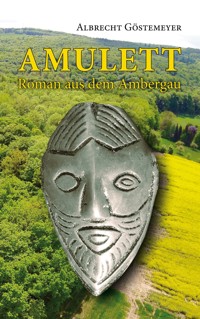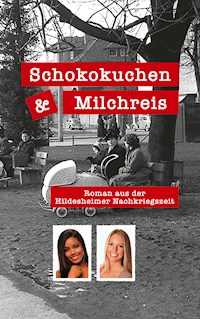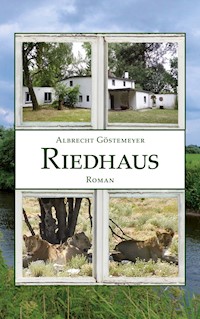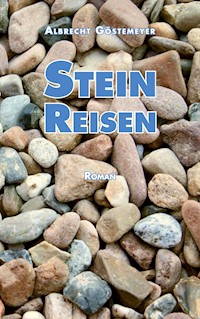
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Freunde Stefan und Hartmut wachsen in einer Provinzstadt auf. Sie unternehmen viel gemeinsam, radeln in die Umgebung und gehen zur Jagd. Im Jahr vor dem Abitur machen sie erste Mädchenbekanntschaften. Nach Wehrdienst und Studium versuchen sie in der Heimatstadt Fuß zu fassen: Stefan als Arzt und Hartmut als Nachfolger im väterlichen Baugeschäft. Doch beide scheitern. Stefan wird Oberarzt in Berlin und Hartmut arbeitet in Köln im Immobiliengeschäft. Eines Tages verschwindet er spurlos. Seine Freundin Elke ist ohne sein Wissen von ihm schwanger und wendet sich verzweifelt an Stefan. Der nimmt sie auf und hilft ihr bei der Geburt und der Betreuung des Kindes. Zwischen beiden entwickelt sich eine Liebesbeziehung. Jahre später erhält Stefan einen Brief von Hartmut. Aus dem Inhalt ergeben sich Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Der Schlüssel ist ein Stein, den Hartmut in seinem Elternhaus aufbewahrt hat. Er ermöglicht Stefan, Hartmut weitab von Deutschland zu finden. Doch der Stein birgt noch ein weiteres Geheimnis, das den Freunden eine Entdeckung von historischer Bedeutung ermöglicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Auftakt
Bärenhöhle
Versuch und Abbruch
Verwirrungen und Irrtümer
Elke
Suche und Einsicht
Sommerfrieden
AUFTAKT
BERLIN, FREITAG, 18. JULI 1980
Die Wärme des Sommertages drang durch die Scheiben, als wolle die Sonne ihre Energie bündelweise in das Gebäude schicken, um ihm einen Speichervorrat für den Winter mitzugeben.
Dr. Manuel Petrowski kannte zwar alle Klimazonen der Erde, doch Wärme in geschlossenen Räumen konnte er nur schwer ertragen. Ein Glück, dass die Blätter der hohen Buchen, die rund um das Institut standen, die Sonnenstrahlen zerstreuten und deren Wirkung milderten. Der Standort des Institutes für Mineralogie der Freien Universität Berlin in der Parklandschaft von Berlin-Dahlem, außerhalb der innerstädtischen Steinwüsten, hell und luftig, war zwar ideal, doch die Sommerhitze musste man im Gegenzug in Kauf nehmen. Die Amerikaner, die an der Finanzierung der großzügig verglasten Betongebäude der Universität beteiligt waren – nicht ganz uneigennützig, denn damit unterstrichen sie ihre Präsenz in Berlin – , hatten leider keine Klimaanlagen spendiert, wie er sie aus dem Süden der USA kannte.
Petrowski schwitzte, unterdrückte sein innerliches Fluchen, zog ein in Pergamentpapier eingewickeltes Brötchen aus seiner Tasche hervor und biss hinein. Der Kaffeeautomat gluckerte hinter seinem Rücken.
Es war die mittägliche Ruhe, inspirierend und gleichzeitig entspannend, die ihn in eine genussvolle Schläfrigkeit versenkte. Manchmal beneidete er seine Kollegen aus der Medizin, denen in ihren Diensträumen ein Bett zur Verfügung stand, wie er wusste.
Der Vormittag war so gelaufen wie immer. Die Morgenvorlesung im kleinen Hörsaal fand vor fast leeren Bänken statt; schade um die Dias, die er in stundenlanger Arbeit mit seinen Mitarbeiterinnen zusammengestellt hatte. Besser sah es im Kurs aus, dessen Beginn um elf Uhr gewesen war. Die Studenten und Studentinnen mussten chemische Aufschlüsse von Mineralien üben, hatten Interesse und waren zudem gezwungen, teilzunehmen, wenn sie ihren Schein bekommen wollten.
Es klopfte.
Petrowski antwortete und eine dünne, fahlblonde Gestalt, Anja Meinert aus der Laborabteilung, trat herein. Sie trug ein Tablett, bestückt mit verschiedenfarbigen Röhrchen und hielt einen mit Seidenpapier eingewickelten Gegenstand in ihrer anderen Hand.
„Sind das die Ergebnisse von dem chemischen Aufschluss?“ Anja nickte.
„Der Papierkram mit den anderen Ergebnissen, Schliffen und Fotografien muss auf Ihrem Schreibtisch liegen. Ihr Kollege Dr. Klausen von der Geologie hat ebenfalls einen Stapel Papier zugeliefert. Offensichtlich ist das ein besonderer Stein. Es gibt auch eine Notiz. Sie sollen sich den Stein noch einmal makroskopisch ansehen, den Zettel habe ich beigeheftet.“
Petrowski dankte ihr, während sie den Raum verließ. Dann ging er zum Schreibtisch und sah die Unterlagen gründlich durch. Zwischendurch nickte er. Nach etwa einer Viertelstunde war er fertig, setzte sich wieder an den Arbeitstisch und wickelte das Seidenpapier auseinander.
Vor ihm lag ein grauer, etwa faustgroßer Gesteinsklumpen. Petrowski schob ihn unter eine Präparierlupe und stellte zwanzigfache Vergrößerung ein. Er betrachtete den Stein, während er ihn drehte und wendete. Plötzlich stutzte er. Er hatte die Angewohnheit, zu sich selbst zu sprechen, wenn er aufgeregt war.
„Merkwürdig“, murmelte er. „Wirklich sehr merkwürdig.“
BÄRENHÖHLE
WESERBERGLAND, FREITAG, 27. JUNI 1958
Die Straße spiegelte auf dem Asphalt und schien auf diese Weise die Entfernung bis zur nächsten Haarnadelkurve zu verlängern. Die Sonne strahlte an diesem Sommertag mächtig und gnadenlos. Peter Neuwirth hatte bereits seit der ersten Steigung begonnen, sein Fahrrad zu schieben, diese Anstrengung trieb ihm das Wasser aus seinem schwammigen Körper. Die Tropfen liefen über das durchtränkte Baumwollhemd nach unten, wo sie sich als Schweißströme in den Hosenbeinen verloren.
Der Ith, wortwörtlich ein Gebirgsstock im Weserbergland – denn von oben betrachtet sieht er wirklich aus wie ein Wanderstock – zeigte seine Steilheit an allen seinen Flanken. Die kleine Gruppe wollte und musste ihn überqueren, um zu ihrem Ziel zu gelangen, der Jugendherberge in einem Ort unterhalb des Berges. Stefan Maienberg, Werner Lieke und Hartmut Müller, alles Schüler der zehnten Klasse des katholischen St. Antonius-Gymnasiums in ihrer Heimatstadt am nahe gelegenen Fluss, hatten Peter längst drei Kurven hinter sich gelassen, doch auch sie mussten absitzen und schieben, bis sie den Kamm des Berges erreichten.
Kamm passte hier genau. Der Ith schob in seiner gesamten Länge mächtige Felsen himmelwärts, manchmal nadelartig, dann massiv und schief gegeneinander gelehnt, wie die Zacken eines alten Kammes, die sich oben aus seinem langen Körper herausstreckten. Neben diesen Felsen standen Eichen und Buchen, manche alt, manche auch krumm und schief. Dazwischen gab es Höhlen, erforschte und nur teilweise erforschte – hier wollten sie nachschauen und erkunden. Dieses Sommerwochenende eignete sich besonders dafür, weil der Sonnabend wegen eines Betriebsausfluges der Lehrerschaft unterrichtsfrei war.
Als Stefan, Werner und Hartmut die Höhe erreicht hatten, warfen sie ihre Räder auf das Gras der Böschung, holten ihre Feldflaschen heraus, tranken und wischten sich den Schweiß von der Stirn. Ein Blick nach rechts führte ihre Augen über eine weite, sonnenbeflimmerte Landschaftsmulde, hinter der sich schemenhaft die Berge des Solling und des Vogler ahnen ließen. Nach kurzer Zeit bog Peter um die Ecke.
„Mach hin, Dicker, wir müssen um sechs in der Jugendherberge sein, sonst lassen die uns nicht mehr rein“, rief ihm Hartmut zu. Peter murrte, schob sich auf den Sattel und fuhr jetzt voraus, den Berg hinab. Die anderen folgten.
Der Wind kühlte sie nun ab, doch sie mussten bei jeder Kurve aufpassen, dass es die Fahrräder nicht von der Straße riss. Das leise klickernde Rätschen der Leerlaufnaben vermischte sich mit dem Geklapper der Radbleche, den Hoppelgeräuschen der Fahrradtaschen und dem zischenden Pfeifen des Fahrtwindes.
Nach einer Weile wurde es langsamer, sie erreichten nun den Waldrand. Vor ihnen lag jetzt eine teils mit halbreifem Korn sich bietende, teils abgemähte Feldlandschaft, die im Hintergrund die Kleinstadt am Rand des Ith zeigte, ihr Ziel. Ein paar Minuten, und sie waren dort.
Sie stellte sich puppig und bieder dar, eine Ansammlung von Fachwerkhäusern, die in ihrer verzweifelten Bescheidenheit schon wieder freundlich wirkten.
Ein berühmter Dichter soll hier geboren sein – die Fahrradler wussten dies nicht, konnten ihn auch nicht erinnern, weil ihre Gehirne seine Romane und Erzählungen, Pflichtlektüre in der Schule, nach hausaufgabenmäßiger Aufnahme beim nächsten Neustart dies und anderes Literarisches unbewusst und gleichsam automatisch gelöscht hatten.
Die Jugendherberge, schlicht und mächtig, überragte den Ort, eine Art Burg der Nachkriegszeit; sie wolle ihn kontrollieren, schien sie zu sagen und es gelang ihr auch, denn die Häuser duckten sich schüchtern unter ihr.
Die Freunde lehnten ihre beladenen Räder an die Wand des Hauses und traten ein. Neben dem Eingang zur Herberge gab es eine Art Büro mit einer schalterartigen Sichtfensterklappe, hinter ihr rührten sich die Burgherren, der Herbergsvater mit seiner Ehefrau; ungehalten traten sie heraus und sichteten misstrauisch die vier unerwarteten und unangekündigten Radfahrer.
Dieses Paar waren die befugten Herbergseltern, adenauersche Korrektheit und wilhelminische Deutschheit ausstrahlend. Die sogenannte Herbergsmutter, in einem Alter rund um die Menopause, sah grottenhässlich aus. Ein Wald von Unreinheiten überzog ihr pferdeähnliches faltendürres Gesicht, als wären die Würmer darüber gelaufen. Zwei dümmliche Augen schauten daraus, hinab auf ihre Schürze, über der sie fortwährend ihre Hände rieb, dabei ab und an ihren Ehemann gläubig anblickend, der dickbräsig neben ihr stand.
Jener war wohl das Pendant zu seiner dürren Frau, ausgestattet mit einem die Hose weit überragenden Bauch. Einen Hals besaß er nicht, erinnerte dadurch an den bayerischen Politiker Franz-Josef Strauß, doch seinen fetten Kopf bedeckte eine Bürste fahlblonder Haare, unter denen sein schläfriges Gesicht die Gruppe ansah.
„Hat jeder von euch einen Jugendherbergsschlafsack mit dabei?“, bollerte er sie an.
„Haben wir.“
Ein Jugendherbergsschlafsack ist ein dünner Baumwollsack unfertigster Art, eine Art Nesselstoff mit sackförmigem Zuschnitt, doch man hat ihn als sein intimes Eigentum und er kann zuhause gewaschen werden. So ist er eine Art letztes Refugium beim Betreten und Beschlafen der Jugendherbergsbetten, die hier zweistöckig in 6er-Zimmern angeordnet waren. Seine Funktion bestand darin, dass man in ihn hineinkroch, bevor man gezwungen war, darüber eine selten gewaschene schwere deutsche Jugendherbergsdecke zu werfen, deren Gebrauch wegen der nächtlichen Kälte leider nicht zu umgehen war.
Die deutsche Jugendherbergsdecke verfügte über eine Vielzahl von Eigenschaften.
Ihre Schwere rührte natürlich aus der Durchdringung mit vielartigen menschlichen Körperflüssigkeiten her – Schweiß, Urin, Darmflüssigkeiten und anderes. Geruchlich wies sie einige Sonderlichkeiten auf, dabei herausragend der Schweiß-, Käsefuß- und eine Art übler Wollgeruch. Optisch lud sie geradezu dazu ein, sich mit ihrem Status auseinanderzusetzen, denn an ihrem einen Ende war der Schriftzug „Fußende“ dick und unübersehbar eingewebt, böse Ahnung erzeugend.
„Ist das wohl bei der Bundeswehr genau so?“, fragte Werner anonym in die Runde, bevor sich alle bemühten, die offensichtliche Lageratmosphäre zu ignorieren, um in den Schlaf zu kommen.
Der nächste Morgen fing an mit einem frühen, gnädigen Wetter und einem ungnädigen Frühstück. Es bestand aus einem auf einen Teller gehäuften Stapel von Scheiben altbackenen Schnittbrotes, begleitet von einem Schmierklacks billiger Margarine und einer Schale Vierfruchtmarmelade, die mehr nach Zucker als nach Früchten schmeckte. Getränk gab es reichlich, kannenweise dünnen Muckefuck. Peter verweigerte.
„Das trinke ich nicht, die haben doch Hängolin da rein getan.“
Ein bösartiges Gerücht, welches sich hartnäckig hielt und in allen Einrichtungen kursierte, wo männliche Jugendliche kaserniert wurden, also Bundeswehr, Internate, Erziehungs- und andere -heime und eben auch deutsche Jugendherbergen, in denen die Nächtigung durch weibliche Gäste sich verhalten gestaltete. Hängolin, dieses Pulver, welches durch die Zufügung in morgendlichen Getränken den maskulinen Geschlechtstrieb dämpfen sollte, damit sich die Beschäftigung mit unangemessenen Gedanken und die Erzeugung von Selbstbefriedigung bei Heranwachsenden in Grenzen hielt, besaß einen gewaltigen Schönheitsfehler.
Eine derartige Substanz gab es nämlich überhaupt nicht.
Hier in der Jugendherberge am Ith hätte man sie ohnehin nicht gebraucht; die tumbe Mehrbettatmosphäre törnte nicht an.
Trotzdem guckte Werner etwas kariert, und auch die anderen konnten nicht ganz vermeiden, dass sich eine Spur von Neid in ihre Gesichtszüge schob. Peter, der „Dicke“, trieb sich zuhause oft mit Mädchen herum, weil beide Elternteile arbeiteten, weswegen die elterliche Wohnung tagsüber oft sturmfrei war – der Glückliche.
Nach dem Frühstück hieß es, sich sofort aufmachen und aufsitzen. Die Vier stiegen auf ihre Räder und mühten sich wieder den Ith hinauf zu ihrem Ziel, der halbwegs erforschten „Bärenhöhle“.
Ein Ziel erfordert Anstrengung, und so war es nur gerecht, dass sich die Vierergruppe mit ihren Fahrrädern wieder den Ithhang hinaufbemühte, auf der Suche nach der Höhle. Der Eingang war nicht leicht zu finden. Neben einer Haarnadelkurve musste man einen Pfad, eine Art Wildwechsel, suchen, der nach etwa 50 Metern zum Eingang der Höhle wies. Sie entdeckten ihn nach kurzer Zeit und gelangten zu einer von Büschen teilweise verdeckten Felsengruppe, in deren Mitte ein schmaler Höhlenschlund direkt in die Tiefe führte.
Sie saßen nun ab und lösten das Gepäck von den Fahrrädern. Stefan und Hartmut schauten auf eine handgezeichnete Karte, die sie in der Schule von anderen Mitschülern erhalten und durch die sie erst von der Existenz der Höhle erfahren hatten.
Bevor man den ersten ebenen Teil der Höhle erreichte, musste man sich ungefähr zehn Meter durch einen engen Kamin fast senkrecht abseilen, so die Beschreibung. Der Dicke hatte deswegen auf die Erkundung der Höhle verzichtet und wollte draußen warten und auf die Räder aufpassen. Die Jungen holten aus einem der Packsäcke ein langes Seil, banden das eine Ende um einen Eschenstamm, der drei Meter neben dem Eingang stand und sicherten es mit einem doppelten Knoten. Stefan und Hartmut schoben ihre Räder in ein etwas weiter entferntes dichtes Gebüsch, denn sie wollten in der Höhle übernachten und sie erst am nächsten Tag verlassen. Werner würde allein nach ein paar Stunden hinaufkommen und mit Peter wieder nach Hause in ihre Heimatstadt zurückfahren, so war es geplant. Den Anfang machte der kleine, dunkelhaarige Werner, schlang sich das andere Ende des Seiles um den Leib und begann mit dem Abstieg, wobei er sich mit den Füßen an den Höhlenwänden abstützte. Zwischen den Zähnen hielt er eine kleine Taschenlampe, mit der er nach unten leuchtete, soweit es ging. Nach etwa zwei Minuten erreichte er eine ebene Fläche und rief nach oben:
„Ich bin da!“
Seine mit einem diffusen Echo gepaarte Stimme erreichte den Höhleneingang und Hartmut machte sich daran, als Nächster hinab zu steigen. Hartmut sah aus wie einer der letzten Germanen: groß, blond und muskulös. Sein kantiges, quadratisches Gesicht verfügte über weit auseinander laufende Kinnseiten und ein ausgeprägtes Kinngrübchen. Im Widerspruch zu seinem athletischen Habitus schienen seine Augen manchmal einen Rest ihm nicht bewusster Traurigkeit zu verraten,
Hartmut packte zu, riss sich eine volle Packtasche über die Schulter, hangelte sich am Seil in das Dunkel und erreichte nach kurzer Zeit den Boden. Stefan, der immer etwas skeptisch wirkte und es wohl auch war, wartete noch einen Moment vor der Höhle.
Äußerlich wirkte er wie eine reduzierte Ausgabe von Hartmut; gleiche Größe, doch viel schmaler, auch im Gesicht, ein Körper mit weniger Muskeln, keinesfalls athletisch. Doch seine Augen, ebenso graublau wie die von Hartmut, wirkten ähnlich und ließen in Bewegung und Ausdruck eine gewisse Verwandtschaft, fast Brüderlichkeit mit ihm erahnen.
„Zieh hoch!“, schallte es herauf.
Das Seil kam und auch Stefan seilte sich ab. Es gab ein schleifendes Geräusch, als er mit dem genagelten Blech der Schuhspitzen gegen den Felsen rieb. Unten erwarteten ihn die beiden anderen mit ihren leuchtenden Taschenlampen.
„Und nun das Gepäck!“, rief Stefan nach oben und ließ das Seil wieder los.
Vor der Höhle knotete Peter nacheinander die restlichen Packtaschen und Rucksäcke an das Seil und ließ sie hinab. Nach zehn Minuten war die Expedition komplett. Die Jungen nahmen das Gepäck auf und stiegen weiter in die Höhle hinab, jetzt auf einem geräumigen Weg, der sich schwach abwärts in die Tiefe wand. Sie hatten zusätzlich ein zweites Seil mitgenommen. Manchmal eröffneten sich Nebengänge, die sie einen nach dem anderen verfolgten, doch es dauerte meist keine zehn Meter, bis sie blind endeten und man auch gebückt nicht weiter kam.
Nach einer Weile öffnete sich der Hauptgang weit zu einem Raum wie eine Halle, deren fast ebener Boden mit Lehm bedeckt war.
„Hier werden wir übernachten“, sagte Hartmut. Er und Stefan packten aus und bauten sich ein Schlaflager, bliesen zwei Luftmatratzen auf und deckten Militärschlafsäcke darüber, deren Oberfläche aus fester, grüner Baumwolle bestand.
Werner half ihnen, indem er ihnen mit seiner Lampe Licht gab. Inzwischen war fast eine Stunde vergangen. Die Jungen machten sich wieder auf den Weg; es ging immer noch abwärts. Nach einer weiteren halben Stunde folgte eine sackförmige Erweiterung, an deren linker Seite sich ein zweiter Kamin öffnete: ein weiteres, fast senkrechtes Loch in die Tiefe.
„Wir wissen nicht, wie weit es bis zum Boden ist“, sagte Werner. „Das Seil können wir nirgendwo hier festmachen.
Wenn wir alle drei auf dem Boden landen und kein Seil mehr haben, sehen wir alt aus. Am besten, ihr lasst mich erst hinunter, ich erkunde und wenn der Kamin nicht zu lang ist, könnt ihr einzeln nachkommen. Zwei müssen aber immer oben bleiben, um das Seil zu halten.“
Hartmut nahm das Seil, welches er um seine Taille geschlungen hatte, sicherte mit Stefan und ließ Werner hinunter. Nach einer Weile schrie Werner „Ihr könnt loslassen!“
Es stellte sich heraus, dass der Kamin nicht sehr lang war, nach fünf Meter erreichte man den Boden. Er mündete in eine weitere kleine, verwinkelte Halle, die ringsum zu mehreren Seitengängen führte. Werner leuchtete alles ab. Aus dem Höhlenlehm ragten kleine spitze Gegenstände hervor, vielleicht Steine oder Knochen.
„Das müsst ihr euch anschauen!“, rief er hinauf.
Nach einer Weile hangelte er sich am Seil aufwärts und machte Platz für Hartmut und Stefan, die sich ihrerseits damit beschäftigten, die geheimnisvolle Halle zu erkunden. Stefan hatte seinen Fotoapparat mit Blitzlicht dabei und fotografierte alles.
Nachher stiegen sie wieder nach oben in die erste Halle; erschöpft lagen sie auf den Luftmatratzen und ruhten sich eine Weile aus.
„Das werden wir nicht mehr schaffen, die Seitengänge in der tiefen Kammer zu untersuchen“, sagte Stefan. „Dazu brauchen wir mindestens zwei Tage und entsprechende Ausrüstung, mehrere Sätze Taschenlampenbatterien und Karbidlampen oder dergleichen.“
„Und überhaupt muss ich jetzt wieder zurück“, erinnerte Werner. „Hier in der Höhle verliert man jedes Zeitgefühl, doch es ist schon Nachmittag, Peter wartet und wir müssen schließlich noch nach Hause fahren, sonst werden unsere Eltern unruhig.“
Nun stieg die ganze Gruppe wieder zum Höhleneingang hinauf. Das lange Seil hing an seiner Stelle, nach kurzem Rufen antwortete Peter. Werner verabschiedete sich und kletterte an dem Seil durch den Kamin aus der Höhle hinaus. Nach ein paar Metern lehnte er sich nach unten – die beiden anderen konnten gerade noch seinen Kopf sehen – und rief:
„Macht keinen Blödsinn! Wir sehen uns noch!“
Hartmut und Stefan gingen zurück in die Halle. Sie zündeten einen Kocher für Trockenspiritus mit ein paar Esbit-Tabletten an, füllten einen Aluminiumtopf mit Wasser aus den Feldflaschen, warfen eine zerbröselte Erbswurst hinein und kochten eine Erbsensuppe. Die warme Suppe reicherten sie mit ein paar mitgebrachten Würstchen aus der Dose an.
Nach der Abendmahlzeit wurden sie schläfrig, krochen in ihre Schlafsäcke und löschten die Taschenlampen. Stefan entzündete eine Kerze, holte sein mitgebrachtes Buch von Hermann Hesse „Der Steppenwolf“ hervor und begann zu lesen. Nach einer halben Stunde fiel es zur Seite. Er konnte gerade noch die Kerze auspusten und zu Hartmut schauen, der bereits wie ein Toter schlief. Die feuchte Kälte der Höhle machte ihnen nichts aus, im Gegenteil, sie erhöhte noch das Wohlgefühl, sich mit dem warmen, durch den eigenen Körper angeheizten Schlafsack zu umgeben, der zudem von den gewohnten eigenen Gerüchen durchdrungen war. So nahmen sie vorerst auch nicht das einzige Ungewohnte wahr.
Nämlich die Schwärze. Das Nichts. Erst am nächsten Tag sollten sie es spüren.
Stefan war es, der erwachte, praktischerweise, denn er besaß eine Armbanduhr mit Leuchtzifferblatt. Ein Blick darauf verriet ihm, dass es kurz nach sechs Uhr am Morgen war; die Höhle schien durchaus ihre Auswirkungen zu zeigen, denn zuhause wachte er regelmäßig erst um sieben Uhr auf und döste meistens noch, bis ihn seine Mutter zum Frühstück und zur Schule trieb. Diese Dösperiode genoss er auch in der Höhle, doch es schlichen sich Erkenntnisse in sein Bewusstsein ein, die er so nicht erwartet hatte.
War es nicht immer so, dass der Tag als Regisseur den Menschen einen Film vorschrieb, den sie seit uralten Zeiten anschauen mussten?
Zuerst die Nacht, schwarz, mit Untermalung durch Träume. Sie beschert den Menschen eine Ruhe im Gehirn, die sie nach dem Tag wohl auch brauchen. Wenn die Menschen sich im Schlaf langweilen, erfüllt die Nacht auch diese Bedürfnisse, schickt kurze Traumfilme, verrückte, liebe, böse, geile, alles was denkbar und meist später nicht mehr erinnerbar ist.
Irgendwann zieht sich der Schlaf zurück und lässt die Menschen aufstehen und die Helligkeit des Tages wahrnehmen. Das erste, was sie dann spüren, ist der Kontakt mit anderen Menschen, körperlichen Partnern, Eltern, Geschwistern oder anderen Personen.
Davon hängt vieles ab. War der erste Kontakt liebevoll, ging man anders mit dem Tag um, als wenn er sich bösartig gestaltete, man aufgescheucht oder sogar mit Vorwürfen überschüttet wurde. Der Tag ist dann dem Werk vorbehalten. Man denkt, arbeitet, egal, ob man Schüler, Arbeiter oder Rentner ist; hier ist jetzt Zäsur. Denn alles dieses gräbt sich ein, bewusst oder unbewusst, ist jetzt meistens erinnerbar. Allmählich und gnädig kommt dann wieder die Nacht mit dem Schlaf und macht alles neu.
Doch in einer Höhle ist das anders.
Stefan hatte im Schlaf gerade besonders schöne, leider auch nicht mehr erinnerbare Träume genossen, als ihn beim Aufwachen nicht die morgendliche Helligkeit, sondern das Nichts, die Dunkelheit, überrannte, völlig ungewohnt, und er erschrak zunächst. Während er zu sich kam, fiel ihm ein, dass er in einer Höhle in den Schlaf gekommen war und er beruhigte sich.
Das Nichts war aber immer noch da. Stefan tastete hin und her, fand die ausgelöschte Kerze und nach einer ganzen Weile endlich die Taschenlampe. Er leuchtete zu Hartmut, doch der schlief noch. Stefan löschte die Taschenlampe, legte sich auf den Rücken und dachte nach, in das Dunkel hinein.
Später zündeten beide die Kerzen an und frühstückten mit dem, was sie in den Packsäcken hatten. Hartmut sagte:
„Bevor wir uns wieder nach oben machen, möchte ich noch einmal in die zweite Kammer steigen. Hast du was dagegen?“ Stefan verneinte.
Also ging es wieder abwärts.
Als sie den Kamin erreichten, blieb Stefan oben und sicherte Hartmut, der eine halbe Stunde in der Kammer blieb, mit dem Seil. Als er wieder heraufgestiegen war, bot er Stefan an, ihn ebenfalls zu sichern, falls dieser auch noch einmal in die Kammer hinab wolle, doch es bestand kein Interesse.
Hartmut sah Stefan mit glänzenden Augen an.
„Schau, was ich gefunden habe!“
Er zeigte ihm einen ovalen, mit Lehm verschmierten Stein, so groß, dass ihn eine Hand bequem umfassen konnte.
„Das ist doch nichts Besonderes!“
„Doch, er ist nicht einfach ein ovaler Kiesel, sondern er zeigt Bearbeitungsspuren, hier an den Rändern. Ich habe den Stein mit Spucke abgerieben und konnte sie dann sehen. Irgendwann müssen schon einmal Menschen hier gewesen sein.“
„Das muss erst einmal bewiesen werden. Du kannst ihn ja mal einem Museum zeigen.“
„Das mache ich auf keinen Fall. Die nehmen ihn mir nur weg. Ich behalte ihn, ganz egal, ob er etwas Besonderes ist. Zu Hause habe ich schon eine Steinsammlung. Von allen außerordentlichen Stellen, an denen ich gewesen bin, habe ich immer einen Stein mitgenommen.“
Das konnte sich Stefan gut vorstellen. Hartmuts Vater gehörte ein aufstrebendes Baugeschäft in ihrem Heimatort. Weil dessen Innenstadt im Krieg zum Teil zerstört worden war, hatte er Aufträge bis über die Kante. Das zwang ihn und seine überlasteten Mitarbeiter, einmal im Jahr den Betrieb mindestens vier Wochen zu schließen. Die Müllers fuhren dann immer in üppigen Urlaub in Luxushotels, nach Italien sowieso, aber auch in andere europäische Länder, Spanien, Frankreich oder Griechenland. Davon profitierte natürlich ihr einziges Kind, ihr Sohn Hartmut. So etwas war für Stefan undenkbar. Auch er war ein Einzelkind, doch die Urlaube seiner Familie beschränkten sich auf gelegentliche Sommeraufenthalte in den deutschen Alpen; mehr als ein Dreibettzimmer in einer Pension in Krün bei Garmisch konnte sich sein Vater als Beamter bei der Stadtverwaltung nicht leisten. Ohnehin fuhren sie in den Sommerferien meist zu Verwandten oder blieben zu Hause.
Beide stiegen jetzt wieder zurück in die Halle und packten ihr Gepäck zusammen. In zwei Etappen wollten sie es zum Eingang schaffen. Doch am Höhleneingang erwartete sie eine unangenehme Überraschung. Das Seil, an dem sie den Kamin heraufklettern wollten, war weg!
Sie schauten sich an, mit einer Mischung aus Ungläubigkeit und Schrecken.
„Das sieht übel aus“, sagte Stefan. „Ohne das Seil kommen wir hier nicht hinaus.“
Hartmut wurde wieder gelassen. „Wir wissen nicht, warum das Seil nicht an seiner Stelle hängt. Das ist jetzt auch egal. Wir werden hier nicht verhungern, denn spätestens morgen wird man uns vermissen. Also können wir damit rechnen, dass morgen im Lauf des Tages jemand, wer auch immer, kommt und ein Seil durch den Kamin wirft.“
„Das hat für uns allerdings zwei Konsequenzen“, erwiderte Stefan. „Erstens müssen wir uns hier am Höhleneingang breit machen, damit wir überhaupt merken, wenn jemand kommt. Zweitens, wir müssen die Taschenlampen schonen, sonst finden wir das Seil nicht. Meine Lampe ist schon schwächer geworden. Wenn wir uns hier endgültig niedergelassen haben, zünden wir die Kerzen an, die brennen noch eine ganze Weile.“
Die Jungen gingen jetzt an die Arbeit, transportierten das restliche Gepäck zum Höhleneingang und bauten sich zwei neue Lager auf, unbequemere, weil sie die Luftmatratzen nur auf einer Schräge mit unebenem Boden ausbreiten konnten. Sie lagen jetzt dicht nebeneinander und mussten aufpassen, dass sie sich nicht den Kopf an der Höhlendecke stießen, wenn sie sich aufrichteten. Im Kerzenlicht teilten sie sich eine Tafel Schokolade; Hartmut, der am Lesen überhaupt nicht interessiert war, versuchte zu schlafen, während Stefan sich weiter mit seiner mitgenommenen Lektüre, dem Buch von Hesse, beschäftigte.
Hartmut war tatsächlich eingeschlafen, während Stefan, gebannt durch das Buch, seine missliche Lage vergaß. Als die Kerze zu flackern begann, zeigte das Leuchtzifferblatt auf fünf Uhr am Nachmittag.
Stefan weckte Hartmut.
„Steh auf, denn wenn du jetzt weiterschläfst, wachst du mitten in der Nacht auf! Wir müssen uns so verhalten, als wenn wir nicht in einer Höhle wären, sonst geht alles durcheinander!“
Hartmut gähnte. „Was soll denn durcheinander gehen?“
„Der Tagesablauf! Wenn wir den nicht einhalten, werden wir in der nächsten Woche zuhause und in der Schule enorme Schwierigkeiten bekommen. Wir sollten uns jetzt so verhalten, als wäre es fünf Uhr an einem beliebigen Tag. Bei uns in der Familie gab es dann immer Tee.“
„Dann mach man.“
Stefan schaffte es, aus den Resten von Wasser und Teeblättern auf dem Esbitkocher ein Gebräu herzustellen, welches beide widerwillig schluckten. Der Kocher brachte genug Licht, sodass sie nicht ihren kostbaren Vorrat an Kerzen und Taschenlampenlicht angreifen mussten.
Danach ging es nur darum, die Zeit in irgendeiner Weise verrinnen zu lassen, denn es gab nun keine Möglichkeiten mehr, sie sinnvoll zu nutzen. Die Jungen unterhielten sich stundenlang über alle Geschehnisse des letzten Vierteljahres in der Schule und in ihrer privaten Umgebung, bis sie wieder schläfrig wurden und sich in ihre Schlafsäcke wickelten.
Doch die Nacht gestaltete sich dieses Mal anders.
Stefan war es wieder, der diesmal um etwa 4:15 Uhr – so zeigte das Zifferblatt seiner Uhr an – aufwachte, wieder in die Dunkelheit starrend. Nach einer Weile wandte er sich an Hartmut. Als er ihn antippte, merkte er, dass Hartmut auch schon wach war.
„Merkwürdiges Gefühl, jetzt schon zum zweiten Mal in der Dunkelheit aufzuwachen, Hartmut!“
„Kann man wohl sagen.“
Stefan sagte jetzt zu Hartmut:
„Geht es dir vielleicht auch so? Ich habe nichts mehr gesehen und gehört, das einzige, was ich noch feststellen konnte, sind meine Gedanken. Es war so, als würden sie wie ein Vogelschwarm durch die reine Luft fliegen, ohne dass Bäume oder Wolken sie verdeckten. Ich konnte jeden einzelnen spüren.“
„Genau dasselbe habe ich empfunden, das ist ein guter Vergleich. Aber bei mir war auch ein großer bunter Raubvogel dabei, der ab und an nach unten stieß und den Vogelschwarm verscheuchte.“
„Raubvögel sind doch gar nicht bunt!“
„Meiner schon, Stefan. Willst du wissen, wie er heißt?“
„Natürlich.“
„Sex.“
Stefan lachte. „Wenn das so ist, kam auch bei mir der bunte Raubvogel vor, nur war er friedlicher. Er flog zwar ebenfalls manchmal durch den Schwarm, zerstreute ihn aber nicht.“ Hartmut musste plötzlich grinsen.
„Kannst du dich noch an die Geschichte mit dem Rückenmark und dem Meyer-Degenhoff erinnern?“
Friedhelm Meyer-Degenhoff war der Religionslehrer ihrer Klasse, traditionell in dieser katholischen Schule auch zuständig für sechstes Gebot und Aufklärung der Schüler. An irgendeinem Vormittag vor einem Jahr hatte er sich vor die Klasse gestellt und ihnen zunächst über den peinlichen nächtlichen Erguss berichtet, der immer die Bettwäsche versaute. Es war mucksmäuschenstill in der Klasse.
Es folgte ein Diskurs über Selbstbefriedigung. Meyer-Degenhoff warnte vor dieser schweren Sünde und betonte, es folge nicht nur die allgemeine Sündenstrafe, sondern auch eine zeitnahe weltliche Strafe.
„Bei häufigem Onanieren läuft nach und nach das Rückenmark aus, das hat zur Folge, dass ihr im Alter kaum noch gehen könnt.“
Hartmut, der sich nicht vorstellen konnte, dass das glibberige Zeugs mit dem Rückenmark in Verbindung stand, war aufgestanden.
„Kann deswegen der Papst so schlecht gehen, dass er immer in einer Sänfte getragen werden muss, Herr Studienrat?“
Die Klasse feixte.
Der Lehrer wurde zornrot, holte aus und gab Hartmut eine knallende Ohrfeige, sodass er fast aus der Bank fiel. Dies bedeutete an sich nichts Besonderes und kam an jedem dritten Unterrichtstag vor, weil Meyer-Degenhoff ein Choleriker war. Es hatte für Hartmut aber kein Nachspiel, denn er wäre niemals wegen dieser Sache vom Lehrer zum Direktor zitiert worden, dafür war sie zu peinlich und zu lächerlich.
Hartmut lachte. „Und ob du es mir glaubst oder nicht, ich wollte nicht fragen, ob der Papst sich selbst befriedigt. Ich wollte mich nur erkundigen, ob das Rückenmark vom Papst allgemein nicht in Ordnung war.“
Das St. Antonius-Gymnasium hatte noch einen weiteren Versuch unternommen, die lästige Pflicht der Sexualaufklärung ihrer Schüler zu meistern, indem es sie an einen anderen abgeschoben hatte.
Ähnlich wie die Eltern der Schüler war die Schule für diese Aufgabe viel zu prüde. Stattdessen engagierte sie dafür einen bekannten Aufklärer, den Jesuitenpater Pereira, der durch die Lande zog, um den Gymnasiasten den Unterschied zwischen männlich und weiblich zu erklären.
Die Massenaufklärung des Paters fand ausgerechnet in der Aula einer Mädchenschule statt, natürlich an einem Nachmittag – so wurden die katholischen Knaben nicht durch den Anblick der Mädchen abgelenkt. Mehr als hundert Schüler hatten sich versammelt, um den Worten des Geistlichen drei Stunden lang zuzuhören.
Es kam nicht viel dabei heraus.
Hartmut bemerkte: „Wie es die Bienen mit den Blüten machen, interessiert mich nicht. Er hätte uns lieber erklären sollen, wie man anständig vögelt.“ Beide lachten lauthals.
„Das meiste kenne ich von dem Dicken und von den älteren Schülern in der Oberprima. Die haben schon Erfahrung, jedenfalls ein bisschen“, sagte Stefan unsicher – und spürte jetzt durch das Dunkel, wie sich das Gesicht seines Freundes zu einem spöttischen Grinsen verzog.
„Das ist nur die Spitze des Eisberges“, dozierte Hartmut langsam und überheblich. „Wenn du wirklich etwas wissen möchtest, musst du die Gesellen in unserer Baufirma fragen, so wie ich das gemacht habe. Die haben richtige Erfahrung und können dir erzählen, was Sache ist. Es liegt daran, dass sie Kontakt mit ganz anderen Mädels haben als wir, die meistens nur mit den Schülerinnen von den Oberschulen herumpusseln. Die sind viel offener und kreischen nicht gleich los, wenn man sie mal anfasst.“
Das Gesprächsthema hielt die beiden noch eine Weile fest, bis sie langsam wieder eindösten.
So merkten sie nicht, wie die Zeit verging. Ein lautes „Hallo“, von einem Echo verstärkt, weckte sie und ließ sie aufspringen. Stefan schrie:
„Wir sind hier unten!“
Kurz darauf fiel das Seil durch den Kamin und klatschte neben ihnen auf den Boden. Beide schalteten jetzt ihre Taschenlampen ein. Stefan kletterte als erster nach oben, während Hartmut die Ausrüstung in den Packsäcken verstaute. Als er sich dem Ausgang näherte, wurde es heller und als er durch das Höhlenloch kroch, blendete ihn die Sonne dermaßen, dass er zuerst die Gesichter der beiden gebückten Personen nicht erkennen konnte, die zu ihm hin schauten.
Es handelte sich um Werner Lieke und Johannes, genannt „Hannes“, Arbeiter und Fahrer vom Baugeschäft Müller, dem Betrieb von Hartmuts Eltern. Als nächstes zogen sie die Packsäcke nach oben, dann verließ zum Schluss auch Hartmut die Höhle.
„Na, ihr Schulschwänzer“, sagte Hannes, „wie habt ihr das denn nun geschafft, uns einen Tag lang in Atem zu halten?“
„Keine Ahnung, wer das Seil hochgezogen hat“, antwortete Hartmut. „Denkt ihr vielleicht, wir wären freiwillig in der Höhle geblieben?“
Hannes und Werner waren mit dem Pritschenwagen der Baufirma gekommen, weil sie die Fahrräder verladen wollten. Als Hartmut und Stefan die Räder aus dem Gebüsch holen wollten, erwischte sie der nächste Schreck.
„Unsere Fahrräder sind nicht mehr da! Jemand hat sie geklaut!“
Alle suchten jetzt weiträumig die Gegend ab, doch sie fanden keine Spur von den Rädern. Hannes meinte, alles passe zusammen, denn die Diebe hätten durch das Hochziehen des Seiles gleichzeitig dafür gesorgt, dass niemand sie kurzfristig verfolgen konnte.
„Wenigstens haben sie das Seil vor der Höhle liegen lassen. Wenn wir es nicht gefunden hätten, wären wir langsam zurückgefahren und hätten euch entlang der Strecke gesucht. Wer weiß, wie lange ihr dann noch in der Höhle gehockt hättet!“
Hartmut und Stefan mochten sich das nicht vorstellen, warfen ihr Gepäck auf die Ladefläche des Pritschenwagens, stiegen auf die Sitzbank, wo sie sich mit Werner und Hannes drängten und fuhren nach Hause.
Hannes setzte Stefan als Ersten vor der Haustür seines Elternhauses ab.
Die Familie Maienberg bewohnte eine kleine, etwas verträumt wirkende Villa am Rand der Stadt, direkt an einem kleinen Wäldchen gelegen. Sie war von Stefans Urgroßvater kurz vor der Jahrhundertwende erbaut und seither in der Familie weitervererbt worden. Vor dem zweiten Weltkrieg hatte die Familie ein Möbelgeschäft in der Innenstadt besessen, das aber von Stefans Vater nicht weitergeführt und verkauft worden war. Der Krieg hatte ihm jeglichen Mut und die Hoffnung genommen, dass es jemals wieder aufwärts gehen könne, denn fast die ganzen Kriegsjahre hatte er an der Front im Osten verbringen müssen. Diese Jahre hatten ihn geprägt; zwar konnte er einer körperlichen Verwundung entgehen, doch seine Seele brauchte noch lange, um sich von den miterlebten katastrophalen Ereignissen zu erholen.
Mit großer Mühe gelang es ihm, in der Nachkriegszeit Jura zu studieren und eine Stelle als Beamter bei der Stadtverwaltung zu finden.
Als Stefan das Haus betrat, erwartete ihn seine Mutter voller Anspannung, schon gut informiert von Werner und Peter.
„Was habt ihr da wieder für Sachen gemacht! Ich dachte, ihr wolltet in der Jugendherberge übernachten, und nicht in einer Höhle!“
„Haben wir ja auch. Aber nur in der ersten Nacht.“
Stefan erzählte daraufhin seine Geschichte. Die Mutter hörte aufmerksam zu, die Anspannung verlor sich und ihr war die Erleichterung anzumerken, dass Stefan nichts Schlimmes passiert war.
„Aber dein Fahrrad ist nun einmal weg und glaub nur nicht, dass dein Vater dir gleich ein neues Rad kauft!“
„Wird mir schon etwas einfallen“, sagte Stefan.
In der Schule hatte sich der Vorfall natürlich herumgesprochen, jedoch gab es keine Sanktionen für Stefan und Hartmut, weil sie einen Tag versäumt hatten. Die Sommerferien würden ohnehin zum Wochenende beginnen und die Lust der Lehrer, jetzt noch neue Unterrichtsstoffe zu behandeln, hielt sich in Grenzen. Zudem hatten sie in den ersten zwei Stunden des Dienstag ausgerechnet bei Wilhelm Krokowski Englischunterricht. Als Krokowski die Klasse betrat, setzte er sich sofort hinter sein Pult und rief Michael Kramer, den Klassensprecher, zu sich.
„Ich bin heute heiser“, hüstelte er. „Der mündliche Unterricht fällt aus. Ihr sollt euch mit euren Hausaufgaben beschäftigen und könnt noch einmal die Vokabeln lernen, die wir letztes Mal durchgenommen haben. Pass auf, dass alle Ruhe halten, besonders die Dummen auf den letzten Bänken.“
Der Lehrer vermied es, die Schüler mit Namen anzureden, denn die konnte er sich nie merken. Die Klasse feixte, wusste sie doch, worum es ging.
Krokowski war schwerer Alkoholiker, was die Schule geflissentlich zu verheimlichen suchte. Dann und wann schlug er so gewaltig über die Stränge, dass er den Weg nach Hause nicht mehr fand. Ein paar Mal hatte man ihn schon aus dem Straßengraben aufpicken müssen und es war nicht zu vermeiden, dass sich dies in der Stadt herumsprach. Am Abend zuvor musste er sich also wieder einmal reichlich die Kante gegeben haben.
Am Nachmittag ging Stefan zu Hartmut hinüber, der ihn angerufen hatte.
Hartmuts Elternhaus mit dem dazugehörigen Betriebshof der Baufirma lag ebenfalls am Stadtrand, nicht weit von der Villa der Maienbergs entfernt. Die Gebäude hatte Hartmuts Vater vor ein paar Jahren errichtet; vorher hatte die Stadt dort ursprünglich eine Siedlung mit Einfamilienhäusern geplant. Müller musste sich lange mit der Stadtverwaltung herumschlagen, bis man ihm den Bau der Anlage genehmigte. Doch es gelang ihm, unter Einflussnahme auf die Ratsherren der Stadt, die Verwaltung auszutricksen und dafür zu sorgen, dass der Bebauungsplan geändert wurde. Ausschlaggebend war seine Drohung, mit seiner Firma in die Nachbargemeinde umzuziehen.
Das machte wiederum den Ratsherren kalte Füße; Müller war einer der größten Steuerzahler der Stadt und hatte auch oft großzügige Spenden geleistet. Außerdem hielt sich die Lärmbelästigung am Ort in Grenzen, denn die meisten Baustoffe wurden nicht auf dem Betriebshof gelagert, sondern gleich von den Handelsfirmen zu den Baustellen gebracht.
Als Stefan an der Tür klingelte, öffnete das Mädchen – Müllers konnten sich eine Hausangestellte leisten – und führte ihn in das Wohnzimmer, damit er dort auf Hartmut warten solle. Stefan schaute sich um.
Das Wohnzimmer war von Hartmuts Mutter nach der zeitgemäßen Mode eingerichtet worden. Ein langer Esstisch aus Teakholz mit dazugehörigen Stühlen auf schrägen Beinen stand inmitten einer großzügigen Essecke, die mit der Küche über eine Durchreiche verbunden war. Der große, winkelförmig angeordnete Raum war sonst nur spärlich möbliert. Außer einem niedrigen, lang gezogenen Büffet, ebenfalls aus Teak, gab es keine weiteren Schränke darin, dafür aber zwei Sitzgruppen, eine vor dem Fenster und eine vor dem Kamin. Die Sitzgruppen bestanden aus je einem Nierentisch, um den herum schalenförmige, pastellfarbene Sessel und eine hierzu passende Couch angeordnet waren. Daneben hatte man Stehlampen mit spitzen, tütenförmigen Schirmen gestellt. Vor dem breiten, zum Garten gerichteten Fenster standen zwei Gummibäume, deren Blätter wie eine seitliche Umrahmung wirkten.
Die Wände des Raumes waren mit einer Tapete beklebt, die ein abstraktes Muster aufwies, ebenfalls in Pastellfarben. Es gab auch eine Wanddekoration, ein Bild eines Clown von Bernard Buffet, sicher eine Massenreproduktion.
Stefan musste sofort an die Inneneinrichtung seines eigenen Elternhauses denken – hier war alles alt, schwere Eichenmöbel aus der Gründerzeit und ein paar gute antike Stücke, die im Lauf der Zeit von den Vorfahren gesammelt worden waren, dazu dunkle Tapeten und Vorhänge.
Das und die verhältnismäßig kleinen Fenster der Villa führten dazu, dass diese Räume einen wesentlich düsteren Eindruck machten als die Räume in dem Neubau der Familie Müller. Stefans Eltern hatten eben die geerbten Möbel in ihren Räumen belassen und nur dazugekauft, was unbedingt nötig war.
Hartmut kam vom Flur herein und begrüßte Stefan.
„Hallo, Alter, hast du unser Abenteuer gut überstanden? Die Fahrräder haben wir verloren, doch ich habe eine Möglichkeit aufgetan, zu neuen Fahrrädern zu kommen.“
„Und wie geht das?“
„Komm erst mal mit.“
Hartmut und Stefan gingen in den Garten. Inmitten des großen, gepflegten Rasens stand eine Sitzgruppe mit Tisch und einer Hollywoodschaukel, die mit geblümtem Stoff bezogen war. Auf der Schaukel saß Rudolf Müller, Hartmuts Vater und schaute voller Genugtuung auf seinen Betrieb, der zu seinen Füßen lag. Vor ihm stand neben einem halbleeren Glas Bier ein mit Kippen gefüllter Aschenbecher, der anzeigte, dass Müller wohl zum Kettenrauchen neigte; gerade zündete er sich eine neue Zigarette an.
Auf dem Betriebshof war nicht viel los. In ein paar Tagen würden die Betriebsferien beginnen und seine Maurer und Hilfsarbeiter begannen nichts Neues mehr, sondern räumten auf und sicherten die Baustellen. Auch Müller hatte nun mehr Zeit als sonst.
Für den Rest des Jahres fehlte sie ihm. Manchmal wusste er selbst nicht, ob seine Anwesenheit und sein geschäftlicher Erfolg gerade hier an diesem Ort ein Glücksfall war oder ein Fluch. Der Ort hatte schon seine Merkwürdigkeiten; für eine Kleinstadt zu groß und für eine Großstadt zu klein, schien er sich gleichwohl zu schämen, wenn es um wirklich große Dinge ging. Vor einem Jahr hätte er fast das Geschäft seines Lebens gemacht. Jenseits des Flusses zur Innenstadt hin wäre es möglich gewesen, ein Geschäftszentrum zu bauen, mit zwei Kinos, einem Restaurant und einer Ladenzeile für die Geschäfte in der Innenstadt, die sich mit den Räumen in ihren muffigen Fachwerkgebäuden begnügen mussten. Leider hatte ihm der Denkmalschutz einen Strich durch seine Vorstellungen gemacht.
Gerade die Kinos schienen ihm ein Garant für den geschäftlichen Erfolg zu sein. Jeden Samstagabend setzte eine Völkerwanderung zu den Kinos ein, denn die wenigen Einwohner mit Fernsehapparat mussten sich mit flimmrigen Schwarzweißsendungen begnügen, die zudem nur zeitweise zu betrachten waren, dann aber häufig live. Höhepunkte waren allein Fußball oder Quizsendungen, das hieß dann Kulenkampff oder Frankenfeld; sonst produzierte man meistens Dokumentarsendungen oder seichte Unterhaltung. Die Sendungen dauerten bis spätestens zwölf Uhr nachts, samstags beendete ein Geistlicher nach abgesprochenem Konfessionsklüngel mit dem „Wort zum Sonntag“ den Abend. Also gingen die Leute nach wie vor in das Kino, hier konnte man sich die aktuellen Filme mit bekannten Schauspielern ansehen, vor allem groß und in Farbe. Also mit dem Kino waren noch Geschäfte zu machen.
Doch die Stadt hatte noch viele andere Vorteile für einen Bauunternehmer. Die Engländer hatten durch ihre Fliegerbomben gottlob eine Menge Löcher in die Altstadt geschlagen, sodass der Lückenschluss noch für eine Weile Arbeit geben würde. Müller war jetzt stolz darauf, dass an dem Gerüst fast jeder zweiten Baustelle ein Schild hing: „Rud. Müller, Bauunternehmen“.
Ein Geschenk – so nahm er es jetzt wahr – waren auch die Flüchtlinge aus den ehemals deutschen Gebieten, Pommern, Sudetenland, Schlesien und Ostpreußen. Die hatten im Osten, ihrer Heimat, fast überall in ihren eigenen Häusern gewohnt und wollten auch wieder Wohneigentum haben. Ihre angeborene Sparsamkeit und ihr Fleiß machten sie zu guten Kunden und das Baugeschäft konnte ihnen dazu verhelfen, freilich nicht in der Stadt, sondern in den Dörfern der Umgegend.
Und dann noch der Wohnungsbau.
Wohnungen wurden massenhaft gebraucht. Die Familien drängten sich in den vom Krieg übrig gebliebenen viel zu engen Wohnungen und brauchten mehr Platz. Müller hatte hier selbst investiert und ihm gehörten einige Wohnblocks, quer über die Stadt verteilt. Natürlich musste man auch hier wie meistens Rat und Verwaltung auf die Füße treten, damit sie genügend viele Grundstücke in den Bebauungsplan aufnahmen.
Im Gegensatz zu dem Vater von Stefan hatte Hartmuts Vater die Kriegszeit ohne größere Unannehmlichkeiten überstanden. Man hatte ihn fast über die gesamten Jahre in Frankreich stationiert, und seine guten Sprachkenntnisse sorgten dafür, dass er mit den Franzosen schnell in Kontakt kam. Später hatte er angefangen, mit ihnen Geschäfte zu machen. Unwillkürlich gewann er dabei Erfahrungen, die ihm zugutekamen, als er kurz nach dem Krieg zusammen mit seinem Vater das Baugeschäft gründete. Hartmuts Großvater, ein einfacher Maurerpolier, wäre von allein nie auf den Gedanken gekommen, eine Firma zu gründen.
Mit den geschäftlichen Entscheidungen hielt er es wie ein Torjäger beim Fußball: geradeaus, möglichst auf kürzestem Weg, alle Bedenklichkeit zur Seite schiebend. Dies führte dazu, dass er stets gezwungen war, eine Gratwanderung zu machen, was seine Skrupel betraf. Natürlich brachte ihm diese Denkweise auch reichlich Feinde ein; deren heftigster war das Finanzamt, mit dem ihn gegenseitiger Hass auf das Tiefste verband.
Auf der anderen Seite führte seine Handlungsweise dazu, dass er mit wenigen anderen Persönlichkeiten der fünfziger Jahre die Wirtschaft der Stadt überhaupt erst anspringen lassen konnte, die sich dann fast explosiv entwickelte. Nicht nur die Arbeitsplätze seiner eigenen Firma entstanden neu, sondern auch die Arbeitsplätze anderer Firmen, die ihn belieferten oder die an seinen Bauvorhaben beteiligt waren.
Als Müller sich auf ein Geräusch hin umblickte, sah er Hartmut und Stefan kommen, begrüßte sie und lud sie ein, sich zu setzen.
„Na, ich kann mir schon denken, warum ihr zu mir kommt.“
„Du hast es wahrscheinlich erraten“, sagte Hartmut. „Wegen der Fahrräder.“
„Das ist überhaupt kein Problem“, bemerkte Müller. „Was braucht man, um zwei neue Fahrräder zu besorgen? Geld. Und wie bekommt man Geld? Durch Arbeit. Und die gibt es bei mir, sogar reichlich. Im Moment zwar nicht, aber nach den Betriebsferien. Wenn ihr eine Weile hier arbeitet, habt ihr die Räder wieder. Ich biete euch zwei Mark die Stunde, viel mehr verdienen auch meine Hilfsarbeiter nicht.“
„Wir hätten unsere Räder aber lieber gleich.“
„Auch das ist kein Problem. Ich leihe euch das Geld für ein Vierteljahr. Wenn ihr in der nächsten Zeit hundert Stunden bei mir arbeitet, sind das für jeden zweihundert Mark, das dürfte für die Räder reichen. Natürlich muss das Geld verzinst werden.“
„Und wie hoch sind die Zinsen?“
Müller schmunzelte.
„So hoch wie zurzeit ortsüblich, also vier Prozent. Wenn ihr innerhalb einer Minute im Kopf ausrechnen könnt, wie viel das bei euch in Mark und Pfennig sind, erlasse ich sie euch.“
„Ist doch ganz einfach“, sagte Stefan. „Vier Prozent für ein Vierteljahr ist ein Prozent. Ein Prozent von zweihundert sind zwei Mark.“
„Gratuliere, stimmt, also zahlt ihr keine Zinsen. Doch nun kommt mit.“
Müller stand auf und ging mit den beiden Jungen zum Büro hinüber, das sich im Eingangsbereich der großen Halle befand.
Als sie eintraten, war Müllers Sekretärin gerade damit beschäftigt, eine Akte in das dem Schreibtisch gegenüber stehende Regal einzuordnen.
Zu diesem Zweck musste sie sich auf die Spitzen ihrer hochhackigen Schuhe stellen, was zur Folge hatte, dass sie sich den Eintretenden von hinten präsentierte, ihren in den engen Rock eingezwängten Po, die Kniekehlen und eine akkurat gerade verlaufende Strumpfnaht über ihren Beinen zeigend. Müller schaute hin, sein Blick verriet eine Mischung aus Interesse und Gier.
„Fräulein Bartels, ich habe Ihnen hier zwei Herren mitgebracht. Meinen Sohn Hartmut kennen Sie, der andere ist der Freund meines Sohnes, Stefan Maienberg. Bitte geben sie ihnen einen Vorschuss in bar, für jeden zweihundert. Das Geld wird im Herbst abgearbeitet.“
„Ist in Ordnung, Herr Müller.“
Die Sekretärin setzte sich wieder an ihren Schreibtisch und lächelte Müller an. Stefan fiel auf, dass dieses Lächeln zu direkt war, um neutral zu wirken.
Später, als sie allein waren, sagte Stefan:
„Hat dein Vater mit seiner Sekretärin…“
„Er hat“, grinste Stefan. „Was meinst du, was los war, als meine Mutter vergangenes Jahr im Mercedes von dem Alten ein Gummi gefunden hat. Gott sei Dank war es noch unbenutzt, sonst hätte meine Mutter das Auto abgefackelt. Fast zwei Wochen lang hing der Haussegen schief wie der Turm zu Pisa. Die Geschichte hat meinen Alten viel gekostet, einen dicken Brilli und zwei Wochen Winterurlaub in St. Moritz.“
Als sie wieder in das Haus der Müllers kamen, saß Frau Müller, die mit ihrem Porsche vom Tennis gekommen war, vor dem Fenstertisch und hatte es sich in einem der Schalensessel bequem gemacht. Vor ihr stand ein volles Sektglas und ein Aschenbecher mit zwei ausgedrückten Zigarettenkippen – hast wohl ähnliche Laster wie dein Ehemann, dachte Stefan.
Todschick sah sie aber aus, Chanelkostüm und hellblonde Haare, die zu einem Farah-Diba-Dutt hochgebunden waren. Die Blondfarbe schien Stefan jedoch nicht von der Natur, sondern vom Friseur zu kommen. Er musste an seine Mutter denken, deren naturbraunes Haar bereits anfing, sich mit grauen Strähnen zu durchsetzen.
Helga Müller fühlte sich offensichtlich gestört, dennoch sagte sie zuckrig:
„Habt ihr euer Abenteuer gut überstanden? Kann ich etwas für euch tun?“
„Nein, Mama“, sagte Hartmut. Die Jungen verschwanden.
Die Schule – sie machte natürlich den Freunden von der Bärenhöhle tagaus und tagein die meiste Mühe und bereitete ihnen auch den meisten Ärger. Die Schule hatte in der Stadt einen guten Ruf: das Gymnasium St. Antonius bezeichnete sich als ein katholisches Gymnasium für Knaben und sein Unterrichtsstil war auch so, manchmal mehr, als ihm gut tat. Im pädagogischen Überschwang hatten die Jesuiten im neunzehnten Jahrhundert neben dem Hauptgebäude des Gymnasiums ein kleines Internat gegründet. Es nahm in der Hauptsache Schüler von außerhalb auf, häufig aus schwierigen Familien, die das Geld übrig hatten, ihre Kinder in ein katholisches Internat zu entsenden und damit zum Teil ihr Gewissen besänftigten. Nebenbei hoffte man, dass aus dem Internat Priester hervorgingen, also verstand man sich als eine Art Priesterzuchtinstitut.
Doch es war ein mieses Gerücht in der Stadt entstanden, scheinbar schon ewig, nicht zu fassen und nicht zu widerlegen:
„Das Antonius-Internat ist eine Brutstätte der Theologie und Homosexualität!“
Es gab eine Reihenfolge der Personen, die das Gerücht kannten: zum einen die betroffenen Schüler selbst, zum anderen die Einwohner der Stadt, dann die Schüler des Gymnasiums, zum Schluss die Lehrer und am wenigsten die Betreuer des Internates, häufig selbst katholische Geistliche.
Man sprach nicht viel in dieser Stadt über derart peinliche Dinge. Man hatte alles wohlgeordnet, die paar Patzer in der Nazizeit fast vergessen – ganz zu schweigen von dem Militarismus der preußischen Kaiserzeit, auf den ein Großteil der Straßen- und Platznamen hinwies und sich darauf konzentriert, eine neue Ordnung zu schaffen, die sich wieder an der alten Ordnung orientieren sollte, das war doch wohl richtig!
Rudolf Müller, der Bauunternehmer, machte sich dagegen kaum Gedanken um solche Dinge. Das passte nicht zum Geschäft.
Alles nahm seinen althergebrachten Lauf. Die Hälfte der Einwohner der Stadt war katholisch, die andere Hälfte evangelisch. Also die Schulen trennen. Von den Katholischen und von den Evangelischen war eine Hälfte weiblich, die andere Hälfte männlich. Also wieder trennen. Ein paar Straßen neben dem Antonius-Gymnasium gab es das Hildegardgymnasium, eine katholische Mädchenschule, von Nonnen geführt.
Im Herbst des nächsten Jahres stand dann aber der Tanzkurs an, die von den Eltern geplante und gewünschte Begegnung mit dem anderen Geschlecht für ihre Kinder.
Tanzstunde – für die Jungen war sie so ähnlich wie egal, für die Mädels fast der Grund für einen Herzinfarkt. Für Hartmut, Werner, Peter und Stefan bedeutete dies, dass die Eltern sich auf den Weg machen mussten, ihren Söhnen das gebührende Outfit zu verpassen, zwei Anzüge, einen für den Tanzkurs, einen weiteren für die Bälle.