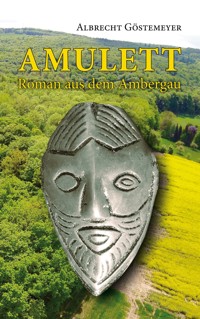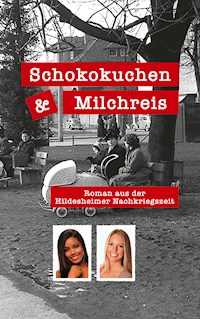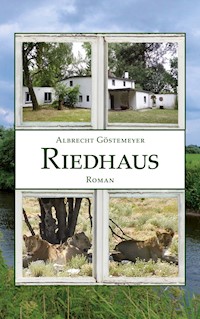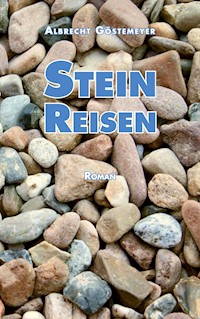Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ratten sind widersprüchliche Wesen. Einerseits standorttreu, wobei sie sich am ehesten an verschlampten, unordentlichen Orten wohlfühlen, andererseits sozial aus Engste miteinander verbunden, was wiederum nach Ordnung geradezu verlangt. Und auch ihre Standorttreue ist relativ: meist sind sie von weither gekommen und scheuen sich nicht, bei Problemen ihren Standort zu verlassen. Sie ähneln den Bewohnern von Berlin Kreuzberg. "Ratten sind die Kaninchen Kreuzbergs!", so bringt es der Delikatessenhändler Norbert gegenüber seiner sternhagelvollen Zufallsbekanntschaft Katharina auf den Punkt. Beide kommen aus dem fränkischen Weinland, einer Gegend, die in ihrer Aufgeräumtheit, Biederkeit und landschaftlicher Schönheit den denkbar größten Gegensartz zu Kreuzberg verkörpert. Doch zunächst landen sie in der Kreuzberger Welt mit ihren skurrilen Typen: dem Maler Till mit seinen beiden Frauen, dem zaubernden Schauspieler Andy, dem Antiquar Rocker Dave, der geheimnisvollen rothaarigen Milla, der temperamentvollen Neapolitanerin Francesca und dem introvertierten Lehrer Dietmar, dessen Verhältnis mit seiner minderjährigen Schülerin Melanie scheinbar nie endet. Aller Aktivitäten verknüpfen sich miteinander und verweben sich zu einem turbulenten Geschehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
BERLIN KREUZBERG, IM HERBST 2009
BERLIN KREUZBERG, IM SOMMER 2010
BERLIN-KREUZBERG, IM SOMMER 2018
WEITERE TITEL VON ALBRECHT GÖSTEMEYER:
BERLIN KREUZBERG, IM HERBST 2009
Wenn man der Hässlichkeit einen Namen geben würde, hieße er Kreuzberg, dachte Norbert.
Wirft gleich zwei Fragen auf: wer ist „Man“ und was ist „Hässlichkeit“?
„Man“ ist überall und doch irgendwie eine irre Figur. Weder männlich noch weiblich, deswegen absolut gendergerecht. Könnte also durchaus gleichgeschlechtlich heiraten, tut Man aber normalerweise nicht. Vielleicht liegt es daran, dass Man von einem historischen Mantel der Spießigkeit umgeben ist, der sie oder ihn schützt, vor allen Vorwürfen, den Behörden, den Politikern, den Kirchen und den Medien. Voller Aufmerksamkeit sehen sie sich das an, was Man tut oder was Man will.
Man hat auch nie was Falsches getan und sich – vor allen Dingen – noch nie schuldig gemacht. Man hat alles wohlwollend mitgemacht, nie die Nazis oder die Kommunisten unterstützt, nie das Finanzamt beschissen und ist alle Jahre zur Wahl gegangen. In der Ehe verhält Man sich vorbildlich, betrügt die Partnerin beziehungsweise den Partner nicht und verprügelt seine Kinder nicht oder verprügelt sie doch, je nach dem Zeitgeist.
Die größte Stärke von Man ist immer sein korrektes Verhalten, angefangen vom Verhalten auf ländlichen Schützenfesten über Familienfeiern bis hin zu Adel oder Politik: stets ist bestimmt, was Man isst, was Man trägt oder wie Man sich zeigt. Ab einer gewissen Stufe trägt Man pinguingleiches Outfit, Mann Anzug und die frauenhafte Version Kostüm mit Feinstrumpfhose oder Hosenanzug. Unverzichtbar das farbige Accessoire Krawatte oder Schal, welchesursprünglich wohl einen Hauch von Individualität verleihen sollte und in Man-gemäßer Weise eher gehorsame Konformität verspricht.
Konformität war eigentlich immer die geheime Sehnsucht von Man. Merkwürdigerweise ist das sogar global, wenn Man nicht gerade Araber ist und Nachthemden und Turban bevorzugt. Im Orient lebt Man eben anders. Norbert Renner ließ seine Gedanken sich kreuzen und zur Einigkeit finden. Sie kamen zum Entschluss.
Man, du bist ein elender Heuchler. Wohl eher ein Blödman. Ein Oberblödman. Er zertritt dir deine Seele. Man würde nie sowas sagen, vielleicht aus Höflichkeit oder schlechtem Gewissen. Mein Freund bist du nicht.
Mit der Hässlichkeit verhält es sich anders. Lass sie uns genießen, sie ist kreativ. Sie ist der Feind des Vollkommenen, und das macht sie sympathisch. Stets ist sie von Schönheit umgeben und deswegen ist sie schön, denn pure Hässlichkeit gibt es nicht. Sonst wäre es keine Hässlichkeit. Das allein Schöne, Vollkommene, ist überaus langweilig.
Norbert Renner konnte sich an eine ehemalige Freundin erinnern, die so hübsch war, als wäre sie einem Hochglanzmagazin entsprungen. Nichts war im Gesamtbild da, was ihn spontan hätte antörnen können, ihr Gesicht war makellos, ihre Figur von weiblicher Schlankheit, die Haare üppig, blond und glatt, die Brüste halbkugelig und stramm, die Beine schlank und rasiert. Er hatte sie in einem Café in der Uhlandstraße kennengelernt, sie schien ihn zu mögen und es schmeichelte ihm, so verabredete er sich mit ihr.
Eines der anschließenden Dates fand auf einer Geburtstagsfeier eines Freundes statt; in vollen Zügen genoss er die neidischen Blicke der anwesenden Männer. Dann lud er siezu einem Konzert von Eric Clapton ein, in die Arena an der Spree genau gegenüber seiner Wohnung, wie hieß die denn damals? O2 oder so, die Arena ist mit ihrem Namen nie einverstanden, denn sie wechselt ihn ständig, muss wohl eine Krankheit von Arenen sein. Annabella – welch passender Name – mochte Clapton und als dieser „Tears In Heaven“ spielte, bekam sie feuchte Augen und rückte an Norbert heran. Der kurze Rückweg über die Oberbaumbrücke führte beide in seine Wohnung und nun schien Vollzug angesagt, er hatte alles eingefädelt, mit größter Sorgfalt. Bloß, es ging erst einmal schief. Nichts war da, kein geiles Begehren, keine Passion, Organversagen. Zum Schluss klappte es doch noch.
Denn als sie nackt auf dem Bett lag, entdeckte er einen Pickel auf ihrem Po und sofort regte es sich, konnte er sich erinnern.
Kreuzberg hat viele Pickel. Einige davon sind liebenswert.
Zum einen seine Bewohner. Früher waren es missmutige Berliner Rentner, jetzt waren sie das, was man Multikulti nennt, Deutsche, Türken, Polen, Russen, Araber, Amerikaner, Österreicher, Schweden, Japaner, Briten und Brasilianer. Sie leben von Arbeit, Nichtstun, Schummelei, Künstlergagen, Beamtengehalt, Prostitution, Eltern, Verwandten, Ladeneinkünften, Drogenhandel, Reichtum, Armut und Sozialhilfe. Also sind sie alle glücklich, jedenfalls meistens.
Pickelig ist auch das Angesicht von Kreuzberg, natürlich hat es reichlich Pickel, anders als der solitäre Pickel auf dem Annabellenpo, der von Makellosigkeit umgeben war.
Das fiel ihm ein, als er von der Arbeit kam und einen abendlichen Spaziergang durch Kreuzberg machte, wiehäufig. Zu seinem Leidwesen konnte er nicht an der Spree entlanglaufen, weil ihr Ufer fast immer durch private Grundstücke zugesperrt ist, was gleich einen Pickelpunkt für Kreuzberg ergibt. Dass es in Kreuzberg entlang der Spree keinen Promenadenweg gibt, ist ein Berliner Kuriosum. Es war der damaligen Grenzsituation geschuldet und da die Spree in voller Breite zum Osten gehörte, hätte der Berliner Senat damals einen solchen Weg zur Spree absperren müssen, ebenfalls mit Mauer oder Draht. Es ist am Gröbenufer, dort, wo er wohnte, vorgekommen, dass Kinder in die Spree gefallen sind und ertranken. Also hieß es, eine zweite Grenze gegenüber der verhassten Grenze zu bauen, und das wollte niemand.
So kam es, dass die Spree von der nächstgelegenen Kö-penicker Straße aus nicht erreichbar ist und von schäbigen Hinter- oder Fabrikhöfen begrenzt wird, auf denen Eisenteile und Bauschrott herumliegen.
Norbert hatte in Wilmersdorf die U-Bahn bestiegen, die in der Nähe des Potsdamer Platzes aus dem Boden kriecht und zur Hochbahn mutiert. Sie ist eine historische Strecke, mehr als hundert Jahre alt und führte ihn zur Station Görlitzer Bahnhof, in einen altertümlichen Glaskasten. Er stieg aus und schaute dem rollenden, donnernden Zug nach. Dann mischte er sich in den eiligen Menschenstrom, der sich über eine Treppe in die Skalitzer Straße entleerte, jeder auf seine Art: die Kinder hüpfend und springend, die Erwachsenen mürrisch und hastend, die Alten mühselig und langsam, auf den Stock und an das Geländer sich stützend.
Es war feucht und windig, Kreuzberger Wetter. Norbert fröstelte und zog seinen Schal fester, als er an der Skalitzer Straße entlangging. Hier war es noch hell, dafür sorgte die Straßenbeleuchtung. In den Nebenstraßen hatte man siereduziert und es galt, aufzupassen, nicht in hündische Kotgranaten zu treten. Ein Schwaden von Geruch nach Fett und Knoblauch streifte ihn; er kam aus der halb geöffneten Tür eines sudanesischen Imbisses.
Überall blinkten Lichter aus Ladenfenstern, manche waren eingetrübt mit Staub. Lichtreklame, Plakate, Ladenschilder wanderten vorbei, eine Kreuzberger Miniwelt aus Kneipen, Imbissen, Friseuren, Nagelstudios, Secondhandshops, türkischen Bäckern, Läden für Kinderspielzeug, Spätkaufs, Cafés und Restaurants. Die Kneipen und Restaurants konnte man allein dadurch orten, indem man über die Bordsteinkanten guckte; Berge von Zigarettenkippen zeigten ihre Nähe an. Ihre Küchen boten preiswertes Essen; türkisch, arabisch, italienisch, spanisch, vietnamesisch, chinesisch, selten deutsch. Kreuzberg schien pausenlos zu essen. Trotzdem sah man nur wenige dicke Leute.
Norbert schaute nach oben. Fast alle Hausfassaden waren beschmiert. Als Graffiti war das nicht zu bezeichnen. Es wäre so etwas wie der Vergleich des Bildes eines Schulkindes mit einem Rembrandt.
Am Lausitzer Platz bog er nach links ab und erblickte auf dem Rasen die Emmauskirche, aus roten Ziegeln erbaut, wie eine Glucke über dem Häusermeer thronend.
Ein Kind spielte auf dem Rasen, ein Mädchen, etwa acht Jahre alt, gut gekleidet. Es hatte einen Ball bei sich, ließ ihn ticken, fing ihn auf. Dann warf sie ihn weg und lief hinterher, um zu sehen, wer schneller war, sie oder der Ball. Was machen Kinder um diese Zeit noch auf der Straße, dachte Norbert und schaute auf seine Uhr. Ach so, wir haben ja Herbst und um diese Zeit ist es schon dunkel.
Der Ball rollte vor seine Füße. Er hob ihn auf und warf ihn dem Mädchen zu. Sie fing ihn auf und schaute ihn an. Aber sie lächelte ihm nicht zu.
Norbert ging weiter. Er umrundete den Lausitzer Platz und verließ ihn, als er die Eisenbahnstraße erreichte. Weitere kleine Kneipen und Geschäfte erschienen, die Menge geschäftiger Menschen nahm zu und verdichtete sich, je weiter er die Straße entlang ging. Nachdem er die Muskauer Straße überquert hatte, kam er zur Markthalle 9. Sie lag vor ihm wie ein wilhelminisches Landschloss mit Säulen, Stuck und Sprossenfenstern und schien aus der Zeit gefallen zu sein, doch hierhin passte sie. Er ordnete sich ein in den Menschenstrom, welcher zum Eingang strebte.
Innen eröffnete sich eine neue Welt aus Läden und Ständen. Gemüse und Obst wechselten ab mit Brot, Backwaren, Fleisch und Fisch, Kunstgewerbe und Haushaltswaren. Ausgefallenes gab es auch: eine Weinhandlung namens „Suff“, ein Laden mit japanischen Spezialitäten, selbstgebrautes Bier und eine Bio-Fleischerei, dazu die üblichen Verkaufsstände mit Delikatessen aus dem Mittelmeerraum und dem Orient. Über allem wölbte sich ein alter Dachhimmel mit verglasten Fenstern zwischen Eisenrahmen und einem Stützwerk von Balken, der den Lärm auffing, der überall erschallte und von den Ziegelwänden reflektiert wurde. Und wieder Essen: einfache Tische mit Bänken gruppierten sich längs der Stände, die Menschen saßen dicht aneinander vor ihren Tellern mit Suppen, Nudeln, Pizza, Döner oder Austern und tranken Wein und Bier.
Kreuzberg ist verfressen, dachte Norbert wieder.
Er kaufte einen Kanten irischen Käse und eine Packung japanischen Tee und verließ die Markthalle.
Kurz hinter ihr wandelte sich das Straßenbild. Läden und Kneipen verschwanden und machten gesitteter Kreuzberger Wohnkultur Platz, sofern Kreuzberg gesittet sein kann. Die Sittsamkeit entspross offensichtlich dem Niedergang durch Kriegsbombardierung; die Altbauten vereinzelten sich, Beton erschien in Form von balkongepflasterten Neubauten, deren Stockwerke andere Häuser überragten, dazwischen Baulücken mit Grünflächen. Eine Entschuldigungsarchitektur, nicht geeignet für die Kreuzberger Merkmale kreative Unrast und wohltuende Aufmüpfigkeit, deren Aufblühen Menschen voraussetzt, die sich in unordentlichen Altbauten wohlfühlen.
Norbert bog nach rechts in die Köpenicker Straße ab.
Die Sittsamkeit verlor sich, der Wohncharakter auch, alles wich lärmendem Durchgangsverkehr, der aggressiv und pfeilgerade durchschoss, weder nach links noch nach rechts schauend. Ein paar vereinzelte Altbauten mit ihren unglücklichen Bewohnern säumten; sonst war zunehmend Kriegsverwundung zu spüren, viele leere Grundstücke, unbebaute oder vernachlässigte Flächen, nicht das gewohnte Kreuzberg. Ein weiterer Pickelpunkt. Er sah zu, dass er schnell weiterkam.
In der Nähe des Schlesischen Tores erschien wieder geschlossene Altbebauung und ließ Norbert durchatmen. Die Räume eines türkischen Boxvereins gesellten sich zu Spätis, kleinen Gemüsegeschäften, einer Bäckerei und Kneipen. Vor der U-Bahnstation verdichtete sich stauend der Straßenverkehr, quoll über und machte es für Fußgänger schwierig, die Straße zu überqueren. Unterhalb der Bahnstation stand eine Menschenschlange vor einem Imbiss, der für frisch gemachte Burger bekannt war; es roch appetitlich, Kontrapunkt zu der Tatsache, dass sich vordem in dieser Örtlichkeit eineToilette befand. Auf der anderen Seite der Straße las man über der Tür eines Eckhauses: „Schlesisches Eck“. Sie war seine Stammkneipe, denn er konnte sie in wenigen Minuten von seiner Wohnung aus erreichen. Er ging hinein.
Eine Mischung aus Menschenstimmen und Punkrock empfing sein Ohr, ein beizender Qualm aus Tabakschwaden seine Augen und dessen Vermischung mit Bier- und Schnapsdunst seine Nase. Die Kneipe war voll, wie meistens. Norbert hängte seinen Mantel auf einen überfüllten Haken.
Um eine eckförmige Theke drängten sich auf Barhockern die Gäste. Auch die beiden Gasträume, nicht groß, waren eckig angeordnet. An sämtlichen Wänden klebten Plakate, meist von alten Rockkonzerten; manche hatte man mit neuen Ankündigungen überklebt. Auf den wenigen freien Flächen wetteiferten Kritzeleien mit Graffiti um den Platz. Neben dem Zigarettenautomaten am Eingang stand ein Regal mit Flyern, ein Teil von ihnen war heruntergefallen und verstreute sich auf dem Fußboden, dessen speckige schwarze Oberfläche offensichtlich einen Teil der Kippen aufnahm, der nicht mehr in die überquellenden Aschenbecher der Gäste gepasst hatte.
Mit seinen zweiunddreißig Jahren gehörte Norbert bereits zu den älteren Gästen, doch er war bekannt und wurde mehrfach begrüßt. Der Wirt hieß Meinolf, war hager, groß und bartlos, hatte lange zusammengebundene Haare, schaute ihn fragend an und hob zwei Finger. Als Norbert nickte, ließ er Bier in ein hohes Bierglas laufen, nahm eine Flasche Wodka aus der Kühlung und schenkte in ein Schnapsglas ein. Alles geschah ohne Worte. Norbert nahm seine Getränke von der Theke und ging zu einem kleinen runden Tischin der Ecke. Hier saßen zwei Frauen. Eine kannte er, es war Milla.
Milla war Stammgast, so wie er. Was sie tagsüber trieb und wo sie wohnte, wusste keiner so genau; wenn sie davon sprach – was selten vorkam – redete sie von einem Bürojob, der irgendetwas mit Digitalisierung und Wirtschaft zu tun haben musste. Sie kam aus Sachsen, hatte ihren Akzent noch nicht gänzlich abgelegt und hieß eigentlich Mathilde, seltener weiblicher Vorname aus den östlichen Landesteilen, in denen man offensichtlich Namen wie Doreen, Mandy oder Chantal bevorzugte. Ihr knallrot gefärbtes Haar, kurz geschnitten, lag ihr wie eine Manschette um den Kopf. Sie hatte einen ansehnlichen vollschlanken Körper und trug meist Jeans und einen enganliegenden dünnen Pullover, der ihre molligen Brüste betonte, heute in rot.
Norbert liebte die ungezwungene Geselligkeit mit ihr; je besser er sie kannte, desto mehr kam sie ihm geradezu heimatlich vor, eine Eigenart der Kommunikation, wie sie nur Stammkneipen erzeugen können. Einen festen Lover schien sie nicht zu haben, war aber durchaus einem kleinen Abenteuer zugeneigt. Einmal hatte es sich bei ihnen beiden so ergeben, es war angenehm und durchaus befriedigend für ihn gewesen – hoffentlich auch für Milla – dachte er, von der Sorte wohltuender Gemütlichkeit, die er manchmal schätzte. Milla wurde zu ihrer Verwunderung häufig von Frauen angebaggert, wahrscheinlich musste sie irgendein lesbisches Schönheitsideal verkörpern, vermutete sie.
Die Frau neben ihr kannte Norbert nicht. Etwas kleiner als Milla, dabei schlank, fast dünn, trug sie löcherige Jeans und ein khakifarbenes T-Shirt. Ihr Gesicht gefiel ihm, ihre Augen wirkten irgendwie zart und so spürte er in ihren Zügen eine gewisse Kindlichkeit, überhaupt nicht zu ihremAufzug passend. Zum Unpassenden trugen in erster Linie die Dreadlocks bei, mit denen sie ihre Haare vergewaltigt hatte. Sie fielen ihr lang um die Schultern und zeigten dunkelblonde, spiralige Mattigkeit, manchmal von blonden Strähnen durchsetzt, als fände hier ein Kampf zwischen Auffälligkeit und Gefälligkeit statt.
„Das ist Norbert Renner“, sagte Milla zu ihr, sich dann zu Norbert wendend, „und das ist Katharina.“
Norbert vermeinte, in diesem Moment in Katharinas Augen ein kleines Aufblitzen zu spüren. Er holte aus der Ecke einen Stuhl und wollte sich neben Milla setzen, die sofort seinen Stuhl fasste und ihn zwischen Katharina und sich schob. Norbert stellt das Bierglas und das Schnapsglas auf den Tisch und stellte fest, dass beide Frauen das gleiche tranken wie er; merkwürdig für Milla, denn meistens trank sie hier Wein, badischen Grauburgunder, einzige Sorte, die der Wirt auf Vorrat hielt und der ganz leidlich schmeckte. Sein Aufzug – schwarze Hose, weißes Hemd – musste zwischen diesen beiden Frauen etwas einfallslos und deplatziert wirken, kam es Norbert in den Sinn. Doch er kam gerade aus seinem Geschäft und hatte wie immer keine Lust gehabt, sich umzuziehen. Hier im „Schlesischen Eck“ wusste man das.
„Katharina kommt wie du aus Franken“, sagte Milla und zündete sich eine Zigarette an.
„Und wie hat es dich hierhin verschlagen?“, fragte Norbert.
„Ich bin da aufgewachsen, wie es dir schon Milla gesagt hat, und habe Weinbau in Gießen und Geisenheim studiert. Vor vierzehn Tagen habe ich mein Studium beendet. Warst du schon einmal in Gießen?“
Norbert schüttelte den Kopf.
„Das lass man auch bleiben. Gießen hat so einen speziellen Charme, der Winkehändchen erzeugt und Abschiede leicht macht. Im Moment möchte ich so etwas wie Leben kennenlernen, Kreuzberg scheint mir dafür eher geeignet zu sein.“
„Ich komme aus Ochsenfurt. Man sagt, von da gehen sogar die Ochsen fort“, Norbert lachte, „im Ernst, ich tue der Stadt unrecht, sie ist eigentlich ganz hübsch, mit Stadtmauer und so. Bloß, sonst ist nichts los und das Leben lernst du da auch nicht kennen, jedenfalls nicht so, wie du es willst.“ Milla unterbrach.
„Ihr unterhaltet euch von einem hohen Ross herunter, das merkt ihr noch nicht mal. Ich, das heißt wir alle, konnten uns in der DDR noch nicht einmal aussuchen, wo wir wohnen wollten. Es war auch letztlich egal. Es war ein Plätscherleben, keine Höhepunkte, vielleicht mal ein Rockkonzert oder ein Besäufnis. Es war eine Gartenfetengesellschaft. Prost.“
Sie stießen an und tranken die Schnapsgläser leer.
Das wird wohl so ein üblicher Kreuzberger Abend mit Versacken werden, dachte Norbert. Irgendwie schienen alle entweder die Nase von irgendetwas voll zu haben oder sie suhlten sich in Euphorie oder es war ein Mittelding von beiden. Letzteres wäre typisch kreuzbergisch.
„Und was machst du hier?“, fragte Katharina. Norbert lehnte sich zurück und zog die Schultern nach hinten.
„Kurze und knappe Antwort: ich lebe.“ Milla ergänzte.
„Er hat ein Geschäft.“
„Und was kauft man da?“
„Feinkost“, sagte Norbert. Katharina war immer noch nicht zufrieden.
„Was für eine Feinkost? Hier in Kreuzberg?“
Norbert merkte, wie sein Wohlbefinden abnahm.
„Schrauben und Nägel. Direkt am Kurfürstendamm.“ Milla lachte schallend und trank ihr Bier aus.
„Er kann es nicht haben, wenn er hier in der Kneipe an seinen Beruf erinnert wird. Mir geht es übrigens ähnlich.“
Norbert drehte sich jetzt zu Katharina und rückte an sie heran.
„Im Ernst, Milla hat recht. Ich arbeite in Wilmersdorf und wohne in Kreuzberg. Übrigens nicht weit von hier. Dass man in Kreuzberg nicht gleichzeitig wohnt und arbeitet, ist fast der Normalzustand.“
Er nahm jetzt Katharinas Geruch wahr. Er wirkte herb und anregend auf ihn; wohl deshalb, weil er wegen ihrer Dreadlocks eher eine Geruchsnote nach staubiger Schmuddeligkeit erwartet hätte.
Der Wirt schaute zu ihrem Tisch herüber und hob fragend seine Augenbrauen. Norbert zückte Zeige- und Mittelfinger, hob und senkte sie dreimal. Der Wirt nickte. Nach einer Weile stand Norbert auf, ging zur Theke und holte ein Tablett mit Bier- und Schnapsgläsern. Sie tranken weiter. Milla zündete sich eine Zigarette an. Katharina ließ nicht locker.
„Wohnst du allein?“ Eine Vorlage für Norbert, genüsslich zu provozieren.
„Du meinst, ob ich Single bin?“
„Das hab ich dich nicht gefragt.“
„Aber gemeint. Also ja. Mach dir trotzdem keine Hoffnungen.“ Katharina reagierte zornig, wahrscheinlich ist sie beleidigt oder fühlt sich ertappt, dachte Norbert.
„Bilde dir bloß nichts ein!“, zischte sie. Bingo.
Milla amüsierte sich. „Über meinen wohnsexuellen Beziehungsstatus hat mir Katharina vorhin auch schon einpaar Fragen gestellt, Entschuldigung, Katharina, das waren keine richtigen Kreuzberger Fragen.“
„Und was hast du geantwortet?“, fragte Norbert.
„Mal so, mal so.“ Sie lachten jetzt zusammen und stießen an.
Es ging weiter, mit Bier und Wodka. Irgendwann wurde Norbert hungrig.
„Ich habe heute Abend noch nichts gegessen. Kommt ihr mit zum Burger gegenüber? Es ist schon elf. Die Warteschlange dürfte sich verkürzt haben.“ Milla stand auf.
„Muss nach Hause. Morgen geht es früh los.“ Sie klopfte auf den Tisch, holte einen plüschigen roten Mantel, zu ihren Haaren passend, vom Haken und ging. Katharina und Norbert standen auf und verließen die Kneipe.
Beim Burgerladen war nicht mehr viel Andrang. Sie mussten nur ein paar Minuten warten, dann waren die Burger fertig. Norbert nahm sie und brachte sie zu einem runden Stehtisch. Katharina fror und sagte es Norbert.
„Können wir die Burger nicht in der Kneipe essen?“
„Hat der Wirt nicht so gern. Er hat wohl Angst, dass dann die ganzen Burgeresser zu ihm hineingehen und seine Kneipe verdrecken. Moment mal.“
Er ging zurück, holte seinen Mantel und zog ihn Katharina über die Schultern. Sie aßen, während über ihnen die U-Bahnzüge hinweg pfiffen und dröhnten. Norbert fiel eine Tomatenscheibe aus dem Burger, segelte auf das Pflaster und gesellte sich zu den Brötchen- und Gemüseresten anderer.
Als sie mit den Burgern fertig waren, gingen sie wieder in die Kneipe. Ihr Tisch war jetzt besetzt, doch an der Theke gab es noch zwei freie Plätze. Sie setzten sich. Norbert kannte seinen Platznachbarn und begrüßte ihn.
„´n Abend, Till!“
„´n Abend, Norbert!“
Till war nicht sehr groß, doch ein voluminöser Kopf saß auf einem schmächtigen Körper. Das Volumen gewann er durch eine üppige schwarze Haarpracht, mit grauen Strähnen durchsetzt, die als Bart sein Kinn umrahmte und als lockige Matte sein Haupt zierte. Eine kleine spitze Nase und zwei listige Augen, garniert mit einer runden Brille, schauten heraus.
„Till ist Künstler, spezialisiert auf Acrybilder“, sagte Norbert zu Katharina. Till schaute Katharina prüfend an. Dann wandte er sich an den Wirt.
„Machste drei kleine Braune, Meinolf?“ Der Wirt nickte. Kurz darauf standen drei Schnapsgläser mit Jägermeister vor ihnen.
„Cheers, habe gerade was verkauft!“ Sie stießen an. Norbert bestellte anschließend drei Bier. Der Vorgang wiederholte sich mehrfach. Über eine Stunde ging es so weiter. Zwischendurch hielt Till einen Monolog über Kunst und Können, sein persönliches Können im Besonderen. Er versäumte es niemals, ihn einer neuen Bekanntschaft vorzutragen, diesmal Katharina; sie hörte interessiert zu, während Norbert, der den Vortrag kannte, schwieg. Von einem Moment auf den anderen sprang Till auf, verabschiedete sich kurz und verließ das „Schlesische Eck.“
Katharina schaute Norbert fragend an. Er schmunzelte.
„Till ist ein besonderer Mensch. Ein lebt und liebt sein Künstlertum, das ihn gerade so über die Runden bringt. Wenn er was verkauft hat, besäuft er sich aus Freude. Hat er nichts verkauft, besäuft er sich aus Frust. Also besäuft er sich fast immer. Till ist übrigens sein Künstlername. Eigentlich heißt er Manfred.“
Mittlerweile war es in der Kneipe etwas leerer geworden. Als Katharina ein Bedürfnis verspürte, rutschte sie von ihrem Barhocker, um zur Toilette zu gehen. Ihr wurde sofort schwindlig und sie musste sich an der Tresenkante festhalten. Norbert sah sie skeptisch an.
„Wird wohl langsam Zeit, dass wir uns auf den Heimweg machen?“
Die Toilettenräume waren ebenso wie das Lokal mit Plakaten und Zetteln vollgeklebt. Der Boden starrte von Schmutz und Zigarettenkippen. Vor dem Waschbecken lagen zerknüllte Papierhandtücher. Als Katharina die Toilettenschüssel sah, ergriff sie Unbehagen. Sie riss zwei Streifen Toilettenpapier ab und legte sie über die Klobrille. Als sie zurückging, merkte sie, dass sie schwankte.
Vor ihren Plätzen standen zwei gefüllte Biergläser. Der Wirt zeigte auf sie und lächelte.
„Scheidebecher!“ Norbert hatte bereits gezahlt. Katharina schaffte es nicht mehr, ihr Glas leer zu trinken. Norbert schaute prüfend zu ihr hin.
„Wenn du dein Glas nicht mehr schaffst, wirst du es wahrscheinlich auch nicht mehr nach Hause schaffen. Wo wohnst du?“
„Oppelner Straße.“ „Die Oppelner Straße ist lang.“
Welche Nummer?“ „Weiß ich nicht. Ich wohne da nur vorübergehend.“
„Wie lange hast du für den Hinweg gebraucht?“ „Eine Viertelstunde.“
„Das wird nicht mehr klappen. Ich mache dir einen Vorschlag, Katharina. Du kannst bei mir schlafen, ich habe Platz. Es sind nur zwei Minuten Weg und ich passe auf dich auf.“
Katharina nickte. Sie stiegen von ihren Hockern, zogen ihre Mäntel an und verließen die Kneipe.
Draußen war es windig. Katharina flogen die Dreadlocks um den Kopf. Sie bogen um die Ecke und gingen in Richtung Spree. In der Bevernstraße lief ihnen eine fette Ratte über den Weg. Norbert deutete auf sie.
„Ratten sind die Kaninchen Kreuzbergs.“
Sie erreichten Norberts Wohnung. Sie lag in einem Altberliner Mietshaus direkt an der Spree, einem der wenigen Häuser am Gröbenufer, eigentlich waren es nur drei. Er schloss auf und half Katharina, zwei Treppen hinaufzugehen, denn seine Wohnung lag im ersten Geschoss.
Als Katharina sie betrat, versuchte sie, sich zu drehen, um sich umzuschauen, doch es gelang ihr nicht. Als sie würgte, schaffte Norbert sie in das Bad, wo sie sich über der Toilette erleichterte. Dann half er ihr in sein Zimmer. Außer seinem Doppelbett befand sich in einer Ecke noch eine Schlafcouch. Er setzte sie auf sein Bett, zog die Couch auseinander, deckte ein Bettlaken über die Sitzflächen und holte eine Wolldecke herbei. Katharinas Oberkörper war auf seinem Bett nach hinten gefallen. Er richtete ihn wieder auf und führte sie zu der hergerichteten Couch. Sie fiel hinein. Er deckte sie zu. Dann ging er ins Bad, zog sich um und ging ins Bett. Er löschte das Licht.
Norbert Renner wohnte seit elf Jahren in Kreuzberg. Gleich nach Abitur und Ersatzdienst war er nach Berlin gezogen, um Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Er kam aus Ochsenfurt am Main, wo er geboren wurde und seine Familie lebte. Sein Vater arbeitete als Geschäftsführer bei einem Automobilzulieferer im nahen Kitzingen, seine Mutter half gelegentlich im Weingut ihrer Eltern in Frickenhausen aus. Er hatte außer einem älteren Bruder noch zwei jüngere Schwestern.
Die Renners besaßen ein ansehnliches Einfamilienhaus mit Mainblick im Stadtteil Kleinochsenfurt, in der Nähe des einzigen Ochsenfurter Weinberges. Obwohl er sich über Kindheit und Elternhaus nicht beklagen konnte, zog es ihn fort aus seiner Heimatstadt, die zwar über touristische Qualitäten hinsichtlich ihrer Lage am Main und einer lauschigen Altstadt verfügte, ihm jedoch letztlich eng und spießig vorkam. So kam es zum Entschluss, Ochsenfurt zu verlassen und nach Berlin zu ziehen. Berlin sei nach der Wende eine spannende Stadt geworden, so hatte er gehört und so erlebte er es.
Der Stadtteil Kreuzberg bildete aufgrund seiner Lage eine Art Nahtstelle zwischen dem ehemaligen Ostberlin und dem alten Westen und schien ihm schon deswegen besonders kreativ und aufregend zu sein; folglich suchte er sich dort eine Wohnung.
Er fand sie im Bergmannkiez, in der Nähe des Chamissoplatzes. Von dort war es nicht weit bis zu den U-Bahnstationen Platz der Luftbrücke und Gneisenaustraße, sodass er die TU Berlin, seine Ausbildungsstätte in Berlin Tiergarten, gut erreichen konnte.
Die Gegend faszinierte ihn. Sie war weitgehend unzerstört geblieben und zeigte ein Bild, wie es sich wohl seit demneunzehnten Jahrhundert erhalten hatte. Nach außen hin wurden die Straßen und Plätze gesäumt von prächtigen Gründerzeitbauten, deren Fassaden derart mit Stuck verziert waren, dass sich keine in ihrer Ausgestaltung wiederholte. Die Wohnungen lagen bei den Vorderhäusern im Hochparterre und drei Etagen darüber; manchmal gab es außen Kellereingänge, die ursprünglich in kleine Läden und Werkstätten geführt hatten. In den Wohnungen lebten früher die besser gestellten Leute, besonders in der ersten Etage über dem Hochparterre, der sogenannten „Beletage“. Doch die Höfe der Häuser waren durchsetzt mit Hinterhäusern, deren Schäbigkeit im Kontrast zu den üppigen Vorderhäusern stand; oft hatte man die Fassaden nicht einmal verputzt, sodass blanke Ziegelwände mit kleinen Fenstern in Erscheinung traten.
In solch einem Haus wohnte Norbert. Die Wohnung war winzig und bestand aus einem Zimmer, einer Schlafkammer und einem vor vielen Jahren abgetrennten kleinen Badezimmer, vorher hatte sie keines. Geheizt wurde mit einem Ofen. Im Winter umwickelte er morgens zwei Briketts mit Zeitungspapier und legte sie hinein, wenn er zur Universität fuhr. Abends glimmte dann der Ofen noch und er konnte ihn wieder schnell in Gang bringen. Der ganze Hinterhof roch penetrant nach Kohle und Brikett.
In den Hinterhöfen wohnten einstmals Arbeiter und Bedienstete. Es gab also in diesem Stadtteil eine Mischung zwischen reich und arm, wichtig und unwichtig, Herren und Dienern. Das war im neunzehnten Jahrhundert sonst unüblich und doch richtungsweisend für Kreuzberg, denn immer noch war sie für diesen Stadtteil typisch. Doch Arbeiter und Bedienstete wohnten kaum noch hier, an ihre Stelle traten vielfach Studenten und Künstler. Reichtum kamdurchaus vor; Banker, Geschäftemacher und Yuppies besiedelten die Penthousewohnungen in den Altbauten. In den großen Wohnungen der Vorderhäuser lebten häufig Wohngemeinschaften.
Doch es gab eine farbige, auch für Berlin außergewöhnliche Kommunikation. Man traf sich oft mit den Nachbarn, veranstaltete Events und feierte gemeinsam. Besonders im Sommer war in den Hinterhöfen und auf den Plätzen ständig etwas los: Livemusik füllte die Luft, Bänke wurden aufgestellt, man grillte und trank. Die Eckkneipen – von denen es allerdings hier, wie im gesamten Berlin immer weniger gab – wurden regelmäßig und häufig besucht.
In dieser Zeit lernte Norbert auch seinen Freund Andreas Beyer, Künstlername „Andy Beier“ kennen.
Andy war Schauspieler, hatte wie die meisten seiner Kollegen kein festes Engagement und kämpfte sich außerhalb gelegentlicher Auftritte mit Nebenjobs durch, meistens in der Gastronomie. Andy war zwei Jahre jünger als Norbert, besaß einen muskulösen, allerdings kleinen Körper und ein ausdrucksvolles, ebenmäßiges Gesicht. Seine schwarzen Haare hielt er kurz geschnitten. Fast an jedem Morgen machte er an einer Teppichstange auf dem Hinterhof seine Klimmzüge, gegenüber von Norberts Wohnung. Er wolle sich fit halten, sollte ihm plötzlich eine Rolle angeboten werden, sagte er zu Norbert.
Die Mädchen mochten ihn. Eine Kette kurzfristiger Freundinnen versüßte sein Leben, und Norbert profitierte oft davon, weil Mädchen immer Freundinnen haben, die er kennenlernte, während er mit Andy unterwegs war. Dafür half er manchmal aus, wenn Andy klamm war; Norbert hatte keine Probleme, denn jeden Monat traf pünktlich das mehr als ausreichend bemessene Geld seiner Eltern ein.Zudem bot Andy allen, die mit ihm zu tun hatten, beste Unterhaltung; er konnte singen, rezitieren und sogar zaubern.
Es war eine lockere und ereignisreiche Zeit für Norbert. Er blieb in den Semesterferien meist in Berlin, arbeitete manchmal mit Andy in Kneipen und gab das verdiente Geld schnell wieder aus, indem er es mit seinen Freunden und seinen wechselnden Mädchen verfeierte. Durch Andy hatte er auch Kontakt mit der Kreuzberger Künstlerszene, die sich in den billigen Wohnungen in der Nähe der Oberbaumbrücke angesiedelt hatte.
Nach dem Examen arbeitete Norbert bei einer Immobilienfirma, die sich auf den Verkauf teurer Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser spezialisiert hatte. Das Erste, was ihn störte, war, dass er sich bei den Außenterminen mit Anzug und Krawatte verkleiden musste, ein Aufzug, den er aus Leibeskräften hasste. Die Besichtigungstermine fanden meist in der Weise statt, dass er betuchte Ehepaare zur Besichtigung durch die Objekte führte. Die hochhackigen Gattinnen, welche mit arroganter Pikiertheit die Räume naserümpfend durchschritten, nervten ihn ebenso wie deren katzbuckelnde Ehemänner. Er kündigte den Job.
Danach trat Norbert eine Stelle bei einer Firma für Steuer- und Wirtschaftsprüfung an. Den ganzen Tag saß er im Büro und ärgerte sich mit Zahlen herum. Diesen Job empfand er als grenzenlos langweilig, blieb aber eine Weile dabei, weil er noch nicht wusste, wohin er seinen Weg richten solle. Und ganz zufällig bot sich ihm eine ungeahnte Chance.
Ein Feinkostladen in Wilmersdorf hatte Insolvenz angemeldet und seine Firma sollte die Abwicklung vornehmen. Norbert fuhr hin. Der Laden lag in der Pfalzburger Straße,unweit des Ludwigkirchplatzes. Die Gegend war beliebt und wurde vom Berliner Großbürgertum bewohnt, darunter auch viele Wohlhabende und Prominente. Bekannte und begehrte Restaurants befanden sich in der Nähe und der Kurfürstendamm war nicht weit. Eigentlich müsste ein Feinkostladen hier funktionieren, dachte Norbert.