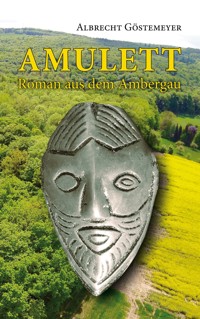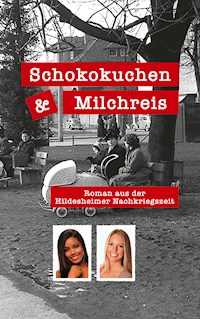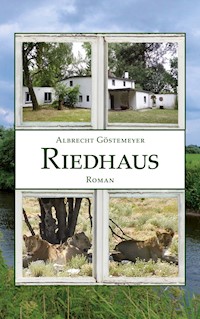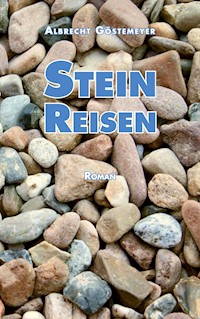Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Student Marcus spielt seit seiner Kindheit Saxophon. In Freiburg, wo er studiert, trifft er auf eine Gruppe von Jazzmusikern, mit denen er öffentlich auftritt. Marcus ist als Einzelkind bei seinem Vater aufgewachsen, seine Mutter hat er kaum gekannt. Plötzlich stirbt sen Vater. Seither plagen ihn Depressionen. Während eines Engagement in einem Pariser Jazzclub lernt er die Sängerin Anna kennen. Im Sommer, als die Musiker durch Südfrankreich touren, kommen Anna und Marcus sich näher. Sie entwickeln eine Spielweise, in der Annas Gesang und das Saxophonspiel von Marcus miteinander verschmelzen. Gleichzeitig gehen sie eine intensive Liebesbeziehung ein. Marcus kann seine Depressionen besiegen. Als sie über ihre Vergangenheit reden, ahnt Anna, dass sie vermutlich mit Marcus nah verwandt ist und verlässt ihn fluchtartig. Marcus spürt sie wieder auf. Beide beginnen, die Vergangenheit ihrer Eltern zu erkunden. Ihre Reise führt sie in die turbulente Zeit Westberlins um 1968. Es ist eine Zeit voller Aufregungen und Gefühle, wie die wirbelnden Klänge des Saxophons.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
PARIS, IM MAI 1996
PARIS, IM JUNI 1996
MALLORCA, IM MÄRZ 1997
KRAKAU, IM HERBST 1997
FREIBURG, IM HERBST 1997, KURZ ZUVOR
PARIS, IM DEZEMBER 1997
PARIS, IM MAI 1996
Langsam ging Marcus die Rue Madame entlang, auf dem Weg zu seinem abendlichen Auftritt.
Er hatte den Koffer mit dem Tenorsaxophon in dem winzigen Raum neben der Bühne des „Saxworld“ hinterlassen, abgeschlossen und an einer Kette mit einem zusätzlichen Schloss befestigt. Es gab eine Vorgeschichte; sein Altsaxophon war nach einem langen und ereignisreichen Wochenende im April verschwunden, futsch, gestohlen oder sonst was. Nicht schlimm, denn er hatte ja noch sein Tenorsaxophon, auch wenn es etwas lästig war, einen Teil der Musikstücke im Kopf jeden Abend von der Tonart „Es“ nach „B“ zu transponieren.
Immer, wenn ihm das „Saxworld“ in den Sinn kam, hüpfte ein kleiner Kobold durch seine Gedankenlandschaft. Claude, der Besitzer, war selbst Saxophonist gewesen und spielte die ganze Reihe durch, vom Baritonsax bis zum Sopranino, deshalb der Name. Dass ein paar Straßen weiter, Richtung Montparnasse, ein Erotikladen mit der Bezeichnung „Sexworld“ aufgemacht hatte, führte des Öfteren zu Missverständnissen und Unstimmigkeiten. Egal, diesen Happen musste Claude eben futtern, dachte er.
Der Gedanke an Sex lenkte ihn ab, er warf ihn beiseite. Seit sein Vater vor kurzem gestorben war, konnte er seine meisten Empfindungen kaum noch steuern. Das war nicht weiter schlimm, solange ihm das noch beim Spielen seines Saxophones gelang.
Nach einer Weile bog Marcus auf die Rue du Dragon ab. Der kalte Sprühregen, ungewöhnlich für den Mai, führte dazu, dass die Menschen gezwungen waren, sich wettergerecht zu bekleiden. Er nahm sie noch ungenauer wahr als sonst. Es begann nun schon, dunkel zu werden.
Die dumpfe Traurigkeit, die ihn sonst von morgens bis abends heimsuchte, fing an sich zu lichten, als er die Stufen zum Saxworld hinabstieg. Er nahm gierig den Geruch des Jazzkellers wahr, sog ihn förmlich auf, diese Mischung aus Alkohol, Mädchenparfüm und Zigarettenrauch.
Claude begegnete ihm auf der Treppe und nickte ihm zu. Er sah aus wie ein lebendes Künstlerdenkmal: schmächtig und dünn; schüttere, lange, graue Haare umhüllten ein schmales, zerfurchtes Gesicht. In seinem linken Mundwinkel steckte wie immer eine Zigarette. Sein Alter war schwer einzuschätzen. Wenn man seinen Erzählungen aus der Pariser Nachkriegszeit folgte, in der er als Kind den legendären Klarinettisten und Saxophonisten Sidney Bechet noch gekannt hatte, musste er die fünfzig längst überschritten haben. Claude konnte auch sehr gut Deutsch sprechen, weil er einmal in Deutschland gelebt hatte.
Das Saxophonspielen hatte Claude längst aufgegeben. Doch er kannte sich mit Musik immer noch bestens aus, wie Marcus an den Blicken merkte, die er ihm und seinen Mitspielern manchmal zuwarf. Als Marcus noch sein Altsaxophon spielte, bekam Claude manchmal sogar glänzende Augen.
Der Laden lief nicht gut. Meist war er nur halb gefüllt. Wäre die Miete für den Keller nicht so niedrig gewesen, hätte ihn Claude schon längst schließen müssen. Traditioneller Jazz, wie er im Saxworld gespielt wurde, war eben keine große Nummer mehr, weder in Paris noch in anderen europäischen Großstädten. Das Publikum bestand aus einer Stammgemeinde, meist männlich, die regelmäßig kamen, und ein paar verirrten Touristen.
Es war für Marcus das zweite Engagement bei Claude in Paris. Der Anstoß dazu kam von Werner, seinem Freund und Pianisten. Werner kannte sich in Paris gut aus und sprach fließend französisch, weil seine Freundin aus Frankreich stammte. Mit Werner hatte er bereits länger zuvor zusammengespielt, während er in Freiburg Jura studierte.
Durch die Verbindung zu Claude und dem Saxworld waren sie auch an ihre französischen Mitspieler gekommen, Louis, ihren Trompeter, Nicolas am Schlagzeug und Vincent, der den Bass bediente. Ihr Engagement im Saxworld sollte mit Unterbrechungen sechs Wochen dauern, danach würden die französischen Sommerferien anfangen und Werners Agent hatte ihnen eine Reihe von Auftritten in Südfrankreich und an der Cote d`Azur vermittelt.
Als er hereinkam, sah er, dass seine Mitspieler schon zur Stelle waren. Marcus ging in den Raum hinter der Bühne, schloss den Instrumentenkoffer auf und nahm sein Saxophon heraus. Das Instrument von der Firma Henri Selmer Paris hatte zwar einen ausgezeichneten Klang, doch es sah durch das jahrelange Spielen nicht mehr schön aus. Auch die Versuche von Marcus, den Goldlack mit Autopolitur wieder zum Glänzen zu bringen, waren erfolglos geblieben. Die Oberflächen des Instrumentenkörpers und der Klappen hatten ein taubes Aussehen und behielten es auch.
Marcus öffnete eine Klappe im Koffer und nahm den Schwengel und das Mundstück seines Saxophones heraus. Er löste die Klammer vom Mundstück und nahm sie beiseite. Aus einem Etui entnahm er ein neues dünnes Bambusblatt und schraubte es am Mundstück fest. Es war in Wirklichkeit kein neues Blatt, sondern eines von vier Blättern, die er bereits ausprobiert und eingeblasen hatte.
Dieses kleine Blatt, einem Bambusrohr aus der Natur entnommen, war die Seele des Instrumentes und bestimmte Ton und Ausdruck. Auch das Mundstück aus Naturkautschuk trug sein Teil bei; das ganze andere opulente Menschenwerk, das gebogene Rohr, der metallene Körper und die Mechanik mit den Klappen leistete nur Hilfsarbeit, indem es die Höhe des Tones bestimmte.
Das zu wissen, faszinierte Marcus. Alles von Menschen Fabrizierte, sei es noch so kompliziert oder spektakulär, entpuppte sich bei diesem Instrument als Beiwerk. Entscheidend für den Ausdruck des Saxophones waren allein die beiden kleinsten Teile, die aus natürlichen Rohstoffen bestanden.
Er nahm jetzt das fertig montierte Tenorsaxophon, hängte es sich um den Körper und ging zur Bühne hinaus.
Louis, den Trompeter, Nicolas und Vincent begrüßte er mit Handschlag. Werner nickte ihm nur kurz zu, denn sie hatten sich tagsüber schon gesehen. Auf solche Formen legten alle mittlerweile großen Wert. Es kam häufig vor, dass es in der Band knisterte und es stellte sich heraus, dass es gerade die äußere Form war, die sie in gewisser Weise zusammenhielt und eine Brücke zur Versöhnung darstellte.
Louis schaute ihn an.
„Du kommst spät, Marcus. Hast du gestern gesumpft?“
„Kein Stück. Frag Werner!“
Marcus wohnte in Paris mit Werner und seiner Freundin Danielle zusammen. Ihr Agent hatte ihnen eine kleine Wohnung in der Nähe des Jardin du Luxembourg verschafft. Die Wohnung war ein Teil der Gage; zusätzlich bekamen sie von Claude noch ein Taschengeld für Essen und Trinken. Mehr gab es nicht, das konnte Claude sich nicht leisten.
Ein Problem für sie war die gegenseitige Kommunikation. Es herrschte sozusagen babylonische Sprachverwirrung. Marcus sprach so gut wie kein Französisch; Nicolas und Vincent sprachen dagegen nur Französisch, überhaupt kein Deutsch und fast kein Englisch. Louis und Werner waren die großen Ausnahmen, die beide Sprachen fließend beherrschten und daher häufig moderieren mussten. Louis kam aus dem Elsass und sah im Gegensatz zu den beiden kleinen und schwarzhaarigen Mitspielern Vincent und Nicolas überhaupt nicht aus wie ein Franzose.
Er verfügte über eine große, in den Schultern etwas gebückte Statur. Sein etwas faltiges Gesicht hatte er mit einem breiten Schnauzbart angereichert, über dem sich eine lange und spitze Nase erhob. Wegen seiner Kurzsichtigkeit musste er stets eine Brille tragen. Sein dunkelblondes Haupthaar ragte ihm spitzwinklig in die Stirn und begann bereits, Geheimratsecken zu bilden.
Werner schlug ein paar Töne auf dem Piano an und besprach mit seinen Kollegen die Reihenfolge der Stücke für den heutigen Abend. Für die musikalischen Arrangements waren er und Marcus zuständig; das brachte den beiden Deutschen den Vorzug der Unentbehrlichkeit ein. Doch damit mussten sie sehr sensibel umgehen.
Claude hatte schon den Bierhahn geöffnet, ein paar Liter durchlaufen lassen und war nun damit beschäftigt, die Tische zu kontrollieren und die Stühle zurecht zu rücken. Catherine, die Bedienung, kam aus der kleinen Küche hinaus und band sich die Schürze um. Die Zeiger der Uhr über der Theke zeigten auf Viertel nach neun. Sie hatten noch Zeit, denn vor halb zehn würde kaum jemand kommen.
Als plötzlich die Tür aufging und zwei ältere Damen sich suchend umschauten – vermutlich amerikanische Touristinnen – pfiff Claude durch die Zähne. Die Musiker verschwanden in dem kleinen Raum hinter der Bühne. Claude konnte es nicht leiden, wenn die Musiker sich auf der Bühne herumtrieben, wenn der Laden noch nicht gefüllt war.
Als Louis sich eine Zigarette anzündete, protestierte Werner, der Gelegenheitsraucher.
„Lass das sein, das Gequalme in dem kleinen Kabuff! Wir müssen alle deinen stinkigen Rauch mit einatmen!“ Nicolas und Vincent warfen sich belustigte Blicke zu. Louis knurrte Werner an.
„Und wo soll ich sonst rauchen? Auf der Bühne geht gar nichts, das will Claude nicht!“
„Dann rauch gefälligst auf dem Klo!“
Das Ritual wiederholte sich in dieser oder ähnlicher Form fast jeden Abend.
Nicolas öffnete die Tür einen Spalt und schaute in den Keller.
„Ihr werdet es nicht glauben! Der Laden ist fast voll!“ Nach einer Weile hatte Claude ihn bemerkt. Nicolas drehte sich um.
„Wir können anfangen. Claude hat mir zugewinkt.“
Die Musiker nahmen ihre Instrumente und gingen auf die Bühne. Plätschernder Beifall erhob sich. Es war wichtig, dass sie gleich zu Anfang einen „Knaller“ spielten, ein lautes und schnelles Stück. In diesem Fall war es der „Royal Garden Blues“. Claude hatte ihnen eingeschärft, dass sie die erste Stunde ohne Pause durchzuspielen hatten und in dieser Zeit auch die bekanntesten und beliebtesten Stücke spielen sollten. Gerade die erste Stunde war wichtig, weil jetzt die Gäste den Keller betraten und mit einem Blick entschieden, ob sie bleiben oder den Laden wieder verlassen würden. Es gab dann nichts Schlimmeres als eine leere Bühne, oder noch schlimmer, eine Bühne mit Musikern, die nicht spielten, sondern herumlungerten. Werner begrüßte die Gäste kurz, dann legten sie los.
Marcus behielt die Tür im Blick. Er hatte die Gäste in Kategorien eingeordnet und konnte genau den Typus Gast bestimmen, der gerade hereinkam. Die Zögerlichen, die nur einen Schritt aus der Tür traten und sich umschauten, waren Einheimische, die noch nie dagewesen waren. Bei denen, die in den Keller hineingingen und hilfesuchend um sich blickten, handelte es sich um Touristen. Meist kamen sie mit mehreren Personen. Es gab auch Gäste, die den Keller forsch betraten, mit einem zielstrebigen Ausdruck im Gesicht, und sofort nach freien Plätzen Ausschau hielten. Das waren die Stammgäste – wobei dies lediglich bedeutete, dass sie schon einmal dagewesen waren.
So ungefähr nach einer Dreiviertelstunde begann bei Marcus die Spannung in den Lippen nachzulassen. Er sah sich nach Louis um und bemerkte, dass es ihm wohl ebenso ging. Ein Blick zu Werner veranlasste diesen, seine Klaviersoli etwas auszudehnen. Vincent spulte sein erstes Basssolo an diesem Abend hinunter. Zum Schluss donnerte Nicolas noch ein Schlagzeugsolo in den Keller. Auf diese Weise entlasteten sie die beiden Bläser.
Alles, was auf der Bühne passierte, wurde durch kurze Blicke der Musiker untereinander gesteuert. Deswegen war der ständige gegenseitige Blickkontakt äußerst wichtig. Es kam vor, dass der eine oder der andere unkonzentriert war, weil sein Blick beispielsweise an einem Mädchen im Publikum festhing. Das brachte ihm dann unweigerlich Kollegenschelte ein.
Die Stunde war vorbei. Das Publikum hatte anständig Beifall geliefert. Die Musiker verschwanden im Hinterraum.
„Eine Viertelstunde noch, und mein Ansatz wäre im Arsch gewesen“, sagte Marcus.
„Musst eben noch tagsüber zusätzlich üben, dann hält er länger“, bemerkte Louis, „aber ich will mal gerecht sein. Meinem Ansatz ging es heute auch nicht besser.“
Marcus hätte jetzt sagen können, dass seine Probleme daher kämen, dass Louis viel zu laut blies, aber er hielt lieber seinen Mund. Werner beschwichtigte.
„Wir sind eben keine Profis, das wisst ihr alle. Es geht aber auch so. Hauptsache, das Publikum ist zufrieden, und das war es ja.“
Nicolas grinste.
„Claude kann sich ja Profis in seinen Laden holen, wenn er möchte.“
„Dann muss er aber vorher noch im Lotto gewinnen“, feixte Louis.
Alle lachten.
Die zweite Runde begannen sie mit etwas betulicheren Stücken, alten Standards wie „Baby won´t you please come home“ und „Mood Indigo“ von Duke Ellington. Zwischendurch lieferten Marcus, Werner und Louis ein paar maßgeschneiderte Solostücke ab. Marcus ließ seine Augen schweifen und erblickte zwei Mädchen, wie sie zur Tür hereinkamen. Kategorie zögerliche Erstbetreter. Sie setzten sich auf Plätze in der Nähe der Bühne, die gerade frei geworden waren. Beide gefielen ihm.
Das eine Mädchen war mehr ein dunkler Typ mit fast schwarzen Haaren, die ihr lang herunterfielen. Ihr Gesicht beeindruckte; es wirkte lachend und temperamentvoll, obwohl es für seinen Geschmack etwas zu viel Schminke trug. Sie könnte eine Italienerin oder Südfranzösin sein, dachte er.
Das andere Mädchen trug seine dunkelblonden Haare hochgesteckt, in einer hübschen, dekorativen Weise. Er schaute sie jetzt ganz bewusst an. Sie war groß und etwas mollig. Doch es war eine edle Molligkeit, so, als hätte sich nur eine Spur von Weichheit über einen sonst muskulösen Körper gelegt. Dass sie durchtrainiert war und vermutlich Sport trieb, hatte er an ihrem Gang und ihren Bewegungen gemerkt.
In dieser Beziehung durfte er an sich gar nicht denken. Mindestens zehn Kilo trug er zu viel mit sich herum, und Sport kannte er nicht.
Beide Mädchen waren anregend zurechtgemacht, mit engen Jeans und ebenso engen, ausgeschnittenen Tops. Sie hörten der Musik aufmerksam zu und applaudierten ordentlich, als die Runde zu Ende war.
Als die Musiker nach der Pause wieder hereinkamen, stand das blonde Mädchen an der Bühne und sprach Marcus an. Sie wirkte schüchtern.
„Ich habe vorhin an deiner Stimme gehört, dass du wahrscheinlich Deutscher bist. Ich komme aus der Nähe von Frankfurt und heiße Anna Schäfer. Ich habe eine Bitte. Kann ich bei euch mal ein Stück mitsingen?“
Marcus schmunzelte.
„Kommt darauf an, was du unter „kann“ verstehst. Wollen wir mal so sagen: wenn du es kannst, dann kannst du. Ich spreche mit meinen Kameraden in der nächsten Pause darüber und sage dir Bescheid. Hast du schon mal irgendwo vor Publikum gesungen?“
„Ich hab mal in Frankfurt für eine Weile in einer Swingband gesungen“, sagte sie leise. „Die hat sich aber im letzten Jahr aufgelöst.“
In der nächsten Pause sprachen sie darüber.
„Wir haben hier einen Singezahn, der möchte einsteigen“, sagte Marcus.
„Singezähne sind entweder hübsch oder können singen“, warf Werner ein. „Beides zusammen ist selten. Dieses Mädchen ist hübsch, und wenn es dazu noch singen könnte, wär es ein Treffer. Also wollen wir?“ Louis, Nicolas und Vincent nickten.
„Dann hol sie herein“, sagte Werner zu Marcus. Marcus ging hinaus, kam zurück und brachte Anna mit, die sich vorstellte.
„Was möchtest du denn mit uns singen?“, fragte Werner.
„Ich dachte an „All of Me“ oder so was“, antwortete Anna. Alle guckten sich vielsagend an. Es kam nicht selten vor, dass sich während eines Auftrittes ein Mädchen meldete, welches mitsingen wollte. Wenn man es dann fragte, an welches Stück es denke, kam meistens „All of Me“. Der zweite Renner war „Summertime“ von Gershwin. Das lag daran, dass dies Stücke waren, die fast jeder Musiker, jedenfalls fast jeder Jazzmusiker, kannte und konnte.
„Also gut, dann All of Me“, sagte Werner. Sie gingen auf die Bühne. Werner moderierte auf Französisch.
„Verehrte Gäste, wir haben hier eine junge, begnadete Sängerin, die hier bei uns eine Probe ihres Könnens abliefern wird. Applaus für Anna Schäfer!“ Anna wurde rot.
Sie starteten. Marcus und Louis spielten ihren Eingangssatz und stellten damit das Thema vor. Beim vorletzten Takt nickte Werner Anna zu. Die Bläser schwiegen und Anna sang. Überraschend gut. Sie hatte eine kraftvolle und trotzdem weiche Stimme. Die Stimme ist genauso wie ihr Körper, dachte Marcus. Gegen Ende der Strophe flüsterte er ihr zu: „Noch eine!“ Und Anna sang weiter.
Zu ihrem Erstaunen sang sie sogar den Originaltext der zweiten Strophe, den sonst keiner von ihnen kannte. Zum Schluss fielen die Bläser wieder ein. Anna bekam Zwischenapplaus, bedankte sich mit einer Geste und setzte sich wieder auf ihren Platz.
Als die Runde vorbei war, sagte zunächst niemand der Musiker etwas. Werner erhob sich schließlich und ging zu Anna.
„Das hast du wirklich sehr schön gemacht!“ „Danke.“ Anna wurde wieder etwas rot. Werner schaute auf die Uhr. Es war Mitternacht. Sie würden jetzt noch zwei Runden spielen, dann war ihr heutiger Auftritt wohl beendet.
Die Mädchen blieben bis zum Schluss. Als sie zur Tür hinausgingen, rief ihnen Marcus hinterher:
„Kommt doch mal wieder, wir freuen uns!“ Anna drehte sich um und lachte jetzt. Claude räumte hinter der Theke auf. Louis zündete sich eine Zigarette an. Nach einer Viertelstunde stiegen alle die Treppe hinauf. Catherine war schon längst gegangen und Claude schloss die Tür zum „Saxworld“ ab.
Sie gingen die Rue de Dragon entlang und bogen nach fünf Minuten in eine rechte Seitenstraße ab. Etwa nach hundert Metern erreichten sie ein Bistro, hinter dessen verschlossener Tür schwaches Licht leuchtete. Als Claude an die Tür klopfte, drehte sich ein Schlüssel im Schloss und die Tür öffnete sich, sodass sie eintreten konnten. Marcel, der Wirt hatte bereits einen Tisch für sechs Personen gedeckt und Flaschen mit Rotwein dazu gestellt.
Die Konzentration von mehr als drei Stunden fiel von ihnen ab wie herbstliche Blätter vom Baum. Sie lehnten sich an ihre Stühle, räkelten sich zurecht und zündeten sich erst einmal Zigaretten an, diesmal auch Werner. Der Wirt brachte einen Topf voller Essen, heute köstliches Boeuf bourguignon. Das Bistro, mehr wie eine Bierkneipe aussehend, bot jeden Abend nur ein wechselndes Gericht an, von dem immer genug für die Musiker übrigblieb. Den Wein und das Essen zahlte Claude, der zwischen ihnen saß und sich genauso entspannte wie sie. Das war eine Sonderleistung, die er wegen der kümmerlichen Gage freiwillig bot.
Sie schwatzten und aßen, der Rotwein floss. Marcus genoss das Wohlgefühl, welches sich stets zu dieser Zeit einstellte.
Morgen, wenn der Rausch verflogen war, würde er wieder nach dem Aufwachen im Bett liegen bleiben und grübeln. Morgen würde ihn wieder die alltägliche, gewohnte Freudlosigkeit beschleichen. Bis zum Abend. Bis er sein Saxophon wieder in den Händen hielt.
Die erste Erinnerung von Marcus, die aus dem Nebel seiner Kindheit auftauchte, war die Figur seiner Mutter.
Es war mehr eine abstrakte, weniger eine figürliche Erinnerung; etwas Buntes, Huschendes strich an ihm vorbei. Auch eine liebevolle und fröhliche Stimme konnte er noch wahrnehmen, die jedoch immer leiser wurde und echoartig verklang.
Erst danach tauchte die Figur seines Vaters auf, ein ernstes, ihn musterndes Gesicht und Finger, die über seine Wangen glitten. Die Figur des Vaters wurde immer deutlicher. Er hatte einen weißen Kittel an.
Es gesellte sich zu ihnen eine weitere weibliche, auch liebevolle Figur. Sie gehörte zu Tante Lore, der Haushälterin des Vaters, die ihn aufgezogen hatte. Die Figuren wurden jetzt ganz deutlich und traten zurück, dafür erschienen Räume mit Bildern, Möbeln und Spielzeug, die Räume seines Elternhauses. Es war eigentlich kein Elternhaus, sondern ein Vaterhaus.
Dr. Robert Kramer praktizierte als Arzt für Allgemeinmedizin am Stadtrand von Hannover. Das Haus in Kirchrode, die Heimat, war alter Besitz der Familie Kramer und wurde von seinem Vater, seiner Großmutter und ihm bewohnt. Der Großvater hatte den Krieg nicht überstanden und seine Großmutter war bettlägerig, solange er zurückdenken konnte. Kurz nachdem er eingeschult wurde, verstarb auch sie. An seine Tränen konnte er sich noch erinnern. Es gab ein paar weitläufige Verwandte, keine direkten, denn sein Vater war ein Einzelkind gewesen. Mit der Verwandtschaft seiner Mutter hatte er nie Kontakt gehabt. Vielleicht lag es daran, dass die Mutter den Vater früh verlassen hatte, als Marcus noch ein Kleinkind war. Angeblich sollte sie nicht mehr am Leben sein, hatte ihm der Vater eines Tages gesagt.
Seine Kindheit war trotzdem gut und vertrauensvoll gewesen. Sein Vater, obwohl tagsüber an seinen Beruf gebunden, konnte ihm dennoch die Zuwendung und das sichere Nestgefühl geben, das er brauchte. Jeden Abend wurde zusammen mit Tante Lore zu Abend gegessen und sein Vater brachte ihn regelmäßig zu Bett. Tagsüber war die Haushälterin für ihn da. Ihm fehlte nichts.
Der Vater führte eine sehr erfolgreiche Praxis, sodass es ihnen finanziell gut ging. Zum Glück schaffte er es, mit nur wenigen Hausbesuchen auszukommen und hatte auf diese Weise ausreichend Zeit für Marcus. Es kam häufig vor, dass Marcus ihn in der Praxis besuchte. Als er ihn eines Tages fragte, was seinen beruflichen Erfolg ausmache, lachte der Vater.
„Das liegt daran, wie ich mit den Krankheiten umgehe. Die meisten Krankheiten zeigen einen wellenförmigen Verlauf, Marcus. Denk mal an eine typische Infektionskrankheit wie eine Erkältung. Sie entsteht aus dem Nichts, zunächst mit etwas Halsschmerzen. Später kommen weitere Symptome dazu wie Schnupfen, Husten und Fieber. In dieser Anfangszeit kannst du gar nichts machen, höchstens die Beschwerden lindern.
Sie werden trotzdem zunehmen; der Patient wird nun ungeduldig und verlangt von dir, dass du ihn heilst. Das geht nicht, also überweist du ihn mit Verdacht auf Lungenentzündung an einen Spezialisten, beispielsweise an einen Arzt für Innere Medizin. Doch der kann auch nichts machen und schickt dir den Patienten zurück.
Die Krankheit hat nun ihren Höhepunkt erreicht, sozusagen den Scheitelpunkt der Welle. Das Abwehrsystem des Patienten hat den Feind in seinem Körper erkannt und beginnt, ihn auszurotten. In diesem Moment schlägst du zu. Du gibst dem Patienten irgendein einfaches Medikament, welches keinen Schaden anrichtet. Jetzt wird es automatisch besser, wäre es aber auch ohne Medikament geworden. Irgendwann verschwindet die Krankheit wieder.
Der Patient wird begeistert sein, denn er denkt, du habest ihn geheilt.
Diese Methode erklärt übrigens auch die Erfolge der Homöopathen und Heilpraktiker. Es kommt darauf an, zum richtigen Zeitpunkt einzugreifen, nämlich dann, wenn der Höhepunkt der Krankheit erreicht ist. Auf diese Weise wirst du immer Erfolg haben.
Natürlich trifft das nicht auf jede Krankheit zu. Krebs zum Beispiel hat keinen wellenförmigen Verlauf, sondern führt oft in einer gerade absteigenden Linie zum Tod. Das muss man wissen. Doch für die meisten anderen Krankheiten gilt das, was ich dir zuvor gesagt habe.“
Marcus war sehr beeindruckt.
Der Vater führte auch eine ausgesprochen zuwendungsbereite Praxis. Die soziale Herkunft seiner Patienten war ihm egal. Er liebte kein Schickimicki und behandelte ohne Ansehen der Person, und er machte keinen Unterschied zwischen Kassen- und Privatpatienten. Marcus schätzte ihn deswegen.
Als Marcus älter wurde, fuhren sie regelmäßig zusammen in den Urlaub. Oft ging es nach Italien, meist in kleine Pensionen an der Küste. Es kam auch vor, dass der Vater ein Wohnmobil gemietet hatte. Am Abend saßen sie dann vor dem Fahrzeug und grillten, was Marcus besonders liebte. Mehr als vierzehn Tage Urlaub am Stück konnten sie jedoch nicht machen, denn länger konnte der Vater die Praxis nicht im Stich lassen. Doch es gab einmal eine Ausnahme.
Als Marcus vierzehn Jahre alt wurde, flogen sie in die USA. Der Vater hatte auch hier ein Wohnmobil gemietet. Drei Wochen waren sie an der Ostküste unterwegs; der Vater konnte Marcus vieles zeigen, weil er schon einmal als Student in den USA gewesen war.
Die Kindheit hatte Marcus nur in guter und warmer Erinnerung. Als er in die Pubertät kam, ließ der Vater ihm viel Freiheit; er konnte Mädchen mit nach Hause bringen und auch bei sich übernachten lassen. Umgekehrt hatte der Vater nichts dagegen, wenn er eine Nacht außer Haus war; er verlangte jedoch, dass Marcus sich abmeldete, und wenn es noch so spät war. Zu einer festen Bindung mit einem Mädchen kam es bei Marcus aber nicht; die längste Zeit, in der er mit einem Mädchen eng zusammen war, betrug ein halbes Jahr.
Irgendwann erwachte in Marcus der Wunsch, das Spielen des Saxophons zu erlernen. Warum er diesen Wunsch hatte, wusste er selber nicht. Als er ihn seinem Vater vortrug, wurde dieser eigenartig still und lehnte ihn zunächst ab. Doch Marcus drängte. Der Vater ging noch einmal in sich und erlaubte es ihm, jedoch unter dem Vorbehalt, dass Marcus parallel dazu auch Klavierunterricht nehmen müsse. Marcus war einverstanden und nahm Privatunterricht.
Zu seiner Freude konnte er feststellen, dass ihm das Erlernen dieser beiden Instrumente besser als erwartet leicht von der Hand ging. Sein Lehrer war beeindruckt von seiner Einfühlsamkeit und seinen schnellen Fortschritten. Kurz vor dem Abitur war Marcus soweit, dass er in verschiedenen Schülerbands ohne besondere Mühe mitspielen konnte. Doch am liebsten spielte er Jazz, ohne sich auf eine bestimmte Stilrichtung festzulegen.
Robert Kramer beobachtete die Entwicklung seines Sohnes mit stiller Freude und auch einer Spur Genugtuung. Seine Vergangenheit, die er in sich eingeschlossen hatte, als sei sie ein Ballast, den er niemandem zumuten mochte, hatte doch letztlich zu einem guten Ende geführt, wenn auch spät, dachte er für sich. Marcus würde einmal sein Erbe sein, und aus diesem Grund hatte er einen Teil seines Vermögens, ein paar Bausparverträge und Lebensversicherungen, bereits auf Marcus übertragen, der davon nichts wusste. Wenn Marcus sein Abitur machte, würde die Schenkung zehn Jahre zurückliegen, und er bekäme ein kleines, steuerfreies, unantastbares Vermögen.
Manchmal überlegte Marcus, warum sein Vater nach dem Verschwinden und dem Tod seiner Mutter keine neue Beziehung eingegangen war. Es war zu Kontakten mit Frauen gekommen, das wusste er, weil sein Vater manchmal ein Wochenende für sich allein reservierte, an dem er verreiste. Kramer hatte auch manchmal Besuche von Frauen, mit denen er ausging und die einige Male über Nacht blieben. Doch an einer festen Bindung war er offensichtlich nicht interessiert. Marcus war es egal, denn eine Mutter vermisste er nicht. Doch es machte ihn neugierig, und eines Tages, beim Frühstück, fragte er ihn danach. Sein Vater legte die Zeitung beiseite und blickte Marcus belustigt in die Augen.
„Das ist eigentlich ganz einfach, Marcus. Ich nehme jetzt eine Erfahrung vorweg, die du auch noch machen wirst.
Männer und Frauen sind nicht füreinander geschaffen und vertragen sich im Prinzip nicht gut, jedenfalls, wenn sie ständig zusammen sind. Am besten klappt es noch sozusagen während der Paarungszeit. Ich möchte niemandem in meiner Familie Vorschriften machen und möchte selbst auch keine Vorschriften haben, wie ich zu leben habe. Dazu würde es jedoch unweigerlich kommen, wenn ich eine neue Partnerschaft einginge. Außerdem werde ich älter und muss mit Krankheiten oder mit Befindlichkeitsstörungen rechnen. Dann möchte ich allein sein.
Auf keinen Fall könnte ich es ertragen, dass mich eine Frau mit ihrer Fürsorge plagt.“
Marcus war verdutzt. Sein Vater schien schlechte Erfahrungen gemacht zu haben. Das stimmte, wie er später feststellen sollte.
Das Abitur kam in Sicht. Marcus bestand es nur mit durchschnittlichen Noten. Der Grund dafür war ganz einfach, dass er in der Zeit, in der seine Mitschüler lernten, ständig mit seinem Saxophon unterwegs gewesen war. Für ein Medizinstudium hätte sein Zeugnis nie gereicht, aber das war nicht schlimm, denn Marcus hatte keine Sekunde daran gedacht, den Beruf seines Vaters zu ergreifen. Robert Kramer hatte auch nie in dieser Hinsicht Druck aufgebaut.
Manchmal hatte Marcus überlegt, ob er nicht Musik studieren solle. Die Voraussetzungen dazu waren vorhanden, denn er spielte zwei artfremde Instrumente und die Aufnahmeprüfung für sein Hauptinstrument, das Saxophon, könnte er bestehen, wenn er sich Mühe gäbe, dessen hatte ihn sein Lehrer versichert.
Doch Marcus verwarf diesen Gedanken. Die Aussichten, vom Spielen eines Saxophons leben zu können, waren zu schlecht. Das Instrument kommt nur in einem sehr beschränkten Teil der Musikwelt vor, hauptsächlich in der Unterhaltungsmusik und im Jazz. Für die konzertante Musik, Musiktheater und Klassik eignet es sich überhaupt nicht, weil es viel zu individualistisch ist. Außerdem hatte ihm sein Lehrer alles Rüstzeug vermittelt, welches nötig ist, das Instrument professionell zu beherrschen. Marcus kannte sich in Harmonielehre und Arrangement bestens aus, sodass es ihm jederzeit möglich war, eine Band aufzubauen oder in eine bestehende Band einzusteigen. Er brauchte also für das, was er gerne tat, kein Studium. Doch wenn er allein von der Musik leben wollte, wäre er darauf angewiesen, viele Dinge zu tun, die ihm gegen den Strich gingen, beispielsweise Musikunterricht zu erteilen. Er hatte das einmal probiert, als sein Lehrer ausgebucht war und musste die Erfahrung machen, dass die meisten Schüler dumm, faul oder untalentiert waren. Dabei hätte eine von den drei Eigenschaften schon gereicht, um dem Unterricht seinen Sinn zu nehmen.
Hin oder her, Marcus hatte keine Ahnung, welchen Beruf er wählen solle.
Ihm kam nun zu Hilfe, dass er in einem Vierteljahr seinen Ersatzdienst antreten sollte. Marcus hatte sich gegen den Dienst mit der Waffe entschieden. Seinem Vater merkte er an, dass der seine Entscheidung begrüßte, obwohl er sich strikt aus ihr herausgehalten hatte. In dieser Zeit würde er sich vielleicht über seinen Berufswunsch im Klaren werden.
Doch das funktionierte nicht. Nach dem Dienst wusste Marcus immer noch nicht, was er werden wollte. Es nützte nichts, die Entscheidung musste fallen. Am Ende entschloss er sich, Jura zu studieren, weil er damit seine Entscheidung noch weiter hinauszögern konnte. Einem Juristen stehen bekanntlich viele Tore offen, und irgendwann würde er schon merken, welche Tätigkeit ihm am meisten läge.
Kramer fand seine Entscheidung vernünftig und fragte ihn:
„Hast du dir denn schon einen Studienort ausgesucht?“
„Ich dachte an Freiburg, Papa. Die Stadt liegt mitten in Europa, Frankreich und die Schweiz sind nah. Das könnte für meinen späteren Beruf vielleicht wichtig sein.“
„Da hast du völlig recht. Freiburg ist natürlich weit von Hannover entfernt. Ich hoffe, dass du mich trotzdem oft besuchst. Und jetzt habe ich noch etwas für dich.“
Kramer erzählte seinem Sohn, dass er für ihn Geld angespart habe und schlug ihm vor, dafür eine Wohnung in Freiburg zu kaufen. Marcus wusste gar nicht, was er dazu sagen sollte.
„Wie kann ich dir dafür überhaupt danken, Papa? Du hast mir jeden Wunsch erfüllt, solange ich zurückdenken kann. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe.“
„Du sollst mir gar nicht danken, Marcus. Eines Tages wirst du sowieso mein Erbe sein. Das mit der Wohnung sollten wir bald realisieren. Erst einmal ist das Geld in einer Wohnung besser angelegt als auf einer Bank und außerdem kannst du so in Freiburg schneller Fuß fassen. Solltest du die Wohnung eines Tages nicht mehr brauchen, kannst du sie immer noch vermieten oder verkaufen.“
Sie fuhren zusammen nach Freiburg. Es ging recht schnell. Eine Agentur konnte ihnen eine Dreizimmerwohnung in einem in die Jahre gekommenen Baugebiet aus der Nachkriegszeit vermitteln, zwar im Erdgeschoss gelegen, dafür aber mit einer kleinen Terrasse ausgestattet. Zu der Wohnung gehörte eine Garage, etwa fünfzig Meter entfernt.
Vor dem Umzug nach Freiburg schenkte ihm sein Vater noch ein Auto, einen gebrauchten VW Golf. Besser kann ich für mein Studium nicht ausgestattet sein, dachte Marcus und versprach dem Vater, ihn bald zu besuchen. Seine beiden Saxophone – er hatte sich von seinen Gagen aus der Schülerzeit zusätzlich zu seinem Tenorsaxophon noch ein Altsaxophon gekauft – nahm er mit nach Freiburg.
Das Studium lief schleppend an. Marcus fand den Stoff, den ihm seine Professoren in ihren Vorlesungen zu vermitteln versuchten, äußerst langweilig und überlegte schon, ob er das Studium abbrechen solle. Zudem merkte man den Professoren an, dass sie sich samt und sonders für ausgewiesene Koryphäen hielten, ein Eindruck, den er mit anderen teilte.
„Mach dir nichts draus“, sagte ihm eines Tages Manfred, ein Mitstudent, „die Juristen neigen wohl von Natur aus zum Narzissmus, weil sie darauf programmiert sind, sich auch vor Gericht nicht gegenseitig die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Ich lasse die Vorlesungen links liegen und kaufe mir lieber Bücher. Vor den Examina bist du sowieso auf fremde Hilfe angewiesen, da nützen dir auch die Vorlesungen nichts.“ Marcus war nun beruhigt.
In dieser Zeit lernte er auch Werner kennen.
Es war an einem heißen Tag im Juli. Die Studenten hatten ein Sommerfest ausgerichtet, das auf dem Gelände eines Studentenheimes stattfand. Marcus schlenderte über den Rasen, auf dem sich ein Teil der Besucher niedergetan hatte, darunter viele Pärchen. Ein warmer Wind strich über den Platz. Viele hatten wegen der Hitze ihre T-Shirts und Hemden ausgezogen. Die Mädchen liefen zum Teil in Shorts und mit Bikinioberteilen herum. Das Bier, das an einem Stand mit einer Fassanlage ausgeschenkt wurde, floss reichlich und der Geruch gebratenen Fleisches zog von zwei Grillständen herüber. In der Mitte des Platzes hatte man eine Bühne aufgebaut, auf der eine Rockband spielte, deren aggressive Klänge in die Weite dröhnten; keine Musik nach Marcus` Geschmack. Er ging weiter und hörte plötzlich aus einer Ecke weitaus sanftere Musik kommen. Zwischen zwei Gebäuden befand sich eine kleine Tanzfläche aus Holzbrettern mit einem überdachten Stand, unter dem ein Klaviertrio Blues spielte. Ein Kontrabass und ein Schlagzeug standen hinter einem Stagepiano, das ein stämmiger Mann bediente, der im Alter von Marcus sein musste, wahrscheinlich auch ein Student. Seine fröhlichen Augen schauten aus einem gut gelaunten Vollbartgesicht heraus; er wirkte wie ein freundlicher Bär.
Sein Stil gefiel Marcus. Er sah, wie die Finger des Mannes leicht perlend über das Piano liefen, um zwischendurch immer wieder aggressive Blockakkorde in die Tasten zu versenken. Dieser Wechsel zwischen laut und leise, zart und hämmernd ist es, was den guten Pianisten ausmacht, dachte Marcus. Mit einem Keyboard, wie es Rockmusiker bespielen, ist das so nicht zu machen. Auf einem Stuhl vor der Bühne erblickte er ein Mädchen. Sie war zierlich und hübsch; ihr Minirock zeigte zwei schlanke Beine in hochhackigen Schuhen, und als er sie musterte, drehte sie ihren Kopf zu ihm hin. Ihre Haare waren lang und schwarz. Zwei große braune Augen mit langen Wimpern schauten ihn an, mit einem Ausdruck, den er als etwas verschreckt und schüchtern empfand. Als er sich wegdrehte, wendete sie ihren Blick wieder zu dem Pianisten hin, an dem er sich die ganze nächste Zeit festhielt.
Als das Trio Pause machte, ging Marcus zu den Musikern hin.
„Große Klasse spielt ihr, euer Stil ist genau meine Kragenweite“, sagte Marcus zu dem Pianisten. „Ich heiße Marcus, spiele Saxophon und mache auch schon seit Jahren Musik.“
Der Pianist lächelte und streckte Marcus die Hand hin.
„Und ich bin Werner, aber wir spielen erst kurze Zeit zusammen“, antwortete er. „Und das Mädchen vor unserer Bühne ist meine Freundin Danielle.“
Sie unterhielten sich jetzt eine ganze Weile miteinander, nachdem Werner Marcus mit seinen Mitspielern Peter und Torsten bekannt gemacht hatte. Alle stellten untereinander fest, dass sie einen ähnlichen Musikgeschmack besaßen. Als Werner Marcus die Stückeliste des Trios gab, zeigte es sich, dass dieser die meisten Stücke selbst schon gespielt hatte, die Mehrzahl sogar in der gleichen Tonart.
„Ich würde gern mit euch mitspielen“, rückte Marcus heraus.
Werner lachte.
„Wir sind zwar ein Trio, doch ein Quartett ist auch ganz schön. Die Katze im Sack kaufen wir aber nicht. Komm doch nächste Woche zu unserem Übungsabend. Der findet gleich hier nebenan statt, im Keller vom Studentenwohnheim.“
Marcus nahm am nächsten Donnerstag seine Saxophone und ging hin. Im Keller hatten die drei schon aufgebaut. Werner hatte ein akustisches Klavier zur Verfügung und brauchte sein Stagepiano nicht mitzuschleppen. Auch Danielle war dabei. Marcus packte sein Tenorsaxophon aus. Sie spielten erst etwas Blues und gingen dann zu ein paar Jazzklassikern über. Nachdem Werner sich mit seinen Mitspielern beraten hatte, sagte er zu Marcus:
„Wir würden uns freuen, wenn du mitmachen würdest. Eines sage ich dir aber gleich zu Anfang. Wir müssen viel üben und arbeiten, denn ich habe eine volle Liste mit Engagements in der nächsten Zeit.“
Marcus war glücklich, hatte er doch gleich in Freiburg einen Kreis gefunden, mit dem er nach seiner Vorstellung musizieren konnte. Werner war, wie es schien, der Kopf der Band, weil er die meisten theoretischen Kenntnisse hatte. Doch das traf auf Marcus ebenso zu, wie Werner nach kurzer Zeit feststellte. Es entstand also eine Art Arbeitsteilung; beide schrieben wechselseitig Arrangements und übten mit der Band neue Stücke ein. Zwischen Marcus und Werner entwickelte sich eine intensive Freundschaft.
Werner wohnte mit Danielle im Studentenwohnheim; beide studierten Germanistik. Auf diese Weise hatten sich die beiden kennengelernt. Irgendwann würden sie mit dem Studium fertig sein, und sie wussten noch nicht, ob sie nach Frankreich ziehen oder in Deutschland bleiben wollten. Auf alle Fälle hatten sie schon einmal ihre Fühler nach Frankreich ausgestreckt und kannten dort mittlerweile eine Menge Leute. Marcus besuchte die beiden oft. Er musste aufpassen, dass es ihm nicht so ging wie in der Schule, also dass er mehr mit dem Saxophon als mit dem Studium beschäftigt war.
Es war so, wie Werner gesagt hatte, sie bekamen reichlich Engagements. Das konnte in kleinen Clubs in Freiburg sein oder bei größeren Veranstaltungen im Umkreis von etwa hundert Kilometern stattfinden. Werner besaß einen alten Kleinbus, sodass der Transport der Verstärkeranlage und der Instrumente kein Problem war. Auch bei Werbeveranstaltungen und bei Privatfeiern traten sie auf; hier gab es immer die höchste Gage. Die Auftritte verschaffte ihnen ein Agent, den Werner kannte. Nur während der Semesterferien machten sie Pause, weil die Musiker, alles Studenten, dann oft nach Hause fuhren. Auch Marcus besuchte in dieser Zeit seinen Vater.
Marcus war damit zufrieden, wie es war.
Die Zeit verging, das vierte Semester brach an. Eines Tages erhielt Marcus einen Anruf von Tante Lore. Nachdem sie ihn begrüßt hatte, kam sie sofort zur Sache.
„Marcus, deinem Vater geht es nicht gut. Er ist krank. Seit drei Wochen ist er nicht mehr in der Praxis gewesen.“
„Was ist das für eine Krankheit“, unterbrach Marcus sie, „und warum hat er mich nicht selbst angerufen?“
Marcus war sehr beunruhigt. Noch nie war es vorgekommen, dass der Vater so lange die Praxis im Stich gelassen hatte.
„Das wird er dir selber sagen, Marcus. Er wollte sich bei dir noch nicht melden. Er sagte, das sei noch zu früh. Ich mache mir große Sorgen.“
„Ich komme sofort“, sagte Marcus.
Als er von Freiburg losfuhr, lag der Himmel düster und grau über dem Rheintal. Es war gerade November geworden, die Natur zog sich jetzt mit einem Hauch von Schwermut zurück. Hinter Karlsruhe fing es an zu regnen, zuerst nieselte es nur, dann platschten dicke Tropfen gegen sein Autofenster, sodass er für den Rest der Strecke langsam fahren musste. Spät am Abend erreichte er Hannover.
Tante Lore öffnete und schaute ihn traurig an. Nach kurzer Begrüßung führte sie ihn in das Wohnzimmer, das ihm überheizt vorkam. Robert Kramer saß in einem Sessel am Fenster, ließ ein Buch sinken, mit dem er sich beschäftigt hatte und lächelte Marcus zu.
„Komm her“, sagte er, „ich erzähle dir gleich alles.“
„Was ist mit dir los, Papa?“ Kramers Gesicht wurde ernst.
„Ich will nicht darum herumreden, Marcus. Seit einem Jahr habe ich Krebs. Es ist ein besonders übler Krebs, den man nicht heilen kann, Krebs der Bauchspeicheldrüse. Ein Vierteljahr Zeit habe ich noch, dann wird es vorbei sein.“
Marcus merkte, wie seine Augen sich mit Tränen füllten.
„Aber es gibt doch Operationen, Bestrahlung, Medikamente. Hast du nichts unternommen, und warum hast du mir nicht schon früher etwas davon gesagt?“
„Das sind zwei Fragen, Marcus. Zunächst zu deiner ersten Frage. Das gibt es alles tatsächlich, doch es bringt nichts als Schmerzen und Verzögerung. Ich habe in meinem Beruf viele Patienten mit diesem Krebs betreut. Nicht ein einziger hat ihn überlebt. Und nun zu deiner zweiten Frage. Was wäre gewesen, wenn du schon vor einem Jahr alles erfahren hättest? Du hättest dir die ganze Zeit Sorgen gemacht und vielleicht sogar dein Studium unterbrochen. Davon hättest du und hätte ich nichts gehabt. Sogar unsere Lore weiß erst seit ein paar Tagen Bescheid. Ich werde nun in Ruhe alles ordnen, bis meine Zeit gekommen ist.
Die Praxis steht im Moment still, aber das wird sich ändern. In zwei Wochen zieht ein Nachfolger ein, den ich selbst ausgesucht habe. Er wird alle meine Mitarbeiterinnen übernehmen. Du kannst mir bei meiner Krankheit durchaus helfen, wenn du möchtest. Ich will auf keinen Fall im Endstadium Schmerzen ertragen müssen. Dabei kommt mir zugute, dass ich selbst Arzt bin und genau weiß, mit welchen Medikamenten das geht. Wenn du mich ab jetzt an den Wochenenden besuchst und mir die Medikamente besorgst, die ich dir aufschreibe, hast du schon sehr viel für mich getan.“
Marcus setzte sich neben seinen Vater und drückte ihm die Hand. Er konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Am Abend rief er Werner an und berichtete ihm. Werner hatte Verständnis dafür, dass er zunächst alle Übungsabende und Auftritte absagte.
Marcus kehrte vorerst nicht mehr nach Freiburg zurück.
Er bezog sein altes Zimmer im Elternhaus und kümmerte sich tagsüber um seinen Vater. Kramer wurde von Tag zu Tag schwächer und schlief oft, auch am Tag. Manchmal ging es ihm einen oder zwei Tage besser, dann sprachen sie viel miteinander. Auch seine Krankheit hatte also einen leicht welligen Verlauf – er musste an das denken, was ihm der Vater vor langer Zeit über die Behandlung von Krankheiten erzählt hatte. Doch diese Wellen verdichteten sich im Prinzip zu einer Geraden, die ins Bodenlose abstürzen würde.
Kramer erzählte ihm einiges aus seiner Vergangenheit.
„Ich habe lange in Berlin gelebt und studiert, Marcus. Es war eine wichtige Zeit für mich, manchmal schön, manchmal übel, aber immer verrückt. Wir – das heißt, eine Gruppe ähnlich gesinnter Studentinnen und Studenten – wollten die Welt verbessern und aus der Spießigkeit unserer Väter und Mütter heraus. Unser Lebensentwurf sollte schockieren und der damaligen Gesellschaft – dem verhassten Establishment – ein Bild vor Augen führen, das sie verunsichern und provozieren würde.
Wir hatten in Kreuzberg um 1967 herum eine große Altbauwohnung in der Nähe des Chamissoplatzes gemietet, in der wir zusammenwohnten. Es waren etwa zwölf Personen, die hier auf engem Raum lebten, manchmal zogen einige weg und andere zu. Marianne Schäfer, deine Mutter, und ich gehörten die ganze Zeit dazu. In der ersten Zeit nannten wir uns „Kommune“ in Anlehnung an gesellschaftliche Experimente in China während der Kulturrevolution. Als wir merkten, welche elenden Verbrecher und Diktatoren dort am Werk waren, ließen wir die Bezeichnung fallen und wurden zu einer Wohngemeinschaft.
Doch es war keine Wohngemeinschaft im üblichen Sinn. Wir besaßen keine abgeschlossenen Zimmer und schliefen mal hier, mal da. Das ist auch im sexuellen Sinn durchaus wörtlich zu nehmen. Damals war gerade die Empfängnisverhütung durch die Pille aufgekommen und Aids gab es noch nicht, sodass sich ungeahnte Freiräume eröffneten. Es war damals meine Aufgabe als Medizinstudent, den Mädchen die Pille zu besorgen.
Es gab natürlich jede Menge Probleme. Die geringsten waren noch, ein Mindestmaß an Sauberkeit und Ordnung einzuhalten, denn wir mussten uns eine einzige Küche und ein einziges Bad teilen. Das größte Problem entstand, als einige unserer Mitbewohner anfingen, Rauschgift zu konsumieren. Wir kifften natürlich, jedoch manche beließen es nicht dabei. Das lag vielleicht daran, dass der Alkohol als ungeliebte bürgerliche Droge meistens von uns gemieden wurde. Natürlich standen wir alle politisch links. Doch ein Mindestmaß an gemeinsamer Gesinnung, das am Anfang durchaus vorhanden war, ließ sich nicht durchhalten. Vielleicht ist es so, dass Menschen nur für eine gewisse Zeit sozial übereinstimmen. Werden sie älter, schlagen wohl ihre Gene durch und sie entwickeln sich mehr und mehr zu Individuen.
Das sind Erkenntnisse, die ich erst durch meine Erfahrung als Arzt gewonnen habe. In meiner Zeit in der Berliner Wohngemeinschaft wären das absolut sündige Gedanken gewesen. Man war damals der Ansicht, der Mensch sei zu hundert Prozent das Produkt der Gesellschaft, in der er lebe und jeder verfüge über das gleiche geistige Potential, das ihn im Prinzip zu allem befähige. Also brauche man nur die Gesellschaft zu ändern, um zu idealen Zuständen zu kommen. Eine total falsche Ansicht.
Wie auch immer, wir machten Entwicklungen durch, dass jedem Außenstehenden die Haare zu Bergen stünden. Der sogenannte „Marsch durch die Institutionen“, als den ihn die Linken bezeichneten, war dabei noch das Harmloseste. Er besagte nichts anderes, als dass sich ein Teil von uns in das bequeme Beamtenbett der bürgerlichen Gesellschaft legte und an seiner Karriere feilte. Andere wurden regelrecht scharf auf Geld und ließen keine Gelegenheit aus, mit dubiosen Geschäften Kohle zu machen. Von den Mädchen landeten einige in der Werbe- und Modebranche und verkauften und verrieten damit ihre linke Seele. Und so weiter und so fort.
Es kam, wie es kommen musste. Irgendwann brach alles auseinander. Du bist, wie du weißt, im Jahr 1971 auf die Welt gekommen. Marianne und ich taten uns zusammen, heirateten und zogen später nach Hannover. Leider klappte es nicht mit unserer Beziehung. Marianne verließ mich, ließ sich scheiden und nahm ihren Mädchennamen wieder an. Sie zog zu einem Mann, den sie schon aus unserer Berliner Wohngemeinschaft kannte. Sie hat nicht mehr lange gelebt. Das habe ich selbst nur auf Umwegen erfahren.“
„Und warum bist du damals nach Hannover gezogen?“, fragte Marcus.