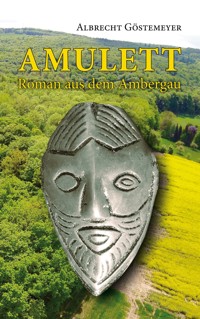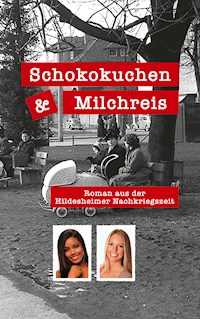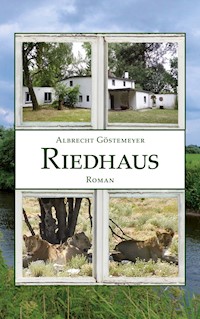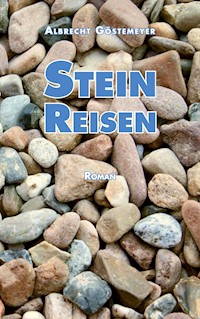6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein gemischter Satz ist ein Weißwein, der aus Trauben verschiedener Rebsorten gekeltert wird, die nur von ein und demselben Weinberg stammen dürfen. Dieser Wein ist fast nur in Österreich bekannt. Ähnlich verhält es sich mit den gemischten Sätzen des Autors in diesem Buch. Es enthält Geschichten, die nach Art und Länge breit gefächert sind. Da gibt es literarische Reisezählungen, beispielsweise aus Israel und Namibia, wobei wie im "Rheinsberger Tagebuch" die romantische Stimmung nicht zu kurz kommt. Die Kurzgeschichten weisen in ihrer Konzeption erhebliche Unterschiede auf. "Müde in Müden" ist die poetische Beschreibung eines Seitensprunges, der tief mit der Landschaft der Lüneburger Heide verbunden ist und in "Golden Goose" erfährt ein Ehemann, dessen Ehe schon etwas verschlissen ist, wie ein heruntergekommenes Paar ihm eine intensive, seelenvolle Bezeichnung vorlebt. Im Gegensatz dazu stehen Erzählungen mit derber Satire, wie "Der Bürgermeister", eine Trump-Parodie, "Der schwarze Koffer", die Story über einen verkrachten Juristen und "Babyface", wo genüsslich dargelegt wird, wie ein erfolgreicher Jäger mit seinem sorgfältig geplanten Verführungsversuch scheitert. Alles zusammen bietet 200 Seiten Lesespaß.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Der schwarze Koffer
Müde in Müden Eine Heidegeschichte
Austern zum Frühstück Ein Reisebericht aus Namibia
Golden Goose
Der Zauberer
Rheinsberger Tagebuch
Der Bürgermeister
Hahnenschreie am Damaskustor Ein Reisebericht aus Israel
Babyface Eine Jagdgeschichte
DER SCHWARZE KOFFER
Professor Dr. jur. Leberecht Hasenbusch starrte auf die weiße Wand. Dann drehte er sich, ging zu seinem Bett, das eher einer weißbezogenen Pritsche ähnelte, seufzte und setzte sich. Er dachte nach. Ihm kamen aus Langeweile Erinnerungen.
Seine Schulzeit am Gymnasium des Städtchens an der Weser war eine fortlaufende Erfolgsgeschichte gewesen. Er erinnerte sich noch genau an eine Schulstunde in der dreizehnten Klasse, eine Probestunde für einen angehenden Studienrat, bei der der Schulrat anwesend gewesen war. Es ging um Goethe. Vor ihm hatte der Lehrer einen anderen Schüler aufgerufen.
„Was können Sie mir über das Verhältnis von Goethe zu Frau von Stein sagen, Krause?“
„Die wird halt seine Geliebte gewesen sein.“ Der Lehrer runzelte die Stirn. Er rief Hasenbusch auf.
„Hasenbusch, wissen Sie es besser?“ Leberecht stand auf.
„Das Verhältnis von Goethe zu der Frau von Stein war viel zu intellektuell, um sich auf schnöde Geschlechtlichkeit zu beschränken.“
„Richtig. Was können Sie mir sonst noch über Goethe sagen?“
„Geboren am 28. August 1749 in Frankfurt am Main. Lebte in Frankfurt und Weimar. Hauptwerke: Drama Götz von Berlichingen, Novelle Die Leiden des jungen Werther, Theaterstück Faust. Gestorben am 22. März 1832. Todesursache: Darmverschlingung.“
„Sehen Sie“, der Lehrer drehte sich zum Schulrat, mit einer geringen Körperknickung eine Art von Verbeugung ausdrückend, „das ist Bildung.“
Während der Abiturprüfungen ließ er seine Mitschüler in weitem Abstand hinter sich. Ins Mündliche kam er mit dem Fach Geschichte, seinem Spezialfach. Man prüfte ihn über den Dreißigjährigen Krieg. Es folgte ein viertelstündiger Monolog. Hasenbuch schnarrte Schlachten, Schlachtorte und Jahreszahlen hinunter, bis der Lehrer verzweifelt Einhalt gebot.
„Sie können sich setzen, Hasenbusch. Sie haben sehr gut gelernt.“
Zum Schluss wurde er gefragt, mit welcher Gesamtnote er für sein Abitur rechne. Die Antwort kam pfeilschnell.
„Eins natürlich, Herr Studienrat.“ Als die Lehrer sich nach seinem Berufswunsch erkundigten, bekamen sie zu hören:
„Ich gehe in die Politik. Ich will Bundeskanzler werden.“
Seine Erfolgsgeschichte setzte sich nach dem Abitur fort.
Zunächst meldete er sich freiwillig zur Bundeswehr, denn die Teilnahme an der Landesverteidigung hielt er für seine vaterländische Pflicht. Er verließ die Truppe als Reserveoffizier und begann in Tübingen das Jurastudium. Ein Blick auf die Statistik der Berufe der Bundestagsabgeordneten hatte ihn davon überzeugt, dass der Beruf des Juristen am ehesten der politischen Karriere förderlich sei, denn unter den Politikern waren Juristen weitaus mehr gegenüber anderen Berufen präsent, noch viel mehr als die Lehrer.
In dieser Zeit trat er in eine schlagende Burschenschaft ein, knüpfte Beziehungen und erwarb einen leichten Schmiss im Gesicht, den er für ein ehrenvolles Abzeichen hielt, der juristischen Elite anzugehören. Das Studium schnurrte. Im letzten Semester fing er bereits mit der Abfassung seiner Doktorarbeit an, und zwar über das Thema:
Eigentumsdelikte an Hühnern. Diebstahl oder Mundraub?
Privat lief es nicht so gut für Hasenbusch. Ungeachtet der leidenschaftlichen Antwort im damaligen Deutschunterricht – hier war es ja um Goethe, den Dichterfürst gegangen –, begannen ihn urmenschliche Gelüste zu plagen, die während seiner Pubertät erwacht waren. Er wäre nicht Hasenbusch gewesen, in seiner logisch-intellektuellen Persönlichkeit, wenn er nicht versucht hätte, jene Plage in subtilen Genuss zu überführen. Doch dazu sollte sich weder seine Bundeswehrzeit noch seine Erfahrung in der Burschenschaft eignen.
Erstere hatte ihm zwar die Bekanntschaft mit der käuflichen Liebe beschert, eine Erfahrung, die ihn freudig stimmte und nach Wiederholung drängte, ungeachtet dessen, dass sich diese Erfahrung auf Ereignisse während ausgedehnter Nato-Manöver reduzierte. Seine Zeit in der Burschenschaft hatte zwar dafür gesorgt, dass er seine Gelüste durch Bierkonsum sublimieren konnte, doch letztlich erwies sich das Bier eher als ein Mittel zur Unterdrückung der Potenz. Das missfiel ihm außerordentlich, zumal ihm das Biertrinken einen Kugelbauch verschafft hatte, den er einziehen musste, wenn er sich einen optischen Eindruck vom Zustand seines Unterleibes verschaffen wollte. Seiner natürlichen Gier tat das keinen Abbruch.
Hinderlich wirkte sich für die Beziehung zum weiblichen Geschlecht die Qualität seines Äußeren aus. Hasenbusch verfügte eine gedrungene, wenig athletisch aussehende Gestalt und auch der optische Zustand seines Hauptes entsprach nicht dem Wunschdenken der Damenwelt.
Ein fahlweißes Gesicht mit einer Kopfbedeckung von schütteren roten Haaren – eigentlich eine sinnfällige Kombination – ließ nicht ästhetisch überzeugen. Seine kleinen blassblauen Augen, überdeckt von kaum auffallenden Brauen, erweckten den Eindruck mondgesichtiger Langeweile.
Kurz gesagt, es war ein Schweinchengesicht, das allen, die mit Leberecht Hasenbusch zu tun hatten, entgegen schaute.
Die Folgen dieses Zustandes musste man eben ändern, dachte Leberecht.
Er hatte die Erfahrung gemacht, dass es durchaus Möglichkeiten gab, die Attraktivität in Bezug auf die Weiblichkeit zu steigern. In erster Linie war das der Erwerb von Geld oder Besitz. Schwierig. Die einfachste Möglichkeit in dieser Hinsicht war schlichtweg der Vorzug eines üppigen Erbes, verbunden mit einer dementsprechenden Herkunft. Damit konnte er nicht aufwarten. Sein Vater war einfacher Beamter beim Finanzamt gewesen und dessen einzige Gewinnmaximierung bestand darin, dass er mit seiner Bank verbotene Tafelgeschäfte machte und damit seinen Brotgeber beschiss.
Allzu viel hatte das nicht gebracht.
Auch für Juristen war es schwierig, an ein Vermögen zu kommen, wenn man nicht gerade über ein Elternhaus mit einer Rechtsanwaltskanzlei verfügte, welche vorzugsweise reiche Mandanten zu ihren Kunden zählte oder wenn man Notar in Bayern war. Aus Erfahrung wusste er, dass man durch Arbeit niemals reich werden konnte. Reich wurde man nur, wenn man Geld hin- und herschob, an der Börse oder irgendwo anders. Dazu hätte er Betriebswirtschaft studieren müssen, der Zug war abgefahren.
Blieb Möglichkeit zwei, Potestas, also Ansehen und Macht. Auch so etwas wird von den Frauen als attraktiv bewertet.
Das ginge. Es kam ihm sogar gelegen, denn er hatte ja sowieso vor, in die Politik zu gehen.
Der Anfang war zwar schon gemacht, als er nach dem Abitur in die CDU eingetreten war. Doch damals hatte er festgestellt, dass Bildung und Schulnoten nicht automatisch das bewirken, was er sich nach seinem Wunsch vorgestellt hatte: erst Parteikarriere, dann Karriere in der Politik. Leider spielten innerparteiliche Beziehungen eine viel größere Rolle, als er sich gedacht hatte. Er musste feststellen, dass der innere Apparat der Partei aus verschiedenen Strängen von Strippenziehern bestand, die dazu noch untereinander verfeindet waren. Um da hineinzukommen, musste er sich einen der Stränge aussuchen, um sich nach oben durchwinken zu lassen. Dazu war Kärrnerarbeit nötig, beispielsweise das Aufstellen und Kleben von Plakaten in Wahlkampfzeiten – nichts für Hasenbusch, der eine natürliche Abscheu gegen körperliche Arbeit hegte. Es musste also etwas Besonderes her.
Das war der Moment, in dem Hasenbusch beschloss, Professor zu werden.
Voraussetzung dafür war erst einmal, dass er ein erstklassiges Examen ablegte. Ein ganzes Jahr büffelte er sich neben seiner Doktorarbeit durch und ging zu Repetitoren, wobei ihm sein angeborenes Talent zum Auswendiglernen zugutekam. Die Tübinger Professoren lobten seinen Verstand und belohnten ihn im Staatsexamen mit der Prädikatsnote „sehr gut“, die äußerst selten vergeben wurde. Auch seine Promotion erhielt die Benotung „Summa cum laude“.
Es war Hasenbuschs kreativste Zeit. Um sich zu habilitieren, war ein Ortswechsel vonnöten. Er wählte Göttingen, denn auf diese Weise würde er auch in eine Schwesterverbindung seiner Bundesbrüder überwechseln können, eine Sache, die er sehr schätzte und die ihm Heimatgefühl verschaffte. Bei den „alten Herren“, also Mitgliedern, die ihr Studium bereits absolviert hatten, lernte er auch seinen Mentor kennen, eine Bekanntschaft, die sich auf seinen späteren Lebensweg bestimmend auswirken sollte. Professor Dr. Justinian Menzel, spezialisiert auf Staats- und Völkerrecht, war einer vom alten Schlage. Optisch erschien er weißhaarig, hager gewachsen und stets korrekt gekleidet mit anthrazitfarbenen Anzügen, deren glänzende Ärmel häufigen Gebrauch anzeigten. Dazu passten blasse quergestreifte Krawatten, die er bei den Treffen der Verbindung stets unauffällig zur Seite schob, wenn er sie mit Bier besabbert hatte. In der juristischen Fakultät von Göttingen genoss er einen Sonderstatus, weil er der dienstälteste Professor war; von ihm konnte also nichts Übles mehr ausgehen. Seine Zeit als Richter während der Nazizeit hatte ihm zwar einige braune Flecken eingebracht, unter anderem, weil er lediglich ein paar Sinti wegen Umhertreiberei in ein Arbeitslager geschickt hatte, doch die waren längst abgebüßt. Auf diese Weise bestätigte er das landläufige Vorurteil, dass ein Richter häufig auch ein Rechter sei, hatte aber damit keinen Schaden genommen.
Hasenbusch war es mühelos gelungen, nach seinem Referendariat bei Gericht eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der juristischen Fakultät der Universität Göttingen zu ergattern.
Zielgerecht machte er sich an Menzel heran, half ihm vor und nach seiner Vorlesung, die Akten zu transportieren und spielte in dessen Büro die Kanzleischwalbe.
Menzel war beeindruckt vom Ehrgeiz seines jungen Kollegen und lud ihn ein paarmal sogar zu sich nach Hause ein. Hier lernte Hasenbusch Menzels Tochter Hildegard kennen.
Hildegard war eine graue Maus, langweiliges Gesicht, Haare von undefinierbarer graublonder Farbe, unspektakuläre Figur und ihre Kleidung erinnerte an Versandhausmode. In ihrer Schulzeit wurde sie von ihren Schulkameraden regelmäßig als „dumme Gans“ bezeichnet, blieb bei Schulbällen häufig sitzen und verschaffte sich auf diese Weise einen Berg von Minderwertigkeitskomplexen.
Um diese abzubauen, nahm sie an den sporadischen Tanzveranstaltungen der Studentenverbindung ihres Vaters teil, wo sie auf die dezente Werbung von Hasenbusch traf. Ihre Begeisterung darüber hielt sich in deutlichen Grenzen, was etwas mit Hasenbuschs Schweinegesichtigkeit zu tun hatte.
Doch Hasenbuschs Karriere nahm rasanten Fortschritt. Menzel, der ebenso wie Hasenbusch über ein nahezu unschlagbares Gedächtnis verfügte, ließ ihn in die Gefilde seiner Erkenntnisse einsteigen und vermittelte ihm alle notwendigen Informationen, die schließlich in einer großrahmigen Habilitationsschrift gipfelten. Ihr Titel war:
Das Nationalgefühl der Deutschen. Legitimes Ziel oder Übel? Eine Analyse der deutschen Staatsverträge vom Wiener Kongress bis zur Gegenwart.
Wie gewohnt gelang es Hasenbusch, dafür Bestnoten zu bekommen. Die Arbeit traf zwar auf geteiltes Interesse, führte aber dazu, dass Hasenbusch jetzt in einer gehobenen Liga gehandelt wurde. Es war genau das, was er wollte.
Auch die Werbung um Menzels Tochter Hildegard gestaltete sich jetzt um einen ganzen Schritt erfolgreicher. Die Habilitation ließ die Nachteile seiner äußeren Erscheinung in den Hintergrund treten, und so gelang es ihm, der Tochter seines Mentors näher zu treten und ihr die Unschuld zu rauben, ein Vorgang, auf den sie schon lange verzweifelt gewartet hatte. Beides, Entjungferung und Habilitation, ließen Hasenbusch für Hildegard Menzel in einem anderen Licht erscheinen; Hildegards diffuse Abneigung wich einer halbeuphorischer Grundstimmung, die sich bei ihr bis hin zur Verliebtheit und schließlich zur Verlobung steigerte und dazu führte, dass Hildegard Menzel Dr. Leberecht Hasenbusch im August 1975 heiratete.
Hasenbusch verspürte Genugtuung. Der Sex mit Hildegard war zwar langweilig – ihre Anteilnahme bestand darin, dass sie während des Vorganges irgendwas vor sich hin quiekte – doch er setzte seinen körperlichen Pflichten stets damit ein Sahnehäubchen auf, indem er sich gedanklich kurz vor dem Höhepunkt an seine Beziehungen zur käuflichen Liebe erinnerte.
Diese hatte er auch in Göttingen weiter gepflegt, doch sie führten ihn in eine bessere Kategorie als zu seiner Bundeswehrzeit. Ein paar rotschummrige Clubs, meist an Landstraßen um Göttingen gelegen, lieferten ihm alles, was er zusätzlich brauchte.
Zu alledem konnte sich Hasenbusch plötzlichen Nachwuchses erfreuen. Ein Verhütungsfehler machte ihn nach zwei Jahren zum Vater; Hildegard gebar zur Freude seines Schwiegervaters kurz vor Weihnachten ein gesundes Töchterlein.
Dr. Justinian Menzel wurde ein Jahr später emeritiert, es galt nun, einen Nachfolger für seinen Lehrstuhl zu finden, der sich im Staatsrecht ebenso auskannte wie Menzel.
Die Juristische Fakultät der ehrwürdigen Georg-August-Universität Göttingen befiel Verlegenheit. Normalerweise hätte man jetzt einen Ruf in die Welt geschickt und sich darauf verlassen, dass der darauffolgende Zulauf kurzfristig zu einer würdigen Neubesetzung des Lehrstuhles führen würde.
Doch die Zeiten hatten sich geändert, „tempora mutantur“, wie sich der greise Inhaber des Lehrstuhles für Strafrecht, Herr Professor Dr. Galgener, voller Resignation ausdrückte – auch er bereits mit einem Fuß schon im Ruhestand stehend. In der Universitätsstadt Göttingen gärte es am Ende der Siebziger Jahre. Die Studentenunruhen, die von Berlin aus ihren Ausgang nahmen, schwappten auch nach Göttingen über und ließen die ehemals ruhige Provinzstadt nervös werden, über die der Dichter Heinrich Heine, erzürnt über seinen Universitätsverweis, dazumal – im neunzehnten Jahrhundert – berichtet hatte:
„Die Stadt Göttingen, berühmt durch ihre Würste und Universität, gehört dem Könige von Hannover und enthält 999 Feuerstellen, diverse Kirchen, eine Entbindungsanstalt, eine Sternwarte, einen Karzer, eine Bibliothek und einen Ratskeller, wo das Bier sehr gut ist. … Die Stadt selbst ist schön und gefällt einem am besten, wenn man sie mit dem Rücken ansieht. … Im Allgemeinen werden die Bewohner Göttingens eingeteilt in Studenten, Professoren, Philister und Vieh, welche Stände doch nichts weniger als streng geschieden sind. Der Viehstand ist der bedeutendste. Die Namen aller Studenten und aller ordentlichen und unordentlichen Professoren hier aufzuzählen, wäre zu weitläufig; auch sind mir in diesem Augenblick nicht alle Studentennamen im Gedächtnisse, und unter den Professoren sind manche, die noch gar keinen Namen haben.“
Jeden Sonnabend zog also der schwarze Block, eine etwa fünfzigköpfige Herde schwarz vermummter Linker, marodierend durch die Stadt, zündete Autos an, zerdepperte Ladenfenster und beschmierte Häuserwände. In ihrer Mitte ging ein späterer Obergrüner und Bundesumweltminister feixend und grinsend mit, wie ein plusternder Hahn, um den sich die Hennen scharten.
Die Polizei flankierte stets den rituellen Zug. Die Mienen der Beamten hatten im Laufe der Zeit einen Ausdruck von phlegmatischem Fatalismus angenommen. Kein Wunder also, dass angehende Professoren, zumal Juristen, den Ruf an die Universität Göttingen scheuten.
Doch Hasenbusch hatte sich mit wenigen anderen um die Nachfolge für den Lehrstuhl seines Schwiegervaters beworben.
Zuerst standen die Professoren der Fakultät seiner Bewerbung skeptisch gegenüber.
„Es macht keinen guten Eindruck, wenn wir als Nachfolger vom Kollegen Menzel ausgerechnet seinen Schwiegersohn auswählen“, bemerkte Dr. Erbenspeck, Professor für Notarrecht.
„Meine Herren! Bedenken Sie, welche Noten uns Kollege Hasenbusch für sein Staatsexamen, seine Doktorarbeit und seine Habilitation vorgelegt hat!“, entgegnete Dr. Theuerzins, Professor für Wirtschaftsrecht, „damit liegt er haushoch vor den zwei anderen Bewerbern!“
„Es gibt noch einen anderen Gesichtspunkt, dem man sich nicht verschließen sollte“, warf Dr. Malochius, Professor für Arbeitsrecht, ein. „Wir alle, meine Herren Kollegen, leiden unter dem entsetzlichen Linksruck, dem unsere ehrwürdige Alma Mater seit einiger Zeit ausgesetzt ist. Sicher gehen auch Ihre Vorlesungen und Seminare nicht mehr ohne Störungen vonstatten. Nun ist Kollege Dr. Hasenbusch mentalitätsmäßig eher der äußersten Rechten zuzuordnen und dürfte die Störer gleichsam magisch anziehen und uns dadurch mehr Ruhe verschaffen. Lassen Sie mich es so sagen: er könnte das Stückchen Käse sein, um das sich die Mäuse versammeln und sie auf diese Weise von unseren Näpfen fernhalten.“
Dieses Argument überzeugte die versammelten Gelehrten. Hasenbusch erhielt den ersehnten Ruf und wurde ordentlicher Professor für Staats- und Völkerrecht an der Universität Göttingen. Er frohlockte und beschloss, angesichts dieser glanzvollen Karriere seine politischen Ambitionen zu begraben. Im Überschwang zeugte er ein weiteres Töchterlein. Voller Vorfreude sah er seiner ersten Vorlesung entgegen.
Ihr Titel: „Können wir uns noch Nationalstolz leisten?“ zog in erster Linie die in Göttingen noch reichlich ansässigen Burschenschafts- und Korpsstudenten an, letztere mit etwas mehr Schmissen gezeichnet, denn die Anzahl der abzuleistenden scharfen Degenkämpfe, genannt Mensuren, lag bei ihnen beträchtlich höher als bei den Burschenschaftern.
Hasenbusch schwadronierte, warf Graphiken über Staatsverträge, siegreiche Kriege und die darauffolgenden Gebietsgewinne des Deutschen Reiches mit dem Projektor an die Wand, um sich daraufhin bitter über das Unrecht des geteilten Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg zu beklagen. Glänzender Beifall erhob sich, durchbrochen nur vom Zähneknirschen eines kleinen Häufleins zufällig anwesender Linker, die sich anschließend mit den Korpsstudenten vor dem Hörsaal prügelten. Das kam in Göttingen ständig vor und erregte weiter kein Aufsehen.
Die Kollegen von der juristischen Fakultät priesen ihre Weisheit. Sie hatten recht behalten, und von Mal zu Mal füllte sich Hasenbuschs Hörsaal immer mehr mit den linksgerichteten Studenten vom Sozialistischen Hochschulbund und dem Kommunistischen Bund und hielt sie von ihren eigenen Hörsälen fern. Es dauerte nicht lange, und die ersten Tomaten flogen in Richtung Rednerpult, unter dem wüsten Geschimpfe der Rechten, die sich die andere Seite des Hörsaales ausgesucht hatten. Hasenbusch musste trotz Mikrofon seine Lautstärke steigern, um den Tumult zu übertönen und sein Albinokopf nahm eine flammendrote Farbe an.
Die Wurfgeschosse wurden im Lauf der Zeit kompakter. Die Störer gingen zu Eiern über und Hasenbusch, vom Geschehen äußerst mitgenommen, empfand es als trostreich, dass meistens keine faulen darunter waren.
In dieser Zeit erwachten wieder seine politischen Ambitionen. An einem ausgedehnten Bierabend in seiner Verbindung ließ er sich von ein paar rechten Sektierern, die seinen scharfen Verstand priesen, davon überzeugen, den Republikanern beizutreten und sich als Kandidat für den Landtag aufstellen zu lassen. Die Republikaner waren ein neuer Versuch, die verschiedenen, vor kurzem zusammengebrochenen Sammelbecken der Rechten wieder zu ordnen.
Der Versuch scheiterte. Hasenbusch, dessen unerschütterliches Selbstvertrauen die Erkenntnis der Verzweiflung, in der er sich befand, nicht zuließ, fiel bei der nächsten Landtagswahl kläglich durch.
Ein weiteres Problem plagte ihn zusehends, der Niedergang des Privaten. In seiner temporären Euphorie hatte er kaum wahrgenommen, dass seine Ehefrau Hildegard zunehmend unzufriedener wurde. Sein Schwiegervater Justinian Menzel litt unter fortschreitender Demenz, konnte sich nur noch mit dem Rollator fortbewegen und beschäftigte seine Tochter von morgens bis abends, denn die Familie Hasenbusch wohnte auf Hildegards Wunsch in der Villa der Menzels, weil Menzel Witwer war – ein Wunsch, den sie jetzt bitter bereute. Dass sie ständig die Eigelbflecken aus Hasenbuschs Anzügen entfernen musste, während ihre Töchter greinten und an ihrer Schürze zogen, störte sie weniger als das verhaltene Kichern der Ehefrauen der Kollegen ihres Mannes, das sich stets einstellte, wenn diese auf offiziellen Feiern Hasenbuschs ansichtig wurden. Kurzum, sie drängte ihn, einen Ortswechsel vorzunehmen.
Auch die juristische Fakultät wurde unruhig. Man traf sich zu einem konspirativen Treff, von dem Hasenbusch weder etwas wusste noch es ahnte.
„Wir haben einen Fehler gemacht, meine Herren Kollegen“, begann der Strafrechtler Dr. Galgener. „Die Straftaten in der Fakultät, angefangen von Beleidigung über Sachbeschädigung bis hin zu Hausfriedensbruch, nehmen stündlich zu. Hasenbusch treibt es zu heftig. Ein bisschen rechts, bitte ja, aber alles muss seine Grenzen haben. Man sollte darüber nachdenken, den Kollegen Hasenbusch hinwegzuloben.“
„Loben nützt nichts“, warf Dr. Malochius, der Arbeitsrechtler, ein. „Wir werden ihn aus dem Dienst entfernen müssen, und das wird nicht einfach sein. Hasenbusch ist Beamter wie wir alle. Ist ihm denn irgendeine dienstliche Verfehlung nachzuweisen, Herr Kollege Galgener? Es wäre hilfreich!“
„Leider nein“, entgegnete Galgener.
„Dann werden wir wohl nicht umhinkommen, den Kollegen Hasenbusch freiwillig zur Aufhebung seines Arbeitsvertrages zu bewegen. Das dürfte schwierig sein“, gab der Notarrechtler Dr. Erbenspeck zu bedenken. Der Wirtschaftsrechtler Dr. Theuerzins wusste Rat.
„Es gibt nur einen einzigen Weg, unser Vorhaben in die Tat umzusetzen, meine Herren. Und der heißt: Geld. Ihm muss eine derart hohe Abfindung angeboten werden, dass er freiwillig seinen Arbeitsvertrag und gleichzeitig seinen Beamtenstatus aufkündigt, mit allen seinen Privilegien.“
„Doch seinen Professorentitel wird er wohl behalten“, bemerkte Dr. Erbenspeck. „Dagegen können wir nichts machen.“
„Ach was, Titel“, wiegelte Dr. Galgener ab und verzog sein Gesicht in spöttischer Weise, „die nützen nur was, wenn sie auch was bringen. Viele sind sowieso nachgeschmissen oder gekauft.“
Vier Wochen später teilte die Universitätsleitung Hasenbusch mit, dass sie dazu bereit sei, eine Abfindung von DM 500 000.00 zu zahlen, wenn Hasenbusch freiwillig sein Amt unter Aufhebung seines Arbeitsvertrages zur Verfügung stelle.
Nach einer Woche Bedenkzeit entschied sich Hasenbusch, darauf einzugehen. Doch weitere Kalamitäten sollten ihn heimsuchen.
Seine Ehefrau Hildegard war zufällig auf eine seiner Kreditkartenabrechnungen gestoßen, unter der sich eine Abbuchung des „Club Kokett“, Leinedorfer Landstraße 52, in Höhe von DM 222,20 befand. Hildegard Hasenbusch geb. Menzel war zwar nicht sonderlich mit optischen Reizen gesegnet, aber das hatte sich zu Hasenbuschs Schaden weder auf ihren Instinkt noch auf ihre Intelligenz niedergeschlagen.
„Du warst im Puff gewesen, du Schwein!“
Hasenbusch versuchte, zu mäßigen. Seine Stimme klang ungewohnt dünn.
„Das war eine Bar mit etwas Striptease. Wir haben den Junggesellenabschied eines Kollegen gefeiert. Zum Schluss habe ich ihm ausgeholfen, weil er nicht genug Bargeld bei sich hatte.“
„Hältst du mich für blöd? Ich bin hingefahren und habe mir den Laden angeguckt. Seit wann haben Bars zwei Stockwerke und rotverhangene Fenster im Obergeschoss? Denkst du, ich habe Lust, mir von dir einen Tripper zu holen?“
„Dafür habe ich Neuigkeiten, die dir gefallen werden, meine Gute. Mit einem Ortswechsel bin ich jetzt einverstanden. Ich könnte meine Stelle in Göttingen kündigen und wir würden fortziehen und von Neuem anfangen. Freust du dich?“
„Das kannst du mit Schuhwichse auf Klopapier schreiben und dir hinter die Ohren stecken“, schrie Hildegard. „Denkst du, ich bin bereit, mit dir unzuverlässigem Ungeheuer das Risiko einzugehen, mich und meine Kinder in einer neuen Stadt von dir abhängig zu machen? Komme was wolle, wir bleiben hier in Göttingen.“ Am gleichen Tag warf sie ihn aus dem ehelichen Schlafzimmer hinaus.
Hasenbusch fand, seine Ehefrau lasse den gehörigen Respekt ihm gegenüber vermissen. Schließlich war er es gewesen, der sie aus ihrer Unscheinbarkeit erlöst und ihr zudem die Ehre angetan hatte, die Unberührtheit zu nehmen. Eine Scheidung würde wohl unumgänglich sein. Derlei Gedanken beschäftigten ihn pausenlos und ließen ihn befürchten, dass seine ihm zugesicherte Abfindung durch eine Scheidung dahin schmelzen könne. Er beriet sich dahingehend mit seinem Kollegen Dr. Erbenspeck, dem Ordinarius für Notarrecht.
Erbenspeck, selbst daran interessiert, dass Hasenbusch Göttingen verlasse, präsentierte ihm daraufhin ein feingehäkeltes Vertragsgespinst. Es sah vor, Hasenbusch solle seinen Abfindungsvertrag derart gestalten, dass ein kleiner Teil des Geldes in eine Minipension flösse, die dann mit der Ehefrau und den Töchtern wegen der Unterhaltsverpflichtung geteilt werden müsse. Der Löwenanteil der Abfindung solle erst nach dem Abschluss des Scheidungsverfahrens gezahlt werden, auf diese Weise sei die lästige Klippe des Zugewinnes zu umschiffen. Hasenbusch stimmte zu, Erbenspeck setzte den Vertrag auf und leitete ihn an die Universitätsverwaltung weiter, während Hasenbusch die Scheidung einreichte.
Nach einem Vierteljahr war alles gelaufen. Hasenbusch war im beiderseitigen Einvernehmen geschieden, seine Ehefrau mit den beiden Töchtern und dem Schwiegervater wieder allein, die Fakultät hatte sich von ihrem unliebsamen Professor befreit und Hasenbusch war um DM 450 000, 00 reicher geworden. Alle waren zufrieden – sah man einmal von dem dementen Professor a.D. Dr. Justinian Menzel ab, dessen Gefühle kaum zu spekulieren waren.
Die Gedanken an einen neuen Aufbruch beflügelten Hasenbusch. Unbeeinträchtigt von demotivierenden Selbstzweifeln hinderlicher Art machte er sich daran, seine weitere Zukunft zu planen, die ihm angesichts seiner gloriosen Vergangenheit mehr als aussichtsreich erschien. Als ihm eine zum Verkauf anstehende Rechtsanwaltspraxis in Frankfurt am Main angeboten wurde, griff er zu.
Frankfurt, diese wolkenkratzende Kapitale der Banken und Firmen, dieser Hort des Mammons, des verdienten und unverdienten, schien ihm geradezu prädestiniert, an diesem Platz die Früchte seiner überbordenden juristischen Intelligenz zu ernten. Nachdem er sich in der großen Altbauwohnung eines opulenten Hauses aus der Gründerzeit mit einer übernommenen Kanzlei etabliert hatte, machte er sich daran, in vorausschauender Weise seine Finanzen zu ordnen. Zu diesem Zweck verteilte er den Rest seiner Abfindung, der immer noch mehr als 400.000 DM betrug, stückchenweise auf eine Anzahl Frankfurter Banken. Von Zeit zu Zeit hob er davon Summen in Bargeld ab und deponierte sie in dem Schließfach seiner Hausbank, bis er über die Ausgangssumme in bar verfügte. Als nächsten Schritt besorgte er sich einen kleinen schwarzen Koffer, auf dessen Verkauf die Frankfurter Lederwarengeschäfte spezialisiert waren, füllte ihn mit den Geldscheinen und machte eine kurze Vergnügungsreise in die Schweiz, die er mit leerem Koffer wieder verließ.
Hast für die Zukunft vorgesorgt, frohlockte Hasenbusch, niemand mehr kommt an dein Geld heran.
Doch geschäftlich lief es nicht so gut. Zwar blieben die alten Kunden der Kanzlei treu, starben aber langsam weg, weil sie sich meistens in einem ähnlichen Alter befanden wie sein Vorgänger, der sie aus Altersgründen an Hasenbusch verkauft hatte. Zudem musste Hasenbusch zu seinem Leidwesen feststellen, dass sein Fachgebiet – Staats- und Völkerrecht – sich wenig für die Vermarktung in einer freien Rechtsanwaltspraxis eignete. Allmählich trat jedoch ein Lichtschein zutage.
Die Kanzlei lag am Rand des Frankfurter Bahnhofsviertels, einem Rotlichtbezirk, durchmischt mit Spielhöllen und Wettbüros. Es dauerte nicht lange, bis die dort Tätigen an seine Tür klopften und seinen Rat begehrten. Es handelte sich meistens um Strafverteidigung oder zivile Auseinandersetzungen; kein Problem für Hasenbusch, denn diese Aufgaben gehören zum Rüstzeug eines jeden Juristen. Hasenbusch konnte sich erfolgreich in mehreren Prozessen behaupten, wobei ihm seine natürliche Verschlagenheit zugutekam. Zudem arbeitete er gern im Zwielicht und so geschah es, dass er sich in dieser Szene zum gesuchten Anwalt entwickelte. Dabei stieß er auf eine neue Quelle.
Die Damen des Milieus, sozusagen ihr tragender Unterleib, waren häufig Kunden bei den Frankfurter Schönheitschirurgen, die ebenfalls gut von ihnen lebten. Es blieb nicht aus, dass mitunter bei diesem diffizilen Geschäft Misserfolge oder Unzufriedenheiten zurückblieben, sodass Hasenbusch genötigt wurde, einige Haftungsprozesse auszufechten. Sein Fleiß und ein paar Fortbildungskurse führten binnen kurzem dazu, dass er die Tafel vor seiner Kanzlei um den Begriff „Medizinrecht“ erweitern konnte.
Bei einem dieser Prozesse lernte er Ivica kennen, eine Kroatin, die als Zeugin auftrat. Ivica arbeitete als selbständige und ambulante Visagistin für mehrere Bordelle in der Szene. Hasenbusch war von ihr beeindruckt; genau sein Typ, wasserblonde Haare, üppige Figur und ein Gesicht mit einer Ausstattung, die Temperament und einen Hauch von Zügellosigkeit versprach: knallroter Lippenstift, geschwungener Lidschatten und überbordende angeklebte Wimpern. Hasenbusch verabredete sich nach dem Prozess mit ihr. Die Dinge nahmen ihren Lauf, es dauerte nicht lange und Hasenbusch ging eine zweite Ehe ein. Ivica genas bald darauf eines Töchterleins, welches die von ihm gezeugte Töchterschar um ein weiteres Mitglied bereicherte.
Prächtige Zeiten kamen. Ivica kannte sich in der Szene bestens aus und versorgte ihren Mann mit Insiderwissen, was er sich für seine Prozesse zunutze machen konnte. Irgendwann fing er an, sich auch an Immobiliengeschäften zu beteiligen. Durch seine Notartätigkeit kannte er sich bereits auf dem Markt aus und vermittelte gegen Provision den einen oder anderen Deal im Bahnhofsviertel. Es brummte. Hasenbuschs kauften für ihre Wohnzwecke einen üppigen Bungalow am Stadtrand, Töchterchen Alina wuchs heran und besuchte bereits die Oberstufe eines Frankfurter Gymnasiums, das Geld sprudelte herein und Hasenbusch machte sich oft mit Frau und Töchterlein zu Kurzurlauben in die Schweiz auf, denn in der Szene zog man die gute alte Barzahlung dem geschwätzigen Überweisungsweg allemal vor.
Zu seinen Töchtern aus erster Ehe hatte er so gut wie keinen Kontakt mehr. Sie waren dabei, ihre Berufsausbildung zu beenden, sodass ihm in Kürze wieder der Teil seiner Pension aus der Göttinger Zeit zufallen würde, den er als Unterhaltsleistung abgeben musste. Seine Exfrau Hildegard hatte wieder geheiratet, ebenfalls einen Juristen, der in der Verwaltung des Landkreises Göttingen damit beschäftigt war, auf Anweisung seiner Vorgesetzten die Statistiken des Amtes sorgfältig zu frisieren, sodass sie juristischen Anforderungen standhielten. Sie war also finanziell unabhängig. So hatten alle eine sinnvolle Aufgabe. Es lief bestens.
Bei Besprechungen mit den Erben eines Frankfurter Grundstücksbesitzers wegen dessen Testaments stieß Hasenbusch auf etwas, das ihm wie die Chance seines Lebens vorkam.
Dem Erblasser hatte ein gesamter Straßenzug am Rand des Bahnhofsviertels gehört. Es waren in die Jahre gekommene Altbauten, die er nie renoviert hatte. In ihnen wohnten langjährige Mieter für eine schändliche niedrige Miete. Hasenbusch rümpfte die Nase. Die Erben waren zerstritten und weder fähig noch willens, diese in die Jahre gekommene Bausubstanz in irgendeiner Weise zu verwerten.
Doch Lage und verkehrsmäßige Anbindung waren hervorragend.
Man müsste das ganze Gerümpel abreißen und durch ein modernes Geschäfts- und Wohnzentrum ersetzen. Ob man das später verkaufen oder allein betreiben würde, würde die Zukunft zeigen. Hasenbusch besprach sich tagelang mit seinen Bekannten aus dem Kiez und kam schließlich überein, den Erben die Grundstücke zunächst für einen hohen Preis abzukaufen, zu dem keiner einsteigen würde. Für die Vermittlung sollte Hasenbusch eine üppige Provision zustehen, dafür erklärte er sich bereit, als einer von vier Investoren mit einzusteigen. Für den Abriss und die Bebauung brauchte man zwar die Genehmigung der Frankfurter Baubehörde, dabei kam ihnen aber zupass, dass der zuständige Baudezernent mit Hasenbusch befreundet und zudem Stammgast in einem der Bordelle eines seiner Geschäftspartner war.
Das Geschäft kam in Gang. Die vier Partner nahmen Kredite bei der Bank auf und kauften den Erben die Grundstücke ab, wobei Hasenbusch als Notar noch einmal kräftig abkassierte. Sofort stiegen die Käufer in die Planung ein, ließen von einem Architekturbüro Vorschläge erstellen, bereiteten die Kündigung der Mieter vor und reichten den Antrag für den Abriss der Altbauten der Baubehörde ein.
Dann passierte Übles. Der zuständige Baudezernent verstarb plötzlich, die Denkmalbehörde erklärte die Altbauten für erhaltungswürdig, stellte sie unter Denkmalschutz und der Antrag auf Abriss wurde abgelehnt. Der Wert der Immobilien sank daraufhin ins Bodenlose und die Banken forderten ihre Kredite zurück. Es folgte ein Notverkauf der Liegenschaften. Das Geld, welches die Investoren selbst hineingesteckt hatten, war verloren, auch Hasenbuschs Villa musste verkauft werden. Die Familie Hasenbusch zog in eine kleine Wohnung neben der Kanzlei um. Zusätzlich kam Hasenbusch noch in Schwierigkeiten, weil er sich weigerte, die Provision für den Grundstückskauf an seine Mitunternehmer zurückzuzahlen, welche ihn sofort unter Druck setzten, und zwar mit den Mitteln, welche im Kiez üblich waren. Alles das erregte den Unmut von Hasenbuschs Frau Ivica. Nachdem sie miterleben musste, wie eines Tages zwei stämmige Russen vor der Tür standen und nach Hasenbusch fragten, verschwand sie plötzlich nach Mexico, zusammen mit einem kiezbekannten Drogendealer, zu dem sie schon länger ein Verhältnis pflegte. Um ihre Tochter Alina kümmerte sie sich nicht. Die war mittlerweile volljährig und studierte in Gießen.
Die ganze Misere brachte Hasenbuschs Kanzlei fast zum Einsturz. Der grandiose Misserfolg sprach sich sofort herum und der Kiez suchte sich andere Anwälte. Hasenbusch selbst war so abgebrannt, dass er die Miete für die Wohnung seiner Tochter nicht mehr zahlen konnte. Als für mehrere Monate Mietschulden aufgelaufen waren, verklagte ihn ihr Vermieter und Hasenbusch, der seine Zahlungsunfähigkeit betonte, wurde vom Gericht aufgefordert, darüber eine eidesstattliche Erklärung abzugeben.
Jetzt wurde Hasenbusch vorsichtig.
Er dachte an den schwarzen Koffer und die pittoreske Schweiz mit ihren Bergen und Seen und der lila Kuh darin. Es war in letzter Zeit vorgekommen, dass CDs mit Daten von Schweizer Konten in Umlauf kamen, die von den Steuerbehörden aufgekauft wurden. Sollte ihm das passieren, nachdem er die eidesstattliche Erklärung abgegeben hatte, hätte er sich des Meineides schuldig gemacht, würde unweigerlich in den Knast wandern und, was noch schlimmer war, seine Lizenz als Rechtsanwalt verlieren.
Also lehnte er die Abgabe der eidesstattlichen Erklärung ab. Die Dinge nahmen jetzt ihren Lauf. Der Gläubiger war mit der Entwicklung des Verfahrens unzufrieden und beantragte über das Gericht Beugehaft für Hasenbusch, ein probates Mittel, um unwillige Schuldner zur Abgabe der eidesstattlichen Erklärung zu bewegen. Hasenbusch dachte nach.
Der Gläubiger war ein selbständiger Fliesenlegermeister mit einem schlecht gehenden Betrieb, von daher dringend auf den Eingang seiner Mietzahlungen angewiesen. Auf der anderen Seite würde die Beugehaft teuer für ihn werden, denn er musste die Ausgaben für Kost und Logis des Schuldners sowie die anfallenden Verwaltungskosten selbst tragen. Hasenbusch schätzte also, es würde nicht lange dauern, bis dem Gläubiger die Puste ausginge, vielleicht eine Woche. Eine Woche Einzelzimmer in einem deutschen Gefängnis ist zu ertragen, überlegte Hasenbusch, den die Bundeswehr abgehärtet hatte. Also packte er den kleinen schwarzen Koffer – einen größeren würde er nicht brauchen, denn in ihn passten Schlafanzug, zweimal Unterwäsche und Zahnbürste hinein – und stand an einem Montagmorgen vor der Tür des Gefängnisses Frankfurt-Preungesheim. Wenige Stunden später bezog er eine saubere Einzelzelle.
Es kam alles so, wie es ihm sein messerscharfer Verstand vorhergesagt hatte.
Der Wärter schloss auf und kam zur Tür herein.
„Guten Morgen, Herr Professor. Ihr Gläubiger hat die Haftanordnung abgebrochen. Sie können also gehen. Bitte packen Sie Ihre Sachen. In einer Viertelstunde komme ich wieder.“