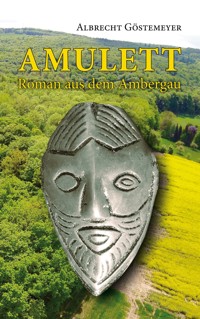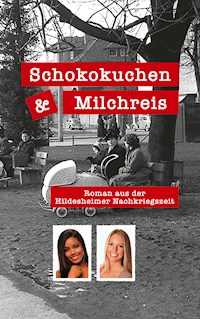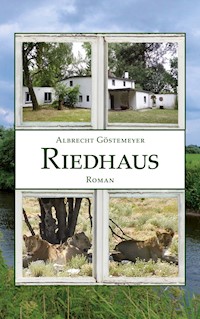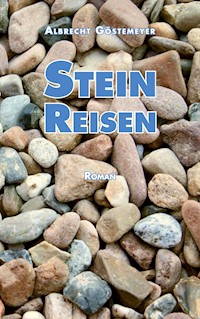Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Chirurg führt einen Routineeingriff durch, ein Pärchen verbringt seine Flitterwochen auf einem Kreuzfahrtschiff. Ein Mann geht durch einen Park, ein Pfarrer plant eine Beerdigung. Eine Frau in ihrem Schönheitswahn möchte sich verjüngen und ein Student geht in eine Wiener Kneipe, als noch die Habsburger regierten. Das sind alltägliche Ereignisse, die hier in einer ungeahnten Weise in skurrilen und makraben Situationen münden. Doch die Menschen in diesen zehn Geschichten verhalten sich daraufhin unterschiedlich, je nach Charakter und Temperamt. Ihre Reaktionen reichen von stoischer Ruhe, hektischer Betriebsamkeit bis hin zu jähem Entsetzen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Wildgänse
Kreuzfahrt
Landsommer
Metamorphose
Jungbrunnen
Adi
Das Klassentreffen
Das Überraschungspaket
Galatea
Der Mäusekrieg
WILDGÄNSE
Die Schranke öffnete sich, geräuschlos und langsam.
Dr. Michael Renard steuerte seinen silberfarbenen BMW auf eine etwas abseits gelegene Parkbucht zu. Sie umfasste sieben Plätze und machte möglichen Verirrten oder gewohnheitsmäßig Dreisten durch ein silberfarbenes Schild unmissverständlich klar, welchem Personenkreis sie zuzuordnen war: Chefärzte.
Er kam heute spät. Normalerweise hätte er seine frühmorgendliche Joggingrunde bereits abgeleistet und wäre in seiner Joggingkluft erschienen, um sie sich in seinem Büro abzustreifen und daraufhin seinen Körper im Bad ausgiebig den Strahlen der Dusche auszusetzen. Das eigene kleine Badezimmer war ein Privileg der Chefärzte, mühsam der Verwaltung des Sophienkrankenhauses abgerungen.
Doch der gestrige Abend hatte sich etwas in die Länge gezogen.
Er gehörte der monatlichen Veranstaltung des Rotary Clubs und Renard war turnusmäßig an der Reihe gewesen, einen kurzen Vortrag zu halten, in dem er Probleme seines Faches auf gehobene populäre und – möglichst – intelligente Weise seinen anderen Rotarybrüdern, Juristen, Architekten, Geschäftsleuten, Bankern und weiteren angesehenen Mitgliedern der großbürgerlichen Schicht seines finalen Wohnsitzes nahebringen sollte.
Na ja, dachte er wieder einmal, die erste Sahne ist der Ort nicht, hättest dir etwas Schickeres denken können, vielleicht Bad Tölz, irgendetwas anderes im Alpenvorland oder am Bodensee. Doch es hatte ihn nach getaner Ochsentour ins Lipperland verschlagen, etwas abseits der Verkehrsströme gelegen, dafür aber mit verträumter Landschaft gesegnet. Auch nicht schlecht. Grundstücke, um die Wohnträume von Daniela und den Kindern zu verwirklichen, hatte es genug und preiswert gegeben, kein Vergleich mit Oberbayern. Sein Architekt war einer der Schlüssel zum Wohlbefinden: er schaffte es, der Chefarztfamilie einen Hausbau zu ermöglichen, welcher genau die Waage zwischen Diskretion und Aufsehen hielt.
Renards Architekt kam aus Hamburg, verstand sofort und erbaute ihm einen gestylten Hangbau aus Beton und Glas; von außen nicht einsehbar, von innen mit allen Annehmlichkeiten wie Schwimmbad, Sauna und Fitnessraum gesegnet. Man muss doch zufrieden sein, dachte Renard. Selbst der nächste Golfplatz war innerhalb von zehn Minuten erreichbar. Die Kinder kamen in die Pubertät und fingen allmählich an zu knurren, weil sie ihren Heimatort als zu langweilig empfanden. Darüber machte sich Renard überhaupt keine Gedanken. In ein paar Jahren würden sie studieren. Dann würden sie sich ohnehin zerstreuen, in die deutschen Großstädte, vielleicht in das europäische Ausland oder in die USA. Ähnlich war es ihm ja selbst ergangen.
Den Titel seines Vortrages hatte er sich tagelang überlegt. Er lautete:
„Chirurgie. Addition oder Subtraktion?“
Der Verblüffungseffekt dieses Themas war bei seinen Rotarybrüdern enorm gewesen, erinnerte er sich. Genauso, wie er es erwartet hatte. Die meisten dachten dabei an irgendetwas Mathematisches: Krankenhausökonomie oder Ähnliches. In Wirklichkeit berührte das Thema die Grundprinzipien der Chirurgie.
Die Chirurgie, eine uralte Kunst, seit Jahrtausenden ausgeübt, um die Leiden der Menschen zu beseitigen oder zu lindern, hatte sich bis vor kurzem darauf beschränkt, dem menschlichen Körper etwas wegzunehmen, aus ihm herauszuschneiden. Das konnte ein Tumor sein, gutartig oder bösartig, ein schmerzender Zahn oder im heikelsten Fall ein ungeborenes Kind. Manchmal mussten verletzte Gliedmaßen oder kranke Organe entfernt werden, damit sie durch ihren Zerfall nicht den übrigen Körper und damit das Leben ruinierten.
Und das hatte sich grundlegend geändert, konnte Renard ausführen. Eine Vielzahl von chirurgischen Eingriffen nahm dem Körper nichts mehr weg, sondern fügte ihm sogar etwas hinzu. Das konnte ein fremdes Organ sein, ein künstliches Gelenk, ein Zahnimplantat oder ein Silikonkissen zur Brustvergrößerung.
Die Rotarier waren von dem Vortrag begeistert. Renard war sehr stolz auf sich. Sein Freund Christoph, Nachbar und lokaler Präsident der Rotarier, dankte ihm vor versammelter Gesellschaft. Das Danken hatte seine Folgen. Die Versammlung endete zwei Stunden nach Mitternacht und hatte damit ihren verschwiegenen Zweck in vollendeter Weise erreicht, nämlich sich in angemessener Männerrunde ab und an in dezenter Weise dem Alkoholgenuss hinzugeben.
So fühlte sich Renard etwas unwohl, als er am Morgen neben Daniela aufwachte. Seine Ehefrau hatte während des Aufwachens zur Seite geblickt und sofort verstanden.
Er stieg aus und nahm ausnahmsweise den Weg durch den Haupteingang des Sophienkrankenhauses, weil die Personalpforte durch einen Bagger versperrt war, der Erdarbeiten am Tor durchführte.
Der Eingangsbereich des Krankenhauses wirkte wie die Rezeption eines Kettenhotels. Zwei Mädels im Businesskostüm hätten ihn wahrscheinlich zuckersüß gefragt, wenn er zu ihnen gekommen wäre: „Was kann ich für Sie tun?“
Das blieb ihm erspart. Er ging mit schnellen Schritten durch die Halle, ohne einen besonderen Blick auf den Steinway-Flügel zu werfen, der die Blicke der Besucher einfing und genau neben dem Eingang zu den Funktionsräumen stand. Noch nie hatte er gehört,dass jemals darauf gespielt wurde. Doch die Vorstellung, dass irgendjemand auf den Gedanken kommen könnte, aus Dank für die Genesung eines Angehörigen darauf womöglich ein Kirchenlied zu spielen, kam ihm eigenartig vor.
Hier roch das Krankenhaus noch normal. Doch in den angrenzenden Funktionsräumen und Stationen entwickelte sich mehr und mehr ein Geruch nach Medikamenten und Desinfektionsmitteln, der sich in Richtung Intensivstation mit einem Geruch nach menschlichen Ausdünstungen vermischte.
Als er seine Station betrat – etwas später als sonst – wurde er schon dringlich erwartet. „Gibt es heute etwas Besonderes?“, wunderte er sich.
„Nein, Dr. Renard“, antwortete Dr. Schubert, sein Assistenzarzt, „aber Herr Schwertfeger ist heute wegen Darmgrippe ausgefallen. Er sollte ursprünglich die Cholezystektomie vornehmen, die heute als erster Eingriff vorgesehen ist. Weil ich die noch nie gemacht habe, müssen Sie die wohl übernehmen, Chef.“
Dr. Schwertfeger war sein Oberarzt.
Das Gedoktere ging Renard langsam auf die Nerven. Normalerweise spricht man niemanden mit „Doktor“ an, wenn man selber den Titel hat; so etwas kommt nur in schwachsinnigen Fernsehserien vor. In diesem Provinzkrankenhaus war es anders; seine ärztlichen Mitarbeiter fühlten sich wohl bemüßigt, ihn mit seinem Titel anzusprechen, um damit ihren Respekt auszudrücken, dass er ihr Chef war. Unsinn. Irgendwann müsste man darüber reden. Sie sollten ihn mit „Chef“ anreden, und fertig.
„Wie, ein halbes Jahr sind Sie schon bei uns und haben noch nie eine Galle gemacht?“, wunderte sich Renard.
„Nein, Dr. Renard.“ Schubert sprach „Renard“ nicht mit dem endständigen harten „D“, sondern am Wortende mit nasaler Verschluckung aus. Es kam immer wieder vor, dass sein hugenottischer Name seinen Gegenübern Unklarheit über dessen Aussprache bescherte.
„Dann fangen wir heute damit an, Sie machen auf und legen frei und ich passe auf. Den Rest machen wir gemeinsam.“
„Ist in Ordnung, Chef.“
Eine Viertelstunde später war es so weit. Renard und sein Team hatten sich eingeschleust; von Kopf bis Fuß stumpfgrün eingekleidet und so vermummt, dass es im Prinzip unter Fremden erforderlich gewesen wäre, Geschlecht und Identität zu hinterfragen. Die Namensschilder auf ihren Kitteln nahmen ihnen dieses ab.
Blitzsilberne Einrichtungsgegenstände, kleine Tische, Schränkchen und Ablagen rundeten die Ausstattung des hellgrün gefliesten OP ´s ab. Der Anästhesist, der „Gasmann“, wie die Chirurgen ihn verspöttelten, hatte den Patienten bereits in den schlafenden Zustand versetzt, den sie für die Ausübung ihres Handwerks benötigten.
Von dem Patienten war nicht viel zu sehen. Ein Schlauch führte in einen unrasierten Hals, die Haut mutete bräunlich an, zwei Warzen, seitlich des Kinnes angeordnet, fielen ins Auge. Die Bauchregion war inmitten des grünen Baumwolltuches freigelegt.
„Wer ist das?“
Der Anästhesist blätterte in der Krankenakte.
„Braumeister, Heinrich. Dreiundsiebzig Jahre alt und kommt aus der Landwirtschaft. Er war wahrscheinlich eine Art Knecht, soweit ich weiß.“
„Vorgeschichte?“
„Keine. Er ist wohl immer ziemlich gesund gewesen. Keine cardialen Auffälligkeiten. Sein Hausarzt hat ihn wegen rezidivierender Gallenkoliken überwiesen. Die Sonographie – hier im Haus vorgenommen – zeigt zwei dicke Gallensteine in der Gallenblase.“
Renard und Schubert schauten sich das Ultraschallbild an, das neben dem Tisch hing.
„Die wird er gleich los sein“, sagte Renard, sah Schubert an und schwenkte kurz seinen Zeigefinger, um ihm anzudeuten, er solle anfangen.
Schubert nahm sein Skalpell in die Hand. Plötzlich stutzte er.
„Da war schon einmal jemand dran, Chef!“ Er zeigte auf eine weißliche Linie am Oberbauch, die parallel zu den Rippenbögen verlief.
„Eine uralte Narbe, Herr Schubert. Fangen Sie endlich an!“ Renard wurde ungeduldig. Sein Assistenzarzt versenkte das Skalpell in die Bauchhaut und arbeitete sich durch die Schichten, bis der Bauchraum eröffnet war und Leber, Gallenblase und Teile von Magen und Dickdarm vor ihnen lagen. Renard nickte. Dann übernahm er, klemmte Gallenarterie und Gallengang ab und löste die Gallenblase mit den Steinen aus dem Leberbett. Gerade wollte er wieder an Schubert übergeben, da hielt er inne. Etwas erregte seine Aufmerksamkeit.
Am Bauchfell hing eine bonbongroße Gewebskapsel, durch einen kleinen Stiel mit ihm verbunden. Das Ding gehörte irgendwie nicht dorthin.
Renard zögerte. Er kannte natürlich das erste Gebot der Chirurgen.
Was du nicht kennst, das schneide nicht weg.
Doch in diesem Fall war alles anders. Beim besten Willen konnte man sich nicht vorstellen, dass hier etwas Wichtiges saß, welches der Körper benötigte. Auch etwas Bösartiges konnte es kaum sein, dazu wirkte es viel zu herausgelöst und solitär. Wahrscheinlich war es ein gutartiger Tumor, eine Zyste, ein Fibrom oder dergleichen. Renard befühlte den kleinen Stiel, der das Ding mit der Bauchdecke verband. Große Gefäße konnten nicht darin sein. Kurzentschlossen nahm er sein Skalpell und trennte den Stiel durch, nachdem er das Ding mit einer Klammerzange gepackt hatte. Es gab nur eine ganz schwache Blutung, die sofort stand. Die OP-Schwester reichte ihm eine Nierenschale. Renard ließ das Ding hinein plumpsen. Morgen würde er von dem Pathologen erfahren, was er hier weggeschnitten hatte.
Der Rest der OP verlief wie immer. Schubert übernahm und vernähte ohne Probleme. Dem Patienten ging es gut. Die Pfleger kamen und rollten die Trage mit ihm aus dem OP. Renard und Schubert lösten ihren Mundschutz und gingen zurück auf die Station.
Als Renard am Nachmittag auf dem Golfplatz stand, ging ihm noch einmal die OP durch den Kopf. Ein solches Ding hatte er vorher noch nie gesehen. Verfluchte Unaufmerksamkeit. Der Schläger traf den Ball viel zu sehr seitlich, sodass er in hohem Bogen ins Gebüsch flog.
Zur Mittagspause am nächsten Tag ordnete Renard den Papierberg auf seinem Schreibtisch. Wieder jede Menge Post, das meiste Werbung, wie üblich. Ein dicker Briefumschlag aus billigem grauem Papier mit dem Aufdruck „Finanzamt“ ließ den Säuregrad seines Magens anschwellen. Schwester Ute kam herein und legte ihm einen Umschlag auf den Tisch, der von der Pathologie kam. Renard riss ihn auf. Er las:
Patient: Braumeister, Heinrich.
Ein etwa kirschgroßes Gewebsstück von derber Konsistenz, bestehend aus einer Kapsel aus fibrösem Gewebe. Innerhalb der Kapsel findet sich altes Granulationsgewebe.
Das Granulationsgewebe umschließt einen Fremdkörper. Dabei handelt es sich um einen menschlichen Zahn. Dessen anatomische Konfiguration ergibt, dass es sich um einen unteren Prämolaren handelt, und zwar den P2 im linken Unterkiefer.
Diagnose: Fremdkörpergranulom.
gez. Dr. Siegfried Kattenhuber
Renard haute es um. Ein Zahn in einer geschlossenen Bauchhöhle, das hatte er noch nie gesehen und auch noch nie davon gelesen.
Er überlegte.
Natürlich gab es manchmal Versprengungen von Zähnen während der Entwicklung der Zahnleiste. Beispielsweise bei den Weisheitszähnen, die sich irgendwo in den Gesichtsschädel oder in den Unterkiefer verirren konnten, statt in die Mundhöhle durchzubrechen. Oder bei den oberen Schneidezähnen, die manchmal in die Nasenhöhle drängten.
Doch diese Zahnbewegungen fanden immer im Schädel statt. Konnte es sein, dass sich in diesem Fall ein Zahnkeim in die Bauchhöhle verirrt hatte? Das wäre eine wissenschaftliche Sensation.
Renard erlebte gedanklich, wie er auf dem Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie einen Vortrag hielt. Er sah seinen Namen bereits in den namhaften Zeitschriften für Chirurgie stehen.
Kurz entschlossen ging er hinaus und machte sich auf den Weg in die pathologische Abteilung des Krankenhauses.
Der Pathologe Dr. Kattenhuber saß in seinem Büro vor einer Tasse Tee und schob sich gerade ein Butterbrot in den Mund. Er war klein und schmächtig und wirkte in seinem Gesichtsausdruck immer etwas leidend. Das passte gut zu seinem Fach, fand Renard. Er begrüßte ihn. Sie duzten sich.
„Kannst dir ja denken, Sigi, warum ich zu dir gekommen bin. Es geht um die kleine Geschwulst von gestern, die mit dem Zahn.“
Kattenhuber nickte. „Was denkst du, wie perplex ich war, als ich den Zahn gefunden hatte?“
„Es kann sich doch nur um einen versprengten Zahnkeim handeln, der aus irgendeinem Grund in der Bauchhöhle gelandet ist. Eine wissenschaftliche Sensation!“
Kattenhuber schüttelte seinen Kopf.
„Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Der Zahn ist von Granulationsgewebe und fibrösen Fasern umgeben, auf keinen Fall irgendeiner Art von embryonalem Gewebe.“
„Na und? Der Patient ist dreiundsiebzig Jahre alt. Wer weiß, wie sich das ursprüngliche Gewebe im Laufe der Zeit verändert hat!“
Kattenhuber wurde ungehalten.
„Weißt du, Michael, es hat keinen Zweck, mit einem Chirurgen über Pathohistologie zu streiten. Vielleicht kann ich dich mit einer anderen Tatsache überzeugen. Wie erklärst du dir dann, dass der Zahn voller Zahnstein ist und eine Amalgamfüllung hat?“
Er schob Renard eine Glasschale mit dem Zahn herüber.
Renard nahm den Zahn heraus und schaute ihn sich an. In der Tat wirkte er schon sehr benutzt, mit seinem Zahnsteinknubbel an der Wurzel und seiner abgekauten Oberfläche, auf der sich eine Amalgamfüllung auftürmte.
„Und wie kommt der Zahn dahin?“
„Woher soll ich das wissen? Das musst du schon selbst herausfinden!“
Über den ganzen Tag ging Renard der Zahn nicht aus dem Kopf. Als er schweigsam beim Abendessen saß, wurde seine Ehefrau Daniela ungehalten. „Bekommst du die Lippen nur zum Essen auseinander oder könnte man vielleicht auch einmal einen Ton von dir hören, Michael? Oder schmecken dir die Scampi nicht, die ich für heute Abend frisch besorgt habe? Was ist mit dir los?“
Renard schrak zusammen.
„Mir geht eben ein Fall nicht aus dem Kopf, den ich gestern hatte.“
„Hast du jemanden umgebracht, oder was?“
Renard beruhigte sie.
„Unsinn. Es geht nur um einen Befund aus der Pathologie.“
Als er in der Nacht weitergrübelte, kam er schließlich zu einem Ergebnis.
Es konnte nur eine Möglichkeit geben, wie der Zahn in die Bauchhöhle gekommen war. Es musste sich um den eigenen Zahn des Patienten handeln. Der Patient hatte ihn sicherlich verschluckt und der Zahn war auf diese Weise in den Magen-Darmtrakt gelangt.
Nur, wie kam der Zahn aus dem Magen-Darmtrakt in die Bauchhöhle, ohne ihn auf dem natürlichen Wege zu verlassen? Vielleicht hatte er sich in einer ähnlichen Ausbuchtung wie dem Wurmfortsatz des Blinddarms verfangen, die häufig irregulär im Darm vorkommt. Im Laufe der Zeit muss er von da aus irgendwie abgestoßen worden sein. Es gibt die verrücktesten Sachen.
Am nächsten Morgen suchte Renard den Patienten in seinem Zimmer auf, dem es trotz des umfangreichen Eingriffes erstaunlich gut ging. Er saß aufrecht in seinem Bett und frühstückte. Renard blickte in ein braunes, wettergegerbtes Gesicht mit wachen Augen unter buschigen Augenbrauen. Die breiten, muskulösen Schultern, die aus der Bettdecke herausragten, zeigten an, dass der Patient sein Leben lang körperlich gearbeitet hatte. Seine dreiundsiebzig Jahre sah man ihm nicht an, wohl auch, weil seinen Kopf dichtes, dunkles Haar mit nur wenigen grauen Spuren bedeckte.
„Guten Tag, Herr Braumeister“, begrüßte Renard den Patienten, „wie geht es Ihnen?“
„Ach, Herr Doktor, ein bisschen schmerzt es, wenn ich mich bewege, sonst ganz gut.“
Renard wickelte aus einem Stück Papier die beiden Gallensteine aus und zeigte sie ihm. Braumeister zog erstaunt die Augenbrauen nach oben.
„Und wegen dieser Biester habe ich mich ein Jahr lang gequält?“ Renard nickte und sagte zu ihm: „Eines habe ich noch mit Ihnen vor. Ich wollte mir Ihre Zähne ansehen.“
„Warum denn das? Die sind immer gut gewesen.“
„Na ja“, log Renard, „es kommt manchmal vor, dass beim Einleiten der Narkose Zähne durch ein metallenes Instrument beschädigt werden. Ich wollte mich nur vergewissern, dass das bei Ihnen nicht der Fall ist.“
Der Patient öffnete den Mund und Renard leuchtete mit einer Taschenlampe hinein.
Er erblickte ein vollständiges, gesundes Gebiss ohne eine einzige Zahnfüllung, mit altersgemäßer Abkauung und frei von jeglicher Zahnfleischerkrankung. Ihm fiel fast die Taschenlampe aus der Hand.
„Alles in Ordnung mit Ihren Zähnen, Herr Braumeister“, sagte Renard mit schwacher Stimme.
„Dann kann ich ja weiter frühstücken!“
„Natürlich, und auf Wiedersehen.“
In Renards Kopf fraß es. Das Schicksal hatte ihm eine Ungebührlichkeit vor die Füße geworfen, einen Operationsfall, den er sich nicht erklären konnte. Außergewöhnlichkeiten, die waren angenehm und brachten Ansehen. Deshalb war er auch zutiefst erfreut, als er noch daran glaubte, dass es sich bei dem Fremdkörper um einen versprengten Zahnkeim handele.
Aber Unerklärlichkeiten ziehen herunter und machen depressiv.
Das ganze Wochenende verbrachte Renard auf dem Golfplatz. Voller Wut schlug er die Bälle, zum Teil gar nicht schlecht. Doch beim Putten kam er nicht in die dafür erforderliche Ruhe und musste erleben, dass ihn seine Partner erstaunt anschauten.
Daniela schüttelte nur mit dem Kopf, als er nach Hause kam. Aber sie sagte nichts. Im Moment blickte Renard durch sie hindurch, sie spürte das.
Man musste eben weitersuchen, diesmal ohne Theorie, wie ein Privatdetektiv. Hatte nicht Schubert eine alte Operationsnarbe am Bauch des Patienten entdeckt?
Am Montag suchte Renard seinen Patienten Braumeister wieder auf. Der schaute ihn erstaunt an, weil er, der schlichte Kassenpatient, nicht mit dem Besuch des Chefarztes gerechnet hatte.
„Morgen, Herr Braumeister!“
„Guten Tag, Herr Doktor. Wenn Sie mich fragen wollen, wie es mir geht, so kann ich nur sagen: bestens! Am nächsten Wochenende möchte ich nach Hause. Dr. Schubert ist auch damit einverstanden.“
„Nein, nein, Herr Braumeister. Heute komme ich nur aus wissenschaftlichem Interesse.“
Braumeister fühlte sich geehrt.
„Wir haben während Ihrer Operation eine Narbe an Ihrer Bauchdecke entdeckt. Ist das eine Verletzung oder sind Sie schon einmal am Bauch operiert worden?“
Braumeister dachte nach.
„Ich lag nur einmal hier im Sophienkrankenhaus. Damals bin ich von einem Belgier in den Bauch getreten worden. Das ist aber schon lange her, ich muss ungefähr fünfzehn Jahre alt gewesen sein. Irgendetwas müssen sie geschnitten haben, ich kann mich noch an eine Art Narkose erinnern. Ob das eine Operation gewesen ist, weiß ich nicht mehr, deshalb habe ich auch bei den Fragen von Dr. Schubert nichts angegeben.“
„Wieso ausgerechnet ein Belgier?“
„Ach so, ein Belgier ist ein Pferd, ein Ackergaul. Die gab es früher, die hatten Hufe, so groß wie Teller. Normalerweise waren sie friedlich, aber ich hatte mich damals zu dicht heran gestellt, als unsere Stute von einem Hengst gedeckt werden sollte.“
„Können Sie sich erinnern, wann Sie damals hier im Krankenhaus gewesen sind?“ Braumeister dachte wieder nach.
„Das muss so im Herbst 1952 gewesen sein. Ich weiß das, weil ich damals nicht zu Tante Käthes Beerdigung kommen konnte.“
Na bitte, ein Hinweis.
Am Nachmittag betrat er das Büro der Krankenhausverwaltung. Gerade hatte man auf Großraum umgestellt, nicht zur Freude von Schwester Condeogratia, die dickbräsig und missmutig in ihrer Nonnentracht an einem Laptop auf ihrem kleinen Schreibtisch saß. Hinter ihr lehnte sich eine verschüchterte Praktikantin an die Wand und verschränkte verlegen ihre Arme.
„Grüß Gott, Dr. Renard. Was führt Sie zu mir?“ Sie war nicht dumm und sprach seinen Namen ohne Nasal aus. Respektlos war sie auf jeden Fall.
„Ein Patient von mir, ein Braumeister, Heinrich, ist offensichtlich im Herbst 1952 hier im Haus operiert worden. Ich hätte aus verschiedenen Gründen gern den damaligen OP-Bericht.“
Die verschiedenen Gründe interessierten Condeogratia überhaupt nicht.
„Wie stellen Sie sich das vor, nach einem halben Jahrhundert? Wir haben alles aufgehoben, das weiß ich, aber wo der Kram archiviert ist, kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Was soll das alles?“
„Ein besonderer Fall, Schwester Oberin. Ich habe den Patienten in der letzten Woche operiert. Und den OP-Bericht von damals würde ich mir sehr gerne anschauen.“
Schwester Condeogratia hielt einen Moment inne. Sie überlegte.
„Kommen Sie morgen Nachmittag wieder. Bis dahin werden wir herausbekommen, wo die Unterlagen sind, die Sie haben möchten.“
Einen Tag später.
Anja Bauer aus der Verwaltung ging ihm voraus und führte ihn zu den Archivräumen, die Unterlagen aus den fünfziger Jahren enthalten mussten.
Es ging in den Keller. Der Krankenhausgeruch verschwand und machte mehr und mehr einer papiernen Muffigkeit Platz. Sie liefen einen langen Gang entlang, Anja schloss eine Holztür auf und öffnete einen winzigen Kellerraum, der mit rissigen Holzregalen vollgestellt war. Es stapelten sich Papierhaufen an den Wänden. Die Leiste eines Regales war mit einem Etikett beklebt, welches sich bräunlich schwarz wellte und drohte, sich abzulösen und herunterzufallen. Auf dem Etikett stand: OP-Berichte 1952.
Anja ließ Renard allein.
„Am besten, Sie suchen sich aus dem Zeug das heraus, was Sie möchten.“ Renard dankte.
Das Zeug bestand aus einem Blätterstapel, gelocht und mit Klammern zusammengehalten.
Renard schlug den Stapel auf. Innen war das Papier noch weiß, wogegen die gelblichbraunen Ränder sich wölbten und bereits Risse zeigten. Offensichtlich hatte man die Berichte nicht chronologisch geordnet. Renard musste alles durchsuchen. Nach einer Weile wurde er fündig. Auf einem verblichenen Bogen stand unter einem fetten Krankenhausstempel in krakeliger Tintenschrift:
Freitag, 24. Oktober 1952
Patient: Braumeister, Heinrich, geb. 4. 7. 1937
Operationsgrund: stumpfes Bauchtrauma infolge Pferdetritt, Verdacht auf Verletzungen innerer Organe.
Äußerlich: umfangreiche Hämatome der Bauchhaut.
Nach Eröffnung der Bauchhöhle: massive Koagel im Situs. Koagel wurden entfernt und Bauchraum gespült. Inspektion zeigte massive Milzruptur, die die Entfernung der Milz in typischer Weise erforderte.
Anschließend schichtweiser Bauchdeckenverschluss. Antibiose angeordnet.
Keine besonderen Vorkommnisse.
gez. Bittener
Na also.
Renard nahm das Blatt mit, um es kopieren zu lassen. Schwester Condeogratia blickte ihn ungnädig an, als er das Büro betrat. Er sprach sie an.
„Schwester, wer war Bittener?“
„Welcher Bittener?“
„Er muss vor langer Zeit hier am Krankenhaus gearbeitet haben.“
Sie stellte ihren Laptop an und schaute ein paar Seiten durch.
„Dr. Ferdinand Bittener, geboren am 18. Januar 1889, war von 1935 bis 1956 Chefarzt der Chirurgie am Sophienkrankenhaus. Von 1942 bis 1945 wurde er eingezogen und war kriegsbedingt abwesend. Am 1. April 1956 ging er in den Ruhestand und starb am 11. Februar 1964.“„Danke.“Renard legte den Bogen mit dem OPBericht auf den Tisch der Oberschwester, nachdem er kopiert war. Er ging zurück auf seine Station.
Anja Bauer fragte die Oberschwester, was sie mit dem Papier anfangen solle.
„Zurück in den Keller. Ach was, schmeißen sie es einfach weg.“
Renards Genugtuung über den überraschenden Fund hielt nicht lange an.
Wieder und wieder las er den OP-Bericht von 1952 durch. Offensichtlich war es ein Bericht über einen vorsorglichen Eingriff bei Verdacht auf eine innere Verletzung. Bloß, ein Zahn kam darin nirgends vor.
Daniela ging sein Gegrübel allmählich auf die Nerven. Sie merkte genau, dass ihn irgendetwas permanent beschäftigte. Eine andere Frau steckte wohl nicht dahinter, das hätte ihre Instinkte geweckt. Zuzutrauen wäre es ihm gewesen; ihr Ehegatte lebte schließlich noch voll in der Paarungszeit. Doch es hatte keinen Zweck, ihn auszufragen. Männer, auch Michael, ziehen sich dann immer mehr zurück, das wusste sie. Insofern ist die ganze Bande bescheuert, dachte sie.
Irgendwann gab Renard auf. Ein ungelöstes Rätsel ist ärgerlich, doch wahrscheinlich muss man damit leben können. Auch Daniela gab ihm manchmal Rätsel auf; ging ja.
Im nächsten Monat würden sie auf die Malediven fliegen, zum ersten Mal ohne die Kinder. Tauchen, relaxen, schwimmen, lesen und alles andere, was das Leben schön macht.
Das sind auf keinen Fall besondere Vorkommnisse.
Freitag, den 24. Oktober 1952
Dr. Ferdinand Bittener ging das Treppenhaus des Sophienkrankenhauses hinauf, um seine Station zu erreichen. An die Schmuddeligkeit der Stufen und Geländer hatte er sich längst gewöhnt; der Krieg hatte alles angehalten und es würde wohl noch eine Weile dauern, bis so etwas auf Vordermann gebracht war. Hauptsache, der Betrieb lief und man konnte vernünftig operieren, ohne sich nächtelang Gedanken zu machen. In diesem Zusammenhang gingen ihm seine drei Jahre in Russland durch den Kopf. Sich ständig mit dem Körperschrott auseinander zu setzen, der jeden Tag angeliefert wurde und dann noch entscheiden müssen, wessen Lebenschancen seinen Einsatz überhaupt sinnvoll machten – nein, in eine solche Lage würde er niemals wieder kommen wollen.
Als er das Stationszimmer betrat, wendeten Schwester Ingeborg und Oberschwester Consolidata ihre Köpfe zu ihm, erstere weiß gekleidet, zweitere in Nonnentracht.
„Gibt’s was Besonderes?“, fragte er.
„Nein“, antwortete Ingeborg und schaute ihm etwas bedenklich in das Gesicht. „Wir haben heute Morgen den Patienten mit Verdacht auf innere Verletzungen auf dem Tisch. Er ist vor vier Tagen von einem Pferd getreten worden und wurde von seinem Hausarzt eingeliefert, wegen zunehmender Schmerzen und Fieber.“
Bittener kannte den Fall. Am Vortag hatte er den Patienten – Braumeister hieß er wohl – im Bett festgenagelt und ihm Penicillin verordnet. Die Bedenklichkeit seiner OP-Schwester ließ sein Gedächtnis allerdings eine Nacht zurückhüpfen.
Jeden letzten Donnerstag im Monat traf er sich mit seinen Bundesbrüdern aus der Studentenzeit, alles Burschenschaftler aus verschiedenen Verbindungen. Der Stammesname seiner Verbindung war „Saxonia“. Er gehörte schon lange zu den „Alten Herren“ und hatte nichts anderes zu tun, als die „Aktiven“, also die Studenten, finanziell zu unterstützen und im Übrigen an den Männergesellschaften der Alten Herren teilzuhaben, deren Zweck darin bestand, sich in geschlossener Gesellschaft gepflegt zu besaufen, genauso, wie sie es in ihrer Studentenzeit geübt hatten. Gestern war es wohl etwas heftig gewesen, der Salamander hatte reichlich exerziert.
Wenn du wieder mit deinen Bundesbrüdern so grauslich zechst, wäre es mir angenehm, wenn du erst am nächsten Tag wieder nach Hause kommen würdest, hatte ihm seine Ehefrau Marianne in den Kopf geschrieben. Also hatte er bei Ingeborg übernachtet.
Natürlich wusste Marianne von Ingeborg. Bittener hatte sie bereits Ende der dreißiger Jahre als OP-Schwester ausgebildet. Vorher war sie eine normale Krankenschwester gewesen. Mittlerweile war Ingeborg für ihn unentbehrlich. Sie betreute seine Patienten vor und nach den Operationen und führte alles durch, was mit Narkose zu tun hatte.
Kurz nach ihrer Ausbildung hatte er das erste Mal bei ihr übernachtet. Vorher waren es wilde Zeiten gewesen. Bittener hatte allem nachgestellt, was nicht bis drei auf den Bäumen gewesen war. Daran konnte auch seine Ehefrau nichts ändern.
Doch durch Ingeborg wurde er ruhiger. In der ersten Zeit mit ihr hatte es heftige Auseinandersetzungen mit Marianne gegeben, die nicht dulden wollte, dass er sich eine Geliebte zulegte. Mittlerweile hatte sich ein Arrangement herausgebildet; ein oder zwei Tage in der Woche verbrachte er bei Ingeborg, den Rest zu Hause. Marianne ging auch ihre eigenen Wege. Zweimal im Jahr fuhr sie zur Kur nach Baden-Baden. Dass sie sich dort mit einem Mann traf, wusste er, es kümmerte ihn nicht. Seine beiden Söhne sah er nur noch selten.
Sie waren kurz nach dem Krieg ausgewandert, einer nach Kanada, einer in die USA.
Die Beziehung zu Ingeborg bekam ihm außerordentlich gut. Hier erhielt er die nötige Aufmerksamkeit und Zuwendung, die ihm seine Frau nicht gab. Marianne war immer ein verwöhntes Ding gewesen, stammte aus reichem Hause und interessierte sich mehr für Tennis, Einkaufen und gesellschaftlichen Umgang, statt sich um ihren Mann, den mit Arbeit überlasteten Chefarzt, zu kümmern. Die alte Villa am Park, in der sie wohnten, hatte einmal ihren Eltern gehört.
Bittener ging es an diesem Morgen nicht gut. Bist dreiundsechzig Jahre alt und solltest dich beim Zechen etwas zurücknehmen, überlegte er, du verträgst es nicht mehr. Ingeborg hatte ihm am Morgen noch einen heißen Fencheltee mit Honig zubereitet, damit er wieder auf die Beine kam. Ihre körperliche Beziehung hatte sich im Laufe der Zeit etwas gewandelt; war vorher heftige Leidenschaft im Spiel, so spielte sich jetzt ihr Liebesleben mehr in den Gefilden der Zärtlichkeit ab. Auch nicht schlecht, ging es ihm im Kopf herum. Man wird eben älter.
Spätestens in vier Jahren, wenn er siebenundsechzig war, würde er seinen Abschied nehmen, das hatte er der Krankenhausverwaltung schon gesagt. Ihm fiel sein Namensvetter Ferdinand Sauerbruch ein, der im letzten Jahr gestorben war. Sauerbruch war lange Zeit ein ausgezeichneter, angesehener und weltweit berühmter Chirurg gewesen. Doch in den letzten Arbeitsjahren litt er unter Altersdemenz und musste sozusagen vom Operationstisch weggezerrt werden, damit er seine Patienten nicht umbrachte. Einen solchen Abgang wollte er sich ersparen.
Bittener störte heute Morgen obendrein sein ausgetrockneter Mund. Dazu trug auch die Zahnprothese bei, die seinen Gaumen bedeckte und so den Speichelfluss behinderte. Er fuhr mit seiner Zunge über die Wangenweichteile, um sie zu befeuchten. Dabei fiel ihm Dr. Wagner ein, sein Zahnarzt und Bundesbruder.
„Deine unteren Zähne haben auch schon massive Paradentose“, hatte er ihm gesagt, „am besten, sie werden gezogen, und ich mache dir unten ebenfalls eine Zahnprothese.“
Davor hatte Bittener Angst. Schon die obere Prothese war ihm lästig. Obwohl, Wagner hatte recht, seine unteren Zähne waren auch schon wacklig. Besonders die seitlichen kleinen Backenzähne. Einen konnte er bereits mit der Zunge ein paar Millimeter hin- und herschieben.
Gewohnheitsmäßig schob er den Gedanken daran erst einmal weg und machte sich auf den Weg in den OP.
Er hatte zwar eine sorgfältige chirurgische Händedesinfektion durchgeführt, jedoch im Gegensatz zu seinem Assistenzarzt Dr. Meinberg keine OP-Handschuhe angezogen. Bittener meinte, mit Handschuhen nicht das richtige Gefühl beim Operieren zu haben. Wenn er darauf angesprochen wurde, pflegte er zu sagen:
„Spielen Sie Klavier? Ich schon. Versuchen Sie mal, mit Gummihandschuhen Klavier zu spielen. Geht überhaupt nicht.“
Im Übrigen befand er sich in bester Gesellschaft. Auch Sauerbruch hatte nur selten mit Handschuhen operiert.
Der Patient lag bereits auf dem Tisch und hatte Beruhigungsmittel bekommen. Hinter seinem Kopf wartete Ingeborg, die die Narkose übernehmen würde. Neben ihr stand Lernschwester Karin, schaute zu und war bereit, kleine Verrichtungen zu übernehmen.
Bei dem Patienten handelte es sich um einen fünfzehn Jahre alten Jugendlichen, stämmig, muskulös und mit einer kräftigen Konstitution ausgestattet. Soweit Bittener sich erinnerte, kam er vom Dorf und arbeitete auf einem Bauernhof.
„Wie geht es dir, Heinrich?“
„Gut, Herr Doktor. Ich habe aber Angst vor der Operation!“
„Die brauchst du nicht zu haben, mein Junge“, beruhigte der Chirurg. „Wir tropfen dir jetzt etwas auf die Nase, dann schläfst du ein, und wenn du aufwachst, ist alles vorbei.“
Auf dem Gesicht des Jungen lag eine Schimmelbusch-Maske, eine Drahtmaske, die mit Gaze bespannt war. Als hätte Bittener ein Kommando gegeben, fing Ingeborg damit an, Ätherflüssigkeit auf die Maske zu tröpfeln. An der linken Seite des OP-Tisches stand Dr. Meinberg. Meinberg war für einen Assistenzarzt schon etwas alt, um die vierzig. Der Krieg hatte seine Ausbildung verzögert, und davor war er ein paar Jahre als Landarzt tätig gewesen. Sein Entschluss, auf Chirurgie umzusatteln, ging darauf zurück, dass im Gegensatz zu Landärzten Chirurgen überall fehlten.
Bittener schaute sich im Raum um. Er strotzte sozusagen vor Weißheit, als wäre überall Schnee gefallen.
Alles war in Weiß gehalten, die mit Ölfarbe gestrichenen Wände, Türen, Fenster, die Schränke, Liegen und Instrumentenwagen, die Kittel, Mützen und Umhänge und die Masken für den Mundschutz. Nur die Instrumente blitzten silbern hervor. Der Eindruck wurde etwas getrübt, weil die Einrichtung reichlich in die Jahre gekommen war. Vieles wirkte gelblich und war angestoßen, sodass an manchen Stellen dunkles Metall durch die Oberflächen der Gegenstände drang. Durch die Verglasung fiel helles Licht herein.
Der OP lag im ersten Stock des Krankenhauses und war etwas heraus gebaut, wie eine Art Erker. Die Außenflächen waren mit Glasscheiben bestückt, die durch einen gestrichenen Metallrahmen zusammengehalten wurden. Die senkrechte Fläche bestand aus Milchglas, während man bei der leicht schrägen Dachfläche Klarglas verwendet hatte, denn sie war nicht einsehbar. Bittener und sein Team konnten also die Wolken vorbeiziehen sehen, wenn sie nach oben schauten. Die Verglasung stammte noch aus einer Zeit, in der die Leistung der OP-Lampen noch nicht so stark war.
Überhaupt war das ganze Krankenhaus in die Jahre gekommen. Deutlichstes Indiz dafür stellte das scheppernde und mahlende Geräusch des Baggers dar, der in der Nähe damit beschäftigt war, ein paar Mauern einzureißen. Der Krankenhausträger hatte sich dazu entschlossen, das Haus Stück für Stück abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Auch der OP würde bald an die Reihe kommen. Nur ein Teil des Bettenhauses sollte stehen bleiben.
Die Narkose entfaltete nun ihre volle Wirkung. Bittener schob das OP-Laken zurück. Braumeisters Bauchhaut kannten sie schon; sie war blitzeblau durch eine Menge zusammenhängender Blutergüsse. Auf ein Zeichen vom Chefarzt hin begann Meinberg, sie aufzuschneiden.
Nach einiger Zeit hatte er die Bauchhöhle freigelegt. Sie spreizten den Schnitt und schauten hinein.
„Schöne Schweinerei!“, entfuhr es Bittener.
Der ganze Bauchraum steckte voller Blutgerinnsel. Man konnte schon einen Geruch erahnen. Wenn ein paar Keime angeschwirrt kämen, würden sich die Gerinnsel entzünden und zu einer deftigen Bauchfellentzündung führen, tödlich für den Patienten.
Der Chefarzt und Meinberg machten sich daran, den Bauchraum mit steriler Gaze von den Blutgerinnseln zu säubern. Zum Glück konnten sie nicht feststellen, dass neues Blut nachschoss. Bittener packte der Stress. Es ging ihm immer noch nicht gut, und das Geräusch des Baggers nervte ihn zusätzlich. Auf seiner Stirn bildeten sich Schweißtropfen. Ingeborg gab Karin einen Wink, die herbeieilte und ihm den Schweiß von der Stirn wischte.
In der Aufregung merkte er nicht, wie sich sein wackliger Zahn aus seinem Bett löste und in den Mundschutz fiel.
Als sie sich Übersicht verschafft hatten und den Bauchraum inspizierten, sagte Meinberg:
„Da ist ein massiver Milzriss. Daher die Blutungen. Wir müssen die Milz entfernen.“ Bittener nickte.
Nach kurzer Zeit waren die Ärzte fertig und spülten den Bauchraum mit Kochsalzlösung. Vorsichtig sahen sie noch einmal nach, ob sich neue Blutungen bildeten. Das war nicht der Fall.