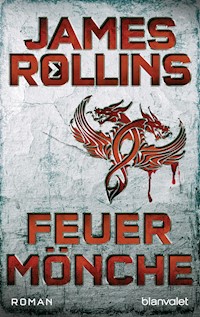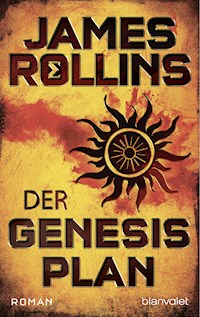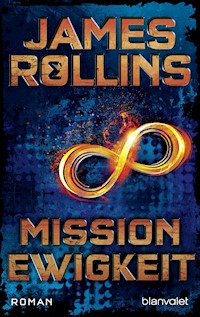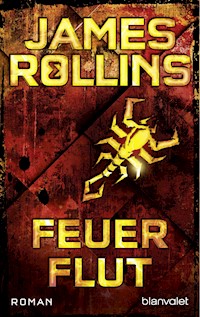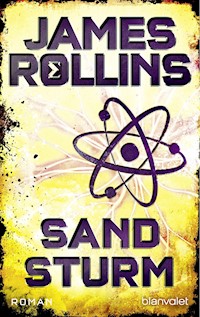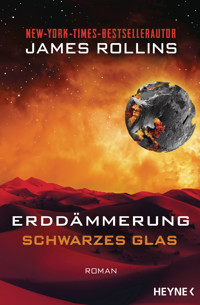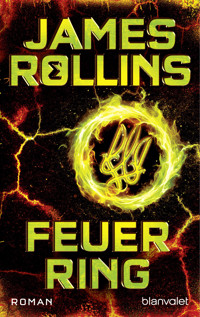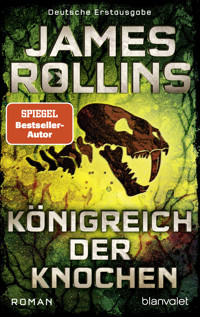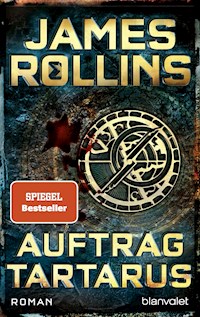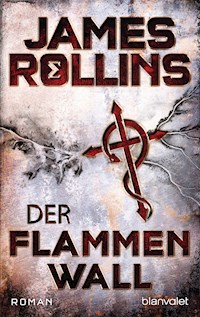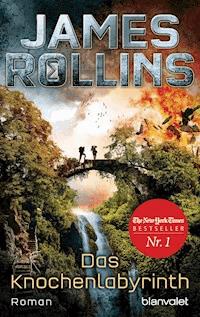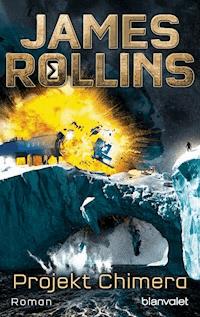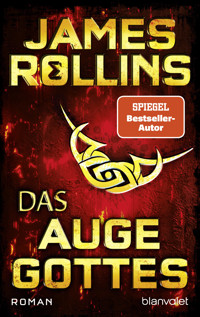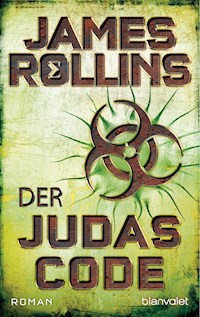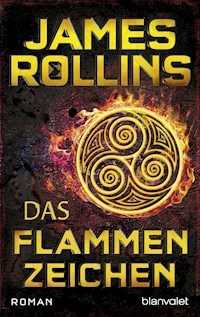
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: SIGMA Force
- Sprache: Deutsch
Der Kampf um das Schicksal der Menschheit hat begonnen – im sechsten Roman um die Topagenten der SIGMA Force.
Der Sohn des einflussreichen US-Senators Sebastian Gorman wurde in Afrika ermordet. Painter Crowe und die Agenten der SIGMA Force werden mit der Aufklärung beauftragt. Bald finden sie heraus, dass eine verbrecherische Söldnerorganisation, genannt »Die Gilde«, hinter dem Angriff steckt. Doch was plant sie? Und was hat die Tat in Afrika mit der Ermordung eines Priesters in Rom zu tun. Painter Crowe und seinem Team bleibt nicht viel Zeit, dieses Rätsel zu lösen. Denn nichts weniger als das Schicksal der Menschheit steht auf dem Spiel!
Verpassen Sie nicht die weiteren in sich abgeschlossenen Romane über die Topagenten der SIGMA Force, zum Beispiel den neusten packenden Action-Roman Auftrag Tartarus!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 642
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »The Doomsday Key« bei William Morrow, New York.
Für Mom, in aller Liebe
DOOMSDAY-BUNKER
NORDEUROPA UND POLARKREIS
VORBEMERKUNG ZUM HISTORISCHEN HINTERGRUND
IM ELFTEN JAHRHUNDERT unterzog König William von England sein Königreich einer umfassenden Bestandsaufnahme. Deren Ergebnisse wurden im Reichsgrundbuch festgehalten, dem sogenannten Domesday Book, das eine der umfassendsten Quellen zum Leben im Mittelalter darstellt. Die meisten Historiker stimmen darin überein, dass dieser gewaltige Bericht vor allem als Grundlage der Besteuerung diente. Bewiesen ist dies freilich nicht. Vieles liegt noch immer im Dunkeln, zum Beispiel weiß man nicht, weshalb der Bericht so rasch erstellt wurde und weshalb einige Orte mit dem lateinischen Wort für »verwüstet« gekennzeichnet sind. Aufgrund der seltsamen Umstände der Erhebung und deren umfassender Genauigkeit bedachten die Menschen der damaligen Zeit den Wälzer zudem mit einem verstörenden Spitznamen. Er wurde bekannt als das »Doomsday Book«, das »Buch des Jüngsten Gerichts«.
Im zwölften Jahrhundert hatte ein irischer katholischer Priester namens Mael Maedoc, der später der heilige Malachias wurde, während einer Pilgerreise nach Rom eine Vision. Im Zustand der Verzückung erhielt er Kenntnis von den Namen sämtlicher Päpste, die bis ans Ende der Welt der Kirche vorstehen würden. Diese Liste – eine kryptische Charakterisierung von einhundertzwölf Päpsten – wurde aufgezeichnet und in den vatikanischen Archiven verwahrt, doch das Buch verschwand vorübergehend und tauchte erst im sechzehnten Jahrhundert wieder auf. Einige Historiker halten das wiederentdeckte Buch für eine Fälschung. Die Charakterisierung der Päpste aus den zurückliegenden Jahrhunderten erweist sich jedoch als erstaunlich exakt – bis hin zum gegenwärtigen Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Benedikt dem XVI. In der Prophezeiung des heiligen Malachias wird der gegenwärtige Papst als De Gloria Olivae aufgeführt, von der Herrlichkeit der Olive. Der Benediktiner-Orden, von dem der Papst seinen Namen hat, führt tatsächlich einen Olivenzweig im Wappen. Besonders verstörend aber ist der Umstand, dass Papst Benedikt XVI. der einhundertelfte Papst ist. Der eigentümlich exakten Prophezeiung des heiligen Malachias zufolge endet die Welt mit dessen Nachfolger.
VORBEMERKUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN HINTERGRUND
IN DEN JAHREN 2006 bis 2008 verschwand ein Drittel aller Honigbienen der Vereinigten Staaten – sowie ein Großteil der Bienen in Europa und Kanada. Eben noch von wimmelndem Leben erfüllte Bienenstöcke waren auf einmal leer, als wären die Bienen ausgeflogen und nicht mehr zurückgekehrt. Das große Bienensterben löste sensationsheischende Schlagzeilen und allerlei Ängste aus. Was ist damals wirklich geschehen?
Dieses Buch birgt die Antwort … Am erschreckendsten freilich ist, dass sie der Wahrheit entspricht.
Während der letzten Heimsuchung der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche wird Petrus der Römer herrschen, der seine Schäfchen durch mancherlei Drangsal geleiten wird; hernach wird die Stadt der sieben Hügel zerstört werden, und der Höchste Richter wird über die Menschen richten.
Prophezeiung des hl. Malachias, 1139
Der Umfang der Bevölkerungsentwicklung übersteigt bei Weitem die Tragfähigkeit des Bodens, die Menschen zu ernähren.
Thomas Malthus,»An Essay on the Principle of Population«, 1798
Man soll kaufen, wenn Blut in den Straßen fließt.
Baron Nathan Rothschild,im neunzehnten Jahrhundertder reichste Mann der Welt
Frühjahr 1086 England
DIE RABEN WAREN die Vorboten.
Als eine Pferdekutsche inmitten von Gerstenfeldern über den von Schlaglöchern übersäten Weg rollte, erhob sich ein Schwarm Raben in die Luft. Die Vögel schwangen sich in den blauen Morgenhimmel empor und flatterten ängstlich umher, doch es steckte mehr dahinter als die übliche Panikreaktion. Die Raben kreisten aufgeregt und wogten durcheinander. Über dem Weg stießen sie zusammen und fielen vom Himmel. Die Vögel klatschten auf die Straße, Flügel brachen, Schnäbel splitterten. So blieben sie in den Wagenfurchen liegen und schlugen kraftlos mit den Flügeln.
Am verstörendsten aber war die Stille.
Kein Gekrächze, kein Geschrei.
Nur das panische Flügelschlagen und dann der Aufprall der gefiederten Körper auf dem harten Boden und dem Schotter.
Der Kutscher bekreuzigte sich und zügelte das Pferd. Mit trägem Blick musterte er den Himmel. Das Pferd warf den Kopf und schnaubte in der Morgenkühle.
»Fahr weiter«, sagte der Reisende. Martin Borr war der jüngste der königlichen Coroner und aufgrund einer geheimen Weisung König Williams in diese Gegend gekommen.
Während Martin den schweren Umhang raffte, dachte er an das Schreiben, das mit dem königlichen Wachssiegel versehen war. Angesichts der drückenden Kriegskosten hatte der König zahlreiche Beamte ins Land entsandt, welche den Auftrag hatten, die Ländereien und Besitztümer seines Reichs einer umfassenden Bestandsaufnahme zu unterziehen. Die Ergebnisse wurden in einem großen Buch festgehalten, dem Domesday Book, das von einem einzigen Gelehrten auf Lateinisch niedergeschrieben wurde. Das Reichsgrundbuch sollte als Grundlage zur Bemessung der Steuern dienen, die der Krone zustanden.
Zumindest wurde dies behauptet.
Manche vermuteten, es gebe noch einen anderen Grund für die Erfassung der Ländereien. Sie verglichen das Buch mit der biblischen Schilderung des Jüngsten Gerichts, bei dem Gott dereinst über die Menschen nach ihren im Buch des Lebens verzeichneten Taten richten soll. Das Getuschel und allerlei Gerüchte führten dazu, dass das Reichsgrundbuch »Doomsday Book« genannt wurde, Buch des Jüngsten Gerichts.
Das kam der Wahrheit näher, als die meisten ahnten.
Martin hatte das Schreiben mit dem Wachssiegel gelesen. Er hatte zugesehen, wie der einsame Gelehrte die Erkenntnisse der königlichen Beamten akribisch in dem dicken Wälzer vermerkte. Schließlich hatte der Mann mit roter Tinte ein einzelnes Wort geschrieben.
Vastatus.
Verwüstet.
Viele Regionen waren mit diesem Wort gekennzeichnet, das besagte, dass die betreffenden Ländereien durch Krieg oder Plünderungen verwüstet worden seien. Zwei Einträge aber waren mit hellroter Tinte verfasst worden. Der eine bezog sich auf eine abgelegene Insel, die zwischen der irischen und der Küste Englands lag. Den zweiten Ort wollte Martin jetzt aufsuchen und dort auf Geheiß des Königs Nachforschungen anstellen. Er hatte Verschwiegenheit gelobt und reiste in Begleitung von drei Männern, die ihm behilflich sein sollten. Sie ritten hinter dem Wagen her.
Der Kutscher flappte mit den Zügeln und trieb das Zugpferd, einen außergewöhnlich großen Fuchs, zum Trab an. Die Wagenräder zerquetschten die zuckenden Raben, zermalmten Knochen, verspritzten Blut.
Schließlich gelangte der Wagen auf eine Anhöhe, und man sah das dahinter ausgebreitete fruchtbare Tal. Ein kleines Dorf lag in der Senke, an der einen Seite flankiert von einem aus Stein erbauten Gutshaus, an der anderen von einer Kirche mit Turm. Der Weiler umfasste mehrere Hütten und Langhäuser sowie Schafpferche und kleine Taubenschläge.
»Das is’n verfluchter Ort, Herr«, sagte der Kutscher. »Merk er sich das. Das war’n nich die Pocken, was den Ort heimgesucht hat.«
»Eben das wollen wir untersuchen.«
Etwa eine League hinter ihnen hatte die Armee des Königs die steile Straße gesperrt. Niemand kam dort durch, doch das konnte nicht verhindern, dass in den umliegenden Dörfern und Gehöften Gerüchte von seltsamen Todesfällen kursierten.
»Verflucht«, brummte der Mann, als er das Pferd wieder anziehen ließ. »Hab gehört, das Land hier hätt’ mal den heidnischen Kelten gehört. Soll ihnen heilig gewesen sein. Da drüben im Hochland find’ man noch ihre Steine.«
Mit seinem mageren Arm zeigte er zum Wald, der die himmelwärts aufragenden Hügel bedeckte. Nebel hing zwischen den Bäumen und verwandelte den grünen Wald in ein grauschwarzes Schattenmuster.
»Die haben den Ort verflucht, jawoll. Haben Unheil über die Kreuzträger gebracht.«
Martin Borr gab nichts auf derlei Aberglauben. Mit seinen zweiunddreißig Jahren hatte er bei zahlreichen Gelehrten und in verschiedenen Städten studiert, von Rom bis Britannien. Er hatte kundige Leute mitgebracht, mit deren Hilfe er die Wahrheit herausfinden würde.
Martin wandte sich um und bedeutete den drei Männern, sie sollten ins Dorf vorreiten, worauf sie sogleich lostrabten. Sie wussten, was sie zu tun hatten. Martin folgte ihnen langsam und ließ neugierig den Blick umherschweifen. Das in einem kleinen Hochlandtal gelegene Dorf Highglen war in der näheren Umgebung bekannt für seine Töpferwaren, die aus dem Lehm der heißen Quellen geformt wurden, auf die der Nebel in den oberen Waldregionen zurückzuführen war. Die Einzelheiten des Brennvorgangs und die genaue Zusammensetzung des Tons waren nur der örtlichen Gilde bekannt und wurden argwöhnisch gehütet.
Jetzt war das Geheimnis unwiederbringlich verloren.
Der Wagen rumpelte über die Straße und kam an weiteren Feldern vorbei: Gerste, Hafer, Bohnen und in Reihen angeordnetes Gemüse. Einige Felder waren erst kürzlich abgeerntet worden, andere sahen aus, als hätte man sie abgefackelt.
Hatten die Dorfbewohner vielleicht die Wahrheit geahnt?
Während der Wagen weiter ins Tal hinunterfuhr, tauchten Schafpferche auf, gesäumt von hohen Hecken, die den Schrecken verbargen. Auf den verwilderten Wiesen verwesten die aufgeblähten Kadaver Hunderter Schafe. Näher am Dorf sah man auch Schweine und Ziegen, die mit leeren Augenhöhlen dort lagen, wo sie tot umgefallen waren. Auf einem Feld war ein großer Ochse zusammengebrochen, der noch an einem Pflock angebunden war.
Als der Wagen am Dorfanger anlangte, blieb es still. Kein Hundegebell begrüßte sie, kein Hühnergegacker, kein Eselsgeschrei. Die Kirchenglocke läutete nicht, und niemand rief die Fremden an, die ins Dorf gekommen waren.
Eine tiefe Stille lastete über dem Ort.
Wie sie bald herausfinden sollten, lagen die meisten Toten in ihren Häusern. Am Ende waren sie zu schwach gewesen, um ins Freie zu gehen. Ein Leichnam aber lag bäuchlings auf dem Anger, nicht weit von der Steintreppe des Gutshauses. Der Mann machte den Eindruck, als sei er eben erst auf den Stufen ins Stolpern geraten und habe sich den Hals gebrochen. Vom hohen Wagensitz aus entging Martin jedoch nicht, wie sich die Haut über den Knochen spannte, die eingesunkenen Augenhöhlen und die Schlaffheit der Gliedmaßen.
Der Tote war ebenso ausgemergelt wie die Tiere auf der Weide. Man hätte meinen können, das ganze Dorf sei belagert und ausgehungert worden.
Hufgetrappel näherte sich. Reginald zügelte sein Pferd neben dem Wagen. »Die Kornspeicher sind gefüllt«, sagte er und wischte sich die staubigen Hände an der Hose ab. Der große, mit Narben bedeckte Mann hatte mehrere Feldzüge König Williams im Norden Frankreichs geleitet. »In den Speichern haben wir auch Ratten und Mäuse gefunden.«
Martin sah ihn fragend an.
»Ebenso tot wie alles andere. Genau wie auf der verfluchten Insel.«
Das war der Grund, weshalb man sie hierher entsandt hatte, weshalb die Dorfstraße gesperrt war und sie feierlich Stillschweigen gelobt hatten.
»Girard hat einen gut erhaltenen Toten gefunden«, sagte Reginald. »Frischer als die meisten. Ein Junge. Er hat ihn in die Schmiede gebracht.« Er deutete auf einen Holzschuppen mit Bruchsteinkamin.
Martin nickte und kletterte vom Wagen. Er musste sich Gewissheit verschaffen, und das war nur auf eine einzige Weise möglich. Als königlicher Coroner hatte er die Pflicht, den Toten die Wahrheit zu entreißen. Die blutigste Arbeit würde er jedoch dem französischen Feldscher überlassen.
Martin ging zum Tor der Schmiede. Drinnen hockte Girard vor der kalten Esse. Der Franzose hatte in König Williams Armee gedient, den Verwundeten die zerschmetterten Gliedmaßen abgesägt und sich bemüht, den Soldaten das Leben zu retten.
Girard hatte in der Mitte der Schmiede einen Tisch freigeräumt, den Jungen entkleidet und auf dem Tisch festgebunden. Martin musterte die blasse, ausgemergelte Gestalt. Sein eigener Sohn war ungefähr im gleichen Alter, doch dieser Junge wirkte viel älter als acht oder neun Jahre, aufgrund der Todesumstände irgendwie verhutzelt.
Während Girard die Messer bereitlegte, untersuchte Martin den Jungen. Er zwickte ihn und stellte fest, dass der Haut die Fettschicht fehlte. Er untersuchte die rissigen Lippen, die schuppigen Stellen am Kopf, wo das Haar ausgefallen war, die geschwollenen Knöchel und Füße; vor allem aber fuhr er mit der Hand über die vorstehenden Knochen, als läse er eine Landkarte mit den Fingern: Rippen, Kiefer, Augenhöhle, Schambein.
Was war geschehen?
Martin wusste, dass die eigentlichen Antworten sehr viel tiefer lagen.
Girard näherte sich dem Tisch mit einem langen Silbermesser. »Soll ich beginnen, Monsieur?«
Martin nickte.
Eine Viertelstunde später glich der Leichnam des Jungen einem ausgeweideten Schwein. Der Arzt hatte die Haut von der Leistengegend bis zum Schlund aufgespreizt und am Holztisch festgenagelt. Die Eingeweide ruhten fest gepackt in der blutigen Körperhöhle, aufgebläht und rosig. Die bräunlich-gelbe Leber war unter den Rippen stark angeschwollen, viel zu groß für ein Kind, das nur noch Haut und Knochen war.
Girard griff in die kalte Bauchhöhle.
Martin fasste sich an die Stirn und bat mit einem stummen Stoßgebet um Vergebung für diesen Übergriff. Der Junge konnte ihnen keine Absolution mehr erteilen, sondern nur noch ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigen.
Girard zog den Magen hervor, gummiartig und weiß, verbunden mit der angeschwollenen dunkelroten Milz. Mit ein paar Schnitten löste der Franzose das Organ und legte es auf den Tisch. Mit einem weiteren Schnitt öffnete er den Magen. Eine grünliche Mischung aus unverdautem Brot und Getreide quoll wie aus einem verdorbenen Füllhorn hervor.
Ein übler, durchdringender Geruch stieg auf. Martin schlug die Hand vor Mund und Nase – nicht um sich vor dem Gestank zu schützen, sondern als Reaktion auf die grauenhafte Gewissheit.
»Verhungert, das ist mal klar«, sagte Girard. »Aber der Junge ist mit vollem Bauch verhungert.«
Martin wich zurück. Auf einmal fröstelte er. Jetzt hatten sie den Beweis. Um sich letzte Gewissheit zu verschaffen, würden sie noch ein paar andere Leichen untersuchen. Doch offenbar war die Todesursache hier die gleiche wie auf der Insel, einem Ort, der im Domesday Book als »verwüstet« markiert war.
Martin starrte den ausgeweideten Jungen an. Dies war der eigentliche Grund, weshalb die Untersuchung überhaupt erst in Angriff genommen worden war. Sie sollten den Ursprung der Seuche ausfindig machen und sie ausrotten, ehe sie sich ausbreiten konnte. Die Todesursache war die gleiche wie auf der abgelegenen Insel. Die Erkrankten hatten sich den Bauch vollgestopft und waren dennoch verhungert. Sie hatten so viel in sich hineinschlingen können, wie sie wollten, doch es hatte nichts genützt.
Martin brauchte dringend frische Luft. Er wandte sich vom Seziertisch ab, trat hinaus in den Sonnenschein und ließ den Blick über die grünen, fruchtbaren Hügel schweifen. Eine Windbö strich über die Gersten-, Hafer-, Weizen- und Roggenfelder. Er stellte sich einen im Meer treibenden Mann vor, der inmitten von ungenießbarem Wasser verdurstete.
Hier war es ganz ähnlich.
Martin schauderte im fahlen Sonnenschein. Er wünschte sich möglichst weit weg von diesem Ort, doch ein Ruf lenkte seine Aufmerksamkeit nach rechts, zur anderen Seite des Dorfangers. In einer offenen Tür stand ein schwarz gekleideter Mann. Einen Moment lang fürchtete Martin schon, dies sei der leibhaftige Tod, doch dann winkte die Gestalt und zerstörte damit die Illusion. Das war Abt Orren, das letzte Mitglied ihrer Gruppe, der Vorstand der Abtei Kells in Irland. Er stand im Eingang der Dorfkirche.
»Das musst du dir mal ansehen!«, rief der Abt.
Martin stolperte ihm entgegen. Es war eher ein Reflex als das Ergebnis einer bewussten Entscheidung. Er wollte nicht in die Schmiede zurückkehren. Den Jungen würde er dem französischen Feldscher überlassen. Er überquerte den Anger und stieg die Treppe hoch.
»Was gibt es, Abt Orren?«
Der Mann drehte sich um und trat in die Kirche. »Blasphemie! «, schimpfte der irische Abt. »Der heilige Ort ist geschändet worden. Kein Wunder, dass alle tot sind.«
Martin eilte dem Abt hinterher. Der Mann war klapperdürr und wirkte in dem viel zu weiten Reiseumhang wie ein Gespenst. Er hatte als Einziger die Insel vor der irischen Küste besucht und die dortigen Verwüstungen mit eigenen Augen gesehen.
»Hast du gefunden, wonach du gesucht hast?«, fragte Martin.
Ohne zu antworten, ging der Abt weiter in die primitive Kirche hinein. Martin blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. Dies war ein düsterer, freudloser Ort, der nackte Erdboden war mit Binsen bedeckt. Es gab keine Sitzbänke, und die schweren Dachbalken hingen dicht über ihren Köpfen. Licht spendeten allein zwei hohe, schmale Fenster an der Rückwand der Kirche. Die Lichtstrahlen, in denen Staubteilchen tanzten, fielen auf den Altarstein. Früher einmal war der nackte Stein wohl von einem Tuch bedeckt gewesen, doch jemand hatte es auf den Boden geworfen, vermutlich der Abt bei seiner Suche.
Abt Orren ging zum Altar und zeigte auf den nackten Stein. Seine Schultern bebten vor Empörung. »Blasphemie!«, wiederholte er. »Heidnische Symbole in einem Gotteshaus!«
Martin trat neben ihn und beugte sich über den Altar. In den Stein waren Sonnen und Spiralen eingeritzt, außerdem Kreise und eigentümlich verschlungene Formen, alles offenbar heidnischer Herkunft.
»Wie kommen diese frommen Leute dazu, eine solche Sünde zu begehen?«
»Ich glaube nicht, dass dies die Bewohner von Highglen waren«, sagte Martin. Er fuhr mit der Hand über den Altar und betastete die verwitterten Kerben. Diese Zeichen waren ganz offensichtlich alt. Martin dachte an den Kutscher, der gemeint hatte, dieser Ort sei verflucht, ein ehemaliges Heiligtum der Kelten, deren große Steine noch immer im nebligen Hochland zu finden waren.
Martin richtete sich auf. Offenbar hatte man einen dieser Steine nach Highglen geschafft und als Altar der Dorfkirche benutzt.
»Wenn das nicht die Dorfbewohner waren, wie erklärst du dir das dann?«, fragte der Abt. Er trat vor die Wand hinter dem Altar und schwenkte den Arm vor dem großen Zeichen. Es war erst kürzlich gemalt worden, der bräunlich-roten Färbung nach zu schließen mit Blut. Es stellte einen geviertelten Kreis dar.
Martin hatte solche Zeichen bereits auf Begräbnissteinen und alten Ruinen gesehen. Dies war das heilige Symbol der keltischen Priesterschaft.
»Ein Heidenkreuz«, sagte Martin.
»Auf der Insel haben wir es an sämtlichen Türen gefunden.«
»Was hat das zu bedeuten?«
Der Abt betastete seinen silbernen Kreuzanhänger. »Genau das hat der König befürchtet. Die Schlangen, die Irland geplagt haben, wurden vom heiligen Patrick von unserer Insel vertrieben und suchen nun diese Küste heim.«
Martin wusste, dass der Abt sich auf die heidnischen Priester mit den schlangenartig gewundenen Stäben bezog – die Druidenanführer der alten Kelten. St. Patrick hatte die Heiden entweder bekehrt oder sie von der Insel vertrieben.
Das war jedoch schon sechshundert Jahre her.
Martin blickte durch die offene Kirchentür aufs ausgestorbene Dorf hinaus. Die Worte Girards gingen ihm durch den Kopf. Der Junge ist mit vollem Bauch verhungert.
Das ergab alles keinen Sinn.
Hinter ihm murmelte der Abt: »Das muss alles niedergebrannt werden. Das Erdreich ist besudelt.«
Martin nickte, vermochte seine Beklommenheit aber nicht abzuschütteln. Ließ sich das Unheil wirklich mit Flammen vernichten? Er war sich nicht sicher, eines aber wusste er: Es war noch nicht vorbei.
Gegenwart 8. Oktober, 23:55 Vatikanstadt
PATER MARCO GIOVANNI verbarg sich in einem finsteren steinernen Wald.
Die mächtigen Marmorsäulen stützten das Dach des Petersdoms und unterteilten die Bodenfläche in Kapellen, Gewölbe und Nischen. Der umschlossene Hohlraum war angefüllt mit künstlerischen Meisterwerken: mit Michelangelos Pietà, Berninis Baldachin, der Bronzestatue des heiligen Petrus. Marco wusste, dass er in dem steinernen Wald nicht allein war. Ein Jäger war hinter ihm her und lag auf der Lauer, wahrscheinlich nahe der Rückwand des Doms.
Drei Stunden zuvor hatte er eine Nachricht von seinem ehemaligen Mentor an der Gregorianischen Universität in Rom erhalten, auch er Archäologe im Dienst der Kirche. Sein Kollege hatte ihn gebeten, sich um Mitternacht im Petersdom mit ihm zu treffen.
Jetzt stellte sich heraus, dass es eine Falle gewesen war.
Marco lehnte sich mit dem Rücken an die Säule, die rechte Hand hatte er unter den linken Arm gepresst. Seine linke Seite war nass von Blut. Er war an den Rippen verletzt. Warmes Blut rann über seine Finger. Mit der Linken umklammerte er den gesuchten Beweis, einen alten Lederbeutel, nicht größer als eine Geldbörse. Er hielt ihn fest, als wollte er ihn nie mehr loslassen.
Als er die Haltung verlagerte und ins Kirchenschiff spähte, trat weiteres Blut aus. Es tropfte auf den Marmorboden. Er durfte nicht länger warten, sonst würde er zu schwach sein. Er sandte ein stummes Stoßgebet gen Himmel, drückte sich von der Säule ab und eilte durchs dunkle Kirchenschiff auf den Altar zu. Bei jedem Schritt verspürte er einen Stich in der Seite. Doch er war nicht von einem Messer, sondern von einem Pfeil verletzt worden. Das Projektil hatte seine Flanke durchbohrt und war in der nächsten Bankreihe stecken geblieben. Der Pfeil war kurz, dick und schwarz. Ein stählerner Armbrustbolzen. Marco hatte ihn aufmerksam betrachtet. Am Ende saß eine kleine rote Leuchtdiode, die im Dunkeln wie ein Feuerauge funkelte.
Da ihm nichts Besseres einfiel, flüchtete Marco geduckt. Er wusste, dass er wahrscheinlich sterben würde, doch das Geheimnis in seiner Hand war wichtiger als sein Leben. Er musste den Ausgang lebend erreichen, einen Schweizer Gardisten auf Patrouille finden und den Heiligen Stuhl warnen.
Trotz seiner Schmerzen rannte er los.
Der Papstaltar lag unmittelbar vor ihm. Der von Bernini entworfene Bronzebaldachin ruhte auf gewundenen Säulen. Marco näherte sich der linken Säule und dem dahinter liegenden Querschiff. Er konnte bereits die gewaltige Statue Alexanders VII. und die darunter befindliche Tür sehen.
Dies war der Ausgang zur Piazza Santa Marta.
Wenn es ihm gelang …
Ein Schlag in den Bauch machte all seine Hoffnungen zunichte. Er taumelte zurück und senkte den Blick. Er war von keiner Faust getroffen worden. Ein stählerner, mit Plastikfedern bestückter Schaft ragte aus dem Hemd hervor. Der Schmerz setzte mit dem nächsten Atemzug ein und breitete sich explosionsartig aus. Auch dieser Bolzen war mit einem Feuerauge besetzt. Die Leuchtdiode ruhte in einer quadratischen Einfassung am Ende des Schafts.
Marco taumelte rückwärts. Im Schatten am Eingang zeichnete sich eine Gestalt ab, bekleidet mit der bunten Uniform der Schweizer Gardisten – vermutlich Tarnung. Der Fremde senkte die Armbrust und trat aus dem Eingang hervor, in dem er gewartet hatte.
Marco wich zum Altar zurück und wollte durchs Kirchenschiff flüchten. Dann aber bemerkte er einen zweiten Schweizer Gardisten. Der Mann beugte sich über eine Sitzbank und riss den Bolzen aus dem Holz.
Marcos Entsetzen ließ den Schmerz in seinem Bauch in den Hintergrund treten. Er wandte sich dem rechten Querschiff zu, prallte aber erneut zurück. Eine dritte Gestalt trat aus einem Beichtstuhl hervor und legte eine Armbrust an.
Er saß in der Falle.
Die Basilika hatte die Form eines Kreuzes, und drei der Sprossen waren jetzt blockiert. Somit blieb nur eine Fluchtrichtung übrig. Richtung Apsis, zur Spitze des Kreuzes. Das aber war eine Sackgasse.
Gleichwohl taumelte Marco in die Apsis hinein.
Vor ihm lag der Altar des Petrusstuhls, ein gewaltiges, vergoldetes Monument mit Heiligen und Engeln, das den Holzstuhl des Petrus barg. Darüber befand sich ein ovales Alabasterfenster mit dem Heiligen Geist in Form einer Taube.
Das Fenster aber war dunkel und barg keine Hoffnung.
Marco wandte dem Fenster den Rücken zu und blickte suchend umher. Zu seiner Linken war die Gruft Urbans VIII. Die Statue des Schnitters Tod in der Gestalt eines Skeletts ragte von der marmornen Krypta des Papstes auf und kündete vom Ende aller Zeit … und vielleicht auch von Marcos Ende.
Auf Lateinisch flüsterte Marco: »Lilium et Rosa.«
Lilie und Rose.
Im zwölften Jahrhundert hatte ein irischer Heiliger namens Malachias in einer Vision die Namen aller Päpste bis zum Ende der Welt geschaut. Ihm zufolge würde es insgesamt einhundertzwölf Päpste geben. Er charakterisierte jeden einzelnen mit einem kurzen kryptischen Satz. Urban VIII. – der fünfhundert Jahre nach Malachias’ Tod geboren wurde – nannte er »die Lilie und die Rose«. Wie alle seine Prophezeiungen erwies sich auch diese als zutreffend. Papst Urban VIII. war in Florenz zur Welt gekommen, dessen Wappen die rote Lilie war.
Am verstörendsten aber war der Umstand, dass der gegenwärtige Papst der vorletzte auf der Liste des heiligen Malachias war. Dessen Prophezeiung zufolge würde das nächste Kirchenoberhaupt das Ende der Welt erleben.
Bislang hatte Marco derartigen Fantastereien keinen Glauben geschenkt – doch jetzt, da er den kleinen Lederbeutel umklammerte, fragte er sich, wie nahe sie dem Armageddon tatsächlich waren.
Marco hörte das Geräusch von Schritten. Einer der Unbekannten schlich sich an ihn heran. Ihm blieb nicht mehr viel Zeit.
Er handelte rasch. Um keine Spuren zu hinterlassen, presste er die Hand auf die blutende Wunde, ging zur Wand und versteckte den wertvollen Lederbeutel. Als er fertig war, trat er wieder in die Mitte der Apsis. Da ihm alle Fluchtwege abgeschnitten waren, sank er auf die Knie und erwartete seinen Tod. Die Schritte näherten sich dem Altar. Eine Gestalt erschien. Der Mann blieb stehen und blickte sich um.
Es war keiner der Angreifer.
Und auch kein Unbekannter.
Marco stöhnte auf, womit er den Neuankömmling auf sich aufmerksam machte. Der Mann zuckte überrascht zusammen, dann eilte er herbei.
»Marco?«
Zu schwach, um sich aufzurichten, blickte Marco den Mann an, schwankend zwischen Hoffnung und Argwohn. Das Misstrauen stand ihm jedoch ins Gesicht geschrieben. Es war Marcos ehemaliger Lehrer, der Mann, der ihn zu diesem mitternächtlichen Treffen bestellt hatte.
»Monsignore Verona...«, flüsterte Marco. Er spürte nun, dass der Mann ihn niemals hintergangen hätte. Marco hob den Arm und die leere Hand. Mit der anderen Hand umklammerte er das gefiederte Ende des Armbrustbolzens, der noch immer in seinem Leib steckte.
Ein Lichtblitz lenkte Marcos Blick nach unten. Die rote Leuchtdiode am Ende des Bolzenschafts blinkte auf einmal grün.
Nein . . .
Die Explosion schleuderte Marco über den Marmorboden. Er ließ eine Spur aus Blut, Rauch und verschmierten Eingeweiden zurück. Mit aufgerissenem Bauch blieb er zu Füßen des Altars liegen. Er verdrehte die Augen und richtete den Blick auf das hoch aufragende vergoldete Monument.
Ein Name formte sich in seinem Geist.
Petrus Romanus.
Petrus der Römer.
Dies war der letzte der in der Prophezeiung des heiligen Malachias verzeichneten Namen, der Mann, der auf den gegenwärtigen Heiligen Vater folgen und der letzte Papst auf Erden sein würde.
Da Marco in dieser Nacht versagt hatte, würde sich das Verhängnis nicht mehr aufhalten lassen.
Marcos Gesichtsfeld verdunkelte sich. Er wurde taub. Er hatte keine Kraft zum Sprechen mehr. So blickte er durch die Apsis zur Gruft Papst Urbans hinüber und fixierte das Bronzeskelett, das sich aus der Krypta erhob. An dessen knochigem Zeigefinger hing der kleine Lederbeutel, den er so lange gehütet hatte. Er dachte an das uralte Zeichen, das ins Leder eingebrannt war.
Es barg die einzige Hoffnung der Menschheit.
Mit seinem letzten Atemzug betete er zu Gott, dass dies reichen möge.
EINS
DIE SPIRALE UND DAS KREUZ
Dienstag, 9. Mai – zur sofortigen Veröffentlichung bestimmt
Viatus will künftige Nahrungsmittelversorgung sicherstellen
Oslo, Norwegen (Business Wire) – Viatus International, das weltweit führende petrochemische Unternehmen, meldet die Gründung einer neuen Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Getreide-Biogenetik.
»Die neue Abteilung hat die Aufgabe, Technologien zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität zu entwickeln, um auf diese Weise der wachsenden globalen Nachfrage nach Nahrungs- und Futtermitteln sowie Kraftstoff zu begegnen«, erklärte Ivar Karlsen, der Hauptgeschäftsführer von Viatus International.
»Mit der Gründung der Abteilung für Getreide-Biogenetik wollen wir uns dieser Herausforderung unter Aufbietung all unserer Ressourcen stellen und ein landwirtschaftliches Manhattan-Projekt auf den Weg bringen. Scheitern ist nicht vorgesehen – das gilt für unser Unternehmen und für die ganze Welt.«
In den vergangenen Jahren haben die patentierten Firmentechnologien zur Einkreuzung und Transgenetik die Erträge bei Getreide, Mais und Reis um fünfunddreißig Prozent gesteigert. Karlsen sagte, Viatus erwarte, die bereits erreichte Ertragssteigerung in den nächsten fünf Jahren noch einmal verdoppeln zu können.
Karlsen erläuterte die Notwendigkeit der Gründung einer neuen Forschungsabteilung in einer programmatischen Rede vor dem Plenum des Welternährungsgipfels in Buenos Aires. Die Weltgesundheitsorganisation zitierend, wies er darauf hin, dass ein Drittel der Menschheit Hunger leide. »Wir haben eine globale Nahrungsmittelkrise«, sagte er. »Am stärksten haben darunter die Bewohner der Dritten Welt zu leiden. Hungeraufstände breiten sich weltweit aus und destabilisieren die gefährlichsten Regionen des Planeten noch weiter.«
Die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung, sagte Karlsen, stelle eine größere Gefahr und Herausforderung dar als die Öl- und Wasserversorgung. »Sowohl aus humanitären Gesichtspunkten als auch aus Sorge um unsere globale Sicherheit sollten wir uns beeilen, die Nahrungsmittelproduktion mittels innovativer Biotechnologien voranzutreiben.«
Führend auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Innovation : Viatus International wird vom Magazin Fortune zu den hundert größten Firmen weltweit gezählt. Der Firmensitz liegt in Oslo, Norwegen. 1802 gegründet, liefert Viatus seine Produkte in einhundertachtzig Länder und verbessert mittels Forschung und Innovation die Lebensqualität. Die Aktien der Firma werden an der New Yorker Börse unter dem Kürzel VI gehandelt. Der Name Viatus leitet sich vom lateinischen via ab, dem Weg, und vita, dem Leben.
1
9. Oktober, 4:55 Mali, Westafrika
GEWEHRFEUER RISS JASON Gorman aus dem Tiefschlaf. Es dauerte einen Moment, bis ihm wieder einfiel, wo er war. Er hatte geträumt, er sei im See beim Ferienhaus seines Vaters im Hinterland von New York geschwommen. Das Moskitonetz, das sein Feldbett umhüllte, und die frühmorgendliche Kühle der Wüste holten ihn jedoch schnell in die Gegenwart zurück.
Die Kühle und die Schreie.
Mit hämmerndem Herzen warf er das dünne Laken ab und streifte das Netz beiseite. Im Innern des Rotkreuz-Zeltes war es stockdunkel, doch durch die Zeltwände flackerte rötlicher Feuerschein, der an der Ostseite des Flüchtlingslagers seinen Ursprung haben musste. Immer mehr Flammen tanzten über die vier Zeltwände.
Ach Gott …
Trotz seiner Panik war Jason sich darüber im Klaren, was da vor sich ging. Vor dem Flug nach Afrika hatte man ihn über die Lage informiert. Im Jahr zuvor waren andere Flüchtlingslager von den Rebellenstreitkräften der Tuareg angegriffen und die Nahrungsmittelvorräte geplündert worden. Nachdem der Preis für Reis und Mais sich in der Republik Mali verdreifacht hatte, waren in der Hauptstadt Hungeraufstände ausgebrochen. Drei Millionen Menschen waren vom Hungertod bedroht.
Deshalb war er hergekommen.
Sein Vater sponserte das Farmprojekt, das man auf einer fünfundzwanzig Hektar großen Fläche an der Nordseite des Lagers hochgezogen hatte und das von der Viatus Corporation finanziert und von Biologen und Genetikern der Cornell University beaufsichtigt wurde. Auf dem ausgelaugten Boden der Versuchsfelder wurde gentechnisch veränderter Mais angebaut. Die ersten Felder waren vergangene Woche abgeerntet worden. Die Pflanzen benötigten nur ein Drittel der normalen Wassermenge. Offenbar war das den falschen Leuten zu Ohren gekommen.
Jason stürzte ins Freie, barfuß. Am Abend zuvor war er mit Kakishorts und T-Shirt ins Bett gesunken. Draußen war der Feuerschein die einzige Lichtquelle.
Offenbar waren die Generatoren ausgefallen.
MG-Feuer und Schreie hallten durch die Dunkelheit. Schattengestalten huschten umher, verängstigte Flüchtlinge suchten Deckung. Da die Gewehrschüsse und das Geknatter der Maschinengewehre von allen Seiten kamen, wusste niemand, in welche Richtung er flüchten sollte.
Jason wusste es.
Krista hielt sich noch im Forschungszentrum auf. Vor drei Monaten hatte er sie in den Staaten bei der Vorbereitungsveranstaltung kennengelernt. Seit einem Monat schlüpften sie gemeinsam unter Jasons Moskitonetz. Gestern Abend aber war sie nicht gekommen. Sie hatte die Nacht über eine Gen-Analyse der frisch geernteten Maiskörner fertigstellen wollen.
Er musste sie finden.
Jason stemmte sich gegen den Strom und eilte zur Nordseite des Lagers. Wie befürchtet war das Gewehrfeuer dort am heftigsten und die Flammen am hellsten. Die Rebellen hatten es auf die Ernte abgesehen. Sollten sie die Ernte ruhig haben. Solange sich ihnen niemand in den Weg stellte, bräuchte auch niemand zu sterben. Wenn sie den Mais hatten, würden sie ebenso schnell wieder verschwinden, wie sie aufgetaucht waren. Der Mais würde auf jeden Fall vernichtet werden. Solange die Untersuchungen nicht abgeschlossen waren, war er nicht für den menschlichen Verzehr zugelassen.
Als Jason um eine Ecke bog, stolperte er über die erste Leiche, einen Halbwüchsigen, der bäuchlings in der Gasse zwischen den primitiven Hütten lag, in denen die Menschen hier lebten. Der Junge war erschossen und dann zertrampelt worden. Jason krabbelte von der Leiche weg und richtete sich auf. Er rannte weiter.
Nach einem panischen Hundert-Meter-Sprint hatte er den Nordrand des Lagers erreicht. Überall lagen Leichen, teilweise in Haufen, Männer, Frauen und Kinder. Das Lager hatte sich in ein Schlachthaus verwandelt. Die Wellblechhütten der Forschungsabteilung standen wie dunkle Schiffe in der westafrikanischen Savanne. Nirgendwo brannte Licht – da waren nur Flammen.
Krista ...
Jason war wie erstarrt. Er wollte weiterlaufen und verfluchte seine Feigheit. Doch er konnte sich nicht mehr bewegen. Tränen der Enttäuschung liefen ihm über die Wangen.
Dann vernahm er hinter sich das Geräusch von Hubschraubern. Zwei Maschinen näherten sich im Tiefflug dem Lager. Das mussten die Regierungsstreitkräfte vom nahe gelegenen Stützpunkt sein. Die Viatus Corporation hatte eine Menge Dollars verteilt, um sich den Schutz des Militärs zu sichern.
Jason stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Die Helikopter würden die Rebellen sicherlich verjagen. Mutiger geworden, trat er aufs Feld, hielt sich aber immer noch geduckt. Er wandte sich zur Rückseite der nächstgelegenen Wellblechhütte, die knapp hundert Meter entfernt war. Im tiefen Schatten würde man ihn nicht sehen, und Kristas Labor befand sich in der angrenzenden Hütte. Er konnte nur hoffen, dass sie sich dort versteckt hatte.
Als er die Hütte erreicht hatte, flammte hinter ihm blendend helles Licht auf. Vom vorderen Hubschrauber ging ein Scheinwerferstrahl aus, der über das Lager schwenkte. Jason seufzte.
Das Licht würde die Rebellen verscheuchen.
Plötzlich flammte auf beiden Seiten des Helikopters Mündungsfeuer auf. Die MGs zielten ins Flüchtlingslager. Jason schien das Blut in den Adern zu gefrieren. Das war kein chirurgischer Schlag gegen Rebellenangreifer. Hier wollte jemand die Lagerinsassen abschlachten.
Der zweite Helikopter schwenkte zur anderen Seite ab, zur Peripherie des Lagers. Aus der hinteren Luke rollten Fässer hervor, die beim Aufprall explodierten. Stichflammen schossen in den Himmel. Das Geschrei wurde lauter. Jason sah einen Mann, der nackt und mit brennender Haut in die Wüste flüchtete. Die Explosionen der Brandbomben näherten sich Jasons Position.
Er machte kehrt und rannte an der Hütte vorbei.
Vor ihm lagen Felder und Getreidespeicher, doch auch sie versprachen keine Sicherheit. An der anderen Seite des Maisfelds machte er Schattengestalten aus. Jason musste die Freifläche überqueren, wenn er Kristas Labor erreichen wollte. Die Fenster waren dunkel, und die einzige Tür war dem offenen Feld zugewandt.
Er hielt inne und schöpfte Atem. Ein kurzer Sprint, und er hätte die Hütte erreicht. Plötzlich aber flammte auch an der gegenüberliegenden Seite des Felds Feuer auf. Männer mit Flammenwerfern schritten die Ackerfurchen ab und verbrannten die noch nicht abgeernteten Maispflanzen.
Was zum Teufel hatte das zu bedeuten?
Zu seiner Rechten explodierte ein Speicherturm. Die Stichflamme schraubte sich in den Himmel empor. Trotz seines Schrecks nutzte Jason die Gelegenheit, um zur Tür der Wellblechhütte zu laufen und hindurchzuschlüpfen.
Der vom Feuerschein erhellte Raum machte einen unbeschädigten Eindruck und wirkte beinahe aufgeräumt. In der hinteren Hälfte der Hütte waren die Geräte untergebracht, die für die genetischen und biologischen Untersuchungen benötigt wurden: Mikroskope, Zentrifugen, Inkubatoren, Thermozykler, Elektrophorese-Geräte. Rechts waren die Arbeitsplätze mit den WLAN-Notebooks, dem Gerät für die Satellitenverbindung und den Ladevorrichtungen.
Bei einem der Notebooks leuchtete der Bildschirmschoner. Er stand auf Kristas Arbeitstisch, doch seine Freundin war nirgendwo zu sehen.
Jason eilte zum Tisch und fuhr mit dem Daumen übers Touchpad. Der Bildschirmschoner machte einem geöffneten E-Mail-Fenster Platz. Im Absenderfeld stand Kristas Mailadresse.
Jason blickte sich in der Hütte um.
Krista musste geflüchtet sein – doch wohin?
Er öffnete seinen eigenen Mail-Account und gab die Adresse des Büros seines Vaters auf dem Capitol Hill ein. Mit angehaltenem Atem schilderte er in knappen Sätzen den Angriff. Falls er es nicht schaffen sollte, wollte er wenigstens Bericht erstatten. Bevor er den Sendebutton anklickte, kam ihm eine Idee. Kristas Datenfiles waren noch geöffnet. Er fügte sie der Mail als Anhang bei und schickte sie ab. Krista würde nicht wollen, dass die Daten verloren gingen.
Die Mail wurde nicht sofort übermittelt. Die angehängte Datei war groß, und der Upload würde etwa eine Minute in Anspruch nehmen. Jason aber konnte nicht länger warten. Er konnte nur hoffen, dass der Akku nicht vorzeitig schlappmachen würde.
Jason wandte sich zur Tür. Er hatte keine Ahnung, wohin Krista geflüchtet war. Hoffentlich war sie in die Wüste gerannt. Das Gleiche hatte auch er jetzt vor. Dort draußen gab es zahlreiche ausgetrocknete Wasserrinnen und Mulden. Dort konnte er sich notfalls tagelang verstecken.
Als er zum Eingang eilte, tauchte darin auf einmal eine dunkle Silhouette auf. Jason schnappte erschreckt nach Luft und prallte zurück. Die Schattengestalt trat in die Hütte und flüsterte.
»Jase?«
Das Gefühl der Erleichterung war überwältigend.
»Krista...«
Er eilte ihr mit weit geöffneten Armen entgegen. Sie würden gemeinsam flüchten.
»Ach, Jason, Gott sei Dank!«
Er war nicht minder erleichtert als sie – bis sie auf einmal eine Pistole hob und ihm dreimal in die Brust schoss. Die Treffer fühlten sich an wie Faustschläge und warfen ihn zu Boden. Erst dann flammte der Schmerz auf, und die Nacht wurde noch finsterer. Von ferne hörte er MG-Feuer, Explosionen und Schreie.
Krista beugte sich über ihn. »Du warst nicht in deinem Zelt. Wir dachten schon, du wärst entkommen.«
Er hustete. Antworten konnte er nicht, denn sein Mund war voller Blut.
Beruhigt durch sein Schweigen, machte Krista auf dem Absatz kehrt und trat wieder hinaus in den Albtraum aus Feuer und Tod. Einen Moment lang hob sie sich als Silhouette von den brennenden Feldern ab, dann verschwand sie in der Nacht.
Jason bemühte sich, zu begreifen.
Warum?
Er fand keine Antwort. Doch während sich die Dunkelheit um ihn schloss, hörte er das Bestätigungssignal des Laptops auf Christas Schreibtisch. Seine Mail war übermittelt worden.
2
9. Oktober, 7:04 Prince William Forest Virginia
ER MUSSTE SCHNELLER fahren.
Tief über den Rennlenker des Motorrads gebeugt, schoss Commander Grayson Pierce um eine scharfe Ecke. Er legte sich mit seinen über eins achtzig so tief in die Kurve, dass er sich fast das Knie aufgeschrammt hätte.
Mit brüllendem Motor richtete sich die Maschine wieder auf. Fünfzig Meter vor ihm fuhr eine kleinere Rennmaschine von Honda. Gray verfolgte sie auf einer älteren Yamaha V-Max. Beide Motorräder waren Vierzylinder, doch seines war größer und schwerer. Wenn er die Honda einholen wollte, würde er sein ganzes Können aufbieten müssen.
Vielleicht brauchte er auch nur eine Portion Glück.
Sie hatten eine kurze Gerade erreicht, die durch die Parklandschaft des Prince William Forest führte. Die zweispurige Straße wurde von Alleebäumen gesäumt. Die hohen Buchen und Espen gaben einen hübschen Hintergrund ab, zumal jetzt im Oktober, da das Laub sich verfärbte. Leider hatte in der Nacht ein Unwetter die Blätter auf dem Asphalt zu einer rutschigen Angelegenheit werden lassen.
Gray gab noch mehr Gas. Mit einem kaum wahrnehmbaren Flattern schoss das Motorrad die Gerade entlang. Die Mittellinie verwischte zu einem Schemen.
Die Honda hatte jedoch ebenfalls aufgedreht. Bislang war die Route 619 eine Achterbahn scharfer Kurven, gefährlicher Serpentinen und wogender Hügel gewesen. Die Verfolgungsjagd war gnadenlos gewesen, doch Gray wollte den anderen Fahrer nicht entwischen lassen.
Als das vorausfahrende Motorrad vor der nächsten Kurve abbremste, verringerte sich der Abstand. Gray wollte noch nicht runterschalten. Vielleicht war es leichtsinnig, doch er wusste genau, was er seiner Maschine zumuten konnte. Nach der Anschaffung hatte er von einem der Roboterspezialisten der DARPA – der Forschungs- und Entwicklungsbehörde des Verteidigungsministeriums – ein paar Umbauten vornehmen lassen.
Dort war man ihm noch einen Gefallen schuldig gewesen.
Grays Gruppe – Sigma genannt – war eine schlagkräftige Unterabteilung der DARPA. Der Organisation gehörten ehemalige Soldaten der Spezialeinsatzkräfte an, die eine Zusatzausbildung auf unterschiedlichen wissenschaftlichen Gebieten erhalten hatten und für Sondereinsätze zuständig waren.
Zu den verschiedenen Modifikationen des Motorrads gehörte auch das in den Helm eingebaute Head-up-Display. An der linken Seite des Visiers wurden Geschwindigkeit, Umdrehungszahl, der Gang und die Öltemperatur angezeigt. Auf die rechte Seite wurde eine Navigationskarte mit dem günstigsten Gang und der empfohlenen Höchstgeschwindigkeit projiziert.
Aus dem Augenwinkel beobachtete Gray, wie die Tachometernadel in den roten Bereich vordrang. Der Navigationsbereich blinkte bereits. Er fuhr zu schnell in die Kurve.
Dennoch gab Gray weiter Gas.
Der Abstand zwischen den beiden Maschinen verringerte sich weiter.
Als sie die Kurve erreichten, betrug der Abstand noch etwa dreißig Meter.
Der vorausfahrende Fahrer legte seine Maschine auf die Seite und schoss um die Kurve. Kurz darauf hatte Gray die Stelle erreicht. Er versuchte, einen weiteren Meter herauszuschinden, indem er die nicht einsehbare Kurve besonders eng nahm und die gelbe Mittellinie schnitt. Zum Glück war zu dieser frühen Stunde kein Verkehr unterwegs.
Für die Wildtiere galt das leider nicht.
Hinter der Kurve hockte am Seitenstreifen ein Schwarzbär neben seinem Jungen. Beide hatten die Nasen in einer FastFood-Tüte vergraben. Das erste Motorrad schoss an den beiden Bären vorbei. Vom Lärm und dem plötzlichen Auftauchen der Maschine erschreckt, richtete sich die Bärin auf die Hinterbeine auf, während sich ihr Junges instinktiv zur Flucht wandte – und mitten auf die Straße lief.
Gray konnte ihm nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Da ihm keine andere Wahl blieb, riss er den Lenker herum und schlitterte mit qualmenden Reifen über den Asphalt. Als er gegen den weichen Lehm der gegenüberliegenden Böschung prallte, ließ er die Maschine los und stieß sich ab. Vom eigenen Schwung getragen, rutschte er auf dem Rücken übers feuchte Laub. Die Maschine prallte unter lautem Getöse gegen eine Eiche.
Gray landete in einer feuchten Wasserrinne und drehte sich auf den Bauch. Er sah gerade noch das Hinterteil der Bärenmutter, die mit ihrem Jungen in den Wald flüchtete. Offenbar hatten sie im Moment genug von Fast Food.
Da hörte er ein Geräusch.
Das andere Motorrad näherte sich.
Gray setzte sich auf.
Na großartig ...
Gray lockerte den Kinnriemen und nahm den Helm ab.
Das zweite Motorrad bremste heftig. Der Fahrer war klein, aber so muskulös wie ein Pitbull. Als seine Maschine zum Stillstand gekommen war, nahm er ebenfalls den Helm ab und entblößte seinen kahl rasierten Schädel. Stirnrunzelnd blickte er Gray an.
»Alles heil?«, fragte Monk Kokkalis, ebenfalls Sigma-Angehöriger und Grays bester Freund. In seinem wie aus Stein gemeißelten Gesicht spiegelte sich aufrichtige Besorgnis.
»Nichts passiert. Mit einem Bären auf der Straße hab ich nicht gerechnet.«
»Wer tut das schon?« Monk grinst breit, bockte seine Maschine auf und stieg ab. »Aber glaub ja nicht, du könntest dich um deine Wettschuld drücken. Von natürlichen Hindernissen war keine Rede. Das Essen nach der Besprechung geht auf deine Rechnung. Porterhousesteaks und das dunkelste Bier, das es in dem Seerestaurant gibt.«
»In Ordnung. Aber ich fordere Revanche. Du hattest einen unfairen Vorteil.«
»Vorteil? Ich?« Monk zog einen Handschuh aus und hielt seine Prothese hoch. »Mir fehlt eine Hand. Und ein großer Teil meines Langzeitgedächtnisses. Außerdem bin ich für ein Jahr krankgeschrieben. Von Vorteil kann da keine Rede sein!«
Sein Grinsen verflüchtigte sich auch dann nicht, als er Gray seine von der DARPA angefertigte Prothese reichte. Gray ergriff die Hand, deren Finger seinen Händedruck erwiderten. Monk konnte damit Walnüsse knacken.
Monk zog ihn auf die Beine.
Als Gray sich feuchtes Laub vom Kevlar-Anzug streifte, klingelte das Handy in seiner Brusttasche. Er nahm es heraus und las die Nummer des Anrufers ab. Seine Miene verhärtete sich.
»Die Zentrale«, sagte er und drückte sich das Handy ans Ohr. »Commander Pierce.«
»Pierce? Wurde allmählich auch Zeit, dass Sie drangehen. In der vergangenen Stunde habe ich schon viermal versucht, Sie zu erreichen. Und dürfte ich fragen, was Sie mitten in einem Wald in Virginia verloren haben?« Es war Grays Boss, der Sigma-Direktor.
Um eine triftige Erklärung verlegen, sah Gray zu seinem Motorrad hinüber. Das eingebaute GPS-System hatte anscheinend seine Position übermittelt. Gray fiel auf die Schnelle keine brauchbare Ausrede ein. Er und Monk waren von Washington nach Quantico gefahren, um an einem FBI-Symposium zum Thema Bioterrorismus teilzunehmen. Heute war der zweite Veranstaltungstag, doch sie hatten sich entschieden, die Vorträge am Vormittag zu schwänzen.
»Lassen Sie mich mal raten«, fuhr Painter fort. »Sie haben eine kleine Spritztour gemacht.«
»Sir...«
Der Tonfall des Direktors wurde milder. »Hat es Monk wenigstens gutgetan?«
Wie immer ahnte Painter die Wahrheit. Der Direktor besaß die geradezu unheimliche Fähigkeit, eine Situation instinktiv zu erfassen. Das zeigte sich auch jetzt wieder.
Gray blickte seinen Freund an. Monk hatte die Arme vor der Brust verschränkt und machte ein besorgtes Gesicht. Für ihn war es ein schweres Jahr gewesen. Er war in einer Forschungseinrichtung brutal gefoltert worden. Der Gegner hatte ihm einen Teil des Gehirns entfernt und sein Gedächtnis zerstört. Obwohl er sich bereits wieder gut erholt hatte, waren Lücken zurückgeblieben, und Gray wusste, dass ihm das immer noch zu schaffen machte.
In den vergangenen zwei Monaten hatte Monk seine Arbeit bei Sigma in bescheidenem Rahmen wieder aufgenommen. Er übte eine Schreibtischtätigkeit aus und unterstützte kleinere Operationen in den Staaten. Dabei musste er sich auf die Informationsbeschaffung und die Auswertung der Daten beschränken, wobei er eng mit Captain Kat Bryant, seiner Frau, zusammenarbeitete, die ebenfalls im Sigma-Hauptquartier beschäftigt und früher für den Marine-Geheimdienst tätig gewesen war.
Gray wusste, dass Monk gern mehr getan hätte und sich das Leben zurückerobern wollte, das man ihm geraubt hatte. Alle fassten ihn mit Glacéhandschuhen an, und allmählich reagierte er allergisch auf die mitfühlenden Blicke und aufmunternden Sprüche.
Deshalb hatte Gray ein Rennen quer durch den Park vorgeschlagen, der an den Stützpunkt des Marine Corps in Quantico grenzte. Er hatte Monk Gelegenheit geben wollen, ein wenig Dampf abzulassen, den Staub im Gesicht zu spüren und mal ein bisschen Risiko einzugehen.
Gray deckte das Handy mit der Hand ab und flüsterte: »Painter ist sauer.«
Sein Freund grinste breit.
Gray hielt sich das Handy wieder ans Ohr.
»Ich hab’s gehört«, sagte sein Boss. »Und wenn Sie Ihren Spaß gehabt haben, möchte ich, dass Sie heute Nachmittag im Sigma-Hauptquartier erscheinen. Sie beide.«
»Jawohl, Sir. Dürfte ich erfahren, worum es geht?«
Die Stille dehnte sich, während der Direktor überlegte, was er sagen sollte. Als er sich wieder meldete, wählte er seine Worte mit Bedacht. »Es geht um den Vorbesitzer Ihres Motorrads.«
Gray warf einen Blick auf die verunglückte Maschine. Um den Vorbesitzer? Er dachte an jene Nacht vor zwei Jahren und hatte wieder das Brüllen des Motors in den Ohren, mit dem ein Motorrad ohne Licht über die Vorortstraße gebrettert war, am Lenker eine mordsgefährliche Fahrerin, eine heimtückische Mörderin mit wechselnder Loyalität.
Gray schluckte und sagte: »Was ist mit ihr?«
»Das sage ich Ihnen, wenn Sie hier sind.«
13:00 Washington, D. C.
STUNDEN SPÄTER SASS Gray geduscht und in frischer Jeans und Sweatshirt an der Satellitenüberwachungsanlage im Sigma-Hauptquartier. Bei ihm waren Painter und Monk. Auf dem Bildschirm war eine digitale Landkarte abgebildet. Eine krumme rote Linie führte von Thailand nach Italien.
Der Weg der Mörderin endete in Venedig.
Sigma hatte sie über ein Jahr lang überwacht. Ihre Position war auf einem Monitor mit einem kleinen roten Dreieck markiert. Es leuchtete mitten auf der Satellitenkarte von Venedig. Gebäude, krumme Gassen und gewundene Kanäle waren in Grauwerten präzise dargestellt, bis hin zu den kleinen, mitten in der Bewegung erstarrten Gondeln. Der Zeitpunkt der Aufnahme wurde zusammen mit den Koordinaten in der Monitorecke angezeigt:
10:52:45 GMT 9. OKT Breite 41°52’56.97” N Länge 12°29’5.19” O
»Wie lange hält sie sich schon in Venedig auf?«, fragte Gray.
»Seit über einem Monat.«
Painter fuhr sich müde durchs Haar und kniff argwöhnisch die Augen zusammen. Er wirkte erschöpft. Für den Direktor war es ein anstrengendes Jahr gewesen. Bei der Büroarbeit und den vielen Besprechungen blass geworden, zeigte sich Painters Indianererbe nur noch in seinen wie gemeißelt wirkenden Gesichtszügen und der weißen Strähne im schwarzen Haar, die an eine Schmuckfeder erinnerte.
Gray studierte die Karte. »Wissen wir, wo sie wohnt?«
Painter schüttelte den Kopf. »Irgendwo in Santa Croce. Das ist eines der ältesten Viertel von Venedig, nicht sonderlich touristisch. Ein Labyrinth von Brücken, Gassen und Kanälen. Dort kann man sich leicht verstecken.«
Monk saß Gray und Painter gegenüber und justierte gerade die Verbindung seiner Handprothese. »Weshalb hat Seichan sich ausgerechnet in dieser Stadt verkrochen?«
Gray blickte auf die Ecke des Monitors. Dort war ein Foto der Mörderin abgebildet, eine Frau Ende zwanzig. Sie vereinigte vietnamesische und europäische Einflüsse. Ihre bronzefarbene Haut, die schmalen Gesichtszüge und die vollen Lippen deuteten auf ein französisches Elternteil hin. Bei ihrer ersten Begegnung mit Gray vor drei Jahren hätte sie ihn beinahe mit einem Brustschuss aus kürzester Entfernung getötet. Auch jetzt wieder stellte er sie sich in dem schwarzen Ganzkörperanzug mit Rollkragen vor, der ihre geschmeidige Gestalt umhüllt und ihre Härte und Weichheit verborgen hatte.
Außerdem dachte Gray an ihr letztes Zusammentreffen. Sie war vom US-Militär gefangen genommen worden, nachdem sie durch einen Bauchschuss viel Blut verloren hatte. Diesmal hatte Gray ihr zur Flucht verholfen, da sie ihm zuvor das Leben gerettet hatte – doch für ihre Freiheit hatte sie einen Preis zahlen müssen.
Bei der Operation hatte Grays Boss ihr einen passiven Polymer-Tracker in die Bauchhöhle implantieren lassen. Das war die Bedingung für ihre Freilassung gewesen, eine Rückversicherung, die es ihnen erlauben würde, Seichans Position zu bestimmen und ihre Bewegungen nachzuvollziehen. Sie war zu wichtig und ihre Beziehungen zur Gilde, einem Terroristennetzwerk, zu eng, um sie einfach gehen zu lassen. Niemand kannte die eigentlichen Drahtzieher dieser Organisation – man wusste nur, dass ihr geheimes Netz die ganze Welt umspannte.
Seichan hatte behauptet, sie sei eine Doppelagentin und habe den Auftrag, die Gilde zu infiltrieren, um die wahren Strippenzieher zu entlarven. Beweise konnte sie allerdings nicht vorlegen. Gray hatte ihr zur Flucht verholfen, ohne den implantierten Tracker ihr gegenüber zu erwähnen. Das Ortungsgerät bot dem US-Geheimdienst die Chance, mehr über die Gilde zu erfahren.
Gray vermutete allerdings, dass ihre Entscheidung, nach Venedig zu fliegen, nichts mit der Gilde zu tun hatte. Er spürte Painter Crowes Blick auf sich ruhen, als erwartete der Direktor von ihm eine Erklärung. Die Miene seines Vorgesetzten war undurchdringlich, nur das Flackern der eisgrauen Augen verriet, dass es sich um einen Test handelte.
»Sie kehrt an den Schauplatz des Verbrechens zurück«, sagte Gray und straffte sich.
»Was?«, sagte Monk.
Gray wies mit dem Kinn auf die Satellitenkarte. »In Santa Croce liegen die ältesten Gebäude der Universität von Venedig. Vor zwei Jahren hat sie dort einen Museumskurator ermordet, der auch Verbindungen zur Universität hatte. Sie hat ihn kaltblütig erschossen. Sie meinte, das sei nötig gewesen, um die Familie des Mannes zu schützen. Seine Frau und die Tochter.«
Painter konnte das bestätigen. »Das Kind und die Mutter leben noch in dem Viertel. Wir haben Leute vor Ort, die sich bemühen, ihren Aufenthaltsort zu bestimmen. Aber das ist ein passiver Tracker. Ihre Position lässt sich nur bis auf fünf Quadratkilometer genau bestimmen. Für den Fall, dass sie dort auftauchen sollte, haben wir die Familie des Kurators unter Bewachung gestellt. Da so viele Augen nach ihr Ausschau halten, ist davon auszugehen, dass sie sich getarnt hat.«
Gray dachte daran, wie angespannt Seichan gewirkt hatte, als sie versucht hatte, die kaltblütige Ermordung des Museumskurators zu rechtfertigen. Wahrscheinlich hatten sie Gewissensbisse und nicht die Gilde wieder nach Venedig geführt. Aber was wollte sie dort? Und wenn irgendetwas an der Sache faul war? Wenn es sich um ein raffiniertes Täuschungsmanöver handelte? Seichan war eine ausgezeichnete, vielleicht sogar herausragende Strategin.
Er fixierte den Monitor. Irgendetwas stimmte da nicht.
»Weshalb zeigen Sie mir das?«, fragte Gray. Sigma überwachte Seichan seit über einem Jahr. Weshalb hatte man ihn ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt in die Zentrale bestellt?
»Von der NSA sind über den neuen Leiter der DARPA Informationen zu uns durchgesickert. Da im vergangenen Jahr keine wesentlichen Erkenntnisse von Seichan gewonnen wurden, haben die maßgeblichen Regierungsstellen die Geduld verloren und die unverzügliche Festnahme angeordnet. Sie soll in ein geheimes Vernehmungszentrum in Bosnien gebracht werden.«
»Aber das ist verrückt. Sie wird niemals reden. Diese Operation bietet die besten Chancen, konkrete Informationen über die Gilde zu gewinnen.«
»Ganz meine Meinung. Bedauerlicherweise sind wir die Einzigen, die das so sehen. Wenn Sean noch immer die DARPA leiten würde...«
Painter verstummte gequält. Dr. Sean McKnight war der Gründer von Sigma und der ehemalige Leiter der DARPA gewesen. Im vergangenen Jahr war er bei einem Angriff auf die Sigma-Zentrale ums Leben gekommen. General Gregory Metcalf, der neue Leiter der DARPA, war noch unerfahren und hatte noch immer mit den politischen Nachbeben des Angriffs zu kämpfen. Von Anfang an hatten er und Painter sich aneinander gerieben. Gray vermutete, dass sich Painter Crowe nur aufgrund der Unterstützung durch den Präsidenten im Amt gehalten hatte. Doch auch diese Unterstützung hatte ihre Grenzen.
»Metcalf möchte keinen der zahlreichen Geheimdienste vor den Kopf stoßen und hat sich der Einschätzung der NSA angeschlossen. «
»Dann wird man Seichan also festnehmen.«
Painter zuckte mit den Schultern. »Wenn möglich. Aber diese Leute haben keine Ahnung, mit wem sie es zu tun haben. «
»Ich habe gerade Leerlauf. Ich könnte rüberfliegen. Meine Hilfe anbieten.«
»Hilfe, wobei? Um sie zu finden oder um ihr zur Flucht zu verhelfen?«
Gray schwieg. Bezüglich Seichan hatte er gemischte Gefühle. Schließlich sagte er entschieden: »Ich werde tun, was man von mir verlangt.« Dabei blickte er Painter an.
Der Direktor schüttelte den Kopf. »Wenn Seichan Sie sieht oder auch nur Verdacht schöpft, Sie könnten sich in Venedig aufhalten, weiß sie, dass sie überwacht wird. Dann haben wir unseren Vorteil verloren.«
Gray runzelte die Stirn. Er musste dem Direktor recht geben.
Das Telefon läutete, und Painter nahm ab. Gray war froh über die Gelegenheit, seine Gedanken zu ordnen.
»Was gibt es, Brant?«, fragte Painter. Während der Direktor seinem Assistenten lauschte, vertieften sich seine Stirnfalten. »Stellen Sie den Anruf durch.«
Nach einer Weile reichte Painter den Telefonhörer an Gray weiter. »Leutnant Rachel Verona, aus Rom.«
Gray vermochte seine Überraschung nicht zu verhehlen. Er hielt sich den Hörer ans Ohr und wandte sich ein wenig ab.
»Rachel?«
Ihre Stimme klang tränenerstickt. Sie schluchzte nicht, sprach aber stockend und rang offenbar um Fassung. »Gray... ich brauche... deine Hilfe.«
»Du kannst auf mich zählen. Was ist los?«
Er hatte seit Monaten nicht mehr mit ihr telefoniert. Über ein Jahr lang war er mit der Polizistin mit dem rabenschwarzen Haar liiert gewesen. Sie hatten sogar an Heirat gedacht, doch es hatte nicht funktioniert. Sie hatte ihre Anstellung bei den italienischen Carabinieri nicht aufgeben wollen, während Gray zu sehr in den Staaten verwurzelt war. Die Entfernung war einfach zu groß gewesen.
»Es geht um meinen Onkel Vigor«, sagte sie. Plötzlich sprudelten die Worte nur so aus ihr hervor, als wären sie die Vorboten eines Tränenstroms. »Gestern Abend gab es eine Explosion im Petersdom. Er liegt im Koma.«
»Mein Gott, was ist passiert?«
Rachel setzte ihren Bericht fort. »Ein Priester wurde getötet, einer seiner ehemaligen Studenten. Man geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Aber ich darf nicht … man lässt mich nicht … Ich wusste nicht, wen ich sonst hätte anrufen sollen. «
»Schon gut. Wenn du willst, komme ich mit dem nächsten Flieger.« Gray wechselte einen Blick mit Painter. Sein Boss nickte; Erklärungen waren unnötig.
Monsignore Vigor Verona hatte Sigma bei zwei Operationen geholfen. Seine Kenntnisse auf dem Gebiet der Archäologie und Geschichte sowie seine Verbindungen zur katholischen Kirche waren für deren Erfolg von ausschlaggebender Bedeutung gewesen. Sie standen in der Schuld des Monsignore.
»Danke, Gray.« Rachel klang bereits ruhiger. »Ich maile dir die Ermittlungsakte. Allerdings sind darin nicht alle Details aufgeführt. Den Rest erzähle ich dir, wenn du hier bist.«
Grays Blick war zum Monitor gewandert, wo mitten in Venedig das rote Trackersignal leuchtete. Aus der Monitorecke heraus schaute ihn Seichan an, kalt und zornig. Sie hatte ebenfalls mit Rachel und deren Onkel zu tun gehabt.
Und jetzt war sie wieder in Italien.
Gray wurde von bösen Vorahnungen erfasst.
Irgendetwas war hier faul. Da braute sich etwas zusammen, doch er wusste noch nicht, aus welcher Richtung der Wind wehte. Eines aber war sicher.
»Ich werde mich beeilen«, versprach er Rachel.
3
10. Oktober, 19:28 Rom, Italien
ALS LEUTNANT RACHEL Verona aus der Klinik in die römische Abenddämmerung hinaustrat, atmete sie tief die kühle Herbstluft ein und entspannte sich ein wenig. Das Desinfektionsmittel hatte den Geruch der Kranken, die in ihren Betten dahinsiechten, kaum zu überdecken vermocht. In Krankenhäusern fühlte sie sich immer unwohl.
Nach Jahren der Enthaltsamkeit hatte sie auf einmal wieder Lust auf eine Zigarette, als könnte sie damit die bösen Vorahnungen ausräuchern, die mit jeder Stunde, da ihr Onkel im Koma verharrte, stärker wurden. Er war mit Infusionsschläuchen verbunden; Geräte mit blinkenden LED-Leuchten überwachten seine Organtätigkeit; eine Beatmungsmaschine versorgte ihn mit Luft. Er wirkte um Jahre gealtert. Um die Augen hatte er Blutergüsse, sein kahl rasierter Schädel war verbunden. Subduralhämatom und kleine Schädelfraktur hatten die Ärzte gemeint. Sie überwachten den interkraniellen Druck. Mit der Magnetresonanztomografie waren keine Hirnschäden feststellbar, doch sein komatöser Zustand bereitete den Ärzten Sorge. Dem Krankenbericht und der Polizeiakte zufolge hatte Vigor bei der Einlieferung deliriert. Bevor er ins Koma gefallen war, hatte er immer wieder ein bestimmtes Wort wiederholt.
Morte.
Tod.
Was hatte er damit sagen wollen? Hatte Vigor gewusst, dass der andere Priester ums Leben gekommen war? Oder hatte er einfach nur fantasiert?
Fragen konnte man ihn nicht. Auf Ansprache zeigte er keinerlei Reaktion.
Rachel aber ging seine Äußerung nicht aus dem Kopf. Sie hatte stundenlang seine Hand gehalten und sie in der Hoffnung, sein Zustand werde sich endlich bessern, hin und wieder gedrückt. Seine Finger aber waren schlaff geblieben, als hätte sich seine Lebenskraft verflüchtigt und nurmehr eine leere Hülle zurückgelassen.
Ihre Hilflosigkeit war für Rachel besonders quälend. Vigor hatte sie großgezogen und ihr die Familie ersetzt. Und so hatte sie den ganzen Tag über bei ihm gesessen und die Intensivstation nur verlassen, um nochmals in die Staaten zu telefonieren.
Gray würde morgen in Rom eintreffen.
Das war die einzige gute Neuigkeit seit vierundzwanzig Stunden. Sie konnte Vigor zwar nicht unmittelbar helfen, aber sie konnte ihre Beziehungen spielen lassen, um wenigstens die Hintergründe des Attentats aufzuklären.
Die Ermittlungen zur Explosion im Petersdom zogen anscheinend immer weitere Kreise, denn außer den italienischen Geheimdiensten waren auch schon Interpol und Europol eingeschaltet. Alle Beteiligten waren der Ansicht, dass es sich um einen terroristischen Anschlag handelte. Diese Einschätzung gründete vor allem auf der Verstümmelung des Priesters, dem man nach seinem Tod ein Zeichen in die Stirn gebrannt hatte.
Offenbar war das Zeichen als Botschaft gemeint. Was aber war ihr Inhalt, und wer war der Adressat? Bislang lag noch kein Bekennerschreiben vor.
Der schnellste Weg, die Wahrheit zu ergründen, bestand Rachels Ansicht nach jedoch darin, eigene Nachforschungen anzustellen. Sie konnte sich auf das Wesentliche konzentrieren und quasi chirurgisch vorgehen, während die offiziellen Stellen eher ein allgemeines Chaos anrichten würden.
Deshalb hatte sie Gray angerufen. Zwar war es ihr ein wenig peinlich, ihn um Hilfe zu bitten, doch wenn sie der Wahrheit auf den Grund gehen wollte, würde sie auf die Ressourcen von Sigma zurückgreifen müssen. Und ihr war klar, dass sie alleine wenig ausrichten konnte. Sie brauchte jemanden, dem sie vollkommen vertrauen konnte. Sie brauchte Gray.
Oder hatte sie bei dem Anruf irgendwelche Hintergedanken gehegt?
Sie schüttelte den Kopf und näherte sich ihrem blauen Mini Cooper, den sie im Parkhaus des Krankenhauses abgestellt hatte. Sie stieg ein und fuhr los. Das Verdeck ließ sie unten, denn der Fahrtwind half ihr, einen klaren Kopf zu bekommen. Als ein schwankender Touristenbus ihr seine Abgase ins Gesicht blies, war damit Schluss.
Rachel bog von der Hauptverkehrsstraße ab und fuhr durch kleinere Straßen, die von Läden, Cafés und Restaurants gesäumt waren. Eigentlich hatte sie vorgehabt, zu ihrer Wohnung zu fahren und vor dem bevorstehenden Wiedersehen mit Gray ihre Gedanken zu sammeln, doch stattdessen wandte sie sich zum Tiber. Nach ein paar Kurven gelangte am anderen Ufer die funkelnde Kuppel des Petersdoms in Sicht.
Sie ließ sich vom Verkehr ihrem Ziel entgegentreiben. Seit der Explosion war die Vatikanstadt für die Öffentlichkeit gesperrt. Der Papst war aus Sicherheitsgründen in seine Sommerresidenz in Castel Gandolfo ausgeflogen worden. All das brachte den Strom der Touristen und Schaulustigen jedoch nicht zum Erliegen. Eher war das Gewühl noch dichter geworden.
Aufgrund des dichten Verkehrs musste Rachel eine halbe Stunde lang nach einem Parkplatz suchen. Als sie die Polizeiabsperrung am Petersplatz erreichte, war es bereits dunkel. Sonst drängten sich auf dem Platz die Pilger und Touristen, doch im Moment war er nahezu menschenleer. Nur ein paar Uniformierte patrouillierten unter den Kolonnaden und auf der Piazza. Einer hielt am ägyptischen Obelisken in der Mitte des Platzes Wache. Alle hatten Gewehre geschultert.
Rachel zeigte an der Absperrung ihren Dienstausweis vor.