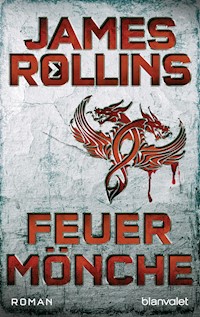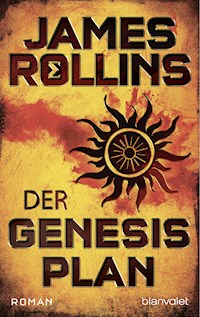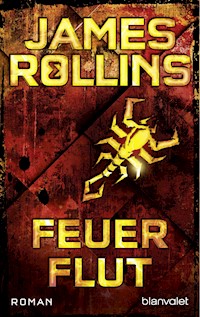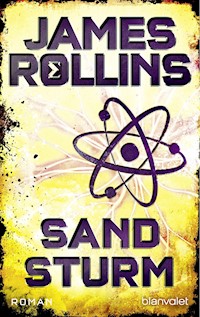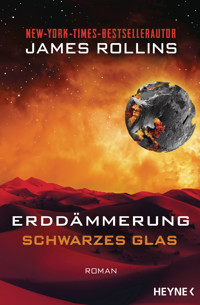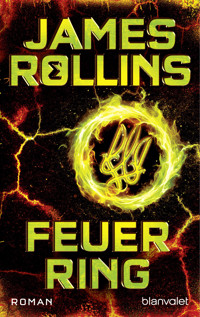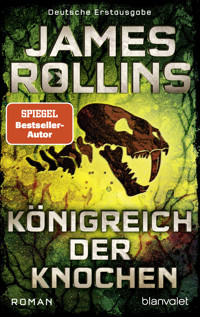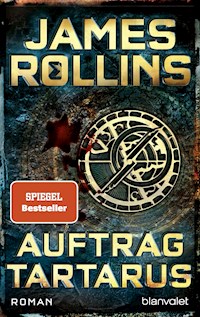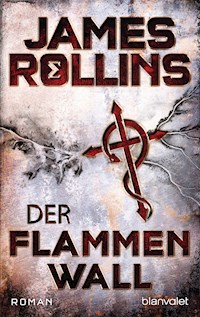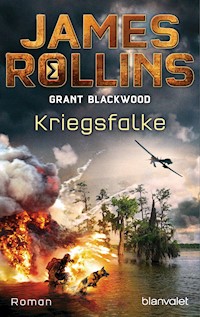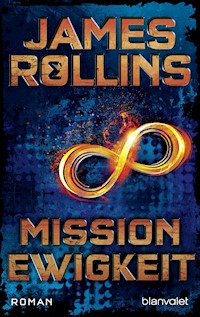
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: SIGMA Force
- Sprache: Deutsch
Der coolste Geheimdienst der Welt ist zurück – endlich ein neuer Fall für die SIGMA-Force.
Amanda Gant, die Tochter des Präsidenten der Vereinigten Staaten, wird von somalischen Piraten gekidnappt. Rasch hat ein Eingreifteam der SIGMA-Force das Hauptquartier der Entführer aufgespürt, doch deren Anführer hat bereits den Tötungsbefehl für Amanda gegeben. Schockstarr sieht das Präsidentenpaar, das die Rettung seiner Tochter live miterleben wollte, auf den Bildschirmen die Leiche. Doch bei allem Mitgefühl geht Painter Crowe, dem Direktor der SIGMA Force, eine Frage nicht aus dem Kopf: Ist Präsident Gant wirklich der Kopf der Terrororganisation Die Gilde?
Verpassen Sie nicht die weiteren in sich abgeschlossenen Romane über die Topagenten der Sigma Force!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 675
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Amanda Gant, die Tochter des Präsidenten der Vereinigten Staaten, macht inkognito Urlaub auf einer Luxusyacht vor den Seychellen. Da wird sie von somalischen Piraten entführt. Zwar bleibt sie bei ihrer Tarnidentität, doch die Hintermänner ihrer Häscher wissen genau, wer sie ist. Tatsächlich war es eine gezielte Entführung, kein Zufall. Doch es geht gar nicht um Amanda, sondern um ihr noch ungeborenes Baby!
Ohne etwas von den Hintermännern zu ahnen, schickt Painter Crowe, der Direktor der Sigma-Force, sofort ein Team nach Somalia, um Amanda zu befreien. Rasch haben sie das Hauptquartier der Entführer aufgespürt. Doch deren Anführer hat bereits den Tötungsbefehl für Amanda gegeben.
Ohnmächtig muss Painter Crowe über die Helmkameras seines Teams mit ansehen, wie Amandas Leiche entdeckt wird. Und was das Ganze noch schrecklicher macht: Das Präsidentenehepaar steht an seiner Seite und muss den Anblick ebenfalls ertragen.
Doch bei aller Trauer meldet sich in Painter Crowes Hinterkopf ein Gedanke: Ist der Präsident der Vereinigten Staaten wirklich der Kopf der Verbrecherorganisation die Gilde?
Autor
Der New York Times-Bestsellerautor James Rollins hat einen Doktorgrad in Tiermedizin. Als begeisterter Höhlenforscher und ebenso eifriger Taucher ist er häufig unter Wasser oder unter der Erde anzutreffen. Er wohnt in den Bergen der Sierra Nevada in Kalifornien, USA.
Von James Rollins bei Blanvalet erschienen:
Sigma-Force:
Der Genesis-Plan, Feuermönche, Sandsturm, Der Judas-Code, Das Messias-Gen, Feuerflut, Mission EwigkeitDie Bruderschaft der Christuskrieger:
Das Evangelium des Blutes, Das Blut des Verräters
Außerdem:
Sub Terra, Im Dreieck des Drachen, Das Flammenzeichen, Operation Amazonas, Das Blut des TeufelsIndiana Jones und das Königreich des Kristallschädels
James Rollins
Mission Ewigkeit
Roman
Aus dem Englischen von Norbert Stöbe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Bloodline« bei William Morrow, New York.
1. AuflageMärz 2016 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.Copyright © 2012 by Jim CzajkowskiPublished in agreement with the author, c/o Baror International, Inc. Armonk, New York, U.S.A.Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 by Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.comRedaktion: text in form / Gerhard SeidlHK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-17359-3V001www.blanvalet.de
Dieses Werk ist fiktional. Namen, Charaktere, Orte und Handlung entspringen der Fantasie des Autors oder sind freizügig verwendet und sollten nicht als real betrachtet werden. Alle Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Ereignissen, Örtlichkeiten, Organisationen oder Personen, ob lebend oder verstorben, sind rein zufällig.
Meinen drei Brüdern und drei Schwestern gewidmet: Cheryl, Doug, Laurie, Chuck, Billy und Carrie.Nachdem wir das vergangene Jahr über gemeinsam im Schützengraben gehockt haben, liegt es nahe, uns auch hier zu versammeln.Ich liebe euch alle.
WORTE ERMORDETER PRÄSIDENTEN
ÜBER DIE EXISTENZ heutiger Geheimgesellschaften und die davon ausgehenden Gefahren:
»Wir haben es mit einer monolithischen und ruchlosen weltweiten Verschwörung zu tun, die ihren Einfluss mit verdeckten Mitteln ausdehnt … einer komplexen und effizienten Maschinerie, die sich militärischer, diplomatischer, geheimdienstlicher, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und politischer Operationen bedient.«
John F. Kennedy, Auszug aus einer Rede, gehalten im Hotel Waldorf Astoria am 27. April 1961
Über Leben und Tod:
»Gott hätte solch ein Wesen wie den Menschen mit seinem Sinn fürs Unendliche nicht nur für einen Tag erschaffen. Nein, der Mensch ist für die Unsterblichkeit bestimmt.«
Abraham Lincoln
VORBEMERKUNG ZUM HISTORISCHEN HINTERGRUND
DIE GESCHICHTE STROTZT von Verschwörungstheorien. Das entspricht der menschlichen Natur. Wir suchen ständig nach Mustern im Chaos, nach Hinweisen auf den unsichtbaren Puppenspieler, der den großen Plan des Lebens steuert, der Regierungen und die Entwicklung der Menschheit lenkt. Einige dieser Strippenzieher sind als Schurken besetzt, andere als große Wohltäter. Manches beruht auf historischen Fakten, andere geheime Umtriebe sind fantasievolle Erfindungen; und noch mehr sind ein so fest geknüpfter gordischer Knoten von beidem, dass die Grenze zwischen Fakten und Fiktion einem wirren Muster falscher Geschichtsschreibung gleicht.
Auf keine andere Organisation der Geschichte trifft dies besser zu als auf die berüchtigten Tempelritter.
Anfang des zwölften Jahrhunderts begann der Orden als Zusammenschluss von neun Rittern, die schworen, die Pilger auf dem Weg ins Heilige Land und auf dem Heimweg zu beschützen. Aus diesem bescheidenen Anfang entwickelte sich ein großer Orden, der zu Reichtum und Macht gelangte und sich in ganz Europa ausbreitete, bis selbst Päpste und Könige ihn fürchteten. Am 13. Oktober 1307 verschworen sich schließlich der König von Frankreich und der damalige Papst unter dem Vorwand, die Tempelritter hätten sich grausamer Verbrechen und sogar der Häresie schuldig gemacht, den Orden aufzulösen und dessen Mitglieder festzunehmen. Nach der Säuberungsaktion ließen wuchernde Legenden und Mythen das wahre Schicksal des Ordens verschwimmen: Man erzählte sich von verschwundenen Schätzen und von Rittern, die sich der Hinrichtung durch die Flucht in die Neue Welt entzogen. Einige behaupten sogar, der Orden existiere noch immer im Geheimen und schütze eine Macht, die in der Lage sei, die Welt zu verändern.
Aber lassen wir die Spekulationen und Mythen beiseite und kehren wir zurück zu den ursprünglichen neun Rittern. Es ist weitgehend unbekannt, dass die neun Gründungsmitglieder des Ordens alle entweder durch Blutsbande oder Heirat verwandt waren und von einer einzigen Familie abstammten. Acht von ihnen sind in historischen Dokumenten namentlich aufgeführt. Der neunte ist unbekannt und gibt Historikern Anlass zu Spekulationen. Wer war das geheimnisvolle Gründungsmitglied, das es in Geschichte und Legende zu solcher Berühmtheit brachte? Weshalb wurde dieser Ritter nicht mit Namen erwähnt?
Die Antwort auf diese Frage ist der Beginn eines großen Abenteuers.
VORBEMERKUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN HINTERGRUND
AM 21. FEBRUAR 2011 kam das Time Magazine mit folgendem Titel heraus: »2045, das Jahr, in dem der Mensch unsterblich wird.« Bei nüchterner Betrachtung ist das eine wilde Behauptung, doch einige Wissenschaftler äußern sich ähnlich. Dr. Ronald Klatz schreibt in seinem Buch Fortschritte in der Anti-Aging-Behandlung: »In den nächsten fünfzig Jahren wird der Mensch praktisch ewiges Leben erlangen, wenn es ihm gelingt, schweren Verletzungen oder der Ermordung zu entgehen.«
Wir leben in einer aufregenden Zeit, da die Fortschritte auf dem Gebiet der Medizin, der Technologie und in zahllosen anderen Bereichen der Menschheit einen neuen Horizont eröffnen: die Ewigkeit.
Wie wird sie sich manifestieren, welche Erscheinungsform wird sie annehmen? Auf den folgenden Seiten werden Sie die Antwort finden. Die in diesem Roman vorgestellten Konzepte basieren auf Fakten sowie auf gründlicher Recherche, die bis zu den von sowjetischen Wissenschaftlern während des Kalten Krieges durchgeführten Studien zurückreichen. Doch ehe Sie die ersten Zeilen lesen, möchte ich die weiter oben gemachten verblüffenden Aussagen korrigieren. In Wahrheit sind diese Einschätzungen zu konservativ.
Denn die Unsterblichkeit ist nicht nur zum Greifen nah – sie ist bereits Realität.
Sommer 1134 Im Heiligen Land
FRÜHER SCHIMPFTE MAN sie Hexe und Hure.
Jetzt nicht mehr.
Sie saß im Herrensitz auf einem grauen Schlachtross und ritt vorsichtig über den Kriegsschauplatz. Überall lagen Leichen verstreut, Muslime wie Christen. Sie scheuchte die Krähen und Raben auf, die sich an den Toten labten und sich hinter ihr erneut in schwarzen Schwärmen sammelten. Die zweibeinigen Leichenschänder durchsuchten die Toten, zogen ihnen die Stiefel aus, rissen die Pfeile wegen der Spitzen und Federn aus den Wunden. Einige schauten sie an und wandten sich gleich wieder ab.
Sie wusste, was sie sahen: einen der vielen Ritter, die in der Schlacht gekämpft hatten. Ihre Brüste waren unter dem gepolsterten Kettenhemd verborgen. Ihr dunkles, schulterlanges Haar, kürzer als das der meisten Männer, verbarg ein konischer Helm; ihre zarten Gesichtszüge entstellte ein Nasenschutz. Das am Sattel festgeschnallte Breitschwert stieß rhythmisch gegen ihr linkes Knie und brachte die Beinlinge zum Klingen.
Nur wenige Menschen wussten, dass sie kein Mann war – und kein Einziger wusste, dass sie noch dunklere Geheimnisse hatte als ihr wahres Geschlecht.
Ihr Knappe erwartete sie am Rand einer zerfurchten Straße. Der steile Weg schlängelte sich zu einem einsam gelegenen Bergfried hoch. Das abweisende Bauwerk, tief im Naphtaligebirge gelegen, hatte keinen Namen und sah aus, als wäre es aus dem Berg herausgehauen. Hinter den Befestigungen stand die rote Sonne tief am Horizont, verschleiert vom Qualm der Lagerfeuer und der versengten Felder.
Der junge Knappe sank auf ein Knie nieder, als sie neben ihm ihr Pferd zügelte.
»Ist er noch da?«, fragte sie.
Ein Nicken. Verängstigt. »Der hohe Herr Godefroy erwartet dich.«
Der Knappe vermied es, in die Richtung der steinernen Feste zu blicken. Ihr selbst machte das nichts aus. Sie klappte das Visier hoch, um besser sehen zu können.
Endlich …
Sechzehn Jahre lang – seit ihr Onkel im Tempel zu Jerusalem den Orden der Armen Ritter gegründet hatte – hatte sie nach dem Unmöglichen gesucht. Nicht einmal ihr Onkel hatte für ihren Entschluss, sich den Templern anzuschließen, Verständnis gehabt, doch ihrem Familienzweig konnte sich niemand widersetzen. Und so hatte man ihr den weißen Umhang des Ordens umgelegt, sie in den Kreis der Neun aufgenommen und versteckt – so gesichtslos wie der Helm, den sie trug –, während der Orden an Zahl und Bedeutung zunahm.
Andere Angehörige ihrer Familie, ihres Geschlechts fuhren fort, den Ritterorden von innen und außen zu manipulieren; sie sammelten Reichtum und Wissen, suchten in verborgenen Krypten und alten Gräbern in Ägypten und im Heiligen Land nach wunderkräftigen Reliquien. Vor einem Jahr hätten sie beinahe die Gebeine der drei Weisen aus dem Morgenland erworben – die Reliquien der Heiligen Drei Könige, die angeblich die Geheimnisse uralter Alchemie in sich bargen.
Heute durfte sie nicht schon wieder scheitern.
Sie ließ die Zügel knallen und lenkte das Pferd den steinigen Weg entlang. Mit jedem Schritt wuchs die Zahl der Toten, denn die Wächter der Feste lieferten einen verzweifelten Abwehrkampf. Als sie die Kuppe des Hügels erreichte, stellte sie fest, dass das Tor von einem schweren Rammbock eingedrückt worden war.
Zwei Ritter bewachten den Weg. Beide nickten ihr zu. Der jüngere der beiden, noch nicht lange Mitglied des Ordens, hatte sich ein purpurrotes Kreuz auf die Brust genäht. Immer mehr Templer trugen dieses Kreuz zum Zeichen der Bereitschaft, ihr Blut um der Sache willen zu vergießen. Der grauhaarige, pockennarbige alte Krieger trug wie sie selbst über der Rüstung den traditionellen weißen Umhang. Ihr einziger Schmuck war das Blut der Erschlagenen.
»Godefroy erwartet dich in der Krypta«, sagte der ältere Ritter und deutete zum Festungsgebäude.
Sie trieb ihr Schlachtross durch das zerstörte Tor und saß mit wehendem Umhang ab. Das Breitschwert ließ sie beim Pferd zurück, denn sie hatte keine Angst, von einem überlebenden Festungswächter angegriffen zu werden. Trotz all seiner Schwächen war Godefroy ein gründlicher Mensch. Im Hof legten die auf Holzspieße gepflanzten Köpfe der Verteidiger Zeugnis ab von seinem Eifer. Die kopflosen Leichname waren wie Feuerholz an der Mauer gestapelt.
Die Schlacht war vorbei.
Jetzt wurde die Beute verteilt.
Sie gelangte zu einer Tür, dahinter war es dunkel. Eine schmale, aus dem Felsgestein herausgehauene Treppe führte in die Tiefe der Feste. Am Fuß der Treppe verbreitete eine flackernde Fackel rötliches Licht. Sie stieg hinab und wurde immer schneller.
Konnte es denn wahr sein? Nach so vielen Jahren …
Sie platzte in einen länglichen Raum, an beiden Seiten gesäumt von etwa zwanzig steinernen Sarkophagen. Ihr Blick wanderte über ägyptische Inschriften, Zeichen, die auf dunkle Mysterien aus der Zeit vor Christi Geburt verwiesen. Ganz hinten machte sie zwei Gestalten aus, gebadet in den Fackelschein: Die eine stand, die andere kniete und stützte sich auf einen Stab.
Sie ging auf die beiden Männer zu und bemerkte, dass der letzte Sarkophag geöffnet war; der steinerne Deckel lag geborsten auf dem Boden. Offenbar hatte bereits jemand angefangen, nach dem verborgenen Schatz zu suchen. Doch in dem geschändeten Sarkophag befanden sich nur Asche und die Überreste eines vertrockneten Pflanzenstängels.
In Godefroys Miene zeichnete sich Enttäuschung ab. »Dann bist du also endlich gekommen«, sagte er mit unaufrichtiger Freude.
Sie beachtete den Ritter nicht. Er war einen Kopf größer als sie, hatte aber wie sie fast schwarzes Haar und eine gebogene Nase, Erbe ihrer gemeinsamen südfranzösischen Ahnen.
Sie fiel auf die Knie nieder und sah dem Gefangenen ins Gesicht. Er war tief gebräunt, seine Haut so glatt wie geschmeidiges Leder. Unter dem schwarzen Haarschopf hervor erwiderten dunkle Augen ihren Blick, der Fackelschein spiegelte sich darin. Obwohl er kniete, zeigte er keine Angst, nur eine tiefe Traurigkeit, die in ihr den Wunsch weckte, ihn zu schlagen.
Godefroy trat neben sie, denn er spürte, dass es hier um etwas Bedeutsames ging, und er wollte beteiligt sein.
»Meine Herrin …«, sagte er.
Die Augen des Gefangenen verengten sich. Jede Spur von Traurigkeit verflüchtigte sich, zurück blieb aufflackernde Angst – doch auch diese Regung verflog.
Eigenartig … kennt er etwa unser Geschlecht, unsere Geheimnisse?
Godefroy unterbrach ihren Gedankengang und fuhr fort: »Gemäß deiner Anweisung haben wir viele Menschen getötet und viel Blut vergossen, um diesen von Gerüchten umrankten und von Zaubersprüchen und Ungläubigen geschützten Ort zu erobern – nur um diesen Mann und die Schätze vorzufinden, die er hütet. Wer ist er? Die Antwort auf diese Frage habe ich mir mit der Spitze meines Schwerts verdient.«
Mit Narren verschwendete sie nicht ihre Zeit. In einem alten arabischen Dialekt sprach sie den Gefangenen an. »Wann wurdest du geboren?«
Der Mann fixierte sie, veranlasste sie mit reiner Willenskraft, einem Windstoß innerer Stärke, zurückzuweichen. Offenbar überlegte er, ob er sie anlügen sollte, doch dann sah er ein, dass es nutzlos gewesen wäre.
Er sprach leise, als trage er eine schwere Last. »Ich wurde im Jahr fünfundneunzig in Muharram geboren.«
Auch Godefroy hatte ihn wohl verstanden. »Im Jahr fünfundneunzig?«, sagte er höhnisch. »Dann wäre er über tausend Jahre alt.«
»Nein«, sagte sie mehr zu sich selbst und rechnete im Kopf. »Diese Leute haben eine andere Zeitrechnung als wir. Sie beginnt mit der Ankunft des Propheten Mohammed in Mekka.«
»Dann ist der Mann also keine tausend Jahre alt?«
»Keineswegs«, sagte sie, als sie die Umrechnung abgeschlossen hatte. »Er ist nur fünfhundertzwanzig Jahre alt.«
Aus dem Augenwinkel bemerkte sie, dass Godefroy sich ihr fassungslos zuwandte.
»Ausgeschlossen«, sagte er mit einem Zittern in der Stimme, das verriet, dass sein Unglauben auf tönernen Füßen stand.
Sie ließ den Gefangenen nicht aus den Augen. Unergründliches, erschreckendes Wissen war darin verborgen. Sie versuchte, sich vorzustellen, was er im Lauf der Jahrhunderte alles erlebt hatte: Aufstieg und Fall mächtiger Reiche, aus dem Sand erblühende Städte, die wieder darin versunken waren. Was konnte er ihr über alte Mysterien und die Rätsel der Geschichte verraten?
Doch sie war nicht hier, um ihn auszufragen.
Außerdem bezweifelte sie, dass er ihre Fragen beantworten würde.
Dieser Mann bestimmt nicht – falls man noch von einem Mann sprechen wollte.
Als er erneut das Wort ergriff, packte er den Stab fester und äußerte eine Warnung. »Die Welt ist noch nicht bereit für das, wonach du suchst. Es ist verboten.«
Sie ließ sich nicht beirren. »Das zu entscheiden, steht dir nicht zu. Wenn jemand stark genug ist, es zu ergreifen, hat er auch ein Recht darauf.«
Er senkte den Blick auf ihre Brust, auf das, was unter der Rüstung verborgen war. »Das hat auch Eva geglaubt, als sie im Garten Eden auf die Schlange hörte und den Apfel vom Baum der Erkenntnis stahl.«
»Ah …« Sie seufzte und neigte sich vor. »Du irrst dich. Ich bin nicht Eva. Und ich suche nicht nach dem Baum der Erkenntnis – sondern nach dem Baum des Lebens.«
Sie zog einen Dolch aus der Scheide, richtete sich auf, trieb die Klinge bis ans Heft in den Hals des Gefangenen und riss ihn unter Aufbietung ihrer ganzen Willenskraft nach oben. Mit diesem einen Stoß kam die endlose Abfolge der Jahrhunderte zu einem blutigen Halt – und damit wurde auch die von ihm ausgehende Gefahr gebannt.
Godefroy schreckte zurück. »War das nicht der Mann, nach dem du so lange gesucht hast?«
Sie riss den Dolch aus der blutspritzenden Wunde und versetzte dem Leichnam einen Tritt. Den Stab fing sie auf, bevor er dem kraftlosen Griff des Gefangenen entglitt.
»Nicht nach dem Mann habe ich gesucht«, sagte sie, »sondern nach dem, was er bei sich hatte.«
Godefroy musterte den Stab aus Olivenholz. Frisches Blut rann daran hinab, darunter zeichneten sich Schnitzereien ab: Schlangen und Ranken schlängelten sich um den Stab.
»Was ist das?«, fragte der Ritter mit geweiteten Augen.
Jetzt erst sah sie ihn an – und stieß ihm die Klinge ins linke Auge. Er hatte zu viel gesehen, als dass er hätte weiterleben dürfen. Als er auf die Knie fiel und sich, durchbohrt von der Dolchklinge, im grausamen Todeskampf schüttelte, beantwortete sie seine Frage, die Hand fest um den Holzstab gelegt.
»Seht, der Bachal Isu«, flüsterte sie den zukünftigen Jahrhunderten zu. »Von Moses geschnitzt, von David benutzt und vom König der Könige getragen. Dies ist der Stab Jesu Christi.«
4. Juli: In fünf Tagen
Der Attentäter blickte durchs Zielfernrohr des Gewehrs und senkte das Fadenkreuz auf das Profil des Präsidenten James T. Gant ab. Er schätzte erneut die Entfernung – siebenhundert Meter – und richtete die Lasermarkierung des Scharfschützengewehrs vom Typ USMC M40A3 auf das Hinterhauptbein hinter dem linken Ohr des Mannes, denn an dieser Stelle würde ein Treffer die größte Wirkung erzielen. Über den Ohrhörer vernahm er festliche Musik und das muntere Gelächter eines Picknickausflugs. Dies alles drängte er in den Hintergrund und konzentrierte sich auf sein Ziel, seine Mission.
In der Geschichte der Vereinigten Staaten waren drei Präsidenten an diesem Tag, dem 4. Juli, dem Geburtstag des Landes, zu Tode gekommen. Das konnte kein Zufall sein.
Thomas Jefferson, John Adams und James Monroe.
Heute würde der vierte sterben.
Commander Gray Pierce hielt den Atem an und drückte ab.
TEIL 1 GEGENWART
1
30. Juni, 11:44, Eastern Standard TimeTakoma Park, Maryland
GRAY PIERCE LENKTE den Thunderbird Baujahr 1960 mit grollendem Motor in die Einfahrt.
Auch ihm war nach Knurren zumute.
»Ich dachte, du wolltest das Haus verkaufen?«, meinte Kenny.
Grays jüngerer Bruder saß auf dem Beifahrersitz, streckte den Kopf aus dem Fenster und betrachtete den Craftsman-Bungalow mit der umlaufenden Holzveranda und dem überhängenden Giebel. Das war ihr Elternhaus.
»Nicht mehr«, erwiderte Gray. »Und erzähl Dad bloß nichts davon. Die Demenz macht ihn paranoid.«
»Als ob das was Neues wäre …«, brummte Kenny verhalten.
Gray funkelte seinen Bruder böse an. Er hatte Kenny, der aus Nordkalifornien kam, vom Dulles Airport abgeholt. Die Augen seines Bruders waren vom Jetlag gerötet – vielleicht aber auch von zu vielen Fläschchen Gin in der Businessclass. In diesem Moment erinnerte Kenny ihn mit seiner Alkoholfahne an ihren Vater.
Im Rückspiegel sah er sein eigenes Gesicht, als er den alten Thunderbird in die Garage steuerte. Sie hatten zwar beide den gleichen rötlichen Waliser Teint und das dunkle Haar ihres Vaters, doch Gray trug es kurz geschoren, während Kenny es sich zu einem kleinen Pferdeschwanz gebunden hatte, der für einen Mann Ende zwanzig zu jugendlich wirkte. Obendrein trug er auch noch Cargoshorts und ein weites T-Shirt mit dem Logo eines Surfbrettherstellers. Kenny arbeitete als Programmierer für eine Firma in Palo Alto, und der Aufzug war offenbar seine Berufskleidung.
Gray stieg aus und bemühte sich, den Groll auf seinen Bruder zu verdrängen. Auf der Herfahrt hatte Kenny sich vor allem mit seinem Handy beschäftigt und Gespräche mit der Westküste geführt. Mit Gray hatte er kaum ein Wort gewechselt und ihm die Rolle des Chauffeurs überlassen.
Es ist ja nicht so, als hätte ich nichts zu tun.
Im Monat zuvor hatte Gray beruflich kürzergetreten und sich der Trauer um seine verstorbene Mutter und dem geistigen Verfall seines Vaters gewidmet. Nach der Beerdigung hatte Kenny versprochen, ihm eine Woche lang dabei zu helfen, die Angelegenheiten zu ordnen, doch schon nach zwei Tagen war er wegen einer dringenden Angelegenheit zurückgeflogen, und Gray hatte alles allein stemmen müssen. In gewisser Weise wäre es leichter gewesen, wenn Kenny überhaupt nicht gekommen wäre. Bei seiner Abreise hatte er ein heilloses Durcheinander von Versicherungsverträgen und Nachlassdokumenten zurückgelassen, das Gray hatte ordnen müssen.
Heute sollte sich das ändern.
Nach einem langen, hitzigen Telefonat hatte Kenny sich bereit erklärt, in diesem kritischen Moment herzukommen. Ihr Vater litt an fortschreitendem Alzheimer, und der plötzliche Tod seiner Frau hatte eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt. Die letzten drei Wochen hatte er in einer Einrichtung für Demenzkranke verbracht, doch gestern war er wieder nach Hause gekommen. Bei diesem Übergang war Gray auf Unterstützung angewiesen. Kenny hatte so viele Urlaubstage angehäuft, dass er für zwei Wochen hatte herkommen können. Gray hatte vor, ihn diesmal in die Pflicht zu nehmen.
Er hatte sich selbst einen Monat freigenommen und sollte in einer Woche wieder in der Sigma-Zentrale erscheinen. Vorher brauchte er eine Auszeit, um sein eigenes Haus in Ordnung zu bringen. Deshalb hatte er Kenny herbestellt.
Sein Bruder nahm seinen Koffer aus dem Kofferraum und klappte den Deckel zu, ließ die Hand aber auf der verchromten Stoßstange liegen. »Und was ist mit Dads Wagen? Den könnten wir auch verkaufen. Fahren kann er ihn ja nicht mehr.«
Gray steckte den Schlüssel ein. Der alte Thunderbird – rabenschwarz mit rotem Lederinterieur – war der ganze Stolz seines Vaters. Er hatte unglaublich viel Mühe auf die Restaurierung verwandt und einen Holly-Vergaser, eine Flame-Thrower-Zündspule und einen elektrischen Choke eingebaut.
»Der bleibt hier«, sagte er. »Dads Neurologe hat gemeint, es wäre wichtig, möglichst wenige Veränderungen in seiner Umgebung vorzunehmen und die familiäre Routine beizubehalten. Und wenn er schon nicht fahren kann, kann er wenigstens daran herumbasteln.«
Ehe Kenny sich überlegen konnte, welche Habseligkeiten ihres Vaters man sonst noch verkaufen könnte, wandte Gray sich zur Tür, ohne seinem Bruder anzubieten, ihm den Koffer zu tragen. Er hatte auch so schon genug zu schleppen.
Kenny aber war noch nicht fertig. »Wenn alles gleich bleiben soll – als hätte sich nichts verändert –, was tue ich dann hier?«
Gray fuhr zu ihm herum und hätte um ein Haar zugeschlagen. »Weil du immer noch sein Sohn bist – und es ist höchste Zeit, dass du dich auch so verhältst.«
Kenny starrte ihn an. Zorn funkelte in seinen Augen, was Gray wiederum an ihren Vater erinnerte. Diesen Jähzorn hatte er bei seinem Dad schon häufig erlebt, zumal in letzter Zeit – eine aus Demenz und Angst geborene Feindseligkeit. Neu war der Zorn eigentlich nicht. Sein Vater war schon immer ein harter Mann gewesen. Ursprünglich hatte er in Texas für eine Ölfirma gearbeitet, bis er bei einem Arbeitsunfall sein linkes Bein und seinen Stolz verlor. Der Ölmann war zum Hausmann geworden. Zwei Jungs großzuziehen, während seine Frau Geld verdiente, war ihm schwergefallen. Zum Ausgleich hatte er den Haushalt wie ein Bootcamp geführt. Und Gray, nicht minder dickköpfig als sein Vater, hatte dem Affen Zucker gegeben, der geborene Rebell. Bis er im Alter von achtzehn Jahren seine Sachen gepackt hatte und zur Army gegangen war.
Seine Mutter hatte sie schließlich wieder zusammengebracht, der sprichwörtliche Kleister, der die Familie zusammenhielt.
Und jetzt war sie tot.
Was sollten sie ohne sie anfangen?
Kenny hob seinen Koffer hoch, zwängte sich an Gray vorbei und brummte etwas, das so wehtat wie verrosteter Stacheldraht: »Wenigstens habe ich Mom nicht umgebracht.«
Vor einem Monat hätte dieser Tiefschlag Gray in die Knie gezwungen. Doch nach den Pflichtgesprächen mit dem Psychologen – von denen er allerdings einige versäumt hatte – reagierte er auf den Vorwurf seines Bruders, indem er sich verhärtete und für einen Moment wie angewurzelt stehen blieb. Eine für Gray gedachte Sprengfalle hatte seiner Mutter das Leben gekostet. Der Psychologe hatte den Ausdruck Kollateralschaden benutzt, um ihm das Schuldgefühl zu nehmen.
Aber bei der Totenfeier war der Sarg geschlossen gewesen.
Nicht einmal jetzt konnte er sich dem Schmerz stellen. Das Einzige, was ihn veranlasste, einen Fuß vor den anderen zu setzen, war seine Entschlossenheit, die Untergrundorganisation, die für den kaltblütigen Mordanschlag verantwortlich war, zu enttarnen und zu vernichten.
Und das tat er auch jetzt: Er drehte sich um und machte einen Schritt und dann den nächsten.
Mehr konnte er im Moment nicht tun.
10:58, Seychelles TimeVor den Seychellen
Etwas weckte sie mitten in der Nacht in der vor Anker liegenden Jacht.
Unwillkürlich legte Amanda die Hand auf ihren angeschwollenen Bauch und machte eine Bestandsaufnahme. Hatte sie einen Krampf gehabt? Sie befand sich im letzten Drittel der Schwangerschaft, und dies war immer ihre erste Sorge, der Mutterreflex, ihr ungeborenes Kind zu schützen. Doch sie nahm keinen Schmerz in ihrem Bauch wahr, nur den üblichen Druck auf die Blase.
Doch nach zwei Fehlgeburten fand sie so schnell keine Ruhe. Sie versuchte, sich damit zu beruhigen, dass sie die anderen beiden Babys – einen Jungen und ein Mädchen – im ersten Drittel verloren hatte.
Ich bin in der sechsunddreißigsten Woche. Alles ist in Ordnung.
Sie stützte sich auf einen Ellbogen auf. Ihr Mann schnarchte leise neben ihr im schmalen Doppelbett der Kabine. Seine dunkle Haut bildete einen starken Kontrast zum weißen Seidenkissen. Macks muskulöser Körper und der maskuline schwarze Stoppelbart auf Wangen und Kinn übten eine beruhigende Wirkung auf sie aus. Er war ihr David, gemeißelt aus schwarzem Granit. Trotzdem verspürte sie ein Unbehagen, als ihr Finger über seiner bloßen Schulter verharrte; sie wagte es nicht, ihn zu wecken, wollte gleichzeitig aber von seinen starken Armen umfangen werden.
Ihre Eltern – deren Aristokratenstammbaum bis in den alten Süden zurückreichte – hatten die Heirat mit der angestrengten Nachsicht moderner Rücksichtnahme gebilligt. Dabei nutzte die Verbindung der Familie sogar. Sie war blond und blauäugig, aufgewachsen in einer Welt der Ballveranstaltungen und Privilegien; er war schwarzhaarig und dunkelhäutig, gehärtet durch eine raue Kindheit auf den Straßen von Alabama. Das ungleiche Paar wurde zu einem Sinnbild familiärer Toleranz, was bei Bedarf ausgewalzt wurde. Doch diesem Sinnbild einer glücklichen Familie fehlte ein wesentliches Element: ein Kind.
Nach einem Jahr ohne Schwangerschaft – wie sich herausstellte, war die Unfruchtbarkeit ihres Mannes die Ursache –, hatten sie zur künstlichen Befruchtung mit dem Sperma eines anonymen Spenders Zuflucht genommen. Nach zwei Fehlgeburten hatte es beim dritten Versuch endlich geklappt.
Ihre Hand wanderte wieder zum Bauch.
Ein Junge.
Und dann hatte der Ärger angefangen. Vor einer Woche hatte sie eine merkwürdige Nachricht bekommen mit der Warnung, sie solle fliehen und niemandem von ihrer Familie davon erzählen. Der Brief deutete auch einen Grund an, und das reichte aus, um sie zu überzeugen.
An Deck ertönte ein dumpfes Geräusch. Sie setzte sich auf und lauschte angestrengt.
Ihr Mann wälzte sich auf den Rücken und rieb sich schlaftrunken die Augen. »Was ist denn, Schatz?«
Sie schüttelte den Kopf und hob warnend die Hand. Sie waren so vorsichtig gewesen und in aller Heimlichkeit vorgegangen. Sie hatten mehrere Privatflugzeuge mit falschen Papieren und falschen Zielangaben gechartert und waren vor einer Woche auf dieser Seite der Welt gelandet, auf der Landepiste der kleinen Insel Assumption, die zu den Seychellen gehörte. Ein paar Stunden nach der Landung waren sie mit einer Privatjacht losgesegelt und hatten auf die Inselkette Kurs genommen, die wie ein Smaragdbogen im azurblauen Meer lag. Sie wollte sich in der Einsamkeit vor neugierigen Blicken schützen, sich für den Fall, dass es Komplikationen gab, aber auch nicht allzu weit von Victoria entfernen, der Hauptstadt der Seychellen.
Nur der Captain und die beiden Besatzungsmitglieder hatten ihre Gesichter gesehen, und keiner kannte ihre wahren Namen.
Der Plan war nahezu perfekt.
Sie hörte gedämpfte Stimmen, konnte aber nichts verstehen. Dann eine befehlende Stimme – und ein Schuss, so hell und laut wie ein Beckenschlag.
Sie bekam Herzklopfen.
Nicht jetzt. Wo wir fast am Ziel sind.
Mack sprang auf, nur mit Boxershorts bekleidet. »Amanda, bleib hier!« Er zog die oberste Nachttischschublade auf und nahm eine große schwarze Automatik heraus, seine Dienstwaffe aus der Zeit als Police Officer in Charleston. Er zeigte zur Rückseite der Kabine. »Versteck dich im Bad.«
Amanda stand auf, benommen und ganz schwach vor Angst, schwankend unter dem Gewicht ihres unförmigen Bauchs.
Mack stürzte zur Tür und spähte durch den Spion. Dann öffnete er sie einen Spalt weit, schlüpfte hindurch und zog sie hinter sich zu – vorher aber gab er Amanda noch eine letzte Anweisung. »Schließ dich ein.«
Sie gehorchte, dann schaute sie sich in der Kabine nach einer Waffe um. Ihr Blick fiel auf ein kleines Messer, mit dem sie das Obst schälten, das jeden Morgen in ihre Kabine gestellt wurde. Der Griff war noch klebrig von Papayasaft. Mit dem Messer in der Hand ging sie zum Bad, hielt auf der Schwelle aber inne. Sie brachte es nicht über sich hineinzugehen. Sie hätte sich darin eingesperrt gefühlt. Das Bad war zu beengt für ihre Angst.
Weitere Schüsse fielen – es wurde gerufen und geflucht.
Sie sank auf die Knie; mit einer Hand umklammerte sie das Messer, mit der anderen stützte sie ihren Bauch. Ihre Angst griff auf das Kind über. Sie nahm einen schwachen Fußtritt wahr.
»Ich lasse nicht zu, dass dir jemand wehtut«, flüsterte sie dem Jungen zu.
Schritte wanderten übers Deck hin und her.
Sie schaute nach oben, als könnte sie durch die Decke hindurch aufs sternerhellte Schiffsdeck blicken. Was ging da vor? Wie viele Leute waren das?
Dann hörte sie ein Scharren – gefolgt von einem leisen Klopfen.
Sie eilte zur Tür und spähte durch den Spion. Mack nickte ihr zu, dann blickte er sich zum Niedergang um. Hatte er einen Fluchtweg entdeckt – oder war er aus Verzweiflung zurückgekehrt, um sie zu verteidigen?
Mit tauben Fingern öffnete sie den Riegel und zog die Tür auf. Im nächsten Moment wurde die Tür mit einem Fußtritt aufgedrückt. Sie taumelte zurück.
Ein großer Schwarzer mit nackter Brust trat in die Kabine – doch es war nicht Mack. In der Rechten hielt er Macks Kopf, die Hand um dessen Hals gelegt. Glänzendes Blut rann aus dem durchtrennten Hals über seinen Unterarm. In der anderen Hand hielt er eine blutige Machete. Er lächelte breit und bleckte die Zähne wie ein Hai, offenbar zufrieden mit seinem gelungenen Scherz.
Sie wich entsetzt zurück, das kleine Messer in ihrer Hand hatte sie vergessen.
Eine zweite Person trat hinter dem Widerling hervor. Ein blasser Mann in einem maßgeschneiderten weißen Anzug. Er hatte schwarzes Haar und einen schmalen Schnurrbart. Seine Lippen waren noch schmaler. Er war so groß, dass er sich beim Eintreten bücken musste. Auch er lächelte, aber eher entschuldigend, so als wäre ihm der Überschwang seines Begleiters peinlich.
Er sagte ein paar tadelnde Worte in einem afrikanischen Dialekt.
Achselzuckend warf der andere den Kopf ihres Mannes aufs Bett.
»Es ist Zeit«, sagte der Mann im Anzug mit gepflegtem britischem Akzent, als lade er sie zu einer Party ein.
Sie rührte sich nicht vom Fleck, konnte sich nicht bewegen.
Seufzend machte der Brite seinem Begleiter ein Zeichen.
Der Mann trat vor, packte sie grob beim Ellbogen und zerrte sie durch die Tür. Der Brite folgte ihnen über den kurzen Gang und stieg hinter ihnen die Leiter zum Achterdeck hoch.
Dort erwartete sie noch mehr Grauen und Chaos.
Der Captain und die beiden Besatzungsmitglieder sowie zwei Angreifer lagen in Blutlachen da. Die Angreifer waren erschossen worden; die Besatzungsmitglieder hatte man erschlagen und grausam verstümmelt.
Einige der Angreifer standen an Deck, weitere befanden sich in einem ramponierten Boot, das an der Steuerbordreling festgemacht hatte. Alle waren dunkelhäutig, einige hatten Stammesnarben, viele waren minderjährig. Alle waren bewaffnet; mit verrosteten Macheten, uralten Automatikgewehren und zahllosen Pistolen.
Piraten.
Im Mondschein, erfrischt vom aus Südost wehenden Passatwind, wurde sie wieder so klar im Kopf, dass sie von Verzweiflung und bitterem Bedauern nahezu überwältigt wurde. Sie hatte geglaubt, dass sie hier draußen bei den Seychellen weit genug vom Horn von Afrika entfernt und vor den Piraten, welche dort die Gegend unsicher machten, sicher wären.
Ein schrecklicher Irrtum.
Man stieß sie zum Boot, der Brite hielt sich an ihrer Seite. Ihr Vater hatte irgendwann mal erwähnt, dass einige europäische Auslandsbürger das profitable Piratengeschäft finanzierten.
Sie musterte den Briten und fragte sich, weshalb sein makelloser Anzug bei dem Gemetzel nicht mal einen Blutspritzer abbekommen hatte.
Er bemerkte, dass sie ihn ansah, und wandte sich ihr zu, als sie an der Steuerbordreling angelangt waren.
»Was wollen Sie von mir?«, fragte sie und musterte ihn durchdringend. Auf einmal war sie froh, dass sie falsche Papiere dabeihatte, die ihre wahre Identität verbargen. »Ich bin ein Niemand.«
Der Brite senkte den Blick – jedoch nicht aus Scham und Bedauern. »Auf Sie haben wir es nicht abgesehen.« Er sah ihren Bauch an. »Sondern auf das Kind.«
19:00, Eastern Standard TimeTakoma Park, Maryland
Gray stützte die Einkaufstüte auf der Hüfte ab und öffnete die Fliegengittertür seines Elternhauses. Es duftete nach Zimtkuchen. Auf dem Rückweg vom Training hatte Kenny ihn per SMS gebeten, französische Eiscreme und noch ein paar andere Zutaten fürs Abendessen mitzubringen – für das erste Familienessen seit dem tragischen Verlust ihrer Mutter.
Auf dem Herd stand ein großer Topf mit blubbernder Bolognese-Soße; in der Spüle ein Sieb mit abtropfenden Spaghetti. Ein zischendes Ploppen lenkte seinen Blick zum Topf. Die rote Soße kochte über, rann am Topfrand herunter und tropfte zischend in die Gasflamme.
Irgendetwas stimmte hier nicht.
Seine böse Vorahnung wurde bestätigt, als aus dem Nebenraum laut gerufen wurde. »Wo sind meine Schlüssel?«
Gray setzte die Tüte auf der Arbeitsplatte ab, schaltete den Herd aus und wandte sich ins Wohnzimmer.
»Jemand will meinen Wagen stehlen!«
Gray ging durchs Esszimmer und trat in den Tumult des Wohnzimmers. Die dick gepolsterten Sitzmöbel waren um den offenen Kamin in der Mitte herum gruppiert, der im Moment kalt und dunkel war. Sein Vater wirkte in dem Liegesessel am Panoramafenster stark abgemagert. Früher einmal hatte er den Sessel ausgefüllt und das ganze Zimmer in Beschlag genommen. Jetzt war er nur noch ein Schatten seiner selbst.
Doch er war immer noch stark. Er versuchte, sich aus dem Sessel hochzustemmen, doch Kenny drückte ihn an den Schultern nieder. Ihm half eine zierliche Frau mit bräunlich grauem Bubikopf, die einen blauen Kittel trug. Sie hatte sich auf ein Knie niedergelassen, hielt seinem Vater die Hand und bat ihn, sich zu beruhigen.
Mary Benning arbeitete in der Demenzeinrichtung des Krankenhauses. Bei seinem Krankenhausaufenthalt hatte sein Vater die Krankenschwester ins Herz geschlossen. Gray war es gelungen, sie als Nachtschwester zu engagieren, denn die Nacht war für seinen Vater die schwierigste Zeit. Der Plan sah vor, dass Kenny tagsüber ein Auge auf Dad hatte, bis Gray und Mary eine Tagesschwester einstellen konnten, die sich mit Mary abwechseln würde. Das würde teuer werden, doch Direktor Crowe hatte für eine angemessene Entschädigungszahlung gesorgt, damit Grays Vater zu Hause bleiben konnte.
»Harriet! Lass mich los!« Sein Vater riss sich von Mary los und hätte Kenny um ein Haar mit dem Ellbogen an der Nase getroffen.
Die Krankenschwester drückte ihm beruhigend das Knie. »Jack, ich bin’s. Mary.«
Er fand ihren Blick. Verwirrung zeichnete sich in seiner Miene ab, und als die Erinnerung einsetzte, sackte er in sich zusammen.
Mary blickte Gray an. »Ihr Vater hat gesehen, wie Sie mit dem Thunderbird vom Einkaufen gekommen sind. Da ist er in Panik geraten. Aber das wird schon wieder.«
Kenny richtete sich mit gequälter Miene auf. So hatte er seinen Vater noch nicht erlebt. Fassungslos stolperte er weg.
Sein Vater wurde auf ihn aufmerksam und riss die Augen auf. »Kenny, was machst du denn hier?«
Kenny, noch ganz erschüttert von der Tatsache, dass sich das Gehirn seines Vaters in einen Schweizer Käse verwandelt hatte, wusste nicht, was er sagen sollte.
Mary sprang für ihn ein. Sie blieb bei der Wahrheit und tätschelte seinem Vater das Knie. »Jack, er ist schon den ganzen Tag hier.«
Jack musterte die Gesichter, dann lehnte er sich zurück. »Ah, stimmt ja … Jetzt fällt’s mir wieder ein …«
Aber erinnerte er sich wirklich? Oder versuchte er bloß, Normalität vorzutäuschen?
Kenny wechselte einen Blick mit Gray. Seine Augen waren glasig.
Willkommen in meiner Welt.
»Ich kümmere mich jetzt besser um das Essen«, sagte Mary, richtete sich auf und wischte sich den Staub vom Knie.
»Und ich packe meinen Koffer aus«, sagte Kenny und machte Anstalten, sich überstürzt zurückzuziehen.
»Gute Idee. Und wasch dich auch gleich«, sagte sein Vater im Befehlston. »Dein Zimmer liegt …«
»Ich weiß noch, wo mein Zimmer liegt«, schnitt Kenny ihm das Wort ab, ohne zu merken, wie unangebracht eine solche Bemerkung gegenüber einem Alzheimerpatienten war.
Sein Dad aber nickte bloß zufrieden.
Als Kenny sich entfernte, bemerkte sein Vater endlich auch Gray. Die Verwirrung in seinem Gesicht verflog, und ein Anflug kalten Zorns trat an ihre Stelle. Sein Vater hatte fast zwei Wochen gebraucht, um den Tod seiner Frau zu akzeptieren, deshalb war die Wunde für ihn noch ganz frisch. Außerdem wusste er, wie es dazu gekommen war. Das vergaß er nie. In den vergangenen Wochen hatte es viele schlechte Tage gegeben, aber was konnten sie tun? Mit Worten konnte man Harriet nicht zurückholen.
Als an der Tür geklopft wurde, schreckten alle zusammen. Gray spannte sich an, auf das Schlimmste gefasst.
Kenny, der bereits an der Treppe angelangt war, öffnete die Tür.
Auf der Veranda stand eine schlanke Person in schwarzer Ledermontur, unter der offenen Motorradjacke trug sie eine weinrote Bluse. Den Helm hatte sie sich unter den Arm geklemmt.
Die Düsternis des Tages wich, als Gray sich ihr näherte. »Seichan, was machst du denn hier?«
Sein Vater mischte sich ein. »Lass die Dame nicht an der Tür stehen, Kenny!« Er winkte die Besucherin ins Zimmer. Das Gedächtnis mochte er verlieren, doch er wusste noch immer, was eine schöne Frau war.
»Danke, Mister Pierce.« Seichan trat ein. Sie bewegte sich so geschmeidig wie eine Dschungelkatze, nichts als Sehnen, Muskeln und Kurven. Als sie an Kenny vorbeikam, bedachte sie ihn mit einem abschätzenden Blick, doch was sie sah, vermochte sie anscheinend nicht zu beeindrucken.
Als sie Gray anschaute, verhärtete sich der Ausdruck ihrer Augen – nicht vor Zorn, sondern eher aus Selbstschutz. Seit dem Kuss und dem Versprechen, das sie sich vor drei Wochen gegeben hatten, hatten sie kaum miteinander gesprochen. Bei dem Versprechen war es nicht um romantische Gefühle gegangen. Sie hatte ihm lediglich zugesichert, dass sie ihm helfen würde, den Mörder seiner Mutter zu fassen.
Gray aber hatte nicht vergessen, wie weich ihre Lippen gewesen waren.
Gab es zwischen ihnen noch etwas Unausgesprochenes?
Ehe er dem Gedanken nachgehen konnte, zeigte sein Vater auf den Tisch. »Wir wollten gerade essen. Möchten Sie sich uns anschließen?«
»Das ist sehr freundlich«, erwiderte Seichan steif, »aber ich kann nicht lange bleiben. Ich möchte nur kurz mit Ihrem Sohn sprechen.«
Sie fixierte Gray mit ihrem Blick aus den eurasischen Mandelaugen.
Da war etwas im Busch.
Seichan hatte früher als Auftragsmörderin für dieselbe Untergrundorganisation gearbeitet, die für den Tod seiner Mutter verantwortlich war, eine international agierende Verbrecherbande, die sich die Gilde nannte. Ihre wahre Identität und ihre Absichten lagen noch im Dunkeln, und selbst ihre eigenen Agenten wussten nicht Bescheid. Die Organisation bediente sich einzelner, in der ganzen Welt verteilter Zellen, die voneinander unabhängig agierten und von denen keine über die kompletten Informationen verfügte. Seichan hatte sich irgendwann gegen die Organisation gewendet und als Doppelagentin für Direktor Crowe gearbeitet, bis sie schließlich aufgeflogen war. Jetzt wurde sie von ihren ehemaligen Arbeitgebern und wegen ihrer früheren Verbrechen von ausländischen Geheimdiensten gejagt, und Gray fühlte sich für sie verantwortlich.
Vielleicht war sie sogar mehr als nur seine Verbündete.
Er näherte sich ihr. »Was ist los?«
Mit leiser Stimme sagte sie: »Ich habe einen Anruf von Direktor Crowe bekommen und bin gleich hergefahren. Vor den Seychellen ist es zu einer Entführung durch somalische Piraten gekommen. Die Zielperson ist eine hochrangige Amerikanerin. Painter möchte wissen, ob wir uns darum kümmern wollen.«
Gray runzelte die Stirn. Was hatte Sigma mit einer einfachen Entführung zu tun? Es gab zahlreiche Polizei- und Schifffahrtsbehörden, die sich um ein solches Verbrechen kümmern konnten. Die Sigma Force – bestehend aus ehemaligen Angehörigen der Spezialkräfte, die man in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen ausgebildet hatte – war ein geheimer Zweig der DARPA, der Defense Advanced Research Projects Agency. Sigma-Teams wurden eingesetzt, um die Welt vor globalen Bedrohungen zu schützen, nicht um eine einzelne Amerikanerin zu befreien.
Seichan sah ihm seine Skepsis an. Sie blickte ihm tief in die Augen. Offenbar wusste sie mehr, als sie in Gegenwart der anderen sagen durfte. Irgendetwas war geschehen. Auf einmal bekam er Herzklopfen.
»Das ist eine sensible Angelegenheit«, setzte sie hinzu. »Wenn du mitkommst, es steht schon ein Jet bereit, und Kowalski ist unterwegs, um uns abzuholen. Wir können bei deiner Wohnung vorbeifahren. Instruktionen bekommen wir unterwegs.«
Gray blickte zu dem Sessel am kalten Kamin. Sein Vater hatte die Unterhaltung mitgehört und schaute seinen Sohn an.
»Geh«, sagte sein Vater. »Mach deinen Job. Ich habe hier genug Unterstützung.«
Die barsche Aufforderung beschwichtigte Grays schlechtes Gewissen, denn er fasste sie als Vergebung auf. Die nächsten Worte seines Vaters, vorgebracht mit schroffer Bitterkeit, zerstörten seine Hoffnung jedoch.
»Und außerdem, je seltener ich dich im Moment zu Gesicht bekomme … desto besser.«
Gray wich einen Schritt zurück. Seichan fasste ihn beim Ellbogen, als wollte sie ihn stützen. Doch es war vor allem die von ihrer Hand ausgehende Wärme, dieser menschliche Kontakt, der ihm Kraft verlieh – genau wie vor Wochen ihr Kuss.
Mary kam ins Zimmer, sich die Hände an einem Handtuch abtrocknend. Sie hatte die Bemerkung mitbekommen und bedachte Gray mit einem mitfühlenden Blick. »Ich habe hier alles im Griff. Nehmen Sie sich ruhig eine Auszeit.«
Er dankte ihr im Stillen und ließ sich von Seichan zur Tür geleiten. Er hätte sich gern von seinem Vater verabschiedet. Das Verlangen brannte in seiner Brust, doch er fand keine Worte.
Ehe er sich’s versah, stand er auf der Veranda. An der Treppe hielt er inne und atmete stockend ein.
»Alles in Ordnung?«, fragte Seichan.
Er fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. »Es geht schon wieder.«
Sie musterte ihn, als suchte sie nach einer aufrichtigeren Antwort.
Ehe Seichan sie gefunden hatte, traf ihr Chauffeur ein. Ein schwarzer SUV hielt mit quietschenden Reifen am Bordstein. Das Fenster glitt nach unten, eine Wolke Zigarrenrauch quoll heraus. Dann wurde ein rasierter Gorillakopf mit einem Stumpen im Mund sichtbar.
»Wollt ihr endlich einsteigen, oder was?«, rief Kowalski mit rauer Stimme.
Sosehr Gray sich manchmal über Kowalski ärgerte, jetzt freute er sich über das Erscheinen seines ungehobelten Teamkollegen. Er ging die Treppe hinunter, doch Kenny kam ihm nachgelaufen und verstellte ihm den Weg.
»Du kannst jetzt nicht weg. Was soll ich denn allein hier?«
Gray zeigte zum Haus. »Jetzt bist du dran. Was glaubst du eigentlich, was ich die ganze Zeit gemacht habe?«
Er schob sich an seinem Bruder vorbei und ging zum wartenden SUV und Seichans Motorrad.
Sie setzte sich im Gehen den Helm auf.
»Wer wurde uns sonst noch zugeteilt?«
»Zwei weitere Teamkollegen, einheimische Einsatzkräfte mit besonderen Fähigkeiten, sind bereits vor Ort.«
»Um wen handelt es sich?«
Mit der Andeutung eines Lächelns klappte sie das Visier herunter. Ihre Antwort klang dumpf und belustigt.
»Ich hoffe, du bist gegen Tollwut geimpft.«
2
1. Juli, 18:32, East Africa TimeRepublik Tansania
EIN LEISES KNURREN warnte ihn.
Tucker Wayne, der bereits auf der Hut war, drückte sich flach an die Backsteinmauer der schmalen Gasse und zog sich in den tiefen Schatten eines Eingangs zurück. Vor einer Stunde hatte er bemerkt, dass ihm jemand in weitem Abstand folgte. Im Labyrinth der Gassen und gewundenen Straßen hatte er den Verfolger rasch abgeschüttelt und war in diesem Viertel von Sansibar gelandet.
Wer hatte ihn aufgespürt?
Er presste den Rücken an die mit Schnitzereien verzierte Holztür. Seit drei Jahren trieb er sich in der Welt herum und stand kurz vor seinem dreißigsten Geburtstag. Vor zwei Wochen hatte er das Archipel von Sansibar erreicht, eine Kette von sonnendurchglühten Inseln vor der Ostküste Afrikas. Allein schon der Name – Sansibar – beschwor eine andere Zeit herauf, ein Land der Geheimnisse und Mythen. Hier konnte man untertauchen, im Verborgenen leben und brauchte keine Fragen zu beantworten.
Die Menschen waren aus gutem Grund nicht neugierig.
Trotzdem zog er hin und wieder Blicke auf sich, jedoch nicht deshalb, weil er ein Weißer war. Der alte Hafen Sansibars war nach wie vor eine Durchgangsstation für Menschen jedweder Herkunft und Hautfarbe. Und nachdem er ein Jahr lang Afrika bereist hatte, war seine Haut ebenso dunkel wie die der einheimischen Händler, die auf dem Gewürzmarkt der Altstadt ihre Waren anpriesen. Außerdem war er groß und muskulös – eher Quarterback als Linebacker –, doch sein harter Blick veranlasste jeden, der ihn musterte, rasch wegzusehen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!