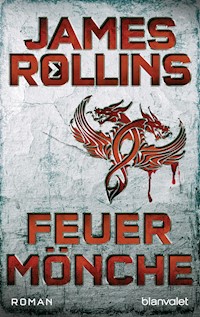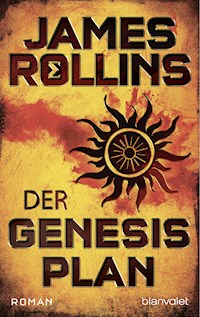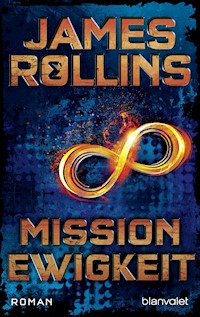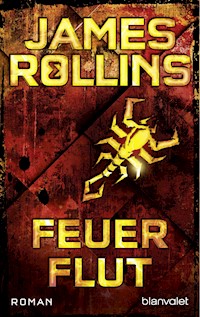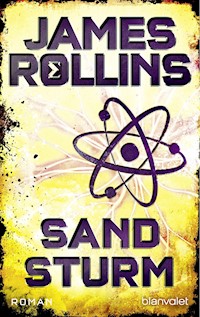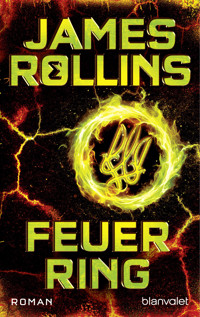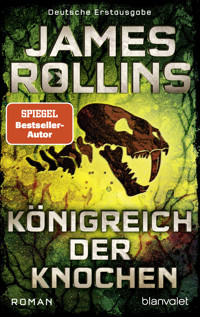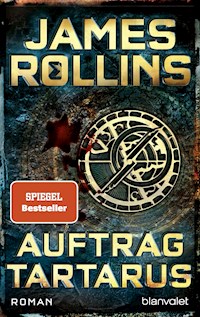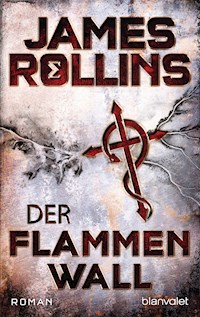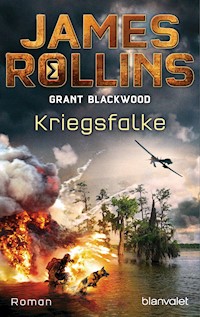8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Erin Granger
- Sprache: Deutsch
Der packende Abschluss der SPIEGEL-Bestsellertrilogie
Das leibhaftige Böse treibt auf der Erde sein Unwesen, und die Archäologin Erin Granger ist die Einzige, die es aufhalten kann. Doch dafür muss sie ein uraltes Rätsel lösen, das im Evangelium des Blutes geschrieben steht: Was ist der Kelch des Luzifer und wie kann er neu geschmiedet werden? Und was hat es mit dem Rat des Unsterblichen Lazarus auf sich, dass sie Evas gebrochenes Versprechen an die Schlange im Paradies erfüllen soll? Erin läuft die Zeit davon, doch sie ist entschlossen, die Aufgabe zu lösen – auch wenn sie dafür im wahrsten Sinne des Wortes die Tore der Hölle durchschreiten muss …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
James Rollins
und Rebecca Cantrell
Die Apokalypse des Blutes
Roman
Aus dem Englischen von Norbert Stöbe
Buch
Das leibhaftige Böse treibt auf der Erde sein Unwesen. Der Dämon Legion übernimmt die Kontrolle über immer mehr Vampire und lässt diese Amok laufen. Die Archäologin Erin Granger ist die Einzige, die es aufhalten kann. Doch was wie wahllose Gewalt und Chaos wirkt, folgt einem schrecklichen Plan.
Erin muss ein uraltes Rätsel lösen, das im Evangelium des Blutes geschrieben steht: Was ist der Kelch des Luzifer und wie kann er neu geschmiedet werden? Und was hat es mit dem Rat des Unsterblichen Lazarus auf sich, dass sie Evas gebrochenes Versprechen an die Schlange im Paradies erfüllen soll? Erin läuft die Zeit davon, doch sie ist entschlossen, die Aufgabe zu lösen – auch wenn sie dafür im wahrsten Sinne des Wortes die Tore der Hölle durchschreiten muss …
Autor
Der New York Times-Bestsellerautor James Rollins hat einen Doktorgrad in Tiermedizin. Als begeisterter Höhlenforscher und ebenso eifriger Taucher ist er häufig unter Wasser oder unter der Erde anzutreffen. Er wohnt in den Bergen der Sierra Nevada in Kalifornien, USA.
Autorin
Rebecca Cantrell gewann als Autorin bereits mehrere Preise. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Berlin.
Von James Rollins bei Blanvalet erschienen:
Sigma-Force:
Der Genesis-Plan, Feuermönche, Sandsturm), Der Judas-Code, Das Messias-Gen, Das Flammenzeichen, Mission Ewigkeit
Die Bruderschaft der Christuskrieger:
Das Evangelium des Blutes, Das Blut des Verräters, Die Apokalypse des Blutes
Außerdem:
Sub Terra, Im Dreieck des Drachen, Operation Amazonas, Das Blut des Teufels
Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels)
James: Für Rebecca, die mir auf dieser Reise Gesellschaft leistet.
Rebecca: Für meinen Mann und meinen Sohn.
Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst!
Jesaja 14, 12
Sommer 1606Prag, Böhmen
ENDLICH IST ESso gut wie vollbracht …
In seinem verborgenen Laboratorium stand der als John Dee bekannte Alchemist vor einer großen Glocke aus makellosem Glas. Sie ragte so hoch auf, dass ein Mann darin aufrecht stehen konnte. Das Wunderwerk war von einem berühmten Glasmacher von der fernen Insel Murano bei Venedig erschaffen worden. Eine Gruppe von Kunsthandwerkern hatte ein Jahr dafür gebraucht, wobei große Blasebälge und eine nur wenigen Meistern bekannte Technik zum Einsatz gekommen waren, die es erlaubte, eine gewaltige Perle aus geschmolzenem Glas zu drehen und zu einer perfekten Skulptur zu formen. Anschließend hatte es fünf weitere Monate gedauert, die kostbare Glocke von der Insel zum kalten Hof des heiligen Kaisers Rudolf II. im fernen Norden zu transportieren. Bei ihrem Eintreffen befahl der Kaiser, ein geheimes Alchemistenlabor darum herum zu errichten, umgeben von Werkstätten und tief unter den Straßen Prags gelegen.
Das war zehn lange Jahre her …
Jetzt stand die Glocke auf einem kreisförmigen Metallpodest in der Ecke des Hauptlabors. Die Ränder des Podests waren rot von Rost. Nahe der unteren Hälfte der Glocke war eine runde Tür, ebenfalls aus Glas, außen verstärkt mit dicken Metallstäben und luftdicht versiegelt.
John Dee erschauerte. Zwar war er erleichtert, dass er sein Werk vollendet hatte, doch er fürchtete sich auch. Er hatte dieses Höllengerät zu hassen begonnen, denn er wusste, welch grauenhaftem Zweck es dienen sollte. In letzter Zeit vermied er es nach Möglichkeit, sich der Glocke zu nähern. Tagelang werkelte er in seinem Laboratorium herum, den langen Kittel voller Chemikalienflecken. Sein weißer Bart tauchte beinahe in die Gefäße ein, seine tränenden Augen waren von der staubigen Oberfläche der Glasglocke abgewendet.
Aber jetzt ist die Aufgabe so gut wie vollendet.
Er ging zum Kamin, stellte sich auf die Zehenspitzen und langte zum Marmorsims hoch. Mit knotigen Fingern öffnete er die kunstvolle Verriegelung, hinter der eine kleine Kammer zum Vorschein kam. Nur er und der Kaiser wussten vom Vorhandensein der Kammer.
Als er die Hand hineinschob, wurde hinter ihm laut geklopft. Er drehte sich wieder zu dem in der Glocke eingesperrten Wesen um. Vor wenigen Stunden hatten es dem Kaiser treu ergebene Männer eingefangen und hierhergebracht.
Ich muss mich beeilen.
Das unheilige Wesen schlug gegen die Innenseite der Glocke, als spürte es, was ihm bevorstand. Trotz seiner übernatürlichen Kräfte konnte es sich nicht befreien. Das hatten schon ältere und weit mächtigere Kreaturen versucht und waren gescheitert.
Im Lauf der Jahre hatte John viele solche Wesen in der Glaszelle eingesperrt.
So viele …
Obwohl er wusste, dass ihm nichts geschehen konnte, klopfte sein schwaches Herz wie verrückt, denn der animalische Teil von ihm spürte die Gefahr auf eine Weise, gegen die seine Vernunft nicht ankam.
Er atmete stockend aus, griff in die Geheimkammer im Kaminsims und holte einen in ein Wachstuch eingeschlagenen Gegenstand heraus. Das Objekt war mit einer scharlachroten Kordel verschnürt und in einer Wachshülle eingeschlossen. Darauf bedacht, das Wachs nicht zu zerbrechen, trug John das Bündel an seine Brust gedrückt zum verhangenen Fenster. Trotz des Tuchs und der Wachshülle ging von dem Gegenstand eine unheimliche Kälte aus, die auf seine Finger und seinen Brustkorb ausstrahlte.
Er zog die dicken Vorhänge einen Spaltbreit auf und ließ einen Strahl Morgenlicht ein. Mit zitternden Händen legte er das Paket in die Lichtinsel auf der steinernen Tischplatte und stellte sich an die andere Seite, sodass nicht der kleinste Schatten auf den Gegenstand fiel. Er löste ein scharfes Flensmesser vom Gürtel und durchschnitt damit das Wachs und die rote Kordel. Behutsam teilte er das Tuch, von dem sich weiße Talgflocken lösten und auf den Tisch fielen.
Die tschechische Morgensonne fiel auf das, was im Kokon aus Wachs und Tuch verborgen war: einen wunderschönen Edelstein, so groß wie seine Handfläche und smaragdgrün funkelnd.
Doch es war kein Smaragd.
»Ein Diamant«, flüsterte er in der Stille des Raums.
Es war wieder Ruhe eingekehrt, denn das Wesen in der Glocke zitterte vor dem, was auf dem Schreibtisch leuchtete. Die Augen des Wesens huschten umher, denn das vom Edelstein reflektierte Licht malte Netzmuster an die verputzten Wände.
Ohne sich von der Angst der Gefangenen stören zu lassen, blickte John in den Diamant hinein, in dessen Innerem tiefe Schwärze wogte. Sie bewegte sich wie eine Mischung aus Rauch und Öl, wie ein lebendiges Etwas, das in dem Diamant so unentrinnbar gefangen war wie die Kreatur in der Glocke.
Dafür sei Gott gedankt.
Er berührte den eiskalten Edelstein mit der Fingerspitze. Der Legende nach stammte der Stein aus einem Bergwerk im Fernen Osten. Wie allen großen Edelsteinen sagte man auch diesem nach, auf ihm liege ein Fluch. Menschen hatten getötet, um ihn in ihren Besitz zu bringen, und waren bald darauf gestorben, als er erneut den Besitzer gewechselt hatte. Kleinere Diamanten aus derselben Gesteinsader schmückten die Kronen ferner Herrscher, doch dieser hier hatte keine solch eitle Verwendung gefunden.
Behutsam hob er den grünen Diamanten hoch. Jahrzehnte war es her, dass man ihn ausgehöhlt hatte. Zwei Juweliere waren erblindet, als sie mit winzigen Bohrern mit Diamantspitze den Hohlraum im prachtvollen grünen Herzen des Steins geschaffen hatten. Ein Knochensplitter, so schmal, dass er beinahe durchscheinend war, verschloss die kleine Öffnung – er war vor über tausend Jahren in einem Grab in Jerusalem gefunden worden, der letzte erhaltene Überrest Jesu Christi.
Wenigstens behauptete man das.
John hustete. Metallischer Blutgeschmack füllte seinen Mund, und er spuckte in den Holzeimer neben dem Schreibtisch. Die Krankheit, die von innen her an ihm nagte, ließ ihn in letzter Zeit kaum mehr in Ruhe. Er rang nach Atem und fragte sich, ob er je wieder Luft bekommen würde. Seine Lunge pfiff wie ein undichter Blasebalg.
Ein gedämpftes Klopfen an der Tür ließ ihn zusammenfahren. Der Edelstein entglitt seinen Fingern und fiel herab. Mit einem erstickten Schreckenslaut versuchte er, das kostbare grüne Objekt aufzufangen.
Der Stein landete auf dem Boden, doch er zerbrach nicht.
Ein durchdringender Schmerz strahlte von Johns Herzen in den linken Arm aus. Er fiel gegen das dicke Tischbein. Ein Becherglas zerschellte auf dem Boden, gelbe Flüssigkeit breitete sich auf den Holzdielen aus. Rauch kräuselte sich vom Rand des Bärenfells empor.
»Meister Dee!«, rief jemand mit jugendlicher Stimme an der anderen Seite der Tür. »Ist alles in Ordnung?«
Das Schloss klickte, die Tür schwang auf.
»Bleib …«, John keuchte vor Anstrengung, »… weg, Vaclav.«
Der junge Mann eilte seinem Meister trotzdem zu Hilfe. Er half John auf die Beine. »Bist du krank?«
Johns Krankheit vermochten nicht einmal die tüchtigsten Alchemisten am Hofe Kaiser Rudolfs zu heilen. Er rang nach Luft und ließ sich vom Jungen halten, bis sein Husten sich allmählich beruhigte. Der durchdringende Schmerz aber ließ nicht nach wie sonst.
Der junge Lehrling berührte sanft Johns schweißfeuchte Stirn. »Du hast heute Nacht nicht geschlafen. Als ich heute Morgen kam, war dein Bett unberührt. Ich wollte nachsehen, ob …« Vaclav stockte, als er zur Glasglocke sah und das darin eingesperrte Wesen bemerkte. Dieser Anblick war nicht gedacht für seine unschuldigen Augen.
Vaclav keuchte auf vor Überraschung und Entsetzen.
Die Frau erwiderte den Blick des Jungen, als er die Hand auf die Glockenwandung legte. Sie kratzte mit dem Fingernagel am Glas. Sie hungerte schon seit Tagen.
Vaclav musterte die Nackte. Welliges blondes Haar fiel ihr auf die Schultern und die bloßen Brüste. Sie hätte beinahe als schön gelten können. Doch im schwachen Licht, das durch die Vorhänge fiel, verlieh das dicke Glas ihrer schneeweißen Haut einen grünlichen Schimmer, als wäre sie bereits in Verwesung übergegangen.
Vaclav drehte sich fragend um. »Meister?«
Der Lehrling war im Alter von acht Jahren in seinen Dienst eingetreten. John hatte erlebt, wie er zu einem jungen Mann herangewachsen war, der eine große Zukunft vor sich hatte, denn er verstand sich auf das Mischen von Heiltränken und die Destillation von Ölen.
John liebte ihn, als wäre er sein leiblicher Sohn.
Dennoch zögerte er keinen Moment, als er das scharfe Flensmesser hob und dem Jungen die Kehle aufschlitzte.
Vaclav fasste sich an die Wunde und blickte John ungläubig in die Augen. Blut strömte zwischen seinen Fingern hervor und tropfte auf den Boden. Er sank auf die Knie und versuchte mit beiden Händen, die Blutung zu stillen.
Das Wesen in der Glocke warf sich mit solcher Gewalt gegen die Wandung, dass das schwere Metallpodest schwankte.
Riechst du das Blut? Erregt dich das?
John bückte sich und hob den grünen Edelstein auf. Er hielt ihn ins Sonnenlicht und überprüfte den Verschluss. Dunkelheit wogte im Stein, als suchte sie nach einem Riss, doch es gab keinen Ausgang. Er bekreuzigte sich und murmelte ein Dankgebet. Der Diamant war unbeschädigt.
John legte den Edelstein wieder in den Sonnenschein und kniete neben Vaclav nieder. Er strich dem jungen Mann das lockige Haar aus dem Gesicht.
Vaclavs Lippen bewegten sich, es gurgelte in seiner Kehle.
»Verzeih mir«, flüsterte John.
Der Mund des jungen Mannes formte ein einzelnes Wort.
Warum?
John konnte es dem Jungen nicht erklären, konnte den Mord nicht wiedergutmachen. Er legte seinem Lehrling die Hände auf die Wangen. »Du hättest das nicht sehen dürfen. Dann hättest du ein langes Leben der Wissenschaft widmen können. Doch das war nicht Gottes Wille.«
Vaclavs blutige Hände lösten sich von seinem Hals. Seine braunen Augen wurden glasig.
Mit zwei Fingern schloss John ihm die warmen Augenlider. Er neigte das Haupt und murmelte ein Gebet für Vaclavs Seele. Er war unschuldig gewesen und sollte jetzt an einem besseren Ort sein. Trotzdem war es ein tragischer Verlust.
Das Wesen in der Glasglocke, das Monstrum, das einmal ein Mensch gewesen war, sah ihm in die Augen. Der Blick der Frau schwenkte zu Vaclavs Leichnam und wieder zu John zurück. Sie spürte offenbar, wie sehr er litt, denn zum ersten Mal lächelte sie und entblößte ihre langen weißen Fangzähne. Sein Unglück bereitete ihr Vergnügen.
John richtete sich mühsam auf. Der Schmerz in der Herzgegend hatte nicht nachgelassen. Er musste seine Aufgabe rasch vollenden.
Er stolperte durchs Zimmer, schloss die Tür, die Vaclav offen gelassen hatte, und sperrte ab. Der zweite Schlüssel zum Raum lag in der abkühlenden Lache von Vaclavs Blut, und weitere gab es nicht. John würde nicht noch einmal gestört werden.
Er wandte sich um und fuhr mit dem Finger über das Glasrohr, das von der Glocke zu seinem Schreibtisch führte. Er suchte gründlich nach neuen Rissen oder sonstigen Defekten.
Ich bin dem Ziel zu nahe, um jetzt noch Fehler zu machen.
Am Ende verjüngte sich das Rohr zu einer schmalen Öffnung, kaum dicker als eine Nähnadel, Werk eines Glasmachers auf der Höhe seiner Kunst. John zog den dicken Vorhang ein Stück weiter auf, bis ein Sonnenstrahl auf das Ende des Glasrohrs fiel.
Der Schmerz in seiner Brust wurde stärker, er konnte den linken Arm nicht mehr anheben. Er brauchte seine Kräfte, doch sie schwanden rapide.
Mit der zitternden rechten Hand hob er den Edelstein hoch. Er funkelte im Sonnenschein, wunderschön und tödlich. Mit zusammengepressten Lippen kämpfte er gegen den Schwindel an und zog mit einer kleinen Pinzette den Knochensplitter heraus.
Ihm schlotterten die Knie, doch er biss die Zähne zusammen. Jetzt, da der Splitter entfernt war, musste der Stein im Sonnenlicht verharren. Fiele auch nur momentweise ein Schatten darauf, würde die darin eingeschlossene wogende Dunkelheit in die Welt entkommen.
Das durfte nicht geschehen … wenigstens jetzt noch nicht.
Die Schwärze wurde flacher und lief an den Seiten des kleinen Gefängnisses empor, erreichte die winzige Öffnung und hielt davor inne. Offenbar wagte sie es nicht, ins Helle vorzudringen. Das eingesperrte Böse spürte irgendwie, dass der ungedämpfte Sonnenschein es vernichten würde. Nur im grünen Inneren des Diamanten war es sicher.
Behutsam platzierte John die kleine Öffnung im Diamanten über dem offenen Ende des Glasrohrs. Beides wurde von der Sonne beschienen.
Er nahm die flackernde Kerze, die auf der fleckigen Tischplatte stand, in die Hand, hielt sie über den Diamanten und ließ Wachs auf den Stein und das Glasrohr tropfen, bis beide luftdicht versiegelt waren. Erst dann zog er den Vorhang zu, sodass der grüne Edelstein in Dunkelheit gehüllt war.
Im Kerzenschein sah er das dunkle Gebilde im Inneren des Diamanten. Es wogte umher, kroch an den Seiten der Öffnung empor. Mit angehaltenem Atem beobachtete er, wie es am Rand entlangfloss. Anscheinend untersuchte es die Versiegelung, und als es feststellte, dass kein Weg ins Laboratorium führte, strömte es durchs Glasrohr. Es folgte dem Rohr bis zum geweiteten Ende – bis zur Glasglocke und der darin befindlichen Frau.
John schüttelte sein weißhaariges Haupt. Sie war einmal ein Mensch gewesen, doch sie war keine Frau mehr. So durfte er nicht von ihr denken. Sie hatte sich beruhigt, stand regungslos in der Mitte der Glocke und musterte ihn mit ihren leuchtenden Augen.
Ihre Haut schimmerte so weiß wie Alabaster, ihr Haar wie gesponnenes Gold; beides war wegen der dicken Glaswandung grünlich getönt. Trotzdem war sie das schönste Wesen, das er je erblickt hatte. Sie legte die Hand aufs Glas. Der Kerzenschein spielte über ihre wunderschönen langen Finger.
Er ging zu ihr und legte seine Hand auf ihre. Das Glas fühlte sich kalt an. Auch als er noch keine Schmerzen gehabt hatte und nicht so schwach gewesen war, hatte er schon gewusst, dass sie die Letzte sein würde. Sie war das sechshundertsechsundsechzigste Wesen, das in diesem Sarg stand. Mit ihrem Tod wäre sein Werk vollendet.
Ihre Lippen formten das gleiche Wort wie zuvor Vaclav.
Warum?
Er konnte es ihr ebenso wenig erklären wie seinem toten Lehrling.
Ihr Blick wanderte zu der Schwärze, die ihrem Gefängnis immer näher kam.
Wie die anderen streckte auch sie die Hand zu dem Nebel aus, der in ihre Glaszelle eindrang. Ihre Lippen bewegten sich lautlos, ihr Gesichtsausdruck war verzückt.
In der Anfangszeit hatte er die gleiche Empfindung gehabt, wenn er dieser dunklen Vereinigung zuschaute, doch diese Gefühle hatten sich längst verflüchtigt. Er lehnte sich ans Glas, um ihr so nahe wie möglich zu kommen. Selbst der Schmerz in seiner Brust versiegte beim Betrachten.
Der schwarze Nebel verdichtete sich an der Oberseite des Hohlraums und bildete einen Nebel kleiner Tropfen aus, die auf die Gefangene niederregneten. Die Flüssigkeit rann ihre weißen Finger und ihre emporgereckten Arme entlang. Sie warf den Kopf in den Nacken und schrie. Er hörte sie nicht, wusste aber, dass sie eine Art Ekstase empfand. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, drückte die Brust heraus und erbebte, als die Tropfen ihren Leib liebkosten und sie überall benetzten.
Sie erschauerte ein letztes Mal, dann brach sie an der Glockenwandung leblos zusammen.
Der Nebel verharrte über ihr.
Es ist vollbracht.
John löste sich von der Glocke. Er trat um Vaclavs Leichnam herum, eilte ans Fenster und riss den Vorhang vollständig auf. Die Morgensonne fiel auf die Glocke. Der verfluchte Körper der Frau brach in Flammen aus, der dicke Qualm vermischte sich mit dem wartenden Nebel.
Der schwarze Nebel – durch die Essenz der Frau noch ein wenig dichter geworden – floh vor dem Sonnenlicht über den einen dunklen Fluchtweg, der ihm geblieben war: das in den Diamanten mündende Glasrohr. Mit einem Handspiegel lenkte John das Sonnenlicht am Rohr entlang und geleitete die böse Schwärze ins grüne Innere des Steins zurück, an den einzigen Ort, wo sie vor der sonnenhellen Welt Zuflucht fand.
Als sie wieder eingesperrt war, brach John vorsichtig das Wachssiegel und löste den Diamanten vom Rohr. Er hielt die kleine Öffnung ins Licht und trug den Stein zu einem Pentagramm, das er vor langer Zeit auf den Boden gemalt hatte. Er legte den Stein in die Mitte, immer noch in Sonnenschein gebadet.
So nah am Ziel …
Behutsam streute John kreisförmig Salz um das Pentagramm. Währenddessen intonierte er Gebete. Sein Leben war fast vorbei, doch bevor er starb, würde er seinen Lebenstraum verwirklichen.
Und die Pforte zur Welt der Engel öffnen.
Über sechshundert Mal hatte er diesen Kreis gezogen, über sechshundert Mal die gleichen Gebete intoniert. Im Innersten seines Herzens aber wusste er, dass es diesmal anders sein würde. Er vergegenwärtigte sich einen Vers aus der Offenbarung: Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.
»Sechshundertsechsundsechzig«, wiederholte er.
Das war die Zahl der Wesen, die er in der Glocke eingesperrt hatte, die Zahl der Rauchessenzen, die er bei ihrem Flammentod im Diamanten gesammelt hatte. Zehn Jahre hatte es gebraucht, so viele aufzuspüren, sie einzusperren und den bösen Wesenskern zu sammeln, der diese verfluchten Kreaturen belebte. Jetzt würden ihm deren vereinigte Kräfte die Pforte zur Welt der Engel auftun.
Er schlug die Hände vors Gesicht, zitterte am ganzen Leib. Er hatte so viele Fragen an die Engel. Seit den Zeiten, von denen das Buch Henoch berichtete, waren keine Engel ohne ausdrücklichen Befehl Gottes mehr auf die Erde gekommen. Seitdem war kein Mensch mehr ihrer Weisheit teilhaftig geworden.
Ich aber werde ihr Licht auf die Erde holen und es mit der ganzen Menschheit teilen.
Er ging zum Kamin und zündete eine lange Kerze an. Er trug sie zum Kreis und entzündete die fünf Kerzen in den Ecken des Pentagramms. Die gelben Flammen wirkten schwach und kraftlos im Sonnenschein und flackerten im Windzug, der vom Fenster kam.
Er zog den Vorhang wieder zu. Dunkelheit hüllte den Raum ein.
Er eilte zurück und kniete am Rand des Kreises nieder.
Schwarzer Rauch strömte aus der kleinen Öffnung des Steins, bewegte sich suchend umher. Vielleicht spürte er, dass draußen heller Tag war. Dann aber wurde er kühner, strömte auf John zu, als wollte er ihn vereinnahmen und ihn für seine lange Gefangenschaft bestrafen. Der Salzkreis aber hielt ihn zurück.
Ohne die Drohung zu beachten, flüsterte er, untermalt vom prasselnden Kaminfeuer, Worte in der Sprache Henochs, welche die Menschheit längst vergessen hatte. »Ich befehle Dir, Herr der Dunkelheit, zeig mir das Licht, das Gegenteil Deiner Schatten.«
Der schwarze Rauch im Kreis erzitterte einmal, zweimal, dehnte sich aus und kontrahierte wie ein lebendiges Herz. Mit jedem Pochen nahm sein Umfang zu.
John faltete die Hände. »Schütze mich, o Herr, sowie ich Deine Herrlichkeit schaue.«
Die Dunkelheit verdichtete sich zu einem Oval, groß genug, dass ein Mensch hindurchtreten konnte.
John vernahm leises Flüstern.
»KOMM ZU MIR …«
Die Stimme kam aus der Pforte.
»DIENE MIR …«
John nahm die Kerze in die Hand, die neben seinem Knie lag, und entzündete sie an der einen Ecke des Pentagramms. Er hielt die Flamme hoch und flehte erneut um Gottes Schutz.
Es hörte sich an, als bewege sich etwas auf der anderen Seite des Durchgangs, begleitet von einem lauten metallischen Klirren.
Worte kamen ihm in den Sinn. »VON ALLEN STERBLICHEN HABE ICH DICH AUSERWÄHLT.«
John richtete sich auf und tat einen Schritt in den Kreis hinein, streifte aber mit dem Fuß an Vaclavs ausgestreckter Hand. Er verharrte kurz, denn auf einmal hielt er sich für unwürdig, eine solche Herrlichkeit zu schauen.
Ich habe einen unschuldigen Menschen getötet.
Sein lautloses Geständnis fand Gehör.
»GRÖSSE HAT IHREN PREIS«, wurde ihm geantwortet. »NUR WENIGE SIND DARAUF VORBEREITET, IHN ZU ENTRICHTEN. DU BIST ANDERS ALS DIE ANDEREN, JOHN DEE.«
Er erschauerte.
Die Engel kennen meinen Namen.
Er schwankte zwischen Stolz und Furcht, das Zimmer drehte sich um ihn, als wäre er betrunken. Die Kerze entglitt seinen Fingern. Noch immer brennend, rollte sie in den Kreis hinein und durch das Portal, sodass sie beleuchtete, was dahinter lag.
Der Anblick der unsagbar majestätischen Gestalt auf dem schimmernden Ebenholzthron verschlug ihm den Atem. Augen aus schwarzem Öl funkelten in einem Gesicht von ernster Schönheit, das aus Onyx gemeißelt schien. Auf dem Haupt trug sie eine zerbrochene Silberkrone, die Oberfläche war dunkel angelaufen, die schartigen Spitzen glichen Hörnern. Hinter den breiten Schultern spannten sich mächtige Schwingen, deren Federn so dunkel und glänzend waren wie die eines Raben. Sie schwangen sich hoch empor und umschlossen die nackte Gestalt.
Die Erscheinung bewegte sich und brachte die Ketten aus eingedunkeltem Silber zum Klirren, mit denen ihr makelloser Leib an den Thron gefesselt war.
John wusste, wen er da vor sich hatte.
»Du bist kein Engel«, flüsterte er.
»ICH BIN … UND WERDE IMMER SEIN.« Obwohl die sanfte Stimme seinen Kopf ausfüllte, bewegte das Wesen nicht die Lippen. »MIT DEINEN WORTEN HAST DU MICH GERUFEN. WAS SONST SOLLTE ICH SEIN?«
Zweifel regte sich in Johns Brust, einhergehend mit einem wachsenden Schmerz. Er hatte sich geirrt. Die Dunkelheit hatte kein Licht heraufbeschworen, sondern bloß neue Dunkelheit.
Voller Grauen schaute er mit an, wie die Ketten vom Leib des Wesens abfielen. Die Bruchstellen leuchteten silberhell. Das Wesen befreite sich.
Sein Anblick brach den Bann. John trat aus dem Kreis hinaus und taumelte zum Fenster. Er musste verhindern, dass dieses Wesen der Dunkelheit in die Welt entwich.
»HALT …«
Die eine Silbe stach wie eine Feuerlanze in seinen Kopf. Er konnte nicht mehr klar denken, konnte sich kaum noch bewegen, schleppte sich aber dennoch weiter. Mit seinen Klauenhänden packte er den dicken Vorhang und zerrte mit seiner ganzen schwindenden Kraft daran.
Der Samtstoff zerriss.
Sonnenschein strömte in den Raum, fiel auf die Glocke, den Schreibtisch, den Kreis und auch auf die dunkle Pforte. Ein durchdringender Schrei drang heraus, brachte seinen Schädel schier zum Platzen.
Das war zu viel für ihn.
Doch es war genug.
Als John Dee zusammenbrach, war das Letzte, was er sah, die Finsternis, die sich in das Refugium im Diamanten flüchtete.
Möge niemand jemals diesen verfluchten Stein finden …
Zu Mittag brachen Soldaten die Tür des Laboratoriums mit einem Rammbock auf. Die Männer fielen im Flur auf die Knie, als der Kaiser an ihnen vorbeieilte.
»Schaut nicht vom Boden auf«, befahl er.
Die Soldaten gehorchten fraglos.
Kaiser Rudolf II. schritt an den knienden Männern vorbei in den Raum und musterte das Pentagramm, die Wachsspritzer und die beiden Toten am Boden – den Alchemisten und dessen jungen Lehrling.
Rudolf wusste, was ihr Tod zu bedeuten hatte.
John Dee hatte versagt.
Ohne den Toten einen zweiten Blick zu gönnen, trat Rudolf in den mystischen Kreis und hob den kostbaren Diamanten hoch, der in dessen Mitte lag. Eine schwarze Masse wogte zornig im blattgrünen Inneren. Kalter Hass strahlte vom Stein aus und setzte Rudolf zu, konnte ihm aber nichts anhaben. Wenigstens hatte Dee den Teufel eingesperrt.
Rudolf hielt den funkelnden Stein ins Sonnenlicht und verschloss die Öffnung mit dem Knochensplitter, der in der Ecke der Tischplatte lag, so durchscheinend wie eine Schneeflocke und doch immer noch so mächtig. Er entzündete eine Kerze und versiegelte die Öffnung mit Talgtropfen, die ihm die Finger verbrannten.
Anschließend setzte er sich auf den lädierten Stuhl. Vorsichtig schlug er den funkelnden grünen Stein und die darin eingeschlossene Dunkelheit in ein frisches Wachstuch ein. Dann verschnürte er das Bündel und tauchte es in einen Kessel mit warmem Talg, der neben dem Kamin stand. Rudolf achtete darauf, dass das Wachs das Bündel vollständig einhüllte.
Er blickte zu den Männern im Flur. Sie knieten noch immer, das Gesicht an den Boden gedrückt. Als er sich vergewissert hatte, dass er unbeobachtet war, öffnete er das Geheimfach im Kaminsims und schob das gefährliche Objekt hinein. In Henochs Sprache flüsterte er rasch ein Schutzgebet, dann verschloss er die Geheimklappe.
Einstweilen war das Böse sicher verwahrt.
Er war müde. Es war lange her, dass er wahre Ruhe gefunden hatte, und auch heute würde es nicht dazu kommen. Seufzend ließ er sich auf den Holzstuhl neben Dees Schreibtisch sinken und nahm ein Pergament von einem unordentlichen Stapel. Er tauchte eine Feder ins silberne Tintenfass und schrieb Henochs Alphabet auf. Nur wenige waren in die Geheimnisse der Sprache eingeweiht.
Als er fertig war, faltete der Kaiser das Papier zwei Mal, versiegelte es mit schwarzem Wachs und drückte seinen Siegelring in die warme Masse. Ein berittener Vertrauter würde es binnen Stundenfrist an den Adressaten überbringen.
Der Kaiser ersuchte um Hilfe.
Er benötigte den Rat einer Frau, die ebenso weit wie Dee in die Engelswelt aus Licht und Dunkelheit vorgedrungen war. Er betrachtete die beiden am Boden liegenden Toten und betete, dass er den hier angerichteten Schaden werde gutmachen können.
Er hob die hastig verfasste Nachricht ins Licht. Sonnenschein fiel auf die schwarzen Lettern ihres berühmten Namens.
TEIL 1
Denn er hatte zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen! Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und er sprach: Legion heiße ich; denn wir sind viele.
Markus 5, 8-9
1
17. März, 16:07 MEZVatikanstadt
LASS DICH NICHTerwischen.
Sämtliche Muskeln angespannt, hockte Dr. Erin Granger hinter einem Zettelkatalog in der Mitte des Lesesaals der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek. Kunstvolle Fresken schmückten die weiße Kuppeldecke. Zu beiden Seiten erstreckten sich Regale mit kostbaren Büchern. In der Bibliothek gab es über fünfundsiebzigtausend Manuskripte und über eine Million Bücher. Eigentlich war dies für eine Archäologin wie sie genau der Platz, an dem sie stunden- und tagelang hätte verweilen mögen, doch in letzter Zeit kam er ihr eher wie ein Gefängnis vor denn wie ein Ort, an dem Entdeckungen auf sie warteten.
Heute muss ich hier rauskommen.
Sie war nicht als Einzige an dem Komplott beteiligt. Ihr Komplize war Pater Christian. Er stand deutlich sichtbar neben ihr und drängte sie mit verstohlenen Handschlenkern, sich zu beeilen. Nach außen hin war er ein junger, hochgewachsener Priester mit dunkelbraunem Haar, funkelnden grünen Augen, markanten Wangenknochen und makelloser Haut. Man hätte ihn leicht für Ende zwanzig halten können, doch in Wahrheit war er Jahrzehnte älter. Früher war er ein Ungeheuer gewesen, ein Strigoi, ein Wesen, das sich von Menschenblut ernährt hatte. Schon vor langer Zeit aber hatte er sich dem katholischen Sanguinarierorden angeschlossen und gelobt, sich fortan ausschließlich von Christi Blut zu ernähren. Jetzt war er Sanguinarier und einer der wenigen, denen Erin vollkommen vertraute.
Deshalb vertraute sie auch seiner Empfehlung.
Neben Erin versteckte sich eine junge Nonne, Schwester Margaret. Schwer atmend befreite sie sich aus dem dunklen Gewand. Ihre Haube lag bereits auf dem Boden. Den Schweißtropfen auf ihrer Stirn nach zu schließen war sie ein Mensch. Erin hätte schwören mögen, dass sie den Herzschlag der Nonne hören konnte. Deren Herz klopfte ebenso wild wie das ihre.
»Fertig«, sagte Margaret, schüttelte ihr langes blondes Haar und erwiderte Erins Blick mit ihren dunklen Bernsteinaugen. Schwester Margaret hatte ungefähr Erins Größe und Hautfarbe, was für die Umsetzung ihres Plans unumgänglich war.
Erin streifte sich Margarets Gewand über den Kopf. Schwarze Serge glitt über ihre Wangen. Das Kleidungsstück roch frisch gewaschen. Sie ließ es an sich herabfallen und strich es in der Hocke an den Hüften glatt. Margaret half ihr, das weiße Brusttuch anzulegen. Sie richtete es gerade und schob ein paar Haarsträhnen darunter.
Als sie fertig war, hockte die Nonne sich auf die Fersen und musterte Erin kritisch.
»Was meinst du?«, fragte Christian aus dem Mundwinkel, den Arm auf den Zettelkatalog gestützt, um den beiden Frauen Deckung zu geben.
Margaret nickte zufrieden. Erin sah aus wie eine gewöhnliche Nonne, die im Vatikan, wo nur die Zahl der Touristen und Priester die der frommen Schwestern übertraf, nicht weiter auffallen würde.
Um die Tarnung zu vervollständigen, streifte Margaret Erin eine schwarze Kordel mit einem großen silbernen Kreuzanhänger über den Kopf und reichte ihr einen Silberring. Als Erin sich den warmen Ring auf den Ringfinger schob, wurde ihr bewusst, dass sie noch nie einen Ring getragen hatte.
Zweiunddreißig und noch immer unverheiratet.
Ihren verstorbenen Vater hatte es davor gegraust, dass seine Tochter ledig bleiben könnte. Er hatte ihr gepredigt, es sei die höchste Pflicht einer Frau, gottesfürchtige Kinder großzuziehen. Gleichermaßen entsetzt hätte es ihn, dass sie eine weltliche Schule besucht, einen Doktor in Archäologie gemacht und die letzten zehn Jahre auf den Nachweis verwandt hatte, dass viele in der Bibel erwähnte Geschehnisse nicht auf Wunder zurückzuführen waren, sondern ganz natürliche Ursachen gehabt hatten. Wenn er sie nicht bereits dafür verstoßen hätte, dass sie als Jugendliche der Religion den Rücken gekehrt hatte, dann hätte er es jetzt getan. Aber damit hatte sie ihren Frieden gemacht.
Vor einigen Monaten hatte sie Gelegenheit gehabt, einen Blick auf die geheime Geschichte der Welt zu werfen, eine Geschichte, die bei ihrem Studium keine Rolle gespielt und in der Wissenschaft, die das Fundament ihrer Weltsicht war, keinen Platz gehabt hatte. Sie war einem Sanguinarier begegnet, dem lebenden Beweis, dass Ungeheuer existierten und durch Frömmigkeit zu bändigen waren.
Gleichwohl hatte sie sich ihre Skepsis bewahrt und stellte noch immer alles infrage. Sie hatte sich mit der Existenz der Strigoi erst dann abgefunden, als sie dem ersten begegnet war, seine Wildheit erlebt und seine scharfen Zähne untersucht hatte. Sie traute nur dem, was sie selbst verifizieren konnte, weshalb sie auch darauf gedrängt hatte, den Plan endlich in die Tat umzusetzen.
Margaret band sich das Haar zum Pferdeschwanz. Unter dem Nonnengewand waren eine alte Jeans von Erin und eines ihrer weißen Baumwollhemden zum Vorschein gekommen. Auf den ersten Blick würde sie als Erin durchgehen.
Jedenfalls hoffe ich das.
Sie ließen sich beide von Christian in Augenschein nehmen. Er reckte den Daumen, dann beugte er sich vor und flüsterte Erin ins Ohr: »Erin, die Gefahr ist real. Sie sind im Begriff, sich auf verbotenes Terrain zu begeben. Wenn Sie erwischt werden …«
»Ich weiß«, sagte sie.
Er reichte ihr eine gefaltete Orientierungskarte und einen Schlüssel. Sie wollte beides entgegennehmen, doch er ließ nicht los.
»Ich bin bereit, Sie zu begleiten«, sagte er besorgt. »Sie brauchen nur ein Wort zu sagen.«
»Es wird schon gut gehen«, entgegnete sie. »Und das wissen Sie auch.«
Erin blickte Margaret an. Damit die List Erfolg hatte, musste Christian in der Bibliothek bleiben. Er war Erin als Leibwächter zugeteilt worden. Und das mit gutem Grund. Die Strigoiübergriffe nahmen in letzter Zeit in Rom zu. Irgendetwas hatte die Ungeheuer aus der Versenkung geholt. Und das nicht bloß hier. Berichte aus aller Welt deuteten auf eine Verlagerung des Gleichgewichts zwischen Finsternis und Licht hin.
Was aber war der Grund?
Sie hatte einen Verdacht, wollte ihn aber bestätigen, bevor sie ihn anderen mitteilte, und die heutige Unternehmung sollte ihr die nötigen Antworten liefern.
»Seien Sie vorsichtig«, sagte Christian abschließend und gab Karte und Schlüssel frei. Dann fasste er Margaret bei der Hand und half ihr beim Aufstehen. Sie hofften, dass man die blonde Frau an Christians Seite für Erin halten und dass ihre Abwesenheit unbemerkt bleiben würde.
»Ihr Blut«, flüsterte Erin. Darauf konnte sie ebenso wenig verzichten wie auf den Schlüssel.
Christian nickte und reichte ihr ein verschlossenes Glasfläschchen mit ein paar Millilitern seines schwarzen Bluts. Erin steckte das Fläschchen in die Tasche mit der kleinen Taschenlampe.
Christian berührte sein Brustkreuz und flüsterte: »Schnapp sie dir, Tiger.«
Dann schob er die Schwester hinter dem Zettelkatalog hervor und zu dem Tisch, auf dem Erin Rucksack und Notebook abgelegt hatte. Erin blickte den Rucksack an, den sie nur ungern zurückließ. Darin befand sich ein Spezialbehälter mit einem Buch, das kostbarer war als all die anderen Bände des vatikanischen Geheimarchivs.
Das Evangelium des Blutes.
Das Buch der Prophezeiungen hatte Christus mit Seinem heiligen Blut verfasst. Bislang hatten sich nur einige wenige Seiten des Buches offenbart. Sie vergegenwärtigte sich die flammenden Schriftzeilen, die auf den leeren Blättern zum Vorschein gekommen waren. Es waren kryptische Prophezeiungen gewesen. Einige waren bereits entziffert worden; andere harrten noch der Auflösung. Eine noch größere Herausforderung aber stellten die Hunderte von leeren Seiten dar, die ihren verborgenen Inhalt bislang noch nicht preisgegeben hatten. Es wurde gemunkelt, darin sei das ganze Wissen des Universums enthalten, und der Sinn des Lebens und dessen, was danach kam, werde darin offenbar.
Erin bekam einen trockenen Mund bei dem Gedanken, diesen Quell des Wissens zurückzulassen. Außerdem erfüllte es sie mit Stolz, dass dieses Wissen ihr zugedacht war. In der ägyptischen Wüste war das Buch mit ihr verknüpft worden. Sein Inhalt offenbarte sich nur dann, wenn sie es in Händen hielt. Deshalb hatte sie es bis jetzt stets bei sich getragen und keinen Moment aus den Augen gelassen.
Nun aber war sie dazu gezwungen.
Nonnen schleppten keine Rucksäcke, deshalb musste sie das kostbare Buch in Christians Obhut zurücklassen.
Je eher ich das hinter mich bringe, desto schneller bekomme ich das Buch zurück.
Dieser Gedanke beflügelte sie. Sie hatte eine Menge zu erledigen, und wenn sie nicht bis zum Abend in die Bibliothek zurückkehrte, würde sie entdeckt werden. Sie schob die Bedenken beiseite und senkte den Kopf. Dann holte sie tief Luft und trat hinter dem Zettelkatalog hervor in das leise Summen der Bibliothek.
Niemand achtete auf sie, als sie langsam zum Ausgang ging. Sie zwang sich, ruhig zu bleiben. Sanguinarier hatten so scharfe Sinne, dass sie den Herzschlag eines Menschen wahrnehmen konnten. Vielleicht würden sie sich ja wundern, wenn eine Nonne mit pochendem Herzen durch die stille Bibliothek eilte.
Sie schritt an Bücherregalen und Gelehrten vorbei, die an Tischen aus poliertem Holz saßen, die mit Bücherstapeln beladen waren. Viele der Forscher hatten jahrelang auf diesen Moment gewartet. Sie widmeten sich ihrer Aufgabe mit ebenso großer Hingabe wie ein Priester der Pflege des Glaubens. Auch Erin war einmal wie sie gewesen – bis sie auf eine andere, tiefere Geschichtsader gestoßen war. Seitdem konnten die bekannten Texte und vertrauten Wege sie nicht mehr zufriedenstellen.
Das war auch in Ordnung so. Die übliche wissenschaftliche Vorgehensweise stand ihr nicht mehr offen. Vor Kurzem hatte sie nach dem Tod eines ihrer Studenten bei einer Ausgrabung in Israel ihre Stelle an der Stanford University aufgegeben. Eigentlich hätte sie für die Zukunft vorsorgen und sich über ihre weitere Karriere Gedanken machen sollen, doch das war im Moment nicht mehr wichtig. Wenn sie und ihre Mitstreiter keinen Erfolg hatten, bräuchte sich niemand mehr über die Zukunft Gedanken machen.
Sie drückte die schwere Bibliothekstür auf und trat hinaus in den hellen italienischen Nachmittag. Die Frühlingssonne fühlte sich gut an auf ihrem Gesicht, doch sie hatte keine Zeit, zu verweilen und die Wärme zu genießen. Sie wurde schneller und eilte durch die Heilige Stadt zum Petersdom. Überall waren Touristen, die Stadtpläne konsultierten und sich umsahen.
Die Menschenmassen machten sie langsamer, doch schließlich erreichte sie die große, imposante Kirche. Das Bauwerk symbolisierte die päpstliche Macht, und niemand, der es betrachtete, konnte sich seiner Ausstrahlung entziehen. Obwohl sie sich seiner ernsten Bestimmung bewusst war, riefen die Schönheit der Fassade und die gewaltigen Kuppeln bei ihr Ehrfurcht wach.
Sie wandte sich zum großen Eingangstor und trat ungehindert zwischen den zwei Stockwerke hohen Marmorsäulen hindurch. Als sie durchs Atrium in das gewaltige Kirchenschiff schritt, warf sie einen Blick auf Michelangelos Pietà zu ihrer Rechten, die berührende Darstellung der Jungfrau Maria, die den Leichnam ihres Sohns in den Armen hielt. Das Bildnis mahnte sie, schneller zu gehen.
Wenn ich scheitere, werden noch viel mehr Mütter um ihre toten Kinder trauern.
Gleichwohl hatte sie keine Ahnung, wassie eigentlich tat. Seit zwei Monaten suchte sie in der Vatikanischen Bibliothek nach der Wahrheit hinter der letzten Prophezeiung des Blutevangeliums: Die Drei müssen sich gemeinsam der letzten Herausforderung stellen. Luzifer hat seine Ketten abgestreift, und sein Kelch ist verschollen. Es bedarf des Lichts aller Drei, um den Kelch neu zu schmieden und ihn erneut in die ewige Finsternis zu verbannen.
Der skeptische Teil von ihr – der Teil, der sich noch immer gegen die Wahrheit über die Strigoi, Engel und sich vor ihren Augen entfaltenden Wunder sträubte – fragte sich, ob die Aufgabe überhaupt lösbar war.
Einen alten Kelch neu schmieden, bevor Luzifer der Hölle entflieht?
Das klang eher nach einem alten Mythos als nach einer Unternehmung, die sich in der heutigen Zeit bewältigen ließe.
Doch sie gehörte dem Trio aus der Prophezeiung des Blutevangeliums an. Dazu gehörte der Christusritter, der Menschenkrieger und die Frau von großer Gelehrsamkeit. Und als Wissenschaftlerin war es Erins Aufgabe, die Wahrheit hinter diesen geheimnisvollen Worten zu ergründen.
Die anderen beiden Mitglieder des Trios warteten auf ihre Lösung und beschäftigten sich mit anderen Aufgaben, während sie in den Bibliotheken des Vatikans nach Antworten suchte. Beide hielten sich derzeit nicht in Rom auf, und sie fehlten ihr. Sie hätte sie gern an ihrer Seite gehabt, und sei es nur als Resonanzkörper für die vielen Theorien, die ihr durch den Kopf gingen.
Bei Sergeant Jordan Stone, dem Menschenkrieger, steckte natürlich noch mehr dahinter. In den wenigen Monaten ihrer Bekanntschaft hatte sie sich in den harten und gut aussehenden Soldaten mit den funkelnden blauen Augen, dem feinen Humor und dem unerschütterlichen Pflichtbewusstsein verliebt. Er verstand es, sie in den schwierigsten Situationen zum Lachen zu bringen, und hatte ihr schon mehrfach das Leben gerettet.
Wie hätte sie ihn da nicht lieben sollen?
Aber es gefällt mir nicht, dass du nicht hier bist.
Das war ein selbstsüchtiger Gedanke, aber ebenso wahr.
In den vergangenen Wochen hatte er angefangen, sich von ihr und allem anderen zu entfernen. Zunächst hatte sie geglaubt, er hadere damit, dass man ihn von seinem regulären Armeeposten abgezogen und gegen seinen Willen den Sanguinariern zugeteilt hatte. Seit Kurzem aber hatte sie den Verdacht, dass seine Distanziertheit einen tieferen Grund hatte und dass sie im Begriff war, ihn zu verlieren.
Sie wurde von Zweifeln geplagt.
Vielleicht wünscht er sich keine so enge Beziehung wie ich …
Vielleicht bin ich nicht die Richtige für ihn …
Sie wollte gar nicht daran denken.
Das dritte Mitglied des Trios, Pater Rhun Korza, war ein noch problematischerer Fall. Der Christusritter war ein Sanguinarier. Inzwischen hatte sie Respekt vor seinem strengen Moralkodex, seiner unglaublichen Kampfkraft und seiner Hingabe an die Kirche, doch sie fürchtete sich auch vor ihm. Kurz nach ihrer ersten Begegnung hatte er in einem Moment der höchsten Not von ihrem Blut getrunken und sie in den dunklen Gängen im Untergrund Roms beinahe getötet. Die Erinnerung daran ängstigte und faszinierte sie gleichermaßen.
Im Moment waren sie enge Kollegen, wenngleich zwischen ihnen eine gewisse Befangenheit herrschte, so als wüssten sie, dass die Grenze, die sie im Tunnel überschritten hatten, sich nicht wieder überwinden würde.
Vielleicht ist das ja der Grund, weshalb Rhun in den letzten Monaten nicht mehr in Rom war.
Sie seufzte und wünschte, die beiden Männer wären hier, wusste aber auch, dass sie die vor ihr liegende Aufgabe alleine bewältigen musste. Und die Aufgabe war gewaltig. Wenn sie Luzifers Kelchneu schmieden sollten, musste sie zunächst herausfinden, was es mit dem Kelch aus der Prophezeiung auf sich hatte. Sie hatte das Vatikanische Archiv durchsucht, angefangen von den modrigen Krypten bis zu den Hochregalen im Torre di Venti, dem Turm der Winde, dessen Stufen schon Galilei emporgeschritten war. Doch nach all den Nachforschungen stand sie immer noch mit leeren Händen da. Nur noch eine letzte Bibliothek musste sie erforschen, eine Sammlung, zu der allen Menschen mit schlagendem Herzen der Zutritt verwehrt war.
Die Bibliotheca dei Sanguines.
Die Privatbibliothek des Sanguinarierordens.
Aber erst einmal muss ich da hineingelangen.
Die Bibliothek lag unter dem Petersdom, in Gängen, die dem Sanguinarierorden vorbehalten waren, den Strigoi, die gelobt hatten, der Kirche zu dienen, auf Menschenblut zu verzichten und sich allein vom Blut Christi zu ernähren – genauer gesagt vom Wein, der durch Gebet und Segnung in die heilige Essenz transsubstanziiert worden war.
Sie schritt energisch durch die riesige Kirche und bemerkte, dass zusätzliche Schweizergardisten in Stellung gegangen waren. Im ganzen Vatikanstaat herrschte wegen der zunehmenden Strigoiübergriffe erhöhte Alarmstufe. Obwohl sie die Nase in Büchern vergraben hatte, war auch ihr zu Ohren gekommen, dass die an den Morden beteiligten Ungeheuer stärker und schneller geworden und schwieriger zu töten waren.
Aber warum?
Das war eine weitere offene Frage, die sie in der Geheimbibliothek zu beantworten hoffte.
In den vergangenen Monaten hatte sie Tausende verstaubte Schriftrollen, alte Pergamente und Tontafeln untersucht. Die Texte waren in verschiedenen Sprachen verfasst und von unterschiedlichen Menschen niedergeschrieben worden, doch keiner hatte ihr die gewünschte Information geliefert.
Jedenfalls hat das bis vor zwei Tagen gegolten …
Im Turm der Winde hatte sie eine zwischen den Seiten des Buches Henoch versteckte alte Karte entdeckt. Sie hatte sich den alten jüdischen Text – ein Buch, das angeblich vom Urgroßvater Noahs verfasst worden war – deshalb vorgenommen, weil er von gefallenen Engeln und ihrer hochmütigen Nachkommenschaft handelte, den Nephilim. Luzifer hatte die gefallenen Engel beim Aufstand im Himmel angeführt. Am Ende wurde er gestürzt, weil er Gottes Plan für die Menschheit infrage gestellt hatte.
Als sie das alte Buch im Turm der Winde aufgeschlagen hatte, war eine Karte herausgefallen. Sie war mit schwarzer Tinte auf vergilbtes Papier gezeichnet und mit verschnörkelten Anmerkungen in mittelalterlicher Handschrift versehen. Sie verwies auf eine weitere Bibliothek des Vatikans, die noch älter war als die anderen.
Von dieser Geheimbibliothek hatte sie noch nie gehört.
Der Karte zufolge lag sie in der Zufluchtsstätte der Sanguinarier, in dem Labyrinth der Gänge und Kammern unterhalb des Petersdoms, die einige von ihnen zu ihrer Zuflucht erkoren hatten. In diesen alten Gemäuern verbrachten die unsterblichen Sanguinarier fernab vom Getriebe der hellen Menschenwelt viele Lebensjahre in stiller Kontemplation und im Gebet. Einige lebten schon seit Jahrhunderten in diesen Räumen und nährten sich allein von einem gelegentlichen Schluck geweihten Weins. Sie suchten nichts weiter als Frieden, und der Zugang zu ihrem Bereich wurde streng bewacht.
Der Karte in ihrer Tasche zufolge befanden sich in der Zufluchtsstätte die ältesten Archive des Vatikans. Sie hatte Christian nach diesem Ort gefragt und erfahren, dass die meisten der dort verwahrten Dokumente in ferner Vergangenheit von Unsterblichen verfasst worden waren. Einige von ihnen waren Christus persönlich begegnet. Andere waren schon damals uralt gewesen und hatten sich dem Orden angeschlossen, nachdem sie jahrhundertelang ihr Unwesen als Strigoi getrieben hatten.
Obwohl Menschen der Zutritt zur Zufluchtsstätte verboten war, war Erin bereits einmal mit Rhun und Jordan dort gewesen. Sie hatten das Blutevangelium ins höchste Heiligtum der Sanguinarier gebracht und den Segen des Ordensgründers entgegengenommen, des Auferstandenen. Dabei hatten sie erfahren, dass er noch einen anderen Namen hatte, der auch in der Bibel erwähnt wurde.
Lazarus.
Er war der erste Strigoi gewesen, der Christ Gefolgschaft geleistet hatte.
Nachdem sie von der Bibliothek erfahren hatte, wandte Erin sich an den gegenwärtigen Ordensleiter in Rom, Kardinal Bernard. Sie bat ihn um Erlaubnis, ihre Nachforschungen in der Bibliothek fortsetzen zu dürfen, wurde aber abgewiesen. Der Kardinal beharrte darauf, dass kein Mensch die Schwelle übertreten dürfe. Außerdem versicherte er ihr, in der Bibliothek seien nur den Orden betreffende Informationen zu finden, die ihr nicht weiterhelfen würden.
Die Reaktion des Kardinals hatte Erin nicht überrascht. Bernard betrachtete Wissen als machtvollen Schatz, der weggeschlossen gehörte.
Sie hatte ihre Trumpfkarte ausgespielt. »Das Blutevangelium hat mich als Frau von großer Gelehrsamkeit bestätigt«, rief sie Bernard in Erinnerung und zitierte die neueste Prophezeiung, die in der Wüste offenbart worden war. »Die Frau von großer Gelehrsamkeit ist jetzt mit dem Buch verbunden, und niemand soll sie davon trennen.«
Trotzdem hatte er sich geweigert, ihr zu helfen. »Ich habe viel in der Bibliothek gelesen. Niemand in der Zufluchtsstätte ist je mit Luzifer und den gefallenen Engeln gewandelt. Die Geschichte seines Sturzes wurde lange nach dem Vorfall niedergeschrieben. Deshalb gibt es keine Berichte von Augenzeugen, und niemand weiß, wohin Luzifer verbannt wurde, wo er eingekerkert ist oder wie die Fesseln, die ihn in der ewigen Finsternis festhalten, beschaffen oder zu lösen sind. Es wäre Zeitverschwendung, in der Bibliothek nach Hinweisen zu suchen, selbst dann, wenn es nicht verboten wäre.«
Als sie ihm in die unnachgiebigen braunen Augen sah, begriff sie, dass er von diesen uralten Regeln nicht abweichen würde. Das bedeutete, sie musste sich selbst Zutritt verschaffen.
Sie blickte zur Statue des heiligen Thomas, der so lange gezweifelt hatte, bis man ihn eines Besseren belehrt hatte. Trotz ihrer Nervosität lächelte sie.
Das ist mal ein Apostel ganz nach meinem Geschmack.
Sie näherte sich der Statue. Zu deren Füßen befand sich eine kleine Tür. Normalerweise war sie unbewacht, doch heute stand ein Schweizergardist vor der Schwelle, halb verborgen im Alkoven. Sie biss die Zähne zusammen und ging zur Seite, wo er sie nicht sehen konnte. Sie wusste, wem sie das zu verdanken hatte.
Zum Teufel mit dir, Bernard.
Der Kardinal hatte nach ihrer hitzigen Unterhaltung einen Wachposten herbeordert, da er zu Recht befürchtete, sie könnte sich heimlich Zugang zur Sanguinarierbibliothek verschaffen.
Sie überlegte – und fand die Lösung in Gestalt eines Mädchens, das nur wenige Schritte von ihr entfernt war. Das Kind war acht oder neun und schlurfte gelangweilt über die Marmormosaike. Zwischen den Händen drehte es einen hellgrünen Tennisball. Die Eltern folgten ein paar Meter nach, in eine angeregte Unterhaltung vertieft.
Erin schloss sich dem Mädchen an. »Hallo.«
Das Kind musterte sie misstrauisch mit seinen blauen Augen. Seine Nase war mit Sommersprossen bedeckt, das rote Haar zu Zöpfen geflochten.
»Hallo«, antwortete das Mädchen widerwillig auf Englisch, als wüsste es, dass es einer Nonne eine Antwort schuldig war.
»Leihst du mir mal den Ball?«
Das Mädchen hielt den Tennisball abwehrend hinter den Rücken.
Okay, eine andere Taktik.
Erin hielt einen Fünfeuroschein hoch. »Vielleicht möchtest du ihn mir ja verkaufen?«
Das Kind machte große Augen, von dem Angebot in Versuchung geführt – dann warf es ihr den Tennisball zu, während es misstrauisch zu den Eltern hinübersah.
Als der Handel abgeschlossen war, wartete Erin, bis sich das Kind wieder seinen Eltern angeschlossen hatte. Dann warf sie den Ball in hohem Bogen durchs Kirchenschiff auf eine Gruppe von Besuchern, die ein paar Meter vom Wachposten entfernt waren. Der Ball prallte gegen den Hinterkopf eines Mannes in einem grauen Mantel.
Er schrie auf, schimpfte auf Italienisch und sorgte für eine Menge Wirbel. Wie gehofft, eilte der Schweizergardist hinzu.
Erin nutzte die Gelegenheit, lief zur Tür und steckte den Schlüssel ins Schloss, den Christian ihr gegeben hatte. Wenigstens erwiesen sich die Angeln als gut geölt. Erin zog die Tür hinter sich zu und sperrte sie im Dunkeln ab. Das Herz klopfte ihr bis zum Hals.
Voller Bangigkeit legte sie die Hand flach auf die Tür. Wie soll ich hier nur wieder rauskommen, ohne erwischt zu werden?
Doch es war zu spät, sich deswegen Gedanken zu machen. Jetzt musste sie ihren Plan umsetzen.
Sie schaltete die Taschenlampe ein und schaute sich um. Vor ihr erstreckte sich ein langer Gang. Die gewölbte Decke befand sich etwa drei Meter über ihr, auch die Wände waren gewölbt. Neben der Tür stand ein verstaubter Eichentisch mit Bienenwachskerzen und Streichhölzern. Sie steckte ein paar ein, zündete sie aber nicht an. Für den Fall, dass die Batterie leer wurde, war es gut, eine Alternative zu haben.
Sie holte die Karte aus der Tasche. Auf die Rückseite hatte Christian einen Lageplan der Tunnel gezeichnet, die zur Zufluchtsstätte führten. Da ihr der Rückweg versperrt war, raffte sie ihr schweres Gewand und setzte sich in Bewegung. Bis zur Zufluchtsstätte waren es fast zwei Kilometer.
Der Strahl der Taschenlampe schwankte über die Wände und beleuchtete Abzweigungen, die sie atemlos zählte.
Einmal falsch abgebogen, und ich irre tagelang durch dieses Labyrinth.
Die Angst trieb sie an, als sie schmale Treppen hinunterstieg und sich einen Weg durch das Gewirr der Gänge suchte. Das Fläschchen mit Christians Blut stieß gegen ihren Schenkel und erinnerte sie daran, dass der Preis für das Wissen bisweilen mit Blut entrichtet werden musste. Das hatte man ihr schon als Kind eingebläut, als ihr Vater unter ihrer Matratze ein Buch entdeckt hatte. Die barsche Stimme ihres Vaters drang aus der Vergangenheit an ihre Ohren.
»Wie ist es Eva ergangen, als sie die Frucht vom Baum des Wissens gekostet hat?«, fragte ihr Vater, der auf ihr neun Jahre altes früheres Selbst herabsah, die kräftigen Farmerhände drohend zu Fäusten geballt.
Sie war sich nicht sicher, ob er eine Antwort von ihr erwartete, und hielt deshalb den Mund. Wenn sie etwas sagte, wurde er meistens nur noch zorniger.
Das Buch – Der Almanach des Farmers – lag aufgeschlagen auf den Dielenbrettern, der Lampenschein fiel auf die cremefarbenen Seiten. Bis heute hatte sie nur in der Bibel gelesen, denn ihr Vater vertrat die Ansicht, darin sei alles zu finden, was sie je zu wissen bräuchte.
Im Almanach hatte sie jedoch neues Wissen gefunden: die Zeiten für Aussaat und Ernte und die Mondphasen. Auch ein paar Witze standen darin, und die hatten sie verraten. Sie hatte zu laut gelacht und war beim Lesen erwischt worden, im Schneidersitz unter dem Schreibtisch hockend.
»Wie ist es Eva ergangen?«, wiederholte er leise und drohend.
Sie versuchte, sich mit Bibelzitaten zu schützen, und sagte eingeschüchtert: »›Da wurden ihrer beiden Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren.‹«
»Und wie sah die Bestrafung aus?«, fuhr ihr Vater fort.
»›Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst; du sollst mit Schmerzen Kinder gebären.‹«
»Und diese Lektion sollst du von meiner Hand lernen.«
Ihr Vater zwang sie, eine Weidenrute auszuwählen und vor ihm niederzuknien. Folgsam kniete sie auf dem Boden nieder und streifte das Kleid über den Kopf. Ihre Mutter hatte es ihr genäht, und sie wollte nicht, dass es schmutzig wurde. Sie faltete es sorgfältig zusammen und legte es neben sich. Dann schlang sie die Arme um ihre kalten Knie und wartete auf die Schläge.
Er ließ sie immer lange warten, so als wüsste er, dass die Erwartung des Schmerzes beinahe ebenso schlimm war wie die Hiebe selbst. Sie bekam am Rücken eine Gänsehaut. Aus dem Augenwinkel sah sie den Almanach, und es tat ihr nicht leid.
Der erste Schlag traf ihre Haut, und sie biss die Lippen zusammen, um nicht zu schreien. Wenn sie schrie, schlug er sie umso fester. Er peitschte ihr den Rücken, bis das Blut in ihre Unterwäsche lief. Später würde sie die hellroten Spritzer von Wand und Boden abwaschen müssen. Erst einmal aber musste sie die Schläge aushalten und warten, bis ihr Vater den Eindruck hatte, er habe genug Blut vergossen.
Erin schauderte bei der Erinnerung, die durch die Dunkelheit in den Gängen eine ganz eigene Realität gewann. Ihre Rückenmuskeln zuckten sogar, als erinnerten sie sich an die schmerzhafte Lektion.
Der Preis des Wissens waren Blut und Schmerz.
Noch ehe ihr Rücken verheilt war, hatte sie sich erneut ins Arbeitszimmer ihres Vaters geschlichen und den Almanach heimlich zu Ende gelesen. Ein Abschnitt befasste sich mit der Wettervorhersage. Ein Jahr hatte sie das Wetter verfolgt, um zu überprüfen, ob die Autoren recht behielten, doch sie irrten sich häufig. Da begriff sie, dass nicht alles wahr war, was in Büchern stand.
Und das galt auch für die Bibel.
Sie hatte sich von der Angst vor Strafe nicht aufhalten lassen.
Und auch jetzt lasse ich mich nicht aufhalten.
Sie stapfte über den Steinboden, bis sie endlich zur Tür der Zufluchtsstätte gelangte. Dies war nicht der Haupteingang, sondern ein selten benutzter Zugang, nicht weit von der Bibliothek entfernt. Die Tür sah aus wie eine leere Wand, doch in einem kleinen Alkoven befand sich ein Steinbecken, so groß wie eine kleine Schüssel oder ein Becher.
Sie wusste, was sie zu tun hatte.
Die Geheimtür ließ sich nur mit dem Blut eines Sanguinariers öffnen.
Sie holte Christians Glasfläschchen aus der Tasche und betrachtete das darin wogende schwarze Blut. Sanguinarierblut war dicker und dunkler als das der Menschen. Es bewegte sich aus eigener Kraft und strömte ohne Herzschlag durch die Adern. Das war in etwa schon alles, was sie über den Lebenssaft der Sanguinarier und Strigoi wusste. Doch auf einmal reichte es ihr nicht mehr, und sie hätte gern die Geheimnisse des Blutes ergründet.
Doch dazu war jetzt keine Zeit.
Sie leerte den Inhalt des Fläschchens in das Steinbecken. Auf Latein sagte sie: »Denn dies ist der Kelch Meines Blutes, des neuen und ewig währenden Bundes.«
Das Blut brodelte im Becken, wodurch es seine übernatürliche Beschaffenheit offenbarte.
Sie hielt den Atem an. Würde die Tür Christians Blut zurückweisen?
Die Antwort erfolgte auf dem Fuß. Das Blut sickerte in den Stein ein und verschwand, ohne eine Spur zu hinterlassen.
Sie seufzte erleichtert auf und flüsterte die abschließenden Worte: »Mysterium fidei.«
Sie trat einen Schritt von der Wand zurück, das Herz klopfte ihr bis zum Hals. Der Preis des Wissens waren Blut und Schmerz.
So sei es denn.
2
17. März, 16:45 MEZCumae, Italien
WIESO LANDE ICHeigentlich immer im Untergrund?
Sergeant Jordan Stone robbte durch den engen Tunnel. Von allen Seiten engte ihn der Fels ein, und er musste sich schlängeln wie ein Wurm. Dreck fiel ihm ins Haar und in die Augen.
Wenigstens geht es voran.
Er schob sich ein paar Zentimeter weiter vor.
Jemand rief mit starkem Akzent: »Sie haben es fast geschafft!«
Das musste Baako sein. Er stellte sich den groß gewachsenen Sanguinarier vor, der aus Afrika stammte. Als er sich vergangene Woche nach seiner Herkunft erkundigt hatte, hatte Baako ausweichend geantwortet: Wie viele afrikanische Länder hat das, in dem ich geboren wurde, viele Namen und wird wohl auch noch viele neue bekommen.
Eine solche Antwort war typisch für die Sanguinarier: dramatisch und im Grunde nutzlos.
Jordan blickte nach vorn. Er machte einen schwachen Lichtschimmer aus, was darauf hindeutete, dass der verfluchte Tunnel tatsächlich in eine Höhle mündete. Er kämpfte sich dem Licht entgegen.
Früher am Tag war Baako diesen kürzlich entdeckten Tunnel hinuntergeklettert und mit der Neuigkeit zurückgekehrt, dass der Schacht direkt in den Tempel der Sibylle führe. Vor einigen Monaten hatte in der Höhle ein furchtbarer Kampf stattgefunden, als ein unschuldiger Junge als Opferlamm missbraucht worden war, um die Pforte zur Hölle zu öffnen. Der Versuch war gescheitert, und anschließend war die Höhle verschüttet worden.
Hinter sich vernahm er eine melodische Stimme mit indischem Akzent, die ihn verspottete. »Vielleicht hätte er nicht so viel frühstücken sollen.«
Er blickte sich nach Sophia um, deren schlanke Gestalt sich im Gang als dunkle Silhouette abzeichnete. Anders als Baako lachte die Sanguinarierin gern. Um ihre Lippen spielte ständig ein Lächeln, ihre dunklen Augen funkelten belustigt. Im Allgemeinen wusste er ihren Humor zu schätzen.
Jetzt nicht.
Er rieb sich den Staub aus den brennenden Augen.
»Wenigstens esse ich etwas zum Frühstück«, rief er ihr zu.
Jordan biss die Zähne zusammen und robbte weiter, denn er wollte sich mit eigenen Augen vergewissern, was nach dem Kampf vom Tempel noch übrig war. Nach dem Erdbeben hatte der Vatikan den ganzen vulkanischen Berg absperren lassen. Die Kirche wollte verhindern, dass die Leichen der Strigoi und ihrer getöteten Brüder und Schwestern vom Sanguinarierorden gefunden wurden.
Eine typische Rette-sich-wer-kann-Aktion.
Und da er von der Army zum Vatikan abgestellt worden war, gehörte er nun der Aufräumtruppe an. Doch er wollte sich nicht beklagen. Immerhin konnte er so mehr Zeit mit Erin verbringen.
Eigentlich hätte er sich deswegen freuen sollen, doch irgendetwas nagte an ihm, und ein dunkler Schatten lag auf seiner Seele. Nicht, dass er sie nicht mehr geliebt hätte. Er liebte sie. Sie war so geistreich, sexy und humorvoll wie eh und je, aber anscheinend bedeuteten ihm diese Eigenschaften nicht mehr so viel.
Alles schien an Bedeutung zu verlieren.
Sie spürte das offenbar auch. Hin und wieder ertappte er sie dabei, wie sie ihn fragend musterte, manchmal mit schmerzlichem Ausdruck. Wenn sie mit ihm darüber sprechen wollte, tat er ihre Besorgnis mit einem Scherz oder einem halbherzigen Lächeln ab.
Was zum Teufel stimmt nicht mit mir?
Er wusste es nicht, und deshalb tat er das, was er am besten konnte: Er setzte einen Fuß vor den anderen. Er arbeitete weiter und lenkte sich ab. Die Zeit würde es schon richten.
Zumindest hoffe ich das.
Außerdem hatte er jetzt immerhin ein bisschen Abstand von Erin, was ihm Gelegenheit bot, die verlorene Mitte wiederzufinden. Viel Freizeit aber hatte er dennoch nicht. In der vergangenen Woche hatten sie Tote aus den Außentunneln des Bergs geborgen. Die Strigoi hatten sie in der italienischen Sonne verbrennen lassen, die toten Sanguinarier hatten sie vor der Sonne geschützt, um sie später zu bestatten. Jordan hatte sich bei der Army mit Forensik beschäftigt, deshalb machte ihm die Arbeit nichts aus.
Und das galt vor allem jetzt, da sie diesen Tunnel entdeckt hatten.
Niemand kannte diesen geheimnisvollen Gang, und den Wänden nach zu schließen war er erst vor Kurzem gegraben worden.
Daraus ergab sich eine interessante Frage: Hatte der Tunnel in die Tempelhöhle hinein- oder aus ihr herausgeführt?
Beide Möglichkeiten waren beunruhigend, doch Jordan war entschlossen, das Rätsel zu lösen.
Endlich hatte er das Ende des Tunnels erreicht und sank auf den unebenen Felsboden. Baako zog ihn so mühelos auf die Beine, als habe er es mit einem kleinen Kind und nicht mit einem fast zwei Meter großen Soldaten zu tun.
Eine kleine Öllampe brannte auf dem Höhlenboden, doch Jordan schaltete trotzdem die Helmleuchte ein, als Sophia aus dem Tunnel kam und sich geschmeidig abrollte. Sie hatte sich nicht einmal richtig schmutzig gemacht.
»Alles nur Show«, sagte er missbilligend und klopfte sich den Staub ab.
Ihr Dauerlächeln wurde noch breiter. Sie streifte sich das kurz geschnittene schwarze Haar von den braunen Wangen und schaute sich um. Mit ihrem übernatürlich scharfen Blick war sie auf die Öllampe oder seine Helmleuchte nicht angewiesen.
Jordan beneidete sie um ihre Nachtsichtigkeit. Er lockerte die Nackenmuskulatur und blickte sich ebenfalls um. Als er tief einatmete, stieg ihm Schwefelgeruch in die Nase, doch er war nicht so intensiv wie während der Auseinandersetzung, als sich ein qualmender Spalt im Boden aufgetan hatte.
Doch da war auch noch ein anderer Geruch.
Der Gestank des Todes.
Jordan bemerkte zu seiner Rechten mehrere Strigoi. Sie waren halb verkohlt, das Fleisch rissig und aufgeplatzt. Instinktiv wollte er sich abwenden und weglaufen, eine natürliche Reaktion angesichts eines solchen Blutbads, doch er musste seine Pflicht tun. Er vergegenwärtigte sich all seine Erfahrung, packte eine Videokamera aus und filmte den Raum. Er nahm sich Zeit und filmte aus reiner Gewohnheit jeden einzelnen Toten. Als Angehöriger der Forensischen Armeeabteilung hatte er Verbrechensschauplätze dokumentiert und dabei Gründlichkeit gelernt.