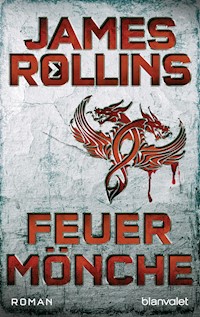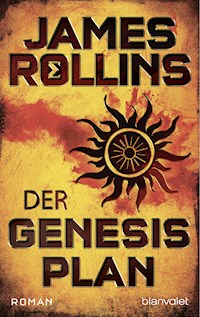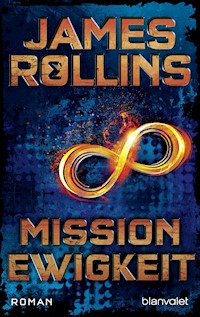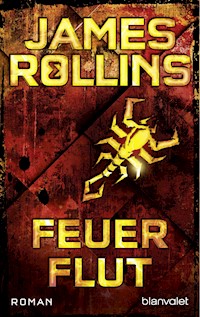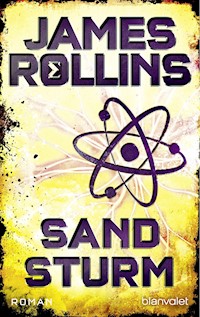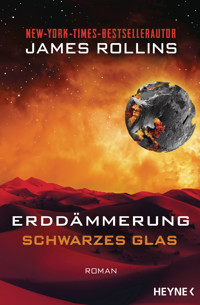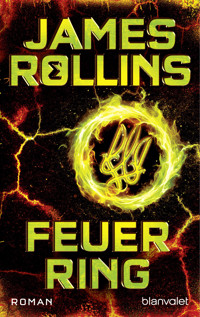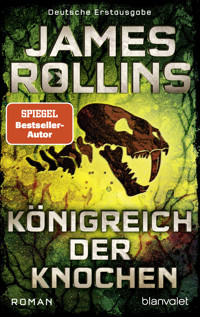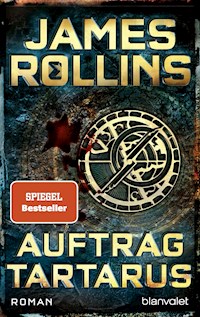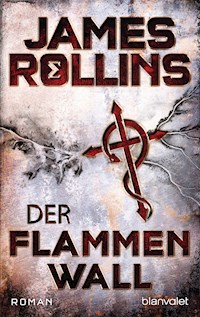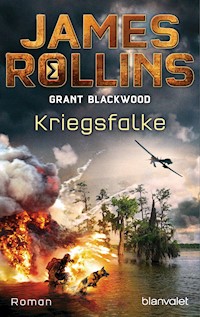
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: SIGMA Force - Tucker Wayne
- Sprache: Deutsch
»Niemand – und ich meine wirklich niemand – schreibt bessere Science-Thriller.« Lee Child
Tucker Wayne hat mit seinem Militärhund Kane die U.S. Army verlassen. Gemeinsam reisen sie ohne festes Ziel durch die USA. Da stöbert sie eine alte Freundin auf, die Hilfe braucht. Irgendjemand versucht, sie und ihr Kind zu ermorden. Wayne will keinen Ärger, aber wegsehen kann er auch nicht. Also stimmt er zu, ein paar Nachforschungen anzustellen. Er ist sich nicht sicher, wie ernst die Lage ist – bis zum ersten Mal eine Kampfdrohne mit einem Maschinengewehr auf ihn feuert! Beinahe zu spät erkennt er, wie gefährlich seine Gegner sind. Doch dann ist er bereit zurückzuschlagen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Tucker Wayne hat mit seinem Militärhund Kane die U. S. Army verlassen. Gemeinsam reisen sie ohne festes Ziel durch die USA. Da stöbert sie eine alte Freundin auf, die Hilfe braucht. Irgendjemand versucht, sie und ihr Kind zu ermorden. Wayne will keinen Ärger, aber wegsehen kann er auch nicht. Also stimmt er zu, ein paar Nachforschungen anzustellen. Er ist sich nicht sicher, wie ernst die Lage ist – bis zum ersten Mal eine Kampfdrohne mit einem Maschinengewehr auf ihn feuert! Beinahe zu spät erkennt er, wie gefährlich seine Gegner sind. Doch dann ist er bereit zurückzuschlagen!
Autor
Der New-York-Times-Bestsellerautor James Rollins hat einen Doktorgrad in Tiermedizin. Als begeisterter Höhlenforscher und ebenso eifriger Taucher ist er häufig unter Wasser oder unter der Erde anzutreffen. Er wohnt in den Bergen der Sierra Nevada in Kalifornien, USA.
Von James Rollins bei Blanvalet erschienen:
Sigma Force:
Der Genesis-Plan, Feuermönche, Sandsturm, Der Judas-Code, Das Messias-Gen, Feuerflut, Mission Ewigkeit, Das Auge Gottes, Projekt Chimera, Das Knochenlabyrinth, Die siebte Plage, Die Höllenkrone, Der Flammenwall
Die Tucker-Wayne-Romane:
Killercode; Kriegsfalke
Die Bruderschaft der Christuskrieger:
Das Evangelium des Blutes, Das Blut des Verräters, Die Apokalypse des Blutes
Außerdem:
Sub Terra, Im Dreieck des Drachen, Operation Amazonas
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.instagram.com/blanvalet.verlag
James Rollins
Grant Blackwood
Kriegsfalke
Roman
Aus dem Englischen von Norbert Stöbe
Die englische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »War Hawk« bei William Morrow, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Copyright der Originalausgabe © 2016 by Jim Czajkowski & Grant Blackwood
Published in agreement with the author, c/o Baror Interantional, Inc. Armonk, New York, U.S.A.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung und -abbildung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Allan Vietmeier; Mary Capriole; Mitrofanov Alexander; Getmilitaryphotos; Olena Yakobchuk; Kutikova Ekaterina; sibsky2016)
Redaktion: text in form / Gerhard Seidl
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-24896-3V002www.blanvalet.de
Für alle vierbeinigen Krieger dort draußen … und für die, welche an ihrer Seite dienen.
Danke für euer Engagement und euren Einsatz.
Prolog
Frühjahr 1940 Buckinghamshire, England
Nur wenige Angehörige der militärischen Abwehr kannten seinen wahren Namen oder den Grund für seinen Aufenthalt auf britischem Boden. Der Spion führte den Tarnnamen Geist, und Scheitern kam für ihn nicht infrage.
Er lag bäuchlings im morastigen Graben, eisverkrustete Rohrkolben stachen ihm ins Gesicht. Er ignorierte die mitternächtliche Kälte, den eisigen Wind, die schmerzenden Gelenke. Stattdessen konzentrierte er sich auf das, was er durchs Fernglas sah.
Er und die ihm zugeteilten Leute versteckten sich am Ufer eines kleinen Sees. Am anderen Ufer, in hundert Metern Entfernung, lagen mehrere stattliche Landhäuser. Nur an wenigen Stellen fiel ein gelber Lichtschimmer durch die Verdunkelungsvorhänge. Trotzdem sah er den Stacheldraht auf der Mauerkrone eines besonders imposanten Anwesens.
Bletchley Park.
Der Codename dafür lautete: Station X.
Von dem trügerisch unauffälligen Landhaus aus leitete der britische Geheimdienst eine Operation, an der der MI6 und die Staatliche Code- und Chiffrenschule beteiligt waren. Auf dem idyllischen Anwesen hatte der Geheimdienst mehrere Holzhäuser errichtet und darin die bedeutendsten Mathematiker und Kryptografen untergebracht, darunter auch Alan Turing, der seinen Kollegen um Jahrzehnte voraus war. Das Ziel von Station X war, mit Geräten, welche die hier versammelten Genies entwickeln sollten, den Enigma-Code der Deutschen zu entschlüsseln. Die Gruppe hatte bereits ein elektromechanisches Entschlüsselungsgerät mit der Bezeichnung »Die Bombe« entwickelt, und es wurde gemunkelt, man habe mit dem Bau von »Colossus« begonnen, dem ersten programmierbaren Computer überhaupt.
Heute aber ging es nicht darum, diese Geräte zu zerstören.
Denn auf dem Gelände befand sich etwas von unschätzbarem Wert: ein technischer Durchbruch, der imstande wäre, den Lauf der Geschichte zu verändern.
Und ich werde es in meinen Besitz bringen – oder bei dem Versuch ums Leben kommen.
Geist bekam Herzklopfen.
Als Eisregen einsetzte, raffte zu seiner Linken Leutnant Hoffmann, sein Stellvertreter, den Jackenkragen und verlagerte die Haltung. »Dieses gottverfluchte Land.«
Unverwandt durchs Fernglas blickend, tadelte Geist den Anführer der Einsatzgruppe. »Schweigen Sie. Wenn Sie jemand deutsch reden hört, sitzen wir hier für die restliche Dauer des Krieges fest.«
Es brauchte eine feste Hand, das ihm unterstellte Acht-Mann-Team zu leiten. Die Männer waren von der Abwehr sorgfältig ausgewählt worden, nicht nur wegen ihrer herausragenden Kämpfereigenschaften, sondern auch deshalb, weil sie Englisch sprachen. Die schwache militärische Präsenz der Briten im ländlichen Raum wurde wettgemacht durch die Wachsamkeit der Bevölkerung.
»Ein Laster!«, knurrte Hoffmann.
Geist blickte sich zu der Straße um, die hinter ihm durch den Wald verlief. Ein offener Lastwagen näherte sich, die Scheinwerfer waren bis auf einen schmalen Schlitz abgeklebt.
»Luft anhalten«, flüsterte Geist.
Er wollte vermeiden, dass der Fahrer auf sie aufmerksam wurde. Sie drückten den Kopf an den Boden, bis sich das Motorengeräusch entfernte.
»Sicher«, sagte Hoffmann.
Geist sah auf die Uhr und blickte dann wieder durchs Fernglas.
Warum dauert es so lange?
Alles hing von der exakten zeitlichen Abstimmung ab. Er und seine Leute waren vor fünf Tagen von einem U-Boot an einem abgelegenen Strand abgesetzt worden. Sie hatten sich in Zweier- und Dreiergruppen aufgeteilt, ausgestattet mit Papieren, die sie als Fabrik- und Landarbeiter auswiesen. Am Zielpunkt trafen sie sich in einer Jagdhütte, wo Schläferagenten ein Waffenversteck für sie angelegt hatten.
Eine Sache aber stand noch aus.
Auf dem Grundstück neben Bletchley Park leuchtete kurz eine Taschenlampe auf. Gleich darauf noch einmal – dann herrschte wieder Dunkelheit.
Das war das Signal, auf das sie gewartet hatten.
Geist stützte sich auf den Ellbogen auf. »Es geht los.«
Hoffmanns Leute sammelten die Waffen auf: Sturmgewehre und Schalldämpferpistolen. Der kräftigste Mann – ein wahrer Bulle namens Kraus – hob ein Maschinengewehr vom Typ MG42 hoch, das bis zu fünfhundert Schuss pro Minute abfeuern konnte.
Geist musterte die dreckverschmierten Gesichter seiner Männer. Sie hatten den Einsatz drei Monate lang in einem maßstabsgetreuen Modell von Bletchley Park geübt. Inzwischen konnten sie sich mit verbundenen Augen auf dem Gelände bewegen. Die einzige Unbekannte war das Ausmaß der Sicherheitsvorkehrungen. Das Forschungsgelände wurde von Soldaten und Sicherheitskräften in Zivil bewacht.
Geist ging den Plan ein letztes Mal durch. »Sobald wir auf dem Gelände sind, stecken Sie die Ihnen zugeteilten Gebäude in Brand. Richten Sie so viel Durcheinander wie möglich an. In dem resultierenden Chaos werden Hoffmann und ich versuchen, das Objekt zu sichern. Sobald geschossen wird, schalten Sie alles aus, was sich bewegt. Verstanden?«
Alle nickten.
Als alle bereit waren – was auch die Bereitschaft einschloss, notfalls zu sterben –, setzte die Gruppe sich in Bewegung und folgte dem Seeufer entlang dem nebelverhangenen Wald. Geist geleitete seine Männer an den Nachbargrundstücken vorbei. Die meisten alten Landhäuser waren verrammelt und würden erst im Sommer wieder bezogen werden. Bald würden Handwerker und Angestellte eintreffen und sie auf die Feriensaison vorbereiten, doch bis dahin waren es noch ein paar Wochen.
Dies war einer der vielen Gründe, weshalb Admiral Wilhelm Canaris, der Leiter der Abwehr, dieses kleine Zeitfenster ausgewählt hatte. Und es gab noch eine zeitliche Einschränkung.
»Der Eingang zum Bunker sollte unmittelbar vor uns liegen«, sagte Geist flüsternd zu Hoffmann. »Die Männer sollen sich bereithalten.«
Die britische Regierung, die davon ausging, dass Adolf Hitler bald mit Luftangriffen auf die Inselnation beginnen würde, hatte an wichtigen Einrichtungen mit dem Bau unterirdischer Bunker begonnen. Der Bunker von Station X war erst zur Hälfte fertiggestellt. An dieser Stelle gab es eine kleine Lücke in der stacheldrahtbewehrten Mauer.
Geist beabsichtigte, sich diese Schwachstelle zunutze zu machen.
Er führte sein Team zu einem Landhaus, das an Bletchley Park grenzte. Es handelte sich um ein Backsteinhaus im Tudorstil mit gelben Fensterläden. Er näherte sich der Bruchsteinmauer, die das Grundstück umschloss, und bedeutete den Männern, dicht davor Aufstellung zu nehmen.
»Wohin wollen Sie?«, flüsterte Hoffmann. »Ich dachte, wir wollten durch einen Bunker eindringen.«
»Das werden wir auch.« Nur Geist verfügte über alle Informationen des Geheimdienstes.
In geduckter Haltung lief er zum Tor, das unverschlossen war. Die blinkende Taschenlampe hatte ihm bestätigt, dass alles vorbereitet war.
Geist zog das Tor auf, schlüpfte hindurch und geleitete seine Leute über den Rasen zum verglasten Wintergarten. Dort stieß er auf eine weitere unverschlossene Tür. Sie betraten das Haus und gingen durch die Küche. Die weißen Schränke leuchteten im Mondschein, der durch die Fenster fiel.
Ohne stehen zu bleiben, näherte er sich der Tür neben der Vorratskammer. Er öffnete sie und schaltete die Taschenlampe ein. Dahinter lag eine Treppe. Sie führte in einen Keller mit Steinboden; die Backsteinwände waren weiß getüncht, an der Decke führten Wasserrohre durch die Deckenbalken. Der Keller nahm die ganze Breite des Hauses ein.
Er führte seine Leute an gestapelten Kartons und mit Tüchern verhängten Möbeln vorbei zur Ostwand. Wie abgesprochen zog er einen alten Teppich beiseite, unter dem ein Loch zum Vorschein kam, das Canaris’ Schläfer gegraben hatten.
Geist leuchtete ins Loch hinein. Darin war strömendes Wasser zu erkennen.
»Was ist das?«, fragte Hoffmann.
»Ein altes Abwasserrohr. Es verbindet alle Anwesen am Seeufer.«
»Und es führt auch zu Bletchley Park.« Hoffmann nickte.
»Und zu dessen teilweise fertiggestelltem Bunker«, bestätigte Geist. »Es dürfte eng werden, aber wir müssen nur hundert Meter darin zurücklegen bis zum Schutzraum.«
Den Agenten zufolge waren die erst kürzlich gegossenen Fundamente des Bunkers weitgehend unbewacht und sollten ihnen Zugang bieten zu dem Anwesen.
»Die Briten werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht«, sagte Hofmann mit fiesem Grinsen.
Geist übernahm erneut die Führung, ließ sich durchs Loch hinunter und landete mit einem Platschen im knöcheltiefen Wasser. Eine Hand auf die verschimmelte Wand gelegt, drang er in die alte Steinröhre vor. Da sie nur anderthalb Meter im Durchmesser war, musste er den Kopf einziehen. Wegen des Gestanks hielt er die Luft an.
Nach ein paar Schritten schaltete er die Taschenlampe aus und orientierte sich am fernen Mondschein. Er bewegte sich noch langsamer durch das gekrümmte Rohr, damit die potenziellen Bewacher nicht aufmerksam wurden. Hoffmanns Leute folgten seinem Beispiel.
Schließlich hatten sie das Loch, durch das der Mondschein fiel, erreicht. Es war mit einem Gitter abgedeckt. Er betastete die Kette und das Vorhängeschloss, mit denen das Gitter gesichert war.
Unerwartet, aber kein Problem.
Hoffmann reichte ihm einen Bolzenschneider an. Vorsichtig durchtrennte Geist die Schließe und löste die Kette. Mit einem Blick auf den Leutnant vergewisserte er sich, dass alle bereit waren, dann schob er das Gitter beiseite und kletterte durch die Öffnung.
Er befand sich innerhalb des Betonfundaments des Bunkers. Ringsumher zeichneten sich Wände, Leitungen und Rohre ab. Gerüste und Leitern führten zum Garten hoch. Er lief zu einem Gerüst hinüber und duckte sich. Einer nach dem anderen gesellten sich die übrigen acht Männer zu ihm.
Geist orientierte sich. Ihr Ziel, Baracke Nummer 8, lag vierzig Meter entfernt. Sie war eines von mehreren grün bemalten Holzgebäuden auf dem Grundstück. Jedes diente einem besonderen Zweck, doch sie hatten es auf die Forschungsanlage abgesehen, die von dem Mathematiker und Kryptoanalytiker Alan Turing geleitet wurde. Geist bedeutete seinen Männern zusammenzurücken.
»Denken Sie dran, nur dann zu schießen, wenn Sie entdeckt werden. Werfen Sie die Brandsätze in die Baracken Nummer 4 und 6. Das Feuer soll uns die Arbeit abnehmen. Wenn wir Glück haben, können wir bei dem entstehenden Durcheinander unbemerkt entkommen.«
Hoffmann deutete auf zwei seiner Männer. »Schwab, Sie führen Ihre Gruppe zur Baracke Nummer 4. Faber, Sie und Ihre Leute übernehmen Baracke Nummer 6. Kraus, Sie folgen uns. Falls es Schwierigkeiten gibt, setzen Sie das MG ein.«
Die Männer des Leutnants nickten, dann stiegen sie die Leitern hoch und kletterten aus dem Bunker hinaus. Geist schloss sich an, Hoffmann und Kraus folgten ihm.
Geduckt lief er in nördliche Richtung zu Baracke Nummer 8 und drückte sich an die Holzwand. Die Tür sollte hinter der Ecke liegen. Er wartete ab, ob sie bemerkt worden waren.
Im Kopf zählte er die Sekunden, bis im Osten und Westen Rufe ertönten. »Feuer, Feuer, Feuer!«
Daraufhin schlüpfte er um die Ecke und eilte die Treppe zur Eingangstür hoch. Als er die Klinke drückte, loderten die ersten Flammen empor.
Während das Geschrei lauter wurde, öffnete er die Tür und trat in den kleinen Raum. In der Mitte standen zwei aufgebockte Tische, darauf waren Lochkarten gestapelt. An den weiß getünchten Wänden hingen Plakate, die davor warnten, die Nazis hätten ihre Augen und Ohren überall.
Mit vorgehaltener Pistole stürmten er und Hoffmann durch die gegenüberliegende Tür in den Nebenraum. An einem langen Tisch saßen zwei Frauen und sortierten Lochkarten. Die Frau zur Rechten schaute bereits hoch. Sie fuhr auf dem Stuhl herum und streckte die Hand zu einem roten Alarmknopf an der Wand aus.
Hoffmann schoss ihr zweimal in die Seite. Die Schüsse waren nicht lauter als ein Husten.
Die zweite Frau schaltete Geist mit einem Schuss in den Hals aus. Sie kippte nach hinten, das Gesicht in einem Ausdruck von Überraschung erstarrt.
Das mussten Wrens gewesen sein – Angehörige des Women’s Royal Navy Service –, die hier bei der Arbeit halfen.
Geist ging zur ersten Frau hinüber, durchsuchte ihre Taschen und fand darin einen daumengroßen Messingschlüssel. Die andere Frau hatte das Gegenstück in der Tasche, einen Eisenschlüssel.
Mit den beiden Fundstücken ging er in den Hauptraum hinüber.
Draußen gellte eine Alarmsirene.
Bislang wurde unsere List anscheinend nicht …
Das Rattern einer Maschinenpistole unterbrach seinen Gedankengang. Immer mehr Schüsse fielen.
Hoffmann fluchte. »Man hat uns entdeckt«, sagte der Leutnant.
Geist wollte nicht aufgeben. Er ging zu dem hüfthohen Tresor hinüber, der an der einen Wand stand. Wie erwartet war er mit zwei Schlössern gesichert, die unten und oben angeordnet waren, in der Mitte befand sich ein Zahlenkombinationsschloss.
»Wir müssen uns beeilen«, sagte Hoffmann mit rauer Stimme. »Scheint so, als wären da draußen eine Menge Leute auf den Beinen.«
Geist zeigte zum Eingang. »Kraus, machen Sie den Rückweg zum Bunker frei.«
Der groß gewachsene Soldat nickte, hob seine schwere Waffe hoch und trat durch die Tür. Als Geist die beiden Schlüssel ins Schloss steckte, eröffnete draußen Kraus’ MG42 brüllend das Feuer.
Geist konzentrierte sich auf seine Aufgabe, drehte den einen Schlüssel im Schloss und dann den anderen. Jedes Mal war ein deutliches Klacken zu hören. Dann legte er die Hand auf das Kombinationsschloss. Jetzt würde sich erweisen, ob die Abwehr ganze Arbeit geleistet hatte.
Er drehte den Zahlenknopf: neun … neunundzwanzig … vier.
Er holte tief Luft, atmete aus und zog am Griff.
Die Tresortür schwang auf.
Gott sei Dank.
Im Tresor befand sich nur ein einziger Gegenstand; eine braune Fächermappe, verschlossen mit Gummibändern. Er las die Beschriftung ab.
Projekt Ares.
Ares war der griechische Gott des Krieges, was in Anbetracht des Inhalts der Mappe durchaus passend war. Allerdings war dies nur ein vager Hinweis. Das Akronym ARES stand für eine welterschütternde Neuerung, die das Zeug hatte, den Lauf der Geschichte zu ändern. Sich der erschreckenden, unerhörten Bedeutung bewusst, nahm er mit zitternden Händen die Mappe heraus und schob sie unter seine Jacke.
Hoffmann, sein Stellvertreter, eilte zur Tür, zog sie einen Spalt weit auf und rief: »Kraus!«
»Kommen Sie!«, antwortete Kraus auf Deutsch, womit er jede Art von Heimlichtuerei überflüssig machte. »Bevor der Gegner sich neu formiert!«
Geist tauchte neben Hoffmann auf, zog den Sicherungsstift einer Brandgranate und schleuderte sie hinter sich in den Raum. Die beiden Männer stürmten nach draußen, als die Granate detonierte und Flammen aus den Fenstern schossen.
Zu ihrer Linken bogen zwei britische Soldaten um die Baracke. Kraus schaltete sie mit dem MG aus, doch ihnen folgten weitere Männer, die in Deckung gingen, das Feuer erwiderten und Geist und dessen Leute vom unfertigen Bunker forttrieben – weg von ihrem einzigen Fluchtweg.
Als sie sich aufs Gelände zurückzogen, wurde der Rauch immer dichter. Der beißende Geruch von brennendem Holz breitete sich aus.
Weitere Soldaten stürmten durch die Rauchwolke. Kraus hätte sie um ein Haar mit seinem MG quergeteilt, dann erkannte er seine Kameraden. Das war Schwabs Einsatzgruppe.
»Was ist mit Faber und den anderen?«, fragte Hoffmann.
Schwab schüttelte den Kopf. »Die sind gefallen.«
Somit waren sie nur noch zu sechst.
Geist ließ sich rasch etwas einfallen. »Zum Fahrzeugpark«, sagte er.
Er rannte los und gab die Richtung vor. Im Laufen warfen sie Brandgranaten, um das Chaos noch weiter zu steigern, feuerten in Barackengassen hinein und legten jeden um, der ihnen vor die Läufe kam.
Schließlich hatten sie eine Reihe kleiner Schuppen erreicht. Fünfzig Meter dahinter lag das Haupttor. Hinter der Betonabsperrung waren etwa ein Dutzend Soldaten in Deckung gegangen und hielten mit angelegten Waffen Ausschau nach Zielen. Scheinwerferkegel schwenkten über das Gelände.
Bevor sie bemerkt wurden, geleitete Geist die Gruppe in einen Wellblechschuppen, in dem drei Lkw-Transporter mit Planenabdeckung abgestellt waren.
»Wir müssen das Tor freimachen«, sagte Geist und blickte Hoffmann und dessen Männer an, wohl wissend, was er da von ihnen verlangte. Einige von ihnen würden den Einsatz vermutlich nicht überleben.
Der Leutnant erwiderte seinen Blick. »Wird erledigt.«
Geist klopfte Hoffmann anerkennend auf die Schulter.
Der Leutnant entfernte sich mit seinen vier verbliebenen Männern.
Geist kletterte in einen Laster, der Zündschlüssel steckte. Er ließ den Motor an, dann sprang er wieder heraus. Er ging zu den beiden anderen Lastern hinüber und öffnete die Motorhaube.
In der Ferne ratterte Kraus’ Maschinengewehr, begleitet vom Knallen der Gewehre und hin und wieder der Detonation einer Granate.
Schließlich kam die erwartete Meldung.
»Alles klar!«, rief Hoffmann.
Geist lief zum wartenden Laster, kletterte hinein und legte den Gang ein – zuvor aber warf er je eine Handgranate in den Motorraum der anderen beiden Fahrzeuge. Als er aus dem Schuppen rollte und Gas gab, detonierten hinter ihm die Granaten.
Er raste zum Haupttor und bremste heftig. Auf dem Boden lagen tote britische Soldaten; die Scheinwerfer waren zerschossen. Hoffmann rollte humpelnd das Tor beiseite; sein Bein war blutverschmiert. Kraus ging hinkend zur Ladefläche und kletterte hinauf. Hoffmann setzte sich auf den Beifahrersitz und zog die Tür zu.
»Schwab und Braatz haben wir verloren.« Hoffmann zeigte nach vorn. »Los, los.«
Geist hielt sich nicht mit Trauern auf, sondern gab Gas und bretterte über die Landstraße. Im Seitenspiegel hielt er Ausschau nach Verfolgern. Mit wiederholtem Abbiegen versuchte er, ihre Fluchtroute zu verschleiern. Schließlich steuerte er den Laster über einen Feldweg, der von alten Englischen Eichen gesäumt war. Er endete an einer großen Scheune, deren Dach zur Hälfte eingestürzt war. Zur Linken lag ein ausgebranntes Bauernhaus.
Geist hielt unter überhängenden Ästen und stellte den Motor aus. »Wir sollten erst mal unsere Verletzungen versorgen«, sagte er. »Wir haben schon genug Männer verloren.«
»Alle aussteigen«, befahl Hoffmann und klopfte mit den Fingerknöcheln gegen die Rückwand der Kabine.
Als alle ausgestiegen waren, verschaffte Geist sich einen Überblick über ihre Verletzungen. »Für die heute bewiesene Tapferkeit bekommen Sie alle das Ritterkreuz. Wir sollten …«
Ein scharfer Ruf schnitt ihm das Wort ab. »Halt! Hände hoch!«
Ein Dutzend schwer bewaffneter Männer kam aus dem Gestrüpp und hinter der Scheune hervor.
»Keine Bewegung!«, rief der Anführer, ein hochgewachsener Amerikaner mit Thompson-Maschinenpistole.
Angesichts der ausweglosen Situation hob Geist die Arme. Hoffmann und mindestens zwei seiner Männer folgten seinem Beispiel, ließen die Waffen fallen und hoben die Hände.
Es war aus.
Während die Amerikaner Hoffmann und die anderen abklopften, trat ein Mann aus der dunklen Scheune hervor und näherte sich Geist. Mit einer Pistole Kaliber .45 zielte er auf dessen Brust.
»Fesselt ihn«, sagte er zu einem der Soldaten.
Als man ihm die Hände band, sprach der Anführer ihn mit Südstaatenakzent an. »Colonel Ernie Duncan, hunderterste Luftlandedivision. Sie sprechen Englisch?«
»Ja.«
»Mit wem habe ich das Vergnügen?«
»Schweinehund«, entgegnete Geist auf Deutsch.
»Mein Sohn, ich bin mir ziemlich sicher, dass dies nicht Ihr Name ist. Ich vermute, die Beleidigung gilt mir. Dann werde ich Sie der Einfachheit halber Fritz nennen. Wir müssen uns unterhalten. Ob die Unterhaltung angenehm oder eher hässlich verläuft, liegt ganz bei Ihnen.«
Der amerikanische Colonel rief einen seiner Männer an. »Lieutenant Ross, lassen Sie die Männer auf die Ladefläche ihres Lasters klettern und bereiten Sie den Abtransport vor. Sie können sich von Ihren Leuten verabschieden, Fritz.«
Geist wandte sich seinen Männern zu und rief: »Für das Vaterland!«
»Für das Vaterland!«, antworteten sie im Chor.
Die amerikanischen Soldaten geleiteten die Gefangenen zur Rückseite des Lasters, während Colonel Duncan mit Geist zur Scheune ging. Er schloss hinter ihnen das Tor und schwenkte den Arm über Heuhaufen und Mist.
»Ich bitte um Verzeihung wegen der bescheidenen Unterbringung, Fritz.«
Geist wandte sich ihm zu und lächelte. »Ich freue mich sehr, Sie zu sehen, Duncan.«
»Ich auch, mein Freund. Wie ist es gelaufen? Haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben?«
»Das steckt unter meiner Jacke. Man kann sagen, was man will, aber die Deutschen kämpfen wie die Teufel. Bletchley brennt. Aber in einer Woche sind sie bestimmt wieder so weit, dass sie weitermachen können.«
»Gut zu wissen.« Duncan trennte mit einer Rasierklinge Geists Fesseln durch. »Wie soll’s jetzt weitergehen?«
»Ich habe in einem Holster im Schritt eine kleine Mauser versteckt.« Geist richtete sich auf und massierte sich die Handgelenke, dann löste er das Halstuch und faltete es zu einem kleinen Quadrat zusammen. Er langte in die Hose und holte die Mauser hervor.
Geist schaute sich um. »Wo ist der Hinterausgang?«
Duncan zeigte in die Richtung. »Bei den Pferdeboxen. Niemand wird Sie bei der Flucht beobachten. Aber es muss überzeugend wirken. Verpassen Sie mir einen ordentlichen Schlag. Amerikaner sind zäh, wissen Sie.«
»Duncan, das gefällt mir nicht.«
»Eine Kriegsnotwendigkeit, Kumpel. Spendieren Sie mir eine Kiste Scotch, wenn wir wieder in den Staaten sind.«
Geist schüttelte dem Colonel die Hand.
Duncan ließ die .45er fallen und lächelte. »Na so was, Sie haben mich entwaffnet.«
»Darin sind wir Deutschen gut.«
Duncan riss sich die Uniformjacke auf, die Knöpfe fielen auf den strohbedeckten Boden. »Und es hat einen Kampf gegeben.«
»Okay, Duncan, das reicht. Drehen Sie den Kopf herum. Ich setze den Schlag hinter dem Ohr an. Wenn Sie zu sich kommen, werden Sie eine golfballgroße Beule und irre Kopfschmerzen haben, aber Sie wollen es ja so.«
»Genau.« Er fasste Geist beim Unterarm. »Seien Sie vorsichtig. Es ist ein weiter Weg bis nach D. C.«
Als Duncan den Kopf abwandte, verspürte Geist einen Anflug von schlechtem Gewissen. Doch er wusste, was nötig war.
Er drückte das zusammengefaltete Halstuch auf die Mündung der Mauser und setzte sie auf Duncans Ohr auf.
Der Colonel regte sich. »Hey, was haben Sie …«
Geist drückte ab. Mit einem dumpfen Knall drang die Kugel in Duncans Schädel ein und schleuderte seinen Kopf zurück, dann kippte er nach vorn und brach zusammen.
Geist sah auf ihn nieder. »Tut mir leid, mein Freund. Wie du schon sagtest, eine Kriegsnotwendigkeit. Wenn’s dir hilft: Du hast soeben den Lauf der Geschichte verändert.«
Er steckte die Pistole ein, ging zum Hinterausgang der Scheune, trat in die neblige Nacht hinaus und verwandelte sich … in ein wahres Gespenst.
Teil 1Gespensterjagd
1
10. Oktober, 18:39 MDT Bitterroot Mountains, Montana
Der ganze Ärger wegen eines einzigen verfluchten Nagels …
Tucker Wayne warf den kaputten Reifen in den Kofferraum seines Mietwagens. Der Jeep vom Typ Grand Cherokee stand auf dem Seitenstreifen einer wenig befahrenen Straße in den bewaldeten Bergen des Südwestens Montanas. Diese Millionen Hektar Land der Kiefern, von Gletscherströmen ausgewaschenen Canyons und schroffen Berggipfel stellten, abgesehen von Alaska, die größte zusammenhängende Wildnis der Vereinigten Staaten dar.
Er streckte sich und musterte die gewundene Straße, an beiden Seiten gesäumt von wogenden Hügeln und dichtem Kiefernwald.
Typisch. Mitten im Nirgendwo fahre ich auf einen Nagel und fange mir einen Platten …
Die Vorstellung fiel schwer, dass dieser bullige SUV von einem Eisenteil lahmgelegt worden war, das nicht mal so lang war wie sein kleiner Finger. Das machte einem bewusst, wie anfällig die moderne Technik war.
Er rammte die Ladeklappe zu und stieß einen durchdringenden Pfiff aus. Sein Reisegefährte zog die lange, behaarte Nase aus einem Heidelbeerbusch zurück und blickte sich zu Tucker um. Die Enttäuschung darüber, dass die Pause schon zu Ende war, zeichnete sich in seinen dunkelbraunen Augen ab.
»Tut mir leid, Kumpel. Aber bis nach Yellowstone ist es noch ein weiter Weg.«
Kane schüttelte sein dichtes schwarz-braunes Fell, fand sich mit den Gegebenheiten ab und lief schwanzwedelnd zu seinem Herrn zurück. Seit seiner Zeit bei den Army Rangers und mehreren Einsätzen in Afghanistan waren sie Partner. Als seine Dienstzeit abgelaufen war, hatte er Kane mitgenommen – und zwar ohne spezielle Erlaubnis der Army. Diese Angelegenheit war jedoch inzwischen geklärt.
Jetzt waren sie ein unzertrennliches Team und suchten nach neuen Straßen und Wegen. Gemeinsam.
Tucker öffnete die Beifahrertür, und der siebzig Pfund schwere, aber schlanke Kane sprang auf den Sitz. Er war ein Belgischer Schäferhund, eine kompakte Rasse, beliebt bei Militär und Ordnungskräften wegen ihrer Treue und Intelligenz, aber auch wegen ihrer Behändigkeit und Zähigkeit im Kampfeinsatz.
An Kane aber reichte kein anderer Belgischer Schäferhund heran.
Tucker schloss die Tür und streichelte seinen Partner durchs offene Fenster hindurch. Dabei ertastete er eine alte Narbe, die Tucker an seine eigenen Verletzungen erinnerte; einige sah man, andere waren gut versteckt.
»Weiter geht’s«, murmelte er, bevor die Gespenster der Vergangenheit ihn einholten.
Er setzte sich hinters Steuer, und die Fahrt durch den Bitterroot-Nationalpark ging weiter. Kane streckte den Kopf aus dem Beifahrerfenster, ließ die Zunge heraushängen und schnupperte die Gerüche der Umgebung. Tucker grinste; wie immer, wenn sie unterwegs waren, ließ seine Anspannung allmählich nach.
Im Moment war er ohne Beschäftigung – und hatte vor, es einstweilen dabei zu belassen. Er übernahm nur dann einen Auftrag, wenn seine Finanzen es erforderlich machten. Nach seinem letzten Job – als die Sigma Force ihn angeheuert hatte, ein geheimer Ableger der militärischen Forschungs- und Entwicklungsabteilung – war sein Bankkonto gut gefüllt.
Um die Auszeit zu nutzen, war er mit Kane in den vergangenen Tagen auf den Spuren der Expedition von Lewis und Clark den Lost Trail Pass entlanggewandert, und jetzt waren sie unterwegs zum Yellowstone-Nationalpark. Er hatte absichtlich den Spätherbst für den Besuch des beliebten Parks ausgewählt, um der Hochsaison auszuweichen, denn Kanes Gesellschaft war ihm lieber als die der Zweibeiner.
Hinter einer Kurve der dunklen Straße tauchten die Neonlichter einer Tankstelle auf. Auf dem Schild an der Einfahrt stand: Edwin Gas and Grocery. Er warf einen Blick auf die Tankanzeige.
Fast leer.
Er setzte den Blinker und bog zur kleinen Tankstelle ab. Bis zum nächsten Motel waren es noch fünf Kilometer. Er hatte vorgehabt, zu duschen und dann zum Yellowstone weiterzufahren, denn nachts war kaum Verkehr.
Jetzt musste er seinen Plan ändern und den platten Reifen so schnell wie möglich ersetzen. Hoffentlich konnte ihm jemand in der Tankstelle eine Werkstatt in dieser abgelegenen Gegend nennen.
Er hielt vor den Tanksäulen und stieg aus. Kane sprang aus dem offenen Fenster an der Beifahrerseite. Seite an Seite gingen sie zum Tankstellengebäude hinüber.
Tucker zog die Glastür auf. Eine Messingglocke läutete. Eingerichtet war die Tankstelle wie überall: Regale mit Snacks und gestapelten Konservendosen, an der Rückwand mehrere Kühlvitrinen. Es roch nach Bohnerwachs und in der Mikrowelle erwärmten Sandwiches.
»Guten Abend, guten Abend«, begrüßte ihn ein Mann in melodischem Tonfall.
Tucker hörte einen Dari-Akzent heraus. Von seinen Aufenthalten in der Wüste Afghanistans her kannte er sich mit den dortigen Dialekten aus. Trotz des freundlichen Tonfalls hatte er auf einmal ein flaues Gefühl im Bauch. Männer mit diesem Akzent hatten zahllose Male versucht, ihn abzuknallen. Und sie hatten ein Wurfgeschwister von Kane getötet.
Er dachte an die ausgelassene Freude seines Partners und ihre einzigartige Beziehung. Gewaltsam verdrängte er das Gemenge aus Schmerz, Trauer und Schuldgefühl.
»Guten Abend«, wiederholte der Mann hinter der Theke lächelnd; Tuckers Anspannung nahm er anscheinend nicht wahr. Das Gesicht des Tankstellenbesitzers war dunkelbraun, seine Zähne blendend weiß. Abgesehen von einem grauen Haaransatz war sein Schädel kahl. Er zwinkerte Tucker zu wie einem alten Freund, den er seit Jahren nicht mehr gesehen hatte.
Tucker, der im Einsatz hunderte afghanische Dorfbewohner kennengelernt hatte, wusste, dass seine Freundlichkeit nicht gespielt war. Trotzdem fiel es ihm schwer, die Tankstelle gänzlich zu betreten.
Auf der Stirn des Mannes bildete sich eine Falte, als er Tuckers Zögern bemerkte. »Willkommen«, sagte er und schwenkte einladend den Arm.
»Danke«, sagte Tucker gepresst. Seine Hand hatte er auf Kanes Flanke gelegt. »Was dagegen, dass ich den Hund mit reinbringe?«
»Nur zu. Jeder ist willkommen.«
Tucker holte tief Luft und ging an den Regalen mit Dörrfleisch, Slim-Jim-Fleischsnacks und Kartons mit Maischips vorbei. Er stellte sich vor die Theke und bemerkte, dass er der einzige Kunde im Laden war.
»Sie haben einen schönen Hund«, sagte der Mann. »Ist das ein Schäferhund?«
»Ein Belgischer Schäferhund. Er heißt Kane.«
»Ich heiße Aasif Qazi. Diese Tankstelle gehört mir.«
Er streifte mit der Hand über die Theke. Tucker bemerkte, dass er Schwielen an der Hand hatte.
»Sie kommen aus Kabul«, sagte Tucker.
Die Augenbrauen des Mannes schossen in die Höhe. »Woher wissen Sie das?«
»Das sagt mir Ihr Akzent. Ich war in Afghanistan.«
»Vor Kurzem, nehme ich an.«
Es ist schon eine Weile her, dachte Tucker, trotzdem kommt es mir so vor, als wäre es erst gestern gewesen. »Und Sie?«, fragte er.
»Ich bin als Jugendlicher in die Staaten gekommen. Meine Eltern sind klugerweise ausgewandert, als die Russen das Land besetzt haben. Meine Frau habe ich in New York kennengelernt.« Er hob die Stimme. »Lila, sag mal eben Hallo.«
Eine kleine grauhaarige Frau schaute lächelnd aus dem Büro hervor. »Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen.«
»Und wie sind Sie beide hier gelandet?«
»Sie meinen, mitten im Nirgendwo?« Aasifs Lächeln vertiefte sich. »Lila und ich wollten aus der Stadt raus. Wir haben nach dem genauen Gegenteil gesucht.«
»Das haben Sie wohl auch gefunden.« Tucker schaute sich im menschenleeren Laden um und blickte zum dunklen Wald hinaus.
»Uns gefällt es hier. Normalerweise kommen auch mehr Leute. Aber im Moment ist Zwischensaison. Die Sommertouristen sind weg, und die Skifahrer lassen noch auf sich warten. Aber wir haben Stammkunden.«
Wie zum Beweis näherte sich ein brummender Dieselmotor, und ein weißer, verrosteter Pick-up bremste scharf vor den Tanksäulen.
Tucker blickte wieder Aasif an. »Sieht so aus, als gäb’s Arbeit …«
Der Mann kniff die Augen zusammen, seine Kiefermuskeln traten hervor. Bei der Army hatte man Tucker wegen seines ungewöhnlich großen Einfühlungsvermögens zum Hundeführer bestimmt. Das war die Voraussetzung für eine tiefe Verbindung zu seinem Partner, erleichterte aber auch den Umgang mit Fremden. Allerdings brauchte es keine besonderen Fähigkeiten, um zu erkennen, dass der Mann Angst hatte.
Aasif hob warnend die Hand. »Lila, geh wieder ins Büro.«
Sie gehorchte, warf ihrem Mann aber einen ängstlichen Blick zu.
Tucker trat näher ans Fenster, Kane folgte ihm. Er musterte den Wagen und bemerkte sogleich eine Auffälligkeit: Das Nummernschild war abgeklebt.
Das sieht eindeutig nach Ärger aus.
Niemand, der gute Absichten hegte, klebte sein Nummernschild ab.
Tucker atmete tief durch. Die Luft fühlte sich auf einmal dichter an und knisterte wie elektrisch aufgeladen. Er wusste, das war Einbildung und eine Folge des Adrenalinstoßes. Doch da braute sich eindeutig was zusammen. Kane reagierte auf seinen Stimmungsumschwung, stellte die Rückenhaare auf und knurrte leise.
Zwei Männer in Flanellhemden, Baseballkappen auf dem Kopf, sprangen von der Ladefläche. Der Fahrer des Trucks hatte einen schmutzig roten Spitzbart, auf seiner grünen Baseballkappe stand: Ich würd’s lieber mit deiner Frau treiben.
Na großartig … diese Landeier haben auch noch einen fürchterlichen Sinn für Humor.
Ohne den Kopf zu wenden, fragte er: »Aasif, haben Sie Überwachungskameras?«
»Die sind kaputt. Wir konnten sie noch nicht reparieren.«
Tucker seufzte vernehmlich. Nicht gut.
Die drei Männer näherten sich dem Eingang. Jeder hielt einen Baseballschläger in der Hand.
»Rufen Sie den Sheriff. Wenn Sie ihm trauen.«
»Das ist ein guter Mann.«
»Dann rufen Sie ihn her.«
»Vielleicht wäre es am besten, wenn Sie nicht …«
»Rufen Sie an, Aasif.«
Tucker ging mit Kane zur Tür und trat ins Freie, ehe die Männer eintreten konnten. So wie die Dinge lagen, brauchte er Manövrierraum.
Tucker erwartete die drei am Bordstein. »n’Abend, Leute.«
»Heh«, sagte Mr. Ziegenbart und wollte an ihm vorbeigehen.
Tucker verstellte ihm den Weg. »Die Tankstelle ist geschlossen.«
»Scheißdreck«, sagte einer der Männer und hob den Schläger. »Guck mal, Shane, ich seh den Windelkopf von hier aus.«
»Dann sehen Sie auch, dass er gerade telefoniert«, sagte Tucker. »Er ruft den Sheriff.«
»Diesen Trottel?«, fragte Shane. »Wenn der seinen Arsch hierhergeschafft hat, sind wir längst wieder weg.«
Tuckers Grinsen wurde böse. »Da wäre ich mir nicht so sicher.«
Er richtete den Zeigefinger der einen Hand nach unten, dann ballte er die Faust. Das Kommando war eindeutig: Drohen.
Kane senkte den Kopf, bleckte die Zähne und stieß ein einschüchterndes Knurren aus. Trotzdem verharrte er an Tuckers Seite. Er würde sich erst dann in Bewegung setzen, wenn er eine weitere Anweisung bekam oder wenn die Fremden handgreiflich wurden.
Shane wich einen Schritt zurück. »Wenn mir der Köter blöd kommt, schlag ich ihm den Schädel ein.«
Wenn der Köter dich angreift, wirst du dich wundern, was passiert.
Tucker hob beschwichtigend die Hände. »Also schön, Jungs, ich sehe das so. Es ist Freitagabend, und ihr wollt ein bisschen Dampf ablassen. Ich bitte euch lediglich, euch ein anderes Ventil zu suchen. Die Leute da drinnen verdienen ihre Brötchen mit ehrlicher Arbeit. So wie ihr und ich auch.«
Shane schnaubte. »Wie wir? Mit diesen Windelköpfen haben wir nichts gemeinsam. Wir sind Amerikaner.«
»Die auch.«
»Ich habe Freunde im Irak verloren.«
»Das haben wir alle.«
»Was zum Teufel wissen Sie denn schon?«, fragte der dritte Mann.
»Genug, um den Unterschied zwischen den Ladenbesitzern und den Leuten zu erkennen, von denen ihr redet.«
Tucker musste an seine Reaktion bei Betreten des Ladens denken und verspürte einen Anflug von schlechtem Gewissen.
Shane hob den Baseballschläger und richtete ihn auf Tuckers Gesicht. »Aus dem Weg, oder es wird Ihnen leidtun, dass Sie sich mit dem Feind eingelassen haben.«
Tucker wusste, dass der Worte genug gewechselt waren.
Wie zum Beweis versetzte Shane Tucker einen Stoß gegen die Brust.
Wenn’s denn sein muss.
Tuckers Linke schnellte vor und packte den Schläger. Er ruckte daran und zog Shane zu sich heran.
»Fass und Wirf Um«, flüsterte er seinem Partner zu.
Kane hat das Kommando gehört – und reagiert. Er erfasst die Bedrohung, die von der Zielperson ausgeht: den schweren Atem, den Zorn, der seinem Schweiß einen bitteren Geruch verleiht. Die straff gespannten Muskeln entspannen sich. Noch ehe das letzte Wort ausgesprochen ist, setzt Kane sich in Bewegung, denn er hat den Wunsch seines Herrn vorausgeahnt und weiß, was zu tun ist.
Mit offenem Maul springt er nach oben.
Gräbt die Zähne ins Fleisch.
Schmeckt Blut.
Zufrieden schaute Tucker zu, wie Kane Shanes Unterarm packte. Als er auf den Pfoten landete, drehte der Schäferhund den Kopf herum und riss den Gegner zu Boden. Der Schläger fiel auf den Beton.
Shane schrie und verspritzte Speichel. »Schaff ihn weg, schaff ihn weg!«
Einer seiner Freunde näherte sich Kane und holte mit dem Baseballschläger aus. Tucker, der damit gerechnet hatte, duckte sich und fing den Schlag mit dem Körper ab. Er dämpfte dessen Wucht, indem er den Schläger seitlich abprallen ließ, langte nach oben und hakte den Unterarm darum. Er hielt ihn fest – dann trat er seitlich aus. Mit einem dumpfen Ploppen traf sein Absatz die Kniescheibe des Mannes.
Der Mann ließ den Schläger brüllend los und taumelte rückwärts.
Tucker schwang die erbeutete Waffe gegen den dritten Angreifer. »Es ist vorbei. Fallen lassen.«
Der Mann funkelte ihn an, dann ließ er den Schläger fallen …
… langte in die Tasche und hob den Arm.
Tucker sah das Messer aufblitzen. Er wich einen Schritt zurück und entging dem ersten Hieb. Mit dem Schuh traf er auf den Bordstein, stürzte in eine Reihe leerer Propangastanks und ließ den Schläger los.
Mit einem grausamen Grinsen nahm der Mann über Tucker Aufstellung und schwang das Messer. »Zeit, dir eine Lektion zu erteilen …«
Tucker langte über die Schulter nach hinten, packte eine Propangasflasche, die über den Gehweg rollte, und rammte sie dem Mann seitlich gegen die Beine. Mit einem Aufschrei ging der Angreifer zu Boden.
Tucker wälzte sich zu ihm, packte das Handgelenk des Mannes und bog es nach hinten, bis ein Knochen brach. Er ließ das Messer los. Tucker nahm es an sich, während der Mann sich zusammenkrümmte.
Lektion abgeschlossen.
Er richtete sich auf und ging zu Shane hinüber, der vor Angst und Schmerz die Lippen zusammenpresste. Kane hielt ihn immer noch fest, die Zähne bis zum Knochen im blutenden Unterarm vergraben.
»Aus«, befahl Tucker.
Der Schäferhund gehorchte, blieb aber in Shanes Nähe und bleckte die blutigen Zähne. Tucker gab seinem Partner mit dem Messer Rückhalt.
Im Wald gellten Sirenen, die stetig lauter wurden.
Tucker hatte ein flaues Gefühl im Bauch. Zwar hatte er in Notwehr gehandelt, doch er befand sich weitab vom Schuss und wartete auf einen Sheriff, der ihn festnehmen konnte, wenn ihm danach war. Hinter den Bäumen funkelte Blaulicht, dann bog ein Streifenwagen auf den Parkplatz ein und hielt in zehn Metern Entfernung.
Tucker hob die Hände und ließ das Messer fallen.
Er wollte vermeiden, dass jemand einen Fehler machte.
»Schhhh«, machte er. »Sei ein Braver Hund.«
Der Hund setzte sich auf die Hinterbeine, wedelte mit dem Schwanz und legte den Kopf schief.
Aasif kam nach draußen. Anscheinend spürte er seine Anspannung. »Sheriff Walton ist ein fairer Mann, Tucker.«
»Wenn Sie es sagen.«
Wie sich herausstellte, war Aasif ein guter Menschenkenner. Hilfreich war, dass der Sheriff die drei Männer bereits kannte und keine hohe Meinung von ihnen hatte. Diese Jungs machen schon seit einem Jahr Ärger, erklärte der Sheriff. Bislang hatte bloß noch niemand die Eier, sie anzuzeigen.
Sheriff Walton nahm ihre Aussagen auf. Das überklebte Nummernschild des Trucks kommentierte er mit betrübtem Kopfschütteln. »Ich glaube, Shane, das wäre dann das dritte Mal. Soviel ich weiß, sind Rotschöpfe dieses Jahr sehr beliebt im Staatsgefängnis.«
Shane senkte den Kopf und stöhnte.
Als zwei weitere Streifenwagen eingetroffen waren und die drei Männer weggeschafft hatten, wandte Tucker sich an den Sheriff. »Muss ich in der Gegend bleiben?«
»Wollen Sie das denn?«
»Nicht unbedingt.«
»Ich glaube, das wird nicht nötig sein. Ich habe ja Ihre Aussage. Ich bezweifle, dass Sie erneut werden aussagen müssen, aber falls es dazu kommen sollte …«
»Dann komme ich zurück.«
»Gut.« Walton reichte ihm eine Karte. Tucker hatte erwartet, dass die Telefonnummer der Polizeistation darauf stünde, doch stattdessen war ein Wagen mit eingedrücktem Stoßfänger darauf abgebildet. »Mein Bruder hat in Wisdom eine Autowerkstatt, das ist das nächste Städtchen am Highway. Ich sag ihm Bescheid, dass er Ihren platten Reifen zu einem fairen Preis flicken soll.«
Tucker nahm die Karte freudig entgegen. »Danke.«
Als alles geregelt war, fuhr Tucker mit Kane weiter. Auf dem Weg zum Motel zeigte er dem Schäferhund die Karte. »Siehst du, Kane? Wer sagt denn, dass keine gute Tat ungesühnt bleibt?«
Allerdings hatte er sich zu früh gefreut. Als er vor seinem Zimmer hielt, bot sich ihm im Scheinwerferlicht ein unerwarteter Anblick.
Auf der Bank neben der Tür saß eine Frau – ein Gespenst aus der Vergangenheit. Allerdings war die Erscheinung weder mit Khakisachen noch mit blauer Ausgehuniform bekleidet, sondern mit Jeans, hellblauer Bluse und offener Strickjacke.
Tuckers Herzschlag geriet ins Stolpern. Mit laufendem Motor blieb er hinter dem Steuer sitzen und versuchte zu begreifen, wie sie hierhergekommen war und wie sie ihn gefunden hatte.
Sie hieß Jane Sabatello. Zum letzten Mal hatte er sie vor sechs Jahren gesehen. Er registrierte jedes Detail an ihr, und ein jedes löste Erinnerungen aus, die Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen ließen: die vollen Lippen, der Mondschein, der ihrem blonden Haar einen silbrigen Glanz verlieh, die Freude in ihren Augen am Morgen.
Tucker hatte nie geheiratet, doch bei Jane hatte nicht viel gefehlt.
Und jetzt saß sie da und wartete auf ihn – und sie war nicht allein.
Neben ihr saß ein Junge, der sich an ihre Hüfte schmiegte.
Einen Moment lang fragte er sich, ob der Junge vielleicht …
Nein, das hätte sie mir gesagt.
Er stellte endlich den Motor ab und stieg aus. Als sie ihn wiedererkannte, richtete sie sich auf.
»Jane?«, murmelte er.
Sie eilte ihm entgegen, umarmte ihn und hielt ihn bestimmt eine halbe Minute lang fest, bevor sie sich von ihm löste. Mit feuchten Augen betrachtete sie sein Gesicht. Im grellen Licht der Scheinwerfer des Cherokee bemerkte er unter dem einen Wangenknochen eine dunkle Prellung, die das Kosmetikpuder nur unzureichend verdeckte.
Die panische Angst in ihrem Blick war noch deutlicher zu erkennen.
Sie krallte die Finger in seinen Arm. »Tucker, du musst mir helfen.«
Sie blickte zum Jungen.
»Jemand will uns umbringen.«
2
10. Oktober, 20:22 MDT Bitterroot Mountains, Montana
Als Tucker Jane die Zimmertür aufhielt, musterte er sie aufmerksam. Sie ging mit steifem Rücken an ihm vorbei, die Hand auf die Schulter des Jungen gelegt. Vor dem Eintreten schaute sie sich aufmerksam im Zimmer um. Erst als sie sich vergewissert hatte, dass sich niemand darin aufhielt, entspannte sie sich und gab ihrer Erschöpfung nach. Sie geleitete ihren Sohn in den Raum und setzte sich mit einem leisen Seufzer auf eines der beiden Betten.
Der blondhaarige, drei- oder vierjährige Junge kletterte neben ihr aufs Bett und lehnte sich an sie. Jane streichelte ihm das Haar. Augenblicklich fielen ihm die Augen zu.
Tucker setzte sich aufs andere Bett, sodass er Jane fast mit den Knien berührte. Sie rutschte unwillkürlich ein Stück weg.
Gleich darauf fasste sie sich wieder und legte sich die Hand aufs Knie. »Es war eine lange Fahrt«, sagte sie.
Tucker wusste, dass sie nicht allein wegen der Fahrt geschafft war. Die Frau, die er kannte, war äußerst belastbar gewesen. Um sie nicht unter Druck zu setzen, überließ er ihr die Wahl des Zeitpunkts, wann sie ihm ihre Geschichte erzählen wollte.
Kane kam näher. Die Schnauze hatte er gesenkt und wedelte langsam mit dem Schwanz; offenbar spürte er Janes Anspannung.
Ein schwaches Lächeln kräuselte ihre Lippen. Sie klopfte neben sich aufs Bett. »Hallo, mein Hübscher«, sagte sie leise. »Du hast mir gefehlt.«
Kanes Schwanzwedeln wurde schneller, offenbar hatte er sie wiedererkannt. Er sprang neben ihr so behutsam aufs Bett, dass der schlafende Junge nicht aufgeweckt wurde. Er machte sich neben ihr lang, legte die Schnauze auf ihren Oberschenkel und schnupperte am Haar des Jungen.
Sie kraulte Kane hinter dem Ohr, worauf der Schäferhund einen zufriedenen Schnaufer von sich gab.
Glücklicher Hund.
Tucker schaute zu, wie Jane ihren Sohn herumdrehte, ihn aufs Bett legte und zudeckte. Sie war noch immer eine hinreißende Schönheit. Ihr Gesicht war klein, ihre Augen so blau wie der tiefste Meeresgraben. Sie wirkte drahtig und topfit. Bei der Army war sie Marathon gelaufen und hatte Kendo praktiziert. In beiden Disziplinen hatte sie ausgezeichnete Leistungen gezeigt, was ihr den Spitznamen Zorro eingebracht hatte. Aufgrund des harten Trainings hatte sie auch ausgesprochen ansehnliche Kurven.
Nachdem sie ihren Sohn versorgt hatte, blickte Jane Tucker an und musterte ihn. Er war ein Jahr älter als sie, sein strohfarbenes struppiges Haar einige Schattierungen dunkler als das ihre, und er hatte ebenfalls eine sportliche Figur, war allerdings massiger als sie. Er merkte, dass sie unter seinen vielen Narben nach seinem jüngeren Ich Ausschau hielt, nach dem jungen Mann, der sie hochgehoben und umhergeschwenkt hatte, wann immer sie einander begegnet waren, der stets zum Lachen aufgelegt gewesen und nachts nicht in schweißnassen Laken aufgewacht war.
Sie musterten einander über den Abgrund der Jahre hinweg.
Vielleicht weil sie den Eindruck hatte, die Kluft nicht überwinden zu können, kam sie auf Kane zu sprechen. Mit ihm war es einfacher.
»Er ist größer geworden, Tuck. Wie ist das möglich?«
Tucker grinste. Jane war der einzige Mensch, der ihn Tuck nannte.
»Er stemmt Gewichte.«
»Unsinn. Er ist so schön wie eh und je.« Sie suchte seinen Blick. »Ich habe das mit Abel erfahren.«
Dass sie Kanes Wurfgeschwister erwähnte, versetzte ihm einen Stich. Vor seinem geistigen Auge sah er das Messer aufblitzen. Auf einmal roch er wieder den Qualm, und das Geheul seines verwundeten Partners hallte ihm in den Ohren. Seine Sicht verengte sich auf dunkles Fell und blutroten Fels.
Abel …
Eine Berührung am Knie brachte ihn in die Gegenwart zurück.
»Das tut mir so leid, Tuck«, sagte Jane und drückte ihm das Knie. »Ich hätte dich anrufen sollen. Wir hätten in Kontakt bleiben sollen.«
»Schon okay«, sagte er mit rauer Stimme. »Kane und ich waren viel unterwegs.«
Jane richtete sich auf und legte Kane die Hand auf die Seite. »Ich weiß, wie sehr du an ihm gehangen hast.«
Er schluckte mühsam.
»Aber wenigstens ist die alte Gang wieder beisammen«, sagte sie. »Wayne, Jane und Kane.«
Wehmütige Belustigung ließ ihre Gesichtszüge ganz weich erscheinen. In Afghanistan waren ihre ähnlich klingenden Namen Anlass für zahlreiche Scherze gewesen.
Tucker sammelte sich noch einen Moment, dann wies er mit dem Kinn auf den schlafenden Jungen. »Und jetzt, Jane, erzähl mir vom neuesten Gangzugang.«
Sie blickte den Jungen voller Zuneigung an. »Er heißt Nathan. In zwei Monaten wird er vier. Ehrlich gesagt ist er der zweite Grund, weshalb ich mich nicht gemeldet habe. Es fällt mir schwer, darüber zu reden. Ich habe immer gedacht, wir beide … na ja, du weißt schon.«
Ich weiß.
»Vor fünf Jahren habe ich einen netten Mann kennengelernt – Mike. Einen Versicherungsvertreter, ob du’s glaubst oder nicht.«
»Weshalb sollte ich dir nicht glauben?«
»Du weißt, was für ein Adrenalinjunkie ich bin. Ich hab mir immer vorgestellt, der Mann an meiner Seite müsste ein Leben voller Gefahren leben. Wenn nicht du, dann ein Rodeoreiter, ein Bergsteiger oder ein Höhlentaucher. Dann habe ich Mike getroffen. Er war humorvoll, zärtlich, verlässlich.« Sie schüttelte den Kopf. Die Erinnerungen entlockten ihr ein Lächeln, doch in ihrem Blick lag Traurigkeit. »Wir verliebten uns, und ich wurde schwanger.«
»Und wo ist Mike jetzt?«
Jane blickte Nathan an. »Drei Monate nach Geburt seines Sohnes kam er bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Er war so stolz … so glücklich …«
Damit hatte Tucker nicht gerechnet. Er fühlte sich, als habe man ihm einen Schlag in den Bauch verpasst. »Das tut mir leid, Jane.«
Sie nickte und wischte sich eine Träne aus dem Auge. »Anschließend habe ich mich zurückgezogen. Ich habe nur noch für meinen Sohn und meinen Job gelebt. Hin und wieder hab ich dran gedacht, Kontakt mit dir aufzunehmen, aber wir hatten uns so lange nicht mehr gesehen, und ich wusste nicht, was ich hätte sagen sollen.«
»Verstehe.« Er ließ den Blick durch das kleine Motelzimmer schweifen und überlegte, wie er zu einem unverfänglicheren Thema übergehen könnte. Jane war aus einem bestimmten Grund hier. »Wie hast du mich hier eigentlich gefunden?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Mit der Hilfe von dubiosen Freunden.«
Er hob eine Braue.
»Okay. Ich habe deine Kreditkarte überwachen lassen. Wenn du wirklich nicht auffindbar sein willst, solltest du vorsichtiger sein.«
Das war als Scherz gemeint, doch er nahm sich den Rat zu Herzen. Offenbar war er ein bisschen lax geworden.
Unvorsichtig.
Mit Daumen und Zeigefinger streifte Jane sich eine Strähne hinters rechte Ohr. Tucker kannte diese Angewohnheit gut; er liebte sie an ihr, konnte aber nicht sagen, weshalb. Es war eben so. Er ertappte sich dabei, dass er sie anstarrte.
»Was ist?«, fragte sie.
»Nichts. Wo lebst du jetzt?«
Jane zögerte. »Das möchte ich nicht sagen. Nicht dass ich dir nicht vertrauen würde. Aber je weniger du weißt, desto besser.«
Bei jedem anderen wäre Tucker diese Heimlichtuerei sauer aufgestoßen. Doch er hatte es hier mit Jane zu tun; normalerweise war sie der geradlinigste Mensch, den er kannte. Jane war beim 75. Ranger Regiment die beste Nachrichtenanalystin gewesen und hatte dem Bataillon der Spezialeinsatzkräfte angehört. Sie und Tucker hatten gemeinsam Einsätze koordiniert, bis sie sieben Monate vor ihm aus der Army ausgeschieden war.
»Jane, du hast gesagt, ihr wärt in Gefahr. Jemand wolle euch umbringen.«
Sie holte tief Luft. »Vielleicht bin ich auch bloß paranoid. Das ist in meinem Job eine Berufskrankheit. Aber jetzt, wo ich Nathan habe, will ich kein Risiko eingehen.«
»Okay, dann sag mir, was los ist.«
»Du erinnerst dich doch bestimmt an Sandy Conlon.«
Tucker musste einen Moment überlegen, bevor er den Namen einordnen konnte. Es war lange her.
Jane zog ein Foto aus der Tasche und reichte es ihm. Es zeigte ihn als jungen Mann, mit trotteligem Grinsen und herausgestreckter Brust, den Arm um Jane gelegt, die ihrerseits den Arm um eine kleinere schlanke Frau mit unscheinbarem braunem Haar und schwarzer Brille gelegt hatte. Zu ihren Füßen saßen zwei stolze junge Hunde: Kane und Abel.
Lächelnd erinnerte er sich an den Tag, als das Foto aufgenommen wurde. Sandy war als zivile Nachrichtenanalystin dem 3. Ranger Bataillon in Fort Benning, Georgia, zugeteilt gewesen. Sie hatten ständig zusammengehangen. Tucker erinnerte sich an Sandys schrägen Humor und ihr helles Gelächter. Auch so eine Freundschaft, an der er besser festgehalten hätte.
»Was ist mit ihr?«, fragte er.
»Sie wird vermisst. Ich habe seit einem Monat nichts mehr von Sandy gehört, deshalb rief ich vor drei Tagen ihre Mutter an. Sie lebt außerhalb von Huntsville, oben in den Bergen. In der tiefsten Provinz. Banjos, Squaredance, Mondschein, diese Sachen.«
»Originell. Was hast du in Erfahrung gebracht?«
»Nicht viel, aber doch genug, um mir Sorgen zu machen.«
»Schieß los.«
Jane holte tief Luft. »Sandy hat vor anderthalb Jahren eine neue Stelle angenommen. Vorher hat sie als Analytikerin für die DIA gearbeitet.«
Den militärischen Nachrichtendienst.
»Sandy hat mir auch den Job bei der DIA besorgt. Wir haben bis zu ihrem Verschwinden zusammengearbeitet.«
»Aber du arbeitest noch immer dort.«
Sie nickte.
Tucker verzichtete darauf nachzufragen. Aufgrund ihrer Fähigkeiten war sie bestimmt in einem Bereich mit erhöhter Sicherheitsstufe gelandet.
»Als Sandy aufgehört hatte«, fuhr Jane fort, »blieben wir in Kontakt. Tauschten ein paarmal pro Woche E-Mails aus. Telefonierten mehrmals im Monat. Wie das halt so läuft. Aber in den letzten Wochen hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Zunächst dachte ich, sie hätte bloß viel zu tun, doch als ich sie fragte, meinte sie, alles sei in Ordnung.«
»Aber das war gelogen.«
»Ich hörte es aus ihrem Tonfall heraus, besonders bei unserem letzten Telefonat. Sie hatte Angst.«
Nach allem, was Tucker über Sandy wusste, ließ sie sich nicht so schnell einschüchtern. Sie hatte Nerven wie Drahtseile.
»Wo hat sie zuletzt gearbeitet?«
»Bei Redstone.«
Tucker kannte den Namen. »Redstone Arsenal?«
Jane nickte.
Redstone war ein Army-Außenposten in Huntsville, Alabama. Die dortigen Militärdienststellen waren befasst mit der Luftfahrtindustrie und arbeiteten unter anderem mit der Raketenabwehr und dem Raumflugzentrum Marshall der NASA zusammen.
»Und ihre Aufgaben?«
»Darüber hat sie nicht gesprochen. Vielleicht durfte sie nicht. Ich nehme an, sie wurde als eine Art Beraterin eingestellt. Hatte mit einem streng geheimen Projekt zu tun.«
»Und jetzt ist sie verschwunden?«, hakte er nach. »Ohne eine Nachricht hinterlassen zu haben?«
»Ihrer Mutter zufolge hat Sandy sie vor drei Wochen besucht. Sie sagte, sie wäre ein paar Wochen lang nicht erreichbar, doch sie solle sich keine Sorgen machen. Dass Sandy ihre Mutter jedoch bat, weder beim Stützpunkt anzurufen noch Nachforschungen anzustellen, kam mir seltsam vor.«
»Das sieht ihr gar nicht ähnlich.«
»Das fand ich auch.« Jane gab ihm Gelegenheit, das Gehörte zu verdauen.
»Was ist passiert, was glaubst du?«, fragte er.
»Jemand hat sie entführt«, sagte sie im Brustton der Überzeugung.
Tucker spannte sich an. »Wie kommst du darauf?«
»Nach dem Gespräch mit Sandys Mutter habe ich bei Freunden von Freunden ein paar diskrete Erkundigungen eingeholt. In ihrem und meinem Freundeskreis. Ich hoffte, irgendjemand wüsste etwas. Dabei erfuhr ich, dass zwei weitere unserer Kollegen spurlos verschwunden sind. Und was noch verstörender ist: Vier weitere sind tot.«
»Tot?«
»Alle sind im vergangenen Monat ums Leben gekommen. Einer ist an einer Kohlenmonoxidvergiftung in seinem Haus gestorben, ein anderer an einem Herzanfall, und zwei weitere kamen bei Autounfällen ums Leben.«
So viele Zufälle gibt es nicht.
»Was ist eure Gemeinsamkeit?«, fragte er. »Wart ihr mit einem bestimmten Projekt befasst? Wart ihr alle am selben Ort stationiert?«
Jane sah ihm in die Augen und schwieg – auch eine Antwort. Tucker kannte sie gut genug, um erkennen zu können, dass sie etwas zurückhielt, beschloss aber, sie nicht zu drängen. Je weniger du weißt, desto besser, hatte sie gemeint.
»Weshalb wendest du dich an mich?«, fragte Tucker.
Sie schlug den Blick nieder. »Im Moment weiß ich nicht, wem ich trauen kann, aber dir vertraue ich mehr als jedem anderen Menschen auf der Welt. Außerdem bist du …« Sie schaute wieder hoch. »Dir fällt immer etwas ein. Und du hast mit der ganzen Sache nichts zu tun.«
»Niemand würde vermuten, dass ich dir helfe«, murmelte er.
»Außerdem bist du unvoreingenommen. Du lässt dich vom Augenschein nicht täuschen. Genau das brauche ich. Ich brauche dich.«
Er blickte sie an. Die tiefere Bedeutung ihrer letzten Bemerkung war zu gefährlich, um ihr im Moment nachzugehen. Jeden anderen hätte er aus dem Zimmer geworfen und seine Spuren verwischt. Stattdessen lehnte er sich zu ihr hinüber und ergriff ihre zitternde Hand.
»Du kannst dich auf mich verlassen … und auf Kane auch.«
Ihr Lächeln berührte ihn tief in seinem Inneren. »Wieder vereint.«
3
11. Oktober, 7:22 EDT Smith Island, Maryland
Pruitt Kellerman stand vor den Panoramafenstern seines Penthousebüros. Der Blick ging auf die Chesapeake Bay hinaus, doch wenn er sich ein wenig zur Seite wandte, sah er die ausgedehnte Skyline von Washington, D. C.
Zu dieser frühen Stunde war die Hauptstadt des Landes nebelverhangen. Die harten Kanten wurden abgemildert, die Monumente und Kuppeln waren nicht zu sehen. Er stellte sich vor, dass der Nebel D. C. bis auf seinen dunklen Kern reduzierte und den krebsartig wuchernden Ehrgeiz freilegte, das kleinliche und großartige Streben seiner Bewohner, den eigentlichen Motor der Stadt.
Er lächelte, als sein Spiegelbild sich mit der fernen Hauptstadt überlagerte, denn er war der Herr all dessen, was er sah.
In weniger als zwei Jahrzehnten hatte er die Machtträume, Hoffnungen und Ängste der Menschen in Geld verwandelt. Die Horizon Media Corporation war die wichtigste Anlaufstelle all derer, die nach Aufmerksamkeit verlangten, die um Erlösung flehten und um einen Platz an der Spitze kämpften. Sein Medienunternehmen kontrollierte alle möglichen Kommunikationskanäle – Fernsehen, Radio, Print- und Onlinemedien. Im Lauf der Jahre hatte er begriffen, wie einfach es war, den Informationsfluss zu kontrollieren. Es ging darum, bestimmte Kanäle zu drosseln und andere weit zu öffnen.
Nur wenige hatten verstanden, dass der alte Spruch Wissen ist Macht nicht mehr galt. Heutzutage waren Framing und Präsentation der Informationen das Entscheidende. In der Ära der Clips und der kurzen Aufmerksamkeitsspanne kam es darauf an, überhaupt wahrgenommen zu werden, und Pruitt verstand es, für Aufmerksamkeit zu sorgen. Deshalb war er der Schlüsselverwahrer der schimmernden Burg auf dem Hügel.
Er kam an jeden Politiker und jeden Regierungsangestellten heran. Eine Wahl stand bevor, und die Vertreter beider Lager sprachen bereits bei ihm vor, den Hut in der Hand; sie wussten, wer über das Schicksal ihrer Pläne entschied.
Um ein wenig Distanz zu wahren, hatte er die Zentrale der Horizon Media auf einer Insel in der Chesapeake Bay errichtet. Smith Island lag zwischen Maryland und Virginia und war eigentlich ein Naturreservat, doch er hatte seinen Einfluss bei der Baubehörde geltend gemacht, um seinen Willen durchzusetzen. Er hatte eine der äußeren Inseln ausgewählt, jene, welche der Küste am nächsten lag, ein schmales Band versalzten Sumpflands, das er mit Baggern erweitern ließ. Arbeiter aus Hongkong hatten die Fundamente gelegt. Er hatte sogar eine Brücke bauen lassen und unterhielt eine kleine Flotte von Tragflächenbooten, die Besucher zur Insel brachten und wieder zurück.
An der Tür wurde geklopft. Aus Gewohnheit überprüfte er sein Aussehen in der spiegelnden Fensterscheibe.
Er war Mitte fünfzig, hielt sich immer noch gerade und hatte breite Schultern. Sein Haar war kurz geschoren, einerseits um andere einzuschüchtern, aber auch aus Eitelkeit, denn sein Haaransatz wich immer weiter zurück. Um den Alterungsprozess noch weiter zu verbergen, ließ er sich Wachstumshormone injizieren, angeblich ein Quell der Jugendlichkeit. Außerdem achtete er auf Sauberkeit. Viele hielten ihn für weitaus jünger, als er tatsächlich war.
Er richtete die Seidenkrawatte.
Der äußere Eindruck ist entscheidend.
Hinter ihm wurde die Tür geöffnet, ohne dass er den Besucher hereingebeten hätte. Normalerweise hätte ihn das verärgert, doch es gab nur eine Person, die es wagte, ihn in seinem Allerheiligsten zu stören. Er entspannte sich und wandte sich lächelnd um.
»Laura«, begrüßte er die junge Frau im marineblauen Businesskostüm. »Was machst du denn so früh schon hier?«
Sie erwiderte sein herzliches Lächeln und deutete in den dunstigen Morgen hinaus. »Wie der Vater, so die Tochter.«
Da sei Gott vor.
Sie ging zum Schreibtisch, einen Aktenordner unter den Arm geklemmt. »Ich hab mir gedacht, ich lege heut mal einen Frühstart hin.«
Er nickte mit einem gedehnten Seufzer und deutete auf einen der Stühle. Sein Büro war ein Meisterwerk des skandinavischen Innendesigns, ausgestattet mit hellen Holzmöbeln, Akzenten aus gebürstetem Stahl und minimalem Schmuck. Die Wand hinter dem Konferenztisch nahmen zwei riesige Flachbildschirme mit Ultra-HD-Auflösung ein. Darauf liefen ohne Ton die Kanäle, die ihm gehörten. Zu sehen waren die Köpfe von Moderatoren, am unteren Rand scrollten Nachrichten.
Seine Tochter setzte sich und streifte sich das kastanienbraune Haar zurück. Ihre Wangen waren mit Sommersprossen gesprenkelt. Nur wenige hätten sie nach den geltenden Maßstäben als schön bezeichnet, doch aufgrund ihrer Intelligenz und ihres Charmes konnte sie sich über einen Mangel an Verehrern nicht beklagen.
»Bevor der heutige Nachrichtenzyklus in Schwung kommt«, erklärte sie, »wollte ich mit dir über die Nachricht sprechen, die die Anwälte zu dieser Abhörgeschichte vorbereitet haben.«
Als Kommunikationsdirektorin managte Laura die Presse, nicht nur die Horizon-eigenen Medien, sondern auch unabhängige. Bei dem neuesten Vorfall – diesem Ärgernis – ging es um den Vorwurf, Horizon Media habe die Telefone der Washington Post abgehört.
»Die Post hat keine Beweise«, brummte er und ließ sich auf seinen Ledersessel plumpsen. »Formulier die Meldung so, wie du es für richtig hältst. Ich vertraue dir. Aber weise darauf hin, dass ich von derlei Aktivitäten nichts gewusst habe. Sollte man das Gegenteil nachweisen, werden wir entsprechend reagieren.«
»Wird erledigt.« Laura ging die Liste durch, die auf dem Notebook auf ihrem Schoß gespeichert war. »Dann lass uns über den Flug nach Athen am kommenden Freitag sprechen. AP hat irgendwie Wind davon bekommen.«
»Wundert mich nicht.«
Im Lauf der Jahre hatte er herausgefunden, dass es durchaus sinnvoll war, wenn ein Reporter hin und wieder ein paar Informationsschnipsel zu Horizon ausgraben konnte. Das lenkte von den wirklich wichtigen Dingen ab.
Einer dieser Schnipsel war die Reise nach Athen.
»Sag ihnen einfach die Wahrheit«, meinte er.
Laura blickte vom Notebook auf, hob eine Braue und grinste. »Die Wahrheit? Seit wann verbreiten wir denn die Wahrheit?«
Er bedachte sie mit einem tadelnden Blick. »Ich dachte eigentlich, ich wäre hier der Zyniker.«
»Ich lerne vom Meister«, erwiderte sie und nahm sich wieder ihre Notizen vor.
Er seufzte; lieber wäre ihm gewesen, es verhielte sich anders. Als Laura in Harvard ihren Abschluss gemacht hatte, wollte er sie zunächst davon abhalten, einen Job bei Horizon anzunehmen. Doch in einer Welt voller geistloser reicher Töchter, die ihre Zeit damit verplemperten, Frappuccinos zu trinken und vor den Paparazzi ihre Unterwäsche aufblitzen zu lassen, war ausgerechnet er mit einer ehrgeizigen, völlig unprätentiösen Tochter geschlagen. Seit sie vor fünf Jahren in das Unternehmen eingetreten war, hatte er sich nach Kräften bemüht, die dunklere Seite des Konzerns vor ihr zu verbergen. Dies galt insbesondere für seine Pläne für den nächsten Sprung nach vorn.
Sie las aus ihren Notizen vor. »Was die Athenreise angeht, sagen wir, es gehe dabei um die Modernisierung und Konsolidierung der griechischen Telekommunikationsanbieter. Außerdem weisen wir darauf hin, dass Horizon und die griechische Regierung sich für einen freien, offenen und transparenten Markt aussprechen.«
»Klingt gut.«
Pruitt war sich bewusst, dass diese Erklärung bei den Anti-Kartell-Eiferern in Amerika und in der EU höhnische Kommentare auslösen würde, doch so wie die Dinge lagen, war die Monopolisierung des griechischen Telekommunikationsmarktes bereits weit fortgeschritten. Jemand musste das Steuer übernehmen.
Das könnte auch Horizon sein.
»Sonst noch etwas?«, fragte sie.
»Ja, einen Punkt gibt es noch.« Er stand auf, trat um den Schreibtisch herum und ergriff ihre Hand. »Du bedeutest mir alles, Laura, das weißt du doch, oder?«
Sie lächelte. »Ja, das weiß ich. Ich hab dich auch lieb.«
»Ich frage mich, ob du dir ausreichend Zeit für dich selber nimmst. Ich habe gehört, du wärst neunzig Stunden die Woche in der Firma.«
»Dad, das gilt auch für viele andere Leute hier.«
»Du bist nicht die. Du bist meine Tochter.«
»Und ich mag meinen Job. Ich komme schon klar.«
»Natürlich tust du das, aber es ist das Vorrecht eines Vaters, sich Sorgen zu machen. Und jetzt, wo deine Mutter …«