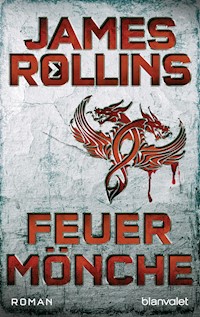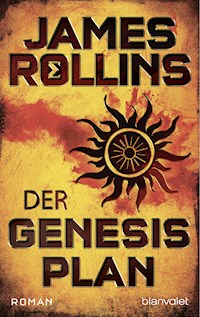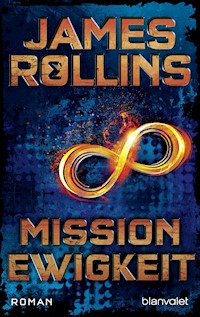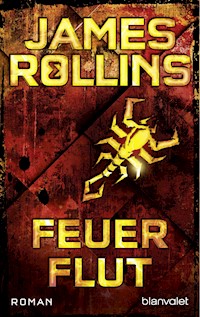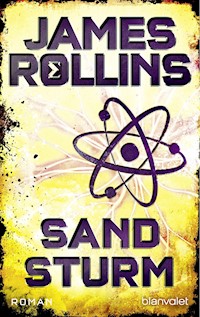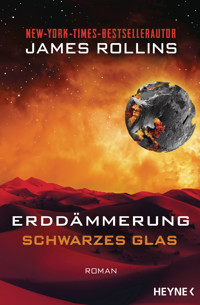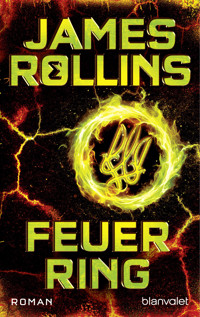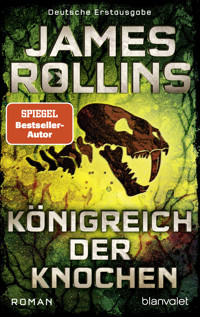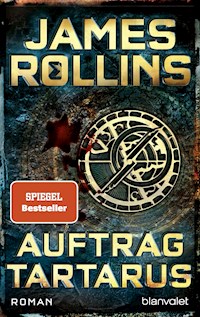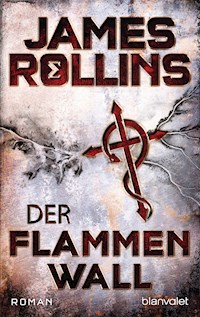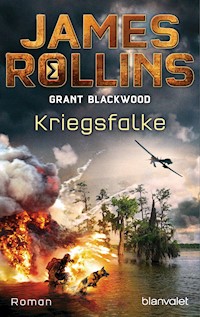9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: SIGMA Force
- Sprache: Deutsch
Einst beherrschten sie die Erde. Nun haben skrupellose Menschen sie neu erschaffen ...
Nur die Topagenten des wissenschaftlichen Geheimdienstes Sigma Force können das Ende der Menschheit noch verhindern. Es begann im Jahre 1903, als einige Wissenschaftler ein Artefakt entdeckten, das die Hölle auf Erden loslassen sollte. Sie wagten nicht, es zu zerstören. Stattdessen vergruben sie es wieder und gelobten Schweigen. Doch nichts bleibt ewig verborgen. Heute, mitten in Washington DC, wird es erneut geborgen, und seine Macht von skrupellosen Menschen freigesetzt. Und Commander Grayson Pierce von der Sigma Force steht vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. Um die Menschheit zu retten, muss er sich mit seinen Feinden verbünden – doch die fordern für ihre Unterstützung das Leben eines seiner Leute!
Verpassen Sie nicht die weiteren in sich abgeschlossenen Romane über die Topagenten der Sigma Force!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Nur die Topagenten des wissenschaftlichen Geheimdienstes Sigma Force können das Ende der Menschheit noch verhindern. Es begann im Jahre 1903, als einige Wissenschaftler ein Artefakt entdeckten, das die Hölle auf Erden loslassen sollte. Sie wagten nicht, es zu zerstören. Stattdessen vergruben sie es wieder und gelobten Schweigen. Doch nichts bleibt ewig verborgen. Heute, mitten in Washington D. C., wird es erneut geborgen und seine Macht von skrupellosen Menschen freigesetzt. Und Commander Grayson Pierce von der Sigma Force steht vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. Um die Menschheit zu retten, muss er sich mit seinen Feinden verbünden – doch die fordern für ihre Unterstützung das Leben eines seiner Leute! ((Nur E-Book ENDE))
Autor
Der New-York-Times-Bestsellerautor James Rollins hat einen Doktorgrad in Tiermedizin. Als begeisterter Höhlenforscher und ebenso eifriger Taucher ist er häufig unter Wasser oder unter der Erde anzutreffen. Er wohnt in den Bergen der Sierra Nevada in Kalifornien, USA.
Von James Rollins bei Blanvalet erschienen:
Sigma-Force:
Der Genesis-Plan, Feuermönche, Sandsturm, Der Judas-Code, Das Messias-Gen, Feuerflut, Mission Ewigkeit, Das Auge Gottes, Projekt Chimera, Das Knochenlabyrinth, Die siebte Plage, Die Höllenkrone
Tucker Wayne:
Killercode
Die Bruderschaft der Christuskrieger:
Das Evangelium des Blutes, Das Blut des Verräters, Die Apokalypse des Blutes
Außerdem:
Sub Terra, Im Dreieck des Drachen, Das Flammenzeichen, Operation Amazonas, Das Blut des Teufels, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
James Rollins
Die Höllenkrone
Roman
Aus dem Englischen von Norbert Stöbe
Die englische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »The Demon Crown (Sigma Force 13)« bei William Morrow, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2017 by Jim Czajkowski
Published in agreement with the author, c/o Baror International, Inc. Armonk, New York, U.S.A.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 by Blanvalet Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (iulias; Martin Capek; Gile68; Spring Bine; Milan M; NOPPHARAT STUDIO 969)
Redaktion: text in form / Gerhard Seidl
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-24911-3V001
www.blanvalet.de
Für Mama Carol, zum Dank für alles, was sie ihren Nächsten gab, immerzu selbstlos und liebevoll
Vorbemerkung zum historischen Hintergrund
Der Ursprung der Sigma Force liegt unter dem Smithsonian Castle, einem wuchtigen, mit Türmen versehenen Gebäude aus rotem Sandstein, das 1849 am Rande der National Mall in Washington errichtet wurde. An diesem ehrwürdigen Bauwerk nahm der weitläufige Komplex der Museen, Forschungsstätten und Labors der Smithsonian Institution seinen Ausgang. Während der Zeit des Bürgerkriegs beheimatete das Bauwerk sämtliche Sammlungen des Smithsonian.
Wie aber ist dieses leuchtende Zeugnis der Wissenschaft überhaupt entstanden?
Erstaunlicherweise wurde die Institution nicht von einem Amerikaner gegründet, sondern von einem recht exzentrischen britischen Chemiker und Mineralogen namens James Smithson. Als er im Jahr 1829 starb, hinterließ er den Vereinigten Staaten eine halbe Million Dollar (heutiger Wert etwa zwölf Millionen Dollar oder ein Sechsundsechzigstel des damaligen Bundeshaushalts). Das Geld sollte zur Gründung einer »Einrichtung zur Mehrung und Verbreitung des Wissens der Menschheit« verwendet werden.
Bis heute ist der Wohltäter geheimnisumwoben. Zum einen hat James Smithson niemals amerikanischen Boden betreten, sein Vermögen und eine umfangreiche Mineraliensammlung aber dieser jungen Nation vermacht. Des Weiteren hat Smithson zu keinem Zeitpunkt seine Absicht kundgetan, den Vereinigten Staaten ein solches Vermächtnis zu machen, und seltsamerweise bestattete sein Neffe ihn im italienischen Genua und nicht in England. Wenig bekannt ist der Umstand, dass im Jahr 1865, gegen Ende des Bürgerkriegs, in der Burg ein verheerendes Feuer ausbrach. Die unteren Etagen hatten nur Wasserschäden zu verzeichnen, die oberen Stockwerke aber sind ausgebrannt. Der Großteil der handschriftlichen Aufzeichnungen Smithsons – darunter seine Tagebücher und wissenschaftlichen Journale – wurde vernichtet. Bei dem Brand ging das Lebenswerk dieses Mannes unwiederbringlich verloren.
Doch die Merkwürdigkeiten nahmen mit seinem Tod kein Ende. Im Winter 1903 reiste der berühmte amerikanische Erfinder Alexander Graham Bell gegen den ausdrücklichen Wunsch des Verwaltungsrats der Smithsonian Institution nach Italien und verschaffte sich Zugang zu Smithsons Grab in Genua, verstaute die Gebeine in einem Zinksarg und brachte sie mit einem Dampfer in die Vereinigten Staaten. Nach seiner Rückkehr setzte er sie in der Burg bei, wo sie sich heute noch befinden.
Aber weshalb widersetzte sich der Erfinder des Telefons den Wünschen seiner Kollegen im Verwaltungsrat auf solch eklatante Weise? Tat er es nur deshalb, wie die meisten annahmen, weil Smithsons Grab in einem sich ausdehnenden italienischen Steinbruch zu verschwinden drohte? Oder steckt noch mehr hinter dem exzentrischen James Smithson und seinem unerwarteten Vermächtnis, dem mysteriösen Feuer, das seine Hinterlassenschaft zerstörte, und der merkwürdigen Reise Alexander Graham Bells, der seine Gebeine barg?
Lesen Sie weiter, um die schockierende Wahrheit über ein dunkles amerikanisches Geheimnis zu erfahren …
Vorbemerkung zum wissenschaftlichen Hintergrund
Palaeovespa florissantia, eine Feldwespe, die vor vierunddreißig Millionen Jahren lebte
Bildrechte: National Park Service
Welches ist das gefährlichste Tier auf Erden? Überlegen wir mal. Haie töten durchschnittlich sechs Menschen pro Jahr, während Löwen für etwa zweiundzwanzig Todesfälle verantwortlich sind. Durch Angriffe von Elefanten kommen erstaunliche fünfhundert Menschen um. Schlangenbisse fordern jährlich tausend Opfer. Wir Menschen übertreffen diese Zahlen natürlich erheblich, denn wir massakrieren Jahr für Jahr vierhunderttausend Artgenossen. Der wahre Killer der Tierwelt aber ist viel kleiner und weit gefährlicher. Gemeint ist die bescheidene Mücke. Als Überträger zahlreicher Krankheiten wie Malaria, Gelbfieber, West-Nil-Fieber und neuerdings Zika sind diese fliegenden Blutsauger für über eine Million Todesfälle jährlich verantwortlich. Mückenstiche sind die Haupttodesursache bei Kindern unter fünf Jahren.
Andere kleine Tiere aber machen der Mücke diesen zweifelhaften Rekord streitig. Tsetsefliegen verursachen alljährlich zehntausend Todesfälle. Die Wanze Reduviidae, auch treffend Mordwanze genannt, erweist sich mit zwölftausend Opfern als noch gefährlicher. Letzten Endes fällt jedes Jahr einer von sechzig Menschen einem Insekt zum Opfer.
Weshalb ist das wichtig? Es dient der Erinnerung daran, dass wir nicht im Zeitalter des Menschen leben, sondern im Zeitalter der Insekten, das schon länger als vierhundert Millionen Jahre währt. Menschen leben auf diesem Planeten seit gerade mal dreihunderttausend Jahren, Insekten hingegen gab es schon lange vor den Dinosauriern. Sie vermehrten sich, breiteten sich aus und eroberten sämtliche Umweltnischen. Inzwischen scheint es sogar denkbar, dass die Insekten zur Auslöschung der Dinosaurier beigetragen oder sie sogar herbeigeführt haben. Wie das? Bei der Untersuchung alter Fossilien kam heraus, dass diese kleinen Raubtiere scharenweise über die schwerfälligen Saurier herfielen, als diese aufgrund der klimatischen Veränderungen zum Ende der Kreidezeit geschwächt waren, und durch ihr räuberisches Verhalten und die Übertragung von Krankheiten maßgeblich zu deren Aussterben beitrugen. In der Vorzeit nutzten sie die Gelegenheit, um sich des Hauptkonkurrenten bei der Nutzung all der neuen Pflanzen und Blumen zu entledigen – und machten dem Zeitalter der Dinosaurier auf einen Schlag ein Ende.
Was natürlich eine Frage hinsichtlich des neuesten Konkurrenten der Insekten beim Kampf um die schwindenden natürlichen Ressourcen aufwirft: Könnten wir das nächste Opfer sein?
Ich vermag nicht zu glauben, dass die Ichneumonidae [parasitäre Wespen], deren Larven sich von lebenden Raupen nähren, absichtsvoll von einem wohlwollenden, allmächtigen Gott erschaffen wurden …
Charles Darwin in einem Brief vom 22. Mai 1860 an den Botaniker Asa Gray
Das sind schwerstens missverstandene Geschöpfe.
J. K. Rowling, Harry Potter und der Feuerkelch
Prolog
11:07 CET31. Dezember 1903Genua, Italien
Für die Passagiere der Kutsche, die aus dem verschneiten Genua kam und in halsbrecherischem Tempo die Steigung hochfuhr, war es eine strapaziöse Fahrt. Das Gefährt schwankte um eine scharfe Biegung der schmalen Straße.
Alexander Graham Bell, der auf dem Rücksitz saß, stöhnte. Nach einem Fieber, das er sich während der Transatlantiküberfahrt in Begleitung seiner Frau zugezogen hatte, war er noch immer nicht ganz genesen. Zu allem Unglück war nach seiner zwei Wochen zurückliegenden Ankunft in Italien eine Menge schiefgegangen. Die italienischen Behörden hatten sein Vorhaben behindert, die sterblichen Überreste James Smithsons zu bergen, des Gründers der Smithsonian Institution. Um den Grabraub durchführen zu können, war er gezwungen gewesen, sich als Spion und Botschafter zu betätigen, zu bestechen und zu täuschen. Dies war ein Spiel für einen weit Jüngeren, aber nicht für einen Mann Mitte fünfzig. Die nervliche Anspannung hatte ihren Tribut gefordert.
Seine Frau umklammerte seinen Arm. »Alec, vielleicht sollten wir den Kutscher bitten, langsamer zu fahren.«
Er tätschelte ihr die Hand. »Nein, Mabel, das Wetter bessert sich gerade. Außerdem sitzen uns die Franzosen im Nacken. Entweder jetzt oder nie.«
Vor drei Tagen, als er endlich die erforderlichen Genehmigungen beisammenhatte, waren irgendwelche französischen Verwandten von Smithson, die keine Ahnung hatten, was auf dem Spiel stand, auf der Bildfläche erschienen und hatten Anspruch auf den Leichnam erhoben. Bevor die Hindernisse unüberwindlich wurden, hatte er gegenüber den italienischen Behörden geltend gemacht, dass Smithson den Vereinigten Staaten seinen gesamten Besitz vermacht habe, was auch für dessen sterbliche Überreste gelte. Er untermauerte diese Position mit haufenweise Lire, die er in die richtigen Hände drückte, und behauptete kurzerhand, Präsident Theodore Roosevelt unterstütze sein Anliegen.
Obwohl er mit seiner List durchgekommen war, wollte er sich nicht darauf verlassen, dass sein Glück von Dauer war.
Entweder jetzt oder nie.
Er legte die Hand auf seine Brusttasche, in der ein gefalteter, angekohlter Papierfetzen steckte.
Mabel war die Bewegung nicht entgangen. »Glaubst du, es ist noch da? Dass es zusammen mit ihm begraben wurde?«
»Wir müssen uns Gewissheit verschaffen. Vor einem halben Jahrhundert wäre das Geheimnis beinahe zerstört worden. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Italiener vollenden, woran andere gescheitert sind.«
Im Jahr 1829 war James Smithson von seinem Neffen in Genua auf einer Landzunge bestattet worden. Der kleine Friedhof gehörte damals den Briten, doch später hatten die Italiener das Eigentumsrecht zurückerlangt. In den letzten Jahren hatte sich ein angrenzender Steinbruch langsam durchs Gestein gefressen, und nun wollte die Firma alles niederreißen, auch den Friedhof.
Als die Mitglieder des Verwaltungsrats des Smithsonian Museums erfuhren, dass die Gebeine ihres Gründers in Gefahr waren, hatten sie darüber gesprochen, ob sie die sterblichen Überreste bergen sollten, bevor der Boden gesprengt wurde und im Meer verschwand. In dieser Zeit gelangte ein alter Brief in Alexanders Besitz. Der Verfasser war Joseph Henry, der erste Sekretär der Smithsonian Institution, der Mann, der den Bau der Burg beaufsichtigt hatte und schließlich in ihren Mauern gestorben war.
»Henry war kein Idiot«, murmelte er vor sich hin und strich sich über den üppigen Bart.
»Ich weiß, wie sehr du ihn bewundert hast«, sagte Mabel aufmunternd. »Und wie viel dir seine Freundschaft bedeutet hat.«
Er nickte.
Genug, um ihm bis zu seinem Grab in Italien zu folgen.
In dem Brief, verfasst ein Jahr vor seinem Tod, erzählte Henry eine Geschichte, die bis zum Bürgerkrieg zurückreichte, als sich das Blatt gegen den Süden zu wenden begann. Henry war in einem von Smithsons Tagebüchern auf einen merkwürdigen Eintrag gestoßen. Er war nur deshalb darüber gestolpert, weil er nach weiteren Informationen zu Smithsons Vermächtnis suchte und wissen wollte, weshalb sich der Mann einem Land gegenüber, das er nie besucht hatte, als so großzügig erwiesen hatte. Im Zuge der Nachforschungen stellte er fest, dass Smithson eine Ausnahme gemacht hatte. Es gab etwas, das er nicht den Vereinigten Staaten vermacht hatte. Seine komplette Mineraliensammlung – sein Lebenswerk – befand sich in der Burg, doch ein Artefakt hatte er davon ausgenommen. Seinen Neffen hatte er angewiesen, diesen Gegenstand zusammen mit seinem Leichnam beizusetzen.
Diese Merkwürdigkeit weckte Henrys Interesse und veranlasste ihn, die Tagebücher und Journale gründlich durchzusehen. Schließlich stieß er auf einen Hinweis, auf etwas, das Smithson als Höllenkrone bezeichnete. Er äußerte sein Bedauern darüber, dass er sie bei einer Reise an die Ostsee ausgegraben hatte. Er behauptete, sie könne etwas Grauenhaftes freisetzen.
»›Die Horden der Hölle auf die Welt loszulassen …‹«, zitierte Alexander flüsternd aus einem von Smithsons Tagebüchern.
»Glaubst du wirklich, es könnte dazu kommen?«, fragte Mabel.
»Zu Zeiten des Bürgerkriegs hat jemand so fest daran geglaubt, dass er versucht hat, das Smithsonian Castle niederzubrennen.«
Jedenfalls hat Henry das angenommen.
Als er Smithsons Geheimnis entdeckte, hatte er mit anderen Vorstandsmitgliedern darüber gesprochen und sogar ausdrücklich gefragt, ob man das Artefakt als Waffe nutzen könne. Drei Tage später war in der Burg das mysteriöse Feuer ausgebrochen, das anscheinend darauf abzielte, Smithsons Aufzeichnungen und seine Mineraliensammlung zu vernichten – sein Vermächtnis.
Der Zeitpunkt des Brandes weckte bei Henry den Verdacht, jemand von der Smithsonian habe seine Befürchtungen der Konföderation anvertraut. Zum Glück hatte Henry Smithsons Journal mit den Hinweisen auf das Artefakt in seinem eigenen Büro verwahrt, sodass es das Feuer, wenn auch in angesengtem Zustand und mit teilweise unleserlichen Seiten, überstanden hatte. Henry sagte sich, dass es am klügsten sei, seine Entdeckung unter Verschluss zu halten und nur den engsten Kreis seiner Vertrauten einzuweihen. Sie bildeten am Museum eine verschworene Gruppe, der die dunkelsten Geheimnisse der Smithsonian Institution anvertraut wurden, Informationen, die bisweilen sogar dem Präsidenten vorenthalten wurden.
Ein Beispiel dafür war die mysteriöse Tätowierung am Handgelenk eines Halunken, den Henry schließlich mit dem Brand in Verbindung brachte. Bevor er verhört werden konnte, schlitzte der Mann sich mit einem Dolch den Hals auf und verstarb. Henry hatte seinem Brief als Warnung für zukünftige Generationen eine Zeichnung des Symbols beigefügt.
Das Zeichen erinnerte an das Freimaurersymbol, doch niemand konnte sagen, welche Gruppe diese spezielle Variante verwendete. Jahrzehnte später, als Smithsons Grab in Gefahr war, wandten Henrys Vertraute sich an Alexander und zeigten ihm den Brief. Sie warben ihn für ihre Sache an, denn um ein solches Husarenstück auf italienischem Boden durchzuziehen, waren sie auf einen prominenten, exzentrischen Verbündeten angewiesen.
Alexander war sich zwar nicht sicher, was er in Smithsons Grab vorfinden würde oder ob überhaupt etwas darin war, erklärte sich aber bereit, den Plan in die Tat umzusetzen, und finanzierte die Unternehmung sogar mit seinem eigenen Geld. Wie die Sache auch ausgehen mochte, er konnte sich nicht verweigern.
Das bin ich Henry schuldig.
Die Kutsche rumpelte um die letzte Biegung und erreichte die Anhöhe der Landspitze. Sie bot Ausblick auf die Stadt Genua mit ihrem Hafen, in dem sich so viele mit Kohle beladenen Kähne drängten, dass es aussah, als könnte man die Bucht überqueren, indem man von einem zum anderen sprang. In der Nähe lag der kleine Friedhof, umgeben von einer weißen Mauer, die von Glasscherben gekrönt war.
»Sind wir zu spät gekommen?«, fragte Mabel.
Ihre Sorge war nicht unberechtigt. Eine Ecke des Friedhofs war bereits verschwunden und in den nahe gelegenen Marmorsteinbruch gestürzt. Als Alexander ausstieg und vom eiskalten Wind erfasst wurde, machte er in der Tiefe zwei zerschellte Särge aus. Er fröstelte, jedoch nicht wegen der Kälte.
»Wir sollten uns beeilen«, sagte er.
Er geleitete seine Frau zum Friedhofstor. Auf dem Gelände machte er eine Gruppe von Männern in warmen Mänteln aus. Dies waren Behördenvertreter und drei Arbeiter. Sie hatten sich an einer auffälligen Gruft versammelt, die von einem Zaun mit Spitzen umgeben war. Alexander eilte hinüber, vorgebeugt wegen des Winds und einen Arm um seine Frau gelegt.
Er nickte dem amerikanischen Konsul William Bishop zu.
Bishop trat ihm entgegen und tippte auf seine Uhr. »Wie ich gehört habe, ist ein französischer Anwalt mit dem Zug von Paris hierher unterwegs. Wir sollten uns sputen.«
»Einverstanden. Je eher wir mit den Gebeinen unseres geschätzten Kollegen an Bord der Princess Irene gehen und die Rückfahrt nach Amerika antreten, desto besser.«
Als Alexander sich der Grabstätte näherte, begann es zu schneien. Er las die Inschrift auf dem Marmorpodest.
Bishop ging zu den Italienern hinüber und sprach kurz mit ihnen. Zwei der Arbeiter machten sich mit Brechstangen an die Arbeit. Sie stemmten den Marmordeckel hoch und hoben ihn ab. Der dritte Arbeiter bereitete einen Zinksarg vor. Wenn Smithsons Gebeine darin lagen, würde er für die Reise über den Atlantik verschlossen werden.
Während die Männer arbeiteten, betrachtete Alexander die Inschrift mit einem tiefen Stirnrunzeln. »Das ist eigenartig …«
»Was meinst du?«, fragte Mabel.
»Hier steht, Smithson wäre im Alter von fünfundsiebzig Jahren gestorben.«
»Und?«
Er schüttelte den Kopf. »Smithson wurde am fünften Juni 1765 geboren. Nach meiner Berechnung war er vierundsechzig Jahre alt, als er gestorben ist. Die Inschrift liegt elf Jahre daneben.«
»Ist das wichtig?«
Er zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung, aber man sollte annehmen, dass sein Neffe das wahre Alter seines Onkels gekannt hat, zumal er es in Stein hat meißeln lassen.«
Bishop winkte Alexander näher ans Grab, als die Gruftplatte weggetragen wurde. »Vielleicht sollten Sie den Vortritt haben.«
Er wusste die Geste zu schätzen, schreckte aber dennoch davor zurück. Andererseits war er bereits zu weit gegangen, um jetzt einen Rückzieher zu machen.
Mitgegangen, mitgehangen.
Er stellte sich neben Bishop vor das offene Grab und blickte hinein. Der Holzsarg war längst verrottet, zurückgeblieben war eine dicke Staubschicht, welche die Gebeine bedeckte. Ehrfurchtsvoll langte er hinein, teilte die Rückstände und hob den Schädel hoch, der erstaunlicherweise unversehrt war. Eigentlich hatte er erwartet, er werde in seiner Hand zerbröseln.
Er trat zurück und starrte in die Augenhöhlen des Gründers der Smithsonian Institution.
Wie in der Inschrift aufgeführt, war Smithson ein angesehenes Mitglied der British Royal Society gewesen, einer der angesehensten Wissenschaftsgesellschaften der Welt. Trotz seines jungen Alters genoss er bereits Anerkennung als Wissenschaftler. In seiner Eigenschaft als Chemiker und Mineraloge verbrachte er einen großen Teil seines Lebens mit Reisen in Europa, auf denen er Mineralien und Gesteinsproben sammelte.
Gleichwohl lag bei ihm immer noch vieles im Dunkeln.
Zum Beispiel der Grund, weshalb er sein Vermögen und seine Sammlung den Vereinigten Staaten vermacht hatte.
Eines war hingegen unbestritten.
»Wir haben dir viel zu verdanken«, murmelte Alexander über dem Schädel. »Mit deiner Großzügigkeit hast du unser junges Land für immer verändert. Dein Vermächtnis hat Amerikas größte Geister gelehrt, sich über ihre Animositäten hinwegzusetzen und gemeinsam für das Allgemeinwohl zu arbeiten.«
»Gut gesprochen«, sagte Bishop und streckte die behandschuhte Hand aus. Das Wetter wurde von Minute zu Minute unangenehmer, und der Konsul wollte die Angelegenheit offenbar abschließen.
Alexander hatte nichts dagegen. Er übergab den Schädel, der daraufhin in den Zinksarg gelegt wurde, und richtete seine Aufmerksamkeit wieder aufs Grab. Der rechteckige Gegenstand in der einen Ecke war ihm bereits aufgefallen.
Er langte erneut hinein und wischte den Staub weg. Darunter kam eine kleine Metalltruhe zum Vorschein.
Und deswegen all das Aufheben?
Er musste seine ganze Körperkraft aufbieten, um die Truhe aus dem Grab zu heben. Sie war furchtbar schwer. Er schleppte sie ein Stück beiseite und setzte sie auf einem Grabstein ab. Bishop wies die Arbeiter an weiterzumachen und kam dann mit Mabel herüber.
»Ist es das?«, fragte sie.
Alexander wandte sich an Bishop. »Nur zur Erinnerung: Dieses Ding darf weder offiziell noch inoffiziell erwähnt werden. Haben Sie mich verstanden?«
Bishop nickte und blickte zu den fleißigen Arbeitern hinüber. »Sie haben die Leute gut für ihr Schweigen bezahlt.«
Zufrieden mit Bishops Antwort klappte Alexander den Deckel der Truhe auf. Auf einer Sandschicht lag etwas von der Größe und Farbe eines Kürbisses. Einen Moment lang betrachtete er es atemlos.
»Was ist das?«, fragte Mabel.
»Sieht aus wie … ein Stück Bernstein.«
»Bernstein?« Ein Anflug von Habgier schwang in Bishops Stimme mit. »Ist der wertvoll?«
»Es geht so. Aber eigentlich ist das nichts Besonderes. Er besteht im Wesentlichen aus Baumharz.« Stirnrunzelnd beugte er sich vor. »Bishop, würden Sie den Arbeiter bitten, mir seine Laterne auszuleihen?«
»Warum …?«
»Tun Sie’s einfach, Mann. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.«
Bishop eilte zu dem Arbeiter.
Mabel blickte ihrem Mann über die Schulter. »Was meinst du, Alex?«
»Ich erkenne da etwas. Im Bernstein. Aber nur undeutlich.«
Bishop kam mit der Laterne zurück.
Alexander nahm sie ihm ab, stellte die Flamme heller und hielt sie dicht an den durchscheinenden Bernsteinklumpen. Er leuchtete honigfarben, und jetzt konnte man erkennen, was sich darin befand.
»Da sind Knochen drin«, sagte Mabel atemlos.
»Sieht so aus.«
Offenbar enthielt Smithsons Grab mehr als nur seine eigenen morschen Gebeine.
»Aber von welchem Lebewesen stammen sie?«, fragte Bishop.
»Keine Ahnung. Bestimmt von einem prähistorischen.«
Er beugte sich weiter vor und kniff die Augen zusammen. Im Bernstein war ein faustgroßer rechteckiger Schädel mit einer Reihe scharfer Zähne eingeschlossen. Er wirkte reptilienhaft, vielleicht stammte er von einem kleinen Dinosaurier. Um den Schädel herum schwammen mehrere kleinere Knochen im leuchtenden Stein. Alexander stellte sich vor, wie das Baumharz seinerzeit über das Grab des Tieres geflossen war und die Knochen auf ewig in dieser Lage fixiert hatte.
Die kleinen Knochen bildeten ein unheimliches Halo um den Schädel.
Sie sehen aus wie eine Krone.
Er blickte Mabel an, die scharf den Atem einsog, als sie die Form erkannte. Auch ihr war klar, dass dies die von Smithson erwähnte Höllenkrone sein musste.
»Das kann nicht sein«, flüsterte sie.
Er nickte. In seiner Tasche steckte eine versengte Seite aus Smithsons Tagebuch, auf der er eine erstaunliche Anmerkung zu dem Artefakt gemacht hatte.
Es konnte nicht sein, wie Mabel bereits gesagt hatte.
Seid gewarnt, denn das, was die Höllenkrone in sich birgt, es lebt …
Ein eiskalter Schauer lief Alexander über den Rücken.
… und ist bereit, die Horden der Hölle auf die Welt loszulassen.
20:34 EDT3. November 1944Washington, D. C.
»Hüten Sie sich vor den Ratten«, sagte James Reardon warnend an der Eingangstür des Tunnels. »Hier im Dunkeln gibt es richtige Biester. Letzten Monat hat eine einem Arbeiter ein Stück vom Daumen abgebissen.«
Archibald MacLeish unterdrückte seinen Ekel und hängte seine Jacke an einen Haken neben der Tür. Eigentlich war er für einen Ausflug unter die Erde nicht ausgerüstet, doch da die Besprechung in der Kongressbibliothek so lange gedauert hatte, war er zu spät hier angekommen.
Er sah auf die fünf Stufen nieder, die zu dem alten Gang hinunterführten, der das Smithsonian Castle mit dem Museumsneubau an der anderen Seite der Mall verband. Das Museum für Naturgeschichte war 1910 fertiggestellt worden, nachdem man mit Pferdekarren zehn Millionen Objekte in das neue Gebäude gebracht hatte. In den folgenden zehn Jahren hatten die beiden Museen Materialien und Exponate durch den zweihundertfünfzig Meter langen Tunnel transportiert, doch im Zuge der Modernisierung war der Gang schließlich verschlossen worden und wurde seitdem nur sporadisch von Wartungskräften betreten.
Für das Ungeziefer gilt diese Einschränkung anscheinend nicht.
Archibald sah eine neue Verwendung für den verlassenen Tunnel. Als Leiter der Kongressbibliothek und Vorsitzender des Komitees für den Erhalt von Kulturgütern war er zu Beginn des Zweiten Weltkriegs mit der sicheren Unterbringung der nationalen Kulturschätze beauftragt worden. Da man Bombenangriffe befürchtete, wie sie London während des Blitzkriegs heimgesucht hatten, hatte er persönlich die Verlegung unersetzlicher Dokumente nach Fort Knox beaufsichtigt, darunter die Unabhängigkeitserklärung, die Verfassung und ein Exemplar der Gutenberg-Bibel. Die Nationale Kunstgalerie hatte die meisten kostbaren Meisterwerke nach Biltmore House in North Carolina geschafft, während das Smithsonian das Sternenbanner tief unter dem Shenandoah National Park versteckt hatte.
Archibald missfiel die unsystematische Vorgehensweise. Im Jahr 1940 hatte er sich für eine dauerhafte Lösung und den Bau eines bombensicheren Depots unter der National Mall ausgesprochen. Bedauerlicherweise hatte der Kongress seinen Vorschlag wegen zu hoher Kosten abgelehnt.
Ungeachtet des Rückschlags hatte Archibald an seiner Idee festgehalten, und dies war der Grund, weshalb er sich nun im Keller des Smithsonian Castle befand, wo man für das Museumspersonal provisorische Schutzräume eingerichtet hatte. Vor drei Wochen hatte Archibald zwei Ingenieure mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Sie sollten feststellen, ob sich im Geheimen ein vom Tunnel abzweigender Bunker errichten lasse. Vor zwei Tagen hatten die beiden bei einer Ortsbegehung im Tunnel auf halbem Weg zur Mall eine Seitentür entdeckt. Sie war hinter Rohren versteckt und zugemauert.
Archibald hatte unverzüglich James Reardon informiert, den Untersekretär des Smithsonian. Als langjähriger Freund unterstützte James Archibalds Plan für die Errichtung eines bombensicheren Gewölbes. Beide hofften, dass die Entdeckung neues Interesse an dem Bunker wecken könnte, zumal in Anbetracht der Person, die den Raum mutmaßlich versteckt hatte. Ihr Name stand auf einer an der Stahltür angebrachten Plakette, die hinter dem Gemäuer zum Vorschein gekommen war.
Alexander Graham Bell.
Was hinter dieser Tür verborgen liegt, ist ein Wunder und eine Gefahr sondergleichen. Es könnte den Verlauf der Menschheitsgeschichte verändern oder unser aller Untergang bedeuten, wenn es in die falschen Hände gerät. Wir, die Unterzeichner, erachten das Artefakt für zu gefährlich, als dass es ans Licht geraten dürfte, wagen aber auch nicht, es zu zerstören, denn in seinem Innern befindet sich der Schlüssel zum Leben nach dem Tod.
Das war eine bemerkenswerte Behauptung, doch sie wurde bekräftigt durch die Unterschriften von fünf Mitgliedern des Aufsichtsrats des Smithsonian. James hatte die Namen verifiziert. Die Männer waren mittlerweile verstorben, und es fanden sich auch keine weiteren Informationen zu den Umständen, die Bell sowie fünf weitere Personen veranlasst hatten, etwas unter der National Mall zu verstecken und den Vorgang vor den anderen Aufsichtsratsmitgliedern geheim zu halten.
Archibald hatte sich ein Beispiel an ihnen genommen und nur mit seinem Freund James über die Entdeckung der Tür gesprochen. Die beiden Ingenieure hatten Stillschweigen gelobt und erwarteten sie im Tunnel, bereit, das Schloss aufzubrechen und herauszufinden, was vor fast vierzig Jahren eine solche Geheimhaltung notwendig gemacht hatte.
»Wir sollten uns sputen«, sagte James und warf einen Blick auf seine Taschenuhr.
Archibald zeigte Verständnis. Da er aufgehalten worden war, hatten sie sich um mehr als eine Stunde verspätet. »Geh du voran.«
James trat geduckt durch die Tür und stieg flink die Stufen hinunter, während Archibald auf der schmalen, steilen Treppe seine Mühe hatte. James war nun mal fünfzehn Jahre jünger und verbrachte als Geologe mehr Zeit mit Feldforschung. Archibald war ein vierundfünfzigjähriger Dichter, der von Franklin D. Roosevelt ins Aufsichtsgremium berufen worden war – oder wie Archibald es seinerzeit formuliert hatte: Der Präsident hat beschlossen, dass ich Leiter der Kongressbibliothek werden will.
Er trat in den Gang, erhellt von drahtgittergeschützten Glühbirnen, die an einem Deckenkabel befestigt waren. Mehrere waren zerbrochen, und einige fehlten, sodass stellenweise Dunkelheit herrschte.
James schaltete eine dicke Taschenlampe ein und marschierte los.
Archibald folgte ihm. Obwohl der Gang hoch genug war, um aufrecht zu gehen, krümmte er den Rücken und senkte den Kopf, denn er wollte Abstand von den dunklen Rohren wahren, die an der Decke entlangliefen. Besonders in Anbetracht der darauf entlanghuschenden Tiere.
Nach einer Weile hielt James plötzlich an.
Archibald wäre beinahe gegen ihn geprallt. »Was ist …?«
Vor ihnen knallte es mehrfach laut.
James blickte sich um, die Augenbrauen besorgt zusammengezogen. »Schüsse.« Er schaltete die Taschenlampe aus und zog eine Pistole von Smith & Wesson aus dem Schulterhalfter unter seiner Arbeitsjacke. Archibald hatte nicht gewusst, dass sein Begleiter bewaffnet war, doch angesichts der Ratten im Tunnel erschien ihm das durchaus vernünftig.
»Geh zurück!« James reichte ihm die Taschenlampe, dann legte er beide Hände um den Griff der Waffe. »Hol Hilfe!«
»Wo? Die Burg ist um diese Uhrzeit menschenleer. Wenn es mir gelingt, Alarm zu schlagen, könnte es zu spät sein.« Archibald schwang die lange Taschenlampe wie einen Knüppel. »Wir bleiben zusammen.«
Eine gedämpfte Explosion entschied die Angelegenheit.
James verzog das Gesicht und übernahm die Führung. Er ging dicht an der Wand entlang und hielt sich nach Möglichkeit im Schatten. Archibald folgte seinem Beispiel.
Nach ein paar Schritten hüllte die von der Explosion hervorgerufene Staubwolke sie ein. Archibald kämpfte gegen den Hustenreiz, doch die Luft wurde bald wieder sauberer. Vom Gang konnte man das nicht sagen. Dunkle Tiere liefen über den Boden und die Deckenrohre.
Ratten … Hunderte.
Archibald unterdrückte einen Schrei und drückte sich flach an die Wand. Etwas fiel von oben herab, landete auf seiner Schulter und sprang fiepend auf den Boden. Andere Ratten huschten über seine Schuhe. Ein paar kletterten an seinen Hosenbeinen hoch wie an einem Baum im Überschwemmungsgebiet.
James ging unbeirrt weiter, ohne die umherwimmelnden Tiere zu beachten.
Archibald biss die Zähne zusammen und wartete, bis der Großteil der Horde ihn passiert hatte, dann eilte er seinem Freund hinterher.
Als sie zu einem unbeleuchteten Gangabschnitt gelangten, machten sie zwei auf dem Boden stehende Laternen aus. In deren Lichtschein zeichnete sich ein Toter ab.
Einer der beiden Ingenieure.
Weitere Schattengestalten gelangten von links in Sicht.
Drei maskierte Männer.
James ließ sich auf ein Knie nieder und feuerte, ohne zu zögern. Archibald zuckte vom lauten Knall zusammen, vorübergehend taub geworden.
Einer der Eindringlinge wirbelte herum und prallte gegen die Wand.
James richtete sich auf, feuerte einen weiteren Schuss ab und rannte los. Archibald stockte der Atem, dann stürmte auch er los. In dem darauf folgenden Tumult, erhellt von Mündungsblitzen, sah er, wie einer der Maskierten seinen verletzten Kumpel auf die Beine zu ziehen versuchte, doch James kannte keine Nachsicht und drückte im Laufen immer wieder ab. Querschläger prallten von Rohren und Betonwänden ab.
Der dritte Eindringling flüchtete durch den Tunnel und feuerte über die Schulter hinweg, in der anderen Hand eine schwere Tasche. Seine Schüsse verfehlten ihr Ziel, da ihm vor allem an der Flucht gelegen war. Sein Begleiter, bedrängt durch James’ Kugelhagel, ließ den am Boden liegenden Verletzten im Stich und folgte seinem Kumpan.
Als James und Archibald sich ihm näherten, wurden sie von einer zweiten Druckwelle getroffen. Flammen schlugen aus der Tür an der linken Seite.
Archibald schlug schützend den Arm vors Gesicht.
Gleich darauf erlosch das Feuer, und James übernahm wieder die Führung.
Als sie die Tür erreichten, verschaffte Archibald sich rasch einen Überblick. Der Ingenieur lag auf der Schwelle, getötet von einem Schuss in den Hinterkopf. Sein Kollege lag tot im Nebenraum, seine Kleidung brannte. Auch an der Rückwand loderten Flammen und verwandelten die kleine Betonkammer in einen Glutofen. Genährt wurden sie von einem brennenden Regal und den darin befindlichen Büchern. Brennende Buchseiten trudelten durch die raucherfüllte Luft.
James kümmerte sich um den am Boden liegenden Angreifer. Er klopfte die Flammen aus, dann durchsuchte er die Taschen.
Archibald blickte sich im Raum um. In der Mitte stand ein hüfthoher Marmorsockel. Daneben lag eine kleine offene Metalltruhe. Vermutlich war sie von der Druckwelle auf den Boden geschleudert worden. Die Truhe war anscheinend leer gewesen, abgesehen von dem Sand, der sich beim Aufprall auf den Boden ergossen hatte.
Er dachte an die schwere Tasche, die der flüchtende Mann bei sich gehabt hatte. Niedergeschlagen machte er sich klar, dass das, was Bell und dessen Gefolgsleute hier versteckt hatten, verschwunden war. Trotzdem hielt er sich den Arm vor Mund und Nase und drang in den Hitzeschwall vor, angelockt von etwas, das aus dem Sand hervorschaute.
Er trat um den toten Ingenieur herum, ging in die Hocke und ergriff den fraglichen Gegenstand. Offenbar handelte es sich um die Überreste eines alten Reisenotizbuchs oder Arbeitsjournals. Der lederne Einband war von einem früheren Feuer versengt worden. Ein rascher Blick ergab, dass die meisten Seiten verkohlt waren oder fehlten – jedoch nicht alle.
Die Diebe hatten das im Sand am Boden der Truhe verborgene Journal anscheinend übersehen. Mit seiner kostbaren Entdeckung zog er sich zurück.
»Sieh dir das mal an«, sagte James, als er in den Tunnel zurückkehrte.
James hatte sich hingehockt und dem Eindringling die Gesichtsmaske abgenommen.
Archibald reagierte mit Bestürzung. »Mein Gott … das ist eine Frau.«
Doch das war nicht die einzige Überraschung. Die Diebin hatte schwarzes Haar und breite Wangenknochen, und die schmalen, leblosen Augen verrieten ihre Herkunft.
»Eine Japanerin«, murmelte Archibald.
James nickte. »Vermutlich eine japanische Spionin. Aber ich wollte dir etwas anderes zeigen.« Er hob ihren Arm an. Das Handgelenk der Diebin war tätowiert. »Was hältst du davon?«
Archibald beugte sich vor und betrachtete das Symbol.
»Hast du eine Ahnung, was das bedeutet?«, fragte James.
Archibald blickte in den brennenden Raum hinein. Die verbeulte Tür lag auf dem Boden, von der Explosion aus den Angeln gerissen. Die Metallplakette funkelte im Feuerschein und bekräftigte die Warnung vor dem, was hier versteckt gewesen war.
… eine Gefahr sondergleichen.
»Nein«, sagte Archibald, »aber im Interesse unseres Landes – und vielleicht dem der ganzen Welt – müssen wir es herausfinden.«
Teil 1 Besiedlung
1
Gegenwart8. März, 15:45 BRTIlha da Queimada Grande, Brasilien
Der Tote lag mit dem Gesicht nach unten am Boden, zur Hälfte auf dem Sand, zur Hälfte im Gras.
»Der arme Kerl hätte es beinahe zurück zum Boot geschafft«, bemerkte Professor Ken Matsui.
Er machte der Teamärztin Ana Luiz Chavos Platz. Jeder, der offiziell seinen Fuß auf die Ilha da Queimada Grande setzte, eine dreißig Kilometer vor der brasilianischen Küste gelegene Insel, musste von einem Arzt und einem Vertreter der brasilianischen Marine begleitet werden.
Ihre Militäreskorte, Oberleutnant Ramon Dias, untersuchte das kleine Boot mit Außenborder, das ein paar Meter entfernt gut getarnt zwischen Felsblöcken lag. Er schnaubte geringschätzig und spuckte in die Wellen. »Caçador furtivo … idiota.«
»Er sagt, der Mann muss ein Wilddieb gewesen sein«, sagte Ken zu seinem Doktoranden. Sie waren von der Cornell University zu dieser abgelegenen Insel gereist.
Oscar Hoff war siebenundzwanzig, hatte einen kahl rasierten Kopf und machte einen ausgebufften Eindruck, doch das war alles nur Show eines Studenten, der sich von Äußerlichkeiten leiten ließ. Seiner blassen Gesichtsfarbe und seinem verzerrten Mund nach zu schließen, war dies der erste Tote, der ihm vor Augen gekommen war. Der Zustand des Toten tat sein Übriges. Der Leichnam war von Vögeln und Krabben verunstaltet worden. Der Sand ringsumher war mit schwarzem Blut getränkt.
Dr. Chavos machte der Zustand des Leichnams weit weniger zu schaffen. Sie untersuchte einen nackten Arm, dann hockte sie sich auf die Fersen. Sie unterhielt sich auf Portugiesisch mit Dias und sah zur tief stehenden Sonne. In wenigen Stunden würde es dunkel werden.
»Seit mindestens drei Tagen tot«, erklärte Ana Luiz und zeigte auf den linken Arm des Mannes. Vom Ellbogen bis zum Handgelenk war er schwärzlich verfärbt und nekrotisch. Durch das verflüssigte Gewebe schimmerte der Knochen hindurch.
»Bothrops insularis«, vermutete Ken und blickte über die Steine hinweg zum Regenwald hoch, der die Anhöhen der Hundert-Hektar-Insel krönte. »Die Insel-Lanzenotter.«
»Deshalb nennen wir den Ort auch Schlangeninsel«, sagte Diaz. »Die Insel gehört ihnen. Und das sollte man klugerweise respektieren.«
Die zahlreichen Ottern auf der Insel – und deren Status als gefährdete Tierart – waren der Grund, weshalb die brasilianische Marine nur eingeschränkten Zutritt zu Queimada Grande hatte. Alle zwei Monate kam sie hierher, um den Leuchtturm zu warten. Dessen Betrieb war automatisiert worden, nachdem die erste Familie von Leuchtturmwärtern – die Frau, der Mann und deren drei Kinder – gestorben waren. Ottern waren durch ein offenes Fenster eingedrungen, und als die Familie fliehen wollte, wurden sie von weiteren Schlangen gebissen, die entlang des Wegs zum Strand von den Baumästen hingen.
Seitdem war Touristen das Betreten der Insel untersagt. Allein Forschergruppen durften sie hin und wieder besuchen, jedoch nur in Begleitung eines mit dem Gegengift ausgerüsteten Arztes und einer Militäreskorte.
So wie heute.
Mit der Unterstützung japanischer Finanziers war es Ken gelungen, die Überfahrt noch vor dem für morgen vorausgesagten Unwetter zu organisieren. Er und sein Student waren überstürzt von ihrem Hotel in dem Küstenstädtchen Itanhaém aufgebrochen, um die Gelegenheit zu nutzen. Sie hatten es gerade noch rechtzeitig aufs Boot geschafft.
Ana Luiz richtete sich auf. »Wir sollten die beiden Exemplare fangen, verpacken und zum Festland zurückkehren, solange es noch hell ist.« Das Zodiac-Schlauchboot lag in einer nicht weit entfernten Sandbucht. »Wenn es dunkel wird, sollten wir hier weg sein.«
»Wir beeilen uns«, versprach Ken. »In Anbetracht der großen Zahl von Ottern auf der Insel sollte es schnell gehen.«
Er packte eine Stange mit Hakenende aus und gab seinem Studenten letzte Anweisungen. »Auf der Insel gibt es im Schnitt eine Schlange pro Quadratmeter. Also halten Sie sich zurück und überlassen Sie mir die Führung. Und vergessen Sie nicht, dass Sie jederzeit nur einen Schritt vom Tod entfernt sind, der unter einem Stein lauert oder von einem Baum hängt.«
Oscar blickte zum Toten am Strand. Von ihm ging die ausdrückliche Mahnung aus, besondere Vorsicht walten zu lassen. »Weshalb … weshalb sollte jemand das Risiko eingehen, allein hierherzukommen?«
»Eine einzige Inselotter bringt auf dem Schwarzmarkt bis zu zwanzigtausend Dollar«, beantwortete Ana Luiz seine Frage. »Manchmal auch mehr.«
»Tierschmuggel ist ein einträgliches Geschäft«, erklärte Ken. »Ich bin schon in allen möglichen Winkeln der Welt auf solche Biopiraten gestoßen.«
Und dieser Tote ist nicht der Erste, der für seine Geldgier mit dem Leben bezahlen musste.
Obwohl er gerade mal zehn Jahre älter war als sein Doktorand, hatte Ken viel Zeit mit Feldforschung zugebracht und viele Länder bereist. Er hatte jeweils einen Doktortitel in Entomologie und Toxikologie und die beiden Fächer zur Venomik verschmolzen, der Wissenschaft der Wirkstoffe giftiger Tiere.
Die Kombination der beiden Fächer erschien in Anbetracht seiner Herkunft besonders passend. Sein Vater war ein Japaner der ersten Generation gewesen und hatte als Kind in einem Internierungslager in Kalifornien gelebt, während Kens Mutter nach dem Krieg als junge Frau aus Deutschland ausgewandert war. Scherzhaft hatte es in ihrer Familie geheißen, sie hätten in der Vorstadt einen Vorposten der Achsenmächte gegründet.
Vor zwei Jahren waren sie innerhalb eines Monats beide gestorben und hatten Ken die helle Haut, das dichte dunkle Haar und die schmalen Augen hinterlassen.
Seine gemischte Herkunft – von den Japanern als hafu bezeichnet – hatte ihm geholfen, sein aktuelles Forschungsprojekt zu finanzieren. Die Reise nach Queimada Grande wurde teilweise vom japanischen Pharmakonzern Tanaka finanziert. Er beabsichtigte, aus dem Gift der Inselotter das nächste Wunderheilmittel zu gewinnen.
»Packen wir’s an«, sagte Ken.
Oscar schluckte mühsam und nickte. Er hantierte am verlängerbaren Schlangenfänger. Damit konnte man eine Schlange gefahrlos packen, doch Ken bevorzugte einen simplen Haken. Der Schlangenfänger setzte die Tiere unter Stress. Ging man zu aggressiv vor, konnte die Schlange zubeißen.
Als sie sich vom Strand entfernten, achteten sie darauf, wohin sie die bis zur Mitte der Wade reichenden Stiefel setzten. Der Sand machte alsbald steinigem Untergrund Platz, durchsetzt mit niedrigem Gebüsch. Fünfzig Meter hangaufwärts erstreckte sich der dunkle Rand des Regenwalds.
Hoffentlich müssen wir nicht da reingehen, um die Schlangen zu fangen.
»Suchen Sie im Gebüsch.« Ken streckte die Stange mit dem Haken vor und hob die unteren Äste eines Buschs an. »Aber versuchen Sie nicht, sie dort zu fixieren. Warten Sie, bis sie ins Freie kommt, und packen Sie sie dann.«
Oscars Schlangenfänger zitterte, als er Kens Beispiel folgte und sich einen Busch vornahm.
»Atmen Sie tief durch«, sagte Ken aufmunternd. »Sie schaffen das. Tun Sie genau das, was wir zu Hause im Zoo geübt haben.«
Oscar schnitt eine Grimasse und stocherte unter dem Busch herum. »Alles … alles klar.«
»Gut. Immer eins nach dem anderen.«
Sie setzten sich wieder in Bewegung, Ken ging voran. In gedämpftem Ton bemühte er sich, seinen Studenten zu beruhigen. »Früher glaubte man, Piraten hätten die Inselottern hierhergebracht, um einen vergrabenen Schatz zu schützen.«
Ana Luiz lachte leise, während Dias finster dreinschaute.
»Aber die Piraten waren es nicht, schätze ich«, sagte Oscar.
»Nein. Die Schlangen sind vor etwa elftausend Jahren hier gestrandet, als der Meeresspiegel stieg und die Landbrücke überflutete, welche die Insel mit dem Festland verband. Da sie hier keine natürlichen Feinde hatten, haben sie sich stark vermehrt. Aber die einzige Nahrung, die sie finden können, lebt in den Bäumen.«
»Vögel.«
»Die Insel liegt auf einer beliebten Wanderroute der Zugvögel, deshalb geht den Schlangen der Nachschub nicht aus. Aber die Vögel sind keine leichte Beute. Die Schlangen hatten Mühe, sie zu fangen, nachdem sie sie gebissen hatten. Deshalb haben sie ein Gift entwickelt, das fünf Mal so stark ist wie das ihrer Festlandverwandten.«
»Um die Vögel schneller zu töten.«
»Genau. Das Gift der Inselotter ist einzigartig und besteht aus einer Vielzahl von Toxinen. Es verflüssigt nicht nur das Fleisch, sondern führt auch zu Nieren- und Herzversagen und verursacht Blutungen des Gehirns und der inneren Organe. Gerade die hämotoxischen Komponenten des Gifts könnten bei der Entwicklung neuer Herzmedikamente hilfreich sein.«
»Und deshalb sind wir hier«, sagte Oscar. »Weil wir hoffen, das neue Captopril zu entdecken.«
Ken lächelte. »Jedenfalls hoffen das die hohen Herrschaften von Tanaka.«
Ganz so abwegig war das nicht. Captopril – ein sehr beliebtes Mittel gegen Bluthochdruck, ein Produkt von Bristol-Meyers Squibbs – wurde aus dem Gift einer nahen Verwandten der Inselotter isoliert: Bothrops jararaca, ebenfalls eine brasilianische Grubenotter.
»Und wer weiß, was wir sonst noch in dem Gift finden werden«, fügte Ken hinzu. »Prialt ist ein wundervolles Schmerzmittel, das vor Kurzem von Elan Pharmaceuticals auf den Markt gebracht wurde. Es wurde im Gift der Kegelschnecke gefunden. Dann gibt es da noch ein Protein, das aus dem Gift der Gila-Krustenechse gewonnen wird und als Wundermittel gegen Alzheimer gilt. Immer mehr Firmen in aller Welt investieren beträchtliche Mittel in die Entwicklung von Medikamenten aus natürlichen Giften.«
»Scheint eine gute Zeit für Toxikologen zu sein, die sich auf giftige Tiere spezialisieren.« Oscar grinste ihn an. »Vielleicht sollten wir eine eigene Firma gründen. Venoms ›R‹ Us.«
Ken stupste seinen Doktoranden spielerisch mit dem Schlangenhaken an. Dann bückte er sich und hob die unteren Zweige eines Buschs an. Etwas schoss hervor und huschte über die Steine. Oscar schrie auf und stolperte rückwärts. Er rempelte Ana Luiz an, worauf sie beide stürzten.
Die halbmeterlange Schlange hielt geradewegs auf ihre warmen Leiber zu.
Ken reagierte und hob die Schlange in der Körpermitte hoch, darauf bedacht, nicht zu viel Kraft aufzuwenden. Die Schlange erschlaffte am Haken, schwenkte den kleinen Kopf hin und her und züngelte.
Oscar versuchte wegzukriechen.
»Keine Angst. Das ist bloß ein weiterer Bewohner von Queimada Grande. Dipsas indica. Auch bekannt als Sauvages Schneckenfresser.« Er schwenkte die Schlange zur Seite. »Völlig harmlos.«
»Ich … ich dachte, sie wollte mich angreifen«, sagte Oscar, der vor Verlegenheit rot geworden war.
»Normalerweise ist dieser kleine Schneckenfresser gutmütig. Es ist schon eigenartig, dass er sich Ihnen genähert hat.« Ken verlängerte in seiner Vorstellung den Weg, den die Schlange verfolgt hatte. »Es sei denn, sie wollte lediglich zum Strand.«
Genau wie der Wilddieb …
Stirnrunzelnd blickte er in die entgegengesetzte Richtung, zu dem vor ihnen liegenden Felsgrat und dem dahinter befindlichen Wald. Er brachte die Schlange zum Stein zurück und gab sie frei, worauf sie ihre Flucht zum Sandstrand fortsetzte.
»Kommen Sie«, sagte Ken und stapfte den Hang hoch.
Hinter dem Felsgrat lag eine Sandmulde. Überrascht hielt Ken inne und ließ den unglaublichen Anblick auf sich wirken.
Auf den Steinen und Sandflächen wimmelte es von gelbgoldenen Leibern. Es waren hunderte. Ausnahmslos Inselottern, die Königinnen der Insel.
»Mein Gott …«, flüsterte Oscar, der merklich zitterte.
Ana Luiz bekreuzigte sich, während Diaz das Gewehr anlegte und in die Mulde zielte. Diese Vorsichtsmaßnahme war jedoch unnötig.
»Anscheinend sind alle tot«, sagte Ken.
Aber was hat sie getötet?
Keine der ein Meter langen goldfarbenen Schlangen bewegte sich. Und das galt nicht nur für die Ottern. In der Mulde lag mit dem Gesicht nach unten ein regloser Mensch.
Dias sagte etwas zu Ana Luiz. Ana nickte. Ken verstand ein wenig Brasilianisch und bekam deshalb mit, dass Dias glaubte, dies sei der Partner des Wilddiebs, den sie am Strand gefunden hatten. Jedenfalls waren beide Männer ähnlich gekleidet.
Obwohl keine unmittelbare Gefahr drohte, hielten alle vor der grauenhaften Szenerie wie festgewurzelt inne.
Oscar brach als Erster das Schweigen. »Atmet er noch?«
Ken kniff die Augen zusammen. Bestimmt nicht. Doch anscheinend waren die Augen seines Doktoranden schärfer als die der anderen. Die Brust des Mannes hob und senkte sich. Er atmete flach und stockend.
Ana Luiz fluchte verhalten und machte Anstalten, in die Mulde hinunterzusteigen, die Hand bereits am Notfallrucksack, den sie auf dem Rücken trug.
»Warten Sie«, sagte Ken. »Überlassen Sie mir den Vortritt. Ein paar Ottern könnten noch am Leben sein. Und selbst tote Schlangen können zubeißen.«
Ana Luiz blickte sich mit ungläubiger Miene zu ihm um.
»Es gibt zahllose Berichte von Leuten, die eine Klapperschlange oder Kobra enthauptet haben und gebissen wurden, als sie den Kopf aufgehoben haben. Noch Stunden später. Viele ektotherme Tiere – oder Kaltblüter – haben diesen Reflex.«
Er übernahm die Führung und beförderte jede einzelne Schlange mit dem Haken aus dem Weg. Langsam arbeitete er sich die Böschung hinunter. Die Inselottern waren anscheinend tatsächlich alle tot. Sie reagierten nicht auf seine Nähe, was in Anbetracht ihres aggressiven Wesens ein wichtiger Hinweis war.
Nach ein paar Schritten bemerkte er einen merkwürdigen Geruch. Es stank wie erwartet nach verwesendem Fleisch, jedoch einhergehend mit einer widerlichen Süße, wie von einer verrottenden Blume.
Aus irgendeinem Grund bekam er so starkes Herzklopfen, als reagiere er auf eine unmittelbare Gefahr.
Mit seinen geschärften Sinnen bemerkte er, dass es im angrenzenden Regenwald merkwürdig still war. Er hielt an und hob den Arm.
»Was ist los?«, fragte Ana Luiz.
»Zurück.«
»Aber …«
Er wich Schritt um Schritt zurück und drängte Ana Luiz vor sich her. Inzwischen konnte er das Gesicht des am Boden liegenden Mannes sehen. Die Augen fehlten. Die Nase war blutverkrustet, die Nasenlöcher verklebt.
Das war ein Leichnam. Trotzdem bewegte sich der Brustkorb – jedoch nicht deshalb, weil er atmete.
Irgendetwas steckt in ihm drin – etwas Lebendiges.
Er ging schneller, wagte aber nicht, den Toten aus den Augen zu lassen. Er hörte, wie Ana Luiz hinter ihm den Felsgrat erreichte. Aus dem Regenwald kam ein Geräusch. Ein leises Summen drang aus dem Schatten hervor und verursachte ihm eine Gänsehaut. Begleitet wurde es von einem eigentümlich hohlen Klopfen. Er hätte es gern Ästen zugeschrieben, die aneinanderstießen, doch es war windstill.
Er dachte an klappernde Knochen.
Als er den Felsgrat erreichte, war er außer Atem. »Wir müssen von hier ver…«
Eine Explosion schnitt ihm das Wort ab. Rechts von ihm, dort, wo das Schlauchboot lag, stieg ein Feuerball in den Himmel. Ein kleiner schwarzer Helikopter schoss durch den Rauch. Die an der Unterseite montierten Waffen spuckten Feuer. Kugeln trafen den Fels und warfen kleine Sandfontänen auf.
Oscar brach als Erster zusammen, über und über mit Blut bedeckt.
Diaz versuchte, das Feuer zu erwidern, wurde aber rückwärts geschleudert.
Ken warf sich in die Mulde. Er hatte einen Moment zu spät reagiert. Ein sengender Schmerz flammte in seiner Schulter auf. Die Wucht des Treffers schleuderte ihn durch die Luft. Er prallte auf den Boden und rollte die Böschung hinunter, mitten zwischen den kalten Leibern der Inselottern.
Als er zum Stillstand kam, blieb er regungslos liegen, halb unter Schlangen begraben. Der Helikopter knatterte vorbei, dann kehrte er im Bogen zurück.
Ken hielt den Atem an.
Schließlich flogen die Angreifer zum Strand zurück, vermutlich um sich zu vergewissern, dass das Schlauchboot zerstört war. Er lauschte, während das Knattern der Rotoren sich allmählich entfernte.
Flogen sie weg?
Ken wagte nicht, sich zu bewegen, obwohl das durchdringende Summen aus dem Regenwald immer lauter wurde. Er verlagerte den Kopf und blickte zu den Bäumen hinüber. Ein feiner Nebel – dunkler als die Schatten – wogte durchs Geäst und stieg zu den Baumkronen auf. Das merkwürdige Klopfen wurde lauter und immer heftiger.
Irgendetwas nähert sich …
Dann brach die Hölle los.
Mehrere Explosionen erschütterten den Wald, Feuerbälle stiegen in den Himmel. Die Donnerschläge der Explosionen breiteten sich in rascher Folge über das bewaldete Hochland der Insel aus. Ringsumher fielen brennende Holzstücke zu Boden. Schwarzer Rauch, erstickend und bitter, wogte über die Felsen und verschlang den Rest der Insel.
Hustend und nach Luft schnappend kroch Ken weiter.
Am Gaumen hatte er einen bitteren chemischen Geschmack.
Napalm … oder irgendein anderes brennbares Entlaubungsmittel.
Mit schmerzender Lunge krabbelte er aus der Mulde hervor und wälzte sich zum Strand hinunter. Er hielt aufs Wasser zu, auf das kleine Boot, das die Wilddiebe bei den Felsen versteckt hatten. Er hoffte, dass der Rauch ihn vor fremden Blicken schützen würde. Halb blind spürte er kühles Wasser an den Händen. Er wälzte sich ins Meer und watete zum Boot.
Hinter ihm breitete sich das Feuer aus und verzehrte die Insel, brannte die Vegetation bis aufs Felsfundament nieder.
Er erreichte das Boot, kletterte hinein und wälzte sich auf den Rücken. Er würde bis Sonnenuntergang warten, bevor er es wagte, das offene Wasser anzusteuern. Dann sollten die über den Wellen hängende Rauchwolke und die Dunkelheit ihn vor neugierigen Blicken aus der Luft schützen.
Wenigstens hoffte er das.
Bis dahin würde ihm seine schmerzende Schulter helfen, wach zu bleiben, und ein Verlangen nähren, das in seinem Innern so heftig loderte wie der Feuersturm auf der Insel.
Er drückte die dicke Tasche an seine Brust.
Darin waren die toten Inselottern, die er eingesammelt hatte, bevor er geflüchtet war.
Ich werde herausbekommen, was hier geschehen ist.
2
4. Mai, 8:38 JSTTokio, Japan
Der alte Mann kniete im Tempelgarten. Er hatte die traditionelle Seiza-Haltung eingenommen, mit geradem Rücken auf den Fersen sitzend. Den Schmerz in seinen neunzig Jahre alten Knien beachtete er nicht. Hinter ihm lag die alte Pagode von Kan’ei-ji, geschmückt mit den letzten Kirschblüten des Frühlings. Vor drei Wochen hatten die Festlichkeiten ihren Höhepunkt erreicht, und in dem Tokioter Park hatte es von Touristen gewimmelt, welche die wundervolle Harmonie der Kirschblüte bewunderten und fotografierten.
Takashi Ito bevorzugte die letzten Tage der Saison. Dann lag Melancholie in der Luft, ein Echo der Traurigkeit seines Herzens. Mit einem kleinen Fächer entfernte er die vertrockneten, spröden Blüten von dem hüfthohen Stein vor seinen Knien.
Damit störte er die Rauchfahnen, die von einem kleinen Räuchergefäß am Fuße des Steins aufstiegen. Der wohlriechende Rauch stammte von einer Mischung von Kyara, einem Duftholz, und Koboku, dem Extrakt der Magnolienrinde. Er wedelte die Rauchfahnen zu sich heran, denn er wollte den ihnen innewohnenden Segen und das Mysterium spüren.
Wie so häufig in diesem Moment, kamen ihm ein paar Zeilen von Otagaki Rengetsu in den Sinn, einer buddhistischen Nonne des neunzehnten Jahrhunderts.
Ein einzelner Schwaden
Duftender Dunst
Eines Räucherstäbchens
Verweht ohne Spur:
Wo geht er hin?
Sein Blick folgte einer langen emporsteigenden Rauchfahne, bis sie verschwand und nur ihren süßen Duft zurückließ.
Er seufzte.
So wie du vor vielen Jahren, meine geliebte Miu.
Er schloss die Augen und betete. Jedes Jahr kam er an ihrem Hochzeitstag hierher. Damals hatte Miu sein Herz im Geheimen mit dem ihren verbunden. Sie waren erst achtzehn gewesen, voller Hoffnung für ihr gemeinsames Leben, verbunden durch Liebe wie durch Zweckbestimmung. Zehn Jahre lang hatten sie gemeinsam trainiert und die Fertigkeiten geschult, die sie brauchen würden. In dieser harten Zeit hatten sie ihre Erfolge gefeiert und die Verletzungen versorgt, die ihre strengen Lehrmeister ihnen zufügten. Wegen ihrer komplementären Begabung waren sie ein Paar geworden. Er war der unnachgiebige Stein; sie war strömendes Wasser. Er war Donner und Kraft; sie war Stille und Schatten.
Sie hielten sich für unbesiegbar, besonders dann, wenn sie zusammen waren.
Eingedenk ihrer jugendlichen Dummheit verzog er die Lippen.
Er schlug die Augen auf und inhalierte den letzten Rauch, der vom Räuchergefäß aufstieg. Die Kyara-Späne hatten sich in Asche verwandelt. Kyara war kostbarer als sein Gewicht in reinem Gold.
Jedes Jahr verbrannte er Kyara in Gedenken an Miu.
Dieser Jahrestag aber war etwas Besonderes.
Er betrachtete die qualmenden Koboku-Räucherstäbchen auf dem Teller aus Glimmer. Das Verbrennen von Koboku war eine jahrhundertealte Tradition der Samuraikrieger, die dazu diente, vor dem Kampf Geist und Körper zu reinigen. Auf diese Weise verband er seine Liebe zu Miu mit einem alten Versprechen.
Ihren Tod zu rächen.
Er sah auf den Stein nieder, beschriftet mit uralten Zeichen. Dies war nicht das Grab seiner Frau. Ihr Leichnam war für immer verloren. Den Granitblock hatte Takashi wegen der eingravierten Zeilen, die ihr Urgroßvater Sessai Matsuyama im Jahr 1821 verfasst hatte, als Grabsteinersatz ausgewählt.
Ihr Ahne hatte den Stein in diesem buddhistischen Park platziert, um die Geister derer zu versöhnen, die er getötet hatte. Sessai war ein großer Förderer der Wissenschaften gewesen und hatte viele Bücher und Manuskripte in Auftrag gegeben, darunter das Chuchi-jo, eine anatomische Studie der Insekten, die wegen ihrer Zeichnungen von Schmetterlingen, Grillen, Heuschrecken und Fliegen inzwischen als nationaler Schatz galt, Beleg dafür, dass Schönheit selbst bei den kleinsten Lebewesen zu finden war. Um das Buch zu vollenden, waren viele Insekten im Dienst der Wissenschaft gefangen und mit einer Nadel getötet worden. Aus schlechtem Gewissen hatte Sessai Matsuyama den Stein aufgestellt, um ihrer zu gedenken, ihren Beitrag zur Wissenschaft zu ehren und seine karmische Last ein wenig zu erleichtern.
Miu war mit Takashi oft hier gewesen. Sie hatte gehofft, sie werde irgendwann, inspiriert von der Leidenschaft ihres Urgroßvaters, in seine Fußstapfen treten. Die Schüsse aber hatten ihren arglosen Traum in Rauch aufgehen lassen.
Er schob den Hemdsärmel hoch und entblößte sein Handgelenk. Seine Haut war an der Innenseite papierdünn geworden und vermochte das Zeichen nicht mehr zu fixieren, das Mius weiche Haut an der gleichen Stelle geschmückt hatte. Es stellte Werkzeuge dar, angeordnet um einen Halbmond und einen schwarzen Stern. Es war eine Ehre, dieses Zeichen zu tragen, Beweis dafür, dass sie die Ausbildung ihrer Meister, der geheimnisvollen Kage,überlebt hatten. Er hatte sie aufs Handgelenk geküsst, nachdem man ihr das Zeichen eintätowiert hatte, und versucht, ihr mit seinen Lippen den Schmerz der Nadel zu nehmen. Diese Geste hatte sie ebenso eng miteinander verbunden wie ihre geheime Heirat.
Jetzt aber verblasste sogar die Erinnerung an Miu.
Er ließ den Ärmel wieder herabrutschen und schaute zu, wie das Feuer den letzten Rest des Räucherwerks verzehrte und die wohlriechenden Rauchfahnen sich auflösten.
Wo geht er hin?
Er hatte keine Antwort darauf. Er wusste bloß, dass er Miu unwiederbringlich verloren hatte. Sie war bei ihrem ersten Einsatz gestorben, als sie versucht hatten, ihrem Gegner einen Schatz vor der Nase wegzuschnappen. Mit brennender Scham erinnerte er sich, wie er in einem dunklen Tunnel ihren Leichnam im Stich gelassen hatte und geflüchtet war, vertrieben von den Schüssen des Gegners und angetrieben von dem Wunsch, dafür zu sorgen, dass ihr Opfer nicht sinnlos gewesen war.
Es gelang ihm, den Einsatz erfolgreich abzuschließen. Später, als er erfuhr, was er da aus dem verfluchten Tunnel geborgen hatte, fasste er es als Omen auf. Sein Blick wanderte über die in den Gedenkstein eingravierten Zeilen. Miu würde niemals in die Fußstapfen ihres Ahnen treten, doch Takashi hatte die Stafette von ihr übernommen.
Mit einer kleinen Verneigung richtete er sich auf. Seine beiden Bediensteten wollten ihm helfen, doch er hatte seinen Stolz, winkte ab und schaffte es aus eigener Kraft. Allerdings ließ er sich den Stock anreichen, als er wieder aufrecht stand. Er legte die knochigen Finger um den rotgoldenen Knauf, der Schnabel und Feuerhaube des Phönix darstellte.
Es hatte jahrzehntelanges Studium und die Bildung erheblicher Rücklagen erfordert, doch nun würde er Rache üben und Japans alte Herrlichkeit wiederherstellen – und um dieses Ziel zu erreichen, würde er den Schatz einsetzen, der Miu das Leben gekostet hatte.
Zufrieden wandte er sich um und ging durch den Park zurück zur Pagode. Das Klackern seines Stocks war im Einklang mit seinem hämmernden Herzen. Der Tempel von Kan’ei-ji war im siebzehnten Jahrhundert errichtet worden. Das Gelände hatte früher einmal den angrenzenden Ueno-Park eingeschlossen, in dem jetzt der Zoo und die Nationalmuseen lagen. Der Niedergang des Tempels hatte 1869 begonnen, als der japanische Kaiser die letzten Shogune der Tokugawa-Dynastie angegriffen hatte, die nach einem Umsturzversuch im Tempel Zuflucht gesucht hatten. Kugeln der Belagerer steckten noch immer in Teilen der Holzwände.
Nur wenige Besucher fanden jetzt noch den Weg zum Tempel, seine blutige Vergangenheit war so gut wie vergessen.
Ich aber werde dafür sorgen, dass die im Krieg erniedrigte Nation sich ihrer glorreichen Vergangenheit erinnert.
Er ging um die Pagode herum und kam an einem großen Kirschbaum vorbei. Aufgestört durch seine Schritte, fielen die letzten Blüten herab, als ob Miu ihn grüßte. Mit leisem Lächeln ging er zur Straße weiter, wo sein Wagen wartete. Mit einer Hand auf den Stock gestützt, rieb er mit dem Daumen über die Tätowierung an seinem Handgelenk.
Es wird nicht mehr lange dauern.
Schon bald würde er sich Miu anschließen – zuvor aber wollte er Rache üben und dem Kaiserreich seinen rechtmäßigen Platz als Herrscher der Welt verschaffen.
Als er im Wagen Platz genommen hatte, schweiften seine Gedanken wie stets am Jahrestag ihrer Hochzeit in die Vergangenheit. Er und Miu waren beide illegitime Kinder von Aristokraten gewesen. Ausgestoßen wegen Vergehen anderer, waren sie von ihren Familien getrennt worden und schließlich bei den Kage gelandet. Miu war an sie verkauft worden. Takashi hatte sie aus Verbitterung selbst aufgesucht.
Damals wusste die Öffentlichkeit nur wenig über die Kage, was »Schatten« bedeutet. Die verschiedensten Gerüchte waren über sie in Umlauf. Manche hielten sie für die Abkömmlinge eines entehrten Ninja-Clans; andere glaubten, sie seien Gespenster. Irgendwann aber erfuhr Takashi die Wahrheit. Der Ursprung der Geheimorganisation lag in der fernen Vergangenheit. Die Kage hatten viele Namen und traten je nach Land in unterschiedlichen Erscheinungsformen auf. Ihr Zweck aber bestand darin, stärker zu werden, in allen Ländern Wurzeln zu schlagen und mit dunkler Alchemie und später auch Wissenschaft ihre Ziele zu verwirklichen. Sie waren die Schatten hinter der Macht.
Als in Japan der Krieg ausbrach, traten die Kage vorübergehend öffentlicher in Erscheinung und nutzten die Gelegenheiten, die das Chaos bot. Vor allem wurden die Kage von dem vergossenen Blut und dem Schmerz der Insassen geheimer Lager angezogen, in denen die Moral keine Geltung hatte. Die kaiserliche Armee hatte im Norden Chinas geheime Forschungsstätten errichtet – erst in der Zhongma-Festung, dann in Pingfang – und sich auf die Entwicklung biologischer und chemischer Waffen spezialisiert. Zu diesem Zweck griff die Armee Dorfbewohner auf, die sich zu den Russen und anderen Kriegsgefangenen gesellten. Dreitausend japanische Wissenschaftler experimentierten mit den unfreiwilligen Versuchsobjekten. Sie infizierten sie mit Anthrax und Beulenpest und sezierten sie ohne Betäubung. Sie fügten den Gefangenen Erfrierungen zu. Sie vergewaltigten die Frauen und infizierten sie mit Syphilis. Sie erprobten Flammenwerfer an Männern, die an Pfosten gefesselt waren.
In diesen Einrichtungen wirkten die Kage im Verborgenen, vorgeblich, um zu helfen, vor allem aber, um sich die bei den abscheulichen Experimenten gewonnenen Erkenntnisse zunutze zu machen.
Damals erfuhren die Meister der Kage von der Entdeckung eines Geheimnisses, das eigentlich als verloren galt. Jahrhunderte zuvor hatten sie versucht, es in ihren Besitz zu bringen – eine potenzielle Waffe wie keine andere –, doch es war ihnen nicht gelungen. Jetzt, als entsprechende Nachrichten aus Amerika kamen, ergab sich eine neue Chance. Gegen Ende des Jahres 1944 wurde ein kleines Team von fließend Englisch sprechenden Japanern damit beauftragt, es zu rauben.
Der Einsatz verlief erfolgreich, kostete aber Miu das Leben.
Bedauerlicherweise endete bald darauf der Krieg, als die beiden Atombomben auf Japan fielen, die eine auf Hiroshima, die andere auf Nagasaki. Takashi hielt es für möglich, dass der Diebstahl im Untergrund ihrer Hauptstadt die Amerikaner zu dieser extremen Vorgehensweise motiviert hatte.
Letztlich aber war es bedeutungslos.
Nach dem Krieg hatte Takashi das Diebesgut, einen Bernsteinklumpen, in Sicherheit gebracht. Damals wäre es zu gefährlich gewesen, das darin verborgene Geheimnis zu nutzen. Jahrzehnte wissenschaftlicher Forschung waren nötig gewesen, eine lange Zeit auch für die Kage.
Vor ein paar Jahren hatten die Amerikaner das Geheimnis der Organisation gelüftet und Licht ins Dunkel ihrer Umtriebe gebracht, doch im Licht verkümmerten Schatten und starben. Inzwischen war Takashi in den Reihen der Kage so weit aufgestiegen, dass er auch deren andere Namen erfahren hatte, darunter auch den, den die Amerikaner verwendeten.
Die Gilde.
Bei der anschließenden Säuberungsaktion waren verschiedene Gruppierungen der Schattenvereinigung enttarnt und vernichtet worden, doch Teile davon hatten überlebt. Darunter ein neunzigjähriger Mann, den kaum jemand für eine Bedrohung gehalten hätte. Andere Überlebende hatten sich zerstreut und waren untergetaucht. Seitdem hatten Takashi und sein Enkel im Geheimen die Samen gesammelt, ihre eigene Samuraitruppe aufgebaut und abgewartet.
Und jetzt, nach gründlichen Studien in abgelegenen Labors und Feldversuchen in Übersee, hatten sie eine Waffe von unermesslicher Stärke und Bösartigkeit entwickelt.
Außerdem hatten sie sich aufs erste Ziel festgelegt, gedacht als Demonstration der Stärke und als Schlag gegen die Organisation, welche die Gilde vernichtet hatte.
Genau genommen ging es um zwei Agenten, die an deren Niedergang wesentlichen Anteil hatten.
Als die Limousine sich in den Verkehr einfädelte, lächelte Takashi. Er fühlte sich schwerelos, denn der Ort, an dem die beiden sich gegenwärtig verkrochen hatten, war ein bedeutsames Vorzeichen. Dort hatte das japanische Kaiserreich den ersten vernichtenden Schlag gegen einen schlafenden Riesen geführt – und dort würde Takashi das Gleiche tun.
Die Vernichtungsaktion würde das, was die Inseln in der Vergangenheit befallen hatte, in den Schatten stellen. Der erste Angriff würde das Ende der gegenwärtigen Weltordnung ankündigen und die schmerzhafte Geburt einer neuen Ordnung einleiten, in der das japanische Kaiserreich auf ewig herrschen sollte.
Gleichwohl vergegenwärtigte er sich die beiden Zielpersonen.
Liebende, so wie Miu und ich.
Die beiden wussten bloß noch nicht, dass sie gleichermaßen todgeweiht waren.
3
6. Mai, 17:08 HSTHana, Insel Maui
So soll es sein …