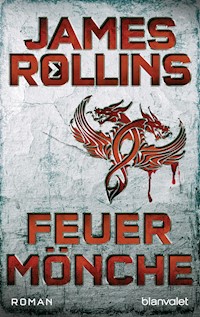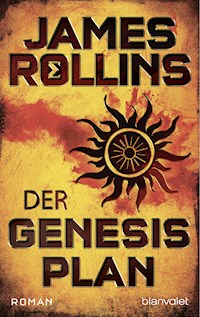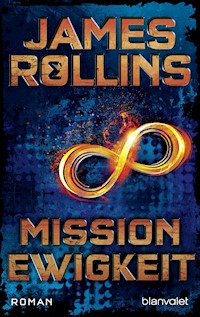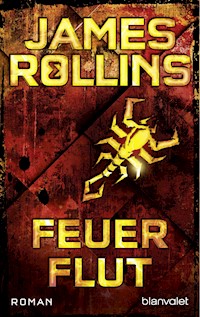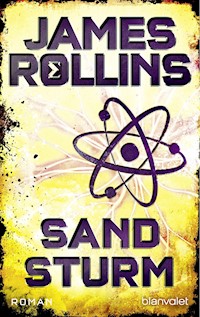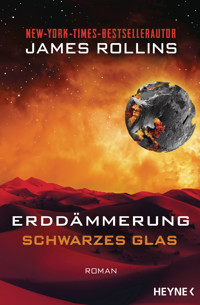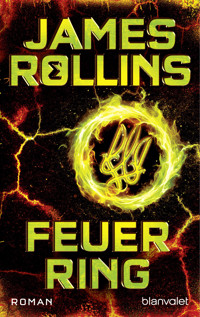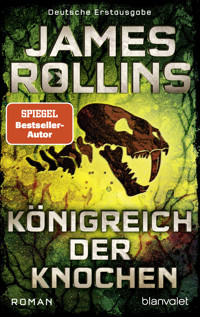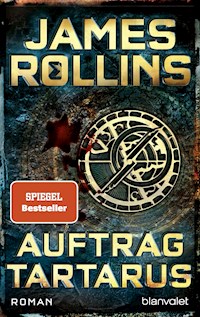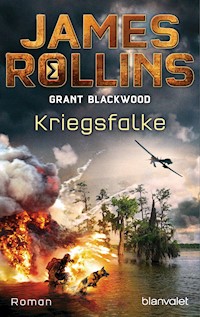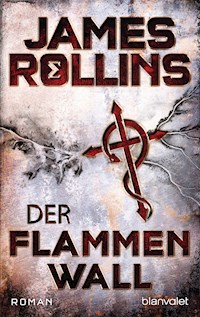
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: SIGMA Force
- Sprache: Deutsch
»›Der Flammenwall‹ ist wie eine Achterbahnfahrt: vom Technothriller über medizinischen Spannungsroman bis hin zur wilden Ballerei.« St. Louis Post-Dispatch
Durch die Ermordung mehrerer Wissenschaftlerinnen gelangen fanatische Terroristen, die sich für die Nachfolger der Inquisition halten, in den Besitz einer schrecklichen Waffe. Mit ihr sind sie ihrem Ziel, die Welt erneut unter die Herrschaft des Glaubens und der Inquisition zu zwingen, einen großen Schritt näher. Doch Grayson Pierce und die Top-Agenten des wissenschaftlichen Geheimdienstes Sigma Force setzen alles daran, sie aufzuhalten. Noch nie war für Grayson und seine Gefährten der Einsatz so groß. Es geht nicht nur um das Schicksal der Menschheit – es geht um das Leben ihrer eigenen Kinder!
Verpassen Sie nicht die weiteren in sich abgeschlossenen Romane über die Topagenten der Sigma Force!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Durch die Ermordung mehrerer Wissenschaftlerinnen gelangen fanatische Terroristen, die sich für die Nachfolger der Inquisition halten, in den Besitz einer schrecklichen Waffe. Mit ihr sind sie ihrem Ziel, die Welt erneut unter die Herrschaft des Glaubens und der Inquisition zu zwingen, einen großen Schritt näher. Doch Grayson Pierce und die Top-Agenten des wissenschaftlichen Geheimdienstes Sigma Force setzen alles daran, sie aufzuhalten. Noch nie war für Grayson und seine Gefährten der Einsatz so groß. Es geht nicht nur um das Schicksal der Menschheit – es geht um das Leben ihrer eigenen Kinder!
Autor
Neueste Technologiekenntnisse und fundierte wissenschaftliche Fakten, genial verknüpft mit historischen und mythologischen Themen – all das macht die Abenteuerthriller von James Rollins zum einzigartigen Leseerlebnis. Der passionierte Höhlentaucher James Rollins betreibt eine Praxis für Veterinärmedizin in Sacramento, Kalifornien.
Von James Rollins bei Blanvalet erschienen:
Der Genesis-Plan, Feuermönche, Sandsturm, Der Judas-Code, Das Messias-Gen, Feuerflut, Mission Ewigkeit, Das Auge Gottes, Projekt Chimera, Das Knochenlabyrinth, Die siebte Plage, Die Höllenkrone, Der FlammenwallTucker WayneKillercode, KriegsfalkeDie Bruderschaft der Christuskrieger:
Das Evangelium des Blutes, Das Blut des Verräters, Die Apokalypse des BlutesAußerdem:
Sub Terra, Im Dreieck des Drachen, Das Flammenzeichen, Operation Amazonas, Das Blut des Teufels
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
James Rollins
Der Flammenwall
Roman
Aus dem Englischen von Norbert Stöbe
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Crucible (Sigma Force 14)« bei William Morrow, New York. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2019 by Jim Czajkowski
Published by agreement with the author,
c/o Baror International, Inc. Armonk, New York, U.S.A.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021
by Blanvalet Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (MysticaLink; Munimara; Eky Studio; Gordan; donatas1205)
Abbildungen: © Jim Czajkowski (1, 2, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7, 8); © Shutterstock (9, 10a, 10b, 10c, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 21, 22); © Wikipedia Commons: (23, 24, 25, 26, 27); © Pexels (28, 29, 30, 31, 32, 33, 34); © Steven Prey (Karte)
Redaktion: text in form / Gerhard Seidl
KW · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-26933-3V001www.blanvalet.de
Gewidmet Chuck und Cindy Bluth, zum Dank für jahrelange Freundschaft, Unterstützung und vor allem beständige Großzügigkeit.
Was wir erschaffen werden, wird im Grunde ein Gott sein. Kein Gott in dem Sinn, dass er Blitz und Donner heraufbeschwören kann. Aber wenn etwas dem Menschen an Intelligenz unendlich überlegen ist, als was sonst soll man es bezeichnen? … (Und) diesmal wird man mit Gott sprechen können, und man wird wissen, dass er einem zuhört.
Anthony LevandowskiEhemaliger Google-Manager und Gründer von Way of the Future, einer neuen Kirche, die künstliche Intelligenz zur Religion erhebt (aus einem Interview von Mark Harris, Backchannel/Wired, 15. November 2017: »Inside der First Church of Artificial Intelligence«)
Mit künstlicher Intelligenz beschwören wir den Dämon herauf.
Elon MuskAuf dem Symposium zur Hundertjahrfeier des Fachbereichs für Luft- und Raumfahrt des MIT, 2014
Vorbemerkung zum historischen Hintergrund
Eu non creo nas meigas, mais habelas, hainas.
Ich glaube nicht an Hexen, aber es gibt sie.
Altes galizisches Sprichwort
Von Februar 1692 bis März 1693 wurden im kolonialen Massachusetts zwanzig Personen – darunter vierzehn Frauen – wegen Hexerei angeklagt und zum Tode verurteilt. Die berüchtigten Hexenprozesse von Salem haben zwar einen unauslöschlichen Platz in der Geschichtsschreibung, waren jedoch lediglich das letzte Aufbäumen der Hysterie am Ende der großen Hexenjagd, die bereits über Europa hinweggefegt war. Die Verfolgung währte fast drei Jahrhunderte, und insgesamt wurden über sechzigtausend »Hexen« verbrannt, erhängt oder ertränkt.
Das ganze Blutvergießen und Töten begann ziemlich unvermittelt im fünfzehnten Jahrhundert und geht auf die Veröffentlichung eines Buches zurück, eines Handbuchs für Hexenjäger mit dem Titel Malleus Maleficarum (was Hexenhammer bedeutet). Publiziert wurde es im Jahr 1487 vom deutschen katholischen Geistlichen Heinrich Kramer, und die Kölner Universität und Papst Innozenz VIII. gaben ihm ihren Segen. Da kurz zuvor die Druckerpresse erfunden worden war, konnte man das Buch rasch vervielfältigen und in Europa sowie Nord- und Südamerika verbreiten. Es wurde zur »Bibel« der Inquisitoren und Ankläger und half ihnen, Hexen zu erkennen, zu foltern und zu töten, wobei das Augenmerk vor allem ketzerischen Frauen galt. Viele Wissenschaftler halten es für eines der am stärksten blutgetränkten Bücher und vergleichen es gar mit Hitlers Mein Kampf.
Vor der Publikation des Handbuchs war die Beziehung zwischen Hexen und Christentum jedoch nicht so eindeutig, wie es auf den ersten Blick scheint. Ursprünglich wurden Hexen nicht durchweg diffamiert. Im Alten Testament sucht König Saul die Hexe von Endor auf und lässt von ihr den Geist des verstorbenen Propheten Samuel heraufbeschwören, und im Mittelalter waren Hexen häufig erfahrene Heilerinnen, die nach alter Tradition heilkräftige Kräuter sammelten. Selbst während der spanischen Inquisition wurden vor allem Ketzer – und nicht Hexen – verfolgt und gefoltert.
Ein weiterer Beleg für die unscharfe Abgrenzung von Hexen und katholischer Kirche ist der Kult der heiligen Kolumba, der im Mittelalter in Spanien aufblühte, hauptsächlich in Galizien im Norden des Landes, das als Bastion der Hexen galt. Kolumba war eine Hexe aus dem neunten Jahrhundert, die dem Geist Christi begegnet ist. Er sagte ihr, sie könne erst dann in den Himmel eingehen, wenn sie zum Christentum konvertiere, und das tat sie auch, blieb aber Hexe. Schließlich wurde sie zur Märtyrerin und wegen ihres Glaubens geköpft, woraufhin sie als Schutzheilige der Hexen bekannt wurde. Bis zum heutigen Tag dient sie als Beschützerin der Hexen, setzt sich für gute Hexen ein und kämpft gegen jene, die ihr Handwerk zu bösen Zwecken missbrauchen.
Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eine Kerze für die heilige Kolumba zu entzünden, denn wir stehen an der Schwelle eines neuen Zeitalters der Hexerei.
Vorbemerkung zum wissenschaftlichen Hintergrund
Jede ausreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie ununterscheidbar.
Arthur C. Clarke, 1962Aus dem Essay »Hazards of Prophecy: The Failure of Imagination«
Lassen Sie uns über das Ende der Menschheit sprechen – zumal wir schon bald in der Angelegenheit vielleicht nicht mehr viel zu sagen haben werden. Am Horizont lauert eine große Gefahr, die vermutlich noch zu unseren Lebzeiten virulent werden wird. Der weltbekannte Physiker Stephen Hawking beschrieb die bevorstehende Krise als das »schlimmste Ereignis in der Geschichte der Zivilisation«. Elon Musk glaubt, dass es zum Dritten Weltkrieg führen wird. Selbst der russische Präsident hat erklärt, wer die Kontrolle über dieses Ereignis habe, werde die Welt beherrschen.
Mit dem Ereignis ist die erste wahrhaft menschenähnliche künstliche Intelligenz (KI) gemeint.
Ein solcher Wendepunkt ängstigt die Machthaber. Im Februar 2018 wurde bei einem geheimen Treffen des Weltwirtschaftsgipfels über die Entwicklung von KI diskutiert. Daran nahmen Vertreter von IBM, Microsoft, Facebook und Amazon teil sowie Regierungsvertreter aus Europa, Russland, Singapur, Australien und den arabischen Staaten. Es herrschte Einmütigkeit darüber, dass unsere Existenz auf dem Spiel steht, doch vor allem gelangten die Teilnehmer zu dem Schluss, dass internationale Regulierungen die Entwicklung einer selbstbewussten KI nicht aufhalten würden. Alle Gegenmaßnahmen wurden als »nicht realisierbar« eingeschätzt, zumal die Geschichte gezeigt hat, dass Verbote von Firmen oder Organisationen, die in abgelegenen Gegenden im Geheimen operieren, leicht zu umgehen sind.
Wie nahe sind wir also dem Auftreten einer neuen Intelligenz auf unserem Planeten? Verschiedene Formen von KI sind bereits in unser Leben eingesickert. Sie arbeiten in unseren Computern, unseren Handys und sogar in unseren Haushaltsgeräten. Fast siebzig Prozent der Käufe und Verkäufe an der Wall Street werden derzeit ohne menschliche Einwirkung ausgeführt, und zwar in weniger als drei Millisekunden. KI ist so allgegenwärtig, dass wir sie gar nicht mehr als KI wahrnehmen. Der nächste Entwicklungsschritt, da ein Computer eine dem Menschen vergleichbare Intelligenz und ein Selbstbewusstsein haben wird, nähert sich jedoch rasch. Kürzlich ergab eine Umfrage, dass zweiundvierzig Prozent der Computerexperten glauben, dass dieses Ereignis innerhalb eines Jahrzehnts eintreten wird, während die andere Hälfte glaubt, es sei schon in fünf Jahren so weit.
Weshalb aber stellt dieses Ereignis eine solche Krise dar? Weshalb ist es »das schlimmste Ereignis in der Geschichte der Zivilisation«? Weil die erste menschenähnliche Intelligenz nicht untätig sein, sondern sich als ausgesprochen umtriebig erweisen wird. In kurzer Zeit – binnen Wochen, Tagen oder vielleicht sogar Stunden – wird sie sich zu einer unbegreiflichen Superintelligenz fortentwickeln, einer uns weit überlegenen Wesenheit, die mit Menschen vermutlich nur wenig anfangen kann. Wenn es dazu kommt, lässt sich nicht vorhersagen, ob die Superintelligenz ein wohlwollender Gott oder ein gefühlskalter, zerstörerischer Teufel sein wird.
Trotzdem wird es eine solche Wesenheit geben. Sie lässt sich nicht verhindern. Manche glauben sogar, es gäbe sie bereits. Und deshalb möchte ich eine letzte Warnung aussprechen: Im Zentrum dieser Geschichte ist ein Fluch verborgen. Es könnte Ihr Verderben sein, wenn Sie weiterlesen.
Wenn Sie fortfahren, bitte auf eigene Gefahr.
23. Juni, im Jahre des Herrn 1611Zugarramurdi, Spanien
Hinter den Eisenstäben kniete der Hexer auf einem schmutzigen Strohlager und betete zu Gott.
Alonso de Salazar Frías ließ den ungewöhnlichen Anblick auf sich wirken. Der Inquisitor vermochte die Gestalt kaum zu erkennen. In der Zelle war es dunkel, nur die lodernden Flammen auf dem Dorfplatz spendeten ein wenig Licht. Durch den Fensterschlitz strömte auch der Gestank von verbranntem Fleisch herein, während der Feuerschein unheimlich über die Steinwände tanzte.
Er lauschte auf das lateinische Gemurmel des Hexers, betrachtete seine gefalteten Hände, den geneigten Kopf. Er kannte das Gebet, Anima Christi, verfasst von Ignatius von Loyola, dem Begründer der Gesellschaft Jesu. In Anbetracht dessen, dass der Mann ein Jesuitenpriester war und dem gleichen Orden angehörte, war das Gebet passend.
Im Stillen übersetzte Alonso das Gebet: Ruf mich in meiner letzten Not, und setz mich neben dich, mein Gott, dass ich mit deinen Heilgen all’n, mög ewiglich dein Lob erschall’n.
»Amen«, sagte Alonso laut, wodurch er die Aufmerksamkeit des angeklagten Hexers auf sich lenkte.
Er wartete, bis der Mann sich aufgerichtet hatte. Obwohl er sicherlich nicht älter war als der siebenundvierzigjährige Alonso, knackten die Gelenke des Priesters. Sein Gesicht war eingefallen und stellenweise wund. Die Gefängniswärter hatten ihm den Kopf geschoren, wobei es zu Abschürfungen gekommen war.
Obwohl er wusste, dass dies ein Gottesmann war, dem Ketzerei und Hexerei vorgeworfen wurden, verspürte Alonso einen Anflug von Mitleid angesichts seines jämmerlichen Zustands. Alonso war vom Großinquisitor persönlich in dieses kleine Baskendorf entsandt wurden, um das Verfahren zu leiten. Er hatte eine Woche gebraucht, um die Pyrenäen zu überqueren und in diese kleine Ansammlung von Häusern und Gehöften in der Nähe der französischen Grenze zu gelangen.
Der Priester humpelte zu den Gitterstäben und umklammerte sie mit seinen knochigen Fingern, die vor Schwäche zitterten.
Wann hat man dem Mann zum letzten Mal zu essen gegeben?
Die Stimme des Jesuiten aber war fest. »Ich bin kein Hexer.«
»Das muss ich entscheiden, Pater Ibarra. Ich habe die Anklagepunkte gelesen, die gegen dich erhoben werden. Dir wird vorgeworfen, Hexerei praktiziert und Kranke mit Zaubermitteln und Amuletten geheilt zu haben.«
Der Priester schwieg einen Moment, bevor er antwortete. »Ich weiß auch einiges über dich, Inquisitor Frías. Ich kenne deinen Ruf. Du warst bei den Hexenprozessen, die vor zwei Jahren in Logroño stattgefunden haben, einer der drei Richter.«
Alonso zuckte vor Beschämung verstohlen zusammen und musste den Blick abwenden, doch so leicht entkam er dem Geflacker der Flammen und dem Gestank nach verkohltem Fleisch nicht. Bei den Tribunalen in der nahe gelegenen Stadt Logroño hatte er sich den Urteilen der anderen beiden Inquisitoren angeschlossen. Jetzt plagte ihn das schlechte Gewissen. Es war der größte Hexenprozess in Spanien gewesen. Nach dem Vorwurf einer einzelnen Frau – Maria de Ximildegui – hatten sich Hysterie und Panik wie ein Lauffeuer verbreitet. Sie hatte behauptet, sie sei Zeuge eines Hexensabbats gewesen, und mit dem Finger auf andere gezeigt, die wiederum andere Leute verleumdeten. Am Ende wurden dreihundert Personen angeklagt, sich mit dem Teufel eingelassen zu haben. Viele der Angeklagten waren noch Kinder, die jüngsten gerade mal vier Jahre alt. Als Alonso in Logroño eingetroffen war, hatten die anderen beiden Inquisitoren den Kreis der Angeklagten auf die schlimmsten Übeltäter eingegrenzt. Diejenigen, die ihre Verbrechen gestanden, wurden bestraft, doch der Flammentod blieb ihnen gnädigerweise erspart. Zwölf Personen, die nicht gestehen wollten, dass sie Hexen waren, wurden daraufhin auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Alonso lasteten die Toten schwer auf der Seele – nicht weil er sie nicht dazu gebracht hatte einzugestehen, dass sie Hexen waren, sondern weil er an ihre Unschuld geglaubt hatte. Anschließend hatte er dies auch geäußert und war damit bei Bernardo de Sandoval y Rojas, dem Vorsitzenden der spanischen Inquisition, auf dessen Freundschaft er große Stücke hielt, ein hohes Risiko eingegangen. Sein Vertrauen in die Beziehung erwies sich jedoch als wohlbegründet. Seit der grausamen und blutrünstigen Zeit des Königlichen Inquisitors Tomas de Torquemada waren hundert Jahre vergangen. Der Vorsitzende der Inquisition beauftragte ihn allein damit, in der Baskenregion Spaniens eine Untersuchung durchzuführen und Hysterie von Wahrheit zu trennen. Jetzt war er seit zwei Monaten unterwegs und befragte die Angeklagten und Eingekerkerten. Bislang hatte er zwölf falsche Geständnisse aufgrund von Folter identifiziert, Geschichten voller Ungereimtheiten und Widersprüche. Bislang hatte er noch keinen Fall nachweislicher Hexerei vorgefunden.
Bei seinem einsamen Kampf, die bedauernswerten Angeklagten solcher Verbrechen zu verschonen, konnte er auf eine einzige Waffe zurückgreifen. Er blickte den Priester an und klopfte auf die Ledertasche, die er an der Seite trug. »Pater Ibarra, ich habe hier ein Glaubensedikt des Vorsitzenden der Inquisition. Es erlaubt mir, alle zu begnadigen, die ihre Verbrechen zugeben, Gott Gefolgschaft geloben und dem Teufel widerrufen.«
Die Augen des Priesters funkelten in der Dunkelheit und glühten vor Stolz. »Ich habe keine Bedenken, Letzteres – nämlich meine Liebe zu Gott – zu schwören, doch wie ich bereits sagte, bin ich kein Hexer und werde dies auch nicht gestehen.«
»Auch nicht, wenn du damit dein Leben retten kannst?«
Ibarra wandte ihm den Rücken zu und betrachtete das vom Feuerschein erhellte Zellenfenster. »Bist du rechtzeitig eingetroffen, um die Schreie zu hören?«
Diesmal vermochte Alonso sein Zusammenzucken nicht zu verbergen. Als er aus den Bergen heruntergekommen war, hatte er die vom Dorf aufsteigenden Rauchfahnen bemerkt. Er hatte gehofft, der Rauch stamme von Feuern zur Feier der Sommersonnenwende. Doch da er das Schlimmste befürchtete, gab er seinem Pferd die Sporen. Er ritt in die untergehende Sonne, bis er am Dorfrand von lautem Wehklagen begrüßt wurde.
Sechs Hexen waren auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden.
Nein, keine Hexen … Frauen, rief er sich in Erinnerung.
Bedauerlicherweise war Alonso nicht der erste Inquisitor gewesen, der das Dörfchen erreicht hatte. Er vermutete, dass man Pater Ibarra bis jetzt verschont hatte, weil er Priester war.
Alonso starrte auf den Rücken des Mannes.
Wenn ich ihn nur retten kann, so sei es.
»Pater Ibarra, bitte gestehe …«
»Was weißt du über die heilige Kolumba?«
Überrascht von der merkwürdigen Frage, ließ Alonso sich mit der Antwort einen Moment Zeit. Er hatte die Universität von Salamanca und die Universität von Sigüenza besucht und zur Vorbereitung auf die Übernahme heiliger Aufgaben und den Eintritt in den Klerus kanonisches Recht studiert. Die Litanei der Heiligen war ihm wohlvertraut. Der Name, den Pater Ibarra genannt hatte, war jedoch umstritten.
»Du meinst die galizische Hexe«, sagte Alonso, »die im neunten Jahrhundert auf einer Pilgerreise nach Rom dem Geist Christi begegnet ist.«
»Christus hat sie aufgefordert, zum Christentum zu konvertieren, wenn sie in den Himmel kommen wolle.«
»Und sie hat seinen Rat befolgt und ist deswegen zur Märtyrerin geworden. Sie wurde um ihres Glaubens willen geköpft.«
Ibarra nickte. »Trotz ihres Beitritts zur Kirche hat sie der Hexerei niemals abgeschworen. Die Bauern aus der Gegend verehren sie noch heute wegen beider Aspekte ihrer Person – weil sie Hexe und Märtyrerin war. Sie beten zu ihr, sie möge sie vor bösem Zauber bewahren und gute Hexen, die Kranke mit Kräutern, Amuletten und Beschwörungen heilen, vor Verfolgung schützen.«
Bei seinen Reisen durch den Norden Spaniens hatte Alonso vom Kult der heiligen Kolumba munkeln hören. Er kannte viele Frauen – gebildete Frauen –, welche die Natur studierten, Heilmittel und Kräuter sammelten und aus heidnischem Wissen schöpften. Einige wurden der Hexerei angeklagt und von Priestern vergiftet oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt; andere suchten Obhut in Nonnen- und anderen Klöstern, wo sie – wie die heilige Kolumba – Christus dienen und gleichzeitig im Geheimen Gärten bepflanzen und Kranke heilen konnten, wobei sich die Grenze zwischen Heiden- und Christentum verwischte.
Er musterte Pater Ibarra.
Hing dieser Priester dem gleichen Kult an?
»Dir wird vorgeworfen, mit Zauberamuletten Kranke geheilt zu haben«, sagte Alonso. »Macht dich das nicht zum Hexer der gleichen Sorte? Wenn du das zugibst, kann ich aufgrund des Edikts …«
»Ich bin kein Hexer«, wiederholte der Priester und zeigte auf den Rauch, der durchs kleine Zellenfenster hereinwehte. »Da gehen die Frauen dahin, die auf diesen Weiden und in den Bergdörfern viele Kranke geheilt haben. Ich war lediglich ihr Beschützer und handelte als demütiger Diener der heiligen Kolumba, der Schutzheiligen der Hexen. Ich kann nicht reinen Herzens gestehen, dass ich ein Hexer bin. Nicht deshalb, weil ich den Vorwurf verabscheue, sondern weil ich es nicht verdient habe, Hexer genannt zu werden … denn ich bin dieser Ehre nicht würdig.«
Alonso reagierte bestürzt auf diese Äußerung. Er hatte schon viele Widerrufe von Personen vernommen, die der Hexerei angeklagt waren, doch noch niemand hatte den Vorwurf auf diese Weise geleugnet.
Ibarra drückte sich an die Gitterstäbe. »Was das Amulett betrifft … diese Anschuldigung ist zutreffend. Ich fürchte, die, die vor dir hier im Dorf eingetroffen sind, wollen danach suchen.«
Wie aufs Stichwort öffnete sich hinter Alonso die Tür. Ein Mönch im schwarzen Kapuzengewand trat ein. Obwohl seine Augen mit einem scharlachroten Band bedeckt waren, konnte er anscheinend deutlich sehen. »Hat er gestanden?«, fragte der Mann schroff.
Alonso wandte sich zu Ibarra um. Der Priester wich von den Gitterstäben zurück und straffte sich. Alonso wusste, dass Ibarra nicht nachgeben würde. »Das hat er nicht«, sagte Alonso.
»Ergreift ihn«, befahl der Mönch.
Zwei Ordensbrüder des Mönchs drängten in den Raum, um Ibarra zum Scheiterhaufen zu zerren. Alonso stellte sich ihnen in den Weg. »Ich geleite ihn nach draußen.«
Die Zellentür wurde entriegelt, und Alonso trat neben Ibarra aus dem Kerker und ging mit ihm zum Dorfplatz. Alonso stützte den Priester am Ellbogen. Er zitterte am ganzen Leib, jedoch nicht vor Schwäche und Hunger – sondern wegen des Anblicks, der sich ihm auf dem Platz bot.
Sechs Scheiterhaufen kokelten dort, darauf vom Feuer verkrümmte Gestalten, die verkohlten Arme emporgereckt, die Handgelenke mit glühendem Eisen gefesselt. Frisch gehauenes Kastanienholz war zu einem siebten hüfthohen Stapel aufgeschichtet.
Ibarra ergriff Alonsos Hand und drückte sie fest.
Alonso versuchte, den verängstigten Gefangenen zu beruhigen. »Vielleicht nimmt Gott dich bei sich auf.«
Alonso aber hatte die Absicht des Priesters falsch gedeutet. Mit knochigen Fingern öffnete der Mönch seine Hand und drückte ihm einen Gegenstand hinein. Unwillkürlich schloss Alonso die Finger darum. Er ahnte, was der Priester ihm gegeben hatte. Vermutlich hatte er es in einer Geheimtasche seines zerrissenen Gewands verborgen gehabt.
Ibarras Amulett.
Auf Spanisch bestätigte der Priester Alonsos Vermutung. »Nómina de moro.«
Nóminas waren angeblich wundertätige Zaubermittel oder Amulette, beschriftet mit den Namen von Heiligen.
»Das wurde an der Quelle des Orabidea gefunden«, erklärte Ibarra eindringlich. »Versteck es vor denen.«
Durch die Rauchwolke näherte sich energischen Schritts eine Gestalt. Das Gewand des Mannes war scharlachrot, und er trug eine schwarze Augenbinde. Alonso waren Gerüchte über diese geheime Verbindung der Inquisition zu Ohren gekommen. Angeblich gab es dort welche, die noch immer dem Blutrausch des verstorbenen Torquemada frönten. Sie bezeichneten sich als Crucibulum, das lateinische Wort für Schmelztiegel, ein Gefäß, das durch Feuer reinigt – wie eine mächtige Flamme gegen heidnische Rituale.
Alonso musterte die rauchenden Überreste der sechs Scheiterhaufen. Er krampfte die Finger um das Amulett in seiner Hand.
Der Anführer trat vor und nickte seinen Ordensbrüdern zu. Auf seinen wortlosen Befehl hin rissen sie Ibarra von Alonso fort und zerrten ihn nach vorn. Der Anführer hatte sich ein dickes Buch mit vergoldetem Einband unter den Arm geklemmt. Alonso erkannte den verfluchten Folianten. Der vollständige Titel – Malleus Maleficarum, Maleficas & earum hæresim, ut phramea potentissima conterens – lautete übersetzt: Der Hexenhammer, der Hexen und ihre Ketzerei mit einem zweischneidigen Schwert vernichtet. Das Buch, verfasst vor über hundert Jahren, war eine Anleitung zur Hexenjagd, zum Nachweis ihrer Verbrechen und zu ihrer Bestrafung. Beim Papst war es inzwischen in Ungnade gefallen, sogar bei der Inquisition.
Beim Geheimbund Crucibulum aber hatte es an Bedeutung eher weiter gewonnen.
Während Ibarra zum Scheiterhaufen gezerrt wurde, wich ihm der Anführer des Geheimbunds nicht von der Seite. Er flüsterte dem Priester ins Ohr. Alonso hörte das Wort nóminas heraus.
Dann war Ibarras Befürchtung also gerechtfertigt gewesen.
Alonso vermutete, dass der Anführer des Crucibulum entweder Drohungen aussprach oder Versprechungen machte für den Fall, dass Ibarra die Wahrheit über das Amulett preisgab.
Da er fürchtete, seinerseits ins Visier des Anführers zu geraten, weil er mit Ibarra allein gewesen war, entfernte Alonso sich vom Platz. Zuletzt sah er noch, wie Ibarra an den Holzblock auf dem Scheiterhaufen gekettet wurde. Ibarra fing seinen Blick auf und nickte leicht.
Lass es nicht in ihre Hände fallen.
Fluchend kehrte Alonso ihm den Rücken zu. Er eilte zu dem Stall, in dem sein Pferd stand. Er war noch nicht weit gekommen, als Ibarra gen Himmel rief.
»VERBRENNTUNSALLE! ESKOMMTNICHTDARAUFAN. DIEHEILIGEKOLUMBAHATIHREANKUNFTANGEKÜNDIGT. DIEHEXE, DIEIHRVERMÄCHTNISFORTFÜHRENWIRD. DIEHEXE, DIEDENSCHMELZTIEGELZERBRECHENUNDDIEWELTREINIGENWIRD!«
Als er das hörte, geriet Alonso ins Stolpern. Kein Wunder, dass das Crucibilum dem Kolumba-Kult Einhalt zu gebieten versuchte und jeden Beweis für ihre Behauptungen zu Asche verbrennen wollte. Er schloss die Hand noch fester um den Talisman. Ob wahr oder nicht, die Welt veränderte sich allmählich – Torquemadas Gepflogenheiten würden aussterben, die Bände des Malleus Maleficarum zu Staub zerfallen –, doch bevor dies geschah, würde es weiteres Blutvergießen und weitere Scheiterhaufen geben, die letzten Zuckungen eines sterbenden Zeitalters.
Als er sich weit genug vom Dorfplatz entfernt hatte, wagte es Alonso, einen Blick auf Ibarras nóminas zu werfen. Er öffnete die Hand. Der Anblick war so bestürzend, dass er den Schatz beinahe fallen gelassen hätte. Es handelte sich um einen Finger, der von einer Hand abgerissen worden war. Die Ränder wirkten verbrannt, doch ansonsten war der Finger gut erhalten. Es war ein Beleg für Heiligkeit, wenn die sterblichen Überreste eines Menschen sich als unzerstörbar erwiesen und weder faulten noch verwesten.
Hielt er eine solche Reliquie in der Hand?
Er blieb stehen, betrachtete den Finger eingehend und bemerkte, dass in das Fleisch Worte eingeschrieben waren.
Sancta Maleficarum
Im Stillen übersetzte er die Worte.
Heilige der Hexen.
Dann war dies also tatsächlich eine nóminas, ein Amulett mit dem Namen einer Heiligen. Doch er fand noch etwas Erstaunlicheres. Der Finger war nicht nur eine heilige Reliquie – ein Stück vom Körper eines Heiligen –, sondern etwas noch Unglaublicheres.
Atemlos vor Staunen wendete er den Gegenstand hin und her. Das Gewebe wirkte echt, doch das war es nicht. Die Haut war weich, fühlte sich aber kalt an. Am Ende wurde ein Mechanismus mit dünnen Drähten und glänzenden Metallknochen sichtbar. Es war ein Simulakrum, das mechanische Ebenbild eines Fingers.
Alonso hatte von gewissen Geschenken gehört, die man Königen und Königinnen machte, von komplizierten Apparaten, welche die Bewegungen des Körpers nachahmten. Vor sechzig Jahren hatte Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, ein Uhrwerk in Gestalt eines Mönchs geschenkt bekommen, das vom spanisch-italienischen Erfinder und Künstler Juanelo Turriano gebaut worden war. Die Puppe konnte ein Holzkreuz heben und senken, das Kruzifix an die Lippen führen, die sich in lautlosem Gebet bewegten, nicken und die Augen bewegen.
Ist das hier ein Teil von einem solchen Apparat?
Wenn ja, welche Bedeutung hatte es dann? In welcher Beziehung stand es zum Kult der heiligen Kolumba?
Da er keine Antwort darauf wusste, ging er weiter zum Stall. Ibarra hatte ihm noch einen Hinweis auf das Mysterium gegeben: Er hatte ihm den Fundort des Talismans verraten.
»Der Orabidea«, murmelte er mit gefurchter Stirn.
Jeder Inquisitor aus der Gegend kannte den Fluss. Er entsprang in einer Höhle mit Namen Sorginen Leizea, Höhle der Hexen. Dort wurden häufig Hexensabbate veranstaltet. Auch der Orabidea hatte eine düstere Vergangenheit. Manchmal wurde er auch Infernukoerreka oder Höllenfluss genannt, da er angeblich aus dem Innersten der Hölle entsprang.
Mit anderen Worten, aus der Höllenpforte.
Er scheute davor zurück, die Angelegenheit weiterzuverfolgen, und erwog, das Amulett wegzuwerfen – als hinter ihm ein qualvoller Schrei zu den Sternen aufstieg.
Ibarra …
Er drückte die Finger um die nómina.
Der Priester war gestorben, um sein Geheimnis zu wahren.
Sein Opfer soll nicht vergeblich gewesen sein.
Er wollte die Wahrheit erfahren, selbst wenn dies bedeutete, die Höllenpforte zu durchschreiten.
Gegenwart21. Dezember, 22:18 WETCoimbra, Portugal
Der Hexensabbat wartete.
Charlotte Carson eilte durch die dunkle Universitätsbibliothek. Das gedämpfte Geräusch ihrer Schritte auf dem Marmorboden wurde von der Ziegelsteindecke des zweistöckigen Saals reflektiert. Einige der Bücher in den mit Schnitzereien verzierten Regalen ringsumher stammten aus dem zwölften Jahrhundert. Der große Raum wurde nur von Wandleuchtern erhellt, und sie staunte über die schattenhaften Leitern und die kunstvoll vergoldeten Schnitzereien.
Erbaut zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts, war die Biblioteca Joanina ein wunderbar erhaltenes Schmuckstück des Barocks, der eigentliche Mittelpunkt der Universität von Coimbra. Und wie jede Schatzkammer war sie auch ein wahrer Tresor, mit sechzig Zentimeter dicken Wänden und Türen aus massivem Teakholz. Aufgrund der zweckmäßigen Bauweise herrschte im Innern unabhängig von der Jahreszeit eine gleichmäßige Temperatur von achtzehn Grad bei gleichbleibender Luftfeuchtigkeit.
Beste Bedingungen für den Erhalt alter Bücher …
Diese Bemühungen beschränkten sich jedoch nicht allein auf die Architektur der Bibliothek.
Charlotte duckte sich, als eine Fledermaus an ihrem Kopf vorbei zur oberen Galerie flog. Vom Ultraschallruf, den sie nicht hörte, aber spürte, sträubten sich ihr die Nackenhaare. Seit Jahrhunderten lebte in der Bibliothek eine Kolonie von Fledermäusen. Sie waren treue Verbündete beim Kampf um den Erhalt der hier gelagerten Schätze. Nacht für Nacht dezimierten sie die Insekten, die sich ansonsten an alten Ledereinbänden und vergilbtem Pergament gelabt hätten.
Dass in dieser Schatzkammer eifrige Jäger lebten, machte bestimmte Vorkehrungen erforderlich. Sie fuhr mit dem Finger über eine der Lederdecken, mit denen die Tische bedeckt waren. Das Personal legte sie allabendlich nach dem Schließen aus, um die Holzoberflächen vor den Hinterlassenschaften der Fledermäuse zu schützen.
Als sie zu den vergoldeten Flügelfenstern in den Backsteingewölben hochschaute, verspürte sie eine abergläubische Furcht – und eine gewisse Belustigung.
Was ist eine Hexenversammlung ohne Fledermäuse?
Diese Nacht hatte man speziell ausgewählt. Das eine Woche währende wissenschaftliche Symposium hatte heute geendet. Morgen würden die Teilnehmer heimkehren und in alle vier Himmelsrichtungen reisen, um mit Freunden und Familie die Ferien zu verleben. Heute Nacht aber würden Freudenfeuer die Stadt erhellen, untermalt von zahlreichen Musikdarbietungen, alles, um die Wintersonnenwende zu feiern, die längste Nacht des Jahres.
Sie sah auf die Uhr, denn sie war spät dran. Sie trug noch immer die halbformelle Kleidung von der Urlaubsparty in der Botschaft: einen weiten schwarzen Rock, der an ihren Knöcheln streifte, und eine kurze Jacke über blauer Bluse. Ihr Haar lag eng am Schädel an. Es hatte sich vorzeitig silbern gefärbt und war nach der Chemo vor neun Monaten kurz und spärlich geblieben. Auf Färbemittel und Extensions hatte sie verzichtet. Nachdem sie die Zumutungen und Demütigungen der Krebserkrankung überlebt hatte, erschien ihr Eitelkeit als alberne Frivolität. Sie hatte keine Geduld mehr dafür.
Doch an Freizeit mangelte es ihr generell.
Stirnrunzelnd sah sie auf die Uhr.
Nur noch vier Minuten.
Sie stellte sich die Sonne auf der anderen Seite der Erde vor, wie sie sich auf den südlichen Wendekreis zubewegte. Wenn sie ihn erreichte, wäre dies der Moment der Sonnenwende, und der Winter würde sich dem Sommer zuwenden, die Dunkelheit der Helligkeit weichen.
Der perfekte Moment für diese Demonstration.
Den Beweis für die Richtigkeit des Konzepts.
»Fiat lux«, flüsterte sie.
Es werde Licht.
Vor ihr lag ein beleuchteter Durchgang, hinter dem eine Wendeltreppe in die unteren Regionen der Bibliothek führte. Die oberste Ebene wurde wegen ihrer Schönheit und langen Geschichte als Edeletage bezeichnet. Darunter lag die mittlere Etage, die den Bibliothekaren vorbehalten war, die dort die wertvollsten Bücher verwahrten.
Charlottes Ziel aber lag noch eine Ebene tiefer.
Da die Zeit drängte, eilte sie zum Durchgang.
Die anderen hatten sich bestimmt schon versammelt. Sie ging am Gemälde König Johanns V. vorbei, der die Bibliothek gegründet hatte, und erreichte die Wendeltreppe, die zur untersten Ebene der Bibliothek hinabführte.
Als sie die Wendel hinunterstieg, vernahm sie Stimmengemurmel. Auf der letzten Stufe hielt sie vor einem stabilen schwarzen Eisentor inne. Man hatte es für sie angelehnt. Daran angebracht war ein Schild mit der Aufschrift PRISÁOACADÉMICA.
Der Umstand, dass sich unter der Bibliothek ein Gefängnis befand, brachte sie zum Lächeln. Sie stellte sich vor, dass hier aufmüpfige Studenten oder betrunkene Professoren eingesperrt wurden. Früher einmal Teil des Königspalasts, hatte diese Ebene bis 1834 als Kerker gedient. Dies war das einzige mittelalterliche Gefängnis, das in Portugal überdauert hatte.
Sie schlüpfte durchs Tor ins Verlies. Ein großer Bereich des Kellers war für Touristen zugänglich, andere Räume waren verschlossen und dienten als Bücherdepot. Sie wandte sich zur anderen Seite, wo die Moderne die mittelalterlichen Räume infiltriert hatte. In einem ungenutzten Bereich des Gewölbes hatte man ein Computersystem installiert, zusammen mit einem System für die Digitalisierung von Büchern, eine weitere Schutzmaßnahme für die oben verwahrten Bestände.
Zur Wintersonnenwende würden die Rechner einem anderen Zweck dienen – dann ginge es nicht darum, die Vergangenheit zu bewahren, sondern einen Blick in die Zukunft zu werfen.
Als sie das schwarze Gewölbe betrat, wurde sie von einer Frau begrüßt. »Ah, Embaixador Carson, Sie haben es doch noch rechtzeitig geschafft.«
Bekleidet mit einem schicken marineblauen Kostüm und weißer Bluse, näherte sich ihr Eliza Guerra, die Leiterin der Bibliothek Joanina, küsste sie auf beide Wangen und drückte ihr rasch den Oberarm. Der zierlichen Bibliothekarin war die Aufregung anzumerken.
»Ich war mir nicht sicher, ob ich es schaffen würde«, erklärte Charlotte mit schuldbewusstem Lächeln. »Die Botschaft ist knapp an Personal, und da die Ferien beginnen, herrscht dort Chaos.«
Als amerikanische Botschafterin musste Charlotte sich heute Nacht um zahllose Dinge kümmern. Unter anderem musste sie den Nachtflug nach D. C. erreichen, wo sie sich mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern treffen wollte. Laura, die Älteste, war aus Princeton zurückgekehrt – das auch Charlottes Alma Mater war –, wo sie Biotechnologie studierte. Carly, die andere Tochter, war eher ein Wildfang und jagte an der New York University dem Traum einer Musicalkarriere nach, sicherte sich allerdings mit einem Studium der Ingenieurwissenschaft ab.
Charlotte hätte auf beide nicht stolzer sein können.
Sie wünschte, sie könnten diesen Moment miterleben. Ihre Töchter waren einer der Gründe, weshalb sie bei der Gründung dieser Organisation von Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen mitgeholfen hatte. Die gemeinnützige Stiftung war ein Ableger der größeren Coimbra-Gruppe, einer Vereinigung, der mehr als drei Dutzend Forschungsuniversitäten in aller Welt angehörten.
Um Frauen in der Wissenschaft zu fördern, zu unterstützen und zu vernetzen, hatten Charlotte und die anderen hier versammelten vier Frauen die Bruxas International ins Leben gerufen, benannt nach dem portugiesischen Wort für »Hexen«. Jahrhundertelang waren Frauen, die Kranke heilten, sich mit Kräutermedizin beschäftigten oder ihre Umgebung einfach nur infrage stellten, zu Ketzerinnen und Hexen erklärt worden. Selbst hier in Coimbra – einer Stadt, die als Hort der Gelehrsamkeit galt – hatte man Frauen verbrannt, häufig bei schaurigen Festumzügen, die als Autodafé bezeichnet wurden, als Glaubensakte, bei denen Glaubensabtrünnige und Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden.
Anstatt vor dem Stigma zurückzuscheuen, hatten sie und die anderen Frauen beschlossen, es stattdessen als Name für ihre Bruxas-Stiftung zu benutzen.
Doch damit hatte sich die Metapher noch nicht erschöpft.
Eliza Guerra hatte einen Rechner bereits hochgefahren. Auf dem Bildschirm drehte sich langsam das Symbol ihrer Organisation, ein von einem Kreis umschlossenes Pentagramm.
Die fünf Spitzen des Sterns standen für die fünf anwesenden Frauen, den innersten Zirkel, der die Organisation vor sechs Jahren an der Universität von Coimbra gegründet hatte. Sie hatten keine Vorsitzende bestimmt. Sie waren gleichberechtigt.
Charlotte blickte an Eliza vorbei und lächelte die anderen drei Frauen an: Dr. Hannah Fest von der Universität Köln, Professor Ikumi Sato von der Universität Tokio und Dr. Sophia Ruiz von der Universität Sáo Paulo. Charlotte war zwar im Jahr zuvor zur Botschafterin ernannt worden – was sie auch ihrem Einsatz für die internationale Organisation dieser in Portugal beheimateten Vereinigung zu verdanken hatte –, doch ursprünglich war auch sie Wissenschaftlerin, hatte in Princeton gelehrt und repräsentierte nun die Vereinigten Staaten.
Trotz ihrer Unterschiede hatten alle fünf Frauen – allesamt in den Fünfzigern – in ihrem Beruf ungefähr zur gleichen Zeit Karriere gemacht und aufgrund ihres Geschlechts ähnliche Diskriminierungen und Kränkungen überwinden müssen. Neben dem Interesse für Wissenschaft war dies eine weitere Gemeinsamkeit. Ihr Ziel war es, Chancengleichheit zu fördern und jüngere Frauen bei ihrer wissenschaftlichen Laufbahn mit Stipendien, Praktika und Mentoring zu fördern und zu unterstützen.
Mit ihren Bemühungen hatten sie in aller Welt bereits große Erfolge erzielt – vor allem aber hier.
Hannah beugte sich zu dem Standmikrofon neben der Computertastatur vor. »Mara, wir sind vollzählig.« Sie sprach Englisch mit starkem deutschem Akzent. »Wenn Sie bereit sind, können Sie die Demonstration starten.«
Als Hannah zurücktrat, teilte sich der Bildschirm. Das Pentagramm rückte zur Seite, und das jugendliche Gesicht von Mara Silviera wurde angezeigt. Sie war zwar erst zweiundzwanzig, hatte aber bereits fünf Jahre in Coimbra zugebracht, finanziert durch ein Stipendium, das Bruxas ihr im zarten Alter von sechzehn Jahren gewährt hatte. Sie stammte aus einem kleinen Dorf in der galizischen Region im Norden Spaniens und war in den Fokus von Tech-Firmen geraten, nachdem sie eine Übersetzungsapp veröffentlicht hatte, die alle anderen Apps auf dem Markt ausstach. Offenbar hatte sie ein angeborenes Talent für Computer und die Grundlagen der Sprache.
Aus ihren Augen leuchtete die Intelligenz hervor. Vielleicht war es auch nur Stolz. Ihr mokkafarbener Teint und ihr langes, glattes schwarzes Haar deuteten darauf hin, dass es in ihrem Stammbaum Mauren gab. Derzeit arbeitete sie auf dem Universitätscampus im Labor für fortschrittliche Computertechnik, das auch den Milipeia-Cluster betrieb, einen der leistungsstärksten Superrechner des Kontinents.
Mara blickte zur Seite. »Ich fahre Xénese jetzt hoch. In einer Minute sollten wir online sein.«
Als die Frauen zusammenrückten, sah Charlotte auf die Uhr.
22:53
Genau im Zeitplan.
Sie stellte sich vor, wie die Sonne über den südlichen Wendekreis aufstieg, den Höhepunkt der Wintersonnenwende erreichte und vom Ende der Dunkelheit und der Wiederkehr des Lichts kündete.
Bevor es dazu kam, schepperte es laut. Alle schreckten zusammen und wandten den Kopf.
Eine dicht gedrängte Gruppe von dunklen Kapuzengestalten drängte durchs schwarze Tor und näherte sich über den Gefängnisboden. In Händen hielten sie große, glänzende Pistolen. Sie verteilten sich und versperrten den fünf Frauen im Rechnergewölbe den Weg zum Ausgang.
Es gab keine weitere Tür.
Charlotte, der das Herz bis zum Hals klopfte, wich einen Schritt zurück. Sie schirmte den Monitor mit dem Körper ab und langte blindlings hinter sich. Mit einer Mausbewegung und einem Klick blendete sie das Bild von Mara Silviera aus, um die junge Frau zu schützen und sie zur stummen Zeugin zu machen. Mikrofon und Kamera waren noch auf Sendung. Man konnte sie sehen, hören und das Geschehen aufzeichnen.
Als die Gestalten näher kamen, flehte Charlotte Mara im Stillen an, die Polizei zu rufen, doch es war unwahrscheinlich, dass sie rechtzeitig eintreffen würde. Sie war sich nicht einmal sicher, dass Mara sich der veränderten Umstände bewusst war. Vielleicht konzentrierte sie sich ja auch auf die bevorstehende Demonstration.
Die acht Eindringlinge – ausnahmslos Männer – trugen schwarze Gewänder und hatten sich scharlachrote Seidenschärpen über die Augen gebunden. Da sie sich bewegten, ohne irgendwo anzustoßen, konnten sie anscheinend durch den Stoff hindurchsehen.
Eliza Guerra trat vor, bereit, ihre Bibliothek zu verteidigen. »Was hat das zu bedeuten? Was wollen Sie?«
Eine nervenaufreibende Stille setzte ein.
Die Eindringlinge teilten sich und gaben die Sicht frei auf einen neunten Mann, offenbar der Anführer. Er war über eins achtzig groß und trug ein scharlachrotes Gewand mit schwarzer Augenbinde, das Gegenstück zur Kleidung seiner Gefolgsleute. Er hielt keine Waffe in der Hand, sondern einen zwanzig Zentimeter dicken Folianten. Der abgenutzte Ledereinband hatte die gleiche Farbe wie sein Gewand. Die Goldprägung war deutlich zu erkennen: Malleus Maleficarum.
Charlotte schreckte zurück, ihre letzte Hoffnung zerstob. Insgeheim hatte sie gehofft, dies sei ein dreister Raubüberfall. Viele Bücher der Bibliothek waren von unschätzbarem Wert. Das Buch, das der Mann in der Hand hielt, stürzte sie jedoch in Verzweiflung. Anscheinend handelte es sich um eine Erstausgabe, von denen es nur noch wenige gab. Ein Exemplar wurde auch hier in der Joanina-Bibliothek verwahrt. Elizas sorgenvoll gefurchter Stirn nach zu schließen handelte es sich um ebendieses Buch.
Es war im fünfzehnten Jahrhundert von dem katholischen Priester Heinrich Kramer verfasst worden. Der lateinische Name bedeutete »Der Hexenhammer«. Es diente als Leitfaden für die Identifizierung, Verfolgung und Folterung von Hexen und war eines der meistgeschmähten und am stärksten blutgetränkten Bücher der Geschichte. Die Zahl der Opfer, die auf dieses Buch zurückgingen, wurde auf über sechzigtausend geschätzt.
Charlotte blickte ihre Gefährtinnen an.
Und bald werden es fünf mehr sein.
Die ersten Worte des Anführers bestätigten ihre Befürchtungen.
»Maleficas non patieris vivere.«
Charlotte kannte die Ermahnung aus dem Buch Exodus.
Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen.
Der Mann fuhr auf Englisch fort, doch er hatte einen spanischen Akzent. »Xénese darf es nicht geben«, psalmodierte er. »Das ist eine Schändlichkeit, geboren aus Hexerei und Verworfenheit.«
Charlotte runzelte die Stirn.
Woher wusste er, was sie vorhatten?
Diese Frage aber musste warten. Während die Pistolen weiterhin auf sie zielten, traten zwei Männer mit Zwanzig-Liter-Kanistern vor. Sie konnte die Beschriftung erkennen: Querosene. Obwohl sie kein Portugiesisch sprach, wusste sie, was sich darin befand, zumal die Männer eine ölige Flüssigkeit auf den Boden schütteten.
Der Geruch des Kerosins verschlug ihnen den Atem.
Hustend wechselte Charlotte einen Blick mit den anderen verängstigten Frauen. Nachdem sie sechs Jahre lang zusammengearbeitet hatten, kannten sie einander gut. Worte waren überflüssig. Sie würden sich nicht auf dem Scheiterhaufen festbinden lassen. Wenn dies ihr Ende sein sollte, würden diese Hexen sich wehren.
Besser eine Kugel als die Flammen.
Sie funkelte den Anführer höhnisch an. »Das ist für dich, Arschloch!«
Die fünf Frauen platschten durch die Kerosinlache und warfen sich auf die Männer. Pistolen feuerten, die Schüsse hallten in dem kleinen Raum dröhnend wider. Charlotte spürte, dass sie getroffen wurde, doch der Schwung beförderte sie zum Anführer. Sie sprang ihn an, grub die Fingernägel tief in seine Haut und zog sie nach unten durch. Sie riss ihm die Augenbinde ab und blickte in seine zornfunkelnden Augen.
Er ließ das verfluchte Buch fallen und stieß sie weg. Sie landete am Rand der Kerosinlache auf dem Steinboden und blickte sich erschrocken um. Die anderen vier Frauen lagen reglos am Boden, ihr Blut mit dem Öl vermischt.
Auch sie verließen die Kräfte, und sie sackte zusammen.
Der Anführer fluchte und erteilte auf Spanisch Befehle.
Die Männer holten ein halbes Dutzend Molotowcocktails hervor und zündeten sie an.
Charlotte achtete nicht darauf. Ihr war so kalt, dass sie keine Angst vor der bevorstehenden Hitze hatte. Sie blickte matt in den Raum, da fiel ihr eine Bewegung auf. Auf dem Monitor rotierte das Bruxas-Pentagramm viel schneller als zuvor, so als hätte es sich von der allgemeinen Aufregung anstecken lassen.
Verblüfft betrachtete sie das verschwimmende Bild.
Versuchte Mara, ihr etwas mitzuteilen?
Die Molotowcocktails wurden in den Raum geschleudert und zerschellten an den Wänden. Flammen loderten empor. Hitze schwemmte über sie hinweg.
Sie aber starrte weiterhin ins Zentrum des Feuers.
Das Symbol auf dem Bildschirm rotierte einen Moment lang noch schneller – dann kam es unvermittelt zum Stillstand. Die Mitte aber war instabil geworden. Teile davon lösten sich und fielen herab.
Der Anführer näherte sich ihr. Vermutlich war auch er auf das Symbol aufmerksam geworden. Zwar konnte sie sein Gesicht nicht sehen, spürte aber seine Verunsicherung. Zwei Zacken waren von dem Stern im Pentagramm übrig geblieben. Sie erinnerten an die Hörner eines Teufels.
Als wäre dies auch ihm aufgefallen, spannte der Mann sich an. Offenbar fühlte er sich beleidigt. Er stolperte zurück und hob den Arm. Auf Spanisch rief er: »Zer… zerstört die computadora!«
Doch es war bereits zu spät. Das Bild veränderte sich ein letztes Mal und vollführte eine Vierteldrehung.
Pistolen knallten, die Kugeln flogen durchs Feuer. Der Monitor splitterte und wurde dunkel. Charlotte sackte zusammen und folgte der Dunkelheit, hielt Ausschau nach dem sprichwörtlichen Licht am Ende des Tunnels und hoffte, dass Mara in Sicherheit war.
Etwas aber begleitete sie in die Tiefe. Es stand ihr leuchtend hell vor Augen: das letzte Bild, das der Monitor angezeigt hatte. Der Kreis um das Pentagramm war verschwunden, zurückgeblieben war ein neues Symbol, das den Monitor ausgefüllt hatte, bevor er geborsten war.
Es sah aus wie ein griechischer Buchstabe.
Sigma.
Sie wusste nicht, was das bedeutete, doch die Botschaft gab ihr dennoch Hoffnung, als sie starb.
Hoffnung für die Welt.
TEIL 1 DERGEISTINDERMASCHINE
1
24. Dezember, 21:06, ESTSilver Spring, Maryland
Als die Münze in der Luft rotierte, war Commander Gray erfüllt von bösen Vorahnungen. Er saß auf einem Hocker neben seinem besten Freund Monk Kokkalis, der die Münze über der Mahagonibar geworfen hatte. Andere Gäste der Quarry House Tavern umringten sie, betrunken, rauflustig und laut, und beobachteten den Flug der Münze. An der anderen Seite der Taverne spielte eine kleine Band eine Rockabilly-Version von »The Little Drummer Boy«. Die dröhnende Basstrommel brachte seine Rippen zum Vibrieren und verstärkte seine Anspannung.
»Kopf!«, rief Monk, als der Vierteldollar in der trüben Beleuchtung aufblitzte.
Es war der dreizehnte Wurf.
Wie bei den anderen zwölf Malen landete die Münze flach auf Monks Handfläche. Die Silhouette George Washingtons lag oben.
»Tatsächlich Kopf!«, bestätigte Monk mit ein wenig schleppender Stimme.
Es wurde gestöhnt und gejubelt, je nachdem, ob der Betreffende auf Monk oder gegen ihn gewettet hatte. Zum dreizehnten Mal in Folge hatte er das Ergebnis des Münzwurfs richtig vorhergesagt. Manchmal Kopf, manchmal Zahl. Jedes Mal mit Erfolg. Monk und Gray wurde dafür kostenlos nachgeschenkt.
Der Barmann ging geduckt unter dem Maskottchen der Taverne hindurch – einem Brett mit einem Eberkopf, der im Moment eine rote Weihnachtsmütze aufhatte – und brachte ihnen einen Krug Guinness.
Als das Dunkelbier in ihren Gläsern anstieg, zwängte sich ein Bulle von einem Mann zwischen sie und hätte Gray beinahe vom Hocker gestoßen. Sein Atem roch nach Whiskey und Fett. »Das ist doch ein Trick … ein beschissener Trick. Die Münze ist präpariert.«
Er entriss Monk die Münze und beglotzte sie mit trübem Blick.
Ein anderer Gast – offenbar ein Freund des Mannes – versuchte ihn wegzuziehen. Sie glichen einander fast wie ein Ei dem anderen; beide waren Ende zwanzig, hatten die Ärmel ihrer Blazer hochgeschoben und hatten den gleichen Haarschnitt. Lobbyisten – möglicherweise Anwälte, vermutete Gray. Jedenfalls hatten sie sich EHEMALIGEVERBINDUNGSKUMPEL auf die Stirn gestempelt.
»Komm schon, Bryce«, versuchte der weniger Betrunkene, ihn zu besänftigen. »Der Typ hat ein halbes Dutzend verschiedene Münzen verwendet. Auch einen Nickel. Die Münze war bestimmt nicht präpariert.«
»Scheiß drauf. Das ist ein Betrüger.«
Bei dem Versuch, sich aus dem Griff seines Freundes zu lösen, verlor Bryce das Gleichgewicht. Als er nach Halt suchte, schwenkte sein Ellbogen in Richtung von Grays Gesicht.
Gray wich rechtzeitig aus und spürte den Luftzug des Arms an der Nase. Der Arm traf die Bedienung, die ein Tablett auf der Schulter balancierte, an der Seite. Gläser, Teller und verschiedene Gerichte – hauptsächlich Tater Tots und Fritten – flogen durch die Luft.
Gray sprang auf und legte der jungen Frau den Arm um die Hüfte. Er hielt sie aufrecht und schirmte sie von den Glassplittern ab, die gegen die Theke flogen.
Monk war ebenfalls aufgesprungen und baute sich dicht vor dem Betrunkenen auf. »Verschwinde, Freundchen, sonst …«
»Was, sonst?«, fragte Bryce. Er ließ sich nicht einschüchtern, zumal Monks rasierter Schädel ihm gerade mal bis zur Schulter reichte.
Monk musste den Kopf in den Nacken legen, um sein Gegenüber anzufunkeln. Dass er mit seinem dicken Wollpullover, der die Muskeln verbarg, die er bei seinem jahrelangen Dienst bei den Green Berets erworben hatte, pummelig wirkte, machte es auch nicht besser. Auch die fröhliche Weihnachtsbaumstickerei auf dem Pullover – ein Geschenk seiner Frau – würde Bryce nicht dazu bewegen, den Rückzug anzutreten.
Gray, dem die sich aufbauende Anspannung nicht entging, ließ die Frau los. »Alles in Ordnung?«
Sie nickte und brachte sich vor den Streithähnen in Sicherheit. »Ja, danke.«
Der Barmann beugte sich vor und zeigte zum Ausgang. »Tragt das draußen aus, Leute.«
Inzwischen waren weitere Verbindungskumpel von Bryce dazugestoßen, bereit, ihren Freund zu unterstützen.
Na großartig.
Gray langte an Bryce vorbei, um Monk aus der Gefahrenzone zu holen. »Lass uns verschwinden.«
Ehe er seinen Freund packen konnte, bekam Gray einen Stoß in den Rücken. Vermutlich von einem der Typen, die glaubten, er wolle ihrem Freund ans Leder. Er prallte gegen Bryce, der aufbrüllte wie ein gereizter Bulle.
Er setzte zu einem auf Monks Kiefer gezielten Schwinger an.
Monk duckte sich und fing die Faust des Mannes mit der Hand ab.
Bryce grinste höhnisch und spannte die im Fitnesscenter antrainierten Muskeln an, um sich loszureißen. Dann drückte Monk mit den Fingern zu. Das verächtliche Grinsen verzerrte sich zur Grimasse.
Monk zwang Bryce in die Knie. Seine Hand war in Wahrheit eine Prothese, ausgestattet mit modernster Militärtechnik. Von einer richtigen Hand nahezu ununterscheidbar, konnte sie Walnüsse knacken – oder in diesem Fall auch die Knochen eines betrunkenen Finsterlings.
Jetzt war es an Bryce, den Kopf in den Nacken zu legen.
»Ich sage es dir nur noch ein Mal, Freundchen«, zischte Monk. »Verzieh dich!«
Einer von Bryce’ Unterstützern wollte eingreifen, doch Gray blockte ihn mit der Schulter ab und fixierte ihn mit eisigem Blick. Anders als bei Monk wurde Grays eins achtzig große Gestalt nicht von einem dicken Pullover kaschiert, sondern von einem eng geschnittenen Pulli akzentuiert. Außerdem hatte er sich seit zwei Tagen nicht mehr rasiert. Er war sich bewusst, dass die dunklen Stoppeln sein kantiges Gesicht noch brutaler erscheinen ließen.
Bryce’ Unterstützer witterte anscheinend das Raubtier in ihrer Mitte und wich zurück.
»Sind wir hier fertig?«, fragte Monk seinen Gefangenen.
»Ja, Mann, okay.«
Monk ließ Bryce los und stieß ihn auf die Seite. Mit finsterem Blick stieg er über ihn hinweg, zwinkerte aber Gray zu. »Jetzt können wir verschwinden.«
Als Gray sich zum Gehen wandte, bemerkte er, dass Bryce’ Miene sich verdüsterte, die einzige Vorwarnung. Nachdem man ihn vor den Augen seiner Kumpel gedemütigt hatte, wollte er offenbar das Gesicht wahren. Befeuert von einer toxischen Mischung aus Whiskey und Testosteron, schnellte er hoch und sprang Monk von hinten an.
Jetzt reicht es aber …
Gray packte Bryce’ Faust, als der Mann an ihm vorbeischoss. Er nutzte Masse und Schwung des Angreifers, um ihm den Arm fachmännisch auf den Rücken zu drehen. Dann hob er Bryce hoch, bis dessen Füße sich vom Boden lösten, achtete aber darauf, ihm nicht die Rotatorenmanschette abzureißen.
Jetzt, da er Bryce fest im Griff hatte, machte er Anstalten, ihn wieder abzusetzen. Bryce aber hatte noch immer nicht genug. Er wand sich, versuchte, Gray mit dem Ellbogen zu treffen, und hätte vor Wut beinahe um sich gespuckt.
»Du Arschloch. Meine Freunde und ich machen dich alle …«
So viel zur vernünftigen Zurückhaltung.
Gray riss den Arm seines Gegners nach oben. Die Schulter knackte vernehmlich, und Bryce erstarb die Drohung auf den Lippen.
»Jetzt gehört er euch!«, rief er und schob Bryce in die Arme seiner Freunde.
Niemand fing ihn auf.
Mit einem Schmerzensschrei fiel Bryce auf den Bauch. Gray starrte dessen Kumpel an, forderte sie wortlos heraus, ihn anzugreifen. Hinter der Theke sah er sein Spiegelbild. Sein glattes aschbraunes Haar war zerzaust, sein Gesicht dunkel verschattet, seine eisblauen Augen funkelten drohend.
Da sie die Botschaft verstand, zog sich die Gruppe in die Tiefe der Bar zurück.
Zufrieden darüber, dass die Angelegenheit erledigt war, wandte Gray sich um und ging hinaus. Monk traf er vor dem Eingang an. Sein Freund, der unendlich viel vertragen konnte, betrachtete das Neonschild des indischen Restaurants nebenan.
Ohne sich umzudrehen, fragte Monk: »Weshalb hast du so lange gebraucht?«
»Ich musste zu Ende bringen, was du angefangen hast.«
Monk zuckte mit den Schultern. »Hab mir schon gedacht, dass du ein bisschen Dampf ablassen musstest.«
Gray runzelte die Stirn, musste aber zugeben, dass die kurze Auseinandersetzung ihn weit besser abgelenkt hatte als die vielen Pint Guinness.
Monk zeigte auf das Restaurantschild, doch Gray winkte ab. »Denk nicht mal dran.« Er sah auf die Uhr und trat an den Bordstein. »Außerdem werden wir von vier Ladys erwartet.«
»Da hast du recht.« Monk trat neben ihn, als Gray ein Taxi anhielt. »Und ich weiß, dass zwei von denen nicht ohne Gutenachtkuss einschlafen.«
Damit meinte er Penny und Harriet, seine beiden Töchter, die von ihren besseren Hälften beaufsichtigt wurden. Monks Frau Kat hatte die Mädchen zu Grays Haus in Takoma Park mitgenommen, einem Vorort von D. C. Monks Familie übernachtete dort, um den Weihnachtsmorgen zusammen mit Gray und Seichan zu verbringen, die im achten Monat schwanger war. Die beiden Männer hatten sie am Abend weggescheucht. Kat hatte erklärt, sie wollten Geschenke einpacken, doch obwohl Captain Kathryn Bryant beim Geheimdienst gearbeitet hatte, durchschaute Gray die Ausrede mühelos. Seichan war ungewöhnlich angespannt, von dem, was bevorstand, überwältigt, und Kat wollte sich ungestört mit ihr unterhalten – von erfahrener Frau zu werdender Mutter.
Gray vermutete jedoch, dass auch er seine Nerven hatte beruhigen müssen. Er drückte seinem Freund den Oberarm, ein wortloser Dank. Monk hatte recht. Er hatte ein bisschen Dampf ablassen müssen.
Das Taxi hielt, und sie stiegen ein.
Als sie unterwegs waren, drückte Gray stöhnend den Kopf ins Polster. »Ich habe seit Jahren nicht mehr so viel getrunken.« Er blickte Monk vorwurfsvoll an. »Und ich glaube, die DARPA wäre nicht sonderlich erfreut zu erfahren, dass du deren neueste Hardware dazu verwendest, dir Freibier zu erschwindeln.«
»Einspruch.« Monk ließ aus dem Nichts eine Münze auftauchen und warf sie hoch. »Man hat mir ausdrücklich geraten, die feinmotorische Steuerung zu trainieren.«
»Aber dieser Verbindungskumpel hatte trotzdem recht. Du hast geschwindelt.«
»Wenn Können im Spiel ist, ist es kein Schwindel.«
Gray verdrehte die Augen, worauf sich das Innere des Taxis zu drehen begann. Vor fünf Monaten hatte man Monk ein experimentelles Gehirn-Maschine-Interface implantiert. Mehrere Mikroelektroden von der Größe eines Zehncentstücks waren mit dem somatosensorischen Kortex von Monks Gehirn verbunden. Sie ermöglichten es ihm, die Neuroprothese mittels Gedanken zu steuern, und übermittelten ihm sogar »Sinneseindrücke« der Gegenstände, die sie berührte. Da er Gegenstände im Raum auf diese Weise besser wahrnehmen und handhaben konnte, vermochte er eine Münze aufgrund der verbesserten Feinmotorik so präzise zu werfen, dass er die Seite, die oben landen würde, vorhersagen konnte.
Zunächst hatte Gray sich über diesen »Trick« amüsiert, doch dann hatte sich ein ungutes Gefühl eingestellt. Den Grund konnte er nicht genau benennen. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass er aufgrund eines Münzwurfs eine geliebte Frau verloren hatte. Oder es war ganz anders, und der Grund war seine Angst davor, in Kürze Vater zu werden. Die Beziehung zu seinem Vater, der seinen Jähzorn auch an den Sohn weitergegeben hatte, war nicht besonders gut gewesen.
Er hatte noch immer das Knacken der Schulter in den Ohren. Tief in seinem Innern wusste er, dass er den Mistkerl hätte unterwerfen können, ohne ihn zu verletzen, doch es war mit ihm durchgegangen. Das machte ihm zu schaffen.
Was für ein Vater werde ich sein? Was werde ich meinem Kind vermitteln?
Er schloss die Augen, um das Schwindelgefühl zu unterbinden. Im Moment wusste er nur, dass er froh war, nach Hause unterwegs zu sein. Er dachte an Seichan. Vor acht Monaten war sie ein wahrer Hingucker gewesen. Die Schwangerschaft hatte sie noch schöner, noch verführerischer gemacht. Er hatte schon vorher sagen hören, dass Schwangere eine besondere Ausstrahlung hätten, doch mit jedem Monat war ihm dies deutlicher geworden. Der mandelfarbene Teint – den sie ihrer eurasischen Abstammung verdankte – hatte jetzt einen Schimmer, der ihm den Atem verschlug. Ihre smaragdgrünen Augen glühten; ihr schwarzes Haar glänzte wie die Schwingen eines Raben im Flug. Und die ganze Zeit über machte sie Sport und Dehnübungen, als konzentrierte sie sich mit aller Kraft darauf, ihre Leibesfrucht zu schützen.
»Zahl«, flüsterte neben ihm Monk.
Gray schlug die Augen auf und sah, wie der Vierteldollar auf der Hand seines Freundes landete. George Washingtons Silhouette funkelte auf der Handfläche. Gray hob eine Braue.
Monk zuckte mit den Schultern. »Wie gesagt, ich muss noch üben.«
»Oder du brauchst die Aussicht auf ein Freibier.«
»Hey, hör auf, dich zu beklagen. Du solltest besser anfangen, jeden Nickel, Dime und Vierteldollar zu sparen.« Er warf noch einmal die Münze. »Pampers sind nicht billig.«
Ob aufgrund dieser Warnung oder wegen des Münzwurfs, jedenfalls flackerte Grays Besorgnis wieder auf. Bald darauf aber bogen sie in seine Straße ab, und die Unruhe ließ nach.
Holzhäuser und solche im viktorianischen Stil säumten die Straße. Es war kühl geworden, Eisnebel hing in der Luft. Die Sterne leuchteten fahl am Himmel, keine Konkurrenz für die Lichterketten, die leuchtenden Rentiere in den Vorgärten und die Weihnachtsbäume in den Fenstern.
Als das Taxi vor seinem Bungalow hielt, blickte er zu der mit blinkenden Eiszapfen geschmückten Veranda hinüber. Monk hatte ihm vor zwei Wochen beim Aufhängen geholfen. Gray stellte sich vor, wie es sein würde, hier eine Familie großzuziehen, auf dem Hof zu spielen, aufgeschürfte Knie zu verbinden, Zeugnisse zu loben und an Schulaufführungen teilzunehmen.
So sehr er daran glauben wollte, es gelang ihm nicht. Es erschien ihm unmöglich. Wie konnte jemand wie er, an dessen Händen so viel Blut klebte, darauf hoffen, ein normales Leben zu führen?
»Da stimmt was nicht«, sagte Monk.
Abgelenkt von seinen Sorgen, war es Gray zunächst entgangen. Er und Seichan hatten zum ersten Mal gemeinsam einen Weihnachtsbaum geschmückt. Sie hatten wochenlang den Schmuck ausgesucht und sich auf einen sündhaft teuren Swarovski-Engel für die Baumspitze geeinigt. Seichan hatte gemeint, er sei das Geld wert und werde ein Familienerbstück werden – ein weiteres erstes Mal. Sie hatten den Weihnachtsbaum vor dem vorderen Erkerfenster aufgestellt.
Er war verschwunden.
Die Vordertür stand offen. Gray konnte erkennen, dass der Türrahmen gesplittert war. Er beugte sich zum Fahrer vor. »Rufen Sie die Polizei.«
Monk war bereits aus dem Wagen gesprungen und lief zur Haustür.
Gray rannte ihm nach und hielt nur kurz inne, um die SIG Sauer P365 aus dem Wadenholster zu ziehen. Von Entsetzen geschüttelt, wurde ihm klar, dass er recht gehabt hatte.
Er würde niemals ein normales Leben führen.
22:18
Monk nahm die Verandatreppe im Sprung. Das Herz klopfte ihm bis zum Hals, er bekam kaum Luft. In Panik stürzte er ins Haus, bewaffnet allein mit seinen Fäusten. In den fünf Jahren bei den Green Berets hatte er gelernt, eine Situation blitzschnell einzuschätzen. Mit seinen geschärften Sinnen nahm er alle Einzelheiten wahr.
… den umgeworfenen Weihnachtsbaum am Erkerfenster.
… die gesplitterte Glasplatte des Couchtischs.
… die in zwei Hälften zerbrochene Stickley-Garderobe.
… den Dolch, der im Treppengeländer steckte.
… den an der Wand zusammengeschobenen Teppich.
Gray kam hinter ihm ins Zimmer gestürmt, mit beiden Händen eine Pistole haltend. Mit den Ohren, der Haut und all seinen anderen Sinnen nahm er die lastende Stille wahr.
Hier ist niemand mehr.
Das wusste er mit absoluter Gewissheit.
Trotzdem wies Gray mit dem Kinn zur Treppe. Monk nahm drei Stufen auf einmal, während Gray das Erdgeschoss absuchte. Die Mädchen hätten bereits im Bett sein sollen. Er dachte an die sechsjährige Penelope mit ihrem strohblonden Pferdeschwanz, der Weihnachtspyjama mit tanzenden Rentieren geschmückt. Und an ihre Schwester mit dem kastanienbraunen Haar, ein Jahr jünger, aber älter wirkend, stets ernst, immer eine Frage auf den Lippen.
Zuerst lief er ins Gästezimmer, wo die Mädchen von ihren in buntes Papier eingepackten Geschenken und Zuckerstangen hätten träumen sollen. Die gemachten Betten waren unberührt, das Zimmer leer. Er rief ihre Namen, sah in den Schränken nach und durchsuchte die anderen Räume, jedes Mal mit dem gleichen Ergebnis.
Genau wie befürchtet.
Verschwunden … alle verschwunden.
Ihm wurde übel, und sein Gesichtsfeld verengte sich auf Stecknadelgröße, als er die Treppe hinunterstolperte.
»Gray …« Es klang wie ein Schluchzen.
Die Antwort kam aus der kleinen Küche, die auf den Hof hinausging. »Hier!«
Monk lief durchs verwüstete Wohnzimmer, vorbei am Esstisch, der zur Seite geschoben war und ihm im Weg stand. Zwei Stühle lagen am Boden. Er versuchte, nicht an den Kampf zu denken, der hier stattgefunden haben musste.
Er stürmte in die Küche, wo die Kampfspuren noch offensichtlicher waren. Die Kühlschranktür stand offen. Messer, Pfannen und Porzellanscherben lagen auf dem Boden und der freistehenden Arbeitstheke. Eine Schranktür hing schief an einer Angel.
Erst als er um die Kücheninsel herumtrat, sah er Gray, der auf dem Holzboden kniete. Vor ihm lag eine Gestalt.
Monk stockte der Atem.
Kat …
Gray richtete sich auf. »Sie lebt … schwacher Puls, aber sie atmet.«
Monk ließ sich auf den Boden fallen und machte Anstalten, sie in die Arme zu schließen.
Gray hinderte ihn daran. »Nicht bewegen.«
Beinahe hätte Monk seinen Freund geboxt, denn er wollte um sich schlagen, wusste aber, dass Gray recht hatte.
Kat hatte mehrere Schnittwunden an den Armen, aus denen dunkles Blut sickerte. Auch aus der Nase und dem linken Ohr kam Blut. Die Augen waren halb offen, zeigten aber das Weiße. Aus dem Augenwinkel sah er einen Küchenhammer aus Edelstahl. An einer Ecke des schweren Küchengeräts klebte blutverschmiertes kastanienbraunes Haar.
Behutsam legte er die Hände um Kats Handgelenk. Mit den Prothesenfingern tastete er nach ihrem Puls. Deren Kunsthaut war empfindlicher als echte Haut. Er beurteilte den Herzschlag, stellte sich die Kontraktionen von Kammer und Vorhof vor. Er schob die Prothesenhand zu ihrem Zeigefinger. Mittels Gedankenbefehl aktivierte er in einem Finger ein Infrarotlicht und in einem anderen einen Fotodetektor. Das Licht, das Kats Fingerspitze durchdrang, ermöglichte ihm eine Näherungsmessung des Sauerstoffgehalts ihres Bluts.
Zweiundneunzig Prozent.
Nicht großartig, aber auch nicht besorgniserregend. Wenn der Wert noch weiter fiel, müsste sie mit Sauerstoff versorgt werden.
Monk war bei den Berets Sanitäter gewesen. Seitdem hatte er sich fortgebildet, mit dem Schwerpunkt auf Medizin und Biotechnologie. Er und Gray – so wie Kat und Seichan – arbeiteten für die Sigma Force, eine geheime Gruppe, die der DARPA angegliedert war, der Forschungs- und Entwicklungsbehörde des Verteidigungsministeriums. Bis auf Grays Partnerin waren sie alle ehemalige Angehörige der Spezialkräfte, von Sigma eingestellt und in verschiedenen wissenschaftlichen Fächern ausgebildet worden. Jetzt arbeiteten sie als Agents für die DARPA und schützten die Vereinigten Staaten und die ganze Welt vor allen möglichen Bedrohungen.
Gray hielt bereits das Satellitentelefon in der Hand und wählte die Nummer der Einsatzzentrale von Sigma.
»Und Seichan?«, fragte Monk.
Gray schüttelte den Kopf, sein Gesicht eine Grimasse des Zorns und der Angst.
Monk blickte zur Küchentür, die zum dunklen Hof offen stand. Seine Frau hatte bestimmt gekämpft wie eine Löwin, um ihre Töchter zu schützen. »Könnte es sein, dass Seichan mit den Mädchen geflohen ist, während Kat die Angreifer aufgehalten hat?«
Gray blickte in die Dunkelheit hinaus. »Das ging mir auch schon durch den Kopf. Nachdem ich nach Kat gesehen hatte, habe ich nach Seichan gerufen.« Er schüttelte wieder den Kopf. »Wenn sie weggelaufen ist, kann sie nicht weit gekommen sein.«
»Vielleicht haben die Angreifer sie verfolgt«, sagte Monk. »Haben sie noch weiter von hier weggetrieben.«
»Wäre möglich.« Gray klang nicht hoffnungsvoll.
Also geht er wohl eher vom Gegenteil aus.
Monk hatte verstanden. Seichan war eine ehemalige Auftragskillerin und ebenso kampfstark wie Kat. Eher noch stärker. Doch im achten Monat schwanger und mit zwei verängstigten Kindern an der Seite konnte sie nicht weit gekommen sein.
Sie mussten davon ausgehen, dass Seichan und die Mädchen entführt worden waren.
Aber von wem? Und warum?