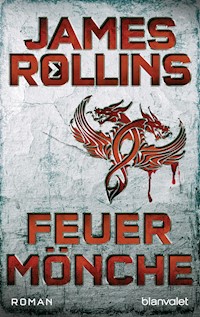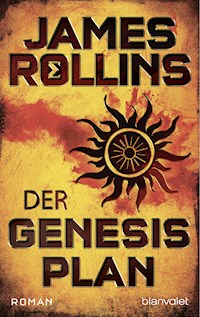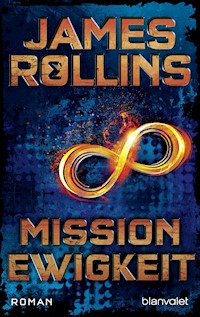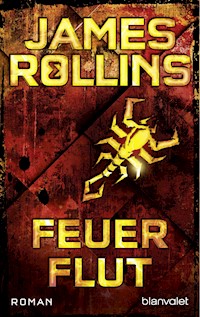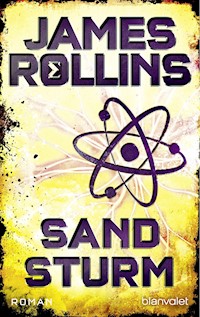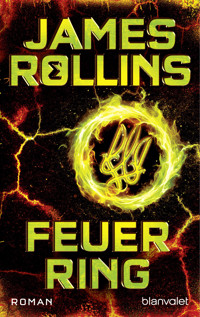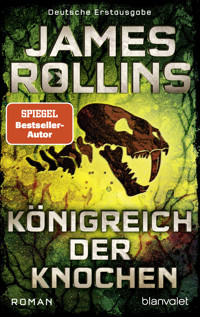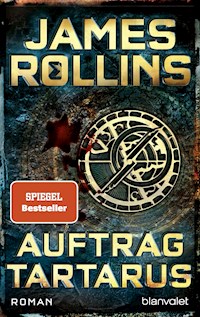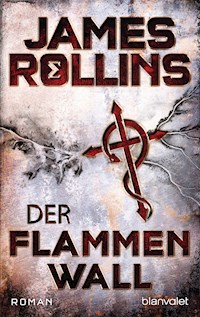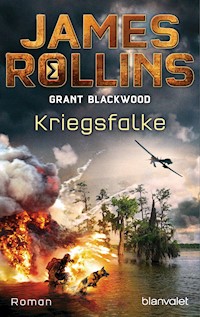8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Unter der Meeresoberfläche lauert tödliche Gefahr!
Ex-Navy-SEAL Jack Kirkland ist mitten in einer Unterwasser-Bergungsmission als plötzlich die Erde bebt und gewaltige Flutwellen den gesamten Planeten erschüttern. Die Air Force One mit dem amerikanischen Präsidenten an Bord stürzt ins Meer. Tiefseeexperte Kirkland erhält den Auftrag, die Black Box zu bergen, doch an der Absturzstelle macht er in den Tiefen des Ozeans eine verstörende Entdeckung: eine Kristallsäule mit unheimlichen Eigenschaften und einer rätselhaften Inschrift …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 711
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
James Rollins
Im Dreieck des Drachen
Roman
Deutsch von Alfons Winkelmann
Die Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel »Deep Fathom« bei HarperCollins Publishers Ltd, New York. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2001 by Jim Czajkowski
Published in agreement with the author, c/o Baror International, Inc., Armonk, New York, USA.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Blanvalet Verlag, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der deutschen Übersetzung by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
2003 erschienen im Ullstein Taschenbuch Verlag innerhalb der Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München.
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
wr · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-08502-5V002
www.blanvalet.de
Buch
Eine Sonnenfinsternis mit einer ungewöhnlich hohen Zahl von Sonnenstürmen löst ein gewaltiges Beben im Pazifik aus – mit katastrophalen Folgen: Von Alaska über Japan bis Neuseeland versinken Küstenregionen unter gigantischen Flutwellen. Und mitten in dem tödlichen Chaos stürzt die Air Force One des amerikanischen Präsidenten vom Himmel.
Der Tiefseespezialist Jack Kirkland erhält den Auftrag, die Black-box aus dem Flugzeugwrack zu bergen – in über sechshundert Metern Tiefe. Auf dem Meeresgrund entdeckt Kirkland eine Kristallsäule, die außer einer starken magnetischen Strahlung noch einige weit rätselhaftere Eigenschaften aufweist. Eine genaue wissenschaftliche Untersuchung des Phänomens bleibt Kirkland allerdings verwehrt, denn die CIA hat ganz eigene Pläne zur Erforschung und Nutzung der geheimnisvollen Energie. Was niemand ahnt: Das Beben war nur ein Vorbote einer ungleich verheerenderen Katastrophe, die auf die Erde zurast. Eine uralte Kraft droht, entfesselt zu werden …
Autor
James Rollins wurde 1968 in Chicago geboren. Er ist promovierter Veterinärmediziner und betreibt eine Tierarztpraxis in Sacramento, Kalifornien. Dort geht der Bestsellerautor, der mit seinen actionreichen Romanen immer wieder zahllose Leser begeistert, neben dem Schreiben auch seinen beiden anderen Leidenschaften nach: Höhlenforschung und Tauchen.
Von James Rollins außerdem lieferbar
Feuermönche (36738) · Der Genesis-Plan (36795) · Sandsturm (37292) · Der Judas-Code (37316) · Das Flammenzeichen (0345, geb. Ausgabe) · Das Messias-Gen (37217)
WIDMUNG UND DANKSAGUNG
Für Steve und Judy Prey …Lehrer, Freunde und Gründer der »Spacers«
Kein Mensch ist eine Insel, und ganz bestimmt kein Autor. So viele nette Leute und Freunde haben dabei geholfen, diesem Roman den letzten Schliff zu geben. Zuallererst möchte ich Lyssa Keusch, meiner Lektorin, und Russ Galen, meinem Agenten, meinen Dank aussprechen.
Mehrere Personen haben unschätzbare »technische Hilfe« geleistet, wenn es um den wissenschaftlichen und historischen Hintergrund ging: Stephen R. Fischer, Ph. D. (polynesische Sprachen); Dr. Charles Plummer vom CSUS (Geologie); Vera Rubin (Artikel über Astronomie); Dr. Phil Nuytten von Nuytco Research Ltd. sowie die Leute bei Zegrahm Deep Sea Voyages (Einzelheiten der Dynamik des Tiefseetauchens); Laurel Moore, Bibliothekar des Woods Hole Oceanografic Institution (sein Buch Ancient Micronesia, eine unschätzbare Quelle). Schließlich muss ich zwei weiteren Autoren meinen besonderen Dank aussprechen, deren Bücher diese Geschichte inspiriert haben: Colonel James Churchward mit seinem Books of the Golden Age sowie Charles Berlitz mit seinem The Dragon’s Triangle.
Natürlich darf ich nicht diejenigen vergessen, die dabei geholfen haben, den ersten Entwurf auseinanderzunehmen und aufzupolieren: Chris Crowe, Michael Gallowglas, Lee Garrett, Dennis Grayson, Penny Hill, Debra Nelson, Chris Koehler, Dave Meek, Chris Smith, Jane O’Riva, Steve und Judy Prey, Caroline Williams – sowie für ihre kritische Analyse und jahrzehntelange Freundschaft Carolyn McCray.
Und last but not least, besonderer Dank an Steve Winters vom Web Stew für sein Geschick bei der Internet-Recherche und Don Wagner für seine engagierte Unterstützung, die besser nicht hätte sein können.
PROLOG
Der Tag der Sonnenfinsternis Dienstag, 24. Juli
I
VORHER
8.14 Uhr, Pacific Standard Time San Francisco, Kalifornien
AM TAG DER Sonnenfinsternis verließ Doreen McCloud eilig das Starbucks. Sie hatte um zehn Uhr einen Termin auf der anderen Seite der Stadt, und für die U-Bahn-Fahrt zu ihrem Büro nahe am Embarcadero blieb ihr weniger als eine Stunde. Sie zitterte in der morgendlichen Kühle und umklammerte ihren Becher Mocha, als sie zügig zur U-Bahn-Station an der Kreuzung Market and Castro hinüberging.
Stirnrunzelnd schaute sie zum Himmel auf. Noch musste die Sonne, im Augenblick lediglich eine blasse Scheibe, die dichte Nebeldecke auflösen. Die Sonnenfinsternis war für kurz nach vier Uhr am heutigen Nachmittag angesagt – die erste des neuen Jahrtausends. Es wäre zu schade, würde der Nebel die Sicht verwehren. Die Medien hatten ein regelrechtes Trommelfeuer veranstaltet, und so wusste auch sie, dass die ganze Stadt sich bereithielt, das Ereignis zu feiern. Eine so günstige Gelegenheit konnte San Francisco unmöglich ohne das übliche Tamtam verstreichen lassen.
Doreen schüttelte den Kopf. Was für ein Unsinn! In San Francisco herrschte sowieso immer der verdammte Nebel, da rechtfertigten ein paar düstere Augenblicke mehr kaum die ganze Hektik. Zudem war es nicht mal eine totale Sonnenfinsternis!
Seufzend schob sie diese flüchtigen Gedanken beiseite und zog sich ihr Tuch fester um den Hals. Sie hatte wahrhaftig andere Sorgen. Wenn sie diese Sache mit der Delta Bank unter Dach und Fach brachte, war ihr eine Partnerschaft in der Kanzlei sicher. Dieser Gedanke munterte sie auf, während sie die Market Street in Richtung U-Bahn-Station überquerte.
Als sie dort ankam, fuhr gerade der nächste Zug ein. Mit zittrigen Fingern steckte sie ihre Karte in den Entwerter, eilte die Treppe zum Bahnsteig hinab und wartete darauf, dass die Bahn stehen blieb. Erleichtert, dass sie den Termin locker schaffen würde, hob sie den Becher an den Mund.
Ein Stoß gegen den Ellbogen riss ihn ihr von den Lippen. Er flog ihr aus den Händen, und heißer brauner Kaffee spritzte heraus. Nach Luft schnappend fuhr sie herum.
Eine ältere Frau in schlecht zueinander passenden Lumpen und löcheriger Decke starrte sie von unten her an, ihre Augen wirkten irgendwie abwesend. Doreen musste plötzlich an ihre Mutter denken, wie sie im Bett gelegen hatte: der Gestank nach Urin und Medikamenten, die eingefallenen Züge, dazu der gleiche leere Blick. Alzheimer.
Sie wich zurück und klemmte ihre Handtasche unter den Arm. Aber die Obdachlose stellte anscheinend keine unmittelbare Bedrohung dar. Doreen erwartete die übliche Frage nach etwas Kleingeld.
Stattdessen starrte die Frau sie weiterhin mit diesen leeren Augen an.
Doreen wich noch einen Schritt zurück. In ihren Ärger und ihre Furcht mischte sich ein Gefühl des Mitleids. Die anderen Pendler wandten sich langsam ab. Typisch Großstadt. Nur nicht zu genau hinsehen. Sie versuchte, es ihnen nachzutun, doch es gelang ihr nicht. Vielleicht war’s die Erinnerung an ihre Mutter, die längst im Grab lag, oder eine Art Mitgefühl. »Kann ich Ihnen helfen?«, hörte sie sich fragen.
Als die alte Frau sich rührte, entdeckte Doreen inmitten der Lumpen einen halb verhungerten Terrierwelpen. Das spindeldürre Geschöpf drückte sich dicht an die Füße seines Frauchens.
Die Obdachlose bemerkte ihren Blick. »Brownie weiß Bescheid«, sagte sie mit heiserer, vom Alter und vom Leben auf der Straße rau gewordener Stimme. »Er weiß Bescheid, ja, ja.«
Doreen nickte scheinbar verständnisvoll. Man sollte Verrückte am besten nicht provozieren, das hatte sie bei ihrer Mutter gelernt. »Ganz bestimmt.«
»Er sagt mir Dinge, weißt du.«
Erneut nickte sie, kam sich allerdings dabei auf einmal albern vor. Hinter ihr öffneten sich zischend die Türen des Zugs. Wenn sie ihn nicht verpassen wollte, musste sie sich beeilen.
Sie wollte sich schon abwenden, als ein welker Arm unter der löcherigen Decke hervorgeschossen kam; knochige Finger umklammerten ihr Handgelenk. Instinktiv riss Doreen ihren Arm weg. Zu ihrer Überraschung hielt die alte Frau sie weiterhin fest und schlurfte noch näher heran. »Brownie ist ein guter Hund«, sagte sie sabbernd. »Er weiß Bescheid. Er ist ein guter Hund.«
Doreen riss sich von der Frau los. »Ich … ich muss los.« Die Alte wehrte sich nicht. Ihr Arm verschwand in ihrer Decke.
Doreen wich in die offene Tür des Zugs zurück, den Blick nach wie vor auf die alte Frau geheftet, die sich jetzt offenbar wieder in ihre Lumpen und ihre qualvollen Träume zurückzog. Sie entdeckte, dass der Welpe ihren Blick erwiderte. Als sich die Zugtüren schlossen, hörte sie die Obdachlose murmeln: »Brownie. Er weiß Bescheid. Er weiß, dass wir alle heute sterben müssen.«
13.55 Uhr, PST (11.55 Uhr Ortszeit) Aleuten, Alaska
Am Morgen der Sonnenfinsternis arbeitete sich Jimmy Pomautuk geübt und vorsichtig den vereisten Hang hinauf. Sein Hund Nanook trabte ihm ein paar Schritt voraus. Der große Malamute kannte den Weg gut, doch hielt er, stets der getreue Gefährte, nach wie vor ein wachsames Auge auf seinen Herrn gerichtet.
Hinter dem alten Hund führte Jimmy drei englische Touristen – zwei Männer und eine Frau – auf den Gipfel des Glacial Point oberhalb von Fox Island. Die Aussicht von dort oben war unglaublich. Seine Inuit-Vorfahren waren dorthin gekommen, um den großen Orca anzubeten, hölzerne Totems zu errichten und Opfersteine über die steilen Felsen ins Meer zu werfen. Sein Urgroßvater war der Erste gewesen, der ihn zu diesem heiligen Ort mitgenommen hatte. Fast dreißig Jahre war das jetzt her. Damals war er noch ein Knabe gewesen.
Heutzutage war der Ort auf den meisten Karten verzeichnet, und die Schlauchboote der verschiedenen Kreuzfahrtlinien luden ihre menschliche Fracht an den Kais des zauberhaften Port Royson ab.
Neben dem malerischen Hafen galten die Felsen von Glacial Point als die andere Hauptattraktion der Insel. An einem klaren Tag wie heute konnte man die gesamte Inselkette der Aleuten überblicken, wie sie sich in einem unendlichen Bogen in die Ferne erstreckte. Dieser Anblick war Jimmys Vorfahren unbezahlbar gewesen; die moderne Welt hatte dafür jedoch vierzig Dollar pro Kopf in der Nebensaison und sechzig Dollar während der warmen Monate zu entrichten.
»Wie weit ist das denn noch, verdammte Scheiße?«, fragte eine Stimme hinter ihm. »Ich friere mir hier noch den Arsch ab!«
Jimmy wandte sich um. Er hatte die drei darauf aufmerksam gemacht, dass es immer kälter werden würde, je weiter sie sich dem Gipfel näherten. Die Gruppe war mit gleichartigen Overalls, Handschuhen und Stiefeln von Eddie Bauer ausgestattet. Kein einziger Faden ihrer teuren Kleidung zeigte auch nur eine Gebrauchsspur. Hinten am Parka der Frau baumelte sogar noch ein Preisschild.
Jimmy zeigte mit dem Arm in die Richtung, in die sein Hund gerade verschwunden war. »Gleich über die nächste Anhöhe. Fünf Minuten. Dort gibt’s eine Hütte zum Aufwärmen.«
Der Mann, der sich beklagt hatte, schaute knurrend auf seine Uhr.
Jimmy verdrehte die Augen und setzte seinen Marsch den Hügel hinauf fort. Wenn er nicht auf sein Trinkgeld als Führer verzichten wollte, sollte er besser der Versuchung widerstehen, die ganze Bande über die Felsen zu werfen. Ein Opfer an die Meeresgötter seiner Vorfahren. Also trabte er wie stets einfach weiter und erreichte schließlich den Gipfel.
Hinter sich hörte er die drei nach Luft schnappen. Die meisten Leute reagierten bei diesem Anblick so. Jimmy drehte sich um und wollte seine übliche Ansprache über die Bedeutung dieses Orts vom Stapel lassen, erkannte dann aber, dass seine Begleiter überhaupt nicht auf die grandiose Aussicht achteten, sondern damit beschäftigt waren, hastig jeden Quadratzentimeter bloßliegender Haut vor den milden Winden zu schützen.
»Ist das kalt!«, meinte der zweite Mann. »Hoffentlich zerspringt die Linse meiner Kamera nicht. Ich fände es absolut scheiße, wenn ich den ganzen verdammten Weg hier raufgewandert wäre und könnte nicht mal was vorzeigen.«
Jimmy ballte die Hände zu Fäusten. Er zwang sich, gleichmütig zu sprechen. »Die Hütte liegt zwischen der Gruppe schwarzer Kiefern da drüben. Warum gehen Sie nicht hin? Wir müssen noch ein bisschen auf die Sonnenfinsternis warten.«
»Gott sei Dank«, sagte die Frau. Sie lehnte sich an den Mann, der sich als Erster beklagt hatte. »Beeilen wir uns, Reggie.«
Jetzt bildete Jimmy das Schlusslicht. Die drei Engländer rannten auf das dürre Gestrüpp aus Kiefern zu, das geschützt in einer Senke lag. Nanook gesellte sich zu ihm und stieß mit der Nase gegen seine Hand – eine Aufforderung, ihn hinter dem Ohr zu kraulen.
»Guter Junge, Nanook«, murmelte Jimmy. Sein Blick fiel auf die Rauchspur im blauen Himmel. Wenigstens hatte sein Sohn seine Pflichten erfüllt und heute Morgen die Kohlen aufgelegt, bevor er zum Festland abgefahren war, um dort die Sonnenfinsternis mit Freunden zu feiern.
Einen äußerst merkwürdigen Augenblick lang überrollte Jimmy eine Woge der Melancholie beim Gedanken an seinen einzigen Sohn. Diese plötzliche Stimmung war ihm unerklärlich, und er schüttelte den Kopf. Das lag an diesem Ort. Irgendwer schien hier stets gegenwärtig zu sein. Vielleicht die Götter meiner Vorväter, dachte er nur halb im Scherz.
Jimmy ging weiter auf die wärmende Schutzhütte zu. Auf einmal wollte er der Kälte ebenso sehr entkommen wie die Touristen. Sein Blick folgte der Rauchspur zur Sonne tief am östlichen Horizont. Eine Finsternis. Seine Vorfahren hatten dazu gesagt, dass ein Wal die Sonne fraß. Die Verfinsterung sollte in den kommenden paar Stunden eintreten.
Plötzlich knurrte Nanook an seiner Seite, ein tief aus der Kehle kommender Laut. Jimmy sah zu ihm hinunter. Der Malamute starrte nach Süden. Stirnrunzelnd folgte er seinem Blick.
Von dem hölzernen Totem abgesehen waren die Felsen leer. Das Ding war übrigens eine Attrappe für die Touristen, irgendwo in Indonesien maschinell gefertigt und per Schiff hierherverfrachtet. Nicht einmal das Holz stammte aus diesen Breitengraden.
Nanook knurrte nach wie vor.
Jimmy konnte sich nicht erklären, was seinem Hund einen solchen Schrecken einjagte. »Ruhig, mein Junge.«
Gehorsam wie immer setzte sich Nanook, zitterte jedoch noch immer am ganzen Leib.
Mit zusammengekniffenen Augen schaute Jimmy über das leere Meer hinaus. Dabei kam ihm ein altes Gebet über die Lippen, das ihn sein Großvater gelehrt hatte. Er war überrascht, dass er sich sogar an den Wortlaut erinnerte, und hätte nicht sagen können, warum er den Drang verspürte, die Worte jetzt auszusprechen. Wenn man allerdings in Alaska überleben wollte, lernte man, der Natur und den eigenen Instinkten Respekt entgegenzubringen – und genau das tat Jimmy jetzt.
Es war, als stünde sein Großvater neben ihm, zwei Generationen, die hinaus aufs Meer schauten. Sein Großvater hatte einen Ausdruck für Augenblicke wie diesen: »Der Wind riecht nach Sturm.«
16.05 Uhr PST (10.05 Uhr Ortszeit) Hagatna, Guam
Jeffrey Hessmire verfluchte sein Pech, während er durch die Korridore des Regierungsgebäudes eilte. Es war der Tag der Sonnenfinsternis, und die erste Sitzung des Gipfeltreffens war für einen frühen Brunch unterbrochen worden. Die Staatschefs der Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China würden laut Terminplan erst anschließend wieder zusammentreffen.
Als Praktikant war Jeffrey mit der Aufgabe betraut worden, während der Sitzungspause die Notizen zu tippen und zu fotokopieren, die der Außenminister sich am Morgen gemacht hatte, und sie dann unter der amerikanischen Delegation zu verteilen. Während sich also die anderen Mitarbeiter am Buffet im Innenhof gütlich taten und ihre Netze zu den Mitgliedern des Präsidentenstabs spannen, musste er den Stenografen spielen.
Was taten sie eigentlich hier draußen mitten im Pazifik? Eher würde ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen, als dass die beiden Pazifik-Mächte jemals ein atomares Abrüstungsabkommen schließen würden. Keines der beiden Länder wollte nachgeben, insbesondere nicht bei zwei entscheidenden Punkten. Der Präsident hatte darauf bestanden, dass auch Taiwan unter den Schutz des allerneuesten Raketenabwehrsystems seines Landes stehen sollte, und der Ministerpräsident der Chinesen hatte jeglichen Vorstoß abgewehrt, die Anzahl der eigenen Interkontinentalraketen mit Nuklearsprengköpfen zu begrenzen. Der einzige Erfolg dieses einwöchigen Gipfeltreffens hatte lediglich darin bestanden, dass die Spannungen zwischen beiden Ländern noch größer geworden waren.
Es hatte nur einen einzigen Lichtblick gegeben, und das war gleich am ersten Tag die Annahme eines Geschenks des chinesischen Ministerpräsidenten durch Präsident Bishop gewesen: die lebensgroße Jadeskulptur eines alten chinesischen Kriegers auf einem Streitross, die Kopie einer ihrer berühmten Terrakotta-Statuen aus der Stadt Xi’an. Die Presse hatte ihren großen Tag gehabt, als sie die beiden Staatsoberhäupter neben der prächtigen Figur fotografiert hatte. Es war ein Tag voller Versprechen gewesen, die bislang unerfüllt geblieben waren.
Als Jeffrey die Bürosuite betrat, die ihrer Delegation zugewiesen worden war, ließ er kurz seinen Ausweis bei dem Wachmann aufblitzen, der kalt nickte. An seinem Schreibtisch angekommen, fiel er in den Ledersessel. Obwohl ihm eine solche Fronarbeit zuwider war, würde er sein Bestes geben.
Er stapelte sorgfältig die handgeschriebenen Notizen neben seinem Computer und machte sich an die Arbeit. Seine Finger flogen nur so über die Tasten, als er Außenminister Elliots Notizen in saubere, klare Maschinenschrift übertrug. Während er dort arbeitete, schwand nach und nach seine Enttäuschung. Dieser Blick hinter die Kulissen der Politik auf höchster Ebene faszinierte ihn. Anscheinend war der Präsident tatsächlich gewillt, bei Taiwan nachzugeben, feilschte jedoch mit der chinesischen Regierung um den Preis dafür. Er beharrte auf einem Moratorium im Hinblick auf einen zukünftigen Ausbau der atomaren Sprengkörper, darüber hinaus auf einer chinesischen Beteiligung am Missile Technology Control Regime, das den Export von Lenkwaffen-Knowhow begrenzte. Elliot war offenbar der Ansicht, dass ein solches Ergebnis durchaus im Bereich des Möglichen lag, wenn sie nur ihre Karten richtig ausspielten. Den Chinesen war nicht an einem Krieg wegen Taiwan gelegen, unter dem alle zu leiden haben würden.
Jeffrey war so in die Notizen des Außenministers vertieft, dass er nicht mitbekam, wie jemand an ihn herantrat. Erst ein Husten hinter ihm ließ ihn hochschrecken. Er drehte hastig seinen Sessel um und sah den groß gewachsenen, silberhaarigen Mann vor sich, der leger mit Hemd und Krawatte gekleidet war und ein Sakko über dem Arm hängen hatte. »Was halten Sie also von der Sache, Mr Hessmire?«
Jeffrey erhob sich so hastig, dass sein Sessel zurückrutschte und gegen einen benachbarten, verlassenen Schreibtisch stieß. »M … Mister President!«
»So beruhigen Sie sich doch, Mr Hessmire.« Der Präsident der Vereinigten Staaten, Daniel R. Bishop, beugte sich über Jeffreys Schreibtisch und las die teilweise fertig gestellte Transkription der Notizen des Außenministers. »Was halten Sie von Toms Überlegungen?«
»Von denen des Außenministers? Mr Elliot?«
Der Präsident richtete sich auf und lächelte Jeffrey müde an. »Ja. Sie haben in Georgetown internationales Recht studiert, nicht wahr?«
Jeffrey war überrascht. Er hätte nie gedacht, dass ihn Präsident Bishop unter den Hunderten anderer Praktikanten erkennen würde, die im Bauch des Weißen Hauses arbeiteten. »Ja, Mr President. Ich lege kommendes Jahr mein Examen ab.«
»Jahrgangsbester und spezialisiert auf Asien, wie ich gehört habe. Was halten Sie also vom Gipfeltreffen? Sind Sie der Meinung, wir können eine Übereinkunft mit den Chinesen herausschinden?«
Jeffrey leckte sich die Lippen. Er war außerstande, Daniel Bishop, dem Kriegshelden, dem Staatsmann und Führer der freien Welt, in die stahlblauen Augen zu sehen. Seine Worte waren lediglich ein Gemurmel.
»Lauter, mein Junge. Ich werde Ihnen schon nicht den Kopf abreißen. Ich möchte lediglich Ihre ehrliche Meinung hören. Warum habe ich wohl Tom gebeten, Ihnen diese Aufgabe zu übertragen?«
Verblüfft blieben Jeffrey die Worte im Hals stecken. Das hätte er nicht gedacht.
»Holen Sie tief Luft, Mr Hessmire.«
Er beherzigte die Empfehlung des Präsidenten, holte tief Luft, räusperte sich und versuchte, seine Gedanken zu sammeln. Langsam sagte er: »Ich … ich bin der Ansicht, Außenminister Elliot hatte völlig recht mit seiner Annahme, dass die Festlandchinesen Taiwan gern ökonomisch vereinnahmen würden.« Er sah auf und schöpfte erneut Atem. »Ich habe die Rückgabe von Hongkong und Macau an China studiert. Anscheinend benutzen die Chinesen diese Regionen als Testgebiete für die Integration demokratischer ökonomischer Strukturen innerhalb einer kommunistischen Struktur. Einige vermuten, dass diese Experimente als Vorbereitung für Chinas Versuche dienen, über Taiwans Integration zu verhandeln. Sie sollen zeigen, wie sehr alle von einer solchen Vereinigung profitieren können.«
»Und was ist mit Chinas wachsendem nuklearem Arsenal?«
Jeffrey sprach fließender, da er sich an der Debatte erwärmte. »Sie haben uns die Kenntnisse auf dem Gebiet der Kernwaffen- und Raketentechnologien gestohlen. Aber China ist von seiner gegenwärtigen Infrastruktur her gesehen nicht in der Lage, diese neuesten Technologien auch anwenden zu können. In vielerlei Hinsicht handelt es sich immer noch um einen Agrarstaat, der schlecht für eine rasend schnelle Ausweitung seines nuklearen Arsenals gerüstet ist.«
»Und Ihre Schlussfolgerung?«
»Die Chinesen haben genau beobachtet, wie eine solche Hochrüstung die Sowjetunion in den Ruin getrieben hat. Den gleichen Fehler werden sie nicht begehen wollen. Im kommenden Jahrzehnt muss China seine eigene technologische Infrastruktur stärken, wenn es seine globale Stellung beibehalten will. Es kann sich ein Wettpinkeln um Atomraketen mit den Vereinigten Staaten nicht leisten.«
»Ein Wettpinkeln?«
Jeffrey bekam große Augen, und sein Gesicht verfärbte sich tiefrot. »Tut mir leid …«
Der Präsident hob eine Hand. »Nein, nein, ich weiß den Vergleich durchaus zu schätzen.«
Plötzlich kam sich Jeffrey wie ein Trottel vor. Was hatte er da für einen Unsinn von sich gegeben? Wie konnte er wagen zu glauben, er dürfe mit seinen Ansichten Präsident Bishops Zeit beanspruchen?
Der Präsident ließ den Schreibtisch los, richtete sich auf und schlüpfte in sein Sakko. »Ich glaube, Sie haben recht, Mr Hessmire. Keines von beiden Ländern möchte es auf einen neuen Kalten Krieg ankommen lassen.«
»Nein, Sir«, murmelte Jeffrey leise.
»Vielleicht können wir darauf hoffen, die Sache zu bereinigen, bevor unsere Beziehungen sich weiter verschlechtern, aber das wird einer geschickten Hand bedürfen.« Der Präsident ging zur Tür. »Bringen Sie Ihre Arbeit hier zum Abschluss, Mr Hessmire, und kommen Sie dann zum Fest im Innenhof herunter. Sie sollten sich die erste Sonnenfinsternis des neuen Jahrtausends nicht entgehen lassen.«
Jeffrey merkte, dass der Kloß in seinem Hals zu dick war, um Antwort geben zu können, als der Präsident den Raum verließ. Er tastete nach seinem Schreibtischstuhl und sank hinein. Präsident Bishop hatte ihm zugehört … ihm zugestimmt!
Er dankte den Sternen für so viel Glück, setzte sich kerzengerade auf und machte sich mit frischen Kräften wieder an die Arbeit.
An diesen Tag würde er bestimmt noch lange zurückdenken.
II
WÄHRENDDESSEN
16.44 Uhr, Pacific Standard Time San Francisco, Kalifornien
VOM BALKON IHRES Büros hatte Doreen McCloud einen weiten Blick über die San Francisco Bay bis hinüber zu den Molen. Sie erkannte sogar die auf dem Ghirardelli Square versammelten Menschen. Dort war eine Party im Gange, aber sie verlor rasch das Interesse an der Menge unten, denn so etwas wie drüben jenseits der Bay bekäme sie wohl nie mehr im Leben zu Gesicht.
Über dem blauen Wasser hing eine schwarze Sonne, deren Korona hell um die Scheibe des Mondes aufflammte.
Doreen, die eine bei Sharper Image erworbene schmale Sonnenbrille trug, beobachtete, wie lange feurige Streifen vom Rand der Sonne hervorschossen. Sonnenstürme, Flares. Die Astronomieexperten beim CNN hatten eine aufsehenerregende Finsternis vorausgesagt, denn das Ereignis wurde von einer Periode mit einer ungewöhnlich hohen Zahl Sonnenflecken begleitet. Ihre Vorhersagen hatten sich als zutreffend erwiesen.
Die anderen Anwälte und Sekretärinnen links und rechts von ihr stießen Seufzer des Entzückens und der Ehrfurcht aus.
Ein langes Flare schoss von der Sonnenoberfläche hoch. In einem Radio, das im Hintergrund lief, knisterte und knackte es entsetzlich; ein Beweis für die Wahrheit einer weiteren Ankündigung der Astronomen. CNN hatte vorhergesagt, dass die höhere Zahl der Sonnenflecken und die damit verbundene Strahlungsaktivität kurze Interferenzen hervorrufen würden, wenn der Sonnenwind die obere Atmosphäre bombardierte.
Doreen bestaunte die schwarze Sonne und deren Spiegelbild in der Bay. Wie wunderbar, das erleben zu dürfen!
»Hat das noch jemand gemerkt?«, fragte eine der Sekretärinnen mit einem Anflug von Besorgnis.
Da spürte es Doreen – ein Zittern unter den Füßen. Es wurde totenstill. Im Radio knisterte und knackte es fürchterlich. Blumentöpfe begannen zu klappern.
»Erdbeben!«, kreischte jemand überflüssigerweise.
Nachdem sie jetzt so viele Jahre in San Francisco gelebt hatte, waren leichte Beben kein Grund zur Panik mehr. Dennoch hatte natürlich jeder ständig Angst vor dem »Großen Beben«.
»Alle rein!«, ordnete der Chef der Kanzlei an.
Die Leute schubsten und drängelten, um die offenen Balkontüren zu erreichen. Doreen blieb zurück und suchte den Himmel über der Bucht ab. Die schwarze Sonne hing wie ein Loch im Firmament über dem Wasser.
Da kam ihr die andere Vorhersage für diesen Tag wieder in den Sinn. Sie sah die alte, obdachlose, in Lumpen gekleidete Frau vor sich – und ihren Hund.
Heute müssen wir alle sterben.
Doreen wich zur offenen Tür zurück. Der Balkon unter ihren Füßen begann heftig zu schaukeln. Das war kein kleineres Beben.
»Beeilung!«, befahl ihr Chef. »Alle in Sicherheit bringen!«
Doreen floh auf die inneren Büros zu, wusste jedoch, dass sie dort alles andere als in Sicherheit war. Heute müssten sie alle sterben.
16.44 Uhr PST (14.44 Uhr Ortszeit) Aleuten, Alaska
Jimmy Pomautuk starrte von den Felsen des Glacial Point zur Sonne hinüber, vor die sich langsam eine schwarze Scheibe schob. Nanook trabte ruhelos an seiner Seite auf und ab. Links riefen die drei Engländer einander ehrfürchtige Bemerkungen zu. Die Kälte hatten sie in der Aufregung längst vergessen. Blitze und das Surren der Kameras würzten ihre überschwänglichen Ausrufe.
»Hast du das Flare da gesehen?«
»Mein Gott! Das werden Wahnsinnsaufnahmen!«
Seufzend ließ sich Jimmy auf dem kalten Stein nieder und lehnte sich an das hölzerne Totem, während er zu der schwarzen Sonne über dem Pazifik hinüberschaute. Eine äußerst merkwürdige Düsternis hatte sich über die Inseln gelegt und tauchte alles in ein unwirkliches Licht. Sogar das Meer wirkte glasig und zeigte einen bläulich silbernen Schimmer.
Neben ihm begann Nanook leise zu knurren. Der Hund war den ganzen Morgen über völlig schreckhaft gewesen. Offenbar verstand er nicht, was mit dem Sonnenlicht los war. »Ist bloß ein hungriger Wal-Geist, der die Sonne frisst«, beruhigte ihn Jimmy leise und streckte die Hand nach Nanook aus, aber der Hund war verschwunden.
Stirnrunzelnd warf er einen Blick über die Schulter. Der große Malamute stand zitternd wenige Schritte entfernt da. Der Hund sah nicht zur Sonne über dem Pazifik auf, sondern hinaus in die Ferne, nach Norden.
»Mein Gott!« Jimmy stand auf und folgte Nanooks Blick.
Der gesamte nördliche Himmel, abgedunkelt in der Sonnenfinsternis, wurde von glühenden azurblauen und lebhaft roten Wellen und Wirbeln erhellt, die sich vom Horizont bis hoch hinauf in den Himmel ausbreiteten. Jimmy wusste genau, was er da sah – die Aurora borealis, das Nordlicht. Noch nie im Leben hatte er ein so großartiges Schauspiel erlebt. Am Himmel wirbelte und schäumte es wie ein schimmerndes Meer.
Einer der Engländer war durch Jimmys erstaunten Ausruf aufmerksam geworden und meinte: »Die Nordlichter sollten doch zu dieser Jahreszeit eigentlich nicht zu sehen sein?«
»Sollten sie auch nicht«, erwiderte Jimmy ruhig.
Die Engländerin, Eileen, trat näher heran, eine Kamera vor dem Gesicht. »Wunderschön. Fast besser als die Sonnenfinsternis.«
»Das muss seine Ursache in den Sonneneruptionen haben«, bemerkte ihr Gefährte. »Da prasseln energiegeladene Teilchen auf die obere Atmosphäre ein.«
Jimmy sagte kein Wort. Für die Inuit war das Nordlicht stets Bote bedeutender Ereignisse, im Sommer sogar bevorstehender Katastrophen.
Als hätte es seine innersten Gedanken gelesen, zitterte das Totem unter Jimmys Hand. Nanook begann zu heulen, was er ansonsten niemals tat.
»Bebt etwa die Erde?«, fragte Eileen, die schließlich besorgt ihre Kamera senkte.
Wie zur Antwort erschütterte ein gewaltiges Beben die Insel. Mit einem unterdrückten Aufschrei fiel Eileen auf Hände und Knie. Die beiden Engländer eilten ihr zu Hilfe.
Jimmy blieb stehen. Er umklammerte nach wie vor das hölzerne Totem.
»Was tun wir jetzt?«, kreischte die Frau.
»Wird schon gut gehen«, beschwichtigte sie ihr Freund. »Wir reiten einfach drauf, bis es vorbei ist.«
Jimmy schaute zu den Inseln hinaus, die in dieses außerweltliche Licht getaucht waren. Oh, mein Gott. Er flüsterte ein Gebet des Danks, dass sein Sohn aufs Festland hinübergefahren war.
Draußen im Pazifik versanken die entfernteren Inseln der Aleuten wie riesenhafte Ungeheuer, die unter die Oberfläche abtauchten. Schließlich und endlich waren die Götter des Meeres gekommen, um sie für sich zu beanspruchen.
16.44 Uhr PST (10.44 Uhr Ortszeit) Hagatna, Guam
Jeffrey Hessmire stand im begrünten Innenhof der Residenz des Gouverneurs und sah ehrfürchtig zu der totalen Sonnenfinsternis auf. Als Sechsundzwanzigjähriger hatte er zwar schon die eine oder andere partielle Sonnenfinsternis gesehen, war aber noch nie Zeuge einer totalen geworden. Guam war als Tagungsort für den Gipfel ausgewählt worden, weil es der einzige Platz in ganz Amerika war, an dem man sie erleben konnte.
Jeffrey war hellauf begeistert gewesen von der Möglichkeit, an diesem seltenen Ereignis teilzunehmen. Er war mit dem Niedertippen und Fotokopieren der Notizen des Außenministers so rechtzeitig fertig geworden, dass er noch den Schluss des Spektakels mitbekam.
Mit einer billigen, geschwärzten Brille auf der Nase stand Jeffrey zusammen mit den anderen US-Delegierten am westlichen Eingang zu den Gärten, während sich die Chinesen am entgegengesetzten Ende drängten. Die beiden Gruppen mischten sich nur wenig. Es war, als läge sogar hier der Pazifik zwischen ihnen. Ungeachtet der Spannungen im Innenhof schaute Jeffrey weiter zu, wie heftige Entladungen aus der Sonnenkorona hervorbrachen. Ein paar der Flares schossen weit in den dunklen Himmel hinaus.
Eine Stimme ertönte neben ihm. »Wunderbar, stimmt’s?«
Jeffrey drehte sich um und fand erneut den Präsidenten unmittelbar hinter sich stehen. »Präsident Bishop!« Er wollte schon die Brille absetzen.
»Nicht! Genießen Sie den Anblick. Die nächste Finsternis soll erst wieder in zwanzig Jahren stattfinden.«
»J-ja, Sir.«
Langsam wandte er sich wieder dem Himmel zu.
Der Präsident schaute gleichfalls hinauf und sagte leise: »Für die Chinesen bedeutet eine Sonnenfinsternis die Warnung, dass sich die Tiden des Schicksals beträchtlich ändern – entweder zum Guten oder zum Schlechten.«
»Zum Besseren«, erwiderte Jeffrey. »Für unsere beiden Völker.«
Präsident Bishop schlug ihm auf die Schulter. »Der Optimismus der Jugend. Ich hätte Sie mit dem Vizepräsidenten reden lassen sollen.« Er schloss diese Bemerkung mit einem spöttischen Schnauben ab.
Jeffrey verstand. Lawrence Nafe, der Vizepräsident, hatte so seine eigenen Ansichten, wie man mit einer der letzten kommunistischen Bastionen umspringen sollte. Während er nach außen hin Bishops diplomatische Bemühungen unterstützte, die chinesische Lage zu lösen, sprach sich Nafe hinter den Kulissen für eine aggressivere Haltung aus.
»Sie werden bestimmt Erfolg haben und eine Übereinkunft erzielen«, meinte Jeffrey. »Da bin ich mir sicher.«
»Wieder dieser verdammte Optimismus.« Der Präsident wandte sich ab und nickte auf ein Zeichen des Außenministers hin. Mit einem müden Seufzer schlug er Jeffrey nochmals auf die Schulter. »Offenbar ist es erneut Zeit für einen Versuch, die ramponierten Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern wiederherzustellen.«
Als Präsident Bishop sich gerade anschickte zu gehen, bebte die Erde.
Jeffrey spürte, wie ihn der Präsident fester an der Schulter packte. Beide Männer gaben sich alle Mühe, auf den Beinen zu bleiben. »Erdbeben!«, schrie Jeffrey.
Ringsumher ertönte das Klirren von zerbrechendem Glas. Jeffrey schaute auf und schirmte sich das Gesicht mit einem Arm ab. Alle Fenster der Residenz waren zerbrochen. Mehrere Mitglieder der Delegation, jene, die den Wänden des Innenhofs am nächsten gestanden hatten, lagen inmitten des Scherbenregens, übersät mit Schnittwunden.
Jeffrey wollte hinüber, ihnen helfen, fürchtete sich jedoch zugleich davor, den Präsidenten im Stich zu lassen. Auf der anderen Seite des Innenhofs flohen die chinesischen Teilnehmer am Gipfeltreffen in das Gebäude und suchten dort Schutz.
»Mr President, wir müssen Sie in Sicherheit bringen«, sagte Jeffrey.
Das Poltern unter ihren Füßen wurde schlimmer. Die Kitschskulptur eines Schwans mit langem Hals stürzte um.
Flankiert von zwei stämmigen Agenten des Geheimdienstes kämpfte sich der Außenminister durch die erschrockene Menge zu ihnen herüber. Einmal angekommen, packte Tom Elliot den Präsidenten am Ellbogen. Er musste schreien, damit er über das Poltern und Krachen hinweg zu verstehen war. »Kommen Sie, Dan! Zurück zur Air Force One. Wenn diese Insel auseinanderfällt, müssen Sie von hier verschwunden sein!«
Bishop schüttelte die Hand des Mannes ab. »Aber ich kann nicht gehen …«
Irgendwo im Osten dröhnte eine laute Explosion, die jegliches Gespräch im Keim erstickte. Ein Feuerball flog in den Himmel.
Jeffrey ergriff als Erster das Wort. »Sir, Sie müssen gehen!«
Das Gesicht des Präsidenten zeigte weiterhin besorgte Anspannung. Jeffrey war bekannt, dass der Mann in Vietnam gedient hatte und niemand war, der einfach davonlief.
»Sie müssen«, fügte Tom hinzu. »Sie können nicht Ihr Leben aufs Spiel setzen, Dan. Dieser Luxus steht Ihnen nicht mehr zu … Nicht, seit Sie den Amtseid geschworen haben.«
Der Präsident krümmte sich regelrecht unter der Last ihrer Argumente. Das Beben wurde schlimmer; die Ziegelwände der Residenz zeigten Risse und Spalten.
»Schön, gehen wir«, meinte er angespannt. »Aber ich komme mir wie ein Feigling vor.«
»Ich habe den Wagen zum Hinterausgang beordert«, sagte der Außenminister und wandte sich dann Jeffrey zu, als der Präsident davonging, die beiden Männer vom Geheimdienst im Schlepptau. »Bleiben Sie bei Bishop. Bringen Sie ihn an Bord dieses Flugzeugs.«
»Was … was ist mit Ihnen?«
Tom wich einen Schritt zurück. »Ich werde so viele Delegierte wie möglich einsammeln und zum Flugplatz scheuchen.« Bevor er sich abwandte, fixierte er Jeffrey mit ernstem Blick. »Sorgen Sie dafür, dass dieses Flugzeug abhebt, wenn auch nur das geringste Risiko besteht, dass der Präsident ansonsten hier in der Falle säße. Warten Sie nicht auf uns!«
Jeffrey schluckte heftig und nickte. Dann eilte auch er davon.
Sobald er an der Seite des Präsidenten war, hörte Jeffrey den Mann murmeln, während er zu der abgedunkelten Sonne hinaufschaute: »Anscheinend hatten die Chinesen recht.«
III
UND DIE NACHWIRKUNGEN
18.45 Uhr, Pacific Standard Time San Francisco, Kalifornien
ES WAR ABEND geworden, und Doreen McCloud stolperte über die aufgerissene Asphaltdecke zum Russian Hill. Gerüchten zufolge hatte die Heilsarmee dort oben ein Flüchtlingslager eingerichtet. Sie betete darum, dass es stimmte. Sie war durstig, hungrig und zitterte vor Kälte in dem ewigen Dunst, der von der Bay her über die zerstörte Stadt kroch. Von gelegentlichen Nachbeben abgesehen, hatten die Beben schließlich aufgehört, aber der Schaden war angerichtet.
Erschöpft und mit zitternden Beinen warf Doreen einen Blick über die Schulter auf das, was einmal eine schöne, prächtige Stadt oberhalb der Bay gewesen war. Allem haftete der Gestank nach Rauch und Ruß an. Brände tauchten den Dunst in einen rötlichen Schein. Von hier aus gesehen lief eine einzige Schneise der Verwüstung bis zum Wasser hinab. Gewaltige Krater durchfurchten die Stadt, als hätte ein riesiger Hammer zugeschlagen.
Noch immer heulten die Sirenen der Rettungsfahrzeuge, obwohl es nichts mehr zu retten gab. Nur wenige Gebäude hatten die Beben heil überstanden. Die übrigen waren völlig eingestürzt oder hatten keine Fassaden mehr, sodass man einen Blick auf die verwüsteten Räumlichkeiten im Innern erhielt.
Auf ihrem Weg in die höheren Bereiche der Stadt hatte Doreen so viele Tote zu Gesicht bekommen, dass sie schließlich nichts mehr empfand. Von einer blutenden Schramme auf dem Kopf abgesehen, war sie fast unversehrt entkommen, aber der Anblick der Familien, die sich um brennende Wohnungen und zerschmetterte Leichen geschart hatten, tat ihr in der Seele weh. Dennoch hatte sie mit allen, an denen sie vorüberkam, etwas gemeinsam – Augen, die aufgrund von Schmerz und Schock keinerlei Ausdruck mehr zeigten.
Auf dem nächstgelegenen Hügel wurde es plötzlich hell. Es war kein Feuerschein, sondern ein klares weißes Licht. Eine Woge der Hoffnung überrollte sie. Das musste das Lager der Heilsarmee sein! Mit knurrendem Magen beschleunigte sie ihren Schritt.
Oh, bitte …
Immer weiter kletterte und kroch sie voran. Nachdem sie an einem umgestürzten Bus vorübergekommen war, erreichte sie die Quelle des hellen Lichtscheins. Eine Vielzahl schmutziger, von Asche bedeckter Männer durchwühlte die Überreste eines Baumarkts. Sie hatten eine Kiste mit Taschenlampen aufgebrochen und reichten sie herum.
Da es bald völlig dunkel würde, wäre eine Lichtquelle lebensnotwendig.
Doreen stolperte auf sie zu. Vielleicht würden sie ihr eine überlassen.
Zwei der Männer sahen zu ihr hinüber. Sie erwiderte ihren Blick, öffnete den Mund und wollte schon um Hilfe bitten, da erkannte sie die Härte in ihren Augen.
Sie blieb stehen, weil ihr aufging, dass alle Männer die gleiche Kleidung trugen. Unter den Worten: CALIFORNIA MUNICIPAL PENAL SYSTEM waren Zahlen aufgenäht. Sträflinge. Ein breites Grinsen erschien auf den Gesichtern der Männer.
Doreen drehte sich um und wollte fliehen, doch einer der entkommenen Sträflinge stand hinter ihr und versperrte ihr den Weg. Sie versuchte, den Mann zu schlagen, aber er boxte ihren Arm zur Seite und schlug ihr so heftig ins Gesicht, dass sie in die Knie ging.
Wie betäubt von Schmerz und Schrecken hörte Doreen die übrigen herankommen. »Nein«, wimmerte sie und rollte sich zu einem Ball zusammen.
»Lasst sie in Ruhe!«, brüllte einer von ihnen. »Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen aus der verdammten Stadt raus, bevor die Nationalgarde kommt.«
Auf diese Bemerkung folgte ein unwilliges Knurren, aber Doreen hörte das Scharren von Absätzen, als die Männer zurückwichen. Erleichtert und entsetzt ließ sie ihren Tränen freien Lauf.
Der Anführer blieb vor ihr stehen.
Mit verheulten Augen hob sie das Gesicht und wollte ihm schon dafür danken, dass er so gnädig gewesen war – und sah in die Mündung einer Pistole! Der Anführer schrie in Richtung des geplünderten Geschäfts: »Nehmt Ersatzmunition mit! Und vergesst nicht die Gasbrenner und das Butan!« Ohne auch nur einen Blick auf sie hinabzuwerfen, drückte er den Abzug.
Doreen vernahm den Knall der Waffe und spürte, wie ihr Körper zurückgeschleudert wurde. Dann war die Welt verschwunden.
20.15 Uhr PST (18.15 Uhr Ortszeit) Aleuten, Alaska
Die Nacht brach an, und der Totempfahl mit den Bildern der Götter von Jimmys Vorfahren, der einmal stolz an ebendieser Stelle auf den Höhen des Glacial Point gestanden hatte, trieb jetzt auf- und niedertauchend im Meer. Jimmy klammerte sich verzweifelt daran und versuchte mit allen Mitteln, sich über Wasser zu halten, doch die Wellen wollten ihn immerzu herunterspülen.
Vor Stunden, als das Wasser an der Steilwand des Glacial Point immer höher gestiegen war, hatte er den Totempfahl aus seiner Zementverankerung gelöst. Die Insel war überraschend glatt versunken, sodass ihm genügend Zeit geblieben war, ihn mit einer Handaxt aus der Schutzhütte loszuhacken. Sobald das Wasser fast den Gipfel erreicht hatte, hatte er den Balken über den Rand geworfen. Zu diesem Zeitpunkt waren die drei Engländer längst den Pfad hinab nach Port Royson geflüchtet. Jimmy hatte versucht, sie zurückzuhalten, aber sie hatten nicht auf ihn hören wollen. Die Panik hatte sie taub gemacht.
Also war er allein ins Wasser gesprungen und zu dem treibenden Totempfahl hinausgeschwommen. Nur Nanook, der große Malamute, war am Rand des Felsens zurückgeblieben. Er hatte nicht so recht gewusst, was er tun sollte, und war hin und her stolziert. Jimmy hatte seinen alten Hund nicht retten können. Das eigene Überleben zu sichern wäre schon keine einfache Sache.
Schweren Herzens hatte er sich breitbeinig auf den Totempfahl gesetzt und sich darangemacht, auf das ferne Festland zuzupaddeln. Nanooks Gebell hatte über das Wasser geschallt, bis die Insel völlig hinter ihm verschwunden war.
Als wollte ihn sein Schuldgefühl erneut plagen, hörte er jetzt wiederum das Gebell. Aber es war kein Geist. Er drehte sich um und sah in mehreren Metern Entfernung etwas platschend auf sich zukommen. Schwarz-weißes Fell blitzte auf.
Freude und Besorgnis mischten sich in Jimmys Herzen. Der alte Hund hatte einfach nicht aufgeben wollen, und obwohl er einerseits realistisch bleiben wollte, wusste er andererseits auch, dass er alles zur Rettung des Tieres unternehmen würde. »Komm schon, Nanook!«, schrie er mit klappernden Zähnen. »Beweg deinen nassen Arsch hier rüber!«
Seine blau gewordenen Lippen teilten sich zu einem Lächeln, als ein Gebell ihm Antwort gab.
Dann sah er hinter seinem paddelnden Hund etwas aus den Wellen steigen. Eine lange schwarze Rückenflosse, zu groß für einen Hai. Ein Orca. Ein Killerwal.
Jimmy drückte es das Herz ab. Er streckte Nanook eine Hand entgegen, aber es war zwecklos. Die Rückenflosse sank ins Wasser. Er hielt den Atem an und betete zu den alten Göttern, sie sollten seinen Gefährten verschonen.
Plötzlich schäumte weiße Gischt auf. Nanook, der das drohende Verhängnis spürte, winselte. Dann verschwand der prächtige Hund in einer Woge blutigen Schaums. Kurz hob sich die schwarze Rückenflosse und sank dann wieder hinab.
Reglos trieb Jimmy auf seinem von Menschenhand gefertigten Holzscheit dahin. Seine Finger klammerten sich an Bilder der Götter seiner Vorfahren: Bär, Seeadler und Orca. Ein Schweigen hing bedrohlich über dem Meer. Der Ozean hatte sich rasch beruhigt, kein Anzeichen für den wilden Angriff war mehr zu erkennen.
Jimmy spürte heiße Tränen seine erstarrte Wange hinabfließen. Voller Trauer legte er die Stirn auf das Holz.
Da veränderte sich irgendwie das Licht. Er hob den Kopf. Der dunkler werdende Himmel glühte jetzt in einem unnatürlichen Rot. Jimmy reckte den Hals und entdeckte links von sich dessen Quelle. Eine Leuchtkugel. Und in der gleißenden Helligkeit sah er einen Kutter der Küstenwache durch das Wasser gleiten.
Er setzte sich auf, winkte mit einem Arm und schrie: »Hilfe!« Er kämpfte darum, auf dem schaukelnden Holz das Gleichgewicht zu wahren.
Das kurze Tuten einer Schiffssirene antwortete ihm. Dann erreichten ihn schwach einige durch ein Megafon gerufene Worte: »Wir sehen Sie! Bleiben Sie, wo Sie sind!«
Jimmy senkte den Arm und schmiegte sich enger an seinen Pfahl. Er stieß einen langen Seufzer der Erleichterung aus. Dann spürte er es. Etwas ganz in der Nähe. Er wandte den Kopf und starrte nach vorn.
Direkt vor seinen Augen tauchte eine weitere lange schwarze Rückenflosse auf. Ihre Vorderkante streifte das Ende des Pfahls, tippte ihn an, testete ihn.
Langsam zog Jimmy die Füße aus dem Wasser.
Dann erschien links noch eine Rückenflosse … und noch eine. Der Schwarm Killerwale umkreiste ihn gemächlich, und da erkannte Jimmy, dass der Kutter nie rechtzeitig eintreffen würde. Er sollte recht behalten. Etwas schlug von unten gegen den Totempfahl und schleuderte ihn einen vollen Meter in die Luft. Jimmy flog davon, wobei seine Finger nach dem Holz krallten.
Klatschend prallte er auf dem Ozean auf und ging unter. Ihm war bereits so kalt, dass er die Eiseskälte seiner Umgebung kaum noch spürte. Unter Wasser öffnete er die Augen. Das Salz brannte darin. In dem feurigen Licht der Leuchtkugel erkannte Jimmy die gewaltigen, immer noch kreisenden Schatten. Obwohl seine eiserstarrten Lungen förmlich nach Luft kreischten, hielt er sich völlig still und ließ sich von seinem natürlichen Auftrieb an die Oberfläche tragen.
Ehe er sie erreichte, näherte sich einer der Schatten. Einen Augenblick lang starrte Jimmy in ein faustgroßes schwarzes Auge. Dann durchbrach er die Oberfläche, legte den Kopf in den Nacken und schnappte keuchend nach Luft.
Der Kutter der Küstenwache raste mit Höchstgeschwindigkeit auf ihn zu. Die Besatzung musste den Angriff mitverfolgt haben.
Jimmy schloss die Augen. Zu weit weg.
Etwas schnappte nach seinem Bein. Kein Schmerz, nur eine feurige Festigkeit. Seine Gliedmaßen waren zu erstarrt, um die Zähne zu spüren. Als der Scheinwerfer der Küstenwache über ihn hinwegfuhr, wurde sein Körper hinabgerissen, von den Göttern seiner Vorfahren in die Tiefe gezerrt.
22.56 Uhr PST (18.56 Uhr Ortszeit)Boeing 747-200B, Höhe: 30 000 Fuß, unterwegs von Guam
In dem getäfelten Konferenzraum an Bord von Air Force One beobachtete Jeffrey Hessmire die Reaktion des Präsidenten auf die weltweite Notsituation. Um den Tisch waren sein oberster Stab und die Berater versammelt.
»Geben Sie mir eine rasche Zusammenfassung, Tom! Wie umfangreich waren die Beben?«
Außenminister Elliot, dessen gebrochener linker Arm in einer Schlinge steckte, saß rechts vom Präsidenten. Jeffrey bemerkte den von Morphium benebelten Ausdruck in Tom Elliots Augen, aber der Mann blieb bemerkenswert wach und scharfsinnig. Einhändig wühlte er durch die vielen Ausdrucke auf dem Tisch. »Es ist zu früh für eindeutige Antworten, aber anscheinend ist der gesamte Pacific Rim betroffen. Wir haben sowohl Berichte weit aus dem Süden, aus Neuseeland, als auch ganz aus dem Norden, aus Alaska. Zudem aus Japan und China im Osten sowie von der gesamten Westküste Zentral- und Südamerikas.«
»Und die Vereinigten Staaten? Irgendwas Neues?«
Toms Ausdruck wurde grimmig. »Die Berichte sind nach wie vor chaotisch. San Francisco erlebt immer noch stündlich Nachbeben. Los Angeles brennt.« Er warf einen Blick auf eines der Papiere und schien wenig Lust zu haben, das zu berichten, was dort stand. »Vor Alaska ist die gesamte Inselkette der Aleuten verschwunden.«
Schockiertes Gemurmel erhob sich um den Tisch.
»Ist das möglich?«, fragte der Präsident.
»Es ist via Satellit bestätigt«, erwiderte Tom leise. »Wir erhalten auch endlich Berichte aus Hawaii.« Er sah von seinem Papierstapel auf. »Vierzig Minuten nach den ersten Beben sind die Inseln von Flutwellen überspült worden. Honolulu steht immer noch unter Wasser. Die Hotels in Waikiki sind wie Dominosteine umgefallen.«
Während die Litanei von Tragödien weiterging, wich dem Präsidenten jegliche Farbe aus dem Gesicht; die Lippen hatte er zu einer harten Linie zusammengepresst. Jeffrey hatte noch nie erlebt, dass er so alt wirkte. »So viele Tote …«, hörte er ihn unterdrückt murmeln.
Schließlich schloss Tom seinen Bericht mit der detaillierten Beschreibung eines Vulkanausbruchs in der Nähe von Seattle. Die Stadt lag meterhoch unter Asche.
»›Der Ring des Feuers‹«, flüsterte Jeffrey in sich hinein.
Präsident Bishop wandte sich an ihn. »Was haben Sie gesagt, Mr Hessmire?«
Jeffrey entdeckte, dass aller Augen auf ihn gerichtet waren. »D … die pazifische Umrandung trägt auch den Spitznamen der ›Ring des Feuers‹, wegen der außerordentlichen geologischen Aktivität – Erdbeben, Vulkanausbrüche.«
Nickend wandte sich der Präsident wieder an Tom. »Ja, doch warum jetzt? Warum so plötzlich? Was hat diese geologische Aktivität im gesamten Pazifik ausgelöst?«
Tom schüttelte den Kopf. »Wir sind nach wie vor weit davon entfernt, dieser Frage nachgehen zu können. Gegenwärtig müssen wir unser Land aus dem Schutt ausgraben. Die Joint Chiefs of Staff und das Kabinett treten auf Anordnung des Vizepräsidenten zusammen. Das Office of Emergency Services ist in volle Alarmbereitschaft versetzt worden. Es wartet nur noch auf unsere Anweisungen.«
»Dann gehen wir an die Arbeit, meine Herren«, begann der Präsident. »Wir …«
Da bockte das Flugzeug unter ihnen. Mehrere Mitglieder des Stabs wurden aus ihren Sitzen geworfen. Nicht jedoch der Präsident.
»Was war das, zum Teufel?«, fluchte Tom.
Wie aufs Stichwort ertönte die Stimme des Flugkapitäns über Lautsprecher: »Tut mir leid, dieser kleine Rüttler, aber wir sind unerwartet auf Turbulenzen gestoßen. Wir … wir haben möglicherweise einen holprigen Flug vor uns. Bitte legen Sie Ihre Sicherheitsgurte an!«
Jeffrey hörte die falsche Munterkeit aus der Stimme des Piloten heraus. Und die dahinter versteckte Sorge. Der Präsident warf Tom mit zusammengekniffenen Augen einen Blick zu.
»Ich geh’ nachsehen.« Tom machte sich daran, den Gurt zu lösen.
Der Präsident legte ihm eine Hand auf den verletzten Arm und hinderte ihn daran. Gleichzeitig wandte er sich an Jeffrey und winkte einem Mitglied seines Sicherheitsteams. »Ihr Jungs habt bessere Beine als wir alten Leute.«
Jeffrey ließ seinen Gurt aufschnappen. »Natürlich.« Er stand auf und ging zu dem Agenten des Geheimdienstes in der blauen Uniform hinüber, der an der Tür wartete.
Zusammen verließen sie den Konferenzraum und arbeiteten sich mühsam auf das Cockpit der Boeing 747 zu, vorüber an der Suite von Privaträumen des Präsidenten. Als sie sich der Cockpittür näherten, sah Jeffrey aus dem Augenwinkel einen grellen Blitz draußen vor einem der Seitenfenster.
»Was war …«, setzte er an, aber da begann das Flugzeug wild zu trudeln.
Jeffrey schlug mit dem Kopf voran gegen das Fenster und stürzte zu Boden. Er spürte seine Trommelfelle platzen. Durch die Tür zum Cockpit vernahm er die verzweifelten Schreie der Besatzung, gekreischte Befehle, Panik.
Er zog sich hoch und drückte das Gesicht an das Bullauge. »Oh, mein Gott …«
23.18 Uhr PST (2.18 Uhr Ortszeit)Air Mobility Command, Andrews Air Force Base, Maryland
Tech Sergeant Mitch Clemens griff nach dem roten Telefon über der Reihe von Radarschirmen und drückte die Tasten für die abhörsichere Leitung zum Basiskommandanten. Da Andrews voll in Alarmbereitschaft war, wurde der Anruf augenblicklich beantwortet.
»Ja?«
»Sir, wir haben ein Problem.«
»Und welches?«
Schwitzend starrte Mitch Clemens seinen Monitor an, die Flugzeugkennung VC-25A. Normalerweise funkelte sie in einem hellen Gelb auf dem Schirm. Jetzt blinkte sie. Rot.
Die Stimme des Tech Sergeant zitterte. »Wir haben Air Force One verloren.«
1
NAUTILUS
24. Juli, 15.35 Uhr90 Kilometer südwestlich von Wake Island, Zentralpazifisches Becken
JACK KIRKLAND HATTE von der Sonnenfinsternis nichts mitbekommen.
Wo er dahinglitt, gab es keine Sonne, lediglich die ewige Dunkelheit der unendlichen Tiefe des Ozeans. Die einzige Beleuchtung stellten zwei Xenonscheinwerfer in der Nase seines Einmann-Tauchboots zur Verfügung. Sein neues Spielzeug, die Nautilus 2000, befand sich auf ihrer ersten Testfahrt tief unter dem Meer. Das acht Fuß lange Minitauchboot aus Titan hatte die Form eines dicken Torpedos, dem eine Plastikkuppel aufgesetzt war. An der Unterseite befand sich ein Stahlrahmen, der die Batterien, die Antriebseinheit, die Elektronik sowie die Scheinwerfer beherbergte.
Vor ihm bohrte die strahlende Helligkeit der Zwillingsscheinwerfer einen Sichtkegel von über dreißig Metern Länge in die Dunkelheit. Jack schwenkte ihn suchend hin und her. Gleichzeitig überwachte er aus dem Augenwinkel die Analoganzeige für die Tiefenmessung. Er näherte sich der Fünfhundert-Meter-Marke und musste sich dicht über dem Grund des Grabens befinden. Die Sonaranzeige auf dem Computermonitor bestätigte seine Vermutung. Lediglich noch zwei Faden. Die »Ping«-Töne des Sonars folgten immer rascher aufeinander.
So wie Jack in dem Minitauchboot saß, ragten Kopf und Schultern in die Kunststoffkuppel. Auf diese Weise hatte er einen Panoramablick auf seine Umgebung. Während die Kabine für die meisten Männer sehr geräumig gewesen wäre, passte Jack, mit seiner Größe von annähernd zwei Metern, so gerade eben hinein. Als würde man einen MG-Coupé fahren, dachte er, nur dass man das nicht mit den Zehen lenkt.
Die beiden Fußpedale im Rumpf dienten nicht bloß zur Geschwindigkeitskontrolle. Mittels der vier Schubantriebe von je einer Pferdestärke konnte man auch lenken. Mit geübter Geschicklichkeit ließ Jack das rechte Pedal los, während er gleichzeitig mit dem großen Zeh das linke niederdrückte. Das Fahrzeug vollführte eine glatte Linkskurve. Scheinwerferlicht durchdrang die Dunkelheit. Vor ihm tauchte der Meeresboden aus der ewigen Finsternis auf.
Jack bremste sein Fahrzeug ab, sodass es nur noch sanft dahinglitt. Er betrat jetzt ein natürliches Wunderland, eine Oase in der Tiefsee.
Unter ihm zogen sich Felder von Röhrenwürmern über den Talboden des Gebirges mitten im Pazifik. Riftia pachyptila. Die Bündel zwei Meter langer Röhren mit ihren blutroten Würmern ließen die Unterwasserlandschaft wie einen außerweltlichen Ziergarten erscheinen. Wenn er vorüberfuhr und sie dabei in der Strömung leicht ins Schwanken gerieten, schienen sie ihm zuzuwinken. Auf den niedrigeren Hängen zu beiden Seiten lagen Schale an Schale riesige Muscheln. Sie standen offen, und weiche Wedel filterten das Meerwasser. Leuchtend rote Krabben der Gattung Munida quadrispina stolzierten auf langen, spindeldürren Beinen unter ihnen umher.
Eine Bewegung lenkte Jacks Aufmerksamkeit nach vorn. Ein dicker, augenloser Aal glitt vorüber, dessen Zähne hell im Licht der Xenonscheinwerfer strahlten. Gleich darauf folgte eine Schule neugieriger Fische, die von einem großen braunen Laternenfisch angeführt wurde. Der freche Bursche schwamm unmittelbar an die Glaskugel heran – ein Tiefseeungeheuer, das den seltsamen Eindringling beäugte. Winzige biolumineszierende Lichter flackerten an der Seite des Fischs; Anzeichen dafür, dass er sein Territorium aggressiv verteidigen würde.
Auch andere Mitbewohner zeigten sich. Unten am Grund liefen rosafarbene Impulse durch das Gewirr aus Bambuskorallen, Lepidisis olapa. Rings um die Kuppel blitzten winzige blaugrüne Lichter auf, deren Besitzer zu klein und durchscheinend waren, als dass man sie hätte deutlich erkennen können.
Der Anblick erinnerte Jack an die umherhuschenden Glühwürmchen seiner Kindheit. Nachdem er seine gesamte Jugend fern der Küste in Tennessee verbracht hatte, hatte er sich sogleich in den Ozean verliebt. Er war von dessen Weite bezaubert gewesen, vom endlosen Blau, von den ständig wechselnden Stimmungen.
Wirbelnde Funken umschwärmten die Kuppel.
»Unglaublich«, murmelte er in sich hinein und grinste breit. Selbst nach so langer Zeit fand das Meer immer wieder Wege, ihn zu überraschen.
Sogleich summte es in seinem Ohrhörer. »Was war das, Jack?«
Stirnrunzelnd verfluchte er schweigend das Kehlkopfmikrofon an seinem Hals. Selbst fünfhundert Meter unter dem Meer konnte er sich nicht völlig von der Welt oben abschotten. »Nichts weiter, Lisa«, antwortete er. »Ich bewundere bloß die Aussicht.«
»Wie verhält sich das neue Tauchboot?«
»Könnte nicht besser sein. Empfängst du die Anzeigen für den Bio-Sensor?«, fragte er und berührte den Clip an seinem Ohrläppchen. Das darin eingebaute Laser-Spektrometer überwachte ständig den Sauerstoffgehalt seines Bluts.
Dr. Lisa Cummings hatte ein Stipendium von der National Science Foundation bekommen, um die physiologischen Effekte der Tiefsee-Arbeit zu studieren. »Atmung, Körpertemperatur, Kabinendruck, Sauerstoffversorgung, Ballast, Kohlendioxid-Reiniger. Überall grünes Licht hier oben. Irgendwelche Anzeichen seismischer Aktivität?«
»Nein. Alles ruhig.«
Als Jack vor zwei Stunden seinen Abstieg in der Nautilus begonnen hatte, hatte Charlie Mollier, der Geologe, von merkwürdigen seismischen Anzeigen berichtet, von harmonischen Schwingungen, die durch das Tiefseegebirge gewandert waren. Aus Sicherheitsgründen hatte er vorgeschlagen, Jack solle an die Oberfläche zurückkehren. »Komm hoch, und sieh dir mit uns zusammen die Sonnenfinsternis an«, hatte Charlie vor einiger Zeit in seinem jamaikanischen Akzent gesendet. »Das wird ein Spektakel, Mann! Wir können immer noch morgen tauchen.«
Jack hatte sich geweigert. Die Sonnenfinsternis interessierte ihn nicht im Geringsten. Wenn die Beben schlimmer würden, könnte er stets wieder auftauchen. Aber während des langen Abstiegs waren die seltsamen seismischen Anzeigen abgeebbt. Charlies Stimme hatte schließlich ihren bemühten Unterton verloren.
Er berührte sein Kehlkopfmikrofon. »Also habt ihr euch da oben Sorgen gemacht?«
Nach einer Pause folgte ein widerstrebendes Ja.
Jack stellte sich vor, wie die blonde Ärztin die Augen verdrehte. »Danke, Lisa. Ich schalte jetzt ab. Zeit für ein bisschen Privatsphäre.« Er riss den Bio-Sensor-Clip vom Ohrläppchen.
Allerdings war es nur ein kleiner Sieg. Das übrige Bio-Sensor-System würde weiterhin Daten über den Zustand des Tauchboots senden, aber wenigstens nichts Persönliches. Das verschaffte ihm zumindest ein wenig Abgeschiedenheit von der Welt oben – und das war es, was Jack am meisten beim Tauchen zusagte. Die Isolation, der Frieden, die Ruhe. Hier zählte nur der Augenblick. So tief unten hatte seine Vergangenheit keine Macht über ihn.
Aus dem Lautsprechersystem des Boots schallten die seltsamen Geräusche der unendlichen Tiefen durch den beengten Raum: ein Chor unheimlicher Pulsschläge, Zwitschern, hochfrequentes Kreischen. Es war, als würde er einen anderen Planeten belauschen.
Ringsumher lag eine Welt, die für die Bewohner der Oberfläche tödlich war: endlose Dunkelheit, zermalmender Druck, giftiges Wasser. Aber das Leben hatte irgendwie einen Weg gefunden, hier zu gedeihen, genährt nicht vom Sonnenlicht, sondern von giftigen Wolken aus Schwefelwasserstoff, ausgestoßen von heißen Quellen, die »schwarze Raucher« genannt wurden.
Jack glitt jetzt in die Nähe einer dieser Quellen, einen dreißig Meter hohen Vulkanschlot, aus dessen Öffnung dunkle Rauchschwaden aus mineralreichem kochendem Wasser quollen. Im Vorüberfahren störte sein Antrieb weiße Wolken aus Bakterien auf und erzeugte hinter ihm einen winzigen Blizzard. Diese Mikroorganismen waren die Grundlage für das Leben hier, mikroskopisch kleine Maschinen, die Schwefelwasserstoff in Energie umwandelten.
Jack umrundete den Vulkanschlot in gebührendem Abstand. Dennoch stieg die Außentemperatur rasch an, als sein Tauchboot vorüberglitt. Die Schächte selbst konnten weit über dreihundertsiebzig Grad Celsius erreichen. Das war heiß genug, ihn in seinem kleinen Tauchboot zu kochen.
»Jack?« Die besorgte Stimme der Teamärztin flüsterte ihm erneut ins Ohr. Ihr mussten die Temperaturänderungen aufgefallen sein.
»Bloß ein Raucher. Deswegen muss man sich keine Sorgen machen«, gab er zur Antwort.
Mithilfe der Fußpedale schob er das Minitauchboot an dem Vulkanschlot vorüber und setzte seine gemächliche Fahrt fort, wobei er sich dicht am Grund der tiefen Rinne hielt. Obgleich ihn das Leben hier unten faszinierte, hatte Jack etwas Wichtigeres vor, als lediglich die Aussicht zu bewundern.
Während des vergangenen Jahres waren er und sein Team an Bord der Deep Fathom auf der Jagd nach dem Wrack der Kochi Maru gewesen, einem japanischen Frachter, der im Zweiten Weltkrieg verschollen war. Ihre Nachforschungen im Ladungsmanifest hatten ergeben, dass das Schiff eine große Menge an Goldbarren mit sich geführt hatte, Überreste des Kriegs. Nach gründlichem Studium von Navigations- und Wetterkarten hatte Jack die Suche auf zehn nautische Quadratmeilen im Meeresgebirge des zentralpazifischen Beckens eingegrenzt. Es war eine sehr vage Vermutung gewesen, ein Roulettspiel, das nach einem Jahr nicht den Eindruck erweckte, als hätte sich der Einsatz gelohnt – bis gestern. Da hatte ihr Sonar einen verdächtigen Schatten am Grund des Ozeans aufgefangen.
Den verfolgte Jack jetzt gerade. Er warf einen Blick auf den Computer des Tauchboots, der ihm die Sonardaten von seinem Schiff weit oben anzeigte. Was diesen Schatten geworfen hatte, war etwa hundert Meter von seiner gegenwärtigen Position entfernt. Er schaltete sein eigenes Sonar ein, das die Gegend links und rechts abtastete, während er sich der Stelle näherte.
Ein Gebirgsrücken tauchte in der Düsternis auf. Jack schwenkte in einem weiten Bogen um das Hindernis herum. Die Oase hinter ihm verschwand, ebenso die üppige Fauna und Flora. Der Meeresboden vor ihm zeigte nichts als leblosen Schlick. Im Vorüberfahren wirbelte der Antrieb des Tauchboots Schlammwolken auf. Als würde man eine staubige Landstraße hinabfahren.
Jack umrundete den Felsausläufer. Vor ihm tauchte erneut eine Erhebung auf – ein Vorgebirge zum zentralpazifischen Becken –, das ihm den weiteren Weg versperrte. Er blieb stehen und ließ etwas Ballast ab, da er über den Grat hinüberwollte. Als er langsam aufwärtstrieb, geriet sein Tauchboot in eine leichte Strömung, die ihn mitzog. Jack kämpfte mit seinem Antrieb dagegen an, bis er sein Fahrzeug schließlich wieder stabilisiert hatte. Was ist das, zum Teufel? Er stupste es leicht an, sodass es langsam auf die Spitze zufuhr.
»Jack«, flüsterte ihm Lisa erneut ins Ohr, »kommst du wieder an einem Schlot vorüber? Meine Temperaturanzeigen klettern in die Höhe.«
»Nein, aber ich weiß nicht genau, was … Du meine Fresse!« Sein Tauchboot hatte den Berg erklommen. Jetzt sah er, was auf der anderen Seite lag.
»Was ist, Jack?« Lisas Stimme zitterte ängstlich. »Bist du okay?«
Jenseits der Erhebung öffnete sich ein weiteres Tal, das jedoch keine Oase des Lebens war. Eher die Hölle. Glühende Spalten zogen sich im Zickzack über den Meeresboden. Geschmolzenes Gestein floss daraus hervor, das beim raschen Abkühlen eine schattige purpurrote Färbung annahm. Jack kämpfte gegen die durch die Hitze hervorgerufene Strömung an, die ihn unermüdlich weiterschieben wollte. Aus den Lautsprechern der Kabine ertönte ein beständiges Brüllen.
»Mein Gott …«
»Jack, worauf bist du da gestoßen? Die Temperatur schießt in die Höhe!«
Um das zu merken, benötigte er keine Instrumente. Bei jedem Atemzug wurde es im Innern des Tauchboots wärmer. »Eine neue Quelle.«
Eine zweite Stimme ertönte über den Funk. Es war Charlie, der Geologe. »Sei vorsichtig, Jack! Ich fange nach wie vor schwache Wellen von dort unten auf. Da ist es alles andere als stabil.«
»Ich verschwinde noch nicht.«
»Du solltest das Risiko …«
»Ich habe die Kochi Maru gefunden«, unterbrach Jack. »Was?«
»Das Schiff ist hier … Aber ich weiß nicht, für wie lange noch.« Während das Boot über die Erhebung schwebte, sah Jack zur anderen Seite des höllischen Tals hinüber. Dort lag das Wrack eines langen Schleppnetzfischers, dessen Rumpf in zwei Teile zerborsten war. In dem finsteren Glanz erwiderten die zerschmetterten Fenster der Kommandobrücke seinen Blick. Der Bug zeigte japanische Schriftzeichen, doch war der Name Jack wohl vertraut: KOCHI MARU. Frühlingsbrise.
Aber zu dem Wrack passte der Name längst nicht mehr.
Rings um das Schiff quoll geschmolzenes Felsgestein hervor, floss dahin und bildete Bänder und Magmalachen, die dampften, während sie sich in den eiskalten Tiefen rasch abkühlten. Die vordere Hälfte des Schiffs lag unmittelbar über einer der Spalten. Jack sah das stählerne Schiff langsam versinken, mit dem Magma verschmelzen.
»Ein Fischerkahn mitten in der Hölle«, berichtete Jack. »Ich werd ihn mal genauer unter die Lupe nehmen.«
»Jack …« Das war wieder Lisa, deren Stimme hart geworden war. Es hörte sich an, als wollte sie ihm einen Befehl erteilen. Aber sie zögerte. Sie kannte ihn zu gut. Ein langer Seufzer folgte. »Halte bloß die Anzeigen für die Außentemperatur im Auge. Titan ist gegenüber extremen Temperaturen nicht unempfindlich. Insbesondere die Schweißnähte …«
»Versteh schon. Keine unnötigen Risiken.« Jack drückte beide Fußpedale nieder. Das Tauchboot schoss davon und stieg gleichzeitig höher. Während er auf das Wrack zuglitt, ging die Temperatur gleichmäßig in die Höhe.
Fünfundzwanzig … vierzig … fünfundvierzig …
Schweiß perlte Jack von der Stirn, und seine Hände wurden glitschig. Wenn eine der Nähte des Tauchboots nachgeben und reißen würde, würde ihn der immense Druck in diesen Tiefen in weniger als einer Sekunde zermalmen.
Er stieg höher, bis die Temperatur unter vierzig Grad fiel. Zufrieden, dass er wieder in Sicherheit war, überquerte er das Tal, wobei er unregelmäßig Gas gab. Bald schwebte er über dem Wrack. Er kippte das Tauchboot und umkreiste das zerbrochene Schiff.
Leicht vorgebeugt sah Jack auf das Wrack hinab. Volle fünfzig Meter vom Bug entfernt lag das zerborstene Heck mit dem höhlenartigen Frachtraum, der von den Spalten abgewandt war. Auf der anderen Seite waren, erhellt vom feurigen Schein aus den Rissen in der Nähe, etliche Kisten halb im Schlamm vergraben, deren Holz über die Jahrzehnte hinweg schwarz geworden war.
»Wie schaut’s aus, Jack?«, fragte Lisa.
Mit zusammengekniffenen Augen musterte er die über den Grund verstreute Ladung des Wracks. »Nicht besonders gut, so viel steht fest.«
Nach einer bewusst eingelegten Pause fragte Lisa: »Und …?«
»Ich weiß nicht so recht. Ich habe das Schiff und die alte Familienranch zur Finanzierung dieses Ausflugs verpfändet. Kämen wir jetzt mit leeren Händen rauf …«
»Weiß ich, aber alles Gold der Welt ist nicht so viel wert wie dein Leben.«