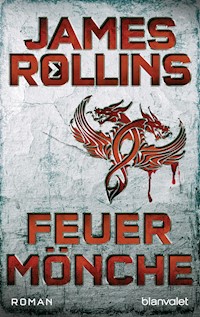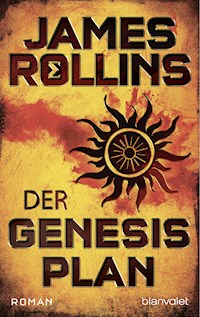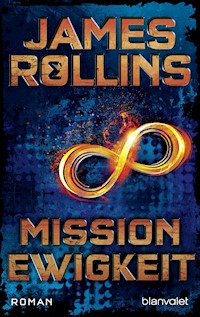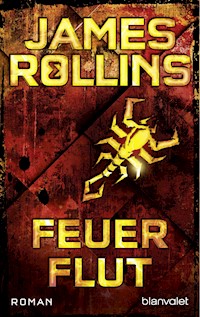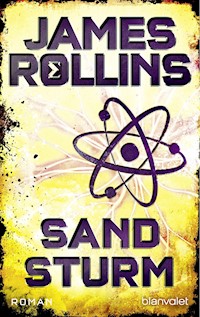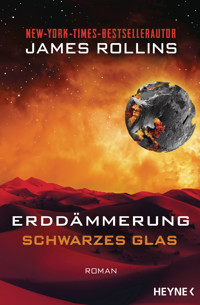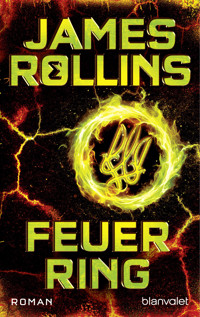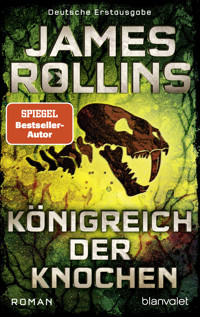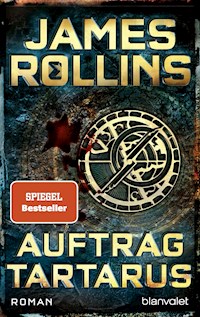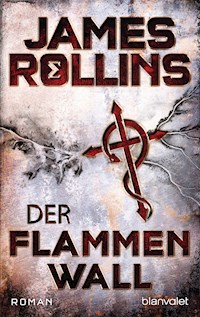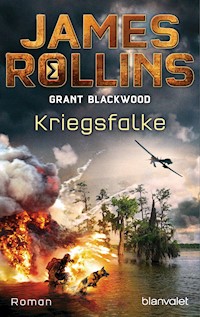8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Erin Granger
- Sprache: Deutsch
Das jüngste Gericht hat die Mauern des Vatikans erreicht ...
Nach einem skrupellosen Anschlag in Kalifornien sucht die Archäologin Erin Granger hinter den Mauern des Vatikans Schutz bei der Bruderschaft der Christuskrieger. Dort erfährt sie von der Entführung eines kleinen Jungen. Ein Priester will ihn für seine finsteren Machenschaften benutzen, und laut einer Prophezeiung kann nur Erin das Kind und auch die Welt vor der drohenden Apokalypse retten. Da tritt eine weitere Partei aus dem Schatten, und die Bruderschaft der Christuskrieger steht ihrer größten Herausforderung gegenüber.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 640
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Im Evangelium des Blutes, geschrieben von Christus persönlich, steht, dass nur die Frau von großer Gelehrsamkeit, der Christusritter und der Menschenkrieger das Ende der Welt aufhalten können. Doch auch die Diener des Bösen kennen diese Prophezeiung und setzen alles daran, die drei zu vernichten, bevor Armageddon beginnt.
Die Archäologin Erin Granger erfährt von der Entführung eines kleinen Jungen. Ein Priester will ihn für seine finsteren Machenschaften benutzen. Könnte es dieses Kind sein, das die Apokalypse auslöst? Erin und die Bruderschaft der Christuskrieger setzen alles daran, den Jungen vor dem schrecklichen Schicksal zu bewahren, das der Priester ihm zugedacht hat. Sie kann nur hoffen, dass sie so auch das Ende der Welt aufhält.
Da tritt eine weitere Partei aus dem Schatten, die davon überzeugt ist, im Auftrag Christi zu handeln. Doch will sie die Apokalypse aufhalten – oder sie herbeiführen …?
Autor
Der New York Times-Bestsellerautor James Rollins hat einen Doktorgrad in Tiermedizin. Als begeisterter Höhlenforscher und ebenso eifriger Taucher ist er häufig unter Wasser oder unter der Erde anzutreffen. Er wohnt in den Bergen der Sierra Nevada in Kalifornien, USA.
Autorin
Rebecca Cantrell gewann als Autorin bereits mehrere Preise. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Berlin.
Außerdem von James Rollins bei Blanvalet erschienen:
Sigma-Force:
Der Genesis-Plan, Feuermönche, Sandsturm, »Der Judas-Code«, »Das Messias-Gen«Die Bruderschaft der Christuskrieger:Das Evangelium des Blutes, Das Blut des VerrätersAußerdem:Sub Terra, Im Dreieck des Drachen, Das Flammenzeichen, Operation Amazonas, Das Blut des TeufelsIndiana Jones und das Königreich des Kristallschädels
James Rollins
und Rebecca Cantrell
Das Blut des Verräters
Roman
Aus dem Englischen von Norbert Stöbe
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Innocent Blood« bei William Morrow, New York.
1. AuflageAugust 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.Copyright © 2014 by Jim CzajkowskiPublished in agreement with the author, c/o Baror International, Inc. Armonk, New York, U.S.A.Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 by Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.comRedaktion: text in form / Gerhard SeidlHK · Herstellung: samSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-15860-6www.blanvalet.de
James: Gewidmet Carolyn McCray für ihre Inspiration, ihre Ermutigung und ihre grenzenlose Freundschaft
Rebecca: Gewidmet meinem Mann, meinem Sohn und Twinkle the Cat
Siehe, Gott hat dein Opfer aus den Händen eines Priesters empfangen – das heißt einem Gesandten des Irrtums.
Judas-Evangelium 5,15
Mittsommer 1099 Jerusalem
ALS DIE SCHREIE der Sterbenden zur Wüstensonne aufstiegen, schloss Bernard seine knochenweißen Finger um den Kreuzanhänger seiner Halskette. Das geweihte Silber versengte seine schwielige Hand, brannte sich in sein verfluchtes Fleisch. Er achtete nicht auf den Gestank verschmorter Haut und verstärkte den Druck. Er nahm den Schmerz hin.
Denn der Schmerz hatte einen Zweck – Gott zu dienen.
Ringsumher strömten die Soldaten und Ritter auf einer Woge von Blut in die Stadt Jerusalem. In den vergangenen Monaten hatten sich die Kreuzfahrer durch das feindliche Land hindurchgekämpft. Neun von zehn Männern starben, bevor sie die Heilige Stadt erreichten; sie fielen im Kampf, erlagen der gnadenlosen Wüste und heidnischen Krankheiten. Die Überlebenden weinten, als sie Jerusalem erblickten. Doch das viele Blut war nicht umsonst vergossen worden, denn jetzt würden die Christen die Stadt wieder aufbauen, ein bitterer Sieg, den Tausende Ungläubige mit dem Leben bezahlt hatten.
Bernard sprach halblaut ein Gebet für die Gefallenen.
Mehr Zeit blieb ihm nicht.
Als er an den Wagen herantrat, zog er sich die raue Kapuze seines Umhangs in die Stirn, verbarg sein weißes Haar und sein bleiches Gesicht in tiefem Schatten. Dann packte er das Zaumzeug des Wallachs und streichelte den warmen Hals des Tiers, vernahm dessen donnernden Herzschlag und spürte ihn bis in die Fingerspitzen. Das Pferd war aufgeregt, seine Flanken dampften.
Er zog am Halfter, und das Ross bewegte sich vor, zog den Holzwagen über das blutgetränkte Pflaster. Auf der Ladefläche stand ein Eisenkäfig, groß genug für einen Menschen. Der Käfig war in dickes Leder eingepackt, sodass man nicht hineinsehen konnte. Bernard aber wusste, was darin war. Das Pferd wusste es auch. Es legte angstvoll die Ohren an und schüttelte seine wirre schwarze Mähne.
Bernards dunkle Ordensbrüder – die Ritter des Sanguinarierordens – bahnten ihm den Weg. Ihr Leben zählte nicht angesichts der Bedeutung der Mission. Sie kämpften so kraftvoll und entschlossen, wie kein Mensch es vermocht hätte. Einer seiner Brüder, in jeder Hand ein Schwert, katapultierte sich hoch in die Luft. Die nur schemenhaft erkennbaren Klingen und seine aufblitzenden scharfen Zähne verrieten, dass er kein Mensch war. Einst waren sie alle gottlose Tiere gewesen wie jenes im Käfig, seelenlos und verflucht – bis ihnen Christus den Weg zum Heil aufgezeigt hatte. Sie alle hatten sich verpflichtet, ihren Durst nicht mehr mit Menschenblut zu stillen, sondern allein mit dem geweihten Blut Christi, ein Segen, der es ihnen erlaubte, sich halb im Dunkel und halb im Licht zu bewegen, ein Balanceakt zwischen Gnade und Verdammnis.
Der Kirche verpflichtet, dienten sie Gott nun als Krieger und als Priester.
Der Dienst an der Kirche hatte Bernard und die anderen vor die Tore Jerusalems geführt.
Der Wagen rollte unbeirrt durch das Geschrei und das Gemetzel. Von jäher Furcht erfasst, zwang Bernard das Pferd, schneller zu gehen.
Ich muss mich beeilen …
Doch ihn quälte noch ein anderes Bedürfnis. Blut tropfte von den Wänden, an denen er vorbeikam, rann über das Pflaster. Der salzige Eisengeruch machte ihn benommen, schwängerte die Luft, löste einen nagenden Hunger aus. Er leckte sich die trockenen Lippen, als schmecke er das, was ihm verboten war.
Er war nicht der Einzige, der litt.
Das Tier im Käfig heulte, denn es witterte das Blut. Seine Schreie sprachen das Monster an, das auch Bernard in sich trug – bloß war dieses Monster nicht hinter Eisenstäben eingesperrt, sondern durch Eid und Segen gebunden. Trotzdem verlängerte und schärfte die Gier Bernards Zähne, und sein Verlangen war kaum mehr bezähmbar.
Als sie die Schreie hörten, drängten seine Ordensbrüder mit frischem Elan voran, so als flüchteten sie vor ihrem früheren Selbst.
Vom Pferd konnte man das nicht sagen.
Als das Untier aufheulte, erstarrte der Wallach.
Das konnte man ihm nicht verdenken.
Bernard hatte das eingesperrte Monster vor zehn Monaten in einem verlassenen Stall am Stadtrand von Avignon gefangen. Im Lauf der Jahrhunderte hatte man diesen verfluchten Wesen die verschiedensten Namen gegeben. Früher einmal Menschen, waren sie nun eine Plage, suchten finstere Orte heim und ernährten sich vom Blut der Menschen und Tiere.
Als das Monster eingesperrt war, hatte Bernard den Käfig in dickes Leder gehüllt, damit kein Lichtstrahl hineinfallen konnte. Die Umhüllung schützte das Untier vor dem sengenden Tageslicht, doch dies hatte seinen Preis. Bernard ließ das Wesen hungern und gab ihm nur so viel Blut zu trinken, dass es überlebte, jedoch nie so viel, dass es gesättigt wurde.
Sein Hunger würde Gott eines Tages gute Dienste leisten.
Da sie dem Ziel peinigend nah waren, versuchte Bernard, das Pferd zum Weitergehen zu veranlassen. Er streichelte ihm die schäumenden Nüstern, doch es ließ sich nicht beruhigen. Es drängte zur Seite, wollte sich losreißen.
Ringsumher vollführten die Sanguinarier ihr wohlvertrautes Kampfballett. Die Schreie der Sterbenden hallten vom teilnahmslosen Gemäuer wider. Das Untier im Käfig schlug gegen die Gitterstäbe und ließ die Lederbedeckung wie eine Trommel erdröhnen. Es wollte sich dem Gemetzel anschließen und endlich Blut schmecken.
Das Pferd wieherte und schüttelte angstvoll den Kopf.
Rauch wälzte sich aus den Straßen und Gassen heran. Der Gestank von verbrannter Wolle und Fleisch biss ihm in der Nase. Die Kreuzfahrer hatten begonnen, Teile der Stadt niederzubrennen. Bernard fürchtete, sie könnten auch den Teil zerstören, den er erreichen wollte – den Ort, wo möglicherweise die heilige Waffe versteckt war.
Da das Pferd zu nichts mehr nutze war, zog Bernard das Schwert. Mit ein paar geschickten Hieben durchtrennte er das lederne Geschirr. Eine Aufforderung brauchte der Wallach nicht. Er sprang zwischen den Strängen hervor, drängte einen Sanguinarier beiseite und galoppierte davon.
Viel Glück, dachte Bernard.
Er ging zur Rückseite des Wagens, wohl wissend, dass keiner seiner Mitbrüder im Kampf entbehrlich war. Die letzten Schritte musste er allein gehen.
So wie Christus mit seinem schweren Kreuz.
Er schob das Schwert in die Scheide und stemmte sich gegen den Wagen.
Er würde ihn den Rest des Weges schieben. In einem anderen Leben, als sein Herz noch geschlagen hatte, war er ein kräftiger, lebensstrotzender Mann gewesen. Jetzt verfügte er über übermenschliche Kräfte.
Zitternd sog er den Blutgeruch ein. Vor lauter Gier färbte sich der Rand seines Gesichtsfelds rot. Er wollte von den Männern, Frauen und Kindern der Stadt trinken. Das Verlangen war nahezu übermächtig.
Doch er gab ihm nicht nach, sondern umklammerte sein Brustkreuz, ließ sich vom sengenden Schmerz besänftigen.
Er tat einen Schritt vor, rang den Wagenrädern eine Umdrehung ab und dann noch eine. Jede Umdrehung brachte ihn dem Ziel ein Stück näher.
Doch mit jedem Schritt wuchs seine quälende Angst.
Komme ich vielleicht schon zu spät?
Als die Sonne sich dem Horizont näherte, machte Bernard endlich das Ziel aus. Er zitterte vor Anstrengung, denn er hatte sich verausgabt.
Am Ende der Straße, hinter den letzten Verteidigungsstellungen, an denen noch heftig gekämpft wurde, ragte die bleifarbene Kuppel einer Moschee in den teilnahmslosen blauen Himmel. Die weißen Mauern waren von dunklen Blutflecken verunstaltet. Trotz der Entfernung nahm er den angstvollen Herzschlag der Männer, Frauen und Kinder wahr, die hinter den dicken Mauern der Moschee Zuflucht gesucht hatten.
Während er den Wagen schob, lauschte er auf die Gebete, mit denen sie ihren fremden Gott um Gnade anflehten. Das Untier im Käfig würde ihnen keine gewähren.
Und er auch nicht.
Ihr kleines Leben zählte wenig angesichts des Einsatzes, um den es ging – eine Waffe, die versprach, alles Böse aus der Welt zu tilgen.
Da er abgelenkt war, reagierte er zu spät, sodass das Vorderrad in eine tiefe Spalte einsank und sich zwischen den Steinen verklemmte. Der Wagen kam ruckartig zum Stehen.
Als witterten sie ihren Vorteil, durchbrachen die Ungläubigen den schützenden Kordon. Mit blitzendem Krummschwert stürmte ein hagerer Mann mit wildem schwarzem Haar auf Bernard zu, entschlossen, seine Moschee, seine Familie und sein eigenes Leben zu schützen.
Bernard streckte ihn mit einem einzigen Schwerthieb nieder.
Warmes Blut spritzte auf Bernards Priestergewand. Obwohl dies nur bei außergewöhnlichen Umständen und in äußerster Not gestattet war, berührte er einen Spritzer und führte die Finger an die Lippen. Er leckte das Rot davon ab. Blut allein würde ihm die nötige Kraft zum Weitermachen verleihen. Buße würde er später leisten, notfalls hundert Jahre lang.
Von der Zunge ausgehend, entzündete sich ein Feuer, das neue Kräfte entfachte und sein Gesichtsfeld bis auf einen kleinen Punkt verengte. Er stemmte sich mit der Schulter gegen den Wagen und versetzte ihn in Bewegung.
Er flüsterte ein Gebet – bat um Ausdauer und Vergebung für seine Sünde.
Er schob den Wagen weiter, und seine Ordensbrüder bahnten ihm den Weg.
Vor ihm tauchte der Eingang der Moschee auf, und mit übermenschlicher Kraft trat er das verriegelte Tor ein.
Angstvolle Schreie hallten von den reich geschmückten Wänden wider. Die rasenden Herzschläge vereinigten sich – es waren zu viele, um einen einzelnen herauszuhören. Sie verschmolzen zu einem Hintergrundgeräusch, vergleichbar dem Meeresrauschen. Verängstigte Augen funkelten in der Dunkelheit unter der Kuppel.
Er verharrte im Eingang, ein dunkler Umriss vor den Flammen der brennenden Stadt. Sie sollten sein Priestergewand und das Silberkreuz sehen, damit sie begriffen, dass sie von Christen besiegt worden waren.
Vor allem aber wollte er ihnen klarmachen, dass es aussichtslos war, fliehen zu wollen.
Die übrigen Sanguinarier schlossen zu ihm auf, nahmen Schulter an Schulter hinter ihm im Eingang Aufstellung. Kein Einziger würde entkommen. Der Gestank der Angst erfüllte den großen Raum vom Kachelboden bis zur Kuppel.
Mit einem Satz sprang er zurück zum Wagen. Er hob den Käfig herunter und zerrte ihn die Eingangstreppe hoch. Das Metall schrammte über die steinernen Stufen. Die Mauer der Sanguinarier öffnete sich und ließ ihn durch, dann schloss sie sich wieder.
Er kippte den Käfig, sodass er aufrecht auf den polierten Marmorfliesen stand. Mit einem Schwerthieb durchtrennte er die Angel der Verriegelung. Dann trat er zurück und schwenkte die verrostete Käfigtür auf. Das Knarren übertönte die Herzschläge und das Atmen.
Das Wesen trat hervor, seit vielen Monaten endlich wieder frei. Es streckte seine langen Arme aus, als suchte es die wohlvertrauten Gitterstäbe.
Dass dies einmal ein Mensch gewesen war, konnte man kaum mehr erkennen – die Haut hatte die Farbe von Toten angenommen, das goldfarbene Haar war gewachsen und hing ihm auf den Rücken, die Gliedmaßen waren so dürr wie Spinnenbeine.
Die Eingeschlossenen wichen entsetzt zur Wand zurück, rempelten sich in Panik gegenseitig an. Der zarte Geruch von Blut und Angst ging von ihnen aus.
Bernard hob das Schwert und wartete auf den Angriff des Wesens. Es durfte nicht ins Freie gelangen. Es sollte dieses Gotteshaus entweihen und alles Heilige daran tilgen. Erst dann konnte man es für Bernards Gott weihen.
Als hätte das Wesen seine Gedanken gehört, wandte es ihm sein verschrumpeltes Gesicht zu. Seine Augen schimmerten milchig weiß. Es hatte lange keine Sonne mehr geschaut, und alt war es schon gewesen, als es verwandelt worden war.
Ein Säugling wimmerte.
Einer solchen Versuchung konnte das Wesen nicht widerstehen.
Ruckartig drehte es sich um und stürzte sich auf seine Beute.
Bernard senkte das Schwert. Es war nicht mehr nötig, das Monster in Schach zu halten. Das Blut und der Schmerz der Opfer würden es einstweilen hier festhalten.
Er zwang sich, einen Fuß vor den anderen zu setzen, und folgte dem mörderischen Wesen. Als er unter der Kuppel herschritt, blendete er die Schreie und Gebete aus. Er wandte den Blick ab von den zerfetzten Toten, über die er stieg. Er weigerte sich, auf den Blutgeruch zu reagieren.
Das Monster in ihm, wachgerufen durch die wenigen roten Tropfen, ließ sich nicht vollständig ignorieren. Es wollte sich zu dem anderen gesellen, sich im Blutrausch verlieren.
Sich seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder sättigen.
Bernard schritt schneller aus, denn er fürchtete, die Beherrschung zu verlieren und dem Verlangen zu erliegen – dann hatte er die Treppe an der anderen Seite des Raums erreicht.
Die plötzliche Stille ließ ihn innehalten.
Alle Herzschläge waren verstummt. Die Stille und das schlechte Gewissen lähmten ihn.
Dann hallte ein unnatürlicher Schrei durch die Kuppel. Die Sanguinarier hatten das Wesen getötet, denn es hatte seinen Zweck erfüllt.
Gott vergib mir …
Von der Stille befreit, stürmte er die Treppe hinunter und eilte durch die gewundenen Gänge unter der Moschee. Sein Weg führte ihn immer tiefer in die Eingeweide der Stadt. Der dicke Gestank des Gemetzels verfolgte ihn wie ein Schattengespenst.
Dann witterte er einen neuen Geruch.
Wasser.
Er ließ sich auf alle viere nieder, kroch in einen engen Tunnel hinein und machte vor sich flackernden Feuerschein aus. Er fühlte sich davon angezogen wie die Motte vom Licht. Der Tunnel mündete in eine Höhle, groß genug, um aufrecht stehen zu können.
Er kletterte hinein und richtete sich auf. Eine Binsenfackel hing an der Wand und erhellte flackernd einen schwarzen Wassertümpel. Die hohe Decke war dick verrußt.
Als Bernard vortrat, richtete sich hinter einem Stein eine Frau auf. Pechschwarze Locken fielen auf die Schultern ihres weißen Gewands, ihre dunkelbraune Haut war glatt und makellos. An einem dünnen goldenen Halskettchen war eine Metallscherbe von der Länge ihrer Handfläche befestigt. Der Anhänger ruhte zwischen ihren wohlgeformten Brüsten, die sich unter dem Leibchen abzeichneten.
Bernard war schon lange Priester, dennoch war er nicht unempfänglich für ihre Schönheit. Sie musterte ihn mit leuchtenden Augen.
»Wer bist du?«, fragte er. Er nahm bei ihr keinen Herzschlag wahr, doch intuitiv war ihm klar, dass sie anders war als das Wesen im Käfig und als er selbst. Trotz des Abstands spürte er die Wärme, die von ihr ausstrahlte. »Bist du die Herrin des Brunnens?«
Diesen Namen hatte er auf einem alten Papyrus gefunden, zusammen mit einer Karte.
Sie antwortete nicht auf seine Fragen. »Du bist noch nicht bereit für das, wonach du suchst«, sagte sie stattdessen. Sie sprach Lateinisch, aber mit einem uralten Akzent, älter als der seine.
»Ich suche nur Wissen«, entgegnete er.
»Wissen?« Aus ihrem Mund klang das Wort wie eine Klage. »Hier wirst du nur Enttäuschung finden.«
Doch offenbar spürte sie seine Entschlossenheit. Sie trat beiseite und bedeutete ihm mit ihrer dunkelhäutigen, langfingrigen Hand, an den Rand des Tümpels zu treten. Ein dünnes Goldband umschloss ihren Oberarm.
Er trat an ihr vorbei, wobei er beinahe ihre Schulter streifte. Lotusduft hüllte sie ein.
»Leg die Kleidung ab«, sagte sie. »Du musst nackt ins Wasser gehen, so wie du herausgekommen bist.«
Am Rand des Tümpels stehend, hantierte er beschämt mit seinem Gewand.
Sie wandte den Blick nicht ab. »Du hast mannigfaltigen Tod an diesen heiligen Ort gebracht, Priester des Kreuzes.«
»Er wird gereinigt werden«, sagte er beschwichtigend. »Dann wird er dem einzigen wahren Gott geweiht.«
»Dem einzigen?« Bedauern lag in ihren tiefen Augen. »Bist du dir sicher?«
»Das bin ich.«
Sie zuckte mit den Schultern. Dabei rutschte ihr das dünne Leibchen von den Schultern. Raschelnd fiel es auf den unebenen Steinboden. Die Fackel beleuchtete einen so makellosen Leib, dass er sein Gelübde vergaß und sie unverhohlen anstarrte. Sein Blick glitt über ihre vollen Brüste, ihren Bauch, ihre langen, muskulösen Oberschenkel.
Sie wandte sich um und sprang ins dunkle Wasser, das sich bei ihrem Eintauchen kaum kräuselte.
Eilig löste er den Gürtel, riss sich die blutigen Stiefel von den Füßen und streifte das Gewand ab. Nackt sprang er ins Wasser und tauchte tief hinein. Das eiskalte Nass wusch das Blut von seiner Haut, taufte ihn in Unschuld.
Er ließ die Luft aus der Lunge entweichen, denn als Sanguinarier bedurfte er ihrer nicht. Er sank rasch in die Tiefe, schwamm der Frau hinterher. Unter ihm blitzten kurz ihre Gliedmaßen auf – dann flitzte sie wie ein Fisch zur Seite.
Er tauchte tiefer, doch sie war verschwunden. Er berührte sein Kreuz und flehte Gott um Unterweisung an. Sollte er nach ihr suchen oder seine Mission fortsetzen?
Die Antwort fiel ihm leicht.
Er machte kehrt und schwamm gemäß der Karte vom alten Papyrus, die er sich eingeprägt hatte, auf das tief unter Jerusalem verborgene Geheimnis zu.
So schnell er sich traute, schwamm er in völliger Dunkelheit durch das komplizierte System der Gänge. Ein Sterblicher wäre längst erstickt. Mit der Hand strich er über den Fels, zählte die Abzweigungen. Zweimal landete er in einer Sackgasse und musste umkehren. Er kämpfte gegen die aufsteigende Panik an, sagte sich, er habe die Karte falsch gelesen, redete sich ein, dass der gesuchte Ort tatsächlich existierte.
Seine Verzweiflung verdichtete sich zu einer scharfen Spitze – dann schwamm im eiskalten Wasser auf einmal eine Gestalt an ihm vorbei, deren Sog er wahrnahm. Erschrocken wollte er das Schwert ziehen, dann fiel ihm ein, dass er es zusammen mit dem Gewand abgelegt hatte.
Er wollte nach ihr greifen, doch sie war bereits verschwunden.
Mit neuer Entschlossenheit wandte er sich in die Richtung, aus der sie gekommen war. Die Vorstellung, dass er womöglich ewig durch die Dunkelheit schwimmen könnte, ohne je fündig zu werden, verdrängte er.
Schließlich wichen die Wände zurück, und er gelangte in eine große Höhle.
Obwohl er noch immer nichts sah, spürte er, dass er hier richtig war. Das Wasser war ein wenig wärmer geworden, und es war anscheinend geweiht, denn es löste einen Juckreiz aus. Er schwamm zum Rand, hob die zitternden Hände und erkundete die Wand.
Der Stein war behauen.
Endlich …
Er betastete den Stein, versuchte, sich ein Bild von den Darstellungen zu machen.
Von Bildern, die ihn retten könnten.
Von Bildern, die ihn zur heiligen Waffe führen mochten.
Er ertastete den Umriss eines Kreuzes, fand den Gekreuzigten – und darüber eine Erhebung, der gleiche Mann mit erhobenem Gesicht, die Arme himmelwärts gereckt. Eine Linie verband die aufsteigende Seele mit dem angenagelten Körper.
Als er die Linie entlangfuhr, brannten seine Fingerspitzen, woraus er folgerte, dass es sich bei dem Metall um reines Silber handelte. Vom Kreuz ausgehend, zog sich die Linie über die geschwungene Höhlenwand zur nächsten Darstellung. Es handelte sich um eine Gruppe von Männern mit Schwertern, die Christus festnehmen wollten. Die Hand des Erlösers berührte einen der Männer an der Schläfe.
Bernard wusste, was die Szene bedeutete.
Die Heilung des Malchus.
Dies war das letzte Wunder, das Christus vor seiner Wiederauferstehung vollbracht hatte.
Bernard schwamm an der Wand entlang und ließ sich von der silbernen Linie durch die zahlreichen Wunder leiten, die Jesus im Laufe seines Lebens vollbracht hatte: die Vermehrung der Fische, die Erweckung von den Toten, die Heilung der Leprakranken. Jedes einzelne Wunder vergegenwärtigte er sich, als habe er ihm persönlich beigewohnt. Er versuchte, seine Hoffnung und sein Hochgefühl zu bezähmen.
Schließlich gelangte er zur Darstellung der Hochzeit zu Kana, wo Christus Wasser in Wein verwandelt hatte. Dies war das erste Wunder des Erlösers.
Das silberne Band reichte noch weiter, brannte sich durch die Dunkelheit.
Wohin führte es? Würde es womöglich unbekannte Wunder offenbaren?
Bernard folgte ihm – bis zu einem Bereich, wo das Gestein unter seinen Fingern zerbröselte. Hektisch bewegte er die Handflächen in immer weiteren Bögen über die Felswand. In den Stein eingebettete Silbersplitter versengten ihm die Haut. Der Schmerz brachte ihn wieder zu Sinnen und zwang ihn, sich seiner größten Angst zu stellen.
Dieser Teil der Darstellung war zerstört worden.
Er breitete die Arme aus, suchte nach weiteren Hinweisen. Den alten Papyrusresten zufolge sollte diese Geschichte der Wunder Christi das Versteck der heiligsten aller Waffen offenbaren – einer Waffe, die imstande war, mit einer Berührung selbst die mächtigste verdammte Seele zu vernichten.
Im Wasser schwebend, begriff er die Wahrheit.
Das Geheimnis war zerstört worden.
Und er wusste, wer das getan hatte.
Die Worte der Wächterin hallten in seinem Kopf wider.
Wissen? Hier wirst du nur Enttäuschung finden.
Da sie ihn für unwürdig befunden hatte, war sie hierhergeschwommen und hatte die heilige Darstellung entstellt, bevor er sie zu Gesicht bekam. Seine Tränen mischten sich ins kalte Wasser, doch er weinte nicht um das, was verloren war.
Ich habe versagt.
Alle, die heute getötet wurden, sind umsonst gestorben.
TEIL 1
Ich habe gesündigt, ich habe euch einen unschuldigen Menschen ausgeliefert. Sie antworteten: Was geht das uns an?
Matthäus 27,4
1
18. Dezember, 9:58 PSTPalo Alto, Kalifornien
SIE WAR NERVÖS, fast ein wenig panisch.
Als Dr. Erin Granger den Vorlesungssaal auf dem Stanford-Campus betrat, vergewisserte sie sich als Erstes, dass sie allein war. Sie ging sogar in die Hocke und sah unter den Sitzen nach, ob sich dort jemand versteckte. Ihre Rechte ruhte auf dem Wadenholster mit der Glock 19.
Es war ein wundervoller Wintermorgen. Die Sonne schien, der blaue Himmel war mit weißen Wolken betupft. Da helles Tageslicht durch die hohen Fenster strömte, brauchte sie sich im Moment nicht vor den dunklen Wesen zu fürchten, die sie in ihren Albträumen verfolgten.
Doch nach allem, was sie erlebt hatte, wusste sie, dass ihre Mitmenschen zu nicht minder Bösem fähig waren.
Sie richtete sich auf, ging zum Vortragspult und seufzte erleichtert. Sie wusste, dass ihre Ängste irrational waren, doch das hielt sie nicht davon ab, den Saal zu untersuchen, bevor ihre Studenten kamen. College-Kids konnten zwar ganz schön nervig sein, doch sie hätte alles getan, um sie vor Schaden zu bewahren.
Sie wollte nicht noch einmal einen Studenten verlieren.
Erin krampfte die Finger um die abgewetzte Ledertasche in ihrer Hand. Sie musste sich zwingen, sie zu öffnen und neben das Pult zu legen. Sie ließ den Blick durch den Raum schweifen, öffnete die Tasche und holte ihre Vorlesungsnotizen heraus. Für gewöhnlich hatte sie alles im Kopf, doch sie hatte diesen Kurs von einer Professorin übernommen, die in Mutterschaftsurlaub gegangen war. Das Thema war interessant und lenkte sie von den Ereignissen ab, die ihr Leben auf den Kopf gestellt hatten. Angefangen hatte es vor ein paar Monaten in Israel mit dem Tod zweier Doktoranden.
Heinrich und Amy.
Der deutsche Student war nach einem Erdbeben seinen Verletzungen erlegen. Amy war später getötet worden, weil Erin ihr verbotenerweise eine bestimmte Information hatte zukommen lassen.
Sie rieb die Handflächen aneinander, als wollte sie das Blut und die Verantwortung abwaschen. Auf einmal kam es ihr kühl vor. Draußen waren es höchstens zehn Grad, und im Saal war es nicht wesentlich wärmer. Der Schauder, der sie durchlief, als sie das Manuskript zurechtlegte, hatte jedoch nichts mit der armseligen Heizung zu tun.
Nach ihrer Rückkehr nach Stanford hätte sie sich in der vertrauten Umgebung und mit der täglichen Routine der Vorweihnachtszeit eigentlich besser fühlen sollen.
Doch dem war nicht so.
Denn nichts war mehr wie vorher.
Als sie noch ihre Notizen ordnete, trudelten die Studenten ein, allein und in Zweiergruppen. Einige stiegen zu den vorderen Plätzen hinunter, doch die meisten entschieden sich für eine der hinteren Reihen.
»Professor Granger?«
Erin schaute nach links. Ein junger Mann mit fünf Silberringen in der Augenbraue näherte sich ihr. Mit entschlossener Miene trat er vor sie hin. Er hatte eine Kamera mit Teleobjektiv geschultert.
»Ja?« Sie vermochte ihre Verärgerung nicht zu verhehlen.
Der junge Mann legte ein gefaltetes Papier auf das Holzpult und schob es ihr hin.
Die anderen Studenten im Saal wirkten unbeteiligt, doch sie waren schlechte Schauspieler. Erin merkte, dass sie herschauten und sich fragten, wie sie wohl reagieren würde. Auch ohne das Papier auseinanderzufalten, wusste sie, dass der junge Mann seine Telefonnummer darauf notiert hatte.
»Ich komme von der Stanford Daily.« Er spielte mit einem der Ringe in seiner Braue. »Würden Sie mir ein kurzes Interview für die Campuszeitung geben?«
Sie schob das Papier ungeöffnet zurück. »Nein, danke.«
Seit ihrer Rückkehr aus Rom hatte sie alle Interviewanfragen abgelehnt. Sie würde ihr Schweigen auch jetzt nicht brechen, denn alles, was sie hätte sagen können, wäre gelogen gewesen.
Um die Wahrheit über den tragischen Tod ihrer beiden Studenten zu verschleiern, war das Gerücht verbreitet worden, sie wäre nach dem Erdbeben in der israelischen Wüste drei Tage lang in den Trümmern von Masada verschüttet gewesen. Demzufolge war sie zusammen mit Sergeant Jordan Stone und Nate Highsmith, ihrem einzigen überlebenden Doktoranden, lebend gefunden worden.
Die Deckgeschichte war nötig, um zu verschleiern, dass sie in der Zeit für den Vatikan gearbeitet hatte, eine List, die auch von einigen wenigen Regierungsmitgliedern gestützt wurde, die ebenfalls eingeweiht waren. Die Öffentlichkeit war nicht bereit für Geschichten über nachts umherstreifende Ungeheuer und das dunkle Fundament, auf dem die Welt ruhte.
Aber wie dem auch sei, sie hatte nicht die Absicht, diese Lügen fortzuspinnen.
Der Student mit den Piercings ließ nicht locker. »Sie könnten sich den Artikel vor der Veröffentlichung anschauen. Wenn er Ihnen nicht gefällt, feilen wir ihn zurecht.«
»Ich respektiere Ihre Hartnäckigkeit und Ihren Eifer, aber das ändert nichts an meiner Haltung.« Sie deutete ins halb volle Auditorium. »Bitte nehmen Sie Platz.«
Er zögerte, als wollte er noch etwas sagen.
Sie richtete sich zu voller Größe auf und fixierte ihn drohend. Sie war nur eins dreiundsiebzig groß, und mit ihrem lässigen blonden Pferdeschwanz wirkte sie nicht besonders einschüchternd.
Ihre Haltung aber gab den Ausschlag.
Was immer er in ihren Augen sah, es veranlasste ihn, sich den anderen Studenten anzuschließen und mit gesenktem Kopf Platz zu nehmen.
Da das geregelt war, schob sie ihre Notizen zu einem ordentlichen Stapel zusammen und wandte sich an die Zuhörer. »Ich danke Ihnen, dass Sie zur Abschlussvorlesung Geschichte 104 erschienen sind: ›Die Bibel vom Heiligen entkleidet.‹ Heute wollen wir uns mit den vorherrschenden Missverständnissen bezüglich des religiösen Feiertags beschäftigen, der bereits vor der Tür steht und den wir Weihnachten nennen.«
Statt des Raschelns von Papier, wie es früher üblich war, vernahm man das Surren hochfahrender Laptops.
»Was feiern wir eigentlich am fünfundzwanzigsten Dezember?« Sie ließ ihren Blick über die Studenten schweifen – einige hatten Piercings, andere Tattoos und mehrere einen Kater. »Der fünfundzwanzigste Dezember? Wer möchte etwas sagen? Das ist nun wirklich leicht.«
Ein Mädchen, auf dessen Sweatshirt ein Engel aufgestickt war, meldete sich. »Die Geburt Christi?«
»Das ist richtig. Aber wann wurde Christus wirklich geboren?«
Niemand antwortete.
Sie lächelte; allmählich fand sie Gefallen an ihrer Vortragsrolle. »Klug von Ihnen, dass Sie alle vermeiden, in die Falle zu tappen.« Das brachte ihr ein paar Lacher ein. »Das Datum von Christi Geburt ist tatsächlich Gegenstand von Diskussionen. Clemens von Alexandrien schrieb …«
Sie setzte ihre Vorlesung fort. Vor einem Jahr hätte sie noch gesagt, kein Lebender kenne das wahre Geburtsdatum Christi. Jetzt konnte sie das nicht mehr sagen, denn bei ihren Abenteuern in Israel, Russland und Rom hatte sie jemanden kennengelernt, der es tatsächlich kannte, der schon zu der Zeit gelebt hatte, als Christus geboren worden war. Da war ihr klar geworden, wie viel von dem, was sie für gesichertes historisches Wissen hielt, falsch war – entstellt entweder durch Unwissen oder in der Absicht, dunklere Wahrheiten zu verhüllen.
Für eine Archäologin wie sie, die im Sand und unter Steinen nach der historischen Wahrheit suchte, war dies eine verstörende Erkenntnis. Nach ihrer Rückkehr in die komfortable akademische Welt stellte sie fest, dass ihr selbst die simpelste Vorlesung sorgfältige Überlegung abverlangte. Ihren Studenten die Wahrheit, wenn nicht gar die volle Wahrheit zu sagen war nahezu unmöglich geworden. Jede Vorlesung kam ihr vor wie eine Lüge.
Wie kann ich so weitermachen und diejenigen anlügen, denen ich eigentlich die Wahrheit vermitteln soll?
Aber hatte sie überhaupt eine Wahl? Nachdem sie die Tür kurz geöffnet und einen Blick auf das verborgene Wesen der Welt geworfen hatte, war sie mit Donnerknall wieder zugefallen.
Nicht zugefallen. Man hat sie mir vor der Nase zugeschlagen.
Jetzt war sie von den hinter der Tür verborgenen Wahrheiten abgeschnitten und fragte sich, was real war und was nicht.
Schließlich endete die Vorlesung. Sie wischte eilig die Weißwandtafel, als wollte sie die darauf versammelten Irrtümer und Halbwahrheiten auslöschen. Endlich war es vorbei. Sie beglückwünschte sich dazu, dass sie die abschließende Vorlesung des Jahres hinter sich gebracht hatte. Jetzt musste sie nur noch die letzten Arbeiten benoten – dann konnte sie sich der Herausforderung der Weihnachtsferien stellen.
Im Geiste sah sie die blauen Augen und harten Flächen eines wettergegerbten Gesichts vor sich, die vollen Lippen, die so gerne lächelten, die glatte Stirn unter dem kurzen blonden Haarschopf. Sie freute sich auf das Wiedersehen mit Sergeant Jordan Stone. Ihre letzte Begegnung war mehrere Wochen her, aber sie hatten häufig telefoniert. Sie war sich nicht sicher, ob die Beziehung halten würde, wollte ihr aber eine Chance geben.
Deshalb musste sie auch das perfekte Weihnachtsgeschenk finden. Bei dem Gedanken lächelte sie.
Als sie sich anschickte, die letzte Zeile auf der Tafel auszuwischen und die Studenten zu entlassen, verdunkelte auf einmal eine Wolke die Sonne und hüllte den Vorlesungssaal in Schatten. Ihre Hand erstarrte. Ihr wurde schwindlig, dann stürzte sie …
… in tiefe Dunkelheit.
Steinwände engten sie ein. Sie setzte sich mühsam auf. Sie stieß sich den Kopf an und sackte zusammen. In Panik tastete sie umher.
Ringsum Stein – über ihr, hinter ihr, an den Seiten. Kein rauer Stein, als wäre sie in einem Berg gefangen. Sondern bearbeitet. Spiegelglatt.
An der Oberseite des Gehäuses befand sich ein silbernes Ornament. Es versengte ihr die Fingerspitzen.
Sie schluckte, Wein lief ihr in den Mund. Genug Wein, um darin zu ertrinken.
Wein?
An der Rückseite des Saals fiel eine Tür zu. Das Geräusch versetzte sie zurück in die Gegenwart. Sie starrte den Schwamm in ihrer Hand an, die weißen Knöchel.
Wie lange habe ich hier so gestanden? Vor aller Augen?
Vermutlich nur ein paar Sekunden lang. In den vergangenen Wochen hatte sie mehrere solche Anfälle gehabt, aber noch keinen in der Öffentlichkeit. Erin hatte sie einem posttraumatischen Schock zugeschrieben und gehofft, sie würden irgendwann aufhören, doch dieser Anfall war bislang der schlimmste gewesen.
Sie atmete tief durch und wandte sich zu den Studenten um. Sie wirkten nicht verunsichert, also war sie nicht besonders lange weggetreten gewesen. Sie musste die Anfälle unter Kontrolle bringen, bevor etwas Schlimmes geschah.
Sie sah zur Tür am Ende des Saals.
Dort erblickte sie Nate Highsmith, der einen großen Umschlag in Händen hielt. Er lächelte entschuldigend und stapfte in seinen Cowboystiefeln in den Saal hinunter. Sein schleppender Gang rief ihr in Erinnerung, was ihm im vergangenen Herbst zugestoßen war.
Sie kniff die Lippen zusammen. Sie hätte besser auf ihn aufpassen müssen. Und auf Heinrich auch. Vor allem aber auf Amy. Hätte sie die junge Frau nicht in Gefahr gebracht, wäre sie heute vielleicht noch am Leben. Amys Eltern würden Weihnachten nicht ohne ihre Tochter verbringen müssen. Sie hatten nicht gewollt, dass Amy Archäologie studierte. Erin hatte sie dazu überredet, ihre Tochter an der Grabung in Israel teilnehmen zu lassen. Sie hatte ihnen versichert, dass es vollkommen ungefährlich sei.
Das hatte sich als furchtbarer Irrtum erwiesen.
Sie stellte den Fuß schräg und spürte die beruhigende Ausbuchtung der Waffe an ihrer Wade. Sie wollte sich nie wieder übertölpeln lassen. Es sollten keine weiteren Unschuldigen mehr sterben.
Sie räusperte sich. »Das wäre alles, Leute. Sie sind entlassen. Genießen Sie die Winterferien.«
Während der Saal sich leerte, schaute sie durchs Fenster zum klaren Himmel hinaus und bemühte sich, die Dunkelheit zu verscheuchen, die von ihrer Vision übrig geblieben war.
Als die Letzten gegangen waren, trat Nate vor sie hin. »Professor.« Er wirkte besorgt. »Ich habe eine Nachricht für Sie.«
»Was für eine Nachricht?«
»Genau genommen zwei. Die erste ist von der israelischen Regierung. Man hat die Daten der Grabung in Caesarea endlich freigegeben.«
»Das ist ja toll.« Sie versuchte, ein wenig Begeisterung zu zeigen, doch es gelang ihr nicht. Es war das Mindeste, dass Amy und Heinrich posthum die Anerkennung zugesprochen bekamen. »Und die zweite Nachricht?«
»Ist von Kardinal Bernard.«
Erstaunt musterte sie Nate. Seit Wochen versuchte sie, den Leiter des Sanguinarierordens in Rom zu erreichen. Sie hatte sogar überlegt, nach Italien zu fliegen und ihn in seiner Privatwohnung im Vatikan aufzusuchen.
»Wurde auch Zeit, dass er auf meine Anrufe antwortet«, brummelte sie.
»Er möchte, dass Sie unverzüglich zurückrufen«, sagte Nate. »Es klang dringend.«
Erin seufzte genervt. Bernard ignorierte sie seit zwei Monaten, und jetzt wollte er auf einmal etwas von ihr. Sie hatte zahllose Fragen – Überlegungen und Gedanken, die sie seit ihrer Rückkehr aus Rom beschäftigten. Sie blickte auf die Tafel, auf die halb ausgewischte Zeile. Auch zu den Visionen hatte sie Fragen.
Waren sie Folge von posttraumatischem Stress? Durchlebte sie die Ängste, die ihr zugesetzt hatten, als sie im Untergrund von Masada eingesperrt gewesen war?
Aber wenn das stimmt, wieso schmecke ich dann Wein?
Sie schüttelte den Kopf und zeigte auf seine Hand. »Was ist in dem Umschlag?«
»Der ist an Sie adressiert.« Nate reichte ihn ihr.
Er war schwer, deshalb musste mehr darin sein als nur ein Brief. Erin warf einen Blick auf die Absenderadresse.
Israel.
Mit zitternden Fingern schlitzte sie den Umschlag mit ihrem Stift auf.
Nate bemerkte ihr Zittern und reagierte besorgt. Sie wusste, dass er mit einem Therapeuten über seine posttraumatische Belastungsstörung gesprochen hatte. Sie waren zwei verletzte Überlebende mit Geheimnissen, die nicht offen ausgesprochen werden durften.
Sie schüttelte den Umschlag. Ein einzelnes Blatt Papier rutschte heraus, zusammen mit einem Gegenstand von der Größe und Form eines Wachteleis. Bedrückt schaute sie es an.
Auch Nate stöhnte auf und wich einen Schritt zurück.
Das war ihr nicht möglich. Sie überflog das Schreiben. Es kam von den israelischen Sicherheitskräften. Man sei zu dem Schluss gelangt, dass das beigefügte Artefakt für die weitere Untersuchung nicht von Bedeutung sei, und hoffe, sie werde es seinem rechtmäßigen Besitzer zukommen lassen.
Sie umfasste den polierten Bernstein, als sei es der wertvollste Gegenstand auf Erden. Im fahlen Licht der Neonröhren wirkte er wie ein glänzender brauner Stein, fühlte sich aber wärmer an. Er spiegelte, und in der Mitte war eine dunkle Feder eingeschlossen, konserviert vor Tausenden von Jahren, ein im Bernstein fixierter Augenblick.
»Amys Glücksbringer«, murmelte Nate und schluckte mühsam. Er war dabei gewesen, als Amy ermordet worden war. Er vermied es, das kleine Bernsteinei anzusehen.
Erin legte Nate mitfühlend eine Hand an den Ellbogen. Der Talisman war weit mehr als nur ein Glücksbringer. Amy hatte Erin eines Tages erklärt, sie habe das Bernsteinstück als kleines Mädchen am Strand gefunden. Sie sei fasziniert gewesen von der eingeschlossenen Feder und habe sich gefragt, woher sie stamme, habe sich den Flügel vorgestellt, von dem sie abgefallen sei. Der Bernstein hatte ihre Vorstellung so vollständig bewahrt wie die Feder. Dies war der Auslöser dafür gewesen, dass Amy Archäologie studiert hatte.
Erin betrachtete den Bernstein auf ihrer Hand in dem Wissen, dass er nicht nur Amys Studienfach bestimmt, sondern ihr auch den Tod gebracht hatte.
Sie schloss die Finger um den glatten Stein, drückte fest zu und gab im Stillen ein Versprechen ab.
Nie wieder …
2
18. Dezember, 11:12 ESTArlington, Virginia
SERGEANT JORDAN STONE kam sich in seiner blauen Uniform vor wie ein Schwindler. Heute würde er das letzte Mitglied seines ehemaligen Teams bestatten – einen jungen Mann namens Corporal Sanderson. Sandersons Leichnam war wie der seiner Teamkameraden nie gefunden worden.
Nach zweimonatiger Suche im Geröll, das einmal der Berg Masada gewesen war, hatte das Militär aufgegeben. Sandersons leerer Sarg drückte Jordan gegen die Hüfte, während er im Gleichschritt mit den anderen Sargträgern marschierte.
Ein Dezembersturm hatte das Gelände des Nationalfriedhofs von Arlington zugedeckt, das braune Gras unter dem Schnee begraben und das Baumgeäst weiß bestäubt. Schnee häufte sich auch auf den geschwungenen Oberseiten der marmornen Grabsteine. Es waren mehr, als er abzählen konnte. Die Gräber waren nummeriert, die meisten mit Namen versehen. Alle diese Soldaten hatten ein ehrenvolles Begräbnis bekommen.
Eine von ihnen war seine Frau Karen, die vor über einem Jahr im Einsatz gefallen war. Es war nicht genug von ihr übrig geblieben, um sie zu begraben, nur ihre Hundemarken. Ihr Sarg war ebenso leer gewesen wie der von Sanderson. Bisweilen fiel es Jordan schwer zu glauben, dass sie nicht mehr da war, dass er ihr niemals mehr Blumen mitbringen und sie sich dafür nie wieder mit einem langen Kuss bedanken würde. Die Blumen brachte er jetzt zum Grab. Bevor er zu Sandersons Bestattung gegangen war, hatte er rote Rosen auf ihr Grab gelegt.
Er stellte sich Sandersons sommersprossiges Gesicht vor. Sein junger Teamkamerad war eifrig bei der Sache gewesen, hatte seinen Job ernst genommen und sein Bestes gegeben. Belohnt worden war er mit einem einsamen Tod auf einem Berg in Israel. Jordan krampfte die Hand um den kalten Sarggriff und wünschte, der Einsatz hätte einen anderen Ausgang genommen.
Noch ein paar Schritte an kahlen Bäumen entlang, dann trugen er und seine Begleiter den Sarg in die eiskalte Kapelle. In diesen schlichten weißen Wänden fühlte er sich mehr zu Hause als in den prachtvollen Kirchen Europas. Auch Sanderson hätte es hier besser gefallen.
Drinnen erwarteten sie Sandersons Mutter und dessen Schwester. Trotz des Schnees und der Kälte trugen beide das gleiche schwarze Kostüm und ungefütterte Schuhe. Ihre Nasen und Augen waren gerötet.
Er fehlte ihnen.
Jordan bedauerte, dass es so gekommen war.
Neben ihnen nahm sein Vorgesetzter Captain Stanley Haltung an. Der Captain war bei allen Bestattungen, an denen Jordan teilgenommen hatte, dabei gewesen und hatte die Lippen zu einem schmalen Strich zusammengepresst, als die Särge in die Grube hinabgelassen wurden. Gute Soldaten, alle miteinander.
Er war ein Vorgesetzter, wie er im Buche stand, und hatte die dienstliche Nachbesprechung vorbildlich durchgeführt. Jordan hatte sich an die Lüge gehalten, die der Vatikan ihm zurechtgelegt hatte: Der Berg sei bei dem Erdbeben auseinandergebrochen, und alle seien umgekommen. Er und Erin hätten in einem Hohlraum überlebt und seien drei Tage später von einem Suchtrupp des Vatikans gerettet worden.
Eigentlich ganz einfach.
Doch es entsprach nicht der Wahrheit, und er war bedauerlicherweise ein schlechter Lügner. Sein Vorgesetzter hegte den Verdacht, dass er nicht alles berichtet hatte, was vor und nach der Rettung in Masada geschehen war.
Jordan war bereits suspendiert und zu einer psychologischen Beratung verpflichtet worden. Jemand beobachtete ihn und wartete ab, ob er zusammenbrechen würde. Dabei wollte er nur wieder in den Einsatz gehen und seinen Job tun. Als Angehöriger der forensischen Abteilung des Expeditionskorps in Afghanistan hatte er militärische Straftaten untersucht. Darin war er gut, und er wollte weiterarbeiten.
Um sich zu beschäftigen und abzulenken.
Stattdessen nahm er neben einem weiteren Sarg Haltung an, und die Kälte des Marmorbodens sickerte in seine Zehen. Neben ihm fror Sandersons Schwester. Am liebsten hätte er ihr seine Uniformjacke umgelegt.
Er achtete mehr auf die ernste Stimme des Militärgeistlichen als auf dessen Worte. Der Priester hatte nur zwanzig Minuten Zeit für die Zeremonie. In Arlington fanden heute mehrere Bestattungen statt, und alles lief streng nach Zeitplan ab.
Bald darauf fand er sich an der Grabstätte wieder. Er hatte diesen Weg schon so oft zurückgelegt, dass seine Füße von allein ans Grab fanden. Sandersons Sarg ruhte auf der schneebestäubten braunen Erde neben der mit einem Tuch ausgelegten Grube.
Ein eiskalter Wind blies über den Schnee, verwirbelte die Flocken zu schmalen Bändern, die den Zirruswolken glichen, die in der Wüste, in der Sanderson gestorben war, so oft zu sehen waren. Jordan wartete bis zum Ende der Zeremonie, lauschte dem Salut aus drei Gewehren und dem Trompeter, der den Zapfenstreich spielte, beobachtete, wie der Geistliche die gefaltete Fahne Sandersons Mutter überreichte.
Die gleiche Zeremonie hatte er für jeden einzelnen seiner zehn toten Teamkameraden mitgemacht.
Leichter war es nicht geworden.
Schließlich schüttelte Jordan Sandersons Mutter die Hand. Sie fühlte sich kalt und zerbrechlich an, und er fürchtete unwillkürlich, er könnte ihr wehtun. »Ich möchte Ihnen mein tiefstes Beileid aussprechen. Corporal Sanderson war ein vorbildlicher Soldat und ein guter Mensch.«
»Er hat Sie gemocht.« Sandersons Mutter lächelte traurig. »Er hat gesagt, Sie wären klug und tapfer.«
Jordan rang seinem erstarrten Gesicht ein nicht minder trauriges Lächeln ab. »Das freut mich zu hören, Ma’am. Er war ebenfalls klug und tapfer.«
Sie blinzelte gegen die Tränen an und wandte sich ab. Obwohl er nicht wusste, was er sagen sollte, wollte er ihr hinterhergehen, doch da legte ihm der Geistliche die Hand auf die Schulter.
»Ich glaube, wir haben noch etwas zu besprechen, Sergeant.«
Jordan musterte den jungen Kaplan. Er trug eine blaue Uniform, genau wie Jordan, doch auf die Umschläge waren Kreuze aufgestickt. Bei näherem Hinsehen bemerkte Jordan, dass er selbst für die Winterzeit zu blass, sein braunes Haar ein bisschen zu lang und seine Haltung nicht ganz militärisch war. Als der Kaplan seinen Blick erwiderte, blinzelte er kein einziges Mal mit seinen grünen Augen.
Jordan sträubten sich die Nackenhaare.
Die Kälte sickerte aus der Hand des Kaplans durch seinen Handschuh hindurch. Die Kälte stammte nicht vom Aufenthalt im Freien. Diese Hand war seit Jahren nicht mehr warm gewesen.
Jordan hatte schon viele seiner Art kennengelernt. Vor ihm stand ein untotes Raubtier, ein Vampirwesen, das als Strigoi bezeichnet wurde. Da dieser Mann bei Tag unterwegs war, bedeutete dies, dass er ein Sanguinarier war – ein Strigoi, der gelobt hatte, kein Menschenblut mehr zu trinken, der katholischen Kirche zu dienen und sich allein von Christi Blut zu ernähren – genauer gesagt von Wein, der durch das heilige Sakrament der Wandlung in das Blut des Erlösers transformiert worden war.
Aufgrund seines Gelöbnisses war dieses Wesen weniger gefährlich.
Jedoch nicht sehr viel weniger.
»Ich wüsste nicht, was wir zu besprechen hätten«, sagte Jordan.
Er wandte sich zum Gehen und bereitete sich innerlich auf einen Kampf vor. Er hatte Sanguinarier kämpfen sehen. Dieser hagere Kaplan könnte ihn sicherlich besiegen, doch Jordan war entschlossen, es ihm so schwer wie möglich zu machen.
Captain Stanley trat zwischen sie und räusperte sich. »Das wurde von ganz oben eingefädelt, Sergeant Stone.«
»Von wem, Sir?«
»Er wird Ihnen alles erklären«, entgegnete der Captain und zeigte auf den Kaplan. »Begleiten Sie ihn.«
»Und wenn ich mich weigere?« Jordan hielt den Atem an und hoffte auf eine positive Antwort.
»Das ist ein Befehl, Sergeant.« Captain Stanley musterte Jordan. »Das kommt von ganz oben.«
Jordan unterdrückte ein Stöhnen. »Tut mir leid, Sir.«
Captain Stanleys Mundwinkel zuckte, was dem herzhaften Lachen eines umgänglicheren Menschen entsprach. »Das glaube ich Ihnen aufs Wort, Sergeant.«
Jordan salutierte und fragte sich, ob es wohl das letzte Mal wäre, dann folgte er dem Geistlichen zu einer am Bordstein wartenden schwarzen Limousine. Offenbar drängten sich die Sanguinarier wieder in sein Leben, um die Trümmer seiner Karriere mit ihren unsterblichen Füßen in alle Richtungen zu zerstreuen.
Der Kaplan hielt ihm die Tür auf, und Jordan stieg in den Wagen. Im Innern roch es nach Leder, Brandy und teuren Zigarren. Vom Gefährt eines Geistlichen hätte er das nicht erwartet.
Jordan rutschte durch. Die Glastrennwand war hochgefahren, vom Fahrer sah er nur den wulstigen Hals.
Bevor der Kaplan einstieg, zog er die Hosenbeine hoch, um die Bügelfalte zu schonen. Mit einer Hand schloss er die Wagentür, die mit einem gediegenen Plopp ins Schloss fiel.
»Bitte stellen Sie für unseren Gast die Heizung höher«, rief der Kaplan dem Fahrer zu. Dann knöpfte er die blaue Uniformjacke auf und lehnte sich zurück.
»Mein Vorgesetzter hat gemeint, Sie würden mir alles erklären.« Jordan verschränkte die Arme. »Schießen Sie los.«
»Das sagt sich so einfach.« Der junge Geistliche schenkte sich einen Brandy ein. Er führte das Glas an die Nase und schnupperte. Seufzend senkte er das Glas und reichte es Jordan. »Ein edler Tropfen.«
»Dann trinken Sie ihn doch.«
Der Kaplan schwenkte den Brandy im Glas und betrachtete die braune Flüssigkeit. »Ich glaube, Sie wissen, dass ich das nicht tun kann, sosehr ich es mir wünsche.«
»Und die Erklärung?«, setzte Jordan nach.
Der Geistliche hob die Hand, worauf der Wagen sich in Bewegung setzte. »Dieser Mantel-und-Degen-Kram tut mir leid. Oder vielleicht sollte man besser von Soutane-und-Kreuz sprechen?« Er lächelte wehmütig und schnupperte erneut am Brandy.
Jordan runzelte die Stirn über die Eigenarten des Mannes. Er wirkte weit weniger pedantisch und förmlich als die anderen Sanguinarier, denen er bisher begegnet war.
Der Kaplan streifte einen weißen Handschuh ab und streckte die Hand aus. »Ich heiße Christian.«
Jordan ging nicht darauf ein.
Daraufhin hob der Mann die Hand und fuhr sich durch sein dichtes Haar. »Ich weiß, das klingt eigenartig. Ein Sanguinarier namens Christian. Als hätte meine Mutter das geplant.« Er schnaubte.
Jordan wusste nicht, was er von dem Sanguinarier halten sollte.
»Um ein Haar hätten wir uns schon im Kloster Ettal kennengelernt«, sagte der Mann. »Aber Rhun hat Nadia und Emmanuel ausgewählt, um sein Dreierteam zu komplettieren.«
Jordan vergegenwärtigte sich Nadias dunkle Gesichtszüge und Emmanuels noch dunkleres Gebaren.
Christian schüttelte den Kopf. »Aber es wundert mich eigentlich nicht.«
»Wieso nicht?«
Der Geistliche zog eine Braue hoch. »Weil ich es in Rhun Korzas Augen an Demut fehlen lasse, glaube ich.«
Jordan verkniff sich ein Grinsen. »Ich kann mir gut vorstellen, dass ihn das stören würde.«
Christian setzte das Glas auf einem Halter ab und neigte sich vor, musterte Jordan ernst mit seinen grünen Augen. »Pater Korza ist der Grund, weshalb ich hier bin.«
»Er hat Sie geschickt?«
Das konnte Jordan sich nicht recht vorstellen. Er bezweifelte, dass Rhun noch etwas mit ihm zu tun haben wollte. Schließlich waren sie nicht als Freunde auseinandergegangen.
»Nicht direkt.« Christian pflanzte die mageren Ellbogen auf die Knie. »Kardinal Bernard versucht noch, es geheim zu halten, aber Rhun ist ohne ein Wort des Abschieds verschwunden.«
Das passt zu ihm … er ist nicht gerade der verbindliche Typ.
»Hat er sich seit Ihrer Rückkehr von Rom bei Ihnen gemeldet?«, fragte Christian.
»Weshalb sollte er sich bei mir melden?«
Christian legte den Kopf schief. »Wieso nicht?«
»Ich hasse ihn.« Jordan sah keinen Sinn darin zu lügen. »Und das weiß er.«
»Rhun macht es anderen Menschen schwer, ihn zu mögen«, räumte Christian ein, »aber weshalb hassen Sie ihn?«
»Abgesehen davon, dass er Erin beinahe umgebracht hätte …?«
Christian senkte besorgt die Augenbrauen. »Ich dachte, er hätte ihr das Leben gerettet … und Ihnen auch.«
Jordan biss die Zähne zusammen. Er dachte daran, wie Erin schlaff auf dem Boden gelegen hatte, leichenblass und mit blutverschmiertem Haar.
»Rhun hat sie gebissen«, erklärte Jordan schroff. »Er hat ihr das Blut ausgesaugt und sie in den Katakomben von Rom zum Sterben liegen lassen. Hätten Bruder Leopold und ich sie nicht gefunden, wäre sie jetzt tot.«
»Pater Korza hat Erins Blut getrunken?« Christian fuhr zurück. Er musterte Jordan sekundenlang; die Enthüllung dieser Sünde hatte ihn offenbar sprachlos gemacht. »Sind Sie sicher?«, fragte er schließlich. »Vielleicht …«
»Sie haben es beide zugegeben. Erin und Rhun.« Jordan verschränkte die Arme. »Ich lüge jedenfalls nicht.«
Christian hob beschwichtigend die Hände. »Es tut mir leid. Ich wollte Ihre Worte nicht in Zweifel ziehen. Das ist nur … etwas ungewöhnlich.«
»Für Rhun offenbar nicht.« Jordan legte die Hände auf die Knie. »Das ist nicht das erste Vergehen, das Ihr Goldjunge sich hat zuschulden kommen lassen.«
»Vorher gab es nur einen Vorfall. Und das mit Elisabeth Bathory ist schon Jahrhunderte her.« Christian nahm das Glas mit dem Brandy in die Hand und betrachtete es. »Wollen Sie damit sagen, Bruder Leopold habe davon gewusst?«
»Sicher hat er das.«
Leopold hatte Rhun anscheinend gedeckt. Christian wirkte enttäuscht, jedoch nicht überrascht. Die Sanguinarier hielten zusammen.
»Er hat von ihr getrunken …« Christian starrte das Glas an, als wäre die Antwort auf die Frage, die ihn beschäftigte, darin verborgen. »Das heißt, Rhun hat ihr Blut im Leib.«
Jordan schauderte, denn er fand die Vorstellung abstoßend.
»Das verändert alles. Wir müssen mit ihr sprechen. Sofort.« Christian beugte sich vor und klopfte an die Trennscheibe. »Bringen Sie uns zum Flughafen!«, sagte er zum Fahrer. »Jetzt gleich!«
Der Fahrer beschleunigte, und der Wagen setzte mit dem Boden auf, als er über eine Erhebung fuhr.
Christian blickte Jordan an. »Am Flughafen trennen sich unsere Wege. Sie kommen von dort allein nach Haus, nehme ich an?«
»Das ginge schon«, meinte Jordan. »Aber wenn es um Erin geht, komme ich mit.«
Christian atmete tief durch. Er holte ein Handy aus der Tasche und tippte eine Nummer ein. »Ich nehme an, Kardinal Bernard hat Ihnen bereits umfassend erklärt, dass Sie Ihr Leben und Ihre Seele in Gefahr bringen, wenn Sie sich in unsere Angelegenheiten einmischen?«
»Das hat er.«
»Dann wollen wir Zeit sparen und so tun, als hätte ich seine Ansprache wiederholt.« Christian drückte sich das Handy ans Ohr. »Jetzt muss ich erst mal ein Flugzeug für den Flug nach Kalifornien chartern.«
»Dann haben Sie nichts dagegen, dass ich Sie begleite?«
»Sie lieben Erin und wollen sie beschützen. Weshalb soll ich dem im Wege stehen?«
Für einen Toten schien Christian ganz in Ordnung zu sein.
Doch als der Wagen durch die verschneite Stadt preschte, nahm Jordans Besorgnis mit jedem zurückgelegten Kilometer zu.
Erin war in Gefahr.
Schon wieder.
Und vermutlich war Rhun Korza daran schuld.
Vielleicht wäre es am besten, wenn der Schuft nie wieder auftaucht.
3
18. Dezember, 18:06 MEZVatikanstadt
KARDINAL BERNARD ARRANGIERTE die Zeitungen auf der polierten Schreibtischplatte um, als könnte er damit den Inhalt der Nachrichten ändern. Die Schlagzeilen waren erschreckend.
Serienkiller in Rom unterwegs
Furchtbarer Mörder verstümmelt junge Frauen
Polizei entsetzt über Brutalität
Der juwelenbesetzte Globus neben dem Schreibtisch funkelte im Kerzenlicht. Der Kardinal versetzte die alte Erdkugel in langsame Drehung und wünschte, er wäre ganz woanders. Er betrachtete seine alten Bücher, die Schriftrollen, das Kreuzfahrerschwert an der Wand – alles Gegenstände, die er im Lauf seines jahrhundertelangen Dienstes an der Kirche gesammelt hatte.
Ich habe lange gedient, aber habe ich meine Sache auch gut gemacht?
Der Geruch der Druckerschwärze lenkte seine Aufmerksamkeit wieder auf die Zeitungen. Die Details verstörten ihn noch mehr. Die Frauen waren aufgeschlitzt worden, der Körper ausgeblutet. Alle waren attraktiv und jung gewesen, mit langem schwarzem Haar und blauen Augen. Sie stammten aus unterschiedlichen sozialen Schichten, waren aber alle im ältesten römischen Viertel ums Leben gekommen, in den dunklen Stunden zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang.
Den Berichten zufolge insgesamt zwanzig.
Bernard war es gelungen, weitere Todesfälle unter Verschluss zu halten. Seit Ende Oktober hatte es fast täglich ein Opfer gegeben.
Der Zeitpunkt war nicht zufällig.
Ende Oktober.
Die Mordserie hatte unmittelbar nach der Schlacht um das Blutevangelium im Petersdom begonnen. Die Sanguinarier hatten gegen die Belial gesiegt, einen Zusammenschluss von Menschen und Strigoi unter der Führung eines Unbekannten, der Bernards Orden auch weiterhin zusetzte.
Unmittelbar nach dem Kampf war Pater Rhun Korza verschwunden.
Wo hielt er sich auf? Was hatte er getan?
Bernard scheute vor dem Gedanken zurück. Er betrachtete den Zeitungsstapel. Hatte ein Strigoi die Schlacht überlebt und stellte nun auf den Straßen Roms jungen Frauen nach? In den unterirdischen Gängen waren so viele Ungeheuer gewesen. Es war durchaus möglich, dass ihnen eines durchs Netz gegangen war.
Irgendwie hoffte er, dass es sich so verhielt.
Über die Alternative wagte er gar nicht erst nachzudenken. Die Angst verunsicherte und lähmte ihn, während unschuldige Frauen starben.
Jemand klopfte an die Tür. »Kardinal?«
Er erkannte die Stimme und den trägen Herzschlag des Besuchers wieder.
»Treten Sie ein, Pater Ambrosius.«
Der Menschenpriester öffnete mit einer Hand die Holztür, die andere hatte er locker zur Faust geballt. »Bitte entschuldigen Sie die Störung.«
Seinem Assistenten war nicht das geringste Bedauern anzumerken. Vielmehr schwang kaum verhohlene Genugtuung in seiner Stimme mit. Ambrosius verehrte den Kardinal und diente ihm gewissenhaft, zog aber eine perverse Freude aus dem Pech anderer Menschen.
Bernard unterdrückte einen Seufzer. »Ja?«
Ambrosius trat ins Büro. Dabei schob er den molligen Oberkörper vor wie ein witternder Jagdhund. Er blickte sich im kerzenerhellten Raum um – vermutlich vergewisserte er sich, dass Bernard allein war. Ambrosius liebte die Heimlichtuerei. Andererseits war dies vielleicht auch mit ein Grund, weshalb er Bernard so gut abschirmte. Nach so vielen Jahrhunderten kreisten in seinen Adern ebenso viele Geheimnisse wie schwarzes Blut.
Schließlich neigte er demütig das Haupt. »Unsere Leute haben das hier am letzten Tatort gefunden.«
Ambrosius trat vor den Schreibtisch und streckte den Arm aus. Langsam drehte er die Hand und öffnete die Faust.
Auf seiner Handfläche ruhte ein Messer. Die geschwungene Klinge glich einer Tigerkralle. In dem scharfen Bogen war ein Loch, durch das man den Zeigefinger schieben konnte, wenn man seine tödlichen Hiebe austeilte. Es war eine historische Waffe, Karambit genannt, deren Ursprung Jahrhunderte zurückreichte. Und von der Patina auf der polierten Klinge nach zu schließen, war diese Waffe tatsächlich uralt – allerdings kein Museumsstück. Sie wies Scharten auf, die auf regen Gebrauch hindeuteten.
Bernard nahm die Waffe entgegen. Das Hitzegefühl in seinen Fingerspitzen bestätigte seine schlimmsten Befürchtungen. Die Klinge war versilbert, typisch für die Waffen der Sanguinarier.
Er dachte an die Gesichter der Getöteten, an ihren klaffenden Hals.
Er schloss die Finger um das sengende Silber.
Von allen Ordensleuten besaß nur ein Sanguinarier eine solche Waffe – der Mann, der verschwunden war, als die Mordserie begonnen hatte.
Rhun Korza.
4
18. Dezember, 16:32 PSTSanta Clara County, Kalifornien
ERIN RITT ÜBER die Weiden, die sich im trockenen kalifornischen Winter goldbraun verfärbt hatten. Der schwarze Wallach reagierte auf ihre Gewichtsverlagerung und wurde schneller.
Gut gemacht, Blackjack.
Das Pferd hatte sie in einem Stall außerhalb von Palo Alto untergebracht. Sie ritt den Wallach, wann immer sie Gelegenheit dazu hatte, einerseits, weil er die Bewegung brauchte, vor allem aber aus purer Freude daran, auf dem muskulösen Tier über die Felder zu fliegen. Blackjack war seit Tagen nicht mehr geritten worden und platzte vor Energie.
Sie warf einen Blick über die Schulter. Nate ritt dicht hinter ihr, auf einem Grauen namens Gunsmoke. Er war in Texas aufgewachsen und ein erfahrener Reiter. Offenbar testete er die Stute aus.
Sie ließ Blackjack sich austoben, konzentrierte sich auf den Wind im Gesicht, den schwindelerregenden Geruch des Pferdes, die Verbindung zwischen ihr und dem Tier. Schon als kleines Mädchen hatte sie das Reiten geliebt. Es half ihr beim Nachdenken. Heute dachte sie über ihre Visionen nach und überlegte, was sie deswegen unternehmen sollte. Sie wusste, dass sie nicht nur von ihrem posttraumatischen Stresssyndrom herrührten. Die Visionen hatten eine bestimmte Bedeutung.