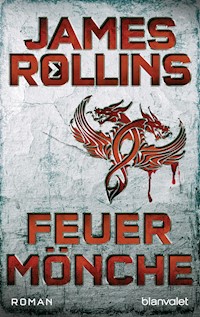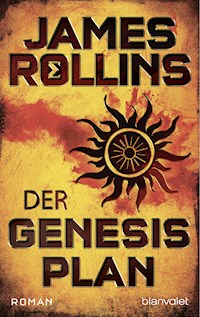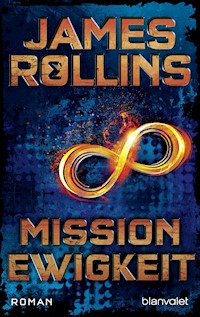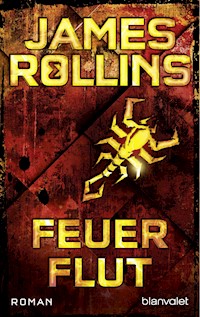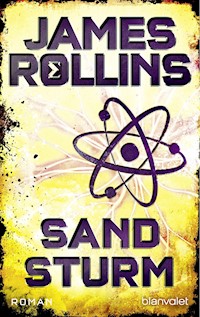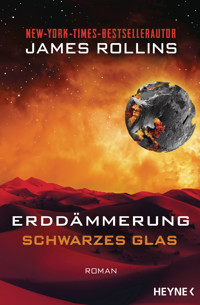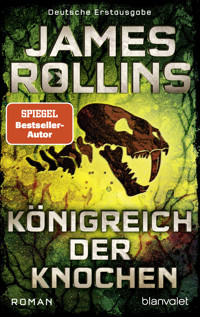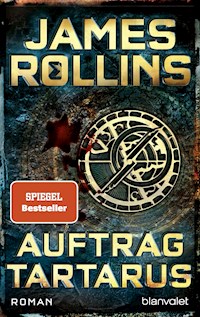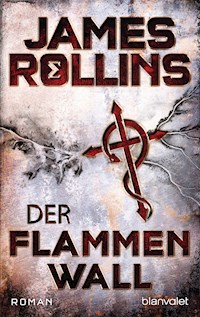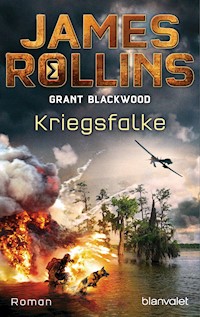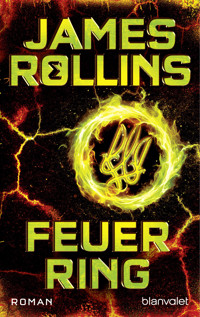
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: SIGMA Force
- Sprache: Deutsch
Erbeben, Vulkanausbrüche, Tsunamis – und das ist nur der Anfang im 17. Abenteuer der Sigma Force!
Das Verschwinden eines Militär-U-Boots vor der Küste Australiens setzt eine Katastrophe in Gang, welche die ganze Region destabilisiert. Chinesische und US-Streitkräfte treffen aufeinander, und die Agenten des wissenschaftlichen Geheimdienstes Sigma Force sind mittendrin. Verzweifelt versuchen sie, die Lage zu beruhigen. Doch Erdbeben, Vulkanausbrüche und tödliche Tsunamis kündigen eine noch größere Katastrophe an: Kilometerweit unter dem Meer rührt sich eine seit Jahrtausenden verborgene Gefahr – und das verschwundene U-Boot könnte der Auslöser sein …
Verpassen Sie nicht die weiteren in sich abgeschlossenen Romane der SPIEGEL-Bestsellerreihe über die Topagenten der Sigma Force – zum Beispiel »Königreich der Knochen« oder »Auftrag Tartarus«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Das Verschwinden eines Militär-U-Boots vor der Küste Australiens setzt eine Katastrophe in Gang, welche die ganze Region destabilisiert. Chinesische und US-Streitkräfte treffen aufeinander, und die Agenten des wissenschaftlichen Geheimdienstes Sigma Force sind mittendrin. Verzweifelt versuchen sie, die Lage zu beruhigen. Doch Erdbeben, Vulkanausbrüche und tödliche Tsunamis kündigen eine noch größere Katastrophe an: Kilometerweit unter dem Meer rührt sich eine seit Jahrtausenden verborgene Gefahr – und das verschwundene U-Boot könnte der Auslöser sein …
Autor
Neueste Technologiekenntnisse und fundierte wissenschaftliche Fakten, genial verknüpft mit historischen und mythologischen Themen – all das macht die Abenteuerthriller von James Rollins zum einzigartigen Leseerlebnis. Der passionierte Höhlentaucher James Rollins betreibt eine Praxis für Veterinärmedizin in Sacramento, Kalifornien.
Von James Rollins bei Blanvalet erschienen:Sigma-Force:Sandsturm, Feuermönche, Der Genesis-Plan, Der Judas-Code, Das Messias-Gen, Das Flammenzeichen, Feuerflut, Mission Ewigkeit, Das Auge Gottes, Projekt Chimera, Das Knochenlabyrinth, Die siebte Plage, Die Höllenkrone, Der Flammenwall, Auftrag Tartarus, Königreich der Knochen, FeuerringTucker Wayne:Killercode, KriegsfalkeDie Bruderschaft der Christuskrieger:Das Evangelium des Blutes, Das Blut des Verräters, Die Apokalypse des Blutes
James Rollins
Feuerring
Roman
Deutsch von Norbert Stöbe
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Tides of Fire (Sigma Force 17)« bei William Morrow, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2023 by Jim Czajkowski
Published in agreement with the author, c/o Baror Interantional, Inc. Armonk, New York, U.S.A.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 by Blanvalet Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: text in form / Gerhard Seidl
Umschlaggestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign; unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com (slay19; milanares; Cobalt; NazarDiablo)
HK · Herstellung: DiMo
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-31503-0V002
www.blanvalet.de
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
Personen
Vorbemerkung zum wissenschaftlichen Hintergrund
Vorbemerkung zum historischen Hintergrund
11. April 1815
TEIL 1
1
2
3
4
5
6
7
8
TEIL 2
9
10
11
12
13
TEIL 3
14
15
16
17
TEIL 4
18
19
20
21
22
23
TEIL 5
24
25
26
27
28
29
30
TEIL 6
31
32
33
34
35
36
37
TEIL 7
38
39
40
41
42
43
44
45
Epilog
Danksagung
Copyright und Quelle der Grafiken
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Newsletter-Anmeldung
Für Steve Berry, den besten Freund, den ein Autor sich wünschen kann. Wir fingen gemeinsam im Schützengraben an, und ich kämpfe noch immer gern an deiner Seite. Natürlich sollte ich ein solches Lob mit einer Beleidigung abmildern – doch darauf möchte ich verzichten. Nur dieses eine Mal.
Personen
Niederländisch-Ostindien
Commander Leland Macklin – britischer Kapitän der HMSTenebrae
Lieutenant Hemple – Zweiter Offizier der HMSTenebrae
Matthew – Aborigine-Schiffsjunge an Bord der HMSTenebrae
Dr. Johann Stoepker – Arzt und Naturforscher sowie Mitglied der Königlichen Batavischen Gesellschaft
Sir Thomas Stamford Raffles – Vizegouverneur von Niederländisch-Indien und Präsident der Königlichen Batavischen Gesellschaft
Captain Haas – holländischer Kapitän des Ostindienfahrers Apollon
Dr. Swann – Schiffschirurg an Bord der Apollon
Thomas Otho Travers – Adjutant von Vizegouverneur Raffles
Dr. John Crawfurd – Arzt und Mitglied der Königlichen Batavischen Gesellschaft
William Farquhar – Naturforscher und Gouverneur von Singapur
Besatzung der Meeresstation Titan
Phoebe Reed – Meeresbiologin
Jasleen (Jazz) Patel – Doktorandin und Mitarbeiterin von Dr. Reed
William Byrd – australischer CEO von ESKY und Hauptfinanzier des Titan-Projekts
Jarrah – Sicherheitschef
Adam Kaneko – Geologe und Mitglied von Tako no Ude
Haru Kaneko – Vulkanologe, Onkel von Adam Kaneko
Datuk Lee – Biochemiker von der Universiti Sains Malaysia
Bryan Finch – Tauchboot-Pilot
Kim Jong Suk – Biologe, Professor am koreanischen Institut für Wissenschaft und Technik
Henry Stemm – Kapitän der Titan X
Sigmaforce
Grayson Pierce – Einsatzleiter
Seichan – ehemalige Terroristin/Auftragsmörderin, arbeitet jetzt für Sigma
Monk Kokkalis – Spezialist für Medizin und Biotechnik
Kathryn Bryant – Expertin für Informationsbeschaffung
Joseph Kowalski – Spezialist für Munition und Sprengstoffe
Painter Crowe – Direktor von Sigma in Washington, D.C.
Jason Carter – Computertechniker in der Sigma-Zentrale
Duan-zhi-Triade
Guan-yin – Mutter von Seichan und Anführerin der Triade (Drachenkopf)
Zhuang – ihr Stellvertreter
Bolin Chen – Novize (blaue Laterne) der Triade
Yeung – ein Stellvertreter der Triadenführung
Chinesisches Kontingent
Kapitän Tse Daiyu – Kommandantin der Forschungsstation der chinesischen Volksbefreiungsarmee in Kambodscha
Luo Heng – Bioingenieur und Arzt der Station
Zhao Min – Molekularbiologe und Assistent von Dr. Luo
Unterleutnant Junjie – arbeitet in der Station
Unterleutnant Wong – Patient im Stützpunkt
Choi Aigua – Generalleutnant und ehemaliger Angehöriger der strategischen Unterstützungskräfte der Volksbefreiungsarmee, jetzt Berater der chinesischen Akademie für Weltraumtechnik
Choi Xue – Anführer der Kommandoeinheit Falke
Yang Háo – Leutnant bei der chinesischen Marine
Weitere Personen
Aiko Higashi – Leiterin von Tako no Ude
Darren Kwong – Direktor des Naturkundemuseums Lee Kong Chian
Kadir Numberi – Direktor des Historischen Museums von Jakarta
Valya Mikhailov – Anführerin der terroristischen neuen Gilde
Jack Pierce – Sohn von Gray und Seichan
Penny und Harriet – Töchter von Monk und Kat
Vorbemerkung zum wissenschaftlichen Hintergrund
Sind wir im Universum allein?
Die Frage, ob da draußen jemand lebt, beschäftigt die Menschheit, seit wir die Sterne beobachten.
Im Oktober 2021 formulierte eine Gruppe von NASA-Wissenschaftlern sieben Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um von »biologischen Signaturen«1 auf die Existenz außerirdischen Lebens schließen zu können. Diese Liste nannten sie »Confidence of Life Scale«.2
Hier die Kriterien in verkürzter Form:
Messung einer Signatur biologischen LebensAusschluss von KontaminierungAusschluss nicht-biologischer QuellenNachweis, dass die Signatur der beobachteten Umgebung entstammen könnteWeitere BeobachtungenEliminierung aller alternativen HypothesenWeitere Beobachtungen aus unabhängiger QuelleOffenbar bereitet sich die NASA auf den Moment vor, da außerirdisches Leben entdeckt oder detektiert wird, sei es auf fremden Sternen oder anderswo.
Im Januar 2021 gab die CIA fast dreitausend Seiten Dokumente zu den Themen Ufos und nicht identifizierte Flugobjekte frei, die als Black Vault bezeichnet werden. Im Juli desselben Jahres gab das Pentagon einen Bericht frei, in dem 144 Fälle nicht identifizierter Flugobjekte aufgeführt sind, die in den Jahren 2004 bis 2021 von Militärpiloten gesichtet wurden. Eine dieser Sichtungen, nur eine einzige, ließ sich als undichter Ballon erklären. Vielleicht war dies der Grund, weshalb das Pentagon im November 2021 eine neue Arbeitsgruppe einrichtete, die unbekannte Anomalien im Luftraum »aufspüren und identifizieren« soll: Die Airborne Object Identification and Management Synchronization Group.
Die Freigaben der letzten Zeit, das allmähliche Durchsickern von Daten und die Kongressanhörung von Pentagon-Mitarbeitern im Jahr 2022 zum Thema außerirdischen Lebens werfen zwei Fragen auf:
Wie viel weiß die Regierung bereits?
Und wegen der gesteigerten Aktivitäten: Worauf versucht sie uns vorzubereiten?
Bald wissen Sie mehr.
1Ein Kompendium von Biosignaturen: Cellular and extracellular morphologies, biogenic fabrics in rocks, bio-organic molecular structures, chirality, biogenic minerals, biogenic stable isotope patterns in minerals and organic compounds, atmospheric gases, remotely detectable features on planetary surfaces, and temporal changes in global planetary properties. National Academics of Sciences, Engineering and Medicine. 2019. An Astrobiology Strategy for the Search for Life in the Universe, D.C.: The National Academic Press
2Call for a Framework for reporting evidence for life beyond Earth, J. Green, T. Hoehler, M. Neveu et al., Nature, 28. Oktober, 2021
Vorbemerkung zum historischen Hintergrund
Wir leben auf einem volatilen Planeten. Auf einem geologischen Pulverfass, das eine Herausforderung darstellt für das Fortbestehen des Lebens auf der Erde.
Vor über 250 Millionen Jahren löschte eines der größten Massenaussterben am Übergang vom Perm zur Trias-Epoche siebzig Prozent des Lebens an Land und neunzig Prozent des Meereslebens aus. Diese Katastrophe wird auch als Großes Sterben bezeichnet. Was war die Ursache? Bei heftigen Vulkanausbrüchen in Sibirien stieg Magma an die Oberfläche, drückte Lava durchs Gestein und entzündete Gas- und Öllagerstätten. Das betroffene Gebiet war so groß wie die Hälfte der USA. Aufgrund der ausgestoßenen Gase war die Temperatur damals achtzehn Grad höher als der heutige Mittelwert. Die Meere versauerten, Korallen zerbröselten, die Schalen von Meerestieren lösten sich auf.3
Doch dieses geologische Ereignis war nicht die letzte Bedrohung des Lebens.
Vor 74 000 Jahren brach der Toba-Vulkan in Indonesien aus. Er schleuderte 2000 Megatonnen Schwefeldioxid in die Luft, und es entstand ein Krater von hundert Kilometern Länge und dreißig Kilometern Breite. Die Eruption hatte eine jahrelange Winterperiode zur Folge und riss ein großes Loch in die Ozonschicht des Planeten, was zu einem starken Anstieg der UV-Strahlung führte.4 Die Menschheit schrumpfte auf 10 000 – 30 000 Individuen, ein Engpass, der beinahe unsere Auslöschung zur Folge gehabt hätte.
Damit waren die Versuche der Erde, uns abzuschütteln, jedoch nicht zu Ende. Fast siebzig nahezu apokalyptische Vulkanausbrüche folgten, einer der letzten die Explosion des Tambora in Indonesien. Dies war der größte Vulkanausbruch seit Beginn der Geschichtsschreibung, beobachtet von Hunderttausenden. Die Nachricht wurde von britischen Kolonialschiffen aus dem Südpazifik in die ganze Welt getragen. Der Gipfel des 2850 Meter hohen Berges wurde atomisiert, die Wolke aus Asche und Gesteinsstaub ragte dreißig Kilometer in den Himmel. Durch den Ausbruch und die nachfolgende Hungersnot kamen allein in Indonesien 100 000 Menschen ums Leben, und weitere Millionen starben binnen der folgenden zwei Wochen, als die Aschewolke zum Äquator trieb und die Temperatur in manchen Gebieten um zwanzig Grad fiel. Es folgte das berüchtigte »Jahr ohne Sommer«5.
Und noch eine weitere Geschichte wurde unter der Wolke begraben. Dabei geht es um die geologische Instabilität unseres volatilen Planeten – und um eine Zukunft, die sich heute entwickelt und alle Gewissheiten über unsere Stellung in der Welt infrage stellen wird.
Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr über die Wahrheit, die uns allen vorenthalten wurde.
Bis jetzt.
3The Great Dying: Earth’s largest-ever mass extinction is a warning for humanity, Jeff Berrardelli und Katherine Niemczyk, CBSNews, 4. März 2021
4An Ancient Supervolcano May Have Zapped the Ozone Layer, Exposing Early Humans to Intense Sunburns, von Isaac Schultz, Gizmodo, 2. Juni, 2021
5William K. Klingaman und Nicolas P. Klingaman, The Year Without Summer: 1816 and the Volcano That Darkened the World and Changed History (St. Martin’s Press, 2013)
Lasst China schlafen, denn wenn es erwacht, wird es die Welt erschüttern.
NAPOLEONBONAPARTEZUGESCHRIEBEN
Krieg ist Täuschung.
SUNTZU, DIEKUNSTDESKRIEGES
»Die Erde muss gewarnt werden!«
CLAUDEHAIGNERÉ, EINEFRANZÖSISCHEASTRONAUTIN, DIEZWEIWOCHENANBORDDERRAUMSTATIONMIRUNDDERISS VERBRACHTE. SIERIEFDIESEWORTE, BEVORSIE 2008 EINENSELBSTMORDVERSUCHUNTERNAHM.
11. April 1815
Vor der Ostküste von Sumbawa, Niederländisch-Ostindien
Vom Bug der HMSTenebrae aus blickte Commander Leland Macklin in den feurigen Schlund der Hölle.
Es ging bereits auf Mittag zu, doch die Sonne war nicht zu sehen. Eine tief hängende Schicht aus Asche und Rauch verdeckte den Himmel. Der Schwefelgestank brannte in den Augen und in der Lunge. Allein die Feuerinsel Sumbawa spendete Licht. Der Inselstrand war eine halbe Meile entfernt, doch bis auf die Lavaströme, die über die Hänge des Tambora flossen, war dort nichts zu erkennen.
Grabesstille lag über dem Meer – soweit man es überhaupt sehen konnte. Rund ums Schiff war das Wasser mit einer dreißig Zentimeter dicken Bimsschicht bedeckt. Unmengen aufgedunsener Fische schwammen in der heißen Asche sowie zahlreiche Tote. Hunderte tote Seelen. Die meisten waren so stark verkohlt, dass sie vom dunklen Meer kaum zu unterscheiden waren.
»Wir sollten uns zurückziehen, Commander«, sagte Lieutenant Hemple, dem die Angst deutlich anzumerken war.
Der Lieutenant, sieben Jahre jünger als der Commander, war seit über zehn Jahren Macklins Zweiter Offizier. Hemple war ein schroffer, harter Mann mit dunkelblondem Haar, der nicht zu Dramatisierungen neigte. Wegen der drückenden Hitze hatte er die Uniformjacke ausgezogen. Jetzt war er nur noch mit Weste, weißem Hemd und blauer Hose bekleidet. Wie alle Besatzungsmitglieder hatte er sich ein feuchtes Tuch vor Nase und Mund gebunden.
»Wir haben schon eine Menge Asche aufgenommen, Sir«, sagte Hemple. »Teilweise sehr heiß.«
»Das ist richtig.«
Macklin wischte sich mit einem feuchten Tuch die Stirn ab. Er war gekleidet wie sein Lieutenant, hatte die blaue Jacke mit schlichten goldenen Paspelierungen und Messingknöpfen aber anbehalten. Er klopfte sich Asche vom schwarzen Hut, dann bedeckte er damit wieder sein angegrautes Haar.
Macklin schaute sich um und begutachtete den Zustand der Tenebrae. Sein Schiff wirkte ebenso versteinert wie das Meer, eine dunkle Erhebung inmitten dieses verfluchten Gewässers. Asche bedeckte Decks, Takelage und Segel des Dreimasters. Seeleute mit verhüllten Gesichtern eilten umher, kehrten und schaufelten die heiße Asche von Bord, während unablässig Staub und federleichte Flocken herabregneten.
»Sir?«, sagte Hemple.
»Wir wenden«, befahl Macklin. »Zurück nach Java. Vizegouverneur Raffles erwartet bestimmt schon unseren Bericht. Aber reffen Sie in diesem tückischen Gewässer die Segel.«
»Aye, Commander.«
Hemple gab den Befehl an den Steuermann weiter. Kurz darauf schwenkte das Schiff langsam von der Feuerinsel ab. Der raue Bims scharrte am Rumpf, was sich anhörte, als kratzten die Klauen des Todes an der Bordwand. In der Ferne war ein leises, unheimliches Zischen zu hören, das von der Lava herrührte, die das Wasser zum Verdampfen brachte.
Macklin reagierte erleichtert, als der Feuerschein des Tambora allmählich hinter ihnen zurückfiel. Der erste Ausbruch war vor sechs Tagen erfolgt. Auf der dreizehnhundert Kilometer entfernten Insel Java hatte es sich angehört wie fernes Kanonenfeuer. Viele glaubten, ein Handelsschiff werde von Piraten angegriffen, doch als schwarze Aschewolken herantrieben, gefolgt von einer Riesenwelle, wurde klar, dass es sich um einen Vulkanausbruch biblischen Ausmaßes handelte.
Die Tenebrae hatte zu dem Zeitpunkt in Batavia angelegt, der Hauptstadt von Niederländisch-Ostindien auf Java. Zwei Tage nach der ersten Eruption hatte der Vizegouverneur sie angewiesen, sich vor Ort ein Bild vom Ausmaß der Schäden zu machen.
Die Tenebrae war für eine solche Unternehmung gut gerüstet. Sie war ein Kohletransporter, mit viereckigem Heck, breitem Bug und flachem Rumpf, der es ihr ermöglichte, auch in flachen Gewässern zu segeln. Außerdem verfügte sie über ein breites Hauptdeck, das vom Vorschiff bis zum Achterdeck reichte. Die Gesamtlänge betrug dreißig Meter, die Breite neun Meter zehn. Wegen der zahlreichen Piraten hatte sie sechs Vierundzwanzigpfünder-Karronaden an Deck und zwei Sechspfünder auf dem Vorschiff.
Macklin legte die Hand auf eine der Kanonen und betastete das kühle Eisen. Er war froh, dass sie zum Hafen zurücksegelten, denn die Stille des Meeres und das ständige Scharren am Rumpf verursachten ihm Unbehagen.
Als er das Geräusch von Schritten vernahm, wandte er sich um und erblickte eine klapperdürre Gestalt. Obwohl der Mann sich ein feuchtes Tuch umgebunden hatte, erkannte er Johannes Stoepker, den Naturforscher der Batavischen Gesellschaft. Stoepker hatte Jacke und Weste abgelegt und war nur noch mit schwarzer Hose und weißem Hemd bekleidet, das inzwischen ebenso dunkel wie seine Hose war. Vizegouverneur Raffles hatte ihn dem Schiff zugeteilt, denn er war der Vorsitzende der Gesellschaft, deren Ziel die Erforschung und Bewahrung all dessen war, was in Ostindien in historischer und wissenschaftlicher Hinsicht von Belang war. Deshalb hatte die Batavische Gesellschaft einen Forscher mitgeschickt.
Stoepker dicht auf den Fersen folgte der Schiffsjunge Matthew. Der zwölfjährige Aborigine – schwarzes Haar, dunkle Haut und bewundernswert mutig – wurde auch als Pulverjunge eingesetzt, wenn die Kanonen gebraucht wurden, doch in den vergangenen Tagen hatte er dem Naturforscher geholfen. Offenbar hochzufrieden mit der neuen Aufgabe, grinste Matthew, der eine schwere Ledertasche auf der Schulter trug, gefüllt mit Bimsstein, den die Matrosen aus dem Wasser gefischt hatten.
»Was gibt’s, Mister Stoepker?«, fragte Macklin.
Der Forscher schob die Maske aufs bärtige Kinn hinunter. »Commander, wäre es nicht möglich, ein paar Leichen zu bergen? Auf Java gibt es einen Anatomen und Chirurgen, der sich für den Zustand der Toten interessieren würde.«
Macklin verzog das Gesicht. »Das kommt nicht infrage, Mister Stoepker. Das würde die Männer beunruhigen.«
Stoepker zog stirnrunzelnd die Brauen zusammen. Tief in Gedanken versunken, drehte er einen Goldring am Finger. Der Ring hatte einen Granatstein, in den die Buchstaben BG eingraviert waren, die Abkürzung für Bataviaasch Genootschap, die niederländische Bezeichnung für die Batavische Gesellschaft.
Stoepker beendete seine Grübelei und räusperte sich. »Commander Macklin, die Tenebrae führt ein Beiboot mit Eisenrumpf mit, das über Felsen und Riffs fahren kann. Könnten wir es nicht zu Wasser lassen, einen Toten einladen und es dann bis nach Java schleppen?«
Macklin überlegte. Clever war der Vorschlag jedenfalls. »Das klingt vernünftig. Ich erlaube es.« Er wandte sich an Matthew. »Junge, hol den Leichtmatrosen Perry und lass mit ihm das Beiboot zu Wasser.«
Matthew nickte, stellte die Tasche ab und eilte davon.
Während sie warteten, trat Stoepker ans Geländer und schaute zu der Insel hinüber, die hinter dem Schiffsheck leuchtete. »Ich hätte nie erwartet, dass der Tambora der Auslöser ist. Eher schon der Merapi oder der Klut. Wäre ich ein Spieler, hätte ich auf den Bromo gewettet, der regelmäßig Rauchwolken ausstößt.«
Macklin nickte grimmig. »Alle haben geglaubt, der Tambora schlafe.«
»Genau genommen hielt man ihn für erloschen«, präzisierte Stoepker. »Zumindest war das die vorherrschende Meinung. Aber ich habe gehört, die Eingeborenen von Sumbawa hätten hin und wieder Erdstöße registriert oder es tief in der Erde rumpeln hören. Vielleicht sollten wir solche Berichte nicht vorschnell abtun.«
»Richtig.«
»Und heute Nacht … ich glaube, die zweite Eruption des Tambora war noch heftiger als die erste. Vielleicht kam es mir aber auch nur so vor, weil wir näher dran waren.«
»Nein, ich glaube, Sie haben recht«, entgegnete Macklin. »Das hat sich angehört, als würde die Erde in zwei Hälften zerbrechen.«
»Stimmt. Und die nachfolgende Welle war gewaltig. Vermutlich wird es auf den umliegenden Inseln weitere Überschwemmungen geben.«
Macklin dachte an die Welle, die nach der ersten Eruption Java getroffen hatte. Die Tenebrae hatte in tiefem Wasser geankert und keinerlei Schäden davongetragen. An der Küste aber waren Docks zerstört und Schiffe und Trümmerteile landeinwärts geschwemmt worden.
»Hoffen wir, dass es noch einen Hafen gibt, zu dem wir zurückkehren können«, murmelte Macklin.
Lieutenant Hemple war aufs Vorschiff zurückgekehrt. Mit steifen Schritten eilte er heran. »Commander, der Ausguck meldet Feuer voraus.«
»Auf einer der vorgelagerten Inseln?«
»Nein, Sir. Im Wasser. Eine halbe Meile voraus.« Hemple setzte ein Fernglas aus Messing an. »Ich kann das bestätigen.«
Macklin streckte die Hand aus. »Lassen Sie mal sehen.«
Hemple reichte ihm das Fernglas. Macklin ging zur Steuerbordseite des Schiffes. Im Dunst bemerkte er einen hellen Fleck. Er passte das Glas ans Auge an, atmete mehrmals tief durch und richtete es aufs Ziel. Eine Minute lang schwieg er. Als die Tenebrae die Stelle passierte, klärte sich die Sicht.
»Das scheint ein Schiff zu sein«, meldete Macklin. »Brennend und mit starker Schlagseite.«
»Ein Schiff Seiner Majestät, Sir?«, fragte Hemple. »Oder ein indisches?«
Macklin senkte das Glas und schüttelte den Kopf. »Noch zu weit weg, um Farben oder Flaggen erkennen zu können. Aber wir gehen näher ran.«
Hemple nickte knapp und ging weg, um dem Steuermann Bescheid zu geben.
»Es ist gefährlich hier draußen«, sagte Stoepker. »Glühende Asche kann ein Holzschiff leicht in Brand setzen.«
»Nicht die Tenebrae. Meine Männer halten die Augen auf. Bei uns wird es keine böse Überraschung geben.«
»Vielleich war die Besatzung des anderen Schiffes weniger wachsam.«
»Wir werden sehen.«
Selbst mit halber Besegelung dauerte es nicht lange, dann hatten sie das sinkende Schiff erreicht. Macklin und Stoepker waren Lieutenant Hemple aufs Achterdeck gefolgt. Master Welch stand am Ruder. Niemand wollte ein Risiko eingehen. Zumal inzwischen klar war, dass es sich bei dem Schiff in Seenot um ein Piratenschiff der Bugi-Piraten handelte, in dieser Gegend die Geißel der Niederländer. Die Masten hatten sich in Fackeln verwandelt und standen bereits schief. Der Qualm war so dicht, dass er die Flammen beinahe verdeckte.
Mehrere kleine Ruderboote entfernten sich im Ascheregen vom Wrack. Die meisten brannten oder qualmten. Zwei Boote schwenkten herum und hielten auf die Tenebrae zu, die Insassen ruderten wie besessen.
Macklin fand es seltsam, dass Piraten bei einem Schiff Zuflucht suchten, das unter der Flagge Seiner Majestät fuhr. Selbst wenn sie an Bord gelangten, mussten sie damit rechnen, aufgeknüpft zu werden. Trotzdem legten sie sich mächtig ins Zeug.
Eins der Boote geriet in Brand. Es geschah so plötzlich, dass Stoepker der Atem stockte. Die Piraten drängten sich in der Mitte des Boots zusammen, als fürchteten sie das Wasser mehr als die Flammen. Doch es gab kein Entrinnen. Ihre Kleidung fing Feuer, das Boot brach auseinander. Die Männer fielen ins Wasser und verschwanden unter der Ascheschicht. Ein brennender Arm schoss hoch, dann versank auch er.
»Was ist da los?«, fragte Hemple mit aufgerissenen Augen.
Stoepker wich von der Reling zurück. »Wir sollten abdrehen. Irgendwas stimmt hier nicht.«
Wie aufs Stichwort ließ ein Donnergrollen das Wasser erbeben. Hinter ihnen wurde das Leuchten heller. Offenbar war der Tambora erneut ausgebrochen.
Macklin schnitt eine Grimasse. Der Name des Schiffes erwies sich heute als allzu treffend. Sein erster Eigner hatte es als Sträflingsschiff genutzt und es nach der katholischen Klagezeremonie benannt. Als Tenebrae bezeichnete man die letzten drei Tage der Karwoche. Die fünfzehn Kerzen, die das Leiden Christi auf dem Kreuzweg symbolisierten, wurden nacheinander gelöscht – bis nur noch Dunkelheit zurückblieb. Die Zeremonie endete mit einem lauten Donnerschlag, der das Verschließen von Jesu Grab versinnbildlichen sollte.
Macklin sah zum bedeckten Himmel auf, während der Knall verhallte.
Wird das hier unser Grab werden?
Im nächsten Moment hob sich das Wasser hinter dem Schiff, als ob ein gewaltiges Meereswesen an die Oberfläche käme und sich ihnen näherte.
»Festhalten!«, brüllte Hemple.
Das Heck wurde erst angehoben, dann sackte es ab, während der Bug emporstieg, bis das Schiff hinter der Woge wieder ins Wasser einsank. Die Tenebrae schaukelte heftig, die Masten schwankten hin und her, und die Segel peitschten.
Macklin blickte zum letzten der flüchtenden Ruderboote hinüber. Es war abgeschwenkt, als hätten die Piraten nun doch die Flagge bemerkt, die an ihrer Mastspitze wehte.
Doch das war nicht der Grund für das Manöver.
Hemple eilte an seine Seite. »Rauch, Sir. Er steigt ringsumher auf.«
Macklin war bereits aufgefallen, dass die Sicht sich verschlechterte, hatte es jedoch auf das brennende Piratenschiff zurückgeführt.
Ein Bootsmann und dessen Maat stürmten aufs Achterdeck und riefen: »Feuer in der Bilge!«
Hemple gab Anweisungen. »Sandeimer und Wasser! Los!«
Macklin schaute stirnrunzelnd aufs Meer hinaus, auf das brennende Piratenschiff.
Stoepker beugte sich über die Reling und blickte in die Tiefe. »Wo sind sie abgeblieben?«
Macklin folgte seinem Blick. Verkohlte Äste hafteten am Rumpf. Mit jeder Schaukelbewegung des Schiffes tauchten mehr davon auf. Rauch waberte ringsumher, als wären die Äste glühende Schürhaken, die sich in die Schiffsplanken bohrten.
Macklin schauderte. Das sah nicht gut aus.
»Alle Segel setzen!«, befahl er. »Wir müssen von hier verschwinden!«
Nach wie vor blickte er gebannt in die Tiefe. Die brennenden Äste schienen sich auszubreiten, als handele es sich um die Klauen eines Meeresungeheuers, das sich die Tenebrae krallen wollte.
Jetzt begriff er, was die Piraten in Panik versetzt hatte.
Bevor die Tenebrae richtig Fahrt aufgenommen hatte, brachen Flammen aus dem Rumpf, fraßen sich entlang der Äste vor und hüllten das Schiff ein. Nicht einmal ein vorübergehendes Absinken ins Aschewasser vermochte das Feuer zu löschen.
Hinter ihm gab Hemple die Befehle des Commanders weiter. Überall wurde geschrien und geflucht.
Macklin hielt im dichten Rauch Ausschau nach dem Bugi-Schiff. Das Piratenschiff versank langsam im aschebedeckten Meer. Er wusste, dass die Tenebrae das gleiche Schicksal erwartete. Auf einmal fiel ihm auf, dass Stoepker und der Schiffsjunge verschwunden waren, doch er hatte keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen.
Eine Rauchwolke verschluckte das Schiff. Flammen loderten über die Reling. Das Herz klopfte ihm bis zum Hals. Er dachte an die letzte Karfreitagsmesse, der er in einer Kirche in Batavia beigewohnt hatte. Der Chor hatte ein Lied gesungen, das Gregorio Allegri vor Jahrhunderten für die Tenebrae komponiert hatte, die drei Leidenstage Christi.
Er sagte den Titel auf: »Miserere mei, Deus.«
Das passte zum Schiffsnamen.
Gott sei mir gnädig.
23. April 1815 Batavia, Java
Stamford Raffles, der Vizegouverneur von Niederländisch-Ostindien, folgte dem Captain des Ostindienfahrers Apollon durch den im Wiederaufbau befindlichen Stadthafen. Captain Haas wurde von seinem Schiffschirurgen Swann begleitet.
Die beiden waren aufgeregt am Gouverneurspalast aufgetaucht und hatten den Brief eines Mannes übergeben, dem Stamford vertraute. Obwohl die Sonne bereits unterging, hatten sie sich deshalb mit einer Kutsche auf den Weg zu den Docks gemacht. Jetzt schritten sie einen langen steinernen Pier entlang, einen der wenigen, welche die Verwüstungen der vergangenen Wochen unbeschädigt überstanden hatten.
Überall im Hafen wurde gehämmert, gesägt und gerufen. Es hatte ein wenig aufgeklart, doch noch immer verwandelte eine dicke Staubwolke die Sonne in eine dunkelrote Scheibe, und es herrschte den ganzen Tag lang Zwielicht. Der Abendwind führte Schwefelgeruch mit sich.
Stamford hielt sich ein parfümiertes Tuch vor die Nase. Die Hitze drückte auf seine Stimmung. Er trug eine schwarze Jacke mit steifer Weste, weil er mit Würdenträgern von Britisch Malaya, die zur Begutachtung der Schäden infolge des Vulkanausbruchs angereist waren, zu Abend speisen wollte.
Captain Haas schloss zu Stamford auf. Der rotblonde Niederländer war mit grauer Jacke und grauer Hose weniger formell gekleidet, machte aber einen gepflegten Eindruck und strahlte zupackende Entschlossenheit aus.
Haas deutete auf das Schiff, das in der Bucht vor Anker lag. »Die Apollon war nach Neuguinea unterwegs und entdeckte in der Javasee ein kleines treibendes Boot. Wir glaubten, es habe sich irgendwo losgerissen.«
Swann nickte. Er war ein kleiner, älterer Mann mit strenger Miene und dunklen Augen. »Dann sahen wir, was sich in dem Boot befand. Ich empfahl Captain Haas, es hierher zu schleppen.«
»Wir haben nichts angerührt«, setzte Haas hinzu, führte ein silbernes Kreuz an die Lippen und ließ es wieder sinken. »Das hätten wir auch gar nicht gewagt.«
Die beiden Männer geleiteten Stamford zum Ende des Piers, wo ein kleines Beiboot festgemacht war. Es war mit Segeltuch abgedeckt. Davor stand der Mann, der dem Captain den Brief mitgegeben hatte. Es war Thomas Otho Travers, Stamfords Adjutant und zuverlässiger Freund. Der dunkelhaarige Ire und ehemalige Soldat war kräftig gebaut, was durch die eng anliegende Jacke und die forsche Hose noch betont wurde. Bei ihm war ein Schotte gleichen Alters, den Raffles ebenfalls kannte, der berühmte Arzt Dr. John Crawfurd, Mitglied der Batavischen Gesellschaft.
Beide Männer schauten grimmig drein.
Stamford näherte sich den beiden. »Was gibt es? Was ist von solcher Dringlichkeit?«
Travers wandte sich zu dem zerbeulten Metallboot um. »Das Beiboot stammt von der Tenebrae.«
»Was? Woher wissen Sie das?«
Stamford hatte das Frachtschiff Tenebrae vor sechzehn Tagen entsandt, seitdem aber nichts mehr von ihm gehört. Man hatte angenommen, das Schiff sei von Piraten überfallen worden, da die Bugi-Flotte im Gefolge der Eruptionen das Gewässer unsicher machte wie Geier, die sich über Aas hermachten.
»Wir sind uns sicher, Sir«, sagte Travers und wandte sich an den Arzt. »Vielleicht sollten Sie es ihm zeigen, Doktor Crawfurd. Ich helfe Ihnen.«
Der junge Arzt war schwarz gekleidet, mit weißem Kragen, der ihm das Aussehen eines Priesters verlieh. Er näherte sich zusammen mit Travers dem Beiboot, und mit vereinten Kräften zogen sie die Plane zurück, die etwas Grausiges enthüllte.
Stamford wollte zurückweichen, doch Haas und der Chirurg standen dicht hinter ihm und hinderten ihn daran.
Zwei Tote lagen auf dem Boden des Boots, der eine doppelt so groß wie der andere. Beide waren geschwärzt und hatten kein Gesicht mehr. Ihre Körperoberfläche aber glänzte, als wäre sie aus dunklem Marmor geschnitten, mit leichten Unebenheiten der Haut. Der kleinere der beiden, offenbar noch ein Junge, lag zusammengekrümmt unter dem Arm des anderen. Sein verdrehter Hals und der gekrümmte Rücken kündeten von einem schmerzhaften Tod. Er hatte unter dem Arm keinen Trost gefunden. Trotzdem hatte der Mann ihm zu helfen versucht, obwohl er den gleichen qualvollen Tod erlitten hatte.
Noch seltsamer war, dass die beiden Körper nicht vollständig von dem Unheil betroffen waren. Das vom Jungen am weitesten entfernte Viertel des Mannes wies Blasen auf und war am Rand verbrannt, doch ansonsten weitgehend unversehrt. Ein Ohr und eine Wange leuchteten bläulich blass. Die Reste eines verbrannten weißen Hemds hafteten am Oberkörper, und ein Bein wirkte intakt, noch von einem dunklen Hosenbein und dem wadenhohen Stiefel bedeckt.
Das ergab keinen Sinn.
Raffles stellte die naheliegende Frage. »Wer waren die beiden?«
Doktor Crawfurd stieg behände ins Beiboot. Er zeigte auf den Arm, den der Mann um den Jungen gelegt hatte, dann auf die verkohlte Hand, an der noch ein Ring steckte. »In den Stein sind die initialen BG eingraviert.«
Stamford presste sich das parfümierte Tuch an den Mund. Er wusste, wer an Bord der Tenebrae gewesen war. »Johannes Stoepker, der Naturforscher.«
»Das glauben wir auch«, sagte Travers. »Der andere war vermutlich ein Schiffsjunge.«
»Was ist passiert? Das war kein Feuer. Es sieht eher so aus, als wären sie versteinert.«
Crawfurd richtete sich auf, was das Boot so stark zum Schaukeln brachte, dass Travers ihn stützen musste. »Wir wissen es nicht, Sir«, erklärte der Arzt. »Aber ich habe sie kurz untersucht. Ihr Gewebe ist tatsächlich petrifiziert. So hart wie Stein. Die Ursache konnte ich nicht bestimmen. Ich müsste die Toten in mein Labor in der Stadtapotheke schaffen, um sie gründlicher zu untersuchen.«
»Es gibt noch etwas, das Sie sehen sollten«, sagte Travers.
Der Adjutant stieg ins Boot und kniete neben Stoepkers anderem Arm nieder, mit dem er etwas an seine Brust drückte. In seinen versteinerten Fingern hielt er ein kleines Metallkästchen.
»Er wollte noch etwas anderes beschützen als den Jungen«, meinte Travers. »Wir haben mit dem Öffnen auf Sie gewartet.«
»Lässt sich das Kästchen lösen?«, fragte Stamford. »Mitsamt dem Inhalt?«
»Ich kann’s versuchen.«
Travers wickelte sich ein Taschentuch um die Hand und packte das Kästchen. Er versuchte, es hervorzuziehen, jedoch erfolglos. Selbst im Tod wollte Stoepker sein Geheimnis nicht preisgeben.
»Kräftiger ziehen, Mister Travers«, befahl Stamford.
»Ja, Sir.«
Travers stellte die Füße auseinander, dann bewegte er das Kästchen hin und her. Schließlich löste es sich mit lautem Knacken, und Travers taumelte gegen die Bordwand. Das Boot wäre beinahe gekentert, doch Crawfurd glich die Schwerpunktverlagerung an der anderen Seite aus.
Am Heck war ein Platschen zu hören.
Er zuckte zusammen. »Haben Sie den Gegenstand verloren?«
»Nein, Sir.« Travers hielt das Kästchen hoch. »Ich hab’s noch.«
Stamford schaute aufs Wasser. Die Überreste einer geschwärzten Hand, an der zwei Finger fehlten, trieben an die Oberfläche. Obwohl sie aussah wie versteinert, schwamm sie auf dem Wasser.
Was für eine Teufelei ist das nun wieder?
Travers kletterte auf den Pier und brachte ihm den Gegenstand.
Stamford verschränkte die Arme, denn er hatte nicht vor, das verfluchte Ding anzufassen. »Machen Sie’s auf«, sagte er.
Travers entriegelte den Verschluss und klappte den Deckel hoch. Ein gefaltetes Papier fiel heraus und flatterte auf den Pier. Vermutlich eine Nachricht von Johannes Stoepker.
Stamford beugte sich vor. In dem Kasten war noch etwas anderes: ein länglicher Stein, der aussah wie ein Stück schwarzer Koralle.
»Was halten Sie davon?«, flüsterte Travers.
Stamford schüttelte den Kopf. Darauf konnte er sich keinen Reim machen.
Wozu hat Stoepker das Ding aufbewahrt?
Die Farbe und der Glanz des abgebrochenen Steins entsprachen der Beschaffenheit der Toten im Beiboot. Außerdem waren abgebrochene, trockene Korallen häufig leichter als Wasser.
Während er Stoepkers im Wasser treibende Hand betrachtete, ging ihm ein Licht auf.
Die beiden Toten waren nicht versteinert.
Sie hatten sich in Korallen verwandelt.
TEIL 1
1
18. Januar, 10:04 NCTFünfhundert Kilometer vor der Norfolkinsel (Australien)
Phoebe Reed schaute ehrfurchtsvoll zum versunkenen Garten Eden hinaus. Hinter den neun Fenstern aus Acrylglas erhellten die Scheinwerfer der Station die ewige Dunkelheit. Sie gaben rotes Licht ab, welches das Meeresleben kaum störte. Phoebe hatte eine lichtverstärkende Brille aufgesetzt, die an die Wellenlänge der Scheinwerfer angepasst war und ihr Sichtfeld erweiterte.
Selbst hier in über 3000 Metern Tiefe wimmelte es von Leben. Riesige Krabben mit roten Beinen kletterten über Korallen und suchten in Vertiefungen nach Nahrung. Geisterhafte weiße Scheibenbäuche glitten über den Sand hinweg. Ein Zigarrenhai – dessen Namen von seiner zylindrischen Form herrührte – schwamm vorbei, dunkel an der Oberseite, biolumineszierend an der Unterseite. Ein größerer Grauhai patrouillierte am Rand des Lichtscheins.
Neben ihr zeigte jemand darauf. »Grauhaie wurden in dieser Tiefe noch nie gesichtet.«
»Tatsächlich, Jazz?«, fragte Phoebe und sah ihre Doktorandin an.
Jasleen Patel bedachte sie mit einem Seitenblick, weil Phoebe an ihrer Expertise zweifelte. Jazz hatte vor zwei Jahren ihren Master in Meeresbiologie gemacht und promovierte jetzt unter Phoebes Anleitung. Jazz hatte zunächst bei Phoebe studiert und dann als Lehrassistentin am Meereslabor der Caltech gearbeitet. Seit mehr als fünf Jahren arbeiteten sie zusammen. Ihre Beziehung war so eng, dass sie von vielen Kollegen PB&J genannt wurden.
Die meisten glaubten, sie hätten sich zusammengetan, weil sie beide farbig waren. Phoebe war in Barbados geboren, aber bei ihrer Mutter in South Central aufgewachsen, nachdem sie im Alter von acht Jahren mit ihr in die Staaten gekommen war. Jasleen, acht Jahre jünger als sie, war eine waschechte Kalifornierin, doch ihre Wurzeln lagen in Ostindien. Ihre Familie stammte ursprünglich aus Mumbai und betrieb in der Bay Area von San Francisco eine Kette von chemischen Reinigungen.
Doch weder die Hautfarbe noch das Geschlecht hatten die beiden Frauen zusammengebracht. Zumindest hatten sie nicht den Ausschlag gegeben. Der eigentliche Grund war ihr Interesse an den Geheimnissen der Tiefsee. Und ihr Respekt voreinander.
»Es ist schwer zu glauben, dass in der lichtlosen bathypelagischen Zone überhaupt etwas lebt«, sagte Jazz und legte die flache Hand aufs Glas. »Der Druck da draußen beträgt etwa 300 Kilogramm pro Quadratzentimeter.«
»Das ist wirklich aufregend. Das Leben hat hier nicht nur Fuß gefasst, es hat auch eine große Artenvielfalt hervorgebracht.«
Sie schauten beide in das Wunderland hinter dem Fenster hinaus.
Zwei Seeteufel schwenkten ihre langen Antennen mit den leuchtenden Ködern. Teuthidodrilus wanden sich am Boden und fraßen den Meeresschnee, der von den sonnenerhellten Bereichen herabfiel und Nahrung in die pechschwarze Tiefe brachte. Jeder Blick enthüllte weitere Wunder: Schulen von Viperfischen, zwei Vampirkalmare, einen Dumbo-Oktopus. Etwas weiter weg krochen kleine weiße Hummer in einer roten Seeanemone umher.
»Hast du schon die Korallenbänke ausgewählt, von denen du die ersten Proben nehmen möchtest?«, fragte Jazz und sah auf ihre Taucheruhr. »Die erste Nutzungsperiode für das ROV beginnt in neunzig Minuten.«
»Ich hab schon ein paar Kandidaten, aber ich würde die Stationsfenster in dieser Höhe und vielleicht auch auf der nächsthöheren Ebene gern noch einmal komplett umfahren.«
»Vertrödele nicht die Zeit«, meinte Jazz. »Wir sind nicht die Einzigen, die nach ROV-Zeit lechzen. Es gibt hier unten eine Menge Konkurrenten.«
»Und weiter oben auch.«
Tausende Forscher, Akademiker und Wissenschaftler hatten sich für diese große Unternehmung beworben, doch nur 300 waren für den Start des Titan-Projekts ausgewählt worden. Diese 300 Personen waren jetzt über drei Bereiche verteilt.
Die Hälfte der Forscher befand sich über Wasser in der TitanX, einer 300 Meter langen Gigajacht mit einem dreizehn Stockwerke hohen Kugelaufbau am Heck. In der Kugel waren 22 hochmoderne Laboratorien untergebracht. Das Schiff versorgte die Station, verfügte jedoch auch über einen Flüssigsalzreaktor, der es ihm ermöglichte, überall auf der Welt Forschung zu betreiben.
Die Überwasserstation der Titan war nach dem Prinzip der FPSO-Schiffe aufgebaut, den Schwimmenden Produktions- und Lagereinheiten, die bei Ölplattformen eingesetzt wurden. Sie diente als Anlaufstelle, Arbeitsplattform und der Versorgung. Auch die zwei Dutzend Unterwasserfahrzeuge der Station – ferngesteuerte Tauchroboter (ROVs) und bemannte U-Boote (HOVs) – waren hier untergebracht.
In den vergangenen zwei Wochen hatten die hochspezialisierten HOVs Forscher und Besatzungsmitglieder in die drei Kilometer tiefer gelegene Unterwasserstation der Titan gebracht. Einige bezeichneten die umgedrehte Pyramide der Station als »teuersten Spielzeugkreisel der Welt«.
Auch Phoebe hatte vor zwei Tagen bei der Anfahrt gestaunt. Die oberste Ebene der Station mit ihrer Beobachtungskuppel sah aus wie ein Ufo von hundert Metern Durchmesser. Die vier darunter befindlichen Ebenen waren ebenfalls kreisförmig, doch ihr Durchmesser nahm nach unten hin ab, weshalb der Eindruck eines Kreisels entstand. Die unterste Ebene, auf der sie sich befand, hatte einen Durchmesser von lediglich zwanzig Metern. Labore gab es keine, nur einen Ring aus polarisierendem schwarzem Glas, weshalb auch hier Beobachtungen durchgeführt wurden.
Wie die Plattform und das Schiff schwamm auch die ganze Station über dem Meeresgrund. Die Position wurde von Ballasttanks und Schubdüsen an jeder Ebene stabilisiert. Die einzigen Berührungspunkte mit dem fragilen Ökosystem der Tiefsee waren mehrere Anker, welche die Station fixierten.
Um den Forschern und Arbeitern den Wechsel zwischen den drei Zonen zu erleichtern, herrschte überall in der Unterwasserstation der gleiche Druck, was eine Anpassung oder Dekompression unnötig machte. Der Personenverkehr mittels U-Booten erfolgte über ein Schleusensystem, das dem der Internationalen Raumstation ähnelte – die Tiefsee war für Menschen schließlich ebenso lebensfeindlich und gefährlich wie das Vakuum des Weltraums.
Doch daran gewöhnte man sich schnell. Phoebe und Jazz erkundeten die himmelblauen Gänge ebenso ehrfurchtsvoll und neugierig wie die meisten anderen Forscher. Hinter ihnen lagen wochenlange Vorbereitungen, angefüllt mit Vorträgen und Sicherheitstraining. Ihrem Staunen tat dies keinen Abbruch.
»Pheebs, schau du dich weiter hier unten um«, sagte Jazz. »Ich gehe hoch und sehe mir mal unser ROV-Terminal an. Ich möchte sicherstellen, dass die beiden MIT-Leute uns nicht die Zeit stehlen.«
»Tu das. Mach ihnen ordentlich Dampf.«
Phoebe lächelte, während Jazz zu der Wendeltreppe ging, die nach oben führte. Jasleen war nur eins fünfzig groß und hatte einen dunklen Kurzhaarschnitt, doch wenn es um ihren Arbeitsbereich und den Zeitplan ging, verwandelte sie sich in einen Pitbull.
Da sie wusste, dass Jazz auch sie für Verzögerungen verantwortlich machen würde, setzte Phoebe ihre Umkreisung fort. Diesmal konzentrierte sie sich weniger auf das wimmelnde Meeresleben, das umherschwamm, umherkroch oder durch die Riffs flitzte, sondern mehr auf die Eigenschaften des Geländes.
Das Thema ihrer Doktorarbeit war die einzigartige Biologie der Tiefseekorallen. Die meisten Menschen kannten vom Schnorcheln her die oberflächennahen Korallen, deren Polypen von fotosynthetisierenden Algen mit Energie versorgt wurden. Ihr Interesse galt jedoch den Korallen, die unterhalb der sonnenerhellten Zone lebten. Über die Tiefseekorallen war nur wenig bekannt. Im kalten Wasser und bei hohem Druck reiften sie nur langsam und waren unglaublich langlebig – manche Schätzungen reichten bis zu 5000 Jahren.
Da sie im Dunkeln lebten, ernährten sie sich von Mikroorganismen – von Zooplankton und Phytoplankton – sowie von bestimmten organischen Zersetzungsprodukten von Pflanzen und Tieren. Sie bildeten wunderschöne, fragile verzweigte Strukturen aus, die Nahrung und Sauerstoff aus dem Wasser filterten. Tiefseekorallen ähnelten deshalb gefiederten, fächerartigen Wäldern.
Hier trifft das jedenfalls zu.
Die Masse der Korallen hinter dem Fenster war erstaunlich. Sie glichen eher einem fluoreszierenden Dschungel als einem Wald. Riesenfächerkorallen ragten teilweise mehr als zehn Meter empor. Sie leuchteten gelb, rosa, blau und purpurfarben. Darunter waren Hornkorallen und Tiefseegorgonien gemischt. Anderswo standen tiefschwarze, dick verzweigte Korallenbäume, die wie versteinerte meterhohe Kiefern wirkten. Die großen, buschartigen elfenbeinfarbenen Lophelia füllten Zwischenräume aus und säumten die Ränder.
Einen Moment lang schüchterte die gewaltige Aufgabe, diese Vielfalt zu erforschen, sie ein, doch dann holte sie tief Luft und dachte an das chinesische Sprichwort, das ihre Mutter nach ihrer Ankunft in den Staaten häufig zitiert hatte, wenn Phoebe sich überfordert fühlte.
Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit einem einzelnen Schritt.
Langsam atmete sie aus.
Ich schaffe das.
11:08
Vierzig Minuten später schloss Phoebe den zweiten Rundgang auf der Thetys-Ebene ab. Dabei war sie mehrfach Gruppen von Kollegen begegnet, die sich in den unterschiedlichsten Sprachen halblaut unterhielten. Sie hatte ein Tablet dabei, das eine Karte der umliegenden Riffs anzeigte. Fünfzehn Orte hatte sie markiert – drei Mal so viele, wie sie bei ihrem ersten ROV-Ausflug bewältigen konnten.
Ich muss mich auf fünf oder sechs Orte beschränken.
Das frustrierte sie, doch sie würden später noch genügend Zeit haben, Proben zu nehmen. Sie hatte vor, das Suchraster in den nächsten Monaten zu vergrößern. Die erste Woche diente der Akklimatisierung. Sie mussten die Technik der Probennahme einüben und lernen, die Labors an Bord bestmöglich zu nutzen. Anschließend konnte sie die Suche ausweiten. Für den nächsten Dienstag hatte sie bereits ein HOV gebucht, mit dem sie weiter entfernte Orte erkunden wollte.
Wie aufs Stichwort glitt ein knallgelbes U-Boot mit einer großen Beobachtungskuppel am Bug vorbei. Darin machte sie trotz der blendenden Scheinwerfer verschwommene Gestalten aus.
Sie legte die flache Hand aufs Fenster und beobachtete sehnsüchtig, wie das U-Boot in der Dunkelheit verschwand, ein langsam erlöschender Stern.
Ein Mann sprach sie an und ließ sie zusammenschrecken. »Was halten Sie von alldem, Dr. Reed?« Ganz auf die Aussicht konzentriert, hatte sie ihn nicht kommen hören. Sie wandte sich um und erblickte zu ihrer Überraschung William Byrd, den CEO von ESKY und Hauptfinanzier des Titan-Projekts. Der fünfzigjährige Australier hatte sein Vermögen mit dem Schiffsbau gemacht – hauptsächlich mit Containerschiffen und Frachtern, aber auch mit Schiffen für die australische Marine. Seine Firma dominierte den internationalen Handel und war mehr als siebzig Milliarden Dollar wert. Trotzdem trug er einen schlichten marineblauen Pullover und eine Kappe mit Dreizacksymbol, die offizielle Stationsuniform. Allein die Taschenuhr aus massivem Gold, die an einer Brustkette hing, kündete von seinem Reichtum.
Phoebe nahm die Brille ab und suchte nach Worten. Schließlich zeigte sie nach draußen und vergegenwärtigte sich ihren ersten Eindruck. »Mister Byrd … Sie … lagen ganz richtig, als Sie die Tiefsee als Garten Eden bezeichnet haben. Die Umgebung ist wirklich sensationell.«
»Ah, Sie haben sich meine Pressekonferenz von vergangener Woche angehört?«
Er grinste, was ihn noch jungenhafter erscheinen ließ. Seine Bräune stammte offenbar nicht von der Sonnenbank. Mit seinem wettergegerbten Gesicht und dem dichten blonden, von entweder ausgebleichten oder altersbedingt weiß gewordenen Strähnen durchsetzten Haar wirkte er wie ein wilder Seemann.
»Die hat sich wohl niemand entgehen lassen«, sagte sie. »Bezos, Branson und Musk mögen mir verzeihen.«
Er zuckte mit den Schultern. »Geschieht ihnen recht. Warum milliardenteure Raketen in den Weltraum jagen, wenn es auf der Erde noch so viele Geheimnisse gibt? Besonders im Meer. Bislang wurden nur zwanzig Prozent des Meeresbodens kartografiert. Und selbst diese Karten sind ungenau. Die erforderliche Auflösung, um zum Beispiel Flugzeugwracks erkennen zu können, wird nur bei null Komma fünf Prozent der Fläche erreicht. Somit kann praktisch der ganze Meeresboden als unerforscht gelten.«
»Das wusste ich nicht«, sagte Phoebe.
Byrd nickte betrübt. »Das ist eine große Herausforderung. Die Zukunft der Menschheit liegt nicht auf dem Mars, sondern auf den 99 Prozent unbekannten Meeresbodens. Es ist gefährlich, dies zu vernachlässigen. Die Meere sind unser Brotkorb, unsere Spielwiese und unsere Apotheke. Vor allem aber sind sie die Lunge unseres Planeten. Sie produzieren achtzig Prozent des Sauerstoffs und binden 25 Prozent des Kohlendioxids. Wenn auch nur ein Viertel der Weltmeere stirbt, bedeutet dies das Ende des Lebens auf der Erde.«
Phoebe nickte. Seine Worte hatten ihr die Bedeutung des Titan-Projekts erneut bewusst gemacht. Finanziert wurde es von mehreren gemeinnützigen Organisationen und Firmensponsoren sowie mit Forschungsstipendien, doch der Löwenanteil stammte von dem Mann, der vor ihr stand. Vielleicht wollte er etwas zurückgeben, nachdem er Milliarden mit den Tausenden Frachtschiffen erwirtschaftet hatte, welche die Weltmeere durchpflügten. Jedenfalls engagierte er sich. Seine Firma hatte zehn Milliarden Dollar zur Titan-Station beigesteuert und sichergestellt, dass der Bau in erstaunlich kurzer Zeit abgeschlossen werden konnte.
Und ich bin mit dabei.
Doch der Milliardär fesselte nicht Phoebes ganze Aufmerksamkeit. Sie blickte über seine Schultern hinweg zu den Fenstern, wo ein Cuvier-Schnabelwal an den Korallen vorbeizog, als beobachte er sie ebenso neugierig wie sie die Umgebung. Diese Wale waren Tiefseetaucher und konnten stundenlang die Luft anhalten.
Byrd bemerkte, dass sie abgelenkt war, was sein freundliches Grinsen vertiefte. Er wandte sich um und schaute ebenfalls nach draußen.
»Das ist wahrhaft ein Garten Eden«, sagte er. »Hoffen wir, dass wir nicht so schnell daraus vertrieben werden, weil wir nach Erkenntnis suchen wie Eva. Wir müssen noch viel lernen. Und es liegt eine Menge Arbeit vor uns.«
»Das ist keine Arbeit, glauben Sie mir. Es ist eine Ehre, hier am Rand des Korallenmeeres zu sein. Aufregende Entdeckungen kommen auf uns zu, und ich kann es gar nicht erwarten loszulegen.«
Inzwischen hatten sich die anderen Anwesenden ihnen zugewandt. William Byrd sprach nur selten mit den Forschern. Während ihrer wochenlangen Ausbildung an Bord der Titan X hatte Phoebe den Milliardär nur einige Male gesehen, entweder an Deck der Jacht oder wenn er mit seiner Entourage auf einer wissenschaftlichen Veranstaltung auftrat. Im Moment wurde er lediglich von einem ernst blickenden Bodyguard begleitet. Einem hoch gewachsenen Aborigine, der die Hand auf den Griff des Schlagstocks an seiner Hüfte gelegt hatte.
»Ihr Enthusiasmus ist eine Inspiration für mich, Dr. Reed«, sagte Byrd, den Blick noch immer nach draußen gerichtet.
»Danke«, stammelte Phoebe, überrascht davon, dass der Mann ihren Namen kannte.
Andererseits war sie eines der wenigen schwarzen Gesichter an Bord der Titan-Station und, soweit sie wusste, die einzige schwarze Frau. Sie hoffte, dass nicht dies der Grund war, weshalb er sie kannte – oder ihre Körpergröße, mit der sie die meisten überragte.
Die Titan-Station war ein internationales Projekt, doch die meisten Mitarbeiter waren weiß und männlich. Einige stammten aus Asien, einige wenige aus der Türkei, Pakistan und dem Mittleren Osten. Das Verhältnis von Männern zu Frauen betrug zwanzig zu eins. Das aber rührte nicht unbedingt von Vorurteilen her, sondern war eher Folge der geringen Anzahl von Wissenschaftlerinnen.
Zumindest hoffe ich das.
Byrd wandte sich vom Fenster ab und sah sie an. »Ich freue mich darauf, Ihre Gedanken zum Zustand unserer Riffs zu erfahren, Dr. Reed. Ich hoffe, wir finden eine Möglichkeit, die Zerstörung der Korallen aufzuhalten, denen dieses Meer seinen Namen verdankt.«
Sie vermutete, dass sie aus ebendiesem Grund für das Projekt ausgewählt worden war. Tiefseekorallen waren besonders resistent gegen die wärmeinduzierte Korallenbleiche an der Meeresoberfläche, ein Phänomen, welches das Great Barrier Reef bedrohte. Die Tiefseekorallen widerstanden dem Umweltwandel weit besser. Den genauen Grund kannte man nicht. Fände man die Ursache, könnte dies für die vielen Korallenriffs der Welt die Rettung bedeuten.
»Ich habe Ihre Forschungsarbeiten vom Monterey Bay Aquarium Research Institute gelesen«, fuhr Byrd fort. »Die mit Bezug zur Resilienzökologie des Sur Ridge an der kalifornischen Küste. Deshalb setze ich große Hoffnungen auf Ihre Arbeit hier vor Ort.«
Sie versuchte, ihre Überraschung zu verbergen. Er hat meine Artikel gelesen. Dann hatte das Interesse dieses Mannes vielleicht wirklich nichts mit ihrer Hautfarbe oder ihrer Körpergröße zu tun.
Sie straffte sich. »Ich werde mein Bestes tun.«
»Daran habe ich keinen Zweifel.« Byrd seufzte vernehmlich. »Ich lasse Sie jetzt allein, denn Sie müssen sich noch akklimatisieren, Dr. Reed. Aber ich freue mich auf weitere Gespräche.«
Bevor er sich der Treppe in der Mitte des Raums zuwenden konnte, war ein leises Grollen zu hören. Draußen schwankten die Ankerseile, doch die fünf Ebenen der Unterwasserstation bewegten sich kaum, da die computergesteuerten Schubdüsen das Beben kompensierten.
Die anderen Wissenschaftler wichen von den Fenstern zurück.
Byrds Bodyguard streckte die Hand nach seinem Schützling aus.
Der Aussie aber hob den Arm und wandte sich an die Allgemeinheit. »Nur ein kleines Seebeben! Kein Grund zur Besorgnis. Wir befinden uns in einer tektonisch aktiven Region. Das ist das sechzehnte … nein, das siebzehnte Seebeben seit Beginn des Projekts. Das war zu erwarten und wurde bei der Konstruktion der Titan auch berücksichtigt.«
Als das Beben nachließ, näherte Phoebe sich als Einzige wieder dem Fenster und schaute hinaus. Die Meeresbewohner wirkten ebenso unbeeindruckt vom Beben wie Byrd. Der aufgewirbelte Sand begann sich bereits abzusetzen.
Sie legte die flache Hand aufs Glas und spürte die Vibration der Stabilisierungsdüsen, nichts sonst. Sie blickte in die Dunkelheit jenseits des roten Lichtscheins hinaus, in Richtung des Epizentrums des Bebens. Dort fiel der Meeresboden steil zu einem Labyrinth tiefer Einschnitte ab, dem Solomongraben, dem Neuhebridengraben und weiter weg dem Kermadec-Tonga-Graben. Sie säumten die Bruchstelle, an der sich die Pazifische an der Indisch-Australischen Platte rieb.
Der Marianengraben war zwar bekannter, weil er der tiefste war, doch der Unterschied zu dieser Kette betrug nur tausend Meter. Trotzdem waren diese Gräben von der Forschungsgemeinde bislang vernachlässigt worden.
Das wird sich jetzt hoffentlich ändern.
Die Nähe zu den Gräben und der Bezug zu ihrer Forschungsarbeit waren mit ein Grund dafür gewesen, dass sie am Titan-Projekt mitarbeiten wollte. Tiefseekorallen waren bis zu einer Tiefe von drei Kilometern gut dokumentiert. Niemand aber wusste, ob es sie auch in größerer Tiefe gab und wenn ja, wie sie aussahen und überlebten. Die Antwort darauf war in den labyrinthischen Gräben zu finden.
Sie blickte sich zu William Byrd um, der von drei Forschern aufgehalten wurde. Offenbar versuchte er, sie zu beruhigen, denn er sprach gerade über die umfangreichen Tests, denen man die Station unterzogen hatte.
Sie hingegen dachte an seine Bemerkung, dass 99 Prozent des Meeresbodens unerforscht seien. Irgendwo hier draußen musste es auch tiefer lebende Korallen geben.
Sie schaute wieder aus dem Fenster.
Und ich werde sie finden.
Mit der flachen Hand am Glas nahm sie eine Vibration wahr, die sich in ihren Arm fortpflanzte. Draußen erzitterte der Meeresboden. Sand wurde hochgewirbelt, der Meereswald schwankte. Mit zuckenden Flossen flitzten die Fische davon. Die Krabben unterbrachen ihren Beutezug und ließen tintiges Wasser hinter sich zurück.
Ihre Augen weiteten sich, der Warnruf blieb ihr im Halse stecken. Bevor sie ausatmen konnte, buckelte der Meeresboden unter der Station. Die Ankerseile schwangen umher. Zwei davon rissen. Sie hörte, wie weiter oben Brandschutztüren zufielen, welche die Ebenen voneinander isolierten. Während die Station schwankte und bebte, lösten sich auch die restlichen Ankerseile aus ihrer Befestigung an der schwimmenden Station.
Die Titan-Station drehte sich langsam – bis die Schubdüsen ihre Lage stabilisierten.
Phoebe schaute sich um. Mehrere Forscher waren gestürzt. William Byrd war noch auf den Beinen, vermutlich wegen des festen Griffs seines Bodyguards.
Das Lachen des Aussies klang gezwungen. »Das war ganz schön heftig, aber wie Sie sehen, haben wir selbst dieses starke Beben unbeschadet überstanden.«
Seufzend öffneten sich die Brandschutztüren, welche die Etagen voneinander isolierten. Ein Entwarnungssignal ertönte.
»Wie gesagt«, versicherte Byrd mit breitem Lächeln, »kein Grund zur Besorgnis.«
Sein Grinsen aber wirkte weit weniger selbstsicher als zuvor.
Phoebe schaute aus dem Fenster. Der Meeresboden beruhigte sich. Der Sand setzte sich ab, und das weitgehend unbeschädigte Riff kam zum Vorschein. Zwei größere Korallenbäume waren entzweigebrochen. Das war anscheinend schon alles.
Trotzdem wartete sie und beobachtete weiterhin aufmerksam die Umgebung.
Nach fünf Minuten wurde sie von kalter Furcht erfasst. Die schwimmenden Meeresbewohner waren nicht zurückgekehrt. Offenbar mieden sie das Gebiet.
Auf einmal machte sie sich Sorgen.
Sollten wir das Gleiche tun?
2
22. Januar, 18:02 HKTHongkong, China
Commander Grayson Pierce kniete vor seinem zweijährigen Sohn und wartete darauf, dass Jack eine schicksalsschwere Entscheidung traf.
Im Moment hatte der Junge nur Augen für den Kakadu mit dem gelben Kamm, der auf dem Balkon umhertänzelte. Dahinter lagen die bewaldeten Hänge des Victoria Peak, die Hochhäuser von Hongkong und der Hafen.
Ein schwerer Seufzer war zu vernehmen.
»Komm schon, Jack, entscheide dich«, drängte Harriet den Jungen. Die Siebenjährige war mit ihrer Geduld anscheinend am Ende. In der Küche wartete eine Torte aus vier Etagen, die Snoopy darstellte.
»Hetz ihn nicht«, tadelte Penny ihre Schwester. Da sie ein Jahr älter war, fühlte sie sich verpflichtet, sich von der verantwortungsvollen Seite zu zeigen.
Die beiden Mädchen waren die Töchter von Grays besten Freunden und Kollegen im Sigma-Team. Monk Kokkalis und Kathryn Bryant waren in der Küche und bereiteten die kleine Party vor, die auf die Zeremonie folgen sollte. Gray hörte sie miteinander plaudern, hin und wieder unterbrochen von einem belustigten Schnauben Monks, das Ähnlichkeit hatte mit dem Balzruf eines Gänserichs.
Sie waren vergangene Woche gemeinsam von D.C. nach China geflogen, um zusammen mit Jacks Großmutter mütterlicherseits seinen zweiten Geburtstag zu feiern. Guan-yin umkreiste den auf dem Boden sitzenden Jack. Ihr Name bedeutete Göttin der Barmherzigkeit. Sie war der Drachenkopf der Triade Duan-zhi, deshalb war der Name wohl eher ironisch zu verstehen. Wären Gray und Seichan nicht mit Jack nach Hongkong gekommen, hätte sie sicherlich keine Barmherzigkeit walten lassen. Guan-yin war verärgert gewesen, dass sie Jacks ersten Geburtstag versäumt hatte.
Jetzt wollte die Großmutter des Jungen das Versäumte nachholen.
Die schlanke Frau trug ein Gewand, unter dessen Kapuze ihr langes schwarzes Haar hervorschaute, das an der linken Seite eine graue Strähne aufwies, an der gleichen Seite, wo sich eine dunkelrote Narbe von der Wange bis zur Stirn zog. In der Öffentlichkeit verbarg sie die Narbe – nicht aus Scham, sondern weil man sie daran hätte erkennen können. In ihrer Eigenschaft als Drachenkopf und Mafiaboss von Macau wurden ihr Verehrung, aber auch Feindschaft entgegengebracht. In ihrer Villa auf dem Peak jedoch brauchte sie sich nicht zu tarnen – das Grundstück wurde von den tüchtigsten Mitgliedern ihrer Triade geschützt. Und obwohl sie schon über sechzig war, konnte sie hervorragend mit den Messern und Dolchen umgehen, die unter ihrem Gewand verborgen waren.
Guan-yin legte einen weiteren Stapel mit Geld vollgestopfter roter Umschläge auf den Sofatisch. Sie gesellten sich zu einer Unmenge eingepackter Geschenke. Offenbar wollte es sich keiner entgehen lassen, ihrem Enkel seinen Respekt zu erweisen.
Der Stapel wurde bewacht von Guan-yins allgegenwärtigem Schatten Zhuang. Er war einen halben Kopf größer als Gray. Das schneeweiße Haar hatte er zurückgekämmt und zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sein Gesicht war faltenlos, seine Bewegungen geschmeidig.
Als ein Umschlag aus dem Stapel herausrutschte, fing er ihn, ohne hinzusehen, auf und steckte ihn zurück. Er hatte sich einen chinesischen Dao auf den Rücken geschnallt, einen Säbel aus dem achtzehnten Jahrhundert. Dessen Vorgeschichte erwähnte er nie, doch Gray hatte bereits gesehen, wie er die Waffe in der Hand gewogen hatte, und dabei war ihm aufgefallen, dass die Klinge noch immer scharf war.
Guan-yin dankte Zhuang für seine Geistesgegenwart, indem sie mit einem Zeigefinger über seinen Oberarm strich. So wie Zhuang sie anschaute, war zu vermuten, dass er mehr war als nur ihr Leibwächter.
Gray fand ihre stille Zuneigung beneidenswert.
Er schaute nach links, wo Jacks Mutter kniete.
Seichan wartete scheinbar gelassen auf die Entscheidung ihres Sohnes. Sie war mit schwarzer Hose bekleidet, ihre ebenfalls schwarze Jacke war mit nur geringfügig helleren Blumen bestickt. Sie wirkte geduldig, doch Gray entging nicht, dass sie die smaragdgrünen Augen leicht zusammengekniffen und die Schultern angespannt hatte.
Sie war so straff gespannt wie eine Feder.
Jedoch nicht wegen Jacks Zukunft.
Gray spürte das Gewicht in der Brusttasche seines Sakkos.
Was habe ich mir nur dabei gedacht?
Guan-yin neigte sich hinüber und küsste Seichan auf die Wange. »Chúc mừng sinh nhật, Con gái«, beglückwünschte sie ihre Tochter auf Vietnamesisch, ihrer Muttersprache, zum Geburtstag.
Seichan ergriff die Hand ihrer Mutter und wünschte ihr das Gleiche. »Chúc mừng sinh nhật, Mẹ.«
Guan-yin kniete geschmeidig an Jacks rechter Seite nieder, legte ihm eine Hand auf den Kopf und lenkte ihn vom Kakadu ab. »Chúc mừng sinh nhật, Jack.«
Seichan hatte Gray die vietnamesische Tradition der Geburtstagsfeier bereits erklärt. Das tatsächliche Geburtsdatum spielte dabei keine Rolle. Alle Geburtstage wurden am vietnamesischen Neujahrstag gefeiert, dem Tet Nguyen Ðan, der auf den ersten Neumond nach dem 20. Januar fiel. Dies war zudem der chinesische Neujahrstag, der gestern Nacht ausgelassen gefeiert worden war.
Genau genommen hatte Jack erst in zwei Tagen Geburtstag, doch Guan-yin wollte, dass er nach vietnamesischer, chinesischer und amerikanischer Tradition gefeiert wurde. Auf der Snoopy-Torte waren Kerzen zum Auspusten – zuvor aber musste die Zhua-Zhou-Zeremonie begangen werden.
Obwohl Jack seine Geburtstagstorte zwei Tage zu früh bekommen würde, fand die Feier eigentlich ein Jahr zu spät statt, denn bei den Chinesen wurde der erste Geburtstag im Monat der Geburt gefeiert. Die Zeit der Schwangerschaft betrachteten sie als erstes Lebensjahr des Kindes.
Guan-yin hatte darauf bestanden, für ihren Enkel eine Ausnahme zu machen. Zhua Zhou – die Geburtstagswahl – sollte heute stattfinden. Vor Jack waren mehrere symbolische Gegenstände auf dem Boden verteilt, die jeweils für eine bestimmte Zukunft standen. Ein Abakus aus Jade symbolisierte die Wirtschaft und das Finanzwesen. Ein Hühnerbein stand für den Beruf des Kochs. Ein kleines Mikrofon wies das Kind als zukünftigen Entertainer aus. Insgesamt gab es sechzehn verschiedene Gegenstände.
Alle warteten darauf, dass Jack seine Wahl traf.
Gray bemerkte, dass Seichan ein kleines Schwert dicht vor Jacks linkem Knie platziert hatte. Eine Erklärung erübrigte sich. Guan-yin, ganz die Großmutter, hatte ein Spielzeugstethoskop vor Jacks rechtes Knie gelegt. Offenbar wünschte sie sich wie alle Großeltern einen Arzt in der Familie.
Gray wollte sich auf diesen Unsinn nicht einlassen.
Das Schicksal des Jungen wird nicht hier entschieden.
Trotzdem spannte er sich an, als Jack sich aufrichtete und seine ersten Schritte in die Zukunft machte. Es herrschte erwartungsvolle Stille. Monk und Kat waren in der Küchentür aufgetaucht. Auch Zhuang war näher gekommen und schaute zu.
Jack tapste durch die ausgelegten Gegenstände wie durch ein Minenfeld. Schließlich ließ er sich auf die Knie nieder, dann auf alle viere. Er griff nach einem Gegenstand ganz am Rand, der von der Sofalehne beschattet wurde und unter einem roten Tuch verborgen war.
Als er ihn ergriffen hatte, ließ er sich auf den Hintern plumpsen und zeigte seinen Schatz lachend vor.
Gray nahm ihm das Ding ab. »Wer hat eine Handgranate hierhergelegt?«
Die Antwort erfolgte aus dem Flur. »Das ist mein Patenkind!«
Gray fuhr herum und funkelte Kowalski böse an.
Der Gorilla von einem Mann war mit Boxershorts, Flip-Flops und T-Shirt bekleidet. Er hatte bis zum Morgen gefeiert, und seine geröteten Augen und der schmerzverzerrte Mund ließen auf einen schweren Kater schließen.
»Keine Sorge«, brummte Kowalski. »Ist ein Blindgänger. Aus dem Koreakrieg. Hab ich vor ein paar Tagen auf dem Nachtmarkt gekauft. Den zukünftigen Sprengstoffexperten sieht man ihm jetzt schon an. Der wird mir bestimmt nacheifern.«
Gray stöhnte. »Vielleicht sollten wir die Zeremonie besser wiederholen.«
Seichan pflichtete ihm bei, ein Moment der Einmütigkeit, wie sie in letzter Zeit selten geworden waren. »Ich bestehe darauf.«
22:18
Seichan stand am Balkongeländer und schaute auf den ummauerten Garten hinunter. Kleine Laternen beleuchteten dunkle Teiche, Bogenbrücken und plätschernde Bambusbrunnen. Der leichte Nachtwind wehte den süßlichen Duft winterblühender Orchideenbäume heran.
In der Villa erlosch allmählich die Beleuchtung. Gray duschte, nachdem er Jack zu Bett gebracht hatte. Monk, Kat und die Mädchen hatten sich in ein Gästehaus auf dem umfriedeten Gelände zurückgezogen. Kowalski war in der Stadt, begleitet von zwei Triadenmitgliedern – vermutlich dienten sie weniger seinem Schutz, sondern sollten verhindern, dass er einen internationalen Zwischenfall auslöste.
Um nicht aufzufallen, waren sie mit Tarnnamen und falschen Pässen von den Staaten eingereist. Da sie nicht in offiziellem Auftrag gekommen waren, wollten sie kein Aufsehen erregen. Offiziell war Hongkong noch immer eine Sonderverwaltungszone der Volksrepublik, mit eigenständiger Regierung und Wirtschaft. Die Formel »Ein Land, zwei Systeme« war nach den heftigen Protesten im Jahr 2019 und der darauffolgenden Corona-Quarantäne jedoch so stark aufgeweicht worden, dass es inzwischen kaum noch Unterschiede gab.
Trotz dieser Veränderungen war ihre Einreise nach Hongkong von zwei Faktoren erleichtert worden.
Erstens war Sigma eine Geheimorganisation mit militärischem Charakter. Die meisten Angehörigen hatten bei den Spezialkräften gedient und waren von der DARPA angeworben worden, einer Behörde der Streitkräfte, die militärische Forschungsprojekte durchführte. Sie hatten eine Fortbildung in mehreren wissenschaftlichen Disziplinen absolviert und wurden immer dann, wenn eine globale Bedrohung vorlag, als Erstschlag-Agenten und Ermittlungsteams eingesetzt. Sigma-Einsätze wurden im Verborgenen durchgeführt. Die Agenten operierten in einem Schattenreich, in dem die Grenzen zwischen Geheimdienst, Militäreinsätzen und wissenschaftlicher Forschung durchlässig waren.
Zweitens standen sie trotz aller Geheimhaltung in Hongkong zweifellos unter Beobachtung, und ihre wahre Identität war bekannt. Es war typisch für Geheimdienste, so zu tun, als sei der Übergriff eines anderen Dienstes unbemerkt geblieben, während man gleichzeitig ein Auge darauf hatte. Solange sie keine unmittelbare Gefahr für die chinesische Sicherheit darstellten, würde man ihre Anwesenheit dulden. Solange sie die Chinesen nicht provozierten, würden sie nichts unternehmen.
Zumindest jetzt noch nicht.
Seichan wirkte wachsam, was ihr Normalzustand war. Abgesehen von den kleinen Laternen im Garten spendeten nur die funkenden Sterne und die fernen Neonreklamen der Wolkenkratzer ein wenig Licht. Der Mond war bereits untergegangen, und er hätte auch nicht hell geschienen. Das chinesische Neujahr endete bei Neumond, der als dunkler Schatten über die Sterne hinwegwanderte.
So hatte sie sich ihr ganzes Leben lang gefühlt.
Ein Schatten inmitten der Helligkeit der Welt.
Hinter ihr bewegte sich der Vorhang, ein silbriger Lichtstreif fiel auf den Balkon. Die Tür glitt auf, und eine Gestalt im Seidengewand trat heraus. Ihre Mutter näherte sich ihr zögernd. Zwischen ihnen gab es viel Ungeklärtes.
Obwohl sie sich vor vier Jahren versöhnt hatten, war ein gewisses Unbehagen geblieben. Ein Abgrund von mehr als zwanzig Jahren – als sie sich gegenseitig für tot gehalten hatten – war schwer zu überbrücken. Seitdem hatte Seichan viel Zeit mit ihrer Mutter verbracht, doch in den vergangenen zwei Jahren waren die Abstände zwischen den Besuchen größer geworden. Ihr letzter Besuch mit Jack war zehn Monate her.
Am Geländer innehaltend, schwieg ihre Mutter, als wollte sie zunächst die Stimmung testen. Guan-yin zog eine Schachtel in Zellophanverpackung aus der Tasche, nahm eine Zigarette heraus und schob sie sich zwischen die Lippen. Sie klopfte die Taschen nach einem Feuerzeug ab.