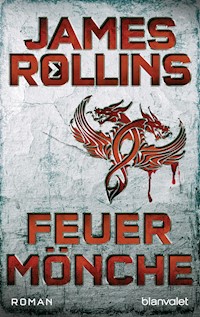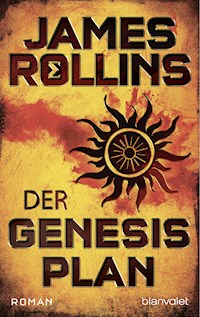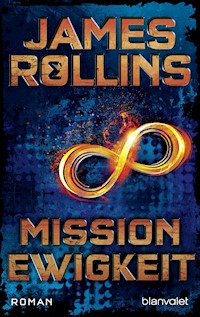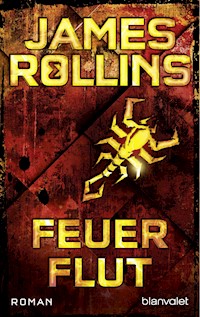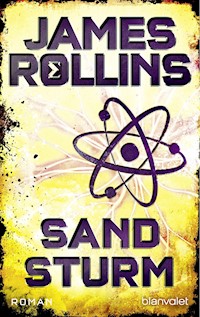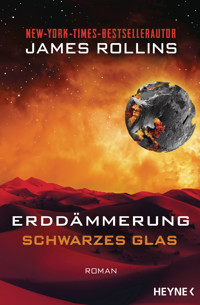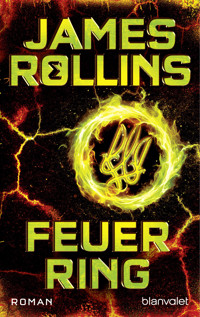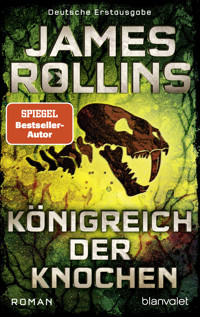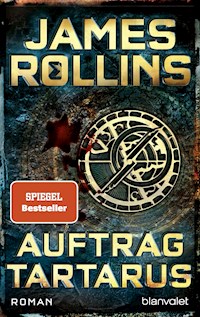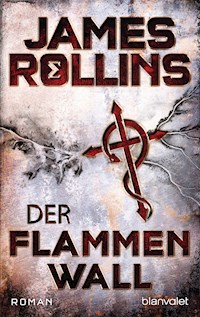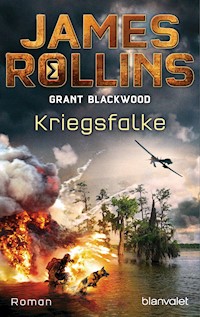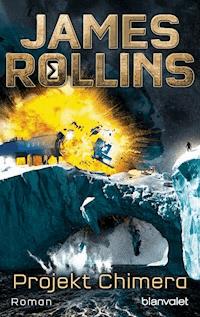
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: SIGMA Force
- Sprache: Deutsch
»Uralte Karten, fremde Lebensformen, ein nuklearer Countdown und exotische tödliche Bestien – und bei James Rollins klingt das alles glaubwürdig.«
Publishers Weekly
Eine abgelegene militärische Forschungsstation sendet einen verzweifelten Notruf, doch als das Rettungsteam eintrifft, stoßen die Männer nur auf Leichen. Außerdem wurde jedes Lebewesen – selbst Bakterien – innerhalb von 75 Quadratkilometern ausgelöscht. Das Land ist völlig steril – und die Zone weitet sich aus! Als die Agenten der SIGMA-Force herausfinden, dass der Chefwissenschaftler entführt wurde, setzen sie alles daran, ihn aufzuspüren. Denn mit seiner Entdeckung kann man das Antlitz der Welt verändern – und dort wäre kein Platz mehr für die Menschheit …
Verpassen Sie nicht die weiteren in sich abgeschlossenen Romane über die Topagenten der Sigma Force!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Eine abgelegene militärische Forschungsstation sendet einen verzweifelten Notruf, der mit einer verwirrenden Forderung endet: Tötet uns alle!
Militärisches Personal der nächstgelegenen Basis dringt in die Forschungsstation ein und stößt nur noch auf Leichen. Doch nicht nur die Wissenschaftler sind tot, sondern jedes Lebewesen innerhalb von 75 Quadratkilometern wurde ausgelöscht: jedes Tier, jede Pflanze, jedes Insekt, selbst Bakterien. Das Land ist völlig steril – und die Zone weitet sich aus!
Um das Unausweichliche zu verhindern müssen Commander Grayson Pierce und die Sigma-Force eine Bedrohung erforschen, deren Ursprung weit in der Vergangenheit liegt – als die Antarktis noch grün war und das Leben an sich auf der Erde noch auf Messers Schneide stand …
Autor
Der New-York-Times-Bestsellerautor James Rollins hat einen Doktorgrad in Tiermedizin. Als begeisterter Höhlenforscher und ebenso eifriger Taucher ist er häufig unter Wasser oder unter der Erde anzutreffen. Er wohnt in den Bergen der Sierra Nevada in Kalifornien, USA.
Von James Rollins bei Blanvalet erschienen:
Sigma-Force:
Der Genesis-Plan, Feuermönche, Sandsturm, Der Judas-Code, Das Messias-Gen, Feuerflut, Mission Ewigkeit, Das Auge Gottes, Projekt Chimera
Die Bruderschaft der Christuskrieger:
Das Evangelium des Blutes, Das Blut des Verräters, Die Apokalypse des Blutes
Außerdem:
Sub Terra, Im Dreieck des Drachen, Das Flammenzeichen, Operation Amazonas, Das Blut des Teufels,
Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
James Rollins
Projekt Chimera
Roman
Aus dem Englischen von Norbert Stöbe
Für David, der dafür sorgt, dass ich trotz Höhenflügen den Kontakt mit dem Boden nicht verliere … keine leichte Aufgabe!
VORBEMERKUNG ZUM HISTORISCHEN HINTERGRUND
IM LAUF DER Geschichte erfährt das Wissen ein ständiges Auf und Ab. Was gewusst wurde, wird wieder vergessen und scheint manchmal jahrhundertlang verloren, bis es irgendwann neu entdeckt wird.
Vor Jahrtausenden studierten die alten Maya die Bewegungen der Sterne und entwickelten einen Kalender, der für die Dauer von zweitausendfünfhundert Jahren sämtliche Tage erfasste. Dies war eine astronomische Meisterleistung, die viele Jahrhunderte lang unübertroffen blieb. In der Blütezeit des Byzantinischen Reichs änderte sich die Kriegsführung dramatisch mit der Erfindung des Griechischen Feuers, einer Brandwaffe, die mit Wasser nicht gelöscht werden konnte. Das Rezept für das entflammbare Gebräu ging im zehnten Jahrhundert verloren und wurde erst um 1940 herum als Napalm wiederentdeckt.
Weshalb ging dieses Wissen in der Antike verloren? Ein Beispiel datiert aus dem ersten oder zweiten Jahrhundert, als die berühmte Bibliothek von Alexandria niedergebrannt wurde. In der ungefähr 300 v. Chr. in Ägypten gegründeten Bibliothek gab es angeblich über eine Million Schriftrollen, ein Wissensdepot ohne Beispiel. Es zog Gelehrte aus der ganzen bekannten Welt an. Der Grund für die Zerstörung liegt im Dunkeln. Einige geben Julius Cäsar die Schuld, der angeblich den alexandrinischen Hafen in Brand setzen ließ; andere machen marodierende arabische Eroberer verantwortlich. Sicher ist nur, dass die Flammen einen gewaltigen Wissensschatz zerstörten, im Lauf der Zeiten gesammelte Erkenntnisse, die unwiederbringlich verloren gingen.
Manche Geheimnisse aber lassen sich nicht begraben. Dies ist die Geschichte eines der dunklen Geheimnisse, die so gefährlich sind, dass sie nie vollständig vergessen wurden.
VORBEMERKUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN HINTERGRUND
DAS LEBEN AUF diesem Planeten war schon immer ein Balanceakt – ein kompliziertes Geflecht von Wechselwirkungen, das erstaunlich fragil ist. Entfernt man genügend viele Schlüsselkomponenten oder verändert sie auch nur, franst das Gewebe aus und löst sich auf.
Ein solcher Kollaps – oder ein solches Artensterben – ereignete sich in der geologischen Vergangenheit unseres Planeten fünf Mal. Die erste Katastrophe betraf gegen Ende des Perm Land und Meer und löschte neunzig Prozent aller Spezies aus, was um ein Haar das Ende allen Lebens auf der Erde bedeutet hätte. Die fünfte und bislang letzte Katastrophe ließ die Saurier aussterben, leitete die Ära der Säugetiere ein und veränderte die Welt für immer.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine solche Katastrophe zu erleben? Einige Wissenschaftler glauben, dass wir bereits bis zum Hals im sechsten Artensterben stecken. Pro Stunde werden drei Spezies ausgelöscht, über ein Jahr dreißigtausend. Am schlimmsten dabei ist, dass die Aussterberate kontinuierlich steigt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind fast die Hälfte aller Amphibien, ein Viertel aller Säugetiere und ein Drittel alle Korallenriffe von der Auslöschung bedroht. Sogar ein Drittel aller Nadelbäume ist gefährdet.
Weshalb ist das so? In der Vergangenheit wurden Artensterben von plötzlichen Klimaveränderungen, Verschiebungen der Plattentektonik oder im Falle der Dinosaurier möglicherweise durch einen Asteroideneinschlag ausgelöst. Die meisten Wissenschaftler glauben, dass die gegenwärtige Krise eine einfachere Erklärung hat: den Menschen. Weil wir die Ökologie missachten und die Umwelt verschmutzen, ist die Menschheit die treibende Kraft hinter dem massenhaften Verlust an Vielfalt. Einem im Mai 2014 veröffentlichten Bericht der Duke University zufolge sterben Spezies inzwischen tausend Mal schneller aus als vor dem Erscheinen des modernen Menschen.
Weniger bekannt ist eine neue Gefahr für das Leben auf der Erde, die aus der fernen Vergangenheit herrührt und das gegenwärtige Artensterben noch weiter zu beschleunigen und uns an den Rand der Apokalypse zu bringen droht.
Diese Bedrohung ist nicht nur real – sie entsteht in diesem Moment in unserem eigenen Hinterhof.
Auslöschung ist die Regel. Überleben ist die Ausnahme.
Carl Sagan, The Varieties of Scientific Experience (2007)
27. Dezember, 1832An Bord der HMS Beagle
WIR HÄTTEN DIE Warnung beherzigen sollen …
Charles Darwin schaute auf die mit schwarzer Tinte auf die weißen Seiten seines Tagesbuchs geschriebenen Worte nieder, doch er sah nur Rot. Trotz des kleinen Kanonenofens fröstelte er in der Kälte, die ihm bis ins Mark drang – eine Kälte, die vermutlich nie mehr ganz verschwinden würde. Er sprach lautlos ein Gebet und dachte daran, dass sein Vater ihn gedrängt hatte, ein Theologiestudium zu beginnen, nachdem er die Medizinerausbildung abgebrochen hatte.
Vielleicht hätte ich auf ihn hören sollen.
Stattdessen hatte er der Lockung ferner Küsten und wissenschaftlicher Entdeckungen nachgegeben. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hatte er seine Anstellung als Naturkundler auf der HMSBeagle angetreten. Im zarten Alter von zweiundzwanzig war er bereit gewesen, sich einen Namen zu machen und die Welt kennenzulernen. So war er hier gelandet, und jetzt klebte an seinen Händen Blut.
Er schaute sich in der Kabine um. Als er an Bord gekommen war, hatte man ihm ein Quartier im Kartenraum des Schiffs zugewiesen, ein beengtes Gemach, das beherrscht wurde von dem großen Tisch in der Mitte, der vom Besanmast durchstoßen wurde. Er nutzte jeden freien Winkel – Schränke, Bücherregale, sogar das Waschbecken – als Arbeitsfläche und provisorisches Museum für die gesammelten Artefakte und Proben. Er hatte Knochen und Fossilien zusammengetragen, Zähne und Muscheln, sogar konservierte Exemplare ungewöhnlicher Schlangen, Eidechsen und Vögel. Neben seinem Ellbogen lag ein Brett mit aufgespießten Käfern von enormer Größe, mit Hörnern, die an das afrikanische Nashorn erinnerten. Neben dem Tintenfass waren Gläser mit getrockneten Pflanzen und Samen aufgereiht.
Hilflos ließ er den Blick über seine Sammlung schweifen – der fantasielose Captain FitzRoy bezeichnete sie als nutzlosen Plunder.
Vielleicht hätte ich das alles nach England schicken sollen, bevor die Beagle von Feuerland aufgebrochen ist …
Bedauerlicherweise war er wie der Rest der Besatzung zu sehr von den Erzählungen der Wilden des Archipels, den eingeborenen Feuerländern des Yaghanstamms, in Anspruch genommen gewesen. Die Legenden der Stammesleute handelten von Ungeheuern, Göttern und Wundern, die jede Vorstellung sprengten. Diese Erzählungen hatten die Beagle in die Irre und um die Spitze von Südamerika herumgeführt, über das aufgewühlte Meer bis zu dieser erstarrten Einöde am Ende der Welt.
»Terra Australis Incognita«, murmelte er vor sich hin.
Das berüchtigte Unbekannte Südland.
Er zog eine Landkarte aus dem Durcheinander auf seinem Schreibtisch hervor. Vor neun Tagen, kurz nach dem Erreichen von Feuerland, hatte Captain FitzRoy ihm diese französische Karte aus dem Jahr 1583 gezeigt.
Es handelte sich um eine Darstellung des unerforschten Kontinents am Südpol der Erdkugel. Die Karte war offensichtlich ungenau und berücksichtigte nicht die Tatsache, dass Sir Francis Drake, ein Zeitgenosse des Kartografen, bereits das Eismeer entdeckt hatte, das Südamerika von diesem unbekannten Land trennte. Obwohl man die Karte schon vor zweihundert Jahren gezeichnet hatte, war dieser unbewohnbare Kontinent noch immer ein Geheimnis. Nicht einmal der exakte Küstenverlauf war bekannt.
War es da verwunderlich, dass ihre Fantasie entflammte, als einer der Feuerländer, ein knochiger alter Mann, der Besatzung der soeben eingetroffenen Beagle ein erstaunliches Geschenk machte? Das Schiff hatte in der Nähe der Wulaiabucht geankert, wo der gute Reverend Richard Matthews in seiner Mission viele Wilde bekehrt hatte und sie in den Grundlagen des Englischen unterrichtete. Der alte Mann, der ihnen das Geschenk überreichte, war der Sprache des Königs nicht mächtig, doch es bedurfte auch keiner Erläuterung.
Die primitive Landkarte, gezeichnet auf einem Stück gebleichter Seehundhaut, stellte die Küste des südlich gelegenen Kontinents dar. Das allein war schon reizvoll genug, doch die Geschichten, welche die Übergabe begleiteten, steigerten ihr Interesse noch mehr.
Einer der Feuerländer – der getauft war und den anglisierten Namen Jemmy Button trug – erläuterte ihnen die Geschichte der Yaghan. Er behauptete, die Stämme lebten hier schon seit siebentausend Jahren, eine erstaunliche Zeitspanne, die ungläubiges Staunen hervorrief. Des Weiteren hob er die nautischen Fähigkeiten seines Volkes hervor, was schon eher glaubhaft schien, da Charles in der Bucht mehrere ihrer größeren Segelschiffe gesehen hatte. Sie waren zwar von primitiver Bauart, aber durchaus seegängig.
Jemmy erklärte, die Karte sei das Ergebnis der mehrtausendjährigen Erkundung des großen Kontinents im Süden, und sie werde von Generation zu Generation weitergereicht und immer wieder verbessert, wenn neue Erkenntnisse über das geheimnisvolle Land hinzukämen. Außerdem erzählte er von großen Tieren und außergewöhnlichen Schätzen, von brennenden Bergen und unendlich viel Eis.
Seine erstaunlichste Behauptung tönte in Charles’ Kopf wider. Er hatte sie in sein Tagebuch eingetragen, und jetzt vernahm er Jemmys Stimme: Zu einer Zeit, die längst den Schatten anheimgefallen ist, hatte sich das Eis von den Tälern und Bergen zurückgezogen – so berichteten unsere Ahnen. Es gab große Wälder und viel jagdbares Wild, doch in der dunklen Tiefe spukten Dämonen, welche die Herzen der Unvorsichtigen verzehrten …
Ein gellender Schrei ertönte an Deck und erschreckte Charles so sehr, dass er Tinte auf der Seite verschmierte. Er verkniff sich einen Fluch, denn die Angst des Rufers war nicht zu überhören gewesen, und erhob sich.
Offenbar waren die letzten Seeleute von der schrecklichen Küste zurückgekehrt.
Er ließ Tagebuch und Feder liegen, stürzte zur Kabinentür und eilte den kurzen Gang entlang und den Niedergang hoch.
»Vorsichtig!«, knurrte FitzRoy. Der Captain stand an der Steuerbordreling; sein Rock war aufgeknöpft, die Wangen über dem angegrauten Bart waren gerötet.
Charles trat aufs Mitteldeck hinaus und blinzelte in die Mittsommersonne. Die bitterkalte Luft schmerzte in Nase und Lunge. Eisnebel hing über dem schwarzen Wasser rund um das vor Anker liegende Schiff, Reling und Segel waren eisverkrustet. Der Atem der Besatzungsmitglieder, die dem Befehl ihres Captains Folge leisteten, dampfte.
Charles eilte nach Steuerbord und half den anderen, ein Besatzungsmitglied von einem Walboot hochzuhieven, das mittschiffs angelegt hatte. Der Verletzte war von Kopf bis Fuß in Segeltuch eingewickelt und wurde an Tauen hochgezogen. Er stöhnte laut. Charles half mit, den armen Kerl über die Reling zu heben und aufs Deck zu legen.
Es war Robert Rensfry, der Bootsmann.
FitzRoy rief nach dem Schiffsarzt, doch der Doktor war unter Deck und kümmerte sich gerade um die beiden Rückkehrer des ersten Landausflugs. Beide würden den nächsten Sonnenaufgang nicht mehr erleben, denn sie hatten furchtbare Verletzungen davongetragen.
Was aber war mit diesem Mann?
Charles kniete neben dem Verletzten nieder. Weitere Seeleute kletterten an Bord. Der letzte war Jemmy Button, aschfahl und aufgebracht. Der Feuerländer hatte sie davor gewarnt hierherzukommen, doch man hatte seine Ängste als Aberglaube abgetan.
»Habt ihr es geschafft?«, fragte FitzRoy seinen Stellvertreter, als er Jemmy an Bord half.
»Aye, Captain. Wir haben alle drei Schwarzpulverfässer am Eingang deponiert.«
»Gut gemacht. Sobald das Walboot gesichert ist, wenden wir die Beagle. Backbordkanonen bereit machen.« FitzRoy richtete den Blick besorgt auf den Verletzten, der vor Charles auf den Decksplanken lag. »Wo bleibt nur der verfluchte Bynoe?«
Wie aufs Stichwort trat Benjamin Bynoe, der hagere Schiffsarzt, aus dem Niedergang und kam herbeigeeilt. Seine Arme waren bis zu den Ellbogen blutverschmiert, auch seine Schürze war beschmutzt.
Charles bemerkte den stummen Blickwechsel zwischen Captain und Arzt. Der Doktor schüttelte zwei Mal den Kopf.
Die anderen beiden Männer waren offenbar gestorben.
Charles richtete sich auf und machte Platz.
»Auspacken!«, befahl Bynoe. »Ich will mir seine Verletzungen ansehen!«
Charles trat an die Reling und stellte sich neben FitzRoy. Der Captain blickte schweigend durchs Fernrohr Richtung Land. Als das Stöhnen des Verletzten lauter wurde, reichte er es Charles.
Er setzte das Fernrohr ans Auge und stellte es auf die Küste scharf. Bläuliche Eiswände rahmten die schmale Bucht ein, in der sie geankert hatten. Dichter Nebel verdeckte die Sicht aufs Ufer, doch es war nicht der Eisnebel, der über dem Meer hing und die umliegenden Eisberge einhüllte. Es war Schwefeldampf, der Brodem der Hölle, der einem Land entstieg, das ebenso wundersam wie monströs war.
Ein Windstoß klärte vorübergehend die Sicht auf einen Schwall von Blut, das von einer Eisklippe herabstürzte. Es teilte sich in mehrere Bäche und Rinnsale auf, die aussahen, als sickerten sie aus der dämonischen Tiefe hervor.
Charles wusste, das war kein Blut, sondern Wasser, das von verschiedenen Stoffen und Mineralien in den Tunneln rot gefärbt wurde.
Trotzdem hätten wir die Warnung beherzigen sollen, dachte er. Wir hätten den unterirdischen Gang nie betreten dürfen.
Er richtete das Fernrohr auf die Höhlenmündung und die drei ölgetränkten Fässer. Trotz all des Grauens, das einem den Verstand zu rauben drohte, war er nach wie vor ein Mann der Wissenschaft, ein Wahrheitssucher, und wenngleich er sich gegen das, was ihnen drohte, hätte auflehnen sollen, hielt er den Mund.
Jemmy trat zu ihnen und flüsterte in seiner Muttersprache heidnische Beschwörungen. Der bekehrte Wilde reichte dem Engländer nur bis an die Brust, doch seine Willenskraft strafte seiner geringen Größe Lügen. Der Feuerländer hatte wiederholt versucht, die Besatzung zu warnen, doch niemand wollte auf ihn hören. Trotzdem hatte der treu ergebene Eingeborene die leichtsinnigen Briten in ihr Verderben begleitet.
Charles legte die Finger um die auf der Reling ruhende dunkle Hand des Mannes. Ihre Hybris und Gier hatten nicht nur unter der Besatzung Opfer gefordert, sondern auch unter Jemmys Stammesgenossen.
Wir hätten niemals hierherkommen dürfen.
Und doch hatten sie es leichtsinnigerweise getan – waren, von den wilden Geschichten über den unbekannten Kontinent verleitet, von der geplanten Route abgewichen und hatten sich nach Süden locken lassen. Die größte Versuchung aber war von einem Symbol ausgegangen, das sie auf der alten Landkarte der Feuerländer vorgefunden hatten. Die Bucht war mit mehreren Bäumen markiert, dem Versprechen von Leben. In der Absicht, den geheimen Garten an dieser Eisküste zu erkunden und das jungfräuliche Land für die Krone zu reklamieren, hatte die Beagle daraufKurs genommen.
Zu spät hatten sie die wahre Bedeutung der Markierung begriffen. Am Ende war die ganze Unternehmung in Grauen und Blutvergießen gemündet, eine Reise, die mit aller Einverständnis aus den Aufzeichnungen getilgt werden würde.
Niemand darf je hierher zurückkehren.
Und für den Fall, dass es doch jemand tat, wollte der Captain dafür sorgen, dass er nichts vorfinden würde. Das, was hier verborgen war, durfte nicht hinaus in die Welt.
Als der Anker eingeholt war, begann das Schiff, sich langsam zu drehen. Das Rigg knackte laut, von den Segeln ging ein Eisschauer nieder. FitzRoy hatte sich bereits entfernt, um nach den Kanonen zu sehen. Die HMSBeagle gehörte zur Königlichen Marine und war eine Slup der Cherokee-Klasse, ursprünglich ausgestattet mit zehn Kanonen. Zwar hatte man das Kriegsschiff zum Expeditionsschiff umgebaut, doch es verfügte noch immer über sechs Kanonen.
Ein Schrei lenkte Charles’ Aufmerksamkeit zurück an Deck, zu dem Mann, der sich auf dem Segeltuch wand.
»Haltet ihn fest!«, rief der Schiffsarzt.
Charles ging hinüber, packte Rensfry bei der Schulter und drückte ihn nieder. Dabei machte er den Fehler, dem Bootsmann in die Augen zu sehen. Schmerz und Flehen lagen darin.
Der Mann bewegte die Lippen. »… macht das raus …«
Der Arzt hatte Rensfrys schwere Jacke geöffnet und schnitt ihm mit dem Messer das Hemd auf. Sein Bauch war blutverschmiert, die Wunde faustgroß. Plötzlich lief eine Art Wellenbewegung durch den Bauch, wie von einer im Sand vergrabenen Schlange.
Rensfry bäumte sich auf und krümmte gequält den Rücken. Ein gepresster Schrei kam aus seinem Mund. Er wiederholte seine Bitte.
»Macht das raus!«
Bynoe zögerte nicht. Er schob die Hand in die Wunde, hinein in den dampfenden Bauch. Der Arm verschwand bis zum Unterarm darin. Trotz der Eiseskälte rollten dem Arzt Schweißtropfen übers Gesicht. Den Arm bis zum Ellbogen in der Wunde versenkt, suchte er umher.
Ein lauter Knall ließ das Schiff erzittern. Noch mehr Raureif regnete auf sie herab.
Dann ein zweiter und ein dritter Knall.
Aus der Ferne, vom Ufer her, ertönte eine noch lautere Antwort.
An beiden Seiten brachen gewaltige Eiswände vom Ufer ab und stürzten ins Meer. Gleichwohl setzten die Bordkanonen ihr Zerstörungswerk fort und feuerten Kartätschen und Kanonenkugeln ab.
Captain FitzRoy wollte kein Risiko eingehen.
»Zu spät«, sagte Bynoe schließlich und zog den Arm aus der Wunde. »Wir sind zu spät gekommen.«
Erst jetzt bemerkte Charles, dass der Bootsmann, den er festhielt, sich nicht mehr regte. Mit toten Augen blickte er in den blauen Himmel auf.
Er setzte sich aufs Deck und rief sich Jemmys Worte über den verfluchten Kontinent in Erinnerung: In der dunklen Tiefe spukten Dämonen, welche die Herzen der Lebenden verzehrten …
»Was sollen wir mit dem Toten machen?«, fragte einer der Seeleute.
Bynoe schaute zur Reling, zum aufgewühlten Eismeer. »Bestattet ihn darin, zusammen mit dem, was sich in ihm befindet.«
Charles hatte genug gesehen. Während das Schiff auf den Wellen schaukelte und die Kanonen donnerten, trat er zurück, als die anderen Rensfrys Leichnam hochhoben. Feige schlich er in seine Kabine, ohne der Wasserbestattung des Bootsmanns beizuwohnen.
Das Feuer im kleinen Ofen war fast erloschen, doch nach der Eiseskälte im Freien fand er es in der Kabine trotzdem stickig. Er ging zum Schreibtisch, riss die Seiten, an denen er gearbeitet hatte, aus dem Tagebuch und warf sie in die Glut. Er schaute zu, wie das Papier sich kräuselte, schwarz färbte und zu Asche wurde.
Erst dann trat er vor den Kartentisch, auf dem noch die Landkarten ausgebreitet waren – darunter auch die alte Karte der Feuerländer. Er nahm sie in die Hand und blickte auf die verfluchten Bäume, mit denen die Bucht markiert war. Sein Blick wanderte zu den Flammen, die frisch aufgelodert waren.
Er tat einen Schritt auf den Ofen zu, dann hielt er inne.
Mit kalten Fingern rollte er die Landkarte zusammen und drückte sie mit beiden Fäusten platt.
Ich bin immer noch Wissenschaftler.
Mit schwerem Herzen wandte er sich vom Feuer ab und versteckte die Karte zwischen seinen persönlichen Habseligkeiten. Ein ganz unwissenschaftlicher Gedanke kam ihm in den Sinn.
Gott steh mir bei …
TEIL 1 DUNKLE GENESIS
1
27. April, 18:55 PDTMono Lake, Kalifornien
»DAS SIEHT JA hier aus wie auf dem Mars.«
Jenna Beck lächelte, als sie diese häufig geäußerte Beschreibung des Mono Lake aus dem Mund eines weiteren Touristen vernahm. Während die letzte Besuchergruppe des Tages noch ein paar Fotos machte, wartete sie neben ihrem weißen Ford-Pick-up F-150, auf dessen Türen der Stern der Ranger des California State Park prangte.
Sie drückte sich die steife Hutkrempe in die Stirn und schaute Richtung Sonne. In einer Stunde würde es dunkel werden, und das schräg einfallende Licht verwandelte den See in einen in Blau- und Grüntönen schimmernden Spiegel. Große Stalagmiten aus zerklüftetem Kalkstein, Tufa genannt, breiteten sich wie ein versteinerter Wald am Südufer des Sees bis ins Wasser hinein aus.
Das Ganze wirkte schon sehr fremdartig – doch der Vergleich mit dem Mars traf es nicht. Sie klatschte sich mit der Hand auf den Arm und zerquetschte eine Mücke, die bewies, dass es in der öden Schönheit des Talkessels noch Leben gab.
Auf das Klatschen hin blickte die andere Fremdenführerin – eine ältere Frau namens Hattie – in ihre Richtung und lächelte mitfühlend, fasste es aber auch als Hinweis auf, ihren Vortrag zu beschleunigen. Hattie war eine eingeborene Kutzadika’a, die dem Volk der nördlichen Paiute angehörten. Sie war Mitte siebzig und wusste mehr über den See und seine Geschichte als jeder andere im Becken.
»Der See«, fuhr Hattie fort, »ist angeblich siebenhundertsechzigtausend Jahre alt, doch einige Wissenschaftler halten es auch für möglich, dass er schon vor drei Millionen Jahren entstanden ist. Damit wäre er einer der ältesten Seen der Vereinigten Staaten. Seine Fläche beträgt hundertachtzig Quadratkilometer, die Tiefe aber nur etwa dreißig Meter. Gespeist wird er von einer Handvoll Bächen und Flüssen, besitzt aber keinen Abfluss und verliert Wasser nur durch die Verdunstung an heißen Sommertagen. Deshalb ist der Salzgehalt drei Mal so hoch wie der des Meeres, und der pH-Wert liegt bei zehn. Damit ist er so alkalisch wie Lauge.«
Ein spanischer Tourist schnitt eine Grimasse und fragte in stockendem Englisch: »Gibt es in dem lago … dem See auch Leben?«
»Keine Fische, falls Sie das meinen, aber Leben gibt es.« Hattie deutete auf Jenna, denn das war ihr Spezialgebiet.
Jenna räusperte sich und schritt durch die Gruppe der Touristen; die Hälfte waren Amerikaner, die anderen kamen aus Europa. Gelegen zwischen dem Yosemite-Nationalpark und den Geisterstädten des historischen Bodie-Nationalparks, lockte der See eine erstaunliche Anzahl von Besuchern an.
»Das Leben findet immer einen Weg, Umweltnischen zu besetzen«, setzte Jenna an. »Der Mono Lake stellt da keine Ausnahme dar. Trotz des lebensfeindlichen hohen Gehalts an Chloriden, Sulfaten und Arsen besitzt er ein komplexes Ökosystem, das wir durch Naturschutzmaßnahmen zu erhalten suchen.«
Jenna kniete am Ufer nieder. »Das Leben im See beginnt mit der Winterblüte einer einzigartigen laugenresistenten Alge. Wäre es jetzt März, würde Ihnen der See wie grüne Erbsensuppe vorkommen.«
»Weshalb ist er jetzt nicht grün?«, fragte ein junger Mann, der seiner Tochter die Hand auf die Schulter gelegt hatte.
»Das liegt an den kleinen Laugengarnelen, die hier leben. Sie sind kaum größer als ein Reiskorn und fressen sämtliche Algen. Dann dienen die Garnelen dem am weitesten verbreiteten Jäger des Sees als Nahrung.«
Im Knien schwenkte sie den Arm über den Boden und scheuchte eine Wolke von Kriebelmücken auf. Sie sirrten empört.
»Gruselig«, sagte ein mürrischer Teenager mit gerötetem Gesicht, der dennoch näher trat, um besser sehen zu können.
»Keine Sorge. Die beißen nicht.« Jenna winkte einen acht- oder neunjährigen Jungen zu sich heran. »Aber sie sind einfallsreiche kleine Jäger. Schau mal.«
Der Junge kam ängstlich näher, gefolgt von seinen Eltern und den anderen Touristen. Jenna klopfte neben sich auf den Boden, und als der Junge sich hingehockt hatte, zeigte sie auf das seichte Wasser. Zahlreiche Mücken wuselten darin umher, eingeschlossen in kleine, silbrige Luftblasen.
»Das sieht so aus, als würden sie tauchen!«, sagte der Junge und grinste breit.
Jenna lächelte, erfreut über das kindliche Erstaunen angesichts dieses kleinen Naturwunders. Das war einer der schönsten Aspekte ihres Berufs: Freude bereiten und Menschen zum Staunen bringen.
»Wie gesagt, das sind einfallsreiche kleine Jäger.« Sie richtete sich auf und machte den anderen Touristen Platz. »Und die Laugengarnelen und Kriebelmücken ernähren wiederum Hunderttausende von Schwalben, Tauchern und Seemöwen, die sich hier angesiedelt haben.« Sie zeigte am Ufer entlang. »Und wenn Sie dorthin schauen, können Sie an der großen Tufa sogar ein Fischadlernest erkennen.«
Als sie zurücktrat, wurde geknipst.
Sie hätte sich noch weiter über die miteinander verwobenen Lebensgemeinschaften des Mono Lake auslassen können. Sie hatte gerade mal an der Oberfläche des außergewöhnlichen Ökosystems des Laugensees gekratzt. Hier gab es alle möglichen seltsamen Spezies und Anpassungen, besonders im Schlamm am Grund des Sees, wo exotische Bakterien unter Bedingungen lebten, die jeder Logik spotteten, in einer giftigen, sauerstofflosen Umgebung, in der es eigentlich kein Leben hätte geben dürfen.
Und doch gab es welches.
Das Leben findet immer einen Weg.
Das war zwar ein Zitat aus Jurassic Park, doch ihr Biologieprofessor an der California Polytechnic State University hatte ihr den gleichen Gedanken eingeimpft. Eigentlich hatte sie den Doktor in Ökologie machen wollen, doch die Arbeit im Park, wo sie aktiv dazu beitragen konnte, das fragile Gewebe des Lebens zu erhalten, das von Jahr zu Jahr immer weiter ausfranste, hatte sie mehr gereizt.
Sie ging zu ihrem Pick-up zurück und wartete auf das Ende der Tour. Hattie würde die Gruppe mit dem Bus nach Lee Vining bringen, und Jenna würde ihr mit dem Wagen folgen. Sie freute sich bereits auf die Spareribs, die im Diner Bodie Mike’s serviert wurden. Durch das offene Wagenfenster leckte ihr eine feuchte Zunge über den Hals. Sie langte hinter sich und kraulte Nikko hinter dem Ohr. Offenbar war sie nicht die Einzige, die Hunger hatte.
»Wir sind hier gleich fertig, Nikko.«
Der klopfende Schwanz gab ihr Antwort. Der vier Jahre alte Sibirische Husky war ihr ständiger Begleiter, ein ausgebildeter Rettungshund. Er streckte die Nase aus dem Fenster, legte ihr den Kopf auf die Schulter und seufzte schwer. Seine Augen – das eine weißblau, das andere nachdenklich braun – waren sehnsuchtsvoll auf die Berge gerichtet. Hattie hatte ihr einmal gesagt, einer Eingeborenenlegende zufolge könnten Hunde mit verschiedenfarbigen Augen Himmel und Erde gleichzeitig sehen.
Ob das stimmte oder nicht, im Moment wirkte Nikkos Blick eher erdverbunden. Als ein Kaninchen über einen mit verdorrtem Gebüsch bestandenen nahen Hang sauste, sprang er auf.
Sie lächelte, als das Kaninchen im Schatten verschwand.
»Ein andermal, Nikko. Beim nächsten Mal erwischst du es.«
Der Husky war zwar ein ausgebildeter Arbeitshund, aber immer noch ein Hund.
Hattie sammelte die Touristen ein und geleitete sie zum Bus. Unterwegs las sie ein paar Nachzügler auf.
»Und die Indianer haben die Mückenlarven tatsächlich gegessen?«, fragte der rothaarige Teenager.
»Wir haben sie Kutsavi genannt. Frauen und Kinder haben die Puppen von den Steinen aufgelesen, in Webkörben gesammelt und später geröstet. Sie gelten immer noch als Spezialität, eine ganz besondere Leckerei.«
Hattie zwinkerte Jenna im Vorbeigehen zu.
Jenna verkniff sich ein Grinsen, als der Junge angewidert das Gesicht verzog. Diese Information zur Verflechtung des Lebens mitzuteilen hatte sie Hattie überlassen.
Während die Touristen in den Bus stiegen, öffnete Jenna die Wagentür und kletterte hinein. Als sie saß, quäkte das Funkgerät.
Nanu?
Sie nahm das Gerät aus der Halterung. »Was gibt es, Bill?«
Bill Howard war der Disponent und ein enger Freund. Bill war Mitte sechzig und hatte sie unter seine Fittiche genommen, als sie im Park angefangen hatte. Das war drei Jahre her. Inzwischen war sie vierundzwanzig und hatte in ihrer Freizeit den Bachelor in Umweltwissenschaften gemacht. Sie waren unterbesetzt und überarbeitet, doch in den drei Jahren hatte sie die Stimmungen des Sees, der Tiere und sogar die ihrer Kollegen lieben gelernt.
»Das weiß ich nicht genau, Jen, aber ich hatte gehofft, du könntest mal eben nach Norden fahren. Ein unvollständiger Notruf wurde an uns weitergeleitet.«
»Erzähl mir mehr.« Die Ranger schützten nicht nur den Park, sondern waren auch vereidigte Polizeibeamte. Ihre Aufgaben umspannten ein weites Feld, angefangen von Verbrechensermittlung bis zur medizinischen Notversorgung.
»Der Anruf kam von außerhalb von Bodie«, erklärte Bill.
Sie runzelte die Stirn. Außerhalb von Bodie gab es nichts, bloß eine Handvoll alte Goldgräberstädte und ein paar aufgegebene Bergwerke. Das hieß, abgesehen von …
»Er kam von der militärischen Forschungseinrichtung«, bestätigte Bill.
Scheiße.
»Worum ging’s?«, fragte sie.
»Ich habe mir die Aufzeichnung angehört. Zu hören war nur Geschrei. Keine einzelnen Worte. Dann brach der Anruf ab.«
»Das kann alles Mögliche bedeuten.«
»So ist es. Vielleicht wurde der Anruf zufällig ausgelöst, aber es sollte doch jemand vorbeischauen und mal nachfragen.«
»Und derjenige bin dann wohl ich.«
»Tony und Kate sind draußen am Yosemite, da gab’s eine Beschwerde wegen ungebührlichen Verhaltens aufgrund von Trunkenheit.«
»In Ordnung, Bill. Ich mach das. Ich melde mich, sobald ich das Tor erreicht habe. Gib mir Bescheid, wenn du mehr erfährst.«
Der Disponent bestätigte und unterbrach die Verbindung.
Jenna wandte sich an Nikko. »Die Rippchen müssen wohl noch warten, großer Bursche.«
19:24
»Beeilung!«
Vier Stockwerke unter der Erde stürmte Dr. Kendall Hess die Treppe hoch, auf den Fersen gefolgt von seiner Systemanalytikerin Irene McIntire. Auf jedem Treppenabsatz blinkten rote Warnleuchten. Eine Sirene gellte.
»Ebene vier und fünf haben wir verloren«, keuchte sie hinter ihm. Auf ihrem tragbaren Biomessgerät behielt sie die Gefahrenlage im Auge.
Die Schreie, die sie verfolgten, waren eigentlich Warnung genug.
»Es ist bestimmt schon in den Atemwegen«, sagte Irene.
»Wie konnte das passieren?«
Seine Frage war rhetorisch gemeint, doch Irene beantwortete sie trotzdem.
»Das ist eigentlich ausgeschlossen, solange kein schwerwiegender Fehler im Labor vorkommt. Aber das habe ich überprüft …«
»Das war kein Laborfehler«, sagte er schärfer als beabsichtigt.
Er ahnte den eigentlichen Grund.
Sabotage.
Zu viele Firewalls – elektronischer und biologischer Natur – hatten versagt. Da musste Absicht dahinterstecken. Jemand hatte das Sicherheitsleck absichtlich hervorgerufen.
»Was sollen wir tun?«, fragte Irene flehentlich.
Es gab nur noch eine Möglichkeit, eine letzte Sicherheitsinstanz: die Bekämpfung des Feuers mit Feuer. Möglicherweise aber würde das mehr Schaden als Nutzen anrichten. Als er einen Moment lang den gedämpften Schreien lauschte, die aus der Tiefe aufstiegen, traf er eine Entscheidung.
Sie hatten die oberste Ebene erreicht. Da sie nicht wussten, was sie erwartete, und weil er Sabotage für wahrscheinlich hielt, fasste er Irene beim Ellbogen und hielt inne. Auf ihrem Handrücken und am Hals bildeten sich bereits Blasen.
»Sie müssen zum Funkgerät gehen. Setzen Sie einen Notruf ab. Für den Fall, dass ich scheitere.«
Oder falls ich die Nerven verliere, Gott steh mir bei.
Sie nickte, versuchte, ihrer Panik Herr zu werden. Was er von ihr verlangte, würde vermutlich ihren Tod zur Folge haben. »Ich werd’s versuchen«, sagte sie mit angstvollem Blick.
Voller Bedauern riss er die Tür auf und versetzte ihr einen Schubs in Richtung Funkraum. »Laufen Sie!«
19:43
Der Wagen bog rumpelnd von der geteerten Straße auf die Schotterpiste ab.
Jenna fuhr schnell und brauchte weniger als zwanzig Minuten für die Strecke vom Mono Lake bis zu dem in einer Höhe von zweitausendvierhundert Metern gelegenen Bodie-Nationalpark. Doch sie wollte nicht zum historischen Park. Ihr Ziel lag noch höher und abgelegener.
Während die Sonne hinter dem Horizont versank, bretterte sie über die dunkle Piste. Kiesel ratterten gegen die Radkästen. Nur wenige Menschen außer den Polizeikräften wussten von der militärischen Forschungsstation. Sie war in kurzer Zeit und unter strenger Geheimhaltung errichtet worden. Das Baumaterial und die Arbeitskräfte hatte man mit Militärhubschraubern herangeschafft, sämtliche Baumaßnahmen waren von Rüstungsfirmen durchgeführt worden.
Trotzdem waren einige Informationen durchgesickert.
Die Einrichtung gehörte zum U. S. Development Test Command, einer Erprobungseinrichtung für militärische Güter, und stand irgendwie mit den Dugway Proving Grounds in Verbindung. Sie hatte die Einrichtung gegoogelt, und was da zu finden war, hatte ihr nicht gefallen. Dugway war zuständig für die Erprobung nuklearer, chemischer und biologischer Waffen. In den Sechzigern des zwanzigsten Jahrhunderts waren Tausende Schafe im näheren Umkreis verendet, nachdem Nervengas ausgetreten war. Seitdem dehnte sich die Einrichtung immer weiter aus. Inzwischen nahm sie eine Fläche von fast viertausend Quadratkilometern ein und war damit doppelt so groß wie Los Angeles.
Weshalb haben sie dann diese neue Einrichtung hier im Nirgendwo gebaut?
Natürlich kursierten Gerüchte. Angeblich nutzten die Militärwissenschaftler die verlassenen Bergwerke, weil es zu gefährlich gewesen wäre, ihre Forschungen in der Nähe einer Großstadt wie Salt Lake City durchzuführen. Es gab auch noch wildere Theorien, wonach hier geheime extraterrestrische Studien durchgeführt wurden – vielleicht deshalb, weil Area 51 inzwischen zur Touristenattraktion geworden war.
Bedauerlicherweise erhielt diese Mutmaßung Nahrung, als eine Gruppe von Wissenschaftlern zum Mono Lake reiste und Proben am Grund des Sees entnahm. Der Gruppe gehörten Astrobiologen der NASA-Abteilung für Raumfahrtwissenschaft und Technologie an.
Wonach sie suchten, war jedoch alles andere als extraterrestrisch gewesen. Vielmehr ausgesprochen terrestrisch. Jenna hatte im Bodie Mike’s eine kurze Unterhaltung mit Dr. Kendall Hess geführt, einem herzlichen, grauhaarigen Biologen. Offenbar kehrte jeder Besucher des Mono Lake mindestens einmal in dem Diner ein. Bei einer Tasse Kaffee erzählte er ihr, die Forschergruppe interessiere sich für Extremophile, jene seltenen Bakterien, die in einer toxischen, lebensfeindlichen Umgebung lebten.
Diese Untersuchungen dienen dazu, die Bedingungen für die Entstehung von Leben auf fremden Welten zu erforschen, hatte er erklärt.
Allerdings hatte sie gespürt, dass er etwas zurückhielt. In seiner Miene hatten sich Vorsicht und Erregung widergespiegelt.
Andererseits war dies nicht die erste geheime Militärstation am Mono Lake. Im Kalten Krieg hatte die Regierung in der Gegend mehrere Einrichtungen für die Waffenerprobung errichtet und verschiedene Forschungsprojekte durchgeführt. Der berühmteste Strand des Sees – Navy Beach – war nach einer Anlage an dessen Südufer benannt.
Was machte ein Geheimlabor mehr da schon aus?
Nachdem sie sich noch ein paar Minuten lang hatte durchrütteln lassen, bemerkte sie einen Zaun, der sich über die Hänge zog. Kurz darauf schwenkten die Scheinwerfer über ein verwittertes, von Kugeln durchsiebtes Schild am Straßenrand.
SACKGASSE
ZUTRITTVERBOTEN
REGIERUNGSEIGENTUM
An dieser Stelle versperrte normalerweise ein Tor die Durchfahrt, doch jetzt stand es offen. Sie bremste argwöhnisch ab und hielt an. Die Sonne war inzwischen hinter den Bergen verschwunden, und Zwielicht hüllte die wogenden Wiesen ein.
»Was meinst du, Nikko? Wenn sie das Tor offen lassen, kann von unbefugtem Zutritt doch keine Rede sein, oder?«
Nikko legte den Kopf schief, die Ohren fragend aufgestellt.
Sie nahm das Funkgerät in die Hand und funkte die Parkverwaltung an. »Bill, ich bin jetzt am Tor.«
»Gibt es Probleme?«
»Kann ich von hier aus nicht erkennen. Aber jemand hat das Tor offen gelassen. Was soll ich tun, was meinst du?«
»In der Zwischenzeit habe ich ein paar Anrufe bei militärischen Einrichtungen gemacht. Zurückgerufen hat niemand.«
»Dann bin ich also auf mich allein gestellt.«
»Wir haben keine Befugnis …«
»Tut mir leid.« Sie drehte den Frequenzschalter hin und her. »Ich versteh dich nicht, Bill.«
Sie schaltete das Gerät ab und drückte es in die Halterung.
»Was ich sagen wollte … wir haben den ganzen weiten Weg zurückgelegt, nicht wahr, Nikko?«
Dann wollen wir mal sehen, was die ganze Aufregung soll.
Sie fuhr los und näherte sich einer Ansammlung beleuchteter Gebäude auf der nächsten Erhebung. Es gab ein paar Wellblechhütten und hastig errichtete Betonbunker. Vermutlich waren die Gebäude nur die Spitze der unterirdischen Pyramide, zumal die Dächer mit Satellitenschüsseln und Antennen gespickt waren.
Nikko knurrte leise, als ein gedämpftes Knattern hörbar wurde.
Sie bremste und schaltete instinktiv die Scheinwerfer aus, denn sie vertraute ihrer eigenen Intuition ebenso sehr wie der ihres Hundes.
Hinter den Wellblechhütten gelangte ein kleiner schwarzer Helikopter in Sicht, der so hoch stieg, dass er die letzten Sonnenstrahlen auffing. Sie hielt den Atem an und hoffte, dass die Besatzung von der Sonne zu sehr geblendet würde, um sie im Schatten auszumachen. Was ihr die Nackenhaare sträubte, war der Umstand, dass der Vogel keinerlei Kennzeichnung aufwies. Er war raubvogelhaft schlank und sah nicht nach Militär aus.
Als der Helikopter sich entfernte, über die Hügel schwenkte und davonflog, atmete sie auf.
Das Krächzen des Funkgeräts ließ sie zusammenzucken. Sie nahm es aus der Halterung.
»Jenna!«, sagte Bill aufgeregt. »Bist du auf dem Rückweg?«
Sie seufzte. »Noch nicht. Ich dachte, ich warte erst mal ab, ob mir jemand am Tor Hallo sagt.«
Das war gelogen, aber besser als die Wahrheit.
»Dann mach, dass du von dort verschwindest!«
»Weshalb?«
»Ich habe gerade einen Anruf reinbekommen, der vom Militär weitergeleitet wurde. Von jemandem auf dem Gelände. Hör zu …« Nach einer kurzen Pause hörte sie die leise Stimme einer Frau, die offenbar in Panik war. »Hier spricht Sierra, Victor, Whiskey. Es gibt einen Ausbruch. Notfallmaßnahmen sind eingeleitet. Egal was passiert: Tötet uns … tötet uns alle.«
Jenna blickte zu den Gebäuden hinüber – als die Hügelkuppe auf einmal eine Wolke aus Feuer und Rauch ausstieß. Der Boden bebte, der Wagen wurde durchgerüttelt.
Oh Gott …
Sie schluckte mühsam, damit sie wieder Luft bekam, dann legte sie den Rückwärtsgang ein und gab Gas.
Eine Rauchwand wogte ihr hinterher.
Sie ahnte, dass sie auf keinen Fall mit der Wolke in Berührung kommen durfte. Sie dachte an die Schafe, die in der Nähe von Dugway umgekommen waren. Ihre Bedenken erwiesen sich als berechtigt, als ein Kaninchen aus der Rauchwand hervorkam. Nach ein paar Sätzen fiel es unter Krämpfen auf die Seite.
»Achtung, Nikko!«
Im Rückwärtsgang war sie nicht schnell genug, deshalb schleuderte sie herum, dass der Kies spritzte – dann bretterte sie durchs offene Tor. Im Rückspiegel sah sie die herandrängende Wolke.
Etwas Schwarzes klatschte gegen die Motorhaube. Ihr stockte der Atem.
Eine Krähe.
Die pechschwarzen Flügel flatterten, dann rutschte der Vogel von der Haube.
Nikko winselte.
Ihr war auch danach, doch im Geiste hörte sie noch immer die letzten Worte der bedauernswerten Frau.
Tötet uns … tötet uns alle …
2
27. April, 20:05 PDTSanta Barbara, Kalifornien
ICH BIN EIN Glückspilz …
Painter Crowe sah zu seiner Verlobten, die sich als Silhouette vor dem verblassenden Glanz des Sonnenuntergangs über dem Pazifik abhob. Sie stand am Rand eines Felsvorsprungs oberhalb des Sandstrands und blickte zu Rincon Point hinüber, wo noch ein paar Surfer den letzten Wellen des Tages trotzten. Vom Strand tönte das Geschrei der Seehunde herauf, die hier, abseits der Touristen, die Brutsaison zubrachten.
Lisa Cummings, seine Verlobte, betrachtete die Landschaft durch ein Fernglas. Von seinem Standpunkt aus schaute Painter wiederum sie an. Sie trug einen gelben Bikini und hatte sich ein dünnes Baumwolltuch um die Hüfte gewickelt. Ihre knappe Bekleidung erlaubte es ihm, die Wölbung ihres Pos, den Schwung der Hüfte und ihre langen Beine zu bewundern.
Aus seiner Sicht gab es nur eine Schlussfolgerung: Ich bin der glücklichste Mann der ganzen Welt.
Lisa unterbrach seiner Träumereien, indem sie in die Tiefe zeigte. »An diesem Strand habe ich für meine Doktorarbeit geforscht. Ich habe die physiologischen Tauchvoraussetzungen der Seehunde untersucht. Du hättest mal die Jungen sehen sollen … so süß. Ich habe wochenlang die Alten mit Blutsauerstoffmessgeräten ausgestattet, um ihre Anpassung ans Meerestauchen zu untersuchen. Und die Folgerungen, die sich daraus für die menschliche Atmung, die Sauerstoffsättigung des Bluts und die Ausdauer ergaben …«
Painter trat neben sie und legte ihr einen Arm um die Hüfte. »Wir könnten im Hotel auch eigene Untersuchungen zum Thema Ausdauer durchführen.«
Sie senkte das Fernglas und lächelte ihn an, streifte sich mit dem kleinen Finger ein paar blonde Strähnen aus dem Gesicht und hob eine Braue. »Ich finde, wir haben schon eine Menge Untersuchungen angestellt.«
»Man kann nie gründlich genug sein.«
Sie wandte sich um, schmiegte sich an ihn. »Vielleicht hast du ja recht.« Sie küsste ihn auf die Lippen und verweilte einen Moment, dann löste sie sich von ihm. »Aber es ist schon spät, und in einer Stunde treffen wir den Caterer und besprechen das Menü des Probedinners.«
Sie seufzte schwer und beobachtete, wie die Sonne versank. Die Hochzeit sollte in vier Tagen stattfinden. Es würde eine kleine Feier am Strand werden, mit den engsten Freunden und der Familie, anschließend sollte es einen Empfang im Four Seasons Resort The Biltmore in Montecito geben. Doch je näher der große Tag kam, desto länger wurde die Aufgabenliste. Um dem Chaos für ein paar Stunden zu entgehen, hatten sie einen Abendspaziergang entlang der Carpenteria-Klippen unternommen und waren über die Wiesen gewandert, auf denen vereinzelte Eukalyptusbäume standen.
In solchen Momenten hatte Painter Gelegenheit, sich mit Lisas Kindheit und ihren Wurzeln im Westen vertraut zu machen. Er wusste bereits, dass sie in Südkalifornien aufgewachsen war und ihren Abschluss an der UCLA in Los Angeles gemacht hatte, aber sie in ihrem ureigenen Element zu erleben – sich erinnernd, Geschichten erzählend, im Sonnenschein schwelgend –, vertiefte seine Liebe.
Wie sollte es auch anders sein?
Angefangen von ihrem langen blonden Haar bis zu der glatten Haut, die schon bei der leisesten Berührung mit den Strahlen der Sonne einen Bronzeton annahm, war sie das Sinnbild des Golden State. Gleichwohl wäre es vermessen gewesen zu glauben, ihre Vorzüge beschränkten sich allein auf ihr gutes Aussehen. Hinter ihrer Schönheit verbarg sich ein überlegener Verstand. Sie hatte nicht nur ihr Medizinstudium an der UCLA als Jahrgangsbeste abgeschlossen, sondern auch einen Doktor in Humanphysiologie.
Wegen ihrer Verbindungen zum Westen hatten sie entschieden, in Santa Barbara zu heiraten. Zwar waren sie inzwischen an der Ostküste zu Hause – in Washington, D. C. –, doch die meisten von Lisas Freunden und Angehörigen lebten hier. Deshalb war es logisch gewesen, die Feier hierherzuverlegen, zumal Painter eigentlich keine Familie hatte. Er hatte seine Eltern schon in jungen Jahren verloren und sich vom indianischen Zweig seiner Familie weitgehend distanziert; seine einzige Blutsverwandte war eine ferne Nichte, die in Brigham Young in Utah zur Schule ging.
Somit mussten nur wenige Gäste den weiten Flug quer übers Land unternehmen, namentlich Painters engste Mitarbeiter von der Sigma Force. Nicht dass die weite Reise keine Unannehmlichkeit für sie bedeutet hätte. Der Vater von Grayson Pierce, dem Einsatzleiter des Teams, entglitt immer weiter in den geistigen Nebel der Alzheimererkrankung, und …
»Habe ich dir schon erzählt, dass ich heute Morgen mit Kat gesprochen habe?«, fragte Lisa, als habe sie seine Gedanken gelesen.
Er schüttelte den Kopf.
»Sie hat jemanden gefunden, der auf die Mädchen aufpasst. Du hättest mal hören sollen, wie erleichtert sie geklungen hat. Ich glaube, ein so weiter Flug mit zwei kleinen Kindern wäre eine große Belastung für sie gewesen.«
Er grinste, als sie entlang der dunklen Klippen den Rückweg antraten. »Ich schätze, Kat und Monk können beide einen kleinen Urlaub von Windeln und Nachtfütterungen gebrauchen.«
Kathryn Bryant war Sigmas Geheimdienstexpertin und Painters Stellvertreterin. Monk Kokkalis, ihr Mann, war ebenfalls bei Sigma angestellt und hatte eine Ausbildung in Rechtsmedizin und Biotechnologie absolviert.
»Wo wir gerade von Windeln und Mitternachtsfläschchen sprechen …« Lisa lehnte sich an ihn und verschränkte die Finger mit seiner Hand. »Vielleicht werden wir bald ähnliche Klagen anstimmen.«
»Schon möglich.«
Ihrem leisen Seufzer entnahm er, dass sie sein Zögern bemerkt hatte. Natürlich hatten sie schon über Kinder und die Gründung einer Familie gesprochen. Aber Träumen war manchmal etwas anderes als die Konfrontation mit der Realität.
Sie entzog ihm ihre Hand. »Painter …«
Der durchdringende Klingelton seines Handys bewahrte ihn davor, sich erklären zu müssen – was ihm ganz recht war, denn er konnte sich seine Zurückhaltung selbst nicht erklären. Er spannte sich an. Lisa erhob keine Einwände, als er den Anruf entgegennahm, denn sie wusste, dass dieser spezielle Klingelton Notfällen vorbehalten war.
Painter drückte sich das Handy ans Ohr. »Crowe.«
»Direktor.« Es war Kat Bryant. »Wir haben ein Problem.«
Wenn seine Stellvertreterin ihn zu diesem Zeitpunkt anrief, musste es sich um ein großes Problem handeln. Andererseits, wann wäre es bei Sigma jemals um kleine Probleme gegangen? Als geheimer Ableger der DARPA – der Forschungsagentur des Verteidigungsministeriums – befasste die Sigma Force sich mit globalen Bedrohungen wissenschaftlicher oder technologischer Art. Als Direktor der Einrichtung hatte Painter eine Gruppe von Soldaten der Spezialkräfte aus unterschiedlichen Bereichen um sich geschart und in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen ausbilden lassen, um sie für den Dienst bei der DARPA tauglich zu machen. Wenn Sigma ein Problem in den Schoß fiel, handelte es sich selten um eine Kleinigkeit.
Normalerweise machte ihn ein solcher Anruf nervös, doch diesmal verspürte er eine gewisse Erleichterung und war geradezu dankbar für die Ablenkung. Wenn ich noch ein Stück Hochzeitskuchen probieren oder mich für eine bestimmte Tischdekoration beim Empfang entscheiden muss …
»Was ist los?«, fragte er Kat und wappnete sich für die Antwort.
20:09
»Nein, nein, nein!«
Jenna trat auf die Bremse und wurde in den Sicherheitsgurt gedrückt. Neben ihr rutschte Nikko auf den Boden. Während der Husky wieder auf den Sitz sprang, blickte sie in den Rückspiegel.
Hinter ihr wogte schwarzer Qualm vom Hochland herunter. Sie musste ihn hinter sich lassen, doch vor ihr beschrieb die Straße eine scharfe Kehre und führte in Serpentinen zum fernen Mono Lake hinunter. Auf diesem Weg würde sie dem giftigen Rauch erneut näher kommen. Sie drehte sich auf dem Sitz herum und folgte der Straße mit dem Blick. Tatsächlich führte sie wieder in die schwarze Rauchwolke hinein.
Trotz der Abendkühle wischte sie sich Schweiß von der Stirn.
Nikko schaute sie an; er vertraute darauf, dass es ihr gelingen würde, sie beide in Sicherheit zu bringen.
Doch wohin sollte sie sich wenden?
Sie schaltete das Fernlicht ein und musterte die Kehre. Eine schwach erkennbare Reifenspur führte von der Schotterpiste weg und hinaus ins Gelände, das mit Salbei und Pinyon-Kiefern bestanden war. Sie hatte keine Ahnung, wohin die Reifenspur führte. Vermutlich legten Touristen und einheimische Teenager häufig illegale Wege an, kampierten in den umliegenden Canyons oder machten ein Lagerfeuer am Ufer eines Flusses. In ihrer Eigenschaft als Park Ranger hatte sie weiß Gott schon einige von ihnen verjagt.
Da sie keine Wahl hatte, gab sie Gas und fuhr zur Kehre. Der Wagen rumpelte über die Böschung und bog auf den schmalen Pfad ein. Sie fuhr so schnell, dass sämtliche Schrauben und Bolzen des Ford klapperten. Nikko hechelte und schaute mit geweiteten Augen umher.
»Festhalten, Kumpel.«
Das Gelände wurde immer unebener, und sie musste etwas Gas wegnehmen. Sie durfte es nicht riskieren, dass eine Achse brach oder dass an einem der scharfen Steine ein Reifen aufgeschlitzt wurde. Immer wieder blickte sie in den Rückspiegel. Hinter ihr hatte die Rauchwolke den Mond verschluckt.
Vor lauter Angst hielt sie die Luft an.
Der Weg stieg an zu einer weiteren Hügelkuppe. Inzwischen kam sie nur noch im Schritttempo voran. Sie verfluchte ihr Pech und überlegte, vom Weg abzuweichen, doch das Gelände war felsiger geworden. Es sah nirgendwo besser aus als hier auf dem Weg.
Entschlossen gab sie mehr Gas und ging an die Grenzen des Vierradantriebs. Nach einer Weile wurde das Gelände wieder eben. Sie nutzte die Gelegenheit, folgte in waghalsigem Tempo einer engen Kurve und wich einem Felsen aus – dann erfassten die Scheinwerfer einen Erdrutsch, der den Weg blockierte.
Sie bremste heftig, doch der Wagen geriet auf dem Sand und Gestein ins Rutschen. Die Stoßstange rammte einen Felsen. Der Airbag blies sich auf und prallte ihr ins Gesicht wie ein Sack Zement. Obwohl ihr der Schädel dröhnte, hörte sie, wie der Motor stotternd ausging.
Tränen schossen ihr in die Augen, sie schmeckte Blut. »Nikko …«
Der Husky saß noch auf dem Sitz und wirkte unverletzt.
»Los, komm!«
Sie drückte die Tür auf und plumpste auf den Boden. Mit zitternden Beinen richtete sie sich auf. Es roch nach verbranntem Öl.
Ist es bereits zu spät?
Sie blickte zur Rauchwolke und dachte an das Kaninchen, das unter Krämpfen verendet war. Schwankend machte sie ein paar Schritte, doch das war keine Folge einer Vergiftung. Ich bin bloß benommen. Jedenfalls hoffte sie das.
»Einfach weitergehen«, befahl sie sich.
Nikko tänzelte umher und wedelte entschlossen mit dem Schwanz.
Hinter ihnen hatte sich die Rauchwolke stellenweise ausgedünnt. Trotzdem kam sie wie eine Flutwelle immer noch näher. Zu Fuß würde sie ihr nicht entkommen können.
Sie schaute zur Hügelkuppe hoch.
Ihre einzige Hoffnung.
Sie holte eine Taschenlampe aus dem Wagen und machte sich auf den Weg. Sie kletterte über den Erdrutsch und rief Nikko mit einem Pfiff zu sich. Hinter dem Gesteinsabgang lag eine wellige Wiese, bestanden mit Purshia und stacheligem Phlox. Hier kam sie schneller voran. Sie lief zur Hügelkuppe hoch und folgte dem tanzenden Lichtkegel ihrer Taschenlampe.
Aber war die Erhebung auch hoch genug?
Keuchend stürmte sie den Hang hinauf. Nikko lief neben ihr her, ohne sich von den auffliegenden brütenden Beifußammern und einem Kaninchen mit schwarzer Blume ablenken zu lassen.
Endlich hatten sie die Kuppe erreicht. Erst jetzt wagte sie, sich umzusehen. Die Rauchwolke brach sich am Hügel und wanderte nach außen, füllte die umliegenden tiefer gelegenen Täler aus und verwandelte die Hügelkuppe in eine Insel inmitten eines vergifteten Meers.
Doch wie lange würde es hier noch sicher sein?
Sie entfernte sich weiter vom tödlichen Ufer und zog sich zur höchsten Stelle zurück. Dort zeichneten sich vor dem Sternenhimmel kantige Silhouetten ab, die Überreste einer Geisterstadt. Sie zählte etwa ein Dutzend Scheunen und Gebäude. Vorposten aus der Zeit des Goldrauschs wie diesen gab es viele in den umliegenden Bergen, die meisten vergessen und auf keiner Landkarte verzeichnet – mit Ausnahme der Geisterstadt Bodie, der Hauptattraktion des Bodie-Nationalparks.
Trotzdem lief sie erleichtert darauf zu, ermutigt von den trotzig aufragenden Wänden und Dächern. Als sie sich dem ersten Gebäude näherte, holte sie das Handy aus der Tasche – vielleicht bekam sie hier eine Netzverbindung. Da das Funkgerät des Wagens im giftigen Meer zurückgeblieben war, stellte das Handy ihr einziges Kommunikationsmittel dar.
Mit großer Erleichterung registrierte sie den einzelnen leuchtenden Signalbalken.
Nicht gerade berauschend, aber ich will mich nicht beklagen.
Sie wählte die Nummer des Büros. Kurz darauf meldete sich der atemlose Bill Howard.
Die Verbindung war zwar schlecht, doch die Erleichterung war ihrem Freund deutlich anzuhören. »Jen, bist du o…ay?«
»Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber unverletzt.«
»Was … angeschlagen?«
Sie überging ihre Verärgerung über den schlechten Empfang und bemühte sich, lauter zu sprechen. »Hör zu, Bill. Da ist was unterwegs zu dir.«
Sie berichtete ihm von der Explosion, doch die ständigen Aussetzer machten es ihr nicht leicht.
»Du musst Lee Vining evakuieren!«, schrie sie. »Und die umliegenden Campingplätze.«
»Hab ich nicht … den. Was war mit der Evakuierung?«
Sie kniff verzweifelt die Augen zu und atmete mehrmals tief durch.
Vielleicht bekomme ich ein besseres Signal, wenn ich auf eine Scheune klettere.
Ehe sie sich eine Vorgehensweise zurechtlegen konnte, vernahm sie ein leises Klopfen. Zunächst glaubte sie, der eigene Herzschlag dröhne ihr in den Ohren. Dann winselte Nikko; er hatte das Geräusch ebenfalls gehört. Als es lauter wurde, musterte sie den Himmel und sah Navigationslichter aufleuchten.
Ein Helikopter.
Bills Rettungsteam konnte das nicht sein, das würde noch einige Zeit brauchen. Voll böser Vorahnungen schaltete sie die Taschenlampe aus und lief auf die Geisterstadt zu. Als sie eine alte Scheune erreichte, gelangte der Helikopter in Sicht.
Es war derselbe schlanke schwarze Vogel, der kurz vor der Explosion von der Militärbasis gestartet war.
Haben sie gesehen, wie ich mit dem Wagen von der Unglückszone geflohen bin, und sind umgekehrt? Aber warum?
Geduckt lief sie zum offenen Tor, betrat zusammen mit Nikko die dunkle Scheune und warf einen Blick auf ihr Handy.
Die Verbindung zu Bill war abgebrochen, es wurden keine Empfangsbalken angezeigt.
Sie war abgeschnitten, auf sich allein gestellt.
An der anderen Seite der Scheune spähte sie vorsichtig durch eine geborstene Fensterscheibe. Der Helikopter senkte sich auf eine Wiese herab. Als die Kufen aufgesetzt hatten, sprangen an beiden Seiten Männer in schwarzen Uniformen heraus. Der Rotorschwall peitschte das Gebüsch.
Das Herz schlug ihr bis zum Hals, als sie die geschulterten Gewehre bemerkte.
Das war kein Rettungsteam.
Sie berührte ihre einzige Waffe, die im Gürtelholster steckte. Ein Taser. Den Rangern war das Tragen von Schusswaffen zwar erlaubt, wurde bei Touristenführungen aber nicht gern gesehen.
Nikko knurrte, beunruhigt durch den Lärm.
Sie befahl ihm, still zu sein. Ihr Überleben hing davon ab, dass sie nicht entdeckt wurden.
Sie duckte sich noch mehr, als der letzte Mann – ein wahrer Hüne – aus dem Helikopter sprang und sich ein paar Schritte weit entfernte. Er hatte eine Waffe mit sehr langem Lauf dabei. Sie überlegte, was das sein könnte – dann schoss ein Feuerstrahl aus der Mündung und setzte die Wiese in Brand.
Ein Flammenwerfer.
Sie brauchte einen Moment, um sich über den Sinn der Waffe klar zu werden. Dann krampfte sie die Finger um die Fensterbank und ließ den Blick über die trockenen, verzogenen Holzbretter schweifen.
Die Bewaffneten verteilten sich und schickten sich an, die kleine Ansammlung von Gebäuden zu umstellen.
Sie wissen, dass ich hier bin, dass ich mich irgendwo in der Geisterstadt versteckt halte.
Ihr Plan war offensichtlich. Die Männer wollten sie mit Feuer aus der Deckung treiben.
Hinter ihnen umwogte das giftige Meer die Hügelkuppe. Es gab kein Entkommen von der Insel. Sie hockte sich auf die Fersen und ging im Geiste die sich bietenden Optionen durch. Sicher war nur eines.
Ich werde das hier nicht überleben.
Das hieß aber nicht, dass sie aufhören würde, ein Ranger zu sein. Sie würde einen Hinweis hinterlassen, der Aufschluss über ihr Schicksal geben würde.
Nikko setzte sich neben sie.
Sie umarmte ihn, vermutlich zum letzten Mal. »Du musst mir noch einen Gefallen tun, Kumpel«, flüsterte sie ihm ins Ohr.
Er wedelte mit dem Schwanz.
»Braver Junge.«
3
27. April, 23:10 EDTTakoma Park, Maryland
EIN ÄRGERNIS KOMMT selten allein …
Gray Pierce bretterte mit seinem Motorrad über die nasse Vorortstraße. Die ganze vergangene Woche über hatte es ordentlich geregnet. Die Kanalisation war überlastet, und am Straßenrand hatten sich tückische Pfützen gebildet. Der Scheinwerferkegel durchdrang den Vorhang aus dicken Regentropfen, als er sich seinem Elternhaus näherte.
Der Craftsman-Bungalow lag in der Mitte des nächsten Straßenblocks. Alle Fenster waren erleuchtet, das Licht fiel auf die umlaufende Veranda und die Schaukel, die reglos an der Kette hing. Das Haus sah aus wie immer; man sah ihm das darin verborgene Chaos nicht an.
An der Einfahrt legte er sich mit seinen ein Meter achtzig in die Kurve und fuhr zur hinter dem Haus gelegenen Garage weiter. Lautes Gebrüll übertönte das Grollen der Yamaha V-Max.
Als er den Motor abgestellt hatte, tauchte eine Gestalt im Regen auf. Es war sein jüngerer Bruder Kenny. Mit seiner rötlichen Waliser Gesichtsfarbe war er ein typischer Vertreter ihrer Familie.
Damit erschöpften sich die Gemeinsamkeiten auch schon.
Gray nahm den Helm ab, stieg vom Bike und stellte sich dem Zorn seines Bruders. Sie waren etwa gleich groß. Kenny hatte einen Bierbauch, den er sich in den vergangenen zehn Jahren bei seiner Schreibtischtätigkeit als Softwareentwickler in Kalifornien zugelegt hatte. Damals hatte er ein Alkoholproblem gehabt. Vor Kurzem hatte Kenny sich eine Auszeit genommen, um ihrem Vater zu helfen. Trotzdem drohte er fast jede Woche damit, wieder an die Westküste zurückzukehren.
»Ich halte das nicht mehr aus«, sagte Kenny und ballte die Hände zu Fäusten, das Gesicht flammend rot vor Wut. »Du musst ihn wieder zur Vernunft bringen.«
»Wo ist er?«
Kenny zeigte zum Hof, gereizt und verlegen.
»Was macht er hier draußen im Regen?« Gray wandte sich zum Haus.
»Sag du’s mir.«
Gray hatte den Hof erreicht. Die Lampe über der Küchentür war nicht besonders stark, trotzdem bemerkte er gleich den hochgewachsenen Mann, der bei den Oleanderbüschen am Zaun stand. Gray hielt inne und versuchte zu begreifen, was er da sah.
Sein Vater war bis auf die schlotternden, durchnässten Boxershorts nackt. Die dünnen Arme hatte er erhoben und das Gesicht dem Regen zugewandt, als betete er zu einem Regengott. Dann klappte er die Arme vor den Büschen zusammen.
»Er glaubt, er würde den Oleander schneiden«, erklärte Kenny, der sich inzwischen ein wenig beruhigt hatte. »Vorher ist er in der Küche umhergewandert. Das ist schon das zweite Mal diese Woche. Aber diesmal hab ich ihn nicht wieder ins Bett gekriegt. Du weißt ja, wie stur er schon vorher war … bevor das anfing.«
Alzheimer.
Kenny vermied das Wort, so als könnte er sich anstecken, wenn er es aussprach.
»Deshalb habe ich dich angerufen«, sagte Kenny. »Auf dich hört er.«
»Das wäre mir neu«, brummte Gray.
Ihre Beziehung war schon immer turbulent gewesen. Sein Vater war in der texanischen Ölindustrie beschäftigt gewesen, er war ein zupackender Mann, für den Unabhängigkeit einen hohen Stellenwert hatte. Das hieß, bis ihm bei einem Unfall am Bohrloch das eine Bein am Knie abgetrennt wurde. Anschließend versank er in Verbitterung und Zorn. Einen Großteil davon wandte er gegen seinen ältesten Sohn. Schließlich hatte Gray sich zur Army geflüchtet und war bei Sigma gelandet.
Jetzt versuchte Gray, den wütenden, harten Mann in dieser zerbrechlichen Gestalt auf dem Hof wiederzuerkennen. Er betrachtete die hervorstehenden Rippen, die erschlaffte Haut, das sich abzeichnende Rückgrat. Das war nicht einmal mehr ein Schatten des früheren Selbst seines Vaters. Das war eine Hülle, von Alter und Krankheit gezeichnet.
Gray näherte sich seinem Vater und berührte ihn sanft an der Schulter. »Dad, es reicht.«
Die Augen, die ihn musterten, wirkten erstaunlich wach. Bedauerlicherweise zeichnete sich der alte Zorn darin ab. »Die Büsche müssen zurückgeschnitten werden. Die Nachbarn beschweren sich bereits. Deine Mutter …«
Ist tot.
Gray verdrängte sein Schuldgefühl und verstärkte seinen Griff. »Ich erledige das, Dad.«
»Was ist mit der Schule?«
Gray hatte Mühe, den Zeitsprüngen des alten Mannes zu folgen, doch dann erwiderte er geistesgegenwärtig: »Ich erledige das nach der Schule. Versprochen.«
Der Blick seines Vaters wurde stumpf. »Aber halt dich dran, mein Junge. Ein Mann taugt nur so viel wie seine Versprechen.«
»Ich mach’s. Ganz bestimmt.«
Gray geleitete ihn zur rückwärtigen Veranda und in die Küche. Die Bewegung, die Wärme und das helle Licht halfen seinem Vater anscheinend, sich wieder zu orientieren.
»G-Gray, was machst du hier?«, fragte er mit rauer Stimme, als bemerke er ihn erst jetzt.
»Bin mal vorbeigekommen, um nach dir zu sehen.«
Mit magerer Hand klopfte sein Vater ihm auf den Arm. »Lust auf ein Bier?«
»Ein andermal. Ich muss zurück zu Sigma. Die Pflicht ruft.«
Was der Wahrheit entsprach. Kat hatte unterwegs angerufen und ihn gebeten, sich mit ihr in der Sigma-Zentrale zu treffen. Er hatte ihr das Problem mit seinem Vater geschildert, und sie hatte ihm etwas Zeit gelassen. Doch ihm war nicht entgangen, dass es dringend war, und er wollte sie nicht hängenlassen.
Er blickte Kenny an.
»Ich bringe ihn ins Bett«, sagte sein Bruder. »Nach diesen Episoden schläft er für gewöhnlich durch.«
Gut.
»Aber, Gray, das ist noch nicht vorbei.« Kenny senkte die Stimme. »Ich kann das nicht jede Nacht machen. Ich habe heute mit Mary darüber gesprochen.«
Es ärgerte Gray, dass man ihn bei der Unterhaltung außen vor gelassen hatte. Mary Benning war die Krankenschwester, die ihren Vater tagsüber versorgte. Nachts kümmerte sich meistens Kenny um ihn, und Gray sprang ein, wann immer es ihm möglich war.
»Was hat sie gesagt?«
»Wir brauchen Rund-um-die-Uhr-Versorgung und Schutzvorrichtungen. Türalarm. Sperrgitter an den Treppen. Oder …«
»Oder wir bringen ihn ins Heim.«
Kenny nickte.
Aber das hier ist sein Zuhause.
Kenny bemerkte seinen Widerwillen. »Wir müssen uns nicht gleich entscheiden. Mary hat mir die Nummern von ein paar Krankenschwestern gegeben, die eine Zeit lang die Nachtschicht übernehmen würden. Ich glaube, wir könnten beide eine Pause gebrauchen.«
»Okay.«
»Ich veranlasse das«, sagte Kenny.
Gray fragte sich, ob der plötzliche Einfallsreichtum seines Bruders nicht dem Wunsch entsprang, ihren Vater loszuwerden und sich nach Kalifornien zurückzuziehen. Anderseits hatte sein Bruder vermutlich recht. Irgendetwas musste geschehen.
Als Kenny ihren Vater die Treppe hoch und ins Schlafzimmer geleitete, holte Gray das Handy hervor und wählte die Nummer von Sigma. Kat meldete sich fast unverzüglich.
»Ich bin jetzt unterwegs.«
»Beeil dich. Die Lage verschlimmert sich.«
Gray blickte zur Treppe.
Das kann man wohl sagen.
23:33
Gejagt von Gespenstern und angetrieben von Kats dringlichem Anruf, brachte Gray die Yamaha auf den leeren Straßen an ihr Limit. Eine Viertelstunde später hatte er die Sigma-Zentrale erreicht. Er hätte sich auch entschuldigen können, doch in seiner Wohnung warteten Sorgen auf ihn. Selbst sein Bett war im Moment kalt und leer, denn Seichan weilte noch in Hongkong und half ihrer Mutter bei einem Projekt zur Unterstützung mittelloser Mädchen in Südostasien.
Deshalb brauchte er im Moment Ablenkung.
Als sich die Fahrstuhltür auf einer der unterirdischen Ebenen von Sigma öffnete, trat Gray auf den Flur hinaus. Die Einrichtung war in Bunkern und Schutzräumen aus dem Zweiten Weltkrieg unterhalb des Smithsonian Castle untergebracht. Die versteckte Lage am Rand der National Mall bot den Sigma-Angehörigen leichten Zugang zu den Hallen der Macht und zu den zahlreichen Labors und Forschungseinrichtungen der Smithsonian Institution.
Gray wandte sich zum Nervenzentrum Sigmas – und zum führenden Kopf, der für die Informationsbeschaffung und das Kommunikationsnetz verantwortlich war.