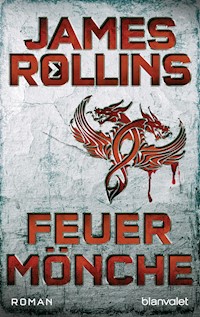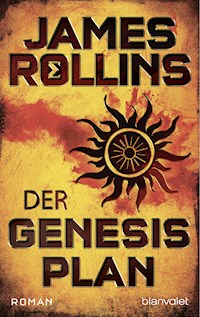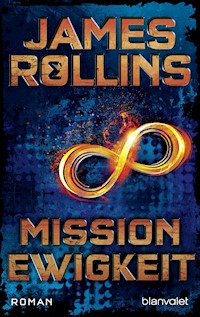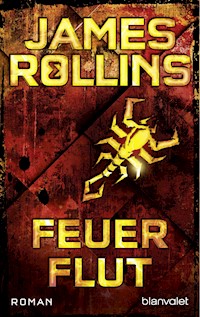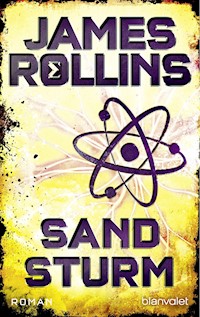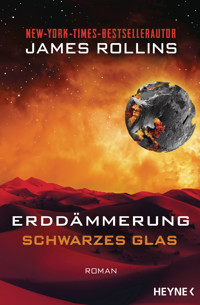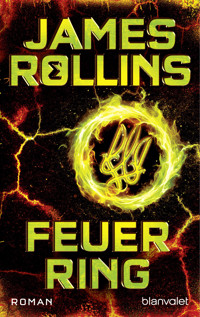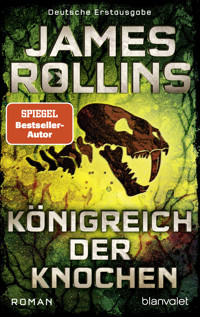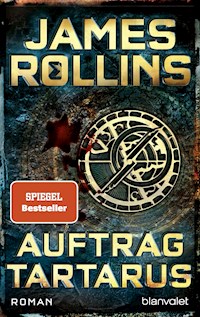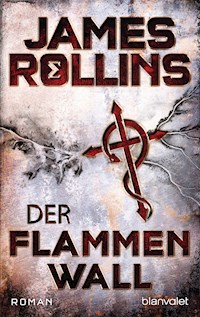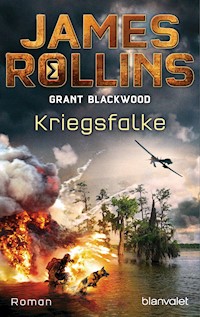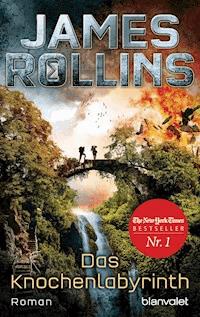
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: SIGMA Force
- Sprache: Deutsch
Ein uralter Feind der Menschheit kehrt zurück!
In Kroatien werden Höhlenmalereien entdeckt, auf denen Menschen gegen riesige schattenhafte Kreaturen kämpfen. Doch bevor sich die Archäologen näher damit beschäftigen können, wird ihr Camp angegriffen. Zeitgleich wird eine Primaten-Forschungsstation in der Nähe von Atlanta überfallen. Die Suche nach den Zusammenhängen führt Commander Grayson Pierce von der Sigma Force 50.000 Jahre in die Vergangenheit und einmal rund um die Erde – bis zu einer uralten Stadt der Toten: dem Knochenlabyrinth!
Verpassen Sie nicht die weiteren in sich abgeschlossenen Romane über die Topagenten der Sigma Force!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
In einem Höhlensystem in den kroatischen Bergen stößt ein Archäologe auf eine christliche Kapelle mit den Gebeinen einer Neandertalerin. In der Nähe finden sich Höhlenmalereien, die vom Kampf der Neandertaler gegen monströse Schattengestalten berichten. Bevor das Geheimnis der Höhlen untersucht werden kann, wird das Erkundungsteam überfallen. Das Höhlensystem wird gesprengt und die amerikanische Forscherin Lena Crandall entführt, während zeitgleich ein Primatenforschungszentrum in der Nähe von Atlanta angegriffen wird. Dort versucht Lenas Zwillingsschwester Maria, den Ursprung der menschlichen Intelligenz zu ergründen – den Großen Sprung nach vorn, der den modernen Menschen hervorgebracht hat. Zu diesem Zweck hat sie die DNA eines Gorillas mit Neandertaler-DNA hybridisiert und das Mischwesen Baako erschaffen.
Die Sigma Force entsendet zwei Teams – Gray Pierce und Seichan setzen in Kroatien an, während Monk Kokkalis und der kampferprobte Kowalski nach Atlanta reisen. Bald darauf stoßen sie auf die Aufzeichnungen des Jesuitenpaters Kircher, der glaubte, er habe die Gebeine Adams entdeckt. Die weiteren Nachforschungen führen 50 000 Jahre in die Vergangenheit, nach China und bis zum verschollenen Kontinent Atlantis …
Autor
Der New-York-Times-Bestsellerautor James Rollins hat einen Doktorgrad in Tiermedizin. Als begeisterter Höhlenforscher und ebenso eifriger Taucher ist er häufig unter Wasser oder unter der Erde anzutreffen. Er wohnt in den Bergen der Sierra Nevada in Kalifornien, USA.
Von James Rollins bei Blanvalet erschienen:
Sigma Force:
Der Genesis-Plan, Feuermönche, Sandsturm, Der Judas-Code, Das Messias-Gen, Feuerflut, Mission Ewigkeit, Das Auge Gottes, Projekt Chimera
Tucker Wayne:
Killercode
Die Bruderschaft der Christuskrieger:
Das Evangelium des Blutes, Das Blut des Verräters, Die Apokalypse des Blutes
Außerdem:
Sub Terra, Im Dreieck des Drachen, Das Flammenzeichen, Operation Amazonas, Das Blut des Teufels, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
James Rollins
Das Knochenlabyrinth
Roman
Aus dem Englischen von Norbert Stöbe
Für die Warped Spacer, die Gruppe, die von Anfang an da war … und die mich immer noch gut aussehen lässt.
VORBEMERKUNG ZUM HISTORISCHEN HINTERGRUND
ZWEIHISTORISCHEPERSÖNLICHKEITEN spielen in diesem Buch eine herausragende Rolle: zwei Priester, die durch Jahrhunderte voneinander getrennt, aber durchs Schicksal miteinander verbunden sind.
Im siebzehnten Jahrhundert galt Athanasius Kircher als Leonardo da Vinci des Jesuitenordens. Wie sein großes Vorbild beherrschte auch er die verschiedensten Disziplinen. Er befasste sich mit Medizin, Geologie und Ägyptologie und baute raffinierte Automaten, darunter eine magnetische Uhr – ein Nachbau befindet sich in der Grünen Bibliothek der Universität Stanford. Dieser Vertreter der Renaissance beeinflusste mit seinem Wirken Persönlichkeiten aller Zeiten, von Descartes bis Newton, von Jules Verne bis zu Edgar Allen Poe.
Und noch eine weitere Persönlichkeit.
Pater Carlos Crespi kam Jahrhunderte später zur Welt, im Jahr 1891. Inspiriert von Kircher, wurde auch Crespi ein Mönch mit vielen Gaben. Er war Botaniker, Anthropologe, Historiker und Musiker. Schließlich ließ er sich als Missionar in einer kleinen Stadt in Ecuador nieder, wo er fünfzig Jahre lang der Kirche diente. Dort gelangte ein großer Schatz goldener Artefakte in seinen Besitz, den ihm die in dieser Gegend ansässigen Shuar schenkten. Angeblich stammten die Objekte aus einem Höhlensystem, das sich über die ganze Breite von Südamerika erstreckte und eine Sammlung alter Metallplatten und Kristallbücher beherbergte. Die Artefakte waren mit fremdartigen Abbildungen geschmückt und mit nicht entzifferbaren Beschriftungen versehen.
Manche Archäologen hielten sie für Fälschungen; andere schenkten den Aussagen des Priesters zur Herkunft der Artefakte Glauben. Wie dem auch sei, im Jahr 1962 wurde das Museum, in dem die meisten Artefakte untergebracht waren, durch ein Feuer zerstört, und die wenigen noch erhaltenen Gegenstände wurden von der ecuadorianischen Regierung weggeschlossen.
Was ist wahr an Pater Crespis Geschichte, und was beruht auf Lügenmärchen? Niemand weiß es. Allerdings steht außer Frage, dass der fromme Mönch an seine Geschichte glaubte und dass es den großen Schatz gegeben hat.
Im Jahr 1976 machte ein britisches Team von Militärs und Wissenschaftlern sich auf die Suche nach dem vergessenen unterirdischen Versteck und landete im falschen Höhlensystem. Eigentümlicherweise wurde die Expedition von einem Amerikaner geleitet – von keinem anderen als Neil Armstrong, dem ersten Mann auf dem Mond.
Was hatte diesen eigenbrötlerischen, einzelgängerischen amerikanischen Helden, der nur selten Interviews gab, dorthin gelockt? Die Antwort verweist auf ein noch größeres Geheimnis, das eine Gefahr darstellt für unsere Stellung in der Welt.
VORBEMERKUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN HINTERGRUND
EINFUNDAMENTALESRÄTSEL, das mit unserem Ursprung verknüpft ist, lässt sich in einer simplen Frage zusammenfassen: Weshalb sind wir so intelligent?
Die Entstehung der menschlichen Intelligenz beschäftigt Wissenschaftler und Philosophen. Ja, das Wachstum unseres Gehirns lässt sich von den frühen Hominiden bis zum Erscheinen des Homo sapiens vor rund zweihunderttausend Jahren nachverfolgen. Unbekannt ist aber nach wie vor, weshalb unsere Spezies vor etwa fünfzigtausend Jahren einen plötzlichen Anstieg der Intelligenz erlebte.
Anthropologen bezeichnen diesen Moment als den Großen Sprung nach vorn. In der fossilen Überlieferung schlägt er sich als explosionsartige Weiterentwicklung von Kunst, Musik und Waffentechnik nieder. Für den plötzlichen Anstieg unserer Erfindungsgabe gibt es keine anatomische Erklärung, und doch muss etwas Grundlegendes geschehen sein, das die sprunghafte Weiterentwicklung von Intelligenz und Bewusstsein ermöglicht hat. Dazu gibt es zahlreiche Theorien, die dieses Ereignis wahlweise auf den Klimawandel, genetische Mutationen oder eine Veränderung der Ernährungsweise zurückführen.
Noch befremdlicher ist die Tatsache, dass unser Gehirn in den vergangenen zehntausend Jahren stetig geschrumpft ist – um bislang fünfzehn Prozent. Was hat das zu bedeuten? Was folgt daraus für die Zukunft? Vielleicht birgt der geheimnisvolle Große Sprung nach vorn des Rätsels Lösung. Bislang aber wurde noch keine triftige Erklärung für diese zentrale Entwicklung der Menschheitsgeschichte gefunden.
Das gilt bis heute.
Die Enthüllungen der folgenden Seiten werfen weitere verstörende Fragen auf: Stehen wir vor einem zweiten Großen Sprung nach vorn? Oder sind wir dazu verdammt, uns wieder zurückzuentwickeln?
Intelligenz ist ein Unfall der Evolution und nicht unbedingt ein Überlebensvorteil.
Isaac Asimov
Das Maß der Intelligenz ist die Fähigkeit zur Veränderung.
Albert Einstein
Herbst, 38 000 Jahre v. Chr. Südliche Alpen
»LAUF, KIND!«
Hinter ihnen brannte der Wald. Seit Tagen trieben die Flammen K’ruk und seine Tochter immer höher in die schneebedeckten Berge. K’ruk aber fürchtete weder den beißenden Rauch noch die sengende Hitze. Er blickte sich um und hielt Ausschau nach seinen Verfolgern, die den Wald in Brand gesteckt hatten, um sie zu jagen, konnte den Gegner aber nirgends ausmachen.
Doch er hörte das ferne Geheul der Wölfe, jener großen Tiere, die sich dem Willen der Jäger unterwarfen. Das Rudel war näher gekommen, nur noch ein Tal entfernt.
Besorgt blickte er zur Sonne, die dicht über dem Horizont stand. Das rötliche Leuchten am Himmel erinnerte ihn an das Versprechen von Wärme, das in dieser Richtung lag, an die heimatlichen Höhlen im schwarzen Felsgestein der grünen Hügel, wo das Wasser noch floss und wo auf den niederen Hängen Rotwild und Bisons umherstreiften.
Er stellte sich die Lagerfeuer vor, die Fleischspieße, von denen das Fett in die Flammen tropfte, den Stamm, der sich zum Einbruch der Nacht versammelt hatte. Er sehnte sich nach seinem alten Leben, wusste aber auch, dass es ihm verwehrt war – vor allem aber seiner Tochter.
Ein gellender Schrei lenkte seine Aufmerksamkeit nach vorn. Onka war auf einem vermoosten Stein ausgerutscht und gestürzt. Normalerweise war sie geschickt im Gelände, doch sie waren schon seit drei langen Tagen auf der Flucht.
Er eilte zu ihr und zog sie hoch. Ihr Gesicht glänzte vor Angst und vom Schweiß. Er hielt kurz inne und legte ihr die Hand auf die Wange. In ihrem kindlichen Gesicht sah er, dass sie sich nach ihrer Mutter sehnte, einer Heilerin, die kurz nach Onkas Geburt gestorben war. Er drehte sich eine Locke ihres feuerroten Haars um den Zeigefinger.
Ganz die Mutter …
Doch er sah noch mehr in Onkas Gesichtszügen, die Merkmale, die sie als anders brandmarkten. Ihre Nase war selbst für ein Mädchen von neun Wintern schmaler als die von K’ruks Stammesgenossen. Ihre Stirn war gerader, weniger ausladend. Er schaute ihr in die blauen Augen, die so strahlend waren wie der Sommerhimmel. Das Leuchten und die anderen Merkmale wiesen sie als Mischwesen aus, als eine Person, die irgendwo zwischen K’ruks Leuten und denen mit den mageren Gliedmaßen und der flinken Zunge stand, die vor Kurzem aus dem Süden gekommen waren.
Diese Kinder galten als Omen und belegten angeblich durch ihre Geburt, dass die beiden Stämme – der neue und der alte – in Frieden zusammenleben konnten. Vielleicht nicht unbedingt in denselben Höhlen, aber sie könnten sich wenigstens die Jagdgründe teilen. Und je näher die beiden Stämme einander kamen, desto mehr Kinder wie Onka wurden geboren. Sie wurden verehrt, denn sie betrachteten die Welt mit anderen Augen und wurden Schamane, Heiler oder Jäger.
Vor zwei Tagen aber war ein Besucher aus einem Nachbartal eingetroffen. Er war tödlich verwundet gewesen, hatte sie vor seinem Tod aber noch vor einem starken Gegner gewarnt, einer großen Gefahr, die sich im Gebirge ausbreitete. Diese geheimnisvollen Stammesleute waren stets zahlreich und machten Jagd auf solche wie Onka. Sie duldeten es nicht, dass irgendein Stamm solche Kinder großzog. Diejenigen, die es trotzdem taten, wurde niedergemetzelt.
Als K’ruk dies hörte, beschloss er, seinen eigenen Stamm nicht zu gefährden und gleichzeitig zu verhindern, dass Onka geraubt wurde. Deshalb war er zusammen mit seiner Tochter geflohen, doch anscheinend hatte jemand dem Gegner von ihrer Flucht berichtet.
Und von Onka.
Ich lasse nicht zu, dass sie denen in die Hände fällt.
Er fasste sie bei der Hand und schritt schneller aus, doch Onka stolperte immer häufiger und humpelte stark wegen des verstauchten Knöchels. Auf einem Gebirgskamm nahm er sie auf die Arme und blickte zum Wald hinunter. Am Talgrund war ein kleiner Fluss zu erkennen. Dort könnten sie trinken.
»Wir rasten dort«, sagte er und zeigte in die Tiefe. »Aber nur kurz …«
Links von ihm knackte ein Zweig. Er ging in die Hocke, setzte Onka ab und hob den Speer mit der Spitze aus Stein. Hinter einem umgestürzten Baum trat ein schlanker Mann hervor, bekleidet mit Umhang und Stiefeln aus Rentierleder. Ihre Blicke trafen sich. Ohne dass ein Wort gefallen wäre, wusste K’ruk, dass der andere wie Onka war – ein Mischwesen. Seine Kleidung und das mit einem Lederriemen zusammengebundene Haar ließen jedoch erkennen, dass er nicht zu K’ruks Stamm gehörte, sondern zu den Leuten mit den schlankeren Gliedmaßen, die später ins Gebirge gekommen waren.
Hinter ihnen, in größerer Nähe als zuvor, ertönte das Wolfsgeheul.
Der Fremde lauschte mit schief gelegtem Kopf; dann hob er die Hand und winkte sie zu sich. Er sagte etwas, doch K’ruk verstand ihn nicht. Schließlich zeigte der Fremde zum Wasserlauf hinunter und machte sich an den Abstieg über den bewaldeten Hang.
K’ruk überlegte, ob es ratsam sei, ihm zu folgen, doch das Gebell der Wölfe veranlasste ihn, dem Fremden zu vertrauen. Mit Onka auf den Armen bemühte er sich, mit dem gewandten Mann Schritt zu halten. Am Fluss wurden sie von einer Gruppe von etwa einem Dutzend Personen erwartet, einige jünger als Onka, andere mit krummem Rücken.
Eines aber hatten alle gemeinsam.
Sie waren Mischwesen.
Der Fremde trat vor und fiel vor Onka auf die Knie. Er berührte sie an der Stirn und fuhr ihr mit dem Finger über die Wange, offenbar um zu prüfen, ob sie wirklich eine der ihren war.
Onka streckte ihrerseits den Arm aus und berührte das sternförmige Narbenmuster an der Stirn des Fremden.
Sie fuhr mit der Fingerkuppe über die Narben, als enthielten sie eine verborgene Bedeutung. Der Mann grinste, offenbar erfreut über die rasche Auffassungsgabe des Kindes.
Dann richtete der Fremde sich auf und legte sich die Hand auf die Brust. »Teron«, sagte er.
Das war offenbar sein Name, doch der Fremde sprach gleich weiter und machte einem der Alten, der sich schwer auf einen dicken, knorrigen Stab stützte, ein Zeichen.
Der alte Mann trat vor und sagte in K’ruks Sprache: »Teron erlaubt dem Mädchen, sich uns anzuschließen. Wir sind unterwegs zu einem Gebirgspass, der nur noch wenige Tage lang schneefrei sein wird. Wenn wir ihn vor dem Gegner erreichen, können wir ihn abschütteln.«
»Bis zur nächsten Schneeschmelze«, setzte K’ruk besorgt hinzu.
»Bis dahin vergehen noch viele Monde. Dann ist unsere Spur längst kalt geworden.«
Das Wolfsgeheul in der Ferne erinnerte ihn daran, dass die Spur im Moment alles andere als kalt war.
Auch der Alte hatte es gehört. »Wir müssen aufbrechen, bevor sie über uns herfallen.«
»Und meine Tochter nehmt ihr mit?« Er schob Onka Teron entgegen.
Teron legte K’ruk eine Hand auf die Schulter und drückte fest zu, um sein Versprechen zu bekräftigen.
»Sie ist willkommen«, versicherte ihm der Alte. »Wir werden sie beschützen. Aber auf dieser langen Reise könnten wir deinen starken Rücken und deinen scharfen Speer gut gebrauchen.«
K’ruk trat einen Schritt zurück und packte den Speerschaft fester. »Der Gegner ist zu schnell. Ich werde ihn von eurer Spur ablenken und so lange wie möglich aufhalten, damit ihr den Pass erreichen könnt.«
Onka schaute ihn mit feuchten Augen an. »Papa …«
Ihm krampfte sich das Herz zusammen. »Das ist jetzt dein Stamm, Onka. Diese Leute werden dich an einen besseren Ort bringen, wo du sicher bist und zu der starken Frau heranwachsen kannst, die zu sein dir bestimmt ist.«
Onka riss sich von Teron los und schlang K’ruk die Arme um den Hals.
Halb erstickt vom Kummer und den Armen seiner Tochter, drückte er Onka von sich ab, bis Teron sie von hinten umfasste. K’ruk neigte sich vor, bis sich ihrer beider Stirn berührten, und verabschiedete sich von ihr. Er wusste, er würde seine Tochter nie mehr wiedersehen.
Dann richtete er sich auf, wandte sich ab und stieg wieder den Hang hinauf, dem Wolfsgeheul entgegen – während hinter ihm Onka kläglich nach ihm rief.
Lebe wohl, mein Kind.
Er schritt schneller aus, entschlossen, seine Tochter zu schützen. Auf dem Höhenrücken angelangt, eilte er dem Gekläff entgegen. Die Rufe der Jäger waren wilder geworden und schallten aus dem angrenzenden Tal herauf.
Mit weit ausgreifenden Schritten machte er sich auf den Weg.
Er erreichte den nächsten Gebirgskamm, als die Sonne unterging. Das Tal lag im Schatten. Er wurde langsamer, schritt vorsichtiger aus, denn die Wölfe waren verstummt. Geduckt huschte er auf der windabgewandten Seite von Schatten zu Schatten und achtete darauf, dass er auf keinen Ast trat.
Schließlich konnte er den Talboden sehen. In der Dunkelheit bewegte sich etwas. Die Wölfe. Eines der Tiere gelangte in Sicht, doch es sah ganz anders aus als ein Wolf. Es hatte eine verfilzte Mähne, der Körper war mit Narben bedeckt. Es bleckte seine langen gelben Zähne.
Obwohl ihm das Herz bis zum Hals klopfte, verharrte K’ruk in geduckter Haltung und wartete darauf, dass die Herren der monströsen Tiere sich zeigten.
Schließlich traten größere Schatten aus dem Wald hervor. Zum ersten Mal sah er das Gesicht des Gegners.
K’ruk wurde ganz kalt von dem Anblick, und das Grauen verwandelte sein Inneres in Eis.
Nein, das kann nicht sein …
Trotzdem packte er den Speer fester und blickte sich über die Schulter um.
Lauf, Onka. Lauf und schau dich nicht um.
Frühling 1669Rom, Kirchenstaat
NICOLASSTENOGELEITETE den jungen Gesandten durch die Tiefen des Museums des Collegio Romano. Der Fremde war mit einem dicken Mantel bekleidet, seine Stiefel waren schmutzig. Dies alles deutete darauf hin, dass er einen dringlichen geheimen Auftrag hatte.
Der deutsche Gesandte war von Leopold I. geschickt worden, dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches im Norden. Das Paket, das er dabeihatte, war für Nicolas’ teuren Freund Pater Athanasius Kircher bestimmt, der das Museum gegründet hatte.
Der Gesandte bestaunte die zahlreichen Naturwunder, die ägyptischen Obelisken, die mechanischen Apparaturen, die tickten und summten, alles bekrönt von Kuppeln, die mit astronomischen Darstellungen geschmückt waren. Der Blick des jungen Mannes fiel auf einen von einer Kerze angeleuchteten Bernsteinbrocken, in dem eine Eidechse eingeschlossen war.
»Nicht trödeln«, mahnte Nicolas und zog den Boten mit sich.
Nicolas kannte hier jeden Winkel. Er kannte jedes einzelne Buch, von denen viele vom Herrn des Museums persönlich verfasst worden waren. Seit fast einem Jahr war Nicolas in diesen Räumen tätig, hierherbeordert von seinem Wohltäter, dem Großherzog der Toskana, mit dem Auftrag, die Exponate zu studieren, denn das Museum sollte als Vorbild dienen für ein Kuriositätenkabinett, das der Herzog in seinem Florentiner Palast zu errichten gedachte.
Schließlich gelangte er zu einer hohen Eichentür und schlug mit der Faust dagegen.
»Herein«, ertönte eine Stimme.
Er zog die Tür auf und geleitete den Gesandten in ein kleines Studierzimmer, das von der Glut eines erlöschenden Feuers erhellt wurde. »Ich bitte um Verzeihung für die Störung, Hochwürden.«
Der deutsche Gesandte beugte vor dem breiten Schreibtisch das Knie und neigte das Haupt.
Der Mann, der hinter den Bücherstapeln saß, seufzte gedehnt. Die Hand mit der Schreibfeder schwebte über einem großen Pergament. »Möchtest du wieder meine Sammlung durchwühlen, Nicolas? Du solltest wissen, dass ich begonnen habe, die Bücher in diesem Raum zu nummerieren.«
Nicolas lächelte. »Ich verspreche, die Mundus Subterranus zurückzubringen, sobald ich einige Eurer darin aufgestellten Behauptungen widerlegt habe.«
»Ist das so? Wie ich höre, steht dein eigenes Werk über die unterirdischen Geheimnisse des Gesteins und des Kristalls kurz vor der Vollendung.«
Nicolas neigte bestätigend den Kopf. »In der Tat. Doch bevor ich es vorstelle, möchte ich Euch um eine nicht minder beißende Kritik bitten.«
Seit Nicolas’ Ankunft vor einem Jahr hatten sie viele Nächte mit Disputen über alle möglichen Fragen der Wissenschaft, Theologie und Philosophie zugebracht. Obwohl Kircher siebenunddreißig Jahre älter und eine Respektsperson war, schätzte der Geistliche die Herausforderung durch andere. Bei ihrer ersten Begegnung hatten sie heftig über eine Schrift gestritten, die Nicolas zwei Jahre zuvor veröffentlicht hatte und worin er erklärte, bei den Gesteinseinschlüssen, die man als Glossopetrae oder Zungensteine bezeichnete, handele es sich in Wahrheit um Haizähne. Auch Pater Kircher interessierte sich für die in Schichtgestein gefundenen Knochen und Relikte. Sie hatten hitzig über den Ursprung dieser Mysterien debattiert. Durch die Feuerprobe des wissenschaftlichen Disputs hatten sie nicht nur wechselseitigen Respekt entwickelt, sondern waren zu Kollegen und vor allem Freunden geworden.
Pater Kircher fasste den Gesandten in den Blick, der noch immer vor dem überladenen Schreibtisch kniete. »Und wer ist dein Begleiter?«
»Er überbringt ein Paket von Leopold I. Der Kaiser erinnert sich anscheinend noch gut genug an seine jesuitische Erziehung, um Euch einen wichtigen Fund zu übermitteln. Leopold hat sich an den Großherzog gewandt mit der Bitte, dass ich Euch diesen Mann im Geheimen vorstelle.«
Pater Kircher senkte die Schreibfeder. »Interessant.«
Sie wussten beide, dass der Kaiser sich für Wissenschaft und die Natur interessierte, was auf die jesuitischen Gelehrten zurückzuführen war, die ihn unterrichtet hatten. Kaiser Leopold hatte eigentlich Geistlicher werden wollen, doch nachdem sein älterer Bruder an den Pocken gestorben war, hatte der fromme Gelehrte sich die kalte Krone des Nordens aufgesetzt.
»Genug des lächerlichen Posierens, guter Mann«, sagte Pater Kircher zu dem Gesandten. »Erhebt Euch und übergebt mir, was der Grund für Eure weite Reise war.«
Der Gesandte richtete sich auf und schlug die Kapuze seines Umhangs zurück. Darunter kam das Gesicht eines jungen Mannes von höchstens zwanzig Jahren zum Vorschein. Er nahm einen dicken Brief aus seiner Umhängetasche, der mit dem kaiserlichen Siegel verschlossen war. Er trat vor und legte ihn auf den Tisch, dann wich er zurück.
Kircher blickte Nicolas an, der mit den Achseln zuckte. Anscheinend hatte auch er keine Ahnung, worum es ging.
Kircher brach das Siegel mit einem Messer. Ein kleiner Gegenstand rollte aus dem Umschlag hervor auf die Tischplatte. Es war ein Knochen, stellenweise bedeckt mit kristallinen Gesteinsresten. Mit gerunzelter Stirn zog Kircher ein Pergament aus dem Umschlag und entfaltete es. Nicolas sah, dass es sich um eine detaillierte Landkarte Osteuropas handelte. Pater Kircher betrachtete sie einen Moment lang.
»Ich verstehe nicht, was das soll«, sagte Kircher. »Die Landkarte und der alte Knochen. Es fehlt eine Erklärung.«
Der Gesandte ergriff das Wort und sagte mit starkem Akzent: »Der Kaiser hat mir aufgetragen, Euch eine mündliche Botschaft zu übermitteln, Hochwürden.«
»Und wie lautet die Botschaft?«
»Der Kaiser weiß von Eurem Interesse an der Vorgeschichte und den Geheimnissen, die im Innern der Erde verborgen sind, und bittet Euch, bei der Erforschung des Fundes an dem markierten Ort zu helfen.«
»Und was wurde dort gefunden?«, fragte Nicolas. »Weitere Knochen wie dieser hier?«
Er trat näher an den Tisch und betrachtete den versteinerten Knochen mit den weißlichen Gesteinsresten.
»Knochen und noch viel mehr«, antwortete der Bote.
»Und zu wem gehören die Knochen?«, fragte Kircher. »Aus wessen Grab stammen sie?«
Die Antwort des jungen Mannes bestürzte beide Zuhörer. Doch ehe sie reagieren konnten, zog der Bote einen Dolch hervor und schlitzte sich die Kehle von einem Ohr zum anderen auf. Blutüberströmt fiel er auf die Knie und kippte dann zur Seite.
Nicolas stürzte zu dem jungen Mann, erzürnt über die Grausamkeit des Kaisers. Offenbar war die Botschaft ausschließlich für ihn und Pater Kircher gedacht gewesen und sollte kein anderes Ohr erreichen.
Pater Kircher trat um den Schreibtisch herum, ließ sich auf ein Knie nieder und ergriff die Hand des jungen Mannes. Seine Frage aber war an Nicolas gerichtet. »Kann das wahr sein?«
Nicolas schluckte, bestürzt von der Botschaft, die der Sterbende überbracht hatte.
Die Knochen … sie stammen von Adam und Eva.
TEIL 1BLUT UND SCHATTEN
1
29. April, 10:32 CESTGepanschaft Karlovac, Kroatien
WIRHABENHIER nichts verloren.
Abergläubische Furcht veranlasste Roland Novak, an einer Spitzkehre des Wegs innezuhalten. Er schützte die Augen mit der Hand vor der Morgensonne und schaute zur schroffen Bergspitze auf. Schwarze Wolken türmten sich in der Ferne.
Den kroatischen Sagen zufolge – die man ihm in seiner Kindheit erzählt hatte – versammelten sich in dunklen Sturmnächten Hexen und Feen auf dem Gipfel des Klek, und ihre Schreie waren bis zur Stadt Ogulin zu hören. Viele unvorsichtige oder glücklose Wanderer hatte auf dem Gipfel angeblich ein furchtbares Schicksal ereilt.
Jahrhundertelang hatten diese Legenden dafür gesorgt, dass der Berg weitgehend unbehelligt geblieben war. Das hatte sich in den letzten Jahrzehnten geändert, denn die hohen Felswände lockten eine stetig wachsende Zahl einheimischer Bergsteiger an. Doch das war nicht der Grund, weshalb Roland und dessen Begleiter den Aufstieg an der Nordseite des Bergs wagten.
»Es ist nicht mehr weit«, sagte Alex Wrightson. »Bevor das Unwetter losbricht, sind wir schon auf dem Rückweg.«
Der britische Geologe leitete die Vierergruppe. Er wirkte ebenso massiv wie die Berggipfel, obwohl er schon fast siebzig war. Trotz der Kälte trug er kakifarbene Wandershorts, die seine kräftigen, drahtigen Beine entblößten. Das schneeweiße Haar, das dichter war als Rolands, hatte er sich unter den Schutzhelm gesteckt.
»Das sagt er jetzt schon zum dritten Mal«, grummelte Lena Crandall. Nach dem stundenlangen Aufstieg glänzten ihre Wangen vom Schweiß, doch sie war nicht außer Atem. Schließlich war sie erst Mitte zwanzig, und den abgetragenen Wanderstiefeln nach zu schließen war sie nicht zum ersten Mal im Gebirge unterwegs.
Sie musterte die dunkle Wolkenwand. »Zum Glück bin ich einen Tag zu früh hier angekommen«, sagte sie. »Wenn das Unwetter losbricht, werden sich die Wege für wer weiß wie lange in Morast verwandeln.«
Die Gruppe zog auf dem unmarkierten Weg das Tempo an. Lena öffnete den Reißverschluss ihrer Thermojacke und rückte die Schulterriemen des Rucksacks zurecht, den das Logo der Emory University zierte, ihrer Alma Mater in Atlanta, Georgia. Sonst wusste Roland nur noch, dass die Amerikanerin Genetikerin war und als Stipendiatin am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig arbeitete. Auch sie hatten der britische Geologe und sein Partner, ein französischer Paläontologe, über den Grund für die Einladung im Unklaren gelassen.
Im Gehen unterhielt Dr. Dayne Arnaud sich leise mit Wrightson. Roland konnte den Paläontologen zwar nicht verstehen, was auch an dessen starkem Akzent lag, doch er wirkte gereizt. Bislang hatten die beiden Forscher ihren Begleitern keine Einzelheiten über das Ziel der Wanderung oder ihre Entdeckung mitgeteilt.
Roland zwang sich zu Geduld. Er war in Zagreb aufgewachsen, der kroatischen Hauptstadt, doch er kannte alle Geschichten, die sich um diesen Gipfel des Dinarischen Gebirges rankten. Er glich auf unheimliche Weise einem auf dem Rücken liegenden Riesen. Angeblich war dies der Körper des Riesen Klek, der sich gegen den Gott Volos aufgelehnt hatte und zur Strafe in Stein verwandelt worden war. Zuvor hatte er gelobt, er werde eines Tages aus seinem Schlummer erwachen und Rache nehmen an der Welt.
Roland verspürte einen Anflug von abergläubischem Unbehagen.
Denn in letzter Zeit grollte der Riese.
Dies war eine Erdbebenregion, was der Legende vom schlafenden Riesen möglicherweise Vorschub geleistet hatte. Im vergangenen Monat hatte ein Erdstoß der Stärke 5,2 auf der Richterskala die Region erschüttert. In der Stadt Ogulin war der Glockenturm einer mittelalterlichen Kirche eingestürzt.
Roland vermutete, dass die Entdeckung des Geologen und des Paläontologen mit dem Erdbeben in Verbindung stand. Seine Ahnung bewahrheitete sich, als sie um eine schroffe Felsspitze bogen und zu einer dichten Ansammlung von Kiefern gelangten. Ein großer Felsbrocken hatte sich aus der Wand gelöst und war in den Wald gestürzt, wobei er mehrere Bäume gefällt hatte. Es sah aus, als sei der gewaltige Klek persönlich hier umhergestapft.
Während sie sich einen Weg durch das Labyrinth der Felsen und zerschmetterten Baumstämme bahnten, sagte Wrightson: »Ein einheimischer Vogelkundler ist nach dem Erdbeben von letztem Monat hierhergekommen. Er war früh am Morgen unterwegs, als er zwischen ein paar Felsen Dampf aufsteigen sah, was auf ein Höhlensystem hindeuten könnte.«
»Und Sie glauben, das Höhlensystem ist bei dem Erdstoß geöffnet worden?«, fragte Lena.
»In der Tat.« Wrightson schwenkte den Arm. »Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Der ganze Gebirgszug besteht aus Karst, einer Erscheinungsform des Kalksteins. Regenfälle und zahlreiche Quellen haben die Gegend in eine geologische Spielwiese voller Wunder verwandelt. Unterirdische Flüsse, Erdlöcher, Höhlen – hier gibt es alles, was man sich nur wünschen kann.«
Roland blickte Arnaud an. »Aber Sie haben mehr entdeckt als bloß eine Höhle.«
Wrightsons Augen funkelten vor Belustigung und Erregung. »Wir wollen uns doch die Überraschung nicht verderben, nicht wahr, Dr. Arnaud?«
Der Paläontologe bekundete brummend seinen Unmut, was zu seiner finsteren Miene passte. Wrightson war ein geselliger Mensch und der Franzose das genaue Gegenteil. Er war beinahe gleich alt mit dem zweiunddreißigjährigen Roland, wirkte aber wesentlich älter. Roland vermutete, dass Arnauds Verärgerung daher rührte, dass man ihn und die Amerikanerin hinzugezogen hatte. Wenn es um ihre Arbeit ging, zeigten manche Wissenschaftler ein ausgeprägtes Revierverhalten.
»Ah, da sind wir ja!«, sagte Wrightson und näherte sich einer Leiter, die aus einem unscheinbaren Erdloch ragte.
Ganz auf sein Ziel konzentriert, übersah Roland die Gestalt, die im Schatten eines Felsens stand, bis der große Mann in den Sonnenschein trat. Er hatte sich ein Gewehr über die Schulter gelegt. Der Wachposten trug zwar Zivilkleidung, doch seine gerade Haltung, die scharfen Bügelfalten und der stählerne Glanz seiner Augen deuteten auf einen militärischen Hintergrund hin. Sein kurz geschorenes schwarzes Haar wirkte wie eine Schädelkappe mit Spitze.
Er sagte etwas zu Arnaud.
Roland verstand kein Französisch, doch die Haltung, die der Wachposten gegenüber dem Paläontologen an den Tag legte, wirkte nicht unterwürfig, sondern eher kollegial, so als wären sie einander gleichgestellt. Der Mann zeigte zum immer dunkler werdenden Himmel hoch. Offenbar ging es darum, ob die Wetterbedingungen den Einstieg noch erlaubten. Schließlich ging er fluchend zu einem Generator hinüber und brachte ihn mit einem Zug an der Startschnur zum Laufen.
»Das ist Commandant Henri Gerard«, stellte Wrightson den Mann vor. »Er ist bei den Chasseur Alpins, den französischen Gebirgsjägern. Er und seine Leute haben dafür gesorgt, dass kein Unbefugter die Höhle betreten konnte.«
Roland schaute sich nach den anderen Soldaten um, konnte aber keine entdecken.
»Eine bedauerliche, aber notwendige Vorsichtsmaßnahme«, fuhr Wrightson fort. »Nachdem der Vogelkundler den Eingang entdeckt hatte, nahm er Kontakt zu Freizeithöhlenforschern auf. Zu unserem Glück halten sich die Mitglieder dieses Klubs strikt an die Regeln und nehmen es ernst mit der Geheimhaltung. Als sie die Bedeutung des Fundes erkannten, rührten sie nichts an und setzten sich gleich mit ihren französischen Kollegen in Verbindung, die sich bereits um die Erhaltung der berühmten Höhlen von Chauvet und Lascaux gekümmert haben.«
Roland, der sich mit Kunstgeschichte auskannte, verstand die Bedeutung dieser Aussage. Die genannten Fundorte waren berühmt für ihre paläolithischen Malereien, die von den ältesten Vorfahren des modernen Menschen stammten.
Er blickte zur Erdöffnung, und auf einmal ahnte er, was darin verborgen war.
Lena hatte es ebenfalls begriffen. »Haben Sie dort unten Höhlenmalereien entdeckt?«
Wrightson hob eine Braue. »Oh, wir haben viel mehr gefunden.« Er fasste Roland in den Blick. »Deshalb haben wir Kontakt mit dem Vatikan aufgenommen, Pater Novak. Das ist auch der Grund, weshalb Sie von der Katholischen Universität in Zagreb hierherbeordert wurden.«
Roland blickte in die Öffnung hinunter. Während in der Ferne Donner grollte, veranlasste ihn die Furcht, sich an den Priesterkragen zu fassen.
Arnaud sagte mit starkem Akzent und unverhohlener Missbilligung: »Pater Novak, Sie sind hier, um den wundervollen Fund zu beglaubigen.«
11:15
Lena kletterte hinter Wrightson und Arnaud die Leiter hinunter. Daneben lief ein Stromkabel entlang, das mit dem Generator verbunden war. Wie die anderen trug auch sie einen Schutzhelm mit Leuchte. Das Herz klopfte ihr bis zum Hals, vor Aufregung und wegen eines Anflugs von Klaustrophobie.
Die meiste Zeit verbrachte sie in irgendeinem Genlabor, schaute durchs Mikroskop oder las Gensequenzen von einem Monitor ab. In ihrer Freizeit flüchtete sie sich in die Natur, was immer diese zu bieten hatte. In letzter Zeit waren dies die Parklandschaften entlang der Flüsse gewesen, die durch Leipzig strömten. Sie vermisste den Wald, der ihre vorige Forschungsstelle am Stadtrand von Atlanta umgeben hatte. Und sie vermisste ihre Zwillingsschwester – Genetikerin wie sie –, die in den Staaten die Arbeit an ihrem gemeinsamen Projekt fortführte, während sie selbst als wissenschaftliche Hilfskraft in Europa arbeitete und sechzehn bis achtzehn Stunden täglich genetischen Code aus alten Knochen oder Zähnen extrahierte.
Wenn diese Höhle hier tatsächlich ein paläolithischer Fundort mit Fossilien und Artefakten war, war ihre Rolle vorgezeichnet: Proben für die spätere Laboranalyse nehmen. Das Max-Planck-Institut genoss bei der Analyse von Knochenfragmenten und der Rekonstruktion alter Gensequenzen einen guten Ruf.
Lena blickte zwischen ihren Stiefeln in die Tiefe und überlegte, was sie dort unten wohl vorfinden würde. Sie wünschte, ihre Schwester Maria wäre bei ihr gewesen.
Pater Novak keuchte auf, als er von der Leiter abrutschte, doch er fing sich gleich wieder. Stirnrunzelnd fragte sie sich erneut, was der Priester hier verloren hatte. Auf dem Herflug hatte sie sich mit ihm unterhalten und erfahren, dass er an der Universität Geschichte des Mittelalters lehrte, ein eigenartiger Hintergrund für jemanden, der eine prähistorische Höhle erkundete.
Endlich hatte sie das Ende der Leiter erreicht. Wrightson half ihr auf den Boden und bedeutete ihr, Arnaud zu folgen, der geduckt in einen Gang trat. Sie zog den Kopf ein, stieß aber trotzdem mit dem Helm an die Decke. Die Leuchte schwankte. Es war hier wärmer als draußen in der Morgenkühle, doch die Kalksteinwände fühlten sich feucht an, und der Boden war morastig.
Nach einer Weile richtete Arnaud sich vor ihr auf. Sie schloss zu ihm auf, streckte den verspannten Rücken – und erstarrte.
Vor ihnen lag eine Höhle, gezähnt von Stalaktiten und Stalagmiten. Die Wände waren von Sinter überzogen, die Decke mit kunstvollen Kronleuchtern aus spiralförmigen schneeweißen Kristallen geschmückt, einige so dünn wie ein Strohhalm, andere dick wie ein Geweih.
»Eine spektakuläre Ansammlung von Heliktiten«, erklärte Wrightson. »Dieser Höhlensinter wird durch Kapillarkräfte gebildet, die das Wasser aus mikroskopischen Rissen hervorpressen. Das Wachstum beträgt nur einen Zentimeter in hundert Jahren.«
»Erstaunlich«, flüsterte sie, als habe sie Angst, ihr Atem könnte die fragilen Gebilde zerstören.
»Von hier an sollten Sie aufpassen«, fuhr Arnaud mit ernster Stimme fort. »Halten Sie sich an die Leitern, die wir als Brücken auf dem Höhlenboden ausgelegt haben. Die Dinge am Boden sind ebenso wertvoll wie das, was an der Decke hängt.«
Der Paläontologe betrat über ein schmales Stahlgerüst die Höhle. Einige Lampen, die vom Generator mit Strom versorgt wurden, beleuchteten den Weg. Auf dem Höhlenboden bemerkte Lena vereinzelte Objekte, die mit Kalkablagerungen bedeckt waren. Durch die Kristallschicht machte sie die Umrisse von Schädeln und Beinknochen aus.
»Hier unten wurde ein Schatz prähistorischen Lebens konserviert«, sagte Arnaud, dessen Griesgrämigkeit kindlichem Staunen Platz gemacht hatte. Er wies mit dem Kinn auf eines der Objekte. »Das ist das intakte Hinterbein von Coelodonta antiquitatis.«
»Das Wollhaarnashorn«, sagte Lena.
In Arnauds Miene zeigte sich ein Anflug von Respekt. »Das ist richtig.«
Sie deutete auf ein Artefakt, das auf einem abgebrochenen Stalagmiten lag, einen von Kalzit fixierten Schädel. »Wenn ich mich nicht täusche, stammt das von einem Ursus spelaeus.«
»Dem sprichwörtlichen Höhlenbär«, bestätigte Wrightson.
Lena verkniff sich ein Lächeln. Dieses Spiel konnte man auch zu zweit spielen.
»Der Lage nach zu schließen«, fuhr Arnaud fort, »wurde der Schädel als Totem verwendet. Davor sehen Sie die Spuren einer Feuergrube. Die Flammen haben vermutlich den Schatten des Bärenschädels an die Wand geworfen.«
Lena stellte sich die Wirkung dieses Schauspiels auf die Höhlenbewohner vor.
Als sie zur anderen Seite der Höhle gingen, zeigte der Paläontologe auf weitere kostbare Relikte: die Hörner einer Saiga-Antilope, einen Bisonschädel, mehrere Mammutstoßzähne und die kompletten Überreste eines Goldadlers. Dunkle Flecken am Boden markierten die Stellen, an denen Lagerfeuer gebrannt hatten.
Schließlich gelangten sie in eine Höhle, welche die erste im Vergleich klein erscheinen ließ. Ein Doppeldeckerbus hätte mühelos darin wenden können.
»Die Hauptattraktion«, erklärte Wrightson. Er übernahm die Führung und ging über die Leiterwege weiter.
Lena war nicht auf Erklärungen angewiesen, um die Bedeutung dieser Entdeckung zu erkennen. Die untere Hälfte der Wände war mit Malereien bedeckt, die verschiedene Tiere darstellten. Einige waren mit Holzkohle gezeichnet, andere in den dunklen Fels gekratzt. Mehrere Abbildungen waren mit Farbpigmenten ausgemalt worden.
Was Lena am meisten beeindruckte, war die Schönheit der Darstellungen. Das waren keine unbeholfenen Strichmännchen, sondern das Werk wahrer Künstler. Die Pferdemähnen sahen aus, als flatterten sie im Wind. Die Bisons waren in vollem Lauf dargestellt. Herden von Rotwild reckten ihr Geweih, als wollten sie die über ihnen schwebenden Adler einfangen. Löwen und Leoparden stürmten durch das Gewühl der Leiber, teils auf der Jagd, teils auf der Flucht. An der einen Seite hatte sich ein Höhlenbär auf die Hinterbeine gestellt und überragte alle anderen Tiere.
Lena hatte Mühe, sich an die Leiterwege zu halten, als sie versuchte, dies alles in sich aufzunehmen. »Faszinierend. Ich wünschte, meine Schwester könnte das sehen.«
»Dagegen erscheinen die Darstellungen von Lascaux doch als Schmierereien, oder?«, meinte Wrightson und grinste. »Aber das ist noch nicht alles.«
»Wie meinen Sie das?«, fragte Pater Novak.
»Sollen wir Ihnen zeigen, was eigentlich ins Auge springen sollte?«, fragte Wrightson Arnaud.
Der Franzose zuckte mit den Schultern.
Wrightson lenkte ihre Aufmerksamkeit von den Wänden weg zur Mitte des Raums. Ein dunkler Fleck von zwei Metern Durchmesser markierte den Ort, an dem sich ein großes Lagerfeuer befunden hatte. Beleuchtet wurde es von einem Lichtpaneel auf einem Stativ.
Der Geologe kniete neben einem Schaltkasten mit Stromkabel nieder. »Wenn Sie so freundlich wären, die Helmleuchten auszuschalten.«
Als sie seiner Bitte nachgekommen waren, drückte er einen Schalter, worauf die Lichtpaneele erloschen. Die Dunkelheit lastete schwer auf ihnen.
»Und jetzt lassen wir uns vierzigtausend Jahre in die Vergangenheit zurückversetzen«, sagte Wrightson; seine Stimme dröhnte wie die eines Zirkusansagers.
Ein Schalter knackte, und drei Paneele in der Mitte des Raums leuchteten auf, doch sie flackerten und stroboszierten, wohl um die Wirkung eines Lagerfeuers zu imitieren.
Zunächst verstand Lena nicht, was das sollte, doch dann sog Pater Novak scharf die Luft ein. Sie folgte seinem Blick. Riesige Schatten tanzten über die Wände, sie reichten viel höher als die Felsmalereien. Die Schatten wurden von kreisförmig angeordneten Stalagmiten erzeugt. Erst jetzt bemerkte Lena, dass sie behauen und mit Bohrern bearbeitet worden waren.
Die Schatten stellten Menschen dar, doch einige trugen gebogene Hörner, andere hielten einen Speer in der Hand. Das flackernde Licht erzeugte die Illusion von Bewegung, als habe sich unter den Tieren Panik ausgebreitet. Der Höhlenbär war einer der Menschengestalten zugewandt, doch nun bohrte sich ein Schattenspeer in seine Flanke. Auf einmal wirkte er nicht mehr zornig, sondern gequält.
Lena drehte sich langsam im Kreis, im Bann der Bilder, die ein kreatürliches Grauen bei ihr auslösten.
»Schluss mit dem Unsinn«, blaffte Arnaud.
Wrightson schaltete die Beleuchtung wieder ein.
Lena holte tief Luft, sog den Höhlengeruch ein, spürte die Stahlleiter unter ihren Stiefeln und versetzte sich zurück in die Gegenwart. »Ich … bin beeindruckt«, brachte sie hervor. »Aber was, glauben Sie, hat das zu bedeuten? Ist das die Darstellung einer Jagd, die Zeugnis ablegen soll vom Geschick des Stammes beim Aufspüren und Erlegen des Wilds?«
Eine Weile schwiegen alle, dann ergriff Pater Novak das Wort. »Auf mich wirkt das wie eine Warnung«, sagte der Geistliche. Er schüttelte leicht den Kopf, als wüsste er nicht so recht, wie er seine Eindrücke in Worte fassen sollte.
Lena verstand, was er meinte. Wenn der Stamm den Umgang mit Speer und Knüppel hätte feiern wollen, wäre die Wirkung eine andere gewesen. So aber wirkte das Ganze eher wie eine brutale Drohung.
»Es liegt nicht an uns, diese Geheimnisse zu lüften«, sagte Arnaud und ging weiter. »Das ist auch nicht der Grund, weshalb ich Sie hergeführt habe.«
Der Franzose geleitete sie zur anderen Seite, wo eine überwölbte Wandöffnung aus der Höhle mit den Malereien hinausführte. Als sie an einem der behauenen Stalagmiten vorbeikamen, wäre Lena am liebsten stehen geblieben, um herauszufinden, wie diese Menschen der Vorzeit die Illusion von Gestalt und Bewegung erzeugt hatten, doch Arnaud mahnte sie weiterzugehen.
Von hier an gab es keine Lichtpaneele mehr. Hinter dem Durchgang herrschte Dunkelheit. Lena schaltete die Helmleuchte wieder ein. Ein Lichtstrahl durchdrang die Finsternis und erleuchtete einen kurzen Gang, der vor einer bröckligen Wand endete.
Arnaud geleitete sie die leichte Steigung hoch zum Ende des Gangs.
»Das ist Mauerwerk«, sagte Pater Novak, der ebenso überrascht war wie Lena.
»Das stammt nicht von den Steinzeitmenschen«, sagte Lena. Sie fuhr mit den Händen über die mit Mörtel verbundenen Ziegel. »Aber es ist alt.«
Wrightson trat vor, beugte sich ein wenig nach vorn und leuchtete in ein mannsgroßes Loch in der Wand. »Hinter der Wand führt der Gang noch fünfzig Meter weiter und endet an einem Tunneleinbruch. Ich glaube, das hier war der ursprüngliche Zugang zum Höhlensystem. Jemand hat ihn zugemauert, um Besucher fernzuhalten. Dann wurde er bei einem Erdbeben verschüttet.«
Lena spähte durch das Loch. »Was das eine Erdbeben verschüttet hat, hat ein anderes anscheinend wieder freigelegt.«
»So ist es. Verborgene Geheimnisse neigen hartnäckig dazu wiederaufzutauchen.«
»Was befindet sich hinter der Wand?«, fragte Pater Novak.
»Der Grund, weshalb wir Sie beide hierhergebeten haben.« Wrightson richtete sich auf und deutete auffordernd auf das Loch.
Lena, die vor Neugier kaum noch an sich halten konnte, kletterte als Erste durch die Öffnung. Die Wand war über einen halben Meter dick. Dahinter lag eine kleine Kammer mit gemauerten Wänden, die an eine Kapelle erinnerte.
Pater Novak schloss sich ihr an und ließ den Lichtstrahl der Helmleuchte über das Kreuzrippengewölbe wandern. »Ich kenne diese Architektur«, sagte er mit bebender Stimme. »Die gotische Bauweise ist typisch für das Mittelalter.«
Lena hatte ihn kaum gehört, denn sie wurde von einem Alkoven in der einen Seitenwand abgelenkt. Die Nische war aus dem Fels herausgehauen. In einer Bodenmulde lag ein Skelett, die Knochenarme auf der Brust verschränkt, umgeben von einem Ring aus Steinen. Innerhalb des Rings waren kleinere Knochen – Rippen, Hand- und Fußwurzelknochen, einzelne Fingerglieder – in einem komplizierten Muster um den Toten herum angeordnet.
»Könnte dies das Grab eines der Männer sein, die den Tunnel vor langer Zeit versiegelt haben?«, fragte Novak.
»Der Beckenform nach zu schließen handelt es sich um einen Mann.« Lena beugte sich vor und leuchtete das Skelett von Fuß bis Kopf ab. Sie bedauerte, dass keine bessere Beleuchtung vorhanden war. »Aber schauen Sie sich den Schädel an, die Augenwülste. Wenn ich mich nicht täusche, sind das die sterblichen Überreste eines Homo neandertalensis.«
»Ein Neandertaler?«
Sie nickte.
Novak musterte sie von der Seite. »Ich habe gehört, dass ähnliche Überreste in Kroatien auch noch an anderen Stellen gefunden wurden.«
»Das stimmt. In der Höhle von Vindija. Dank dieses Funds konnte unser Institut das Genom des Neandertalers vollständig rekonstruieren.«
»Aber ich dachte, die Neandertaler hätten keine Höhlenmalereien angefertigt«, sagte Novak und blickte in Richtung der Haupthöhle.
»Das ist umstritten«, erwiderte Lena. »Nehmen wir zum Beispiel die Höhle El Castillo in Spanien. Darin gibt es zahlreiche künstlerische Darstellungen: Handabdrücke, Tierzeichnungen und abstrakte Muster. Die Datierung legt nahe, dass einige der Abbildungen von Neandertalern stammen könnten. Aber das ist noch ungewiss, und was die Qualität dieser Darstellungen hier betrifft, haben Sie durchaus recht. Die schönsten Felsmalereien – wie die von Lascaux und Chauvet – stammen alle von Frühmenschen. Noch nie wurden derart komplexe Darstellungen einem Neandertalerstamm zugeschrieben.«
Möglicherweise wird sich das nun ändern.
Hinter ihnen kletterten Arnaud und Wrightson in die Kapelle. »Deshalb haben wir Sie und Ihren Kollegen Dr. Crandall um Unterstützung gebeten«, sagte Arnaud. »Wir wollen herausfinden, ob die Bewohner dieser Höhle tatsächlich Neandertaler waren. Und wenn ja, möchten wir wissen, was sie zu so leidenschaftlichen Künstlern gemacht hat.«
Lena leuchtete die Rückwand der Grabstätte an, auf der ein sternförmiges Muster von Handabdrücken zu sehen war. Sie wirkten rötlich braun, was an getrocknetes Blut denken ließ.
Sie holte das Handy hervor und machte ein paar Fotos, dann wandte sie sich dem Skelett in der Mulde zu und überlegte, ob die Handabdrücke wohl von dem männlichen Neandertaler stammten, der hier bestattet war. Sie vergegenwärtigte sich die Furcht einflößenden flackernden Wandschatten und dachte an Novaks Bemerkung.
Auf mich wirkt das wie eine Warnung.
Wrightson räusperte sich. »Was uns zum nächsten Rätsel führt … Diesmal ist Pater Novak gefordert.«
11:52
Als Roland seinen Namen hörte, riss er die Augen mühsam von der Grabstätte los. Ist es nicht schon rätselhaft genug, dass die Überreste eines Neandertalers in einer mittelalterlichen Kapelle bestattet sind?
»Es ist nicht mehr weit, guter Mann«, sagte Wrightson und zeigte zu einem weiteren Loch, das man aus der hinteren Ziegelwand herausgebrochen hatte. Dem Geologen zufolge führte dahinter ein Gang an die Oberfläche.
Roland kroch gespannt hindurch und richtete sich auf. Er leuchtete umher, entdeckte aber nichts Besonderes – nur parallel angeordnete tiefe Furchen am Boden.
Wrightson trat neben ihn und betrachtete die Furchen. »Sieht so aus, als habe man etwas Schweres nach draußen gezogen. Vermutlich die Leute, die den Gang versiegelt haben.«
»Und Sie glauben, ich könnte Ihnen helfen, das Rätsel zu lösen?«
»Das weiß ich nicht, aber es gibt eine Sache, bei der Sie bestimmt helfen können.«
Wrightson legte ihm eine Hand auf die Schulter und drehte ihn zu der hinter ihm befindlichen Wand herum. Erst jetzt bemerkte er die Metallplatte, die wie eine Gruftmarkierung wirkte.
»Die Platte ist beschriftet«, sagte Wrightson und leuchtete sie an, »auf Latein.«
Roland kniff die Augen zusammen. Die Beschriftung war aufgrund der Korrosion teilweise unleserlich, einzelne Buchstaben hingegen waren deutlich zu erkennen. Es war eindeutig Latein. Einzelne Fragmente waren gut erhalten, darunter die letzte Zeile und der Name der Person, welche die Inschrift angebracht hatte.
»Reverende Pater in Christo, Athanasius Kircher«, las er vor, dann übersetzte er. »Der ehrwürdige Vater in Christus, Athanasius Kircher.«
Roland blickte bestürzt Wrightson an. »Ich … ich kenne diesen Mann. Ich habe meine Doktorarbeit über ihn und seine Arbeit geschrieben.«
»Das ist mir bekannt. Deshalb hat der Vatikan Sie hergeschickt.« Wrightson wies mit dem Kinn auf die Platte. »Und der Rest?«
Roland schüttelte den Kopf. »Ich kann nur Bruchstücke lesen. Mit etwas Zeit und den passenden Lösungsmitteln sollte es möglich sein, die Inschrift zu restaurieren. Die längste lesbare Zeile lautet: Möge niemand diesen Weg beschreiten, ohne des Zorns Gottes teilhaftig zu werden.«
»Dafür ist es ein bisschen spät«, brummte Wrightson. Roland ignorierte die Bemerkung und betrachtete die Platte.
Das ist eine weitere Warnung.
Gedämpftes Donnergrollen war zu hören. Das Unwetter brach los.
»Wir sollten jetzt aufbrechen«, sagte Wrightson und geleitete ihn durch die Kapelle. Unterwegs sammelte er die anderen beiden Teamkollegen ein. Als sie die Haupthöhle erreicht hatten, zeigte der Geologe nach vorn. »Wir sollten nach oben gehen, bevor …«
Ein Donnerschlag übertönte ihn. Die Lampen erloschen, nur die Helmleuchten spendeten noch Licht. Jemand schrie in der Finsternis.
Das aber waren nicht die Hexen der Überlieferung.
Gedämpfte Schüsse waren zu hören.
Arnaud packte Roland beim Arm. »Ein Überfall!«
2
29. April, 6:08 EDTLawrenceville, Georgia
DIEANGSTWECKT ihn auf.
Das Pochen in seinen Ohren zwingt ihn, sich zu bewegen. Als er sich aus dem Bett wälzt, taucht ein Bild vor seinem geistigen Auge auf, ein Gesicht …
Mutter.
Er eilt durch den dunklen Raum zum Fenster und schlägt erst mit der flachen Hand, dann mit den Fäusten gegen das dicke Glas. In seiner Brust baut sich ein unerträglicher Druck auf. Er brüllt seinen Missmut hinaus.
Schließlich geht die Deckenbeleuchtung an, und ein Gesicht taucht hinter der Glasscheibe auf und schaut ihn an. Das ist nicht die Person, die er sehen will.
Er drückt den Daumen ans Kinn, wiederholt die Bewegung immer wieder.
Mutter, Mutter, Mutter …
6:22
Ein Klopfen an der Tür weckte Maria in ihrem Büro. Mit einem Gefühl unbestimmter Panik riss sie den Ellbogen hoch. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Das aufgeschlagene Buch, das auf ihrer Brust geruht hatte, rutschte auf den Boden. Erst jetzt fiel ihr wieder ein, wo sie sich befand – viel mehr aber nicht, denn sie hatte schon viele Nächte durchgearbeitet.
Sie wurde ruhiger und blickte auf den Monitor am Nebenplatz. Die Daten der letzten Genanalyse scrollten über den Bildschirm. Sie war eingeschlafen, als sie auf das Ergebnis gewartet hatte.
Mist … es wird immer noch gerechnet.
»J-Ja?«, krächzte sie.
»Dr. Crandall!«, rief jemand an der Bürotür. »Bitte entschuldigen Sie die Störung, aber Baako macht Rabatz. Ich dachte mir, das sollten Sie wissen.«
Sie setzte sich rasch auf, als sie den nasalen Tonfall ihres Viehzuchtstudenten von der Emory University erkannte.
»Ist gut, Jack, ich komme gleich.«
Sie stand auf, nahm einen Schluck aus der Büchse Cola light auf ihrem Schreibtisch und trat auf den Flur.
Jack Russo, der diensttuende Student, ging neben ihr her.
»Was ist los?«, fragte sie, darum bemüht, jeden Anflug von Vorwurf aus ihrer Stimme herauszuhalten, doch aufgrund ihres Mutterinstinkts klang die Frage schärfer als beabsichtigt.
»Keine Ahnung. Ich habe gerade ein paar Ställe ausgemistet, als er durchdrehte.«
Sie hatten die Tür erreicht, die zu Baakos Domizil führte. Im Keller hatte er sein eigenes Spielzimmer samt Schlaf- und Unterrichtsraum, alle vom Rest der Einrichtung abgetrennt. Tagsüber durfte er sich unter Aufsicht auf dem bewaldeten, hundert Morgen großen Versuchsgelände des Yerkes-Primatenzentrums frei bewegen. Die Haupteinrichtung war fünfzig Kilometer entfernt in der Emory University untergebracht.
Für ihren Geschmack war das immer noch zu nah. Sie zog die Freiheiten vor, die sie hier draußen in Lawrenceville genoss. Ihr Projekt war vom Rest der Forschungsstation nahezu unabhängig und wurde durch ein Stipendium der DARPA finanziert, das der Schirmherrschaft einer neuen Initiative des Weißen Hauses unterstand, die BRAIN genannt wurde, die Abkürzung für Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies – Gehirnforschung mittels innovativer Neurotechnologie.
Maria, die einen zweifachen Doktortitel in Genomik und Verhaltensforschung hatte, war zusammen mit ihrer Schwester Lena für dieses einzigartige Projekt speziell ausgesucht worden: die Erforschung der Evolution menschlicher Intelligenz. Das Projekt erhielt weitere Mittel vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Deutschland, wo ihre Zwillingsschwester derzeit die parallele Genomforschung leitete.
Maria hatte die unterste Tür erreicht und zog die Magnetkarte durchs Lesegerät. Sie eilte in den Raum, gefolgt von Jack. Der Student war einen Kopf größer als sie, bekleidet mit einem übergroßen kakifarbenen Overall mit dem Emblem der Emory University auf der Schulter. Er streichelte nervös seinen struppigen blonden Spitzbart, der zu seinem ungekämmten Haar passte, das er sich nach Hipsterart mit einem Kopftuch zurückgebunden hatte.
»Schon okay«, versuchte Maria, den besorgten Studenten zu beruhigen, als sie den Vorraum ihres Forschungsbereichs betrat. »Weshalb haben Sie nicht Tango hergeholt? Meistens hilft das.«
»Mach ich noch.« Jack entschwand erleichtert durch eine Seitentür.
Maria trat vor ein breites Fenster mit acht Zentimeter dickem Sicherheitsglas. Dahinter lag ein Raum mit bunten Kästen, jeder mit einem Buchstaben des Alphabets versehen. Sie wirkten wie die Bauklötze eines Kindes, waren aber dreißig Zentimeter breit und aus dickem Plastik. An der Wand hing eine Weißwandtafel, auf der Ablage lagen verschiedenfarbene Marker. Die einzigen Möbelstücke waren ein breiter Tisch und mehrere Stühle.
Das war der Unterrichtsraum für einen einzigartigen Schüler.
Der Schüler ging vor dem Fenster hin und her und stützte sich dabei auf den linken Arm, während er mit dem rechten Zeichen machte, als murmele er vor sich hin. Er war sichtlich aufgebracht.
»Baako!«, rief Maria und legte die Hand aufs Glas. »Alles gut. Hier bin ich.«
Er gab einen freudigen Laut von sich und kam in ihre Richtung.
Sie ging zum Eingang hinüber, entriegelte ihn mit der Magnetkarte und trat in den kleinen Käfig an der anderen Seite. Dann schloss sie die Käfigtür auf und trat in den Unterrichtsraum.
Baako watschelte ihr aufrecht entgegen. Er legte ihr einen warmen, pelzigen Arm um die Taille und drückte ihr seine gewölbte Stirn an den Bauch. Offenbar wollte er getröstet werden.
Sie setzte sich auf den Boden und bewegte ihn dazu, es ihr nachzutun. Währenddessen beobachtete sie ihn aufmerksam und versuchte, seine Körpersprache zu deuten.
Baako war ein dreijähriger Flachlandgorilla, ein unreifes Männchen mit einem Gewicht von hundertfünfzig Pfund und einer Größe von über hundertzwanzig Zentimetern. Er war zwar kräftig, wirkte aufgrund seines Körperbaus aber schlaksig. Als er sich vor sie setzte, blickte er sie gestresst mit seinen großen karamellfarbenen Augen an. Die buschigen schwarzen Augenbrauen hatte er besorgt zusammengezogen. Seine Lippen waren angespannt, die weißen Zähne lugten hindurch.
Maria hatte ihn seit seiner Geburt begleitet und kannte Baako durch und durch – sein Verhalten und seine Physiologie. Vierteljährlich wurde eine Ganzkörpertomografie durchgeführt, um sein Wachstum, die Anatomie des Schädels und die Gehirnentwicklung zu dokumentieren.
Sie umarmte ihn und streichelte über die knochige Scheitelnaht in der Mitte seines Schädels. Für einen Gorilla seines Alters war sie schwach ausgeprägt. Das galt auch für die Kieferknochen, weshalb seine Schnauze flacher war als bei Primaten üblich.
»Was hast du denn, mein Hübscher?«, sagte sie mit leiser, beruhigender Stimme.
Er hob beide Fäuste, dann öffnete er die Hände und fuhr sich mit gespreizten Händen von außen nach innen über die Brust.
[Angst]
Sie reagierte mit Stimme und Handzeichen, zeigte auf ihn, wiederholte das Zeichen. Dann reckte sie die geöffneten Hände und hob leicht die Schultern. »Wovor hast du Angst?«
Er drückte den Daumen an sein Kinn und spreizte die Finger.
[Mutter]
Baako betrachtete sie als seine Mutter, was sie in vielerlei Hinsicht auch tatsächlich war. Sie hatte ihn zwar nicht zur Welt gebracht, doch sie hatte ihn großgezogen wie ihr eigenes Kind. Selbst vom biologischen Standpunkt aus war Baako praktisch ihr Kind, denn er war kein richtiger Flachlandgorilla. Sein einzigartiges Genom war im Fertilitätslabor entstanden, der Embryo von einem weiblichen Gorilla ausgetragen worden.
»Es geht mir gut«, sagte sie zu Baako und unterstrich die Äußerung damit, dass sie ihn drückte. »Das siehst du doch.«
Baako löste sich von ihr und schüttelte den Kopf.
Er wiederholte das Zeichen für Mutter, dann legte er die rechte Hand um sein Kinn und ließ sie fest auf die Linke herabfallen, die er zur Faust geballt hatte, während der Zeigefinger auf sein Gegenüber wies.
[Mutter-Schwester]
Maria nickte, denn jetzt verstand sie, was er meinte.
Er macht sich Sorgen um Lena.
Baako hatte zwei Mütter: Maria und ihre Schwester Lena. Baako betrachtete sie beide als Ziehmütter. Zunächst hatten sie befürchtet, es könnte Baako verwirren, weil sie identische Zwillinge waren, doch wie sich schon bald herausstellen sollte, hatte er im Unterschied zu ihren Kollegen in der Forschungsstation keine Mühe, sie zu unterscheiden.
Baako wiederholte das erste Zeichen immer wieder.
[Angst, Angst, Angst …]
»Du brauchst keine Angst zu haben, Baako. Darüber haben wir doch geredet. Lena ist im Moment nicht hier, aber sie kommt wieder. Es geht ihr gut.«
Sie formte die Buchstaben O und K.
Abermals schüttelte er den Kopf und wiederholte das Zeichen für Angst.
Sie wiederholte ihre anfängliche Frage, diesmal eindringlicher als zuvor, denn sie wollte den Grund für seine Erregung erfahren. »Weshalb hast du Angst?«
6:38
Er lässt sich aufs Gesäß nieder und blickt seine offenen Hände an. Er krümmt und streckt abwechselnd die Finger und überlegt, wie er sich ausdrücken soll. Schließlich legt er die Fingerspitzen an die Stirn und wendet ihr die Handfläche zu.
[Weiß nicht]
Er legt sich den linken Arm quer auf die Brust und zeigt mit dem rechten Daumen zwei Mal auf sein Gesicht, schlägt das rechte Handgelenk gegen das linke.
[Gefahr]
Sie runzelt die Stirn, dann schaut sie ins andere Zimmer zu seinem Lager aus Decken. Sie tippt sich mit dem Zeigefinger an die Stirn, dann krümmt sie ihn zwei Mal und sagt: »Das war bloß ein Traum, Baako.«
Er schnaubt.
»Du weißt doch, was Träume sind, Baako. Darüber haben wir geredet.«
Er schüttelt den Kopf und imitiert ihre Geste.
[Kein Traum]
6:40
Maria spürte Baakos Verunsicherung. Er glaubte anscheinend, Lena sei in Gefahr. Plötzlich musste sie an ihre eigene unerklärliche Besorgnis beim Betreten des Büros denken.
Muss ich mir Sorgen machen?
Sie hatte einiges über die einzigartige Bindung zwischen Zwillingen gelesen, die angeblich über weite Entfernungen wirksam blieb. Auch Tieren wurde diese übernatürliche Fähigkeit zugeschrieben. Hunde gingen demnach Minuten vor dem unerwarteten Eintreffen ihres Herrn zur Tür. Als Wissenschaftlerin hatte sie diesen Berichten wenig Wert beigemessen. Empirische Daten zog sie Anekdoten vor.
Aber trotzdem …
Vielleicht sollte ich Lena anrufen.
Ihre Stimme am Telefon würde Baako beruhigen.
Und mich auch.
Sie sah auf die Uhr und überlegte, wie spät es in Kroatien sein mochte. Sie sprachen fast jeden Tag miteinander, entweder über Telefon oder Skype. Sie verglichen Notizen, tauschten sich über ihre Erlebnisse aus und unterhielten sich manchmal stundenlang, um ihre enge Beziehung über die weite Entfernung hinweg zu erhalten. Sie wusste, dass es nicht ungewöhnlich war, dass Zwillinge ihre intime Beziehung ein Leben lang aufrechterhielten, doch sie und ihre Schwester waren durch harte Umstände und Kummer noch enger zusammengeschweißt worden.
Sie schloss die Augen und vergegenwärtigte sich die kleine Wohnung in Albany, New York, in der sie aufgewachsen waren.
Die Tür ihres Zimmers knarrte. »Wo sind denn meine beiden Kätzchen?«
Maria schmiegte sich unter der Bettdecke an Lena. Sie war schon neun und hatte ihr eigenes Bett, doch sie schliefen immer beieinander, bis ihre Mutter nach Hause kam. Ihren Vater hatten sie nie kennengelernt, doch bisweilen holte Lena ein Fotoalbum hervor. Dann betrachteten sie sein Gesicht und überlegten, wo er wohl sein mochte und weshalb er fortgegangen war, als sie noch Säuglinge waren. Manchmal war er der Held ihrer Geschichten, manchmal der Schurke.
»Höre ich da ein Schnurren unter der Decke?«
Lena kicherte, und Maria stimmte ein.
Die Decke wurde weggezogen, und sie schnupperten Seifengeruch. Ihre Mutter wusch sich immer die Hände, wenn sie nach Hause kam.
»Da sind ja meine Kätzchen«, sagte sie und ließ sich aufs Bett sinken, müde von ihren beiden Jobs. Abends arbeitete sie im Spirituosenladen an der Ecke und tagsüber im Costco am anderen Ende der Stadt. Sie umarmte ihre beiden Töchter, dann verfrachtete sie Maria behutsam in ihr eigenes Bett.
Maria und Lena verbrachten den größten Teil des Tages allein in der Wohnung. Babysitter waren zu teuer. Ihre Mutter hatte ihnen eingeschärft, nach der Schule gleich nach Hause zu gehen und die Wohnungstür abzuschließen. Das machte ihnen nichts aus – jedenfalls nicht viel. Sie leisteten sich gegenseitig Gesellschaft, spielten miteinander oder schauten sich Zeichentrickfilme an.
Als Maria in ihrem eigenen Bett lag, küsste ihre Mutter sie auf die Stirn. »Schlaf weiter, mein kleines Kätzchen.«
Maria versuchte zu miauen, doch es wurde ein Gähnen daraus. Sie war eingeschlafen, bevor ihre Mutter die Tür hinter sich schloss.
Ein lautes Klopfen versetzte Maria in die Gegenwart zurück.
Sie wandte sich zum Beobachtungsfenster um. Jack winkte ihr zu, in der Hand hielt er eine Leine.
Sie räusperte sich und rief: »Kommen Sie rein!«
Sie rang um Fassung, versuchte, ihre Sorge um Lena zu verdrängen. Doch die Erinnerung hatte ihr bewusst gemacht, wie rasch das Leben sich ändern und dass Liebe sich von einem Moment zum anderen verflüchtigen konnte. In ihrem zweiten Semester am College waren sie mitten in der Nacht angerufen worden. Der Spirituosenladen war überfallen worden, und ihre Mutter lag tot auf dem Linoleumboden.
Von da an waren sie auf sich gestellt gewesen.
Sie verspürte einen Anflug von Angst.
Lena, ich hoffe, es geht dir gut.
Als Jack zur Tür ging, begrüßte Baako ihn lautstark und sprang auf und ab – nicht wegen Jack, sondern wegen dessen angeleintem Begleiter.
Doch der Student war nicht allein. Bei ihm war ein weit weniger willkommener Besucher. Im Fenster tauchte der kahle Schädel des Leiters der Versuchsstation auf. Offenbar war die Kunde von der morgendlichen Aufregung in kürzester Zeit bis in Dr. Trasks Campusbüro gedrungen.
Maria wappnete sich innerlich für die bevorstehende Konfrontation. Jack trat als Erster ein, zwängte sich durch die Käfigtür und leinte seinen Schützling los.
Baako schnaubte aufgeregt, als der australische Hütehund ihn ansprang. Sie wälzten sich über den Boden. Tango war zehn Monate alt, hatte gesprenkeltes graues Fell und einen schwarzen Kopf. Vor einem halben Jahr hatte Baako ihn aus einem Wurf ausgewählt. Seitdem waren sie beste Freunde.
Dr. Leonhard Trask trat mit finsterer Miene ein. »Ich habe gehört, es gibt ein Problem mit Ihrem Versuchstier.«
»Nichts, womit wir nicht klarkämen.« Maria deutete auf die beiden umhertollenden Tiere. »Wie Sie sich selbst vergewissern können.«
Trask verschränkte die Arme, ohne hinzusehen. »Sie haben die Empfehlungen des Vorstands für den Umgang mit dem Tier gelesen. Die Sicherheitsbestimmungen sollten bereits jetzt eingehalten werden, bevor es geschlechtsreif wird.«
»Das heißt, wir sollen ihn in einen Käfig sperren, wenn keine Aufsichtsperson anwesend ist.«
»Das dient nicht nur der Sicherheit des Versuchstiers, sondern auch der der Angestellten.« Trask deutete auf Jack. »Der Schimpanse hätte die Glasscheibe zerbrechen und sich befreien können.«
»Dafür ist er nicht kräftig genug …«
»Noch nicht«, schnitt Trask ihr das Wort ab. »Es ist besser, er gewöhnt sich schon jetzt an den Käfig, solange er noch formbar ist … Besser jetzt als später.«
Sie gab nicht nach. »Ich habe dem Vorstand jede Menge Unterlagen geschickt, die belegen, dass die Käfighaltung die geistige Entwicklung von Primaten verzögert. Primaten sind intelligent. Sie verfügen über Selbstbewusstsein, haben einen Sinn für Vergangenheit und Zukunft und können abstrakt denken. Bei solchen Lebewesen können Isolation und Käfighaltung unerwünschte Auswirkungen auf die geistige Gesundheit haben, was wiederum stressinduzierte Störungen, wenn nicht gar eine ausgewachsene Psychose zur Folge haben kann. Das ist sozusagen der erweiterte Hintergrund des Sicherheitsthemas.«
»Der Vorstand hat Ihre Bedenken zur Kenntnis genommen und sein Urteil gefällt. Sie haben fünfundvierzig Tage Zeit, die neuen Bestimmungen umzusetzen.«
Der Vorstand war mit lauter Jasagern besetzt, die Trask zu Willen waren. Ehe sie etwas entgegnen konnte, machte Trask kehrt und ging hinaus. Sie ließ ihn gehen, denn sie wusste, dass die Schikanen auf beruflichem Neid beruhten. In ihr Projekt flossen weit mehr Forschungsgelder als in die übrigen Forschungsfelder der Einrichtung, weshalb es eine Menge Ressourcen und auch mehr Raum beanspruchte.
Ihr war zu Ohren gekommen, dass Trask beabsichtigte, seine Transplantationsforschung auszuweiten und Schimpansen als Versuchstiere einzusetzen. Sie hatte die Anträge gelesen und sie für mangelhaft befunden. Er wollte Versuche wiederholen, die bereits durchgeführt worden waren, und zudem auf unnötig grausame Weise.
Ein Grund mehr, ihm die Stirn zu bieten.
Sie konzentrierte sich wieder auf Baako, der Tango auf dem Schoß hielt. Während der Unterhaltung hatte er sich still verhalten. Offenbar hatte er ihre Anspannung wahrgenommen und vielleicht sogar begriffen, dass es um ihn gegangen war. Sie blickte sich in seinem Zuhause um und versuchte, sich vorzustellen, wie es für ihn wäre, nachts im Käfig eingesperrt zu sein.
Aber sind diese Räume nicht auch eine Art Käfig?