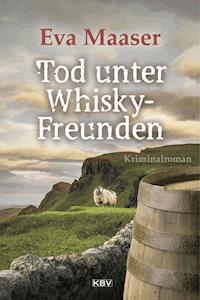9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er hat eine unheimliche Gabe … ist sie Segen oder Fluch? Der Sammelband »Das Flüstern der Toten« von Eva Maaser jetzt als eBook bei dotbooks. Ein kleines Dorf am Venner Moor im Jahre 1803. In einer stürmischen Nacht wird Jan Droste Tomberge geboren, auf dem ein Fluch zu liegen scheint: Während er heranwächst, zeigt sich immer mehr, dass er das zweite Gesicht hat. Die Dorfbewohner bringen dem ungewöhnlichen jungen Mann nur Misstrauen und Ablehnung entgegen – steht doch zu befürchten, dass er ihre dunkelsten Geheimnisse sehen kann … Dann wird im Dorf eine Leiche gefunden – ohne Kopf und ohne Hinweis darauf, wer der Tote gewesen sein könnte. Schnell macht ein Gerücht die Runde: »Der Tomberge war’s, die Ausgeburt der Hölle!« Ihm bleibt keine Wahl: Er muss den wahren Mörder finden, wenn er überleben will – egal, welche schrecklichen Wahrheiten seine Gabe dabei ans Licht bringt … »Poetische Bilder wechseln sich mit beklemmenden Spukwelten in dieser unheimlichen, unergründlichen Landschaft ab.« Münstersche Zeitung Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Sammelband »Das Flüstern der Toten« enthält die Historischen Romane »Der Moorkönig« und »Die Rückkehr des Moorkönigs« von Eva Maaser. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 924
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein kleines Dorf am Venner Moor im Jahre 1803. In einer stürmischen Nacht wird Jan Droste Tomberge geboren, auf dem ein Fluch zu liegen scheint: Während er heranwächst, zeigt sich immer mehr, dass er das zweite Gesicht hat. Die Dorfbewohner bringen dem ungewöhnlichen jungen Mann nur Misstrauen und Ablehnung entgegen – steht doch zu befürchten, dass er ihre dunkelsten Geheimnisse sehen kann … Dann wird im Dorf eine Leiche gefunden – ohne Kopf und ohne Hinweis darauf, wer der Tote gewesen sein könnte. Schnell macht ein Gerücht die Runde: »Der Tomberge war’s, die Ausgeburt der Hölle!« Ihm bleibt keine Wahl: Er muss den wahren Mörder finden, wenn er überleben will – egal, welche schrecklichen Wahrheiten seine Gabe dabei ans Licht bringt …
Über die Autorin:
Eva Maaser, geboren 1948 in Reken (Westfalen), studierte Germanistik, Pädagogik, Theologie und Kunstgeschichte in Münster. Sie hat mehrere erfolgreiche Krimis, historische Romane und Kinderbücher veröffentlicht.
Bei dotbooks erschienen bereits Eva Maasers Kriminalromane »Der Clan der Giovese«, »Das Puppenkind«, »Tango Finale«, »Kleine Schwäne« und »Die Nacht des Zorns«. Kommissar Rohleffs erster Fall »Das Puppenkind« ist auch im Sammelband »Tatort: Deutschland« erhältlich.
Eva Maaser veröffentlichte bei dotbooks außerdem ihre historischen Romane »Der Geliebte der Königsbraut«, »Der Hüter der Königin«, »Der Paradiesgarten« und »Die Astronomin«. Zwei ihrer historischen Romane sind auch im Doppelband unter dem Titel »Der Geliebte der Königsbraut & Der Hüter der Königin« erhältlich.
Zudem erschienen bei dotbooks Eva Maasers Kinderbuchserien um Leon und Kim: »Leon und der falsche Abt«, »Leon und die Geisel«, »Leon und die Teufelsschmiede« und »Leon und der Schatz der Ranen«, »Kim und die Verschwörung am Königshof«, »Kim und die Seefahrt ins Ungewisse« und »Kim und das Rätsel der fünften Tulpe«.
***
Sammelband-Originalausgabe August 2020
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Eine Übersicht über die Copyrights der einzelnen Romane finden Sie am Ende dieses eBooks.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / LightField Studios / Jill Battaglia / kdshutterman / hydebrink / Myszka / Nik Merkulov
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-060-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Flüstern der Toten« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Eva Maaser
Das Flüstern der Toten
Zwei Romane in einem eBook
dotbooks.
Der Moorkönig
Schon seine Geburt steht unter keinem guten Stern: Als Jan im Winter 1803 zur Welt kommt, umtost ein heftiger Sturm das stattliche Bauernhaus seiner Eltern, und unheimliche Dinge gehen vor sich. Fortan behandeln ihn seine Familie und die abergläubischen Dorfbewohner wie einen Aussätzigen. So kommt es, dass Jan auch später lieber schweigt als redet und sich am wohlsten fühlt, wenn er allein im Moor herumschweifen kann. Hier, in der düsteren Einsamkeit, entdeckt er seine mysteriöse Gabe: das Zweite Gesicht – die Fähigkeit, die Zukunft vorherzusehen. Aber ist das ein Geschenk oder ein Fluch?
Kapitel 1
Das Kind in der Wiege schrie und greinte nicht wie andere Kinder. Es lauschte den Stimmen, die im Wispern der Flammen zu ihm sprachen, und betrachtete die Bilder, die im Rauch aus dem Torffeuer aufstiegen. Es schwieg und schaute und lauschte. Fast zwei Jahre lag es in der Geborgenheit der Wiege, die man aus der Upkammer neben das Herdfeuer geschafft hatte. Das Kind war zufrieden mit der Welt der Bilder, die es noch nicht beunruhigten. Am Abend saßen seine Leute um das Feuer. In das Zischen der glosenden Torfbrocken mischte sich der Klang menschlicher Stimmen. Im Stocken und Flüstern, im Dehnen der Laute, den Seufzern dazwischen, dem heftigen Atemholen, in all dem klang mehr mit, als die Worte besagten. Das Schüreisen fuhr in die Glut, im Prasseln des Feuers gellte der Schrecken ferner Kriege nach und das Brausen der Flammen, die sich irgendwo durch die Eichenbalken eines Hofes bis zum Dachfirst fraßen.
Es war fast, als herrschte eine Art Vakuum um die Wiege. Nicht, daß es dem Kleinen an etwas Lebensnotwendigem wie Nahrung und Wäsche fehlte. Nur außerhalb der Zeit, in der er zu versorgen war, blieb er sich selbst überlassen. Die abgewetzten Kufen der Wiege schaukelten kaum noch. Es kostete Mühe, sie in Bewegung zu halten, und so kam es selten vor, daß eine der Frauen im Haus beim Kartoffelschälen und Bohnenschnippeln am Wiegenband zog. Es war bequem, das Kind in der Wiege zu lassen, und es war fast zu spät zum Laufenlernen, als endlich jemand daran dachte, den Jungen auf die Füße zu stellen.
Vielleicht wäre es dazu nie gekommen, wenn nicht Klara Potthoff, die Nachbarin, in die Wiege geschaut hätte, weil Jan sich aus den Tüchern und Bändern des Wickelbundes gekämpft hatte und mit den befreiten Füßen ans Fußbrett klopfte. Mittlerweile konnte er die Beinchen nicht mehr gerade ausstrecken.
»Mein Chott, liegt der immer noch in der Wiege? Wollt ihr ihn drin festwachsen lassen?« rief Klara und hob das Kind heraus.
Sprechen lernte Jan noch später. Möglicherweise lag es an den beiden Jahren in der Wiege, daß er lieber schwieg. Oder daran, daß die vielen Gedanken, die ihm im Kopf herumgingen, lieber dort blieben, als sich mühsam durch das Dickicht von Worten einen Weg nach draußen zu bahnen.
Jan war Mia Droste Tomberges letztes Kind, ein nachgeborenes, als das Empfangen und Gebären eigentlich schon beendet war. Möglicherweise hielt Mia das Kind zwei Jahre in der Wiege, um den Platz besetzt zu halten. Mia hatte genug vom Kinderkriegen. Fast jedes Jahr hatte sie eins geboren, meist im Herbst. Drei Christkinder waren darunter. Im zeitigen Frühjahr, im Februar, wenn der Frost weicher wurde, die beißende Kälte wich oder der Boden dunkel vor Nässe glänzte, überkam den Bauern wie alles rings in der Natur die Lust, mehr als zu andren Zeiten. Außerdem gab es nach den Winterarbeiten und vor der Frühjahrsbestellung nichts Wichtiges zu erledigen. Trotzdem füllte sich das Haus nicht übermäßig mit Kindern. So wie regelmäßig die Wiege in Gang kam, so wurden kleine Särge zum Hof hinausgetragen. »Gottes Wille«, predigte Pfarrer Niesing beim Einsegnen der Leichen auf der Tenne, und der Lauf der Natur, fügte er in Gedanken hinzu.
Die Geburt hatte Mia Droste Tomberge in einer nassen, stürmischen Novembernacht des Jahres 1803 getroffen. Ohne Vorwarnung setzten die Wehen ein, zwei bis drei Wochen früher als erwartet, wobei sich der Tag für eine Geburt nie genau vorhersagen ließ. Aber nach so zahlreichen Geburten meinte Mia, ein Gefühl dafür zu haben, wann es soweit wäre. Sie lag in ihrem Bett in der Upkammer, als sie der erste Schmerz mit einer Wucht traf, die sie fast auseinanderriß. Mia stemmte den Rücken gegen den Strohsack.
Hubert Droste Tomberge bot unterdessen im Stall zusammen mit den Knechten und den beiden ältesten Söhnen alle Kraft auf, um Pferde und Kühe zu beruhigen. Ihr Stampfen, Muhen und Wiehern drang bis in die Upkammer.
Mia schrie gellend auf. Wenig später stand die Magd Anna in der Kammer mit der elfjährigen Lina an der Hand, Mias einziger Tochter, die sich zitternd an die Ältere klammerte. Anna und Lina teilten sich ein Schrankbett. Durch die Holzwand zur Upkammer hatten sie Mias Schrei gehört.
»Das Kind kommt. Bring Lina weg«, fuhr Mia die Magd an, »die hilft uns hier nicht. Weck Mohne Trude und schick Bennard zu Lütke Wierlings rüber, Martha holen.«
Die Magd starrte Mia entsetzt an. Lina begann zu plärren, weil sie die Furcht fühlte, die im Raum stand, die sie aber nicht begreifen konnte. Lina war blöd.
»Glotz nicht so. Nu mach schon.«
Anna schlug die Hand entsetzt vor den Mund und fuhr fort, Mia anzustarren. Da begriff diese. Es würde nichts nützen, nach Martha zu schicken. Martha hatte selbst vor ein paar Tagen geboren, eine gesunde, hübsche Tochter. Mia konnte auf keine weitere Hilfe in dieser Nacht hoffen als auf die einer unerfahrenen siebzehnjährigen Magd und einer alten ledigen Tante.
Eine neue Wehe schloß für einen Augenblick jeden Gedanken aus. Als sie verebbte, öffnete Mia die Augen und sah die Tante in Nachthemd und Haube in der Tür stehen.
»Mohne Trude«, stöhnte Mia, »das Kind kommt, und Martha kann nicht helfen. Nur du und die Anna, die von nichts eine Ahnung hat.«
Trude Bredenbeck war die Schwester von Mias Mutter Lina. Die Heirat der Schwester mit dem wohlhabenden Bauernsohn kam damals wie heute Trudes Vorstellung von einem Wunder auf schon blasphemische Weise nahe, denn sie bedeutete für die unansehnliche Trude mit der schief hängenden Schulter die Erlösung aus der Schäferei in der Gimbter Heide. Lina hatte darauf bestanden, daß Trude mit ihr in die Fremde ging. Vor zwei Jahren war die Schwester an einem bösartigen Fieber gestorben, und Trude sah sich in diesem Augenblick mit einer Verantwortung allein gelassen, die bisher die Schwester getragen hatte.
Tante Trude nickte besonnener, als ihr zumute war. »Das machen wir schon, nur keine Bange, Kind.«
Der Zuspruch verhalf Mia zu einer kurzen Entspannung, bis die nächste Wehe sie aufschreien ließ.
»Was schreist denn so«, tadelte die Tante, »das ist doch alles nichts Neues für dich.«
»Mohne, so schlimm war’s noch nie«, preßte Mia hervor.
Tante Trude schickte Anna mit Lina aus der Kammer und versuchte, sich daran zu erinnern, was jetzt zu tun war. Während sie um das Bett wuselte, warf sie besorgte Blicke auf die Nichte. Mia hatte sich sonst nicht so beim Kinderkriegen.
Der Wind heulte im Kamin des Herdfeuers.
Mia, deren Sinne durch die bevorstehende Geburt bis aufs äußerste gereizt waren, nahm etwas Fremdes wahr, und es fiel ihr, von Schmerzen und bösen Vorahnungen geplagt, nichts anderes ein, als sich in bekannte Deutungen zu flüchten. In das Heulen des Sturmes legte sie das Jaulen aller Teufel und bösen Geister, den dumpfen Ton aus dem Jagdhorn des wilden Jägers Wode, der mit seiner Meute wohl die Moraste und Bruchwälder der Davert verlassen hatte und in die Venne hinausstürmte, als wäre ihm die Zeit bis zu den Rauhnächten, den zwölf heiligen Nächten zwischen Weihnachten und Dreikönig, zu lang geworden.
Das Licht der Kerze flackerte im Luftzug, der durch die Fenster drang, und warf unruhig zitternde Schatten an die Wände. Es war eine Nacht zum Sterben und nicht zum Leben, fühlte die alte Tante, die den Beschwernissen der Geburt bisher mit Gleichmut begegnet war. Mit zunehmendem Alter scherte sie die Not der Jungen immer weniger. Wer die Lust hatte, mußte auch das Leid tragen. Das hatte Gott gewollt. Nur diese Geburt war anders. Über dieser spürte sie den Schatten des Todesengels.
Wenn es man nur das Kind trifft, dachte Trude. Wir haben doch schon drei gesunde Söhne auf dem Hof, was will Hubert denn mehr? Der Bennard, der Älteste, kriegt den Hof, Lütke-Hubert und der Anton werden Knecht, wenn sich Lütke-Hubert und Bennard nicht an die Koppe kriegen, sind ja fast gleich alt, die beiden. Trude spähte zu Mia hinüber, die sich auf dem Strohsack herumwarf. Und wenn die mir draufgeht, sann Trude weiter. Warum sind der Lina, meiner Schwester, nur die drei Töchter am Leben geblieben? Eine Erbtochter ist doch nicht das gleiche wie ein Sohn. Und jetzt ist Hubert hier der Bauer, weil er Mia geheiratet hat.
Was ist, wenn sie krepiert? Was tut dann der Hubert? Ist ja selbst nur ein Eingeheirateter. Nicht mehr lange, und die Jungen drängen nach. Bennard ist fünfzehn, fast erwachsen. Am Ende muß ich in die Einöde zurück, zum Hannes in die Schäferei. Da soll mich der Herrgott lieber vorher holen. Trude biß sich auf die Zunge und schlug ein Kreuzzeichen, um den letzten Gedanken zurückzunehmen.
Anna stolperte wieder in die Stube, nachdem sie Lina im Schrankbett eingeschlossen hatte. Ihr Gesicht rötete sich vor Aufregung und Hilflosigkeit angesichts der Gebärenden, die sich schreiend an ihre Bettstatt klammerte.
»Anna«, stöhnte Mia in einem lichteren Augenblick, »geh nachschauen, ob das Feuer gelöscht ist, nicht, daß uns noch der ganze Hof abbrennt.«
Das Mädchen schwor später, den Schatten des Leibhaftigen an der Wand gesehen, und noch später, die Toten in ihren Särgen klopfen gehört zu haben, die die Lebende riefen, und verdrängte dabei, daß das Klopfen von Lina herrührte, die mit den Fäusten gegen die Holzwand hämmerte.
Hubert stapfte herein, von der Magd geschickt. Mia gelang es nicht, das Schreien zu unterdrücken. Hubert zuckte zusammen, ließ sich von ihrer Qual verstören.
»Ich schick Bennard zu Potthoff rüber, Klara muß kommen«, stammelte er und wandte den Kopf, halb schon auf der Flucht.
»Schick nich Bennard, schick Lütke-Hubert«, stöhnte Mia, die auch in diesem Augenblick nicht vergaß, sich um ihren Ältesten, den Hoferben, zu sorgen. Sie dachte an die morastigen Wege durchs Venn.
Aber Hubert hörte sie nicht mehr, er hatte die Kammer verlassen.
Nach zwei Stunden, in denen sich das Heulen des Sturms mit dem Gewimmer der Gebärenden und den angstvollen Stimmen aus dem Stall mischte, preschte Bernards Pferd allein in den Hof, froh wiehernd, den vertrauten Stall erreicht zu haben. Die Knechte horchten in den Sturm und weigerten sich, Hubert auf der Suche nach dem Sohn zu begleiten.
»Dann geh ich allein, aber das werdet ihr mir büßen.« Mit plötzlich aufflackerndem Zorn griff Hubert nach den Zügeln des Pferdes, das die Knechte mit einem Strohwisch trockenzureiben suchten.
»Willst du auch im Morast versinken?« Der alte Droste Tomberge, Mias Vater, war unbemerkt herangeschlurft. »Was soll aus dem Hof werden, wenn du da draußen verreckst? Bennard ist in Gottes Hand. Komm in die Küche und laß uns beten.«
Noch jemand wollte nicht, daß der Vater in die Nacht hinausritt. Anton, der Siebenjährige, klammerte sich an Huberts Bein. Warum schreit Modder so? hämmerte es in seinem Kopf. Sie soll aufhören damit. Warum hatte Mohne Trude ihn am Arm gepackt, als er in die Kammer laufen wollte? Daß da was Neues ankommen sollte, wußte Anton schon. Was ging ihn das an, er kam vor dem neuen Kind. »Wenn wir man nicht bald das Totenglöckchen hier hören«, hatte Mohne düster gemurmelt, und Anton hatte aus der von Angst geschärften Hellsichtigkeit des Augenblicks genau verstanden, daß die Mutter gemeint war.
Er schrie dem Vater ins Ohr: »Vadder, laß den Storch das neue Kind wieder in den Pfuhl schmeißen, ich will es nicht.«
Hubert gab ihm eine Ohrfeige. »Willst du wohl still sein.«
Bald saßen alle, die nichts zu tun hatten, mit dem Rosenkranz um das gelöschte Herdfeuer und starrten in den Schein der Kerze, die Lichtmeß geweiht worden war, um in Nächten wie dieser Trost zu spenden.
Eine weitere Stunde verrann, und die in der Küche fragten sich, ob es am Morgen drei Tote geben würde.
»Mohne«, flüsterte Mia, »mit dem Kind stimmt was nicht. Ich spür das. Ich glaub, es liegt falsch.« Ihre Stimme klang matt. Trude entsetzte sich beim Klang dieser Stimme mehr als bei dem Geschrei vorher. Mit Mia schien es zu Ende zu gehen. Die Alte legte zögernd die Hände auf den hochgewölbten Leib und zuckte zusammen, als Mias Hände sich über ihre krallten.
»Da, spürst du das? Das Kind liegt verkehrt. Es kann nicht raus.«
Trude war schon lange klar, daß hier etwas nicht stimmte, und so entschloß sie sich zu einem unerhörten Schritt, um wenigsten das Leben der Nichte zu retten. Sie schickte Anna, die ihr nun doch zur Hand ging, den Bauern holen.
Hubert blieb auf der untersten Stufe stehen.
»Komm rauf«, flehte Trude, »du mußt was tun, sonst krepiert Mia.«
»Bist du noch gescheit? Das ist Frauensache, das müßt ihr unter euch abmachen.« Hubert hob abwehrend die Hände und ließ sie langsam sinken, als er Mia stöhnen hörte. »Ich wüßt auch nicht, was tun«, flüsterte er ratlos. Das Mitleid schnürte ihm die Kehle zu, während sich sein Fuß schon rückwärts tastete.
Trudes Stimme ließ ihn innehalten. »Hubert, das Kind liegt falsch, will mit dem Stiärt raus. Du kennst das doch, wenn ein Kalb in der Kuh falsch liegt, dann versuchst du, es zu drehen oder bei den Hufen zu packen. Hubert, das hier ist nichts anderes, du hast das doch schon gemacht, Hubert, komm her!« Die Stimme drängte und beschwor so lange, bis Hubert nicht anders konnte, als an das Bett heranzutreten.
Schließlich drückten Anna und Trude Mia die Knie auseinander, und Huberts Hand wand sich in den Leib seiner Frau. Am Ende einer letzten Preßwehe, die Mias Körper sich aufbäumen ließ, zog er an zwei winzigen Füßen ein blutiges Bündel mit einem Schwall dunkelroten Blutes aus Mia heraus. Hubert ließ das Kind auf den durchweichten Strohsack fallen und kümmerte sich nicht darum, ob es lebte oder starb. Er wankte aus der Stube, ohne sich umzuschauen, wollte nichts weiter, als Blut, Gestank und Gewimmer entgehen. Mia war kein Mensch mehr für ihn. Hubert verstand jetzt, warum Frauen beim Akt der Geburt keinen Mann duldeten. Mohne Trude hatte recht. Es war kaum anders als bei einer kalbenden Kuh. Das ist nicht gerecht, haderte er mit seinem Schöpfer, daß der Mensch nicht mehr sein soll als das Vieh.
Im Morgengrauen kam Bernard auf den Hof gekrochen, verdreckt von Kopf bis Fuß, aber heil an allen Gliedern.
In der Upkammer war es Trude mit Anna zusammen gelungen, Mia auf sauberes Stroh und saubere Laken zu betten, das Kind, das seltsamerweise lebte, zu reinigen und in die alte Familienwiege zu legen.
Mia sank in einen erschöpften Schlaf und auch das Kind, das nicht hatte zur Welt kommen wollen. War vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen, dachte Trude nüchtern. Was hat er schon zu erwarten, der Kleine, als vierter Sohn?
Seit 300 Jahren saßen die Droste Tomberge auf ihrem Hof, dem ehemals größten in diesem Teil der Venne zwischen Venntruper Heide und Venner Moor, am westlichen Rand der Davert, drei bis vier Wegstunden vom nordöstlich gelegenen Münster entfernt. Noch immer beeindruckte der Hof mit dem breiten Vier-Ständerhaus, der Lieftucht, dem Häuschen für den Altbauern, der Scheune, dem Schuppen, dem Schweinestall und der Immenschuer, dem Bienenhaus. Alte Eichen standen im Hof, Schattenspender im Sommer und durch das wertvolle Holz die Spardose, der Notgroschen für schlechte Zeiten. Um das Gehöft zog sich eine mächtige Wallhecke, dicht verwachsen, auf einer Seite von einer Gräfte, einem Wassergraben, begleitet, letzter Hinweis darauf, daß dem Hof ehemals, als größtem Erbpachthof, als Vollerbenhof der Droste zu Senden, mehr Bedeutung zugekommen war. Tatsächlich war es mit dem Hof stetig, wenn auch sehr gemächlich, bergab gegangen durch ein paar ungeschickte Vorfahren und die vergangenen unruhigen Zeiten wie die Kriege des machthungrigen Bischofs Christoph Bernhard von Galen und die Umtriebe Bischof Clemens August von Bayerns, des Franzosenfreundes, der die Münsterländer in den Siebenjährigen Krieg hineingezogen hatte. Jetzt gehörte nur noch ein Heuerlingskotten, der von Lütke Wierling, zum Drostehof. Der andere, der von Pentrop, war im vorigen Jahrhundert aus der Abhängigkeit der Drostes in die der landadeligen Schonebecks geraten, die das meiste Land ringsum besaßen. Der dritte Kotten, mitten im Venn gelegen, war mit der Zeit verschwunden, es fand sich kein Pächter mehr, der die paar sumpfigen Äcker bearbeiten mochte. Längst waren vom ehemaligen Wohnhaus nur ein paar morsche Balken übrig, in denen Eulen und Nattern hausten.
Mit vier weiteren Höfen und dem Heuerlingskotten bildete Droste Tomberge eine Nachbarschaft im Venn. Die sechs Höfe ergaben ein Dreieck, dessen Spitze nach Süden wies. Diese Spitze nahm der Hof von Anton und Klara Potthoff und ihren Kindern ein.
Die Höfe von Schulze Hundrup, Holtkamp und Pentrop bildeten, fast in einer Reihe liegend, die nördliche breite Seite des Dreiecks. Der Schulzenhof, in der nordwestlichen Ecke, kam an Bedeutung mittlerweile dem Drostehof gleich, man konnte nicht mehr genau sagen, welcher der gewichtigere war. Das führte dazu, daß sich die Drostes und die Schulzes nicht immer ganz grün waren, abgesehen von der alten Geschichte zwischen Mia und Johann Schulze Hundrup.
Der Drostehof bildete die Mitte der Dreiecksseite zwischen Potthoff im Süden und Pentrop im Nordosten. Und noch mal auf halber Strecke, aber mehr im Venn, lag der Heuerlingshof. Welcher Vorfahre der Drostes auch immer die Hofstelle gründete, er hatte den Platz klug gewählt, auf einer Erhebung, einem Esch von zwei bis drei Metern, einer schmalen Kleizunge zwischen Torfheide und Moor. Eine Mergelgrube, die sich langsam erschöpfte, sicherte bis jetzt die Fruchtbarkeit des Bodens, so daß die Drostes weniger als die anderen, die sich später ansiedelten, auf die mühsame Düngung der Acker durch die Plaggen angewiesen waren, die aus dem Moor und der Heide gestochen wurden.
In den wachen, einsamen Nächten, die auf die Geburt folgten – denn der Sturm tobte drei Tage ums Haus beschloß Mia, das Kind, das sie nicht für lebensfähig hielt, Jan zu nennen. Sie hoffte, damit eine alte Geschichte still für sich begraben zu können.
Mia war die Erbtochter gewesen, aber von drei Schwestern die am wenigsten hübsche, was sie kaum störte, da nichts an ihrer Stellung im Leben etwas ändern konnte.
Sie bändelte mit Johann auf dem Schützenfest an, indem sie ihm ein Kränzchen an die Joppe steckte, als er mit den andern Bauern vom Königsschießen kam. Johann, ein nachgeborener Sohn ohne Aussicht auf ein Erbe, sah die Sache so vernünftig und richtig und angemessen wie seine Eltern, die Schulze Hundrups, die nichts dagegen hatten, daß einer ihrer Söhne den Drostehof heiratete. Solange noch nichts ausgemacht war, zog Johann es vor, für ein paar Gulden mit den Hollandgängern, von denen die meisten aus dem Tecklenburgischen kamen, über die Grenze zum Torfstechen und Grasmähen zu gehen, statt sich für das Erbe seines Bruders Heinrich abzurackern.
Nach einer Saison im Nachbarland änderte Johann seinen Namen in das holländische Jan, das ihm flotter vorkam. Die Namensänderung ging auf eine junge Holländerin zurück, die einen größeren Hof als Mia erbte.
Das alles erfuhren Mia und die Nachbarn von zurückkehrenden Hollandgängern, die in der Venne eine Rast einlegten und keine Einzelheit ausließen, weder über die hübsche, neue Braut noch über ihren Hof. Die Geschichte von Jan, den sie jetzt Hans im Glück nannten, unterhielt die Bauern zwischen Senden und Ottmarsbocholt einen ganzen öden Winter lang.
Hätte es eine feste Absprache zwischen den Drostes und den Schulze Hundrups gegeben, wäre es zu einer rechtlichen Auseinandersetzung gekommen und zu einer beiderseitigen Klärung und Übereinkunft. So blieb es bei dem Gerede auf den Höfen, das dem Ansehen der Drostes, und Mias vor allem, schadete.
Das Offensichtliche genügte den Redseligen bald nicht mehr. Die Phantasie, die sich am Gehörten und Erahnten entzündet, trieb Blüten in Andeutungen und versteckten Hinweisen, ein ländlicher Zeitvertreib, mit jener gemütlichen Spottlust gewürzt, die nichts eigentlich Böses im Sinn hat, nur ätzte sie den Stolz der ältesten Drostetochter wie Säure. Mancher mochte es ahnen, Mia allein wußte, daß etwas anderes zwischen ihr und Johann stand als die Lockung durch einen größeren Besitz und eine hübschere Braut, nur dafür hätte Johann seine Heimat nicht aufgegeben.
Mia heiratete keineswegs den ersten besten, der ihr danach über den Weg lief, sondern durchaus mit Bedacht, obwohl die Nachbarn munkelten, daß sie sich aus Verzweiflung weggeworfen hätte. Ihre Wahl fiel auf Hubert Sudhoff, einen Kötterssohn ohne Erbaussichten aus der Gegend hinter Ottmarsbocholt. Seine Familie gehörte zur weitläufigen Verwandtschaft der Drostes, weshalb sie sich ein wenig Ansehen zumaß, während sich die Drostes ihrerseits nur mit Mühe der Verwandtschaft entsannen. Als sich Mia und Hubert auf der Frühjahrskirmes in Senden begegneten und Hubert ein gewisses Interesse in Mias Augen las, bedachte er sich nicht lange.
Ihre Eltern aber versagten der Heirat ihre Einwilligung, und Mia mußte lange herumschreien und schließlich damit drohen, sich im Brunnen zu ertränken, bis der Vater Bereitschaft zeigte, eventuell nachzugeben. Mia gelang es, am Arm des stattlichen Hubert Sudhoff den Kopf wieder hoch zu tragen.
Vater Bernhard war jemand, der sich nicht drängen ließ und alles genau erwog. Als Bedingung für die Heirat wurde schließlich ausgemacht, daß Hubert ein Jahr als Knecht auf dem Drostehof schaffen würde, um seine Eignung als zukünftiger Bauer zu beweisen. Ohne Lohn, verstand sich, Huberts Dienst würde einen kleinen Ausgleich bringen für die Summe, die Bernhard Droste zu seiner Ablösung aus der Eigenbehörigkeit aufzubringen sich gezwungen sah. Denn das war für die Eltern das Ärgste an der Sache. Es ging nicht an, daß Mia, eine frei geborene Bauerntochter aus altem Geschlecht, einen Eigenbehörigen ehelichte.
Bernhard Droste rechnete seinem unerwünschten Schwiegersohn vor, was jeder Acker an Frucht in der nächsten Erntezeit tragen müßte, wieviel Milch er von den Kühen erwartete und wie hoch das Gras auf den Wiesen zu wachsen hatte. Fehlte noch, daß er vorgab, wieviel Eier die Hühner zu legen hatten und wieviel Ferkel die Sau werfen sollte. Mia durchkreuzte die Rechnung mit Leichtigkeit, als sie drei Monate später verkündete, daß sie schwanger sei. Sie heirateten noch vor Ostern, was niemandem einfiel, den nicht besondere Umstände trieben. Da wußten auch die Nachbarn Bescheid.
Es dauerte noch neun Jahre, bis Hubert seinem Schwiegervater zur Genüge bewiesen hatte, daß er zu wirtschaften verstand und keine Mühe hatte, die Erbfolge zu sichern. Erst dann übergab Bernhard Droste den Hof an ihn, der längst, wie es üblich war, den Namen des Hofes, Droste Tomberge, angenommen hatte. Jetzt endlich war Hubert Bauer auf seinem eigenen Hof. Mias Eltern zogen in die Lieftucht, ins Austragshäuschen.
Mia dachte in ihrem Wochenbett an diese alten Geschichten und an das Versprechen, das Hubert vor der Hochzeit von ihr erpreßt hatte. Es war wohl doch etwas zu ihm durchgesickert. Sie dachte an die ersten Kinder, die kaum ein Jahr alt wurden. Sie starben an Krämpfen, am Fieber, am Husten. Sie hatte lernen müssen, einem Kind nicht zuviel Liebe zu schenken, weil sie nicht wissen konnte, wie lange sie es behalten durfte. Trotzdem hätte sie dem neugeborenen Jan mehr Aufmerksamkeit gegönnt, wenn sie nicht die Erinnerung an die Geburt mit Scham erfüllte, sobald sie das Kind an die Brust nahm und den blonden Flaum auf dem Kinderkopf betrachtete. Sie war froh, nach dem Stillen den Kleinen Trude wieder überlassen zu können.
Trude war so umsichtig gewesen, Anna noch in der Nacht der Geburt ins Gebet zu nehmen. Da die gestammelten Beteuerungen der Magd ihr nicht genügten, ließ sie das Mädchen auf die Bibel schwören, daß ihr nie im Leben ein Wort über die Einzelheiten der Geburt über die Lippen kommen würde.
Anna setzte sich, als sie Trude entkommen war, zu den anderen, die alte Tante verschwand wieder in der Wöchnerinnenkammer. Im Laufe einer durchwachten Nacht bei Sturm und Regen wird nicht nur gebetet.
Möglicherweise hatte Anna tatsächlich nicht geredet, sondern Hubert war eine Andeutung entschlüpft, als er nach einem rastlosen Gang durch die Ställe bei den anderen am kalten Herdfeuer saß und ihm die Angst um seinen Ältesten in den Eingeweiden saß. Lütke-Hubert hatte vielleicht etwas aufgeschnappt, obwohl er mehr damit beschäftigt war, sich auszumalen, was passieren würde, wenn Bernard nicht zurückkäme. Dann würde er dem Vater als Bauer folgen. Aber dann gäbe es keinen älteren Bruder, der ihm sagte, was er in diesem oder jenem Fall zu tun hätte. Lütke-Hubert verwirrte der Gedanke, plötzlich ohne brüderliche Hilfe das Leben bestehen zu müssen.
Den Großvater hatten die Knechte rechtzeitig vor dem größten Wüten des Sturmes aus seinem Häuschen herübergeholt. Er nahm das Ausbleiben des Ältesten und die Geburt des Jüngsten nicht ohne Anteilnahme, doch letztendlich mit Gleichmut auf. Großvater Bernhard Droste ließ seinen Blick vom vierzehnjährigen Lütke-Hubert zum siebenjährigen Anton wandern, der mit dem Kopf auf den Armen schlief. Die Zukunft des Hofes schien gesichert.
Noch zwei Tage tobte der Sturm in der Venne. Mia wartete auf den Tod des Unglückswurms, der sich erst geweigert hatte, ins Leben zu treten und sich nun weigerte zu sterben.
Hubert zog zum Großvater in die Lieftucht, um die Wöchnerin nicht zu stören, wie er sagte. In den Tagen des Sturms sah er nicht oft nach Mutter und Kind. Fragte er Mia nach ihrem Befinden, hielt er den Blick fest auf das Kruzifix an der Wand über ihr gerichtet. Mia wurde ganz kalt unter der Decke. In Hubert stieg hin und wieder das Bild von Mias aufgerissenem Leib hoch. Dann zankte er mit den Knechten und Bernard, bis sein Ältester nur noch mit finsterem Gesicht über den Hof schlurfte.
Im Morgengrauen nach der dritten Nacht erhob sich draußen ein Getöse, größer und lauter als das Schrillen und Brausen des Sturms. Es klang wie ein gewaltiges Rauschen, ein Stöhnen mischte sich ein, ein Knacken und Knirschen, als würden die Schollen der Erde zum jüngsten Tag aufbrechen.
Noch nie hatte Hubert etwas Derartiges gehört. Es vertiefte das Grauen in seiner Seele. Als Stille einkehrte, der Sturm flaute ab, gellte es ihm noch so in den Ohren, daß ihm die Katastrophe, die er im Dämmerlicht sah, im ersten Moment geradezu gering vorkam. Genauer gesagt, erkannte er den vertrauten Platz vor der Tennentür nicht wieder, so daß ihn das Chaos draußen für einen Augenblick nichts anzugehen schien. Das innere Bild seines Hofes stimmte mit dem äußeren nur noch vage überein, die Mitte fehlte, das Herz: der Sturm hatte sich als Beute die größte Eiche geholt. Sie war quer über den Hof gefallen, hatte knapp die Scheune verfehlt und mit der Krone die Wallhecke zerschmettert. Die Größe eines solchen wohl dreihundert Jahre alten Baumes läßt sich erst dann ermessen, wenn er der Länge nach am Boden liegt. Das Wurzelwerk überragte das Tennentor und das Astgewirr der Krone den noch unzerstörten Teil der Wallhecke mehr als haushoch.
Die Knechte und Huberts Jungen näherten sich beklommen dem gefallenen Riesen und starrten ungläubig in den schweren, grauen Himmel über dem Hofplatz, der, so weit die Erinnerung der Droste zurückreichte, von der Eiche beschirmt worden war.
Hubert hörte hinter sich den Großvater heranschlurfen und brauchte sich nicht umzudrehen, um zu wissen, was der Alte fühlte. Er spürte selbst das Gewicht, das der Baum im Niederbrechen auf seine Seele gelegt hatte. Sein Rücken krümmte sich unwillkürlich wie der des Alten.
In der Nacht hatte der Regen aufgehört, und gegen Morgen war der Sturm abgeflaut, hatte mit seinem letzten Wehen die Wege getrocknet und Kälte mitgebracht, die mit einer Schicht Frost den Boden festigte. Hubert wagte es, die Knechte zu den Nachbarn zu schicken, um, wie es der Brauch verlangte, die Geburt anzuzeigen und um Hilfe zu bitten bei dem Unglücksfall.
Josef Lütke Wierling, der Heuerling, kam nachsehen, wie die Drostes das Unwetter überstanden hatten, als die Knechte gerade vom Hof ritten. Er blieb nicht länger als nötig, um das Wichtigste zu erfahren, und eilte dann, sein Werkzeug zu holen und Martha von der verfrühten Geburt zu erzählen. Hubert, berichtete er, habe merkwürdig dreingeschaut, als er von dem Kind sprach. Martha, mit ihrer sechs Tage alten Lisbeth im Arm, setzte sich, begierig nach weiteren Einzelheiten, im Bett auf.
Von den übrigen Nachbarn kam Anton Potthoff als erster. Ruhig und gefaßt lud er die Werkzeuge vom Leiterwagen und erkundigte sich in einer beiläufigen Art nach Mia und dem Kind, während er Hubert mit stetem Blick musterte. Klara hatte ihm, nachdem sie den Drosteknecht ausgehorcht hatte, genau aufgetragen, was er fragen sollte. Sie mußte zu Hause bleiben und die Kinder pflegen, die an Winterhusten litten.
Mit Peitschenknallen rumpelte schließlich Heinrich Schulze Hundrup auf den Hof, von seinen Söhnen Hermann und Paul begleitet. Heinrich stand breitbeinig vorn auf dem Wagen und blickte abschätzig über den Hof und zu Hubert, der ihm finster von unten entgegenstarrte.
Franz Pentrop blieb im Dreck stecken und kehrte schließlich um, Ludger Holtkamp waren das Backhaus und die halbe Scheune abgebrannt, und er brauchte selbst Hilfe. Da niemand mehr zu erwarten war, machten sich die Drostes mit ihren Helfern an die Arbeit. Drei Tage fuhren Sägen und Äxte ins Holz, erfüllten den Hof mit einem hellen Klang, der die dunklen Geister von Nacht und Sturm bannte. Wenig Worte fielen, jeder wußte, was zu tun war, Schlag folgte auf Schlag. Es gab keinen, der fleißiger und akkurater sägte als Hubert, sich mehr hingab an eine Arbeit, in der er ein Wiedergewinnen menschlicher Ordnung und Sicherheit sah, das sein Gemüt beruhigte und aufrichtete. Am Abend prostete er Heinrich Schulze Hundrup mit einem hausgemachten Klaren zu, und Heinrich schlug ihm anerkennend auf die Schulter, bevor er nach Hause fuhr.
Am zweiten Tag kamen Minna Pentrop und Anne Holtkamp vorbei, um nach Mutter und Kind zu sehen.
Es dauerte nicht lange, und rund um den eisernen Bohnentopf über dem Herdfeuer und bei der Arbeit im Hof setzte ein Wispern und Geraune ein, das kein Ende nehmen wollte: Er hat so helle Augen, allzu hell, wo hatte man schon einmal so ein durchscheinendes Blau gesehen? Die Händchen, weich und schwach wie Blütenblätter, ballten sich nicht zur Faust. Der wird nie was im Leben festhalten.
Zuletzt kam ein Wort auf, das begierig von Mund zu Mund getragen wurde. Hubert hörte es schließlich im Singen der Säge. Wechselbalg, ein Wechselbalg, kreischten die Sägen im Holz. Ein Monstrum mit dem bösen Blick, hämmerten die Äxte.
Vor der Niendüer, der Tür zur Tenne, stapelte sich das Holz, aber Hubert hatte keine Freude mehr an ihm. Endlich war der letzte Axtschlag gefallen, der letzte Balken lag hoch auf dem Haufen, Hubert griff zu und rückte das Holz zurecht. Da fuhr etwas in seine Hand, kroch den Arm hinauf bis in seinen Kopf und begann, sich aus einem nebelhaften Eindruck zu einem Bild zu verdichten, daß sich Hubert die Haare im Nacken sträubten. Gerade als er meinte, den Sinn des Bildes zu erfassen, dröhnte Heinrichs Stimme herüber, der am anderen Ende an den Stapel herangetreten war und seine Pranke darauf legte. »Das nenn ich einen feinen Haufen Holz, bald genug, um ein Haus zu bauen. Aber dazu wirst du’s nicht lang genug behalten.«
Einen Wimpernschlag lang war Hubert noch versucht, der sonderbaren Anwandlung nachzuspüren, die ihm schon zu entgleiten drohte, da zog er hastig seine Hand vom Balken und hielt in der Bewegung inne, um sich nicht zu bekreuzigen und dadurch Heinrichs Aufmerksamkeit stärker zu erregen. Heinrich hatte noch nicht geendet, da hatte sich Hubert das Wahnbild als Humbug aus dem Hirn geschlagen. Aber wie es bei solchen willentlichen Akten geht, das Verdrängte schwindet bereitwillig aus dem vordergründigen Bewußtsein und sackt tief in Schichten des Untergründigen, um dort seiner Stunde zu harren. Hubert würde das Bild wiedererkennen. Jetzt aber erhob er angriffslustig seine Stimme, vertrieb den dunklen Schatten des fast Geschauten.
»So? Und wer, außer mir, sollte wohl Anspruch darauf erheben?«
»Wer wohl? Freu dich, Hubert, brauchst dir um das Holz keine Gedanken zu machen, die Preußen nehmen’s gerne mit, wie’s da liegt, und sagen, es paßt genau für die Schatzung, die jetzt ansteht. Sollen wir das Holz noch auf die Tenne legen, damit es den Preußen nicht naß wird?«
Josef Lütke Wierling war von hinten an Heinrich herangetreten, nahm bedächtig die Pfeife aus dem Mund, stieß den Rauch aus und sagte: »Und du stellst gleich deine zwei Buben daneben, Heinrich. Wie ich gehört habe, heben die Preußen neue Truppen aus, da kommen ihnen Hermann und Paul gerade recht, stattlich wie die sind.«
»Immer sachte, Nachbarn«, ließ sich der alte Droste hören mit Tonkruke und Zinnlöffel in der Hand. Ein verschmitzter Ausdruck lag auf seinem Gesicht, das in gut sechzig Sommern und Wintern wie ein alter Apfel verschrumpelt und rotbraun gebacken worden war. Obwohl der Alte staturmäßig nicht viel hermachte und die Stimme kaum erhob, konnte ihm selbst der große und laute Heinrich, auch wenn es ihn jedesmal ärgerte, die geforderte Aufmerksamkeit nicht versagen.
»Heinrich, auch wenn deine Buben noch keinen Gestellungsbefehl bekommen haben, paß auf sie auf, schick sie ins Moor, wenn es sein muß, und wir kümmern uns um das Holz, auf daß die Preußen das Nachsehen haben. Darauf laßt uns einen heben.«
Der Zinnlöffel mit dem Klaren machte die Runde, stärkte den nachbarlichen Zusammenhalt und befeuerte den Haß auf die Preußen, die ihre Hände ausstreckten nach Geld, Vieh und Menschen.
»Als die Preußen letztes Jahr im August in Münster einzogen, haben die Menschen lauthals geweint und geklagt«, erzählte Anton Potthoff.
»Ja, und keiner hat einen Finger wider sie gekrümmt«, schrie der junge Bernard Droste.
Der alte Droste stahl sich leise davon und folgte Klara Potthoff, die von den anderen unbemerkt den Hofplatz mit einem Korb am Arm betreten hatte und mit ruhigem Schritt durch die Tenne ging, die Küche durchquerte und, ohne innezuhalten, die Treppe zur Upkammer erstieg.
Klara warf einen wissenden Blick auf das Kind, als sie den Korb vom Arm streifte. Sie fragte Mia nach Einzelheiten der Geburt, während sie sich über die Wiege beugte, und wunderte sich nicht weiter, als Mia ausweichende Antworten gab. Klara löste den Wickelbund und schlug die Tücher auseinander. Dann maß sie dem Kind die Hände und Füße, umfaßte den Kopf, schaute auch wohl in die Ohren und in das zahnlose Mäulchen. Das schien Mia ganz in Ordnung, denn Klara wurde in der Venne als Hebamme gerufen, auch wenn sie den Beruf nicht extra auf einer Hebammenschule erlernt hatte. Sie prüfte die Abnabelung. Zum Schluß strich sie dem Kleinen freundlich durch den blonden Flaum.
»Laß man, Mia, der macht sich schon, ein kräftiges, gesundes Kind, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht.«
Mia wollte das nicht hören.
»Dir hab ich was zur Stärkung mitgebracht. Du mußt wieder zu Kräften kommen. Hast wohl viel Blut verloren. Siehst sonst nicht so blaß aus. Komm, trink das mal gleich.«
Klara hielt Mia eine Tonkruke an den Mund, die mehr als puren Schnaps enthielt. Die Flüssigkeit schmeckte nach Kräutern und rann Mia brennend und wohltuend die Kehle hinab. Das Gebräu verbreitete eine angenehme Wärme im Magen und einen Nebel im Hirn. »Meinst du nicht, der Schnaps schadet meiner Milch?« flüsterte Mia und gab sich mit geschlossenen Augen einem Wohlgefühl hin. Als die Antwort auf sich warten ließ, öffnete sie die Augen wieder und sah Klara über die Wiege gebeugt allerhand Zeichen schlagen. Ihre Lippen bewegten sich stumm. Klara besprach das Kind.
»Klara?« rief Mia mit einem Mal scharf.
»Mach dir keine Gedanken, Mia. Trink noch einen Schluck, das tut dir gut und kann dem Kind nicht schaden.«
Klara schüttelte ihr die Kissen auf und drückte sie sanft hinein. Sie griff nach Mias Händen und hielt sie fest. Mia spürte die Kraft, die von Klaras Händen ausging.
Dann war Klara fort, und der Alte kam die Stufen herauf. Auch er beugte sich über die Wiege.
»Hat die Hexe ihre Zaubersprüche aufgesagt?« Als er Mias Erschrecken wahrnahm, fügte er hinzu: »Laß die nur brabbeln, das schadet nicht.«
Nachdenklich schaute er in die Wiege und sagte so leise, als wäre es nur für ihn selbst bestimmt: »So einer ist das also. Den hüt man schön, Miakind.«
Es sollte an diesem Tag nicht der letzte Besuch an der Wiege sein. Martha Lütke Wierling hatte sich aus dem Kindbett aufgerafft, ihre Tochter Lisbeth mit einem gestickten Häubchen ausstaffiert und in ein gutes Umschlagtuch gehüllt, ihren besten Rock angezogen und die Haare gebürstet, bis sie wie mattes Gold glänzten. So aufgeputzt stand sie mit dem Kind im Arm an Mias Bett und fühlte sich mit einem Mal unbehaglich. Hatte sie sich nicht über die Bräuche hinweggesetzt, die von einer jungen Mutter verlangten, bis zur Aussegnung nicht weiter zu gehen, wie das Dach des eigenen Hauses reichte? Nur um Mia Beistand zu leisten, war sie gekommen, versicherte sie sich stumm zur Ermutigung. Mit dem Kind sei etwas nicht in Ordnung, auch bei der Geburt gab es Merkwürdigkeiten, rief sie sich Josefs Worte ins Gedächtnis, wobei sie aus dem Gerede nicht recht klug geworden war. Jedenfalls stand sie jetzt hier, um den Dingen auf den Grund zu gehen und, wenn nötig, ihre Hilfe anzubieten.
Mia wußte, was Marthas Aufzug zu bedeuten hatte. Das sah Martha an ihrem Blick. Mia betrachtete mißgelaunt das hübsche Bild, das die andere mit ihrem Säugling bot. Alles, was an dieser rund und lieblich war, war an ihr herb und eckig, das lag nicht nur an den zehn Jahren Altersunterschied.
Sie schaute voll Neid auf das hübsche Köpfchen, das aus dem Tuch lugte. So eine rosige, gesunde Tochter hatte sie sich immer gewünscht. Als hätte der Gedanke einen Ungeist aufgeschreckt, steckte Lina, ihre eigene blöde Tochter, den zerzausten Blondschopf durch die Tür, starrte die Besucherin aus vorquellenden blauen Augen an und fragte weinerlich: »Modder?«
Mia nahm das Mitleid in Marthas Augen wahr, als diese sich von der unglücklichen Tochter zur Mutter umwandte, und ließ ihren Ärger an Lina aus. »Was willst du hier?« Erschrocken fuhr die Kleine herum und hastete die Stiege hinunter.
Martha hatte sich bei Mias barschem Ton zur Wiege geflüchtet und beugte sich über sie.
»Das Kind ist ja hübsch!« rief sie aus, und ehrliches Erstaunen lag in ihrer Stimme.
»Glaubst du wirklich?« fragte Mia verblüfft zurück, und dann fuhr sie so schroff fort, daß Scham und Verbitterung durchklangen: »Du hättest hören sollen, was sie über das Kind redeten, als sie dachten, ich schlafe. Ein Wechselbalg sei es. Klara Potthoff ist die einzige, die nicht meint, ich habe eine Mißgeburt geboren.«
Martha beugte sich tiefer über die Wiege, um ihre brennenden Wangen zu verbergen. »Aber nein, laß dir nicht so ein dummes Zeug einreden. Sieh doch mal, das Kind ist an allen Gliedern wohlgestaltet und hat so hellen, hübschen Flaum auf dem Köpfchen. Ich finde, es ist allerliebst.«
Vielleicht übertrieb sie in dem Bestreben, Mias Kummer zu lindern, aber die Worte zeigten die gewünschte Wirkung. Mias Züge entspannten sich, über ihre Wangen liefen erlösende Tränen.
Später saß Martha auf der Bettkante und versuchte, Mia über die Geburt auszuhorchen. Hatte sie lange in den Wehen gelegen? Sehr geblutet? Wer hatte ihr beigestanden? Doch nicht bloß die alte Trude? Mia versteifte sich innerlich, während die sanfte Stimme unablässig drängte, und schob das Kind der anderen fort, dessen rosige Wange sie eben noch gestreichelt hatte. Marthas Gesicht ließen Mißmut und Zurückweisung weniger hübsch erscheinen, als sie endlich mit ihrer Tochter die Kammer verließ.
Mia lehnte sich in die Kissen zurück. War Marthas Gefasel aufrichtig gewesen? Sie beugte sich vor und spähte in die Wiege. Unbewegt gab der geisterbleiche Wurm, der in ihr lag, ihren Blick zurück. Ein hübsches Kind?
Die Wierlings waren nur Heuerlinge, dienstverpflichtet den Drostes, die ihnen für ihre Arbeit den Kotten zur Verfügung stellten und ein paar kleine Acker zur eigenen Bewirtschaftung. Martha wußte, daß das Schicksal ihrer Familie vom Wohlwollen der Drostes abhing und dieses auf einer Verwandtschaft gründete, die sich mit jeder neuen Generation weiter in den Nebeln der Vergangenheit verlor. Bei all ihrer Sanftheit und Geradheit war Martha vernünftig genug, diesen Punkt nie aus den Augen zu verlieren.
Mia warf noch einen Blick auf ihren Sohn. Etwas Seltsames umspielte das Kind, zeigte sich nicht unbedingt an der Form der Gliedmaßen – obwohl feiner als die ihrer anderen Kinder – oder des Kopfes, auch nicht unbedingt an der schon ungewöhnlichen Blässe, das Seltsame hielt sich gerade außerhalb des Greifbaren: versuchte man ihm beizukommen, entzog es sich, achtete man nicht darauf, hing es als Schrecken über der Wiege wie ein Nachtmahr. Etwas Dämonisches haftete an dem Kind, dessen war sie sich nun sicher. Wer zweifelte jetzt noch an der Gottlosigkeit der Zeiten, in die es hineingeboren worden war.
Mia erinnerte sich an das Unglücksjahr 1801. Nach dem Frieden von Luneville, der die französischen Revolutionskriege durch die Verhandlungen Napoleons mit den Österreichern beendete, sickerten Gerüchte und Nachrichten in die Venne ein. Es hieß, Gebietsabtretungen und territoriale Verschiebungen seien zwischen den Mächten vereinbart worden, auch die Preußen sollten linksrheinisch Land verlieren und dafür mit westfälischem entschädigt werden, mit münsterländischem. Das Zittern vor der angedrohten Inbesitznahme durch die Preußen begann, protestantische Ketzer, allesamt.
Der Schlag, den die Münsterländer erwarteten, kam unverhofft noch im selben Jahr durch den Tod des Fürstbischofs, ihres Landesherrn. Es war das Ende der gottgesegneten Ordnung. Er starb viel zu früh, ihr Max Franz von Habsburg, aber teuflischerweise gerade passend, um für die neuen Herren Platz zu machen. Einen Nachfolger gab es wohl: Erzherzog Anton Viktor, wie sein Vorgänger aus dem Hause Österreich. Seine Wahl setzte Domdechant Spiegel, der Bistumsverweser, ein umtriebiger, ehrgeiziger Mensch, in aller Hast durch.
In Münster warteten sie noch immer auf den Österreicher, der es vorzog, sich hier nicht blicken zu lassen, in einem von Ketzern okkupierten Land. Dabei träumten die Leute davon, ihn an der Spitze siegreicher Truppen in Münster einziehen zu sehen, während die Preußen wie die Hasen davonliefen.
Stattdessen kamen die Preußen, im August 1802, und im darauffolgenden Februar war die preußische Inbesitznahme amtlich gewesen. Und gerade da mußte es geschehen sein, daß ein neues Leben in Mias Leib zu keimen begann. Unglücklicher hätte der Zeitpunkt nicht sein können. Dann geriet das Frühjahr so naß und kalt, daß das Korn auf den Feldern zu faulen begann – von den Kartoffeln ganz zu schweigen. Sie verwandelten sich in braunen Matsch, der stinkend durch die Finger rann. Es würde schwer werden, Mensch und Vieh durch den Winter zu bringen. Mia war mehr und mehr zu der Überzeugung gelangt, daß auf dieser Schwangerschaft kein Segen ruhte. Ohne sich zunächst ihre Absichten einzugestehen, war sie um Klara Potthoff herumgestrichen, hatte aber nicht den Mut gefunden, den Mund aufzumachen, um nach Kräutern oder was man in solchen Fällen schlucken mußte, zu fragen. Mia erinnerte sich einer Magd, die mehrfach vom Heuboden sprang, bis sie schließlich so unglücklich aufkam, daß sie sich das Genick brach. Klara hatte Mia während ihrer Begegnungen mehr als einmal aufmunternd von der Seite gemustert, aber selbst geschwiegen. Mia seufzte bei der schmerzlichen Erinnerung. Sie wußte ja, wie diese Dinge gehandhabt wurden. Den ersten Schritt tat die Bittstellerin, damit sie sich hinterher nicht Klara gegenüber auf Vorwürfe oder Anschuldigungen verlegen konnte, falls sie die Reue überkam. So lange waren die Hexenverbrennungen noch nicht her. Ihr Großvater hatte die letzte in Wolbeck, dem Hexenwolbeck, brennen sehen. Ein denkwürdiges Ereignis. Vielleicht hielt sie das darüber Gehörte letztlich davon ab, das entscheidende Wort zu sprechen.
»Lasset die Kindlein zu mir kommen«, hatte der Herr gesagt. Und warum holte er das Balg dann nicht?
Als sich das Kind in Mias Leib bewegte, hatte sie die Hoffnung auf Klara und ihren Tinkturenzauber aufgegeben. Es war zu spät. Nun lag der Wurm in der Wiege, und Mia fiel plötzlich ein, daß Gott sie mit der elenden Geburt und dem Monstrum, das schließlich dabei herausgekommen war, für ihre Anmaßung strafte, an seinen Ratschlüssen zu zweifeln und ihm ins Handwerk pfuschen zu wollen. Mia zog ihr Federbett bis zum Kinn. Sie versteifte sich trotzig auf den Gedanken, daß das Kind nicht lebensfähig sei, und richtete sich innerlich auf den baldigen Trauerfall ein – falls man von einem solchen sprechen konnte.
Noch etwas anderes bedrückte sie. Der Blick stand ihr vor Augen, mit dem Hubert sie bedacht hatte, bevor er die Kammer wieder verließ. Zwanzig Jahre hatten sie in Frieden miteinander gelebt. Es hatte kein Zerwürfnis zwischen ihnen gegeben, nur diesen Blick, der eine Kluft aufriß, die das Neugeborene einbezog. Noch kein Kind hatte Hubert so mißachtet, nicht einmal Lina. Eine Fügung Gottes, die jeden treffen konnte, hatte er die Schwachsinnige genannt. Nicht ein Wort des Vorwurfs gegen Mia.
Sie dachte an das Gesinde. Sicher tratschte es schon herum, daß der Bauer beim Alten in der Lieftucht hauste. Das war kein ordentlicher Zustand mehr.
Mia drehte sich zur anderen Seite, um die Wiege nicht mehr sehen zu müssen.
Der alte Droste sammelte die Enkelsöhne, die Knechte und den Schwiegersohn um sich, sobald die Helfer den Hof verlassen hatten. Noch am Abend begann ein Gehämmer und Geklopfe, das den ganzen nächsten Tag anhielt. Eine übermütige Stimmung breitete sich aus und löste die Anspannung, die seit den Tagen des Sturms herrschte. Das Lachen in den Stimmen, die das Haus erfüllten, schwappte schließlich in Mias einsame Kammer und trieb sie aus dem Bett. Mit Staunen gewahrte sie, wie der Haufen Bretter und Balken schwand. Überall im Haus, in der Scheune und im Spieker fanden sich zwei Balken, wo bislang einer war. Der Heuboden hatte eine zweite Bretterlage erhalten. Dann galt es noch, mit einem stinkenden Gemisch aus Moorerde, Ochsenblut und Kuhschiete das neue Holz so einzufärben, daß es dem alten glich.
Mia starrte zu einem Querbalken hoch, der vor der Wand über der Pferdeseite hing, gehalten von mächtigen Pflöcken, die die Knechte tief in den Balken dahinter getrieben hatten. Ein ahnungsvolles Frösteln durchfuhr sie, mit einem unwillkürlichen Schulterzucken suchte sie es abzuschütteln. Es hielt sich beharrlich und verlor sich erst, als sie ihm Ausdruck verlieh. »Wenn das man nur gutgeht, Vadder.«
»Soll wohl«, schmunzelte der Alte, der zu ihr getreten war, »nun laß man die Preußen kommen und ihren Zins einfordern.«
Bei den Nachbarn erzählte man sich bald, Drostes hätten ihren Hof für die Ewigkeit gerüstet.
Am nächsten Sonntag nach der Messe fragte Pfarrer Niesing drohend, ob die Drostes ihr jüngstes Kind als Heiden aufzuziehen gedächten, es sei doch schon über eine Woche alt. Daraufhin schickten die Drostes am folgenden Tag Jan mit der alten Trude als Patin in der Obhut von Josef Wierling und der Magd Anna zur Taufe in die Kirche. Die Wierlings hatten ihrer Lisbeth das Sakrament schon am Tag nach der Geburt spenden lassen.
Die Tauffeier, die die Drostes mit den Nachbarn zusammen begingen, sollte für die meisten, die sich in der Küche um das Herdfeuer drängten, die einzige frohe Stunde in diesem Winter sein. Als würden es alle spüren, geriet die Stimmung ausgelassener als üblich.
Die Kinder hatte Trude der Einfachheit halber zusammen in die Wiege gelegt, die Hubert und Bernard neben das Herdfeuer rückten, wo sie von nun an blieb. Die Kinder lagen eng aneinandergeschmiegt, die Händchen verschlungen wie Miniaturliebende, zwei liebliche Gesichter, zweimal das gleiche blonde Haar. Niemand sprach mehr vom Wechselbalg. Mia hörte erstaunt Lobendes über ihr Kind. Hubert trank den Nachbarn zu und achtete lange nicht auf das Gerede, das mit fortgeschrittener Feier sich der beiden in der Wiege annahm. Gelächter klang auf, in dem eine gewisse Anzüglichkeit mitschwang. Die älteren Kinder faßten sich an den Händen, tanzten um die Wiege und sangen einen schnell erdichteten Reim auf Jan und Lisbeth als Hochzeitspaar.
»Das fängt gut an mit den beiden«, dröhnte Heinrich Schulze Hundrup, »schon vor der Hochzeit zusammen im Bett.«
Josef Lütke Wierling stieg das ungewohnt viele Bier zu Kopf. »Ein Hoch auf das zukünftige Eheglück«, schrie er und schwenkte seinen Humpen in Huberts Richtung.
»Da sei ja wohl Gott vor«, wies ihn Hubert Droste nüchtern in seine Schranken. »Krieg du dein Balg erst mal über den Winter«, fuhr er in einer plötzlichen Stille fort.
Damit endete die allgemeine Heiterkeit. Von der Tenne, wo das Gesinde feierte, klang gedämpft eine Fiedel herüber, eine dünne Stimme, die noch nicht bemerkt hatte, daß die Zeit der Lustbarkeit vorüber war.
Ein dunkler, trüber Winter brach über der Venne herein. Wenig Schnee lag auf den Feldern, um die Wintersaat zu schützen, Frost fraß sich in den Boden. Kahl standen die Bäume. Die Kolke und Tümpel im Moor bildeten schwarze, unheilverkündende Spiegel unter dem Eis.
Kurz vor Weihnachten, sechs Wochen nach der Niederkunft, fand Mias Aussegnung statt, die Reinigung von der Befleckung durch die Geburt, die sie erneut in den Kreis der Gläubigen aufnahm, da sie ihr wieder den Zutritt zur Kirche gewährte. Pfarrer Niesing empfing sie an der Kirchentür und schwang den tropfenden Weihwasserwedel gegen sie. Am Abend nach der Zeremonie zog Hubert unauffällig wieder in die Schlafkammer ein. Das eheliche Verhältnis wurde damit nur teilweise wiederhergestellt. Hubert stopfte sorgfältig das Federbett um sich fest, murmelte einen Gutenachtgruß zu Mia hinüber und kehrte ihr den Rücken zu. Mia mußte sich zufriedengeben, daß wenigstens das Gerede unter den Hausbewohnern erstarb.
Im Januar fegten eisige Winde über das kahle Venn und drangen durch schadhafte Dächer, Mauerlöcher und Fensterritzen in die Häuser ein, trugen die Klagen über rauhe Nächte und graue Tage, wenig Heu, Stroh und Korn auf Böden und in Scheuern mit sich. Ein Notwinter nach einer schlechten Ernte. Erst ging das Vieh ein. Unterernährt fiel es Krankheiten und Seuchen anheim. Von den zwei Kühen der Wierlings starb eine. Was der Winter nicht schaffte, besorgten die preußischen Steuereintreiber. So verloren die Wierlings die zweite Kuh und hatten jetzt wenigstens keine Futtersorgen mehr. Mia sah sich gezwungen, Martha alle Tage eine Kanne Milch zu schicken. Trotzdem fraß der Hunger an den zwei älteren Wierlingskindern, die sich großäugig und hohlwangig in Mias Küche stahlen. Als Mias Milch vorzeitig versiegte und sie Jan Martha für einige Wochen in Pflege gab, nahm Hubert dies als Anlaß, den Wierlings eine von seinen Kühen in den Stall zu stellen. Die Hilfe kam wohl zu spät. Marthas Tochter Josefa legte sich mit Krämpfen ins Bett und stand nicht mehr auf. Jetzt blieben Martha nur noch zwei Kinder von den sechsen, die sie geboren hatte: August, gleichalt mit Anton, dem dritten Drostesohn, und Lisbeth, die bis jetzt gedieh, ebenso wie Jan, das Ziehkind.
Klara Potthoff schleppte sich von Hof zu Hof, um der Krankheiten bei Mensch und Vieh zu wehren. Gottes Erbarmen, wenn es ihr gelang, wenn nicht, hatte Klara, die Hexe, versagt. Das eine wie das andere kümmerte sie wenig, dazu blieb ihr keine Kraft. Als eines ihrer eigenen Kinder starb und die Schatten unter ihren Augen noch dunkler wurden, mochte niemand mehr an ihre Hexenkünste glauben. Viele Nachbarn folgten dem kleinen Sarg und drückten mitleidig Klaras Hände.
Der angestaute Zorn über den Katastrophenwinter machte sich in Schmähreden auf die Preußen Luft, die Hand erhob keiner gegen sie.
Niemand hatte damit gerechnet, daß sie noch im Winter mit der neuen Steuereintreibung beginnen würden. Es mußten Männer aus Eisen sein, die sich durch die unwegsame Ödnis von Moor und Heide kämpften, um ihre Forderungen zu stellen. Es tröstete die Bauern nicht, daß jetzt mehr Gerechtigkeit herrschte und alle Stände in die Abgabenpflicht genommen wurden, ihre Lasten verringerten sich dadurch nicht.
Die fremden Herren waren höflich, aber nicht freundlich, sachlich, aber nicht verbindlich, sie waren protestantisch und damit schlimmer als unwissende Heiden, sie waren so entsetzlich ungemütlich, und das war wohl der heftigste Vorwurf, den ihnen die Münsterländer machen konnten.
Als die Drostes glaubten, das Schlimmste in diesem Winter hinter sich zu haben – ein Pferd und drei Kühe waren krepiert, die Sau fiel um, das Heu schimmelte, im Korn tummelten sich Mäuse und Käfer –, befiel Bernard ein böser Husten. Trotz Vorhaltungen von Mia und besorgten Blicken von Hubert tat Bernard trotzig weiter seine Arbeit. Überall war sein bellender Husten zu hören. Nach zwei Tagen brach Fieber aus, heftig, bösartig. Mitten in der Fütterung der Kühe, Bernard schwang die Heugabel hoch, geriet er ins Stolpern und krachte auf die Tenne in einem Regen von Heu. Er hätte sich aufspießen können.
Sie schafften ihn eilends in die Stube und heizten ein. Bald schickte der kleine eiserne Ofen in der Ecke sengende Hitzewellen aus, die sich mit der Glut verbanden, die im kranken Körper brannte. Bernard warf die Decken von sich, begann zu fantasieren und wälzte sich unruhig auf dem Strohsack. Sie mußten ihn festhalten. Am Küchentisch klickten die Rosenkränze. Anna rannte kopflos zwischen Herd und Stube hin und her, bis Trude sie ans Spinnrad setzte. Mia schickte nach Klara und war entsetzt über deren erschöpftes, verhärmtes Aussehen, als sie in die Stube trat. Klara machte sich sogleich an die Arbeit und verbreitete eine ruhige Zuversicht.
»Wo hast du deinen Jüngsten?« fragte Klara, die sich über alles in einem Haus, in dem sie tätig war, zu unterrichten pflegte.
»Anton sitzt bei den anderen in der Küche, du mußt ihn gesehen haben.« Mia sanken die Arme mit der Waschschüssel, die sie der Nachbarin vorhielt, herab. »Er ist bei Martha«, fuhr sie heiser fort, »seit meine Milch versiegt ist, er hat es besser dort.«
Klara hielt nur einen Augenblick inne, dann griffen ihre Hände wieder ruhig und gleichmäßig zu, um dem Kranken Erleichterung zu verschaffen. Die Nacht brach herein, die Geräusche im Haus erstarben bis auf das gleichmäßige Schnarchen des alten Droste, der neben dem Ofen im Armlehnstuhl eingeschlafen war. Er hatte sich geweigert, die Stube zu verlassen.
Auch Klara und Mia nickten am Bett beinahe ein, bis ein Stöhnen des Kranken sie auffahren ließ.
»Meinst du, er wird leben?« flüsterte Mia. In der stickigen Luft fiel ihr das Atmen schwer, ein dumpfer Schmerz bohrte in ihrem Kopf. Klara hielt den Blick abgewandt und schaute in das stete Licht der Kerze. Mia fragte sich, ob Klara sie gehört hatte, da begann Klara leise zu sprechen.
»Hast du gehört, was sie erzählen? Die Preußen wollen die Eigenbehörigkeit aufheben.«
Mia glaubte, sich verhört zu haben. »Was hast du gesagt? Ich hab dich nach Bernard gefragt.«
»Du weißt ja nicht, wie das ist. Du bist frei geboren, ihr Drostes wart immer frei, sogar die Wierlings, obwohl sie nur den elenden Kotten haben, allein, weil sie mit euch versippt sind. Wir dagegen hängen vom guten Willen des Grundherrn ab. Ich habe vier Kinder – drei«, die leise Stimme stockte kurz, »du weißt, wie das geht. Die jüngeren müssen bei ihm in den Gesindedienst, wenn es ihm so paßt. Sie können nicht frei entscheiden, was sie tun wollen.«
»Aber so ist es doch schon immer gewesen, das ist die Ordnung«, protestierte Mia.
»Die Ordnung? Daß Menschen anderen Menschen gehören? Auf Gnade und Ungnade?«
»Du übertreibst doch. Sie werden halt fragen müssen, wenn sie heiraten wollen, aber welcher Knecht kann schon heiraten? Außerdem habt ihr euren Hof, der bleibt euch, solange ihr die Pacht zahlt und die Dienste leistet.«
»Und wie lange noch? Was ist, wenn Anton stirbt? Als es mit seinem Vater so kam, konnten wir kaum die Sonderabgabe an den Grundherrn zahlen. Ich wünsche mir so sehr, sie würden ihr Versprechen wahr machen, die Preußen.«
Mia verschloß sich vor der Inbrunst, die aus Klaras Worten sprach.
»Aber das geht doch nicht an, dann wären wir ja alle gleich, dann gäbe es unter uns ja keine Unterschiede mehr«, sagte Mia mit plötzlicher Heftigkeit.
»Na und?« Klara streifte Mia mit einem kühlen Blick, wandte sich ab und fixierte wieder die Kerze. Ihre Stimme sank zu einem Flüstern herab, sie sprach, als würde das Aussprechen ihrer Sehnsüchte deren Erfüllung beschwören. »Sie wollen auch die Aufteilung der Allgemeinheit in die Wege leiten. Jeder könnte ein Stück Land erwerben. Wir hätten die Möglichkeit, einen eigenen Hof aufzubauen, den wir unseren Kindern hinterlassen könnten. Wir hätten etwas Eigenes.«
Klaras Stimme verlor sich im Schnarchen aus der Ecke und dem unruhigen Atmen des Kranken. Gegen Morgen besserte sich Bernards Zustand, er schien die Krise überwunden zu haben. Mia beschloß, Klaras Hirngespinste der unguten Krankenzimmerluft und der Heillosigkeit der Nacht zuzuschreiben. Beim Abschied umarmte sie Klara, die sich vor Erschöpfung kaum aufrecht hielt, und gab ihr einen Napfkuchen für die Kinder mit.
»Klara, du mußt dich ein wenig schonen, und«, Mia zögerte einen Augenblick, »wenn es dir eine Hilfe ist, schick mir zwei von deinen Kindern rüber, dann hast du weniger durchzufüttern.«
Klara drückte Mias Hände, aber sie lehnte ab. Sie litten keine Not.
Hubert hatte die Nacht bei den Rosenkranzbetern verbracht. Bald waren seine Gedanken abgeschweift, und er rang mit einem Entschluß, der sich in den frühen Morgenstunden, bevor er noch die Nachricht von Bernards Besserung erhielt, zur Unabänderlichkeit festigte.
»Lütke-Hubert, du nimmst Anton mit ins Moor und zeigst ihm die Wege dort, es wird Zeit, daß er Bescheid weiß«, sagte er zu seinem zweiten Sohn, der den Kopf tief über den Teller mit der Morgensuppe hielt. Lütke-Hubert schaute auf, wandte sich Anton zu, der zusammengerollt am Ende der Bank lag, und begann, ihn aufzurütteln.
»Laß ihn schlafen, er erfährt es früh genug, wenn er aufwacht«, wies ihn Hubert zurecht, von einem Gewissensbiß geplagt angesichts des Kindes, das mit der Unschuld seiner sieben Jahre schlief.
Eine Stunde später war Antons Geschrei zu hören. »Ich will nicht ins Moor«, heulte er, bis es Mia zuviel wurde.
»Warum auch? Was schickst du ihn jetzt schon, er ist doch noch viel zu klein!«
»Wir müssen das Vieh, das, was wir noch haben, vor den Preußen retten. Anton muß lernen, die Tiere ins Moor zu treiben, wenn’s nötig ist.«