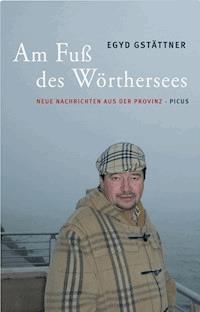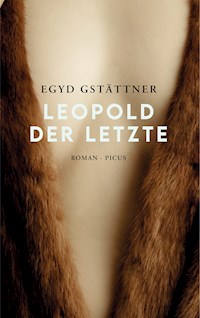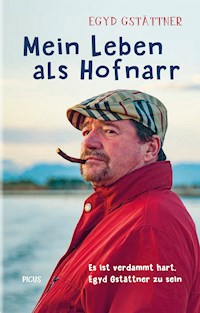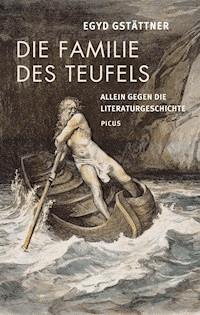19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann sucht im Süden sein Glück - der erfolgreiche Maler Josef Maria Auchentaller aus dem Kreis der Wiener Secessionisten entflieht dem Trubel der Großstadt in ein kleines Fischerdorf an der österreichischen Adria. Es ist eine Insel außerhalb der Zeit, die vom Untergang Österreich-Ungarns, dem Ersten Weltkrieg, dem italienischen Faschismus und dem Zweiten Weltkrieg nur am Rande berührt wird. Dort beginnt er langsam in den Schatten seiner Frau zu gleiten, als diese ein Hotel eröffnet und er bald hauptsächlich Werbepostkarten malt. Sein ganzes Herz hängt an der geliebten Tochter. Er will nicht wahrhaben, dass sie den Freitod gewählt hat, will nicht wahrhaben, dass seine Frau ihn betrügt und seine Karriere versandet, einzig der Tod ist ihm allgegenwärtig: Kollegen, Freunde, Bekannte sterben der Reihe nach, und er selbst sehnt sich nach dem eigenen. Fast vierzig Jahre verbringt er so auf seinem Geisterschiff.Ohne ihn wäre die Wiener Secession nicht das, wozu sie wurde: Auchentaller war Gründungsmitglied der Künstlergruppe - und doch ist er heute ihr unbekanntester Vertreter. Egyd Gstättner erzählt voll Esprit ein Künstlerleben im Abseits und erweckt den romantisch Todessehnsüchtigen noch einmal zum Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
EGYD GSTÄTTNER
DAS GEISTERSCHIFF
Copyright © 2013 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien 3. Auflage 2014 Alle Rechte vorbehalten Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien Umschlagabbildung: © IMAGNO/Österreichisches Volkshochschularchiv Datenkonvertierung E-Book: Nakadake, Wien ISBN 978-3-7117-5186-7 Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt
Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at
EGYD GSTÄTTNER
DAS GEISTERSCHIFF
EIN KÜNSTLERROMAN
PICUS VERLAG WIEN
In der Kunst ist der Mensch als Thema unschlagbar.
XENIA HAUSNER
PROLOG
Ich möchte nicht in der Zukunft leben müssen. Die Zukunft ist brutal, ordinär und billig. Die Zeit, die ich erleben durfte, war eine bessere. Das sollen gemäß der Überlieferung die letzten Worte des Meisters gewesen sein, gesprochen vier Jahre vor seinem Tod.
Als Josef Maria Auchentaller starb, herrschte in den Redaktionen der meisten Zeitungen in kürzester Zeit helle Aufregung. Denn die Sonntagsausgaben waren fast schon in Druck, als das gerade hereingeschneite Gerücht von seinem Tod bestätigt wurde. Eigentlich sollte die am ersten Jänner in Kraft getretene Kraftfahrzeugs-Benutzungsverordnung als Hauptthema herhalten, die der Wirtschaftsrat erlassen hatte, durch die Ausflugs- und Vergnügungsfahrten verboten waren. Nun aber stoppte man die Produktion im letzten Augenblick, warf den öden Wirtschaftsrat mitsamt seiner Kraftfahrzeugs-Benutzungsverordnung sowie die eine oder andere verzichtbare Glosse aus der Nummer und fügte an deren Stelle in höchster Eile einen notdürftig zusammengeschusterten Artikel ein, in dem Auchentaller »Gigant« oder »Pionier« genannt und mit seinen zwei endgültigen Jahreszahlen versehen wurde. Ja, ein Gigant war er, auch wenn das zu seinen Lebzeiten, also die letzten vierundachtzig Jahre bis vor einer knappen halben Stunde, kaum jemand so gesagt hatte. Ein Pionier war Auchentaller weniger. Auchentaller hatte – darin waren sich die Zeitungen einig – in den letzten Jahren »total zurückgezogen in seiner Villa Fortino gelebt«, über den Tod seiner Tochter und vor allem über den Tod seiner geliebten Frau Emma sei er nie hinweggekommen. Das Wort »Lebensekel« konnte man allerdings nirgendwo lesen, das passte nicht mehr in die Zeit, und es passt wohl auch nicht in Nachrufe. Einer der Leitartikler meinte, Auchentallers Ära habe lange vor seinem Tod geendet, seine Epoche sei schon lange vor ihm gestorben, früher als er selbst es bemerkt haben mochte.
Der Bundeskanzler (oder dessen Büro) erklärte, Josef Maria Auchentaller habe als Künstler Generationen von Menschen Freude bereitet, im Inland und auch im Ausland. Er war mit seinem Talent und seiner Vielseitigkeit über alle Grenzen hinweg das Gesicht Österreichs. Viele, viele Leserbriefschreiber meldeten sich, bekundeten ihre Trauer, dankten Auchentaller für sein Leben und Wirken, nannten ihn den Größten seiner Zeit, stellten ihn als Helden und Vorbild dar, nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch, der keine Skandale gebraucht und geliefert und etwa nur eine einzige, ununterbrochene Ehe virtuos und existenziell geführt habe. Emmas Rolle sahen manche Journalisten kritischer. Sie sei nicht nur geliebte Frau, sondern auch gestrenge Managerin gewesen, der er sich in den besten Zeiten bis an die Grenze zur Entmündigung anvertraut habe, sodass sich auch die Journalisten widerwillig ihrem rigiden Diktat unterordnen mussten. Der kommerzielle Erfolg Auchentallers war wohl seiner Emma zu verdanken, die ihn genial vermarktete. Emma schaffte es, Auchentaller durch die auch damals schon turbulenten Fährnisse einer Branche zu geleiten, die schon manche Kollegen Auchentallers das Leben vor dem Tod gekostet hatte.
Eine Zeitung entblödete sich nicht, neben diesem Artikel einen weiteren Artikel zu bringen, in dem sie sich selber auf die Brust trommelte und erklärte, sie sei die schnellste Zeitung gewesen und habe als Allererste die Todesnachricht gebracht – fünf Minuten und dreiundzwanzig Sekunden vor der zweitschnellsten Zeitung! Absolute Todesbestzeit! Sieg! Triumph! Und das, obwohl gerade dieser Tod schwer herauszufinden gewesen war, weil Auchentaller ja nicht gegen einen Baum, einen Bus oder eine Wand gekracht und sich nicht überschlagen und erschlagen hatte, sondern einsam und allein in seinem Bett gestorben war, noch dazu an einem Samstag und Feiertag – redaktionell eigentlich eine tödliche Kombination. Die Zukunft, in der er nicht hätte leben wollen, die brutale, ordinäre, billige Zukunft, hatte begonnen. Nein, sie hatte nicht erst begonnen, sie war schon längst am Werk gewesen, aber er, Auchentaller, hatte sie jetzt endlich verlassen – nach einem seit Jahrzehnten schmerzverzerrten Leben, hartnäckig weggelächelt, weggeschwiegen, weggezwinkert.
Bis zu seinen letzten öffentlichen Auftritten blieb Auchentaller der feine, elegante Gentleman, der höchstens augenzwinkernd auf die Kapriolen seiner Außenwelt reagierte. Seine Gesichtszüge hatten – noch auf den Fotos von der Trauer am Grab seiner Familie, die indiskreterweise veröffentlicht wurden – einen Anstrich von Frische und Jugendlichkeit. Für seine Verletzlichkeit, meinte ein Kommentator, die ihn als Mensch authentisch machte, war und ist in der Szene der bildenden Künstler kein authentischer künstlerischer Ausdruck vorgesehen.
Nach dem Tod seiner Frau und seiner Tochter zog er sich vollends aus der Öffentlichkeit zurück, verschanzte sich hinter den Mauern seiner völlig zugewachsenen Villa und wartete auf den Tod. Mit seiner Schneekugelsammlung spielen. Vogelfüttern. Friedhofgehen. Milch mit Honig: gestern. Heute. Morgen: Bespielung der Schneekugelwelt (am Meeresstrand ließ er es schneien auf Akropolis und Hagia Sofia, auf Petersdom und Stephansdom). Vogelfüttern. Friedhofgehen (aus dem Grab des Lebendigen zum Grab der Toten und wieder zurück). Milch mit Honig trinken. Der Wille zum Leben wendete sich.
Viele Leserbriefschreiber hofften, dass Auchentaller jetzt im Tod wenigstens im Grab wieder mit seiner Emma vereint sein möge. Die Hoffnung erfüllte sich natürlich nicht. Seine abgöttisch geliebte Frau war mittlerweile bereits verwest und zerfallen. Seine abgöttisch geliebte Tochter war bereits woanders verwest und zerfallen. Er schickte sich nach einem langen Leben jetzt an, dort zu verwesen und zu zerfallen, wo seine geliebte Frau verwest und zerfallen war. Wem das ein Trost war …; Immerhin: Das Verwesen und Zerfallen war kein Teil des Lebens, sondern ein Teil des Todes. Verwesen tut nicht mehr weh. Was man sagen konnte: Auchentaller litt jetzt nicht mehr an gebrochenem Herzen oder an Einsamkeit. Er war nicht mehr unglücklich, depressiv, enttäuscht, lebenssatt, angeekelt, herzleidend, inkontinent oder hiobesk.
Über die genaue Todesursache wurde die Öffentlichkeit nicht informiert. Ob er sanft entschlafen war, ob er eine Herzattacke erlitten oder in seinem hohen Alter doch noch den Freitod gewählt hatte, die Erlösung mittels Freitod etwa durch eine Überdosis Tabletten in Kombination mit Whiskey oder Wodka, oder ob er im Gegenteil, aber mit demselben Effekt, seine Medikamente aus Überdruss abgesetzt und Essen und Trinken verweigert hatte, um welche Uhrzeit genau er gestorben war, ob allein oder ob jemand bei ihm war, wer ihn, falls niemand dabei war, fand, wann der Arzt kam und welcher, das wurde der Öffentlichkeit vom »Sprecher der Familie« (wer immer das auch war) nicht bekannt gegeben, und es ging sie auch gar nichts an.
Bereits am Tag nach Auchentallers Tod startete die größte Boulevardzeitung des Landes eine Serie, die auf einer täglichen reich illustrierten Doppelseite sein bewegtes Leben nachzeichnete. Auchentaller selbst hatte eine stille Beerdigung im engsten Kreis gewünscht. Aber die öffentliche Bestürzung und Trauer schwoll nach dem Bekanntwerden seines Todes derartig an, dass man sich doch zu einer öffentlichen Aufbahrung entschloss und Kondolenzbücher auflegte.
Tausende kamen und standen in der Schlange, warteten, defilierten am Aufgebahrten vorbei und schnäuzten sich. Die Journalisten pickten sich die Mächtigen und die Prominenten und die Viertelprominenten aus der Trauerschlange heraus, außerdem Leute, die eigens zum Aufbahrungstermin von weit her gekommen waren, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Italien und aus Österreich. Sie zählten die Kränze ab und berichteten, welcher Kranz vom wem war und was auf welcher Schärpe stand. Einer der Boulevardjournalisten schrieb, der Bürgermeister der Stadt Wien sei exakt dreizehn Sekunden lang vor dem Sarg gestanden. Man kann sich das nur so vorstellen, dass sich der lauernde Journalist in dem Augenblick, als der Bürgermeister an die Reihe kam, gesagt hat, na, jetzt wollen wir doch mal sehen, wie lang genau der Bürgermeister vor dem Auchentaller-Sarg verharrt. Also hat er unauffällig seine Stoppuhr aus der Sakkotasche gezogen und auf den Knopf gedrückt: Ticktack. Ticktack. Ticktack. Dreizehn Sekunden. Wenn es in Wien nicht gerade eine schöne Leiche gab, arbeitete der Boulevardjournalist in der Sportredaktion. Von da her sind also die dreizehn Sekunden verständlich.
Sei es wie immer: Zu einer großen Nummer gehört auch gegen ihren Willen ein großer Abschied, und zu einem großen Abschied ein großes Trara.
So hätte es sein können. So oder so ähnlich. Aber so war es nicht. Und davon handelt dieser Roman.
1. BILD DIE TÖNENDEN GLOCKEN
(1903)
Ich glaube nicht an Gott den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist wahrlich nicht der Grund, warum ich in den Glockenraum des Campanile hinaufgestiegen bin, der mit dem Erzengel Michael auf seiner Spitze zum Dom von Sant’Eufemia gehört. Es ist ganz einfach die prächtige Aussicht: Der Blick über die Dächer von Grado hin zum Fortino, zu unserer Pension, also genau genommen zu Emmas Pension – ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken! Der Blick zum Fenster meines Ateliers im Dachgeschoß des Fortino, das ich mir gerade einrichte, und der Blick auf die Adria dahinter. Die blaue Adria. Es gibt tausend verschiedene Blaus am Meer. Das heutige Meeresblau hat mit blau eigentlich gar nichts zu tun. Mit Grado habe ich wieder einmal alle überrascht. Grado: Das hätte mir keiner zugetraut!
***
Mama half in Großvaters Osteria mit, in den Drei Kronen. Sie servierte und putzte und manchmal kochte sie sogar. Und wenn Zeit blieb, half sie manchmal auch noch bei den Fratelli Marchesini. Aber dann kam Mama plötzlich in den Himmel, und Großmutter musste ihre Arbeiten mitübernehmen. Ich gehöre sozusagen ebenfalls zu Großmutters Arbeiten. Sie schaut auf mich. Aber weil Großmutter den ganzen Tag so viel zu tun hat, merkt sie überhaupt nicht, wenn ich einmal eine halbe Stunde später von der Schule nach Hause komme. Wir leben in einem Haus in einem engen, finsteren Gässchen gleich hinter dem Kirchplatz, keine hundert Meter von der Basilika entfernt. Ich bin in diesem Haus geboren, Mama ist dort in den Himmel gefahren. Auf dem Heimweg ist mir in den letzten Tagen öfters dieser fremde Herr mit dem großen Papierblock unter dem Arm aufgefallen, der in die Kirche gegangen und, ohne dass ein Gottesdienst stattgefunden hätte, erst Stunden später wieder herausgekommen ist. Der Mann ist nicht von hier. Heute konnte ich meine Neugier nicht mehr bezähmen und bin ihm heimlich nachgegangen. Der fremde Herr ist den Kirchturm hinaufgestiegen. Ich bin ihm auf Zehenspitzen gefolgt und stand oben im Glockenturm in seinem Rücken, sodass er mich auf seinem Schemel sitzend ein paar Minuten gar nicht bemerkt hat. Der Fremde hatte den Block auf seine Oberschenkel gelegt und zauberte mit seinem Bleistift die schönste Zeichnung aufs Papier, die ich je gesehen habe. Diese sagenhafte Kunst würde ich auch gerne beherrschen, dachte ich. Ich kann auch zeichnen. Aber nicht so. Ich habe gedacht, wenn man älter wird, hört man zu zeichnen auf. Ich habe gedacht, Erwachsene zeichnen nicht. Großmutter zum Beispiel kann nicht zeichnen, und deswegen tut sie es auch nicht. Nie.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!