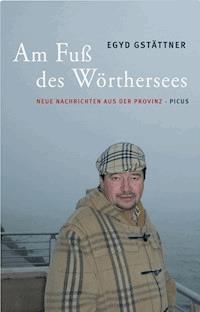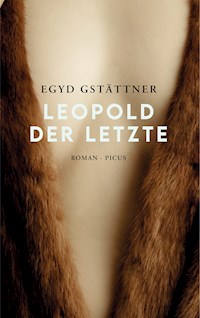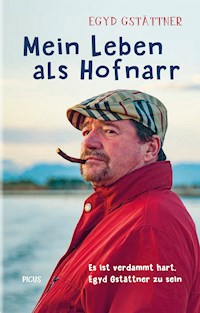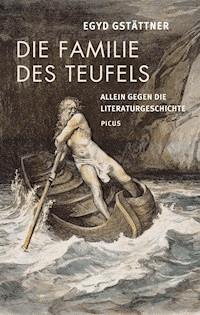19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Egyd Gstättners spitze Feder ist wieder im Einsatz: In seinen satirischen Erzählungen spannt er den Bogen von Sigmund Freud bis zum Song Contest – und arbeitet sich an so manchen Phänomenen der Gegenwart ab. Was, wenn Österreich wieder einen Kaiser hätte? Und was, wenn der ein impotenter Maronibrater aus Klagenfurt wäre? Dann müsste man wohl den Thronfolger via Castingshow bestimmen. Sigmund Freuds Inkognito-Urlaube am Wörthersee, Thomas Bernhards Ohrensessel und Wittgensteins Ururenkel: Egyd Gstättners scharfem Blick entgeht niemand. Er setzt der Lendkönigin mit dem losen Mundwerk ein Denkmal, spürt dem Kopf des Franz Igele nach und hält ein Plädoyer für die Annehmlichkeiten des Rauchens. Und Gstättner outet sich als weltgrößter Fan des Grand Prix Eurovision de la Chanson, heute ESC genannt: Liebevoll, aber gnadenlos rollt er seine Geschichte auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Copyright © 2022 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien
Umschlagabbildung: Quint Buchholz, König und Narr.
Aus: Michael Krüger/Quint Buchholz, Wer das Mondlicht fängt.
Bilder und Gedichte © 2001 Carl Hanser Verlag GmbH & CoKG, München
ISBN 978-3-7117-2126-6
eISBN 978-3-7117-5471-4
Informationen über das aktuelle Programm
des Picus Verlags und Veranstaltungen unter
www.picus.at
egyd gstättner
ich bin kaiser
Österreichische erzählungen
picus verlag wien
Inhalt
ich bin kaiser oder: wachablÖse in schÖnbrunn
freud am see (dr. freudenbergers badereise)
die lendkÖnigin
wittgensteins ururenkel
was sie immer schon Über thomas bernhard wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten: in der ohrensesselausstellung
was sie immer schon Über peter handke denken wollten, aber bisher nicht zu trÄumen wagten oder: in achtzig tagen barfuss durch den stillen garten
der verschwundene kopf des franz igele ein bilderreigen
sterbende nichtraucher oder: von der schÄdlichkeit des tabaks
freude! schÖner gÖtterfunke in der unterwelt. aufzeichnungen aus einem weltuntergangsschutzkeller
unterirdische fÜr ausserirdische archivare im wechselspiel zwischen macht, verantwortung und demut
ich bin kaiser oder: wachablöse in schönbrunn
1
Mein Name ist Trotta, Kevin Kai Trotta. Meine Familie stammt aus Jugoslawien, genau genommen aus Slowenien. Mein Vater war Gastarbeiter. Später machte er sich als Maronibrater in Celovec selbständig. Sein Traum war, eines Tages ein Maroni-Spezialitätenrestaurant zu eröffnen, einzigartig auf der Welt, dessen Karte wirklich jedes Gericht offerieren sollte, das sich in der einen oder anderen Weise aus Kastanien zubereiten ließ, von der Maronisuppe bis zu Maronitagliatelle mit Maronisenf und Maronibier, vor allem aber Süßspeisen: Maroniknödel, Maronimousse, Kastanienpudding, Kastanienreis mit Schlagobers an dreierlei Maronilikör. Aber selten verdient ein Maronibrater mit einem kleinen Wagen, einem Kessel und fünf Säcken Kastanien genug, dass seine Träume in Erfüllung gehen. Ursprünglich war mein Vater Borut Trotta bei der ÖVP, aber das brachte nichts. In der ÖVP dachte jeder nur an seine eigene Karriere, aber niemand an einen Maronibrater, der sein Geschäft vergrößern wollte. Wenn es hochkam, erteilte einer dem Maronibrater gute Ratschläge, er könne außer den Maroni auch noch gebratene Äpfel und gebratene Kartoffel verkaufen. Aber gebratene Äpfel und gebratene Kartoffel, das waren doch Scheußlichkeiten, von denen auch niemand reich wurde. Dann ging Borut Trotta zur SPÖ, aber das nützte ebenfalls nichts. In der SPÖ dachten alle nur an ihre Gremien und manchmal an die Elenden hinter den Karawanken und hinter dem Himalaya – und an sprachpolizeiliche Maßnahmen. Sie nannten meinen Vater Maronibraterin und meinten, er sei mitgemeint. Schließlich ging mein Vater zur FPÖ und fühlte sich eine Zeit lang verstanden, dann aber doch genasführt. In der FPÖ dachten alle nur an den Führer, an ihren Führer natürlich. »Die gehören alle nach Steinhof«, erklärte Papà, »alle!« Und so blieb der Maronibrater Maronibrater. Eine österreichische Lösung.
Noch unbändiger war Vaters Ehrgeiz, aus mir etwas Besonderes, etwas Besseres zu machen. Dass eines Tages schlichtweg das Beste überhaupt aus mir werden sollte, das höchste Wesen, das konnte Borut Trotta aus Podljubelj nad Tržič freilich nicht ahnen. Er »sparte sich das Geld vom Mund ab«, erklärte er, um mich Gastarbeiterkind aufs Gymnasium schicken zu können. Dabei war mein eigener Ehrgeiz längst nicht so ausgeprägt wie seiner. Für die meisten Gegenstände brachte ich kein wirkliches Interesse auf und mogelte mich bis zur Matura irgendwie durch, die ich schließlich mit Ach und Krach bestand. Nur das Schultheaterspiel in der nachmittäglichen Neigungsgruppe fesselte mich wirklich, und bei Goldoni-Stücken, bei Lope de Vega und natürlich bei Nestroy und Raimund ließ ich ein gewisses Talent zum Komiker aufblitzen. Wenn noch Zeit blieb, traf ich mich mit der kleinen Elisabeth vom Laubenweg und wir streiften übers Kreuzbergl. Mein Deutschlehrer besetzte mich als Rappelkopf und Knieriem. Das Publikum, also die Eltern, lachten, wieherten manchmal sogar, und mein Vater war sehr stolz.
Dann ging ich zum Studium nach Wien. Weil nicht so viel auswendig zu lernen war wie in den Rechtswissenschaften und weil mir nichts Besseres einfiel, studierte ich wie alle anderen Volkswirtschaft. Während des ersten Semesters wohnte ich im Panoramaheim an der Brigittenauer Lände, aber nachdem sich bis Semesterende drei Kommilitonen vom Dach des Panoramaheims mit Blick auf das Kronen-Zeitungs-Gebäude in die Tiefe gestürzt hatten, wechselte ich in eine WG in der Mollardgasse im Sechsten, später in die Schopenhauerstraße im Achtzehnten, noch später in die Adambergergasse im Zweiten gleich hinter dem Donaukanal und dem Schwedenplatz und schließlich in die Josefstadt in die Lerchengasse, gleich neben dem Tigerpark. Wo immer ich wohnte, meistens saß ich im Kaffeehaus und schwatzte mit anderen Studenten: im Westend, im Schopenhauer, im Anzengruber oder im Hummel. Bei unseren Unterhaltungen ging es aber selten ums Studium, sondern meistens um Studentinnen zum Flachlegen, um die Austria, um Kreisky oder um Jobs, mit denen man sich – ich mir – das Studium finanzieren konnte, das mich nicht im Geringsten interessierte: Komparse an der Josefstadt, Garderobier im Simpl, Kabelschlepper am Küniglberg, Regieassistent im Schauspielhaus. Abends im Kaffeehaus wurde der Niedergang der verfilzten dekadenten Altparteien, der Tod der Kultur, der Literatur, des Kabaretts debattiert und betrunken (besonders firm war ich freilich noch immer nicht), und wenn sich keine Studentin zum Abschleppen fand, versuchte ich mich nachts an ersten eigenen Kabarettprogrammen, aber es kam im Rausch nur Stumpfsinn heraus. Einmal schleppte ich Paula, eine Germanistikstudentin ab, und als wir schon auf der Matratze lagen, fragte sie mich unvermittelt, ob ich »mit den Trottas verwandt« sei. »Mit welchen Trottas?« – »Na mit den Nachfahren des Helden von Solferino!« – »Welcher Held und welches Solferino? Wo ist das? Was ist das? Wer ist das?« – »Sag, willst du mich verarschen, Kevin Kai Trotta? Hast du im Geschichtsunterricht geschlafen? Hast du im Deutschunterricht geschlafen?« – »Hab ich. Gut sogar, ausgezeichnet!« Und dann schlief ich mit ihr.
2
Zweimal im Jahr, zu Weihnachten und in den Sommerferien, fuhr ich nach Hause und berichtete Papà von meinen Fortschritten im Studium der Volkswirtschaft – mein lieber guter alter Maronibrater glaubte mir alle »Erfolge« aufs Wort – wie viele Kontakte ich im Simpl, im Schauspielhaus, in der Josefstadt oder am Küniglberg knüpfen hatte können, wie viele neue Kontakte jeder Kontakt nach sich zog. Besonders stolz war der alte Herr, als ich an Sommertheaterbühnen in der Provinz von Friesach bis Langenlois engagiert wurde, meistens wieder Raimund oder Nestroy, wenn auch nicht als Rappelkopf und Knieriem, sondern in elenden Nebenrollen …
Bei den Sommerspielen in Gars am Kamp saß einmal der Unterhaltungschef des Österreichischen Rundfunks mit seiner Mätresse im Publikum. Man glaubt es nicht: Es war Paula. Nach der Vorstellung kam er – leicht angeheitert, wie mir schien – auf mich zu und meinte, ich hätte das gewisse Etwas, mein Gesicht sei ausdrucksstark, ich sei ein It-Boy, ob ich nicht Lust hätte, in der einen oder anderen Fernsehproduktion mitzuwirken, anfangs in kleinen Rollen natürlich. Ich fragte mich, was ein It-Boy sein und wobei der hohe Herr dieses gewisse Etwas und meine Ausdrucksstärke bemerkt haben könnte, hatte ich in Gars am Kamp doch einen stummen Diener mit Silbertablett in der Hand gegeben. Aber ihn fragte ich nach diesen Mysterien nicht – wer fragt schon nach, wenn er entdeckt wird? –, sondern sagte sofort zu. Tatsächlich war ich bald darauf dann und wann in Fernsehspielen zu sehen. Meistens verkörperte ich Versager, Dummköpfe, genasführte Ehemänner oder kleine Gauner und ungeschickte Hochstapler. Paula, die Mätresse des Unterhaltungschefs, sah man übrigens auch: als Moderatorin der Hauptabendnachrichten. So entfernte ich mich immer weiter von der Volkswirtschaft.
In der Rundfunkkantine saß der Unterhaltungschef mit einem anderen, mir unbekannten Herrn, und mir entging nicht, dass die beiden mich vom Nebentisch aus musterten. »Dieses Gesicht!«, flüsterte der Unbekannte dem Unterhaltungschef zu, aber doch so laut, dass ich es hören konnte, »unglaublich! Das ist es! Das ist er! Wir haben ihn gefunden!«
Der Unterhaltungschef nickte, winkte mir zu und gab mir ein Zeichen, zu ihnen an den Tisch zu kommen. Er machte uns miteinander bekannt. Jacques Bärenfels! Kevin Kai Trotta! Bärenfels, der eigentlich Franz Tschuschnig hieß, aber Wert darauf legte, mit seinem Künstlernamen angesprochen zu werden – denn dafür hatte er ihn ja! –, fragte gleich nach: »Trotta? Sind Sie mit den Trottas aus Sipolje verwandt?« Sipolje? Ich kannte kein Sipolje und kein Solferino, ich kannte Celovec und Podljubelj nad Tržič. »Sehr gut«, lachte Bärenfels, »ein Original, ausgezeichnet, Originale sind so selten heute, ich glaube, Sie sind unser Mann! Sipolje gibt es auch gar nicht mehr. Es wurde nämlich im Krieg vernichtet. Es war einst ein Städtchen, ein kleines Städtchen, aber immerhin ein Städtchen. Heute ist es eine weite, große Wiese.«
»Aha.«
»Na, wie auch immer. Also hören Sie, Trotta, die Sache ist die: Wir planen eine große Programmreform, die größte in der Geschichte des Rundfunks. Es soll kein Stein auf dem anderen bleiben. Und deswegen wird es auch jede Menge neue Formate geben …«
»Formate?«
»Formate. Früher hat man Sendungen gesagt. Oder Sendeleisten. Oder besser Serien. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Formate sind jetzt Standard. Egal. Jetzt sprechen Sie mir nach: ›Na alsdann!‹«
»Na alsdann …«
»Perfekt! Und jetzt: ›Er muss aber auch ein bisserl brav bleiben!‹«
»Er muss aber auch ein bisserl brav bleiben!«
»Super! Die beiden Sätze werden Ihr Markenzeichen! Trotta, Sie sind Kaiser!« So wurde ich also in der ORF-Kantine zu Kaiser Kevin Kai I. von Österreich gekrönt.
3
Das Konzept der Serie war denkbar einfach: Ich sollte eine Karikatur des österreichischen Kaisers spielen, um Österreich, das im zwanzigsten Jahrhundert zerfallen, amputiert, abgenagt, untergegangen war und schließlich knapp vor der Jahrtausendwende überhaupt zu existieren aufgehört hatte, aus Elend und Erniedrigung befreien und den Glanz monarchistischer Zeiten zurückbringen. Es sollte dem Erdteil wieder inmitten liegen. In der Hauptsache hielt ich – unterstützt von meinem Zeremonienmeister Jacques Bärenfels, der im wirklichen Leben Artdirector war, Hof und gewährte Audienzen, begrüßte also im Grund wie jeder Talkmaster in jeder x-beliebigen Talkshow seine Gäste, allerdings mit dem Unterschied, dass ich sie von oben herab behandelte, von mir selbst im Pluralis Majestatis und von den Gästen in der dritten Person sprach – als wären sie abwesendes Gesindel. Ich trug eine Prachtuniform mit vielen Quasten, Orden und einer Schärpe und konnte es mir durchaus leisten, meine Gäste, überwiegend österreichische Prominente und Politiker, herunterzuputzen und ein bisschen zu verspotten. Was im richtigen Leben Frechheit und Ehrenbeleidigung gewesen wäre, war hier: Chuzpe. Zur Auflockerung wurden zwischendurch Clips aus meinem kaiserlichen Alltag eingespielt: Da war es meine Aufgabe, mich in jeder Situation möglichst weltfremd zu zeigen, was mir nicht wirklich schwerfiel. Wir zeichneten die Sendungen im Großen Festsaal im Haus der Industrie am Schwarzenbergplatz auf. Sie schlugen sofort ein und wurden die erfolgreichste Eigenproduktion des Staatsfernsehens. Von allen neuen Formaten der großen Programmreform war es das einzige, das nach Ablauf eines Jahres noch übrig geblieben war. Ein von lauter Flops und medialen Totenvögeln umzingelter Phönix. Ich bin mir nicht sicher, ob mich die Seherinnen und Seher jemals als Karikatur gesehen haben. Aber falls doch, so habe ich im Lauf dieses Jahres nach und nach aufgehört, eine Karikatur zu sein, und verwandelte mich in den Gegenstand der Karikatur.
Wer meine Gäste waren, war ziemlich einerlei. Sie mussten sich nur demütigen lassen. Es ging den Leuten, den Seherinnen und Sehern zu Hause an den Bildschirmen, nur darum, dass der eine wie der andere von mir heruntergeputzt und wie der letzte Trottel behandelt wurde! Eine Zeit lang machte mir dieses Demütigen und Erniedrigen Prominenter wirklich einigen Spaß. Man möchte ja nicht glauben, welche Idioten die sogenannten Macher und Mächtigen eines Landes hinter der Bühne bei der Vorbesprechung waren! Verängstigte kleine Würstel, Karrierelinge nicht nur ohne Rückgrat, das war klar, sondern auch ohne irgendeine eigene Idee, ohne irgendeine Vision, ohne den geringsten Funken Kreativität, ohne den geringsten Funken Esprit oder Humor oder Selbstironie, machtversessen freilich, aber ohne das geringste eigene Vermögen, Marionetten ihrer Spindoktoren, Coaches, Manager und Berater und, wie für Marionetten kennzeichnend, ohne Bewusstsein ihrer Marionettenhaftigkeit. Mächtig, wenigstens scheinbar mächtig ja, aber mit baldigem Ablaufdatum und anschließender Versenkung für immer. Auf Dauer wurde das Herunterputzen aber tönern, blechern, beliebig, langweilig und stereotyp. Außerdem durfte ich menschlich defekt, musste aber politisch korrekt sein. Die herankutschierten Promimarionetten aus Politik und Gesellschaft ließen sich zehn Minuten lang ein bisschen von mir verspotten, nahmen die Demütigungen innerlich abgeschaltet entgegen und bekamen dafür im Gegenzug enorme Bekanntheit. Bekanntheit, sage ich, nicht Popularität. Das verwechselt man leicht. Populär wurde ich. Immer populärer. Aber der Mechanismus ödete mich an. Ein Kaiser war doch nicht dazu da, Spitzensportler, Musikanten, Provinzpolitiker und Knödelhirne zu zergatschen! Ein Kaiser war nicht dazu da, einen Skikaiser, einen Fußballkaiser oder einen Landeshauptmann, der zufällig Kaiser hieß, zu empfangen! Wäre ich der wirkliche Kaiser, dachte ich, ich würde diese Audienzen sofort abschaffen! Das waren wohl schon Zeichen meiner inneren Verwandlung. Die politische Satire war keine mehr, sie wurde nach und nach zum leidenschaftlichen politischen Wunsch der Mehrheitsbevölkerung. Der Sender, von seinem eigenen missverständlichen Sensationserfolg auf dem falschen Fuß erwischt, bekam es mit der Angst zu tun und setzte die Sendung ab.
***
Die Absetzung der Serie löste massive Proteste aus, mit denen der Sender nicht gerechnet hatte. Ich war der Publikumsliebling, der Quotenkaiser, und ich hatte ein ganzes Volk hinter mir. Die Telefone des Kundendienstbüros liefen heiß. Es gab Morddrohungen gegen den Programmdirektor und gegen den Intendanten. Es gab parlamentarische Anfragen der Opposition (obwohl die doch die meisten Prügel von mir abbekommen hatte), die Vernachlässigung des Kulturauftrags betreffend. Zunächst verschanzte sich der Sender hinter seiner Arroganz und scheinbaren Allmacht: was hier Kultur sei und was nicht, habe er und nur er zu entscheiden – Freiheit der Kunst, Freiheit der Presse, Unabhängigkeit des Rundfunks, daher könne er den Kulturauftrag gar nicht vernachlässigen. Aber der Schuss ging nach hinten los, die Barrikaden fielen. Mitarbeiter des Senders wurden in Wien auf offener Straße attackiert. Es gab eine Demonstration, die über die Ringstraße zum Heldenplatz führte. Die Seherinnen und Seher wollten ihren Kaiser wiederhaben. Ähnliche Szenen dürften sich zuletzt gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts in London abgespielt haben, als alte Damen auf Sir Arthur Conan Doyle auf der Oxford Street mit ihren Handtaschen losgingen, nachdem der seinen Sherlock Holmes in den Reichenbachfällen abstürzen und zu Tode kommen hatte lassen.
***
Wie Sherlock Holmes musste auch ich wiederauferstehen, um die Massen zu besänftigen. Immerhin waren die Massen ja auch Kundschaft, sogenannte Gebührenzahlerinnen (die Gebührenzahler waren mitgemeint!). Etliche hektische Krisensitzungen im Büro des Intendanten (sogar die Staatsspitze war zugeschaltet) führten schließlich zu dem Kompromiss, dass man mich zwar nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch zu besonderen Anlässen und Feierlichkeiten sendete, dafür aber auf dem besten Sendeplatz zur besten Sendezeit in abendfüllender Länge! Es gab ein Silvesterspecial, ein Nationalfeiertagsspecial, Wiederholungen, Best-ofs, Director’s Cuts, Zusammenschnitte, Bundesländerspecials und Ähnliches. Im großen Festsaal des Hauses der Industrie am Schwarzenbergplatz konnten wir nicht mehr drehen, weil der inzwischen ausgebucht war. Also mussten wir eine andere Location suchen. Jacques Bärenfels, der die meisten Folgen der Serie geschrieben hatte, kam schließlich auf die naheliegende Idee: Schönbrunn! Das stand leer und bot sowohl das ideale Interieur als auch das perfekte Umfeld mit Tiergarten, Irrgarten, Gloriette und allem Drum und Dran! Die Produktion würde viel billiger sein und die neuen Spezialfolgen noch authentischer geraten! Austrian Hollywood. Ich fühlte mich am neuen Drehort sofort heimisch, mein Volk hatte mich wieder! Jetzt war ich kein Angebot des Senders mehr, jetzt war ich aus der Verbannung zurückgekehrt der vom Volk gewählte Kaiser!
4
Zur Vorbereitung auf die neuen Specials las ich viel über den Geburtstag des alten Kaisers, den 18. August; über das unselige Manifest An meine Völker, über Bad Ischl, über die »Regierungstrottel«, über die »Untergangssuppe«, über Sarajevo, über Feldkirch, von wo der letzte Kaiser, der junge Karl, letztmalig österreichisches Territorium verließ und ins Exil ging, um niemals wiederzukehren, zuerst in die Schweiz, ins Land der Vermicelles, wo sein Urururgroßvorfahre Rudolf hergekommen war, ursprünglich eine Marionette, eine politische Kompromisslösung, die sich aber zum respektablen Kaiser gemausert hatte; dann von der Schweiz aus tausend Kilometer in den Atlantik hinaus, auf die Insel Madeira, wo er zwischen bunten Blumen bald einmal starb. Ich las auch viel über seinen Sohn Otto, den ersten Leider-nicht-Kaiser, einen kultivierten Mann und prädestinierten Thronfolger, der österreichischen Boden nicht betreten durfte und angesehener Europaparlamentarier wurde, ein non playing homo politicus durch und durch, und über seinen Enkel Karl, Thronfolger nach dem Thronfolger, der aber ein reichlich lächerlicher Fernsehmoderator wurde und sozusagen die Kabarettistenlaufbahn einschlug, aber selbst da ein Rohrkrepierer und bald zum Abdanken gezwungen war. Ein Kaiser als Komiker: Wie hätte das ausgeschaut? Wir gingen genau den entgegengesetzten Weg! Der Urenkel wurde Rennfahrer. Was sich Gott dabei gedacht haben mag? Der Urenkel heißt zwar nicht mehr von, aber hat noch immer so viele Vornamen, dass er einen Grand Prix ganz alleine bestreiten könnte. Aber irgendetwas muss ja auch der Urenkel des Ex-Kaisers machen …
Am meisten Material fand ich natürlich über die legendäre Sisi, eigentlich Elisabeth, später Romy, die in unserer Serie aber keine wirkliche Entsprechung hatte: In diese Richtung hätte man durchaus noch ausbauen können. Ich hatte diesbezüglich etliche Diskussionen mit meinem Autor Jacques Bärenfels und vertrat die Auffassung von James Joyce, wenn es in einem Drama fad würde, müsse man eine Frau auf die Bühne bringen. Aber wir fanden leider zu keinem heterosexuellen Ergebnis. Sisi war, obgleich halbe Ausländerin – Bayerin –, Urmutter der Nation, Vollbluthysterikerin, Zwangsneurotikerin, Hobbylyrikerin und Vorbild aller österreichischen Frauen, die ihr leidenschaftlich nacheiferten und sie oft und oft sogar übertrafen, auch wenn die meisten nicht so spektakulär endeten: mit einem Femizid. Viele österreichische Männer seufzten daher oft und oft: Mir bleibt auch nichts erspart!
***
Die Republik lag im Argen, ihr Bundeskanzlerverschleiß wurde immer gigantischer, zuerst sieben Kanzler in knapp vier Jahren, dann drei Kanzler binnen eines Monats, am Ende wusste man am Morgen nicht mehr, wer am Abend Kanzler sein würde, man wusste nicht mehr, unter welchen Umständen einer Kanzler wurde und unter welchen er im Handumdrehen wieder abdanken musste. Meinungsumfragen wurden gefälscht, aber da die Meinenden bei Meinungsumfragen traditionell logen, waren ihre gefälschten Lügen als Endresultat die Wahrheit. Neu war, dass die Obrigkeit nun nicht mehr nur ihre Untertanen, sondern vor allem sich selbst untereinander bespitzelte. Jedenfalls führte die Bevölkerungsvertreterinflation zu deren totaler Entwertung. Die Bevölkerungsvertreter hatten nichts mehr mit ihrer Bevölkerung zu tun, die Bevölkerung umgekehrt interessierte sich nicht mehr für ihre Vertreter, misstraute ihnen und verachtete sie, ja, sie kannte sie am Ende nicht einmal mehr und vergaß, wozu ein Kanzler oder ein Minister gut sein sollte. Es zahlte sich nicht mehr aus, sich auch bloß ihre Namen zu merken. Die Kurzzeitbundesregierungen überboten einander an Lächerlichkeit, erließen ständig ebenso widersprüchliche wie hanebüchene Verordnungen, die sie weder exekutieren noch kontrollieren noch sanktionieren konnten, ließen Gesetze beschließen, die sie postwendend aussetzen und widerrufen mussten, schauten dessen ungeachtet aufs eigene Wohl und die eigene Tasche, während das Land immer dramatischer in Chaos und Absurdität versank. Der Staat war als Idee an sein historisches Ende gekommen. Die überflüssigen Ansprachen des Bundespräsidenten häuften sich und verkamen mehr und mehr zu ohnmächtigem Geplapper.
Dieser alte Präsident, ein guter Lotsch und zart nobeldement, dem aber zu einem wirklichen Charismatiker das Charisma fehlte, war, selten genug, noch im Amt gestorben, es herrschte drei Tage Staatstrauer. Wir, mein Schöpfer Jacques Bärenfels und ich, überlegten hin und her – die Vorteile des Kaiserreichs Österreich wären enorm: Regierung, Psychotherapie für alle und Tourismusturbo in einem – der Zeitpunkt ideal, die Krone war noch vorhanden: Sie ruhte in Schönbrunn unter einem Glassturz, die Chance auf Realisierung war nie größer als jetzt: Ein konspiratives Gipfeltreffen im Café Roth in der Währinger Straße schräg gegenüber der Votivkirche mit einer handverlesenen Gruppe engster Vertrauter und Netzwerker an einflussreichen Stellen brachte den Durchbruch und die Deklaration. Wir nutzten die Staatstrauer zum Staatsstreich, zur Machtübernahme und zur Ausrufung der Monarchie. Es ging blitzschnell, und es gab kaum Widerstand. Im Grund waren das gar nicht wir: Im Grund hatte sich die Monarchie ganz von allein restauriert und wiederausgerufen. Wir mussten die Dinge, das allgemeine Desiderat bloß auf den Punkt bringen, kanalisieren, verbalisieren, kommunizieren und offiziell machen. Es war ganz einfach: Man musste gar niemanden stürzen, niemanden wegputschen. Man musste nicht einmal das Parlament auflösen, das konnte ruhig weiter parlamentieren und politfuhrwerken wie bisher. Selbst den Augenblickskanzler konnte man Kanzler bleiben lassen, und der war gut beraten, sich damit zufriedenzugeben. Den Sender musste man wie bei jedem Staatsstreich natürlich schleunigst unter seine Kontrolle und auf Linie bringen, das schon. Den Intendanten, das aalglatte Abziehbild, nahmen wir in Geiselhaft. Er hatte keine Chance, er hatte nur eine Funktion, sonst nichts. Er musste froh sein, dass wir ihm seinen Schreibtisch ließen und ihn nicht außer Landes brachten. Er musste aber eine Vereinbarung unterschreiben, meine Marionette zu sein. Die Redakteure (und Redakteurinnen!) wurden samt und sonders fristlos entlassen und nach Ablegung eines Treueeids sofort wieder eingestellt. Wie die murrten und spurten und gurrten! Die eigentliche Macht im Staate ging vom Beamtentum und der Beamtengewerkschaft aus, das war immer so und würde immer so bleiben und war auch jetzt so. Wir mussten einfach übernehmen, was freigeworden und uns zugefallen war. Ich brauchte keine Meinungsumfrage, weder eine gefälschte noch eine nicht gefälschte. Ich bestimmte und setzte fest. Ich würde keine Pressekonferenz geben, in der ich zugab, »kein Heiliger« zu sein. Noch nie hatte ein Heiliger behauptet, ein Heiliger zu sein.
Wien, das der alten abgenagten Backhendlrepublik Österreich ein Wasserkopf gewesen war, ein mutanter Backhendlwasserkopf an Wienerwald, hatte über Nacht und im Handumdrehen wieder seine dem Reich angemessene Größe, sodass sogar die K. K. Beamten wieder etwas zu verwalten hatten und kein absurdes Larifari mehr inszenieren mussten. Die alten Kronländer wieder anzuschließen war überhaupt kein Problem: Durch das wenn auch lustlos zusammengeschlossene Europa waren die Grenzen ohnehin durchlässig oder gar nicht vorhanden gewesen. Gefehlt hatte es diesem Europa bloß an der Seele und an dem, was Leib und Seele zusammenhält. Es drohte seinerseits zu verfallen und zerfallen, wie Österreich verfallen und zerfallen war. Die Oberhäupter der Kronländer wurden nach Schönbrunn zur Kleinkronenverteilung geladen, und sie kamen mit großer Freude und Genugtuung, Teil von etwas Größerem zu sein. Sie bekamen Süßes mit auf den Heimweg. Die Völker der Kronländer waren in Österreich und vor allem in Wien ohnehin schon präsent, außerdem Gscherte und Zugereiste aus allen Winkeln und Ecken und Enden der Welt. Brüssel verlor schlagartig an Bedeutung, es wurde sozusagen ins Belgische zurückgestopft, dazu genügten ein paar Abendessen!
Österreich war eine Demokratie gewesen, in der die Sonne nicht aufging und in der nie das geschah, was die Mehrheit wollte. Ob es um Kunst oder Politik, um Busbuchten oder den Fußballteamchef gegangen war: Die »demokratischen Strukturen« waren eine Mischung aus Alibi, Lobbying, Mobbing, Korruption, Kampagnen und Intrige gewesen. Alles war schlechter geblieben. Schon seit geraumer Zeit war das offizielle Österreich, die morsch und hohl gewordene Republik, das heißt ihre Repräsentanten, immer wieder mit der Gefahr einer Renaissance der Monarchie konfrontiert worden, und auch wenn die Günstlinge gelassen dementierten und gewisse Strömungen ins Reich der nostalgischen Fantasie verbannten, ließ es sich doch nicht übersehen, dass schon vor der Wende immer mehr Touristen aus aller Welt nach Schönbrunn kamen in der Hoffnung, dass ich mich zeigen würde oder um wenigstens eine pompöse Wachablöse mitzuerleben, weil sie überzeugt waren, die restaurierte Monarchie wäre längst Realität: die erste wiedererstandene Monarchie des Jahrhunderts auf dem Kontinent, das erste wiedererstandene Kaiserreich Europas im neuen Jahrtausend, der allererste auferstandene Kaiser! Eine Weltsensation. Dabei hatte das alles mit Politik sehr wenig zu tun! Jetzt hatten sie, was sie wollten! Die Welt war begeistert!
Zurück ins Märchenreich! Im Märchen gab es kein Parlament und keinen Kanzler und keinen Präsidenten, keinen Oppositionsführer, keine Landeshauptleute, keine Unterausschüsse, keine Gemeinderäte und keine Clubchefs, nur Kaiserinnen und Kaiser, Königinnen und Könige, Prinzen und Prinzessinnen. Das heißt: Es gab sie, die Präsidenten und Oppositionsführer und Gemeinderäte, aber sie spielten keine wirkliche Rolle. Die Königshäuser von Großbritannien, den Niederlanden, Spanien, Norwegen oder Schweden lieferten ein Jahrhundert lang den schlüssigen Beweis, dass sich durch konsequentes, hartnäckiges, elitäres Nichtstun nicht nur alle politischen und gesellschaftlichen Probleme lösen ließen, sondern auch die dauernichtstuende Königsfamilie selbst immer beliebter wurde, allen voran der Monarch selbst, dem gottgleiche Verehrung zuteilwurde. Das tragikomische absurde Stegreiftheater des Nichtstuns im Königsschloss, vergleichbar nur dem tragikomischen absurden Stegreiftheater des Nichtstuns in Domen und Kathedralen, war in allen Ländern und selbst bei deren Nachbarn und Nachbarsnachbarn ein permanenter Kassenschlager! Die Medien lebten davon! Der Tourismus lebte davon! Die Wirtschaft lebte davon! Was für ein Wahnwitz, als kleines Land ein volles Jahrhundert lang freiwillig auf diese gesellschaftspolitische Goldgrube verzichtet zu haben!
Ebenso wenig ließ sich übersehen, dass in den Souvenirläden von Schönbrunn neben den Devotionalien von Franz Joseph und Sisi immer mehr Devotionalien von Kevin Kai auftauchten, die sich zudem wesentlich besser als die meiner royalen Vorgänger verkauften: ein Phänomen, das man auch in Rom beobachten konnte, als zum alten Papst ein neuer kam. Und was war Schönbrunn anderes als der österreichische Vatikan, gerade im Jahrhundert der Sedisvakanz! Jetzt hatte endlich alles wieder seine Ordnung, jetzt war das Inoffizielle endlich wieder offiziell geworden – zum Wohl des Volkes, zum Wohl der Staatsfinanzen – und zur Freude der Welt. Fast die komplette Infrastruktur war noch vorhanden. Ich war der eine, der Schönbrunn zu seinem Glück und seiner Seligkeit gefehlt hatte während seines hundertjährigen Dornröschenschlafs. Ich, Kevin Kai Trotta, jetzt natürlich Kevin Kai von Trotta, war der Kaiser, schon vor der Krönung und der eigentlichen Machtübernahme, ein vom Volk per Akklamation gewählter Kaiser, aber das Volk war ja nur ein Instrument Gottes, und Gott war, wenn schon sonst nichts: das Gute! Wer wollte das bestreiten? Theologisches Simsalabim hat kein Ablaufdatum. Insofern alles beim Alten.
Immerhin war es in Frankreich zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts auch nicht anders gewesen: Der Präsident der Republik, Louis-Napoléon Bonaparte, 1848 für vier Jahre gewählt, strebte eine Erneuerung seines Mandats an, konnte aber nicht wiedergewählt werden. Also Operation Rubikon! Er ergriff die uneingeschränkte Macht. Fast überall versuchten die Republikaner bekanntlich den Aufstand, in Paris und erst recht in Lyon, in Marseille, im Südwesten. Die Unterdrückung war erbarmungslos, Victor Hugo und Edgar Quinet mussten ins Exil! Der Staatsstreich gelang. Frankreich war unter die Bonapartistische Diktatur geraten. Ein Jahr später, am 2. Dezember 1852, wurde für Napoleon III. das Kaiserreich wieder errichtet – eine Restauration, die durch ein Plebiszit gebilligt wurde. Die neue Macht verwies gern darauf, dass sie ihre Legitimität aus dem allgemeinen Wahlrecht zog.
Letztlich schlägt Gott in den Kaiser ein wie eine Bombe, und der Kaiser schlägt in sein Volk, in seine Völker ein wie eine Bombe. Es sind Detonationen der Aristokratie, und einmal geschehen sind sie nicht mehr ungeschehen zu machen bis zum Jüngsten Tag.
5
Wie ich es nicht anders erwartet hatte, waren Machtübernahme und Ohnmachtübernahme ein und dasselbe, was mich keineswegs störte, weil mir Ohnmacht ohnehin sympathischer war als Macht, jedenfalls großpolitisch.
Dass ich mir die schwere Krone bei der feierlichen Krönungszeremonie selbst aufsetzte, war eine Idee von Jacques gewesen, eine Anspielung auf den Volkskaiser Napoleon, die Eindruck machen sollte. Und sie machte Eindruck. Kaum war ich gekrönt, kam die erste Einladung: noch dazu aus dem Buckingham Palace! Es ging hauptsächlich um Lachs, Jagd und die schottischen Moore. Das Treffen war zäh, steif und schweinelangweilig, ich war heilfroh, als ich es überstanden hatte. Aber die britischen Durchlauchten und Majestäten litten eben schon ihr Leben lang an der schleichenden Königshauskrankheit, das Langweilen und Gelangweiltsein, und der an Debilität grenzende Nichtstustumpfsinn war ihnen in Fleisch und Blut übergegangen, aber nichts von all dem drang an die Außenwelt. Das einzige sichtbare Dokument des Treffens im Buckingham Palace war ein Foto der Queen und mir, das in rasendem Tempo um die Welt ging, in jeder Fernsehanstalt gebracht wurde, in jeder Illustrierten mit unglaublichen fantasierten Reportagen versehen, allerdings alle langweilig und nichtig. Die Mitglieder des britischen Königshauses waren Schauspieler, die die Rollen nichtstuender Monarchen zu verkörpern hatten: Monarchen, die jeden Tag am Morgen aufstanden und nichts zu tun hatten und auch nichts tun durften, bis sie abends wieder schlafen gingen. Ihre Hauptaufgabe war es, den Tag durchzuhalten und zu überstehen, jeden einzelnen Tag durchzuhalten und zu überstehen, viele, viele Jahre lang, zur Stabilität ihres Reiches, einerseits sogenannte Skandale peinlichst zu vermeiden und andererseits sogenannte Skandale in großer Zahl zu liefern. Solche Skandale mussten nichts Besonderes sein, nur sensationell. Die Königsfamilienschauspieler hatten aber keine festen Arbeitszeiten und schon gar keine Königsfamilienschauspielergewerkschaft, sondern ihr Engagement und ihre Rolle dauerte vom ersten bis zum letzten Tag ihres Lebens. Einfach nur immer für andere da sein als virtuelle Schaufensterpuppe, das ist der härteste aller Jobs. Ich musste mich in Acht nehmen, nicht in diese Falle zu tappen. Etwas Neues im ewigen Einerlei und Monarchenalltagstrott gab es aber, denn zur Zeit meines Antrittsbesuchs im Buckingham Palace wurde gerade wieder eine Staffel einer unheimlich beliebten Netflix-Serie gedreht, die das Schicksal der Könige und Königinnen des ganzen Jahrhunderts darstellte. Eigentlich nur ein König und eine Königin nacheinander. Und rundherum Familie und Hof. Hundert Jahre Nichtstun! So kam ein wenig Leben, Spannung und Aufregung in die Bude: Einmal pro Woche versammelten sich die Königsfamilienschauspieler im großen Salon, um sich die sie darstellenden Schauspieler, die Königsfamilienschauspielerschauspieler (und Schauspielerinnenschauspielerinnen) anzusehen, die sie beim staatstragenden Nichtstuschauspielen spielten. Aber wenn die Dreiviertelstunde vorbei war, wurde es wieder langweilig, und die Exzellenzen und Majestäten und Durchlauchten waren wieder auf sich selbst zurückgeworfen bis zum abendlichen Lachs mit Dillsauce. Das alles liebte das Volk sehr und lechzte nach immer neuem Gleichen.
»Sinn hat das natürlich keinen und Spaß macht es noch weniger«, sagte mir der uralte Prinz zwei Schritte hinter der Queen, wo er schon fast siebzig Jahre Aufenthalt genommen hatte, »eine Million Blumenschauen zu eröffnen und in den ehemaligen Kolonien einige Hundert Eingeborenentänze wohlwollend zu betrachten. Aber es ist unsere Pflicht, und die sinnlose Pflicht muss erfüllt werden. Das Leben meiner Frau, die später Queen wurde, also eine Außerirdische aus Wachs und Blaublut, ist genauso sinnlos! Und die Existenzen all der Pinguine aus aller Herren und Damen Länder, die wir zu langweiligen Palastgalaabendessen empfangen, ob gewählt oder gekrönt, sind genauso sinnlos. Wir sind dazu da, unsere Sinnlosigkeit begaffen zu lassen von all den Millionen und Milliarden Sinnlosen auf der Welt, damit sie ihre eigene Sinnlosigkeit besser ertragen. Das ist ein großer Dienst. Wir sind der Monarchenzoo. Die Welt ist ein Märchen, erzählt von einem Narren, voll Lärm und Wut – bedeutend nichts. Aber sagen Sie es nicht weiter. Man würde es Ihnen ja doch nicht glauben! Wir sind Gestalten, die im Unzusammenhängenden umherirren«, flüsterte mir der alte Prinz hinter seiner Königin ins Ohr. »Wir nennen nichts unser Eigen außer unserem Versagen und der Leere unseres Lebens. Wir sind Wesen, die in ein Etwas hinausgestoßen sind, dem jeglicher Sinn fehlt, deshalb können wir nur grotesk erscheinen, und unser Leiden ist nichts als tragischer Spott.« Ich nickte. »Aber wenn ich einmal gestorben bin, werden in Vanuatu nackte Neger für mich eine Schweigeminute halten. Das ist mein Lohn, Sie werden sehen!« Hätte ich dem alten Prinzen sagen sollen, dass man Neger nicht mehr sagt? Er war ja schon so alt und für die ungehörige Sprache und die flotten Sprüche bekannt, die er sich erlaubt. Ich wusste nicht einmal, wo Vanuatu war, hielt mich an die Devise: Immer nur lächeln! und hoffte, dass keine Lippenleser im Saal waren.
Kaum war ich aus dem Buckingham Palace wieder zurück, stand schon der nächste Pflichttermin im Kaiserkalender: Modellstrammstehen für meine Madame-Tussauds-Wachsfigur im Prater.
***
Österreich war erlöst, Schönbrunn besetzt, aber sonst hatte sich nicht viel geändert seit dem Tag, an dem ich den Kaiser nicht mehr schauspielte, sondern der Kaiser war. Schauspielen musste ich ihn trotzdem. Die Mission des Kaisers war es freilich nicht, wie früher irgendwelchen C-Promis eine Bühne zu bieten, wenn auch zum Preis der öffentlichen Demütigung. Die Mission des Kaisers war es, ein Zeitalter wahrer Glückseligkeit zu stiften. Der Kaiser hatte a) gütig, b) groß, c) erhaben, d) gerecht, e) unendlich fern und gleichzeitig sehr nahe zu sein. Viel zu tun.
Symbolische Akte waren dazu dringend erforderlich, jegliches politische Leben lebt von Symbolen. Eine Zeit lang überlegten Bärenfels und ich, Österreich in Kakanien umzubenennen, aber ich wollte im Namen meines Reiches kein Exkrement. Kastanien wäre noch eine Variante gewesen, mit der Hauptstadt Maroni: Das hätte meinen Vater gefreut.
Als Kaiser war ich nun natürlich auch Oberbefehlshaber meiner Armee. Aber das Heer widerte mich an, Manöver widerten mich an, Krieg, Kriegsgerede, Kriegsgeschichten widerten mich an. Und es entsprach auch nicht dem Zeitgeist. Mir selbst war es als junger Mann mit großem Aufwand, unter anderem auch schauspielerischem Aufwand gelungen, mich vor dem Bundesheer zu drücken. Diesen Sieg über den bornierten Brutalstaat hielt ich für den größten Triumph meines Lebens, jedenfalls bis zur Kaiserselbstkrönung. Ich war Friedenskaiser, Friedenskaiser und noch einmal Friedenskaiser. Zum Glück hatte niemand auch nur das geringste Interesse an Krieg, weder die Deutschen noch die Franzosen noch die Briten. Die Amerikaner, die Russen, die Japaner und die Chinesen zündelten wohl immer da und dort, aber bis zum Supergau und zur Apokalypse kam es in meiner Regierungszeit nicht. Alle wollten nur Gewinn maximieren. Kasernen, die oft noch aus der alten Monarchie stammten, wurden nach und nach aufgelassen, geschleift und durch Wohnblöcke ersetzt. Immobilienentwickler wurden die neuen Machthaber. Ihr Geld kam aus den Weiten Russlands oder den Arabischen Emiraten und den Scheichtümern. Nirgendwo drohten Schlachten, überall nur Einkaufsschlachten. Heldentum wurde von geschickten Werbeprofis mit Konsum gleichgesetzt und mit niedrigen Preisen illustriert und kombiniert. Der Held von heute ließ sich nicht mehr fürs Vaterland abschlachten und töten, der Held von heute shoppte für den Kapitalismus. Das war zwar deprimierend, aber untrügerisches Zeichen, dass die beste aller Welten Wirklichkeit geworden war. Man war ganz oben dahintergekommen, dass der Krieg summa summarum unwirtschaftlich war und daher zu unterbleiben hatte! Mein Onkel Otto, der bei Weihnachtsfesten gern politisierte, hatte mich als Junger einmal gewarnt, von Russland gehe eine große internationale Gefahr aus. Die Führung im Kreml sei in eigenartigen Händen. Viele im Westen seien vom kleinen abgezwickten Zaren entzückt, weil er gut Deutsch sprechen und Ski fahren würde. Er habe vielleicht auch bessere Manieren als mancher Vorgänger und eine repräsentable äußere Erscheinung, »solange man nicht in seine Augen schaut«. Das sei eine dunkle Seele! Tatsächlich wollte dieser russische Tyrann Jahrzehnte später einmal allen Ernstes mit Gewalt das Rad der Geschichte zurückdrehen und seine Kolonien zurückerobern, aber zum Glück hatte die Dekadenz auch Russland schon von innen her angefressen und der Zwergzar fiel einem Attentat des eigenen Geheimdienstes zum Opfer. Ein paar Oligarchen, denen man im Westen ihre Jachten konfisziert hatte, hatten das Attentat gesponsert, um den anachronistischen Dreckskerl loszuwerden. Die anschließende Schändung der Leiche des Tyrannen durch das einfache Volk war grausam und barbarisch, aber na ja, das Volk, schwamm drüber, er hatte es sich verdient.
Österreich hatte freilich keine wirklichen Feinde. Überall liebte man unsere majestätischen Berge und die idyllischen Seen, Wien, Salzburg, Hallstatt und ein bisserl auch Celovec. Vor allem aber liebte die Welt die wunderbare österreichische Küche! Das Weltkulturerbe schlechthin! Wo sonst auf der Welt bekam man denn Kirschknödel? Zwetschkenknödel? Maroniknödel? Hören Sie mir auf mit Barbareien wie Donuts, Profiteroles und Roter Grütze! Kirschknödel! Zwetschkenknödel! Maroniknödel! – das war die Klimax des Kochens, das waren die drei Stufen auf der Treppe zum Paradies – und die Gewähr für immerwährenden Frieden! Dabei habe ich von Kaiserschmarren, Kastanienreis und Salzburger Nockerln noch gar nicht gesprochen! Hoch Palatschinken! Hoch Palatschinken! wurde zum Schlachtruf meines Reiches! Ja, es stimmte, man starb in Österreich hauptsächlich an der Zuckerkrankheit! Aber vor die Zuckerkrankheit hatte der Herr die Zuckergesundheit gesetzt. Die Zuckerzufriedenheit, das Zuckerglück. Ja, man starb an der Zuckerkrankheit, aber man wusste wenigstens wofür. Welche Todesart konnte das sonst noch von sich behaupten? Krebs, Herzinfarkt, Schlagfluss, Verkehrsunfall oder der Tod fürs Vaterland sicher nicht! Ja, der Zuckertod drohte qualvoll zu sein, aber auch dafür fand ich eine Lösung. Zunächst hatte man in die Schweiz emigrieren müssen wie mein letzter unglückseliger Vorgänger (da waren das Leben und die Lebensmittel mittlerweile ohnehin so teuer, dass man ganz ohne Sterbeklinik von allein verhungerte) – oder ins Königreich der Niederlande. Schließlich gestattete ich zahlreichen Widerständen vor allem klerikaler Kreise zum Trotz die sogenannten Happy Ends im eigenen Reich: Das waren – je nach Vorliebe und persönlichem Geschmack kleinere oder größere – Finalfeste, sei es allein, sei es zu zweit, in der Familie oder mit Verwandten und Bekannten, sei es in behaglicher Stille, sei es mit Tanz und Musik nach Wünschen des Finalisten, auf jeden Fall mit einem herrlichen Abschiedssouper (obligatorisch Maroniknödel oder Kastanienreis), einem guten Tropfen, einer Pfeife, einer Zigarre, einem Zigarillo oder einer Zigarette und schließlich – vor dem Zubettgehen – der Paradiescocktail und ein, zwei Eternity-Tabletten: Tickets ins Elysium. So schlief man glückselig ein – und blieb es für immer.
Ich schaffte zwar nicht das Heer, aber die sogenannte Wehrpflicht ab, diese Jahrhundertstaatsgewaltsbarbarei. Keiner meiner Untertanen sollte volljährig geworden aufgrund seines Geschlechts einen sogenannten Einberufungsbefehl erhalten: Niemand, weder Mann noch Frau, sollte jemals wieder »ins Feld gehen«! Stattdessen ließ ich überall im Reich Schauspielschulen gründen: Jeder Untertan sollte die Möglichkeit haben, sich zum Schauspieler ausbilden zu lassen und auch den Beruf eines Schauspielers zu ergreifen. Schauspieler brauchte man überall! Wer wusste das besser als ich? Zugegeben: Auf die Rolle kam es an! Aber auch ich hatte als Statist angefangen! Als Dorftrottel und gehörnter Ehemann! Überall sollte gespielt werden! Ich ließ meine Armee entwaffnen und mit Spielzeugwaffen ausrüsten, für die Wachablöse genügten diese Utensilien. Die Resistance schüttelte den Kopf, aber das war mir egal. Überdies gab ich eine neue Fantasieuniform in Auftrag, nicht komplett lächerlich, aber doch ziemlich albern und absurd, die sich ein wenig am Berufsgewand der Köche orientierte, nur bunter: Die Österreichische Garde in Schönbrunn nach dem Vorbild der Schweizer Garde im Vatikan … Die Kochlöffelbrigade! Erlaubt waren per kaiserlichem Erlass nur noch Ballettauftritte eines Operettenmilitärs.
Als mein Verteidigungsminister zu protestieren wagte, setzte ich den Lümmel sofort ab, ernannte einen neuen Verteidigungsminister und gliederte sein Ministerium ins Tourismusministerium ein. Das war sehr schön! Das hat mich sehr gefreut! Ein paar Parlamentarier wiederum muckten gegen meine – wie sie fanden: undemokratische – Maßnahme auf. Die Kretins bekamen drei Tage Knödelverbot. Alle anderen Reiche folgten meinem Beispiel. Denn sie sahen, dass es gut war.
Den Doppeladler im Wappen, vor dem ich mich immer ein wenig geekelt hatte, ließ ich durch eine goldene Maroni ersetzen. Es ging auch ohne Greifvogel und Schnabeltierungeheuer! Für die Hofburg als Amtssitz hätte der zweifellos eindrucksvolle Balkon gesprochen, der aber historisch kontaminiert war. Also hob ich mir die Hofburg als gelegentliches Wochenenddomizil auf und wählte als Machtzentrale und Ohnmachtszentrale und Hauptthronsitz – trotz fehlenden Großbalkons – Schönbrunn, wo ich ja schon war, wegen des schönen Kaisergelbs, wegen des schönen Gloriettehügels, wegen der schönen Gloriette, wegen des Pools – und wegen der vielen Parkplatzmöglichkeiten auch für Busse.
6
Die Schönbrunner Wachablösen jeden Samstagmittag (zwischen Juni und September auch donnerstagabends!) wurden gigantische Touristenspektakel, zu denen Fernsehsender und Menschen aus allen Teilen der Welt anreisten, bei denen meine persönliche Anwesenheit aber zum Glück nicht erforderlich war. Es genügte, dass man wusste, dass es mich gab und dass ich hier war, dass ich theoretisch beim Fenster hinausschauen und winken könnte (was ich nie tat!), und sah, dass es gut war. Das alles hieß mit einem Wort Mythos. Ich wurde nach und nach ein veritabler Wirtschaftsfaktor! Wegen des enormen Zuspruchs fanden solche Wachablösen bald auch in den Hauptstädten unserer Kronländer statt, in Prag, Budapest, Lemberg, Pressburg, Krakau, Laibach oder Triest, aber auch in vielen Bezirkshauptstädten von Graz bis Salzburg, von Hermannstadt bis Celovec.
Das Kürzel K. K. als Vorsilbe und Markenzeichen wurde offiziell wieder eingeführt. Es konnte nun sowohl kaiserlich-königlich als auch Kevin Kai bedeuten. Ich rief ein eigenes Auszeichnungsministerium ins Leben, das K. K. Hofministerium für Ehrung, Auszeichnung, Würdigung und Wertschätzung. Beamte hatte ich ja genug. Eine ganz besonders wichtige Maßnahme – quasi das zweite Standbein des Reiches neben seiner Küche – war die Wiedereinführung der Adelstitel und der Hofräte. Ganz aufgelassen hatte man diese geniale und gleichzeitig staatsfinanzenschonende Einrichtung, um die uns die Welt immer beneidet, obgleich belächelt hatte, auch im Interregnum der Demokratie und Demokratur und Plutokratie nicht. Aber jetzt erblühte sie zu neuer barocker Üppigkeit und Fülle! Als Erstes wurden alle Maronibrater meiner Monarchie geadelt und zu Hofräten ernannt! Diese Ehre hatten sie sich längst verdient, diese kohlestaubschmutzigen Helden des Alltags mit ihren gegerbten Gesichtern und heiseren Stimmen, die Wind und Wetter trotzten, um den Mercedes unter den Nussfrüchten an den Untertan und an die Untertanin zu bringen! Auch mein alter Vater kam noch in den Genuss seines Titels, und wann immer jemand in Celovec bei seinem K. K. Hofmaronistand in der Kramergasse ein Viertel Maroni verlangte, sprach der Kunde meinen Vater nun respektvoll mit Hofrat von Trotta an, manchmal auch mit Baron de Maron.
Die Maroni war die Frucht des Reiches, wir hatten eine Reichsmaroni, keinen Reichsapfel. Goldig wie die Sonne leuchteten sie jetzt wie damals, denn Maronibrater war jetzt wieder ein symbolisch aufgeladener Beruf geworden, symbolisch für unsere neue Übernation. Überall, wo man Maroni aß und all die feinen Delikatessen, die man aus Maroni machen konnte, war wieder Österreich. Hier regiert Kevin Kai! Köche wurden zu K. K. Köchen (und K. K. Köchinnen), Kellner zu K. K. Kellnern (und K. K. Kellnerinnen) ernannt und durften fortan vor den Augen der Welt K. K. Knödel und K. K. Strudel und K. K. Kastanienreis zubereiten und servieren. So gab ich ihnen ihre Würde zurück.
Nach den Helden des Maronibraterwesens adelte ich als Nächste die dalmatinischen Pfeifenschnitzer und die Trafikanten: Noch so eine altehrwürdige österreichische Institution, die Jahrzehnte der Schmach zu erdulden gehabt hatte. Damit war nun Schluss! Rehabilitierung aller Tabaktrafiken war angesagt! Die wahren Zentren seelischer Gesundheit! Oasen des Glücks! Mittlerweile war auch in Frankreich unter Beibehaltung von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit wieder die Monarchie ausgerufen und Kaiser Michel I. gekrönt worden. Wir trafen uns in Versailles und schmiedeten eine ewige Allianz zur Rehabilitierung von Nikotin und Tabak, den beiden Schutzhelfern in jeder Not. Die neue Achse Frankreich–Österreich wurde zu dem bestimmenden politischen Ereignis des einundzwanzigsten Jahrhunderts. (Da hatten die Deutschen Pech gehabt, aber die meisten Deutschen waren mittlerweile ohnehin aus Deutschland geflohen und nach Österreich gezogen.)
Zweimal im Jahr gab es auf dem Platz vor dem Schloss Schönbrunn außer der Wachablöse den sogenannten Nationalmannschaftswechsel. Vor allem inländische Touristen aus den Kernländern waren hier das Zielpublikum. Dabei stellten sich elf Fußballer in den Nationalmannschaftsdressen in Reih und Glied auf, legten die Hand aufs Herz und ließen die Nationalhymne über sich ergehen. Nachdem die verklungen war, wurden die elf Fußballer durch elf Skifahrer in den Nationalskianzügen ersetzt, die ebenfalls zu den Klängen der Nationalhymne strammstanden. Die einen schwiegen, die anderen murmelten oder nuschelten, wieder andere jaulten volltönig, den Blick himmelwärts gerichtet. Anschließend ohrenbetäubender Jubel und Applaus der Massen. Am Nachmittag das identische Zeremoniell mit Damen. Wenn die Skifahrer auftraten, gab es in den Speisehütten neben den Kirschknödeln, Zwetschkenknödeln und Maroniknödeln ausnahmsweise auch Germknödel, wahlweise mit Mohn oder mit Vanillesauce zu kaufen. Die alte Leierkastenhymne aus Backhendlland, bei der die Nationalmannschaften vieler Generationen eingeschlafen waren, ersetzte ich durch die finale Jubelarie aus Beethovens Fidelio Heil sei dem Tag! Heil sei der Stunde! Überhaupt, dieser grunddusslige Text der alten Bundeshymne! Land der Berge, was sollte denn das heißen? Küniglberg. Berggasse. Kahlenberg. Was ist mit den Ebenen und Becken und Beckenlagen? Und den Seen?
Zur Weltverbesserung und Republikverbesserung hätten selbstverständlich die großen Töchter zu den großen Söhnen in die Hymne gehört, obwohl ich der Meinung war, dass die »großen Söhne« eher militärisch instrumentalisiert waren, allgemeine Männerwehrpflicht und so – Bundeshymne wie Bundesheer, das U, wie es klingt und stinkt –, die Heimat hat sich immer die Leben der Söhne genehmigt, ohne Genierer, ohne mit der Heimatwimper zu zucken, die Töchter sollten dann für Nachschub, also Nachwuchs sorgen, dessen Leben man sich dann wieder genehmigen konnte. Ich, Kevin Kai Trotta, war immer dafür gewesen, lieber die armen großen Söhne, also die armen kleinen Trottel, aus der Hymne herauszunehmen, anstatt die armen großen Töchter auch noch hineinzustopfen! Friede ihrer beider Asche! Und noch in neuerer Zeit bis zu meiner Krönung wurden die großen Söhne wie die großen Töchter aus der Heimat hinausgeekelt oder ins Ausland transferiert, wenn sie nicht schon in jungen Jahren von alleine abgehaut waren. »Heimat« war übrigens so ein missbrauchtes, vergewaltigtes, anrüchiges Wort: Das hätte man als Erstes aus der Hymne hinauswerfen sollen! Aber mit Beethoven machte ich alles wieder gut!
7
Was mich genauso anwiderte wie das Heer, war die Jagd. Die ersetzte ich durch Miniaturgolf, denn da wurde niemand feierlich getötet. Im ganzen Reich fanden nun zu meinen Ehren Minigolfturniere statt. Der Reinerlös ging an den World Wildlife Fund, an Hospitäler in Zentralafrika und Rettet das Kind. Statt des martialischen Halali das friedliche Klackklack meiner Ägide. Einen Ball in ein Loch zu schießen ist doch viel befriedigender als einem Hirschen ins Herz. Viele Wildtiere in den Wäldern des Reiches atmeten erleichtert auf. Es kam, wie es kommen musste: Die Queen lud mich auf eine Treibjagd in die schottischen Highlands ein. Schon wieder das Empire! Ich glaube, der alte Prinz hatte einen Narren an mir gefressen. Vor mir hatte ihm niemand zugehört. Obwohl ich in meiner Absage diplomatisch darauf verzichtete, Nestroy zu zitieren (»Es gibt nix Dümm’res als die Jagd«) und die Barbarei Barbarei zu nennen, führte diese Absage zu einer Verstimmung im Buckingham Palace, die ich beilegen konnte, indem ich die Queen nach Schönbrunn zu einer Minigolfpartie unter der Gloriette einlud, wo ich eine majestätische Achtzehn-Bahnen-Anlage errichten hatte lassen, und galant gewinnen ließ, während die Maroniknödel für das Festbankett zubereitet wurden. Außerdem durfte Elizabeth die goldenen Bälle verwenden. Wurscht.
Small Talk mit der Queen war eine zähe, mühselige Angelegenheit. Außerdem passte der sauertöpfischen greisen Dame nichts an Schönbrunn. Der Lachs war ihr zu stark gewürzt, die Maroniknödel zu süß, außerdem wollte sie zu jedem Gericht völlig unpassenderweise einen Apfel (wir reichten ihr Kronprinz Rudolf!), den Tee fand sie, wenn ich das richtig übersetzt habe, überhaupt igittigitt, also, die Lady war ziemlich etepetete und pingelig. Ich überließ den Small Talk schließlich ihr. Sie kenne auch einen Kevin, sagte die Queen, den habe sie ge-sir-t, Kevin Keegan, ein Rasensportler oder ein Sänger, wenn sie sich recht erinnere, ja doch, so ein Aushilfsbeatle.
»Sie werden es nicht glauben, Kollegin Majestät, nach genau dem bin ich benannt!«
»Oh! Amazing, isn’t it?«
»Ja. Früher haben die Slowenen eher nicht Kevin geheißen. Aber mein Vater Borut war ein großer Fan von diesem Keegan, der vor meiner Geburt dreimal Europacupsieger mit dem FC Liverpool wurde, und da hatte meine Mutter bei der Taufe keine Chance! Heute heißen fast alle Slowenen Kevin. Mein zweiter Name Kai wiederum ist so rätselhaft wie das Menschengeschlecht selbst. Die einen Namensforscher meinen, Kai stamme vom alten friesischen Wort Kempe ab und bedeute »Kämpfer« oder »Krieger«. Konkurrierende Namensforscher hingegen behaupten, es sei eine Kurzform von Nikolaus oder Gaius oder Caius (Zar? Caesar?), Konkurrenten dieser konkurrierenden Namensforscher tippen eher auf Kajetan oder einen keltischen Speerwerfer oder Speerhalter. Im Hawaiianischen und Polynesischen bedeutet Kai »Meer und Ozean«, im Navajo-Indianischen »Weidenbaum«, im Japanischen »Wegbereiter«, im chinesischen Mandarin »Siegreicher« und im Deutschen nichts. Bis 2004 durfte man Kai nicht als alleinigen Vornamen geben, sondern musste einen zweiten, das Geschlecht eindeutig bestimmenden Vornamen hinzufügen. Auch deswegen Kevin.
Ich fragte meinen Vater einmal, was er denn mit Kai bezweckt habe. Da schmunzelte er nur und meinte, das müsse ich selber herausfinden. Während ich ihr von meinem sagenumwobenen Zweitnamen berichtete, konnte ich an der Miene der