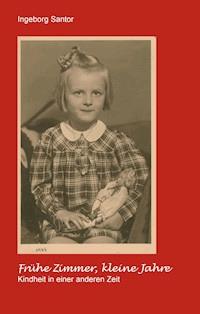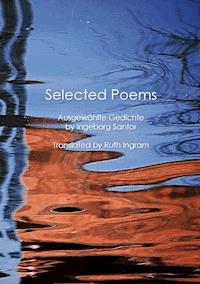Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hier geht es in fast allen Texten um Seh- und Wahrnehmungs-Erlebnisse: um das Ergriffensein von landschaftlicher Schönheit auf Reisen, um berührende oder erschreckende Begegnungen mit Menschen, und immer um einen möglichst genauen Blick auf die Welt. Ebenso wichtig sind der Autorin die imaginären Räume der Phantasie und vor allem der Sprache. Eine Erzählung thematisiert das konkret miterlebte Verlorengehen von Sprache (Aphasie) bei einem nahen Angehörigen. Ein solcher Verlust ängstigt natürlich nicht nur schreibende Menschen - dass der Umgang damit aber auch humorvoll möglich ist, beweist der Text "Verlegte Wörter". Ganz anders eine vor Jahren entstandene, hellsichtige Dystopie, die den Band beschließt und sehr genau zu all unseren Besorgnissen heute passt, jedoch auch Hoffnung aufblitzen lässt. Das tut erst recht und besonders intensiv der titelgebende Essay über das Glück in all seinen Formen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„… denn in unserm Schauen liegt unser wahrstes Erwerben.“
Rainer Maria Rilke, Tagebuch
Inhalt
Unterwegs
Der Reisende
Das Meer umarmen
Nordseelandschaft in wechselndem Licht
Rügen zu Fuß
Szymborskas Haus
Wörtlich genommen
Von Wörtern und Lauten
Das Glück, das ich meine
Wie Geschichten beginnen können
„…der hat Zähne“
Verlegte Wörter
Botschaft
So gesehen
Vom Blühen, vom Welken
Kleines Hand-Werk
Etwas über Nichts
Mutmaßungen
Steinschlag. Ein Bericht aus der Zukunft
Nach-Wort oder: Was ich noch sagen wollte
Kurz-Bibliographien zu den Texten
Biografische/bibliografische Angaben
Lieferbare Bücher
Unterwegs
Der Reisende
Immer wenn er reiste, reiste er mit dem Zug. Er mochte weder Automobile noch Flugzeuge. Schon deshalb nicht, weil sie es ihm versagten, sich mit dem Rücken zur Fahrtrichtung zu setzen, ihm also die Möglichkeit nahmen, dem eigenen Sich-fort-Bewegen zuzuschauen und ihm so eine Art Dauer zu verleihen. Er hasste es, wenn Landschaften oder Gebäude auf ihn zu rasten und sofort wieder verschwanden. Er wollte sie vorüber gleiten sehen, sie dabei lange noch im Blick behalten können, während zugleich neue Bilder sich ins Fenster schoben, denen die Augen wiederum folgen konnten – es war, als müsse er sich schon während der Reise immerfort des Reisens erinnern.
Fünf war er gewesen oder sechs, und zu dem Zug hatte das viel gewichtigere Wort Eisenbahn gehört und eine riesige Dampflokomotive. An der Hand des Vaters war er schon eine halbe Stunde vor der Abfahrt auf dem Bahnsteig hin und her gelaufen, immer zwei Schritte, wenn der Vater einen machte. Er hatte zuschauen dürfen, wie die schwarze, ungeheure Masse der Lok rückwärts vor die Waggons rangierte, ein vor Kraft bebendes Maschinentier, das gewaltig einatmete, ausatmete, dabei abwechselnd Dampfsäulen und Rauchwolken hervorstieß, endlich mit einem Schlag, der die Wagenschlange erzittern ließ, ankuppelte und mit kreischenden Rädern zum Stehen kam. Seine Hand hatte feucht in der des Vaters geklebt. Er sah die Oberkante der Räder so hoch über sich, dass er sie auch auf Zehenspitzen und mit gestrecktem Arm noch lange nicht hätte erreichen können. Dicht vor ihm ragte ölverschmiertes Gestänge, grell-weißer Dampf zischte auf den Bahnsteig, umnebelte ihn und die Beine des Vaters. Ein Mann mit rußigem Gesicht beugte sich aus dem Lokfenster, bleckte lächelnd die Zähne und das Weiße seiner Augen.
Jetzt müssen wir aber, sagte der Vater, Bedauern in der Stimme, und sie liefen zurück zu den Waggons dritter Klasse, fast bis zum Ende des Zuges. Dort hatte der Vater mit Schwung erst den Koffer, dann ihn über die hohen, eisernen Trittbretter, zwischen denen der Blick auf Schotter stürzte, weg gehoben ins Innere. Seine für die Reise frisch mit Blechplättchen beschlagenen Schuhe klackten auf dem Metallboden der halboffenen Plattform. Es roch nach Klo; sie traten rasch in den Gang zu den Abteilen. Erst im dritten fanden sie auf blank gesessenen Holzbänken zwei freie Plätze. Der Vater quetschte den Koffer ins Gepäcknetz neben Rucksäcke und verschnürte Pappkartons. Dann löste er den gelochten Lederriemen unter dem Fenster, um die untere Scheibenhälfte in die Versenkung rutschen zu lassen, damit das Kind, hochgehoben, noch einmal nach vorn schauen konnte zur Lokomotive. Als draußen der Pfiff gellte, schloss der Vater das Fenster und hakte den Lederriemen ein. Man hörte das Zuklatschen der Türen sich den Zug entlang fortpflanzen wie rasche Peitschenhiebe. Ein zweiter, sehr lang gezogener Pfiff, ein mächtiges Anrucken. Ganz langsam kamen die Räder ins Rollen, wurden schneller, fanden endlich ihren Rhythmus im harten Takt der Schwellen.
So hatte es angefangen. Ein Fensterplatz in Fahrtrichtung, den ein Mitreisender für das Kind frei machte. Es spürte das Rappeln der Scheibe, an die es sein Gesicht presste, um keine der Kurven zu verpassen, die ihm die Lok ins Blickfeld schoben. Immer wieder aber zuckte es ein wenig zurück, wenn Signalmasten, ein entgegen kommender Zug, die Streben einer Eisenbahnbrücke auf es zu sprangen und an ihm vorbei gleich wieder weg kippten. Das, als Einziges, hatte ihm nicht gefallen, schon damals nicht.
Dagegen hatte es damals, je näher sie dem Bahnhof von Köln gekommen waren, immer öfter verwirrt auf die Schienen geschaut: Da liefen nämlich nicht mehr wie bis dahin ein oder zwei Schienenpaare neben dem Zug her, sondern auf einmal wurden es immer mehr. Und sie bewegten sich, als wären sie lebendig, als würden sie fließen! Sie kreuzten sich, fielen wieder auseinander, wurden zu neuen Schienen, von denen eine sich schließlich unter den eigenen, langsamer werdenden Zug schob und also nicht mehr zu sehen war. Es gelang dem Vater nicht, die aufgeregten Fragen des Kindes so zu beantworten, dass es verstanden hätte, was da geschah. Die Augen machen das, hatte der Vater vage erklärt, und die Geschwindigkeit des Zugs. Und dass die Schienen sich nicht wirklich bewegen würden.
Sehr viel später, wenn er in einem dieser aalglatten Intercity-Züge durch Städte und Landschaften mehr schwebte als fuhr, konnten zuweilen unvermittelt die Gefühle und Bilder, die Geräusche, ja selbst die Gerüche jener allerersten Reise sich vor die Gegenwart schieben. Es geschah selten und meist, wenn er müde war. Aber einmal war es ihm auch, ganz unpassend, auf dem Weg nach Florenz passiert: Das war, als unzählige, dicht aufeinander folgende Tunnels ihm die Landschaft der Toskana mit harten Schnitten zerstückelt hatten – er war sich vorgekommen wie in einem Videoclip, hatte schließlich entnervt die Augen geschlossen und auf einmal – kleiner Junge neben dem Vater – wieder im ratternden D-Zug gesessen, Rauchgeschmack auf der Zunge und draußen winkende Kinder, die zu bunten Punkten zusammenschnurrten.
Mit der Zeit mied er die Intercity-Züge so gut es ging, mied überhaupt das Reisen von Metropole zu Metropole. Er brauchte die großen Ziele nicht, um sie ging es ihm nicht. Oder nicht mehr. Die Ziele waren nur vorgeschoben, waren Rechtfertigungen. Seine Arbeitskollegen – als er noch Arbeit gehabt hatte und Kollegen – fragten danach, wollten Namen hören von Städten, berühmten Bauwerken, erkundigten sich nach Kunstdenkmälern, nach der originellsten Kneipe am Ort, und ob er denn nicht Fotos...? Aber all das war es nicht, was ihn am Reisen fesselte. Er brauchte auch keinen Fotoapparat; wozu hatte er seine Augen. Um vor den Fragern Ruhe zu haben, hatte er sich schließlich angewöhnt, bündelweise Ansichtskarten und Prospekte mitzubringen, sich zuweilen sogar der Mühe unterzogen, unterwegs im Hotelbett einen Reiseführer quer zu lesen. Wenn er daraus zitierte, ihnen die bunten Bildchen schenkte, waren die Leute zufrieden. Vom Eigentlichen erzählte er nichts.
Die Nebenstrecken. Er hatte es spät begriffen, sich dann aber gleich darauf verlegt, Orten auf möglichst weit ausgreifenden Umwegen näherzukommen, lange über Land unterwegs zu sein, umzusteigen, bei Wind und Wetter auf Anschlusszüge zu warten – unbehelligt von Leuten mit teuren Aktenkoffern, mit Laptops und trällernden Handys. Manchmal war er der Einzige, der auf einem dieser kleinen, verlassen aussehenden Bahnhöfe aus- oder einstieg. Natürlich war er so viele Stunden länger unterwegs, als ein vernünftiger Mensch von A nach B benötigte. Vernünftige Menschen hätten auch das Rütteln der Vorortzüge, Bahnbusse oder mancher ausmusterungsreifen Triebwagen unbequem gefunden. Er aber spürte wieder den Rhythmus der Eisenbahnschwellen, das Vibrieren der Fensterscheiben, fehlte nur das Stampfen einer Dampflok. Er kehrte der Fahrtrichtung den Rücken zu und überließ sich dem Blick auf Schwindendes.
Unersättlich folgten seine Augen dem Fluss der Bilder, sahen eins ins andere übergehen und verschmelzen mit dem nahen oder ins Weite gerückten Horizont. Die Strecken der Tiefebenen liebte er besonders, eben dieser fernen Horizontlinien wegen. Dort bei klarem Wetter in einen Abend fahren, zum Beispiel. Es sind nicht so sehr die theatralischen Sonnenuntergänge mit Purpur- und Feuergarben, die es ihm angetan haben, sondern die anderen, die leisen Sensationen des Lichts: wie es schwindet, der Erde ganz langsam ihre Farben entzieht, zugleich die Helligkeit des Himmels ins strahlend Durchsichtige steigert, bis Augenblicke lang nur noch ein Hauch Türkis überm Land steht, zerbrechlicher als Glas. Im nächsten Moment beginnt der Rest des Tages zu versinken im rasch ausufernden Dunkel. Im Zug gehen die Lampen an, auf die er gern noch verzichten würde. Wenn er allein im Abteil ist, schaltet er die Deckenleuchte aus, bis die schemenhaft vorbei huschenden, schon kaum noch zu deutenden Konturen der Landschaft sich gänzlich auflösen.
Nachtfahrten im ICE dagegen durch Industriegebiete, wo die Städte fast aneinander stoßen. Am Fenster vorüber die unregelmäßig ins Schwarze gestellten oder hoch übereinander gestapelten Rechtecke aus gelbem, weißem, orangefarbenem Licht. Wer konnte schwören, es seien Fenster, Wohnungen dahinter oder Büros, Menschen? Mutmaßungen, die der nächtliche Augenschein nicht stützte. Während der von Jahr zu Jahr kürzer werdenden dunklen Niemandsland-Strecken zwischen Stadt und Stadt sieht ihn von draußen ein Gesicht an, das für das eigene zu halten ihm schwer fällt. In seinem Inneren fühlt er ein ganz anderes Gesicht, das jünger ist. Oder auch viel älter.
Seit der Beruf es nicht mehr erzwingt, fährt er kaum noch nachts. Es ist ihm wichtiger geworden, morgens aufzubrechen, in den Tag hinein. So wie damals, als eine Zeit lang sie neben ihm gesessen hat. Eine Wärme an seiner Schulter, an die gelehnt sie manchmal eingenickt ist, wenn er noch dem Aufruhr seiner Gefühle nachhing, den Blick abgewandt, während er doch fast nichts sah als sie und Angst davor hatte, nichts mehr zu sehen als sie. Sie hatten Nächte geteilt und Hotelzimmer und wie in einer geheimen Übereinkunft das Wort Liebe sorgsam ausgespart aus ihrer Sprache. Sie waren in viele Morgen gefahren, müde, aber mit hellwacher Haut. Sie hatten ihren Abschieden im Grau hallender Bahnsteige wenig Bedeutung zugestanden, hatten sich immer wieder getroffen – auch, als sie schon wussten, dass ihre Wege auseinander führten. Und irgendwann war es zu Ende.
Eine Weile noch hat ein scharfer Schmerz ihm den Atem abgeschnitten, wenn sein Blick auf die schmale, sommersprossige Hand einer Mitreisenden fiel oder wenn im Gewühl der Bahnhofspassanten unvermittelt rötlich-blondes Haar über eine Schulter flog – obwohl die Farbe immer nur annähernd den Ton traf: Weizen mit Brand –, oder wenn ein hellstimmiges Lachen wie Schluckauf klang. Dann war auch das vorüber, ihr Bild weg geglitten vom Fenster seines Bewusstseins, abgesunken in tieferen Schichten.
Jetzt also wieder Morgenfahrten, von keinem Termin und von keiner Erwartung bestimmt. Draußen ein Grün der nordfriesischen Marschen, wie er es grüner nie sah. Auf der Hinfahrt noch hat ihm Nebel die Aussicht verklebt, später schräges Regengestrichel das Land in eine Kaltnadelradierung verwandelt. Heute aber – ein Märzhimmel, windgeweitet und wolkenlos. Er hat die Sonne im Rücken, ins Unzählige vervielfacht spiegelt sie aus Tümpeln, Viehtränken, Gräben, aus den Fensterscheiben verstreut liegender Höfe, aus Fahrradspeichen und Glasscherben, sie blitzt auf von windgestriegelten Gräsern und vom Doppelband der zurückweichenden Schienen.
Einen Streckenabschnitt lang verführt ihn die lichtgetränkte, von Licht überwölbte Landschaft zu dem Gedanken, er könnte beim nächsten Halt einfach aussteigen und bleiben.
Ob es das Alter ist? grübelt er später. Da sitzt er längst in einem anderen Zug.