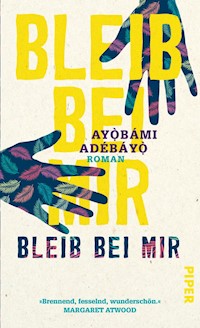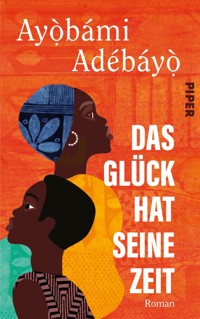
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gibt es Glück in einem zerrissenen Land? Eniola ist groß für sein Alter, ein fünfzehnjähriger Junge im Körper eines Mannes. Jeden Tag fürchtet er die Schläge seiner Lehrer, denn seit der Entlassung des Vaters fehlt das Geld für seine Schulgebühren. Bis Eniola als Laufbursche einer Näherin der wohlhabenden Yeye begegnet. Wuraola dagegen hat Glück: Die junge Ärztin ist frisch verlobt, ihr Freund Kunle stammt aus besten Verhältnissen. Während ihre Mutter Yeye vom Hochzeitskleid träumt, zeigen sich erste Risse. Die Familie wird bedroht, seit Kunles Vater als Gouverneur kandidiert. Und der amtierende Honorable wirbt für seine Leibgarde Jugendliche an, so groß und kräftig wie Männer. Ein aufwühlender Roman über Privileg und Armut in einem zerrütteten Nigeria – und über die Kosten des Glücks. »Ein nigerianischer Pageturner!« NDR Kultur über Ayobami Adebayos Debütroman »Bleib bei mir« »Ein wunderbarer, vor erzählerischer Kraft strotzender Roman.« Süddeutsche Zeitung über »Bleib bei mir« »Ein intensiver, sensibler Roman über den Verlust der Liebe.« taz über »Bleib bei mir«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
Übersetzung aus dem Englischen von Simone Jakob
© Ayọ̀bámi Adébáyọ̀ 2022
Die englische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel A Spell of Good Things bei Canongate Books Ltd, Edinburgh.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Covergestaltung: zero-media.net, München, nach einem Entwurf von Rafaela Romaya
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
–Verwandte
–
TEIL I – Sag allen, es wird gut
1
2
3
4
5
6
Teil II – Auf der Black Sisters Street
7
8
9
10
11
12
TEIL III – Warten auf einen Engel
13
14
15
16
17
18
19
20
TEIL IV – Jeder Tag gehört dem Dieb
21
22
23
24
–Meister
–
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für JọláaJésù. Geliebte Schwester, danke für das großartige Geschenk deiner Freundschaft.
Verwandte
Geht ein Elefant über hartes Felsgestein, Sehen wir seine Spuren nicht. Geht ein Büffel über hartes Felsgestein, Sehen wir seine Spuren nicht.
T. M. Aluko, Kinsman and Foreman
Caro schäumte vor Wut. Nachdem einer ihrer Lehrlinge ihr die Einladung zur Konferenz vorgelesen hatte, hatte sie sie quer durch den Raum in den Müll geworfen. Die Ehefrau irgendeines Politikers wollte vor dem Schneiderverband eine Rede halten, und der Vorsitzende hatte die Frau zu ihrer nächsten Konferenz eingeladen. Natürlich hatte er es sich nicht nehmen lassen, darauf hinzuweisen, dass die Frau des Politikers die Tochter eines Schneiders war. Caro war sich fast sicher, dass das eine Lüge war. Diese Leute würden behaupten, mit sonst wem verwandt zu sein, wenn es ihnen half, an die Macht zu kommen. Es ärgerte Caro, dass sie nun ihre Zeit damit verschwenden mussten zuzuhören, wie diese Frau für ihren Mann Wahlkampf betrieb. Dafür bezahlte sie keine Verbandsgebühren.
Caro ging zum Mülleimer in der Ecke ihrer Schneiderwerkstatt, fischte die Einladung wieder heraus, zerriss sie in winzige Fetzen, trat auf die kleine Betonplattform vor ihrem Geschäft hinaus und warf sie in die Luft. Sie würde dem Verband bei nächster Gelegenheit mitteilen, was sie davon hielt. Nicht, dass es jemanden scherte. Alle wussten, dass der Vorsitzende von den Politikern Geld nahm, damit er sie zu den Konferenzen einlud. Wenn die Wahlen näher rückten, würden die Verbandsmitglieder selbst von der plötzlichen Großzügigkeit diverser Amtsanwärter profitieren. Die Ehefrauen oder Schwestern der Kandidaten brachten Schüsseln voll Reis, Ölfässchen und meterweise Waxprint-Stoffe mit zu den Konferenzen, auf denen die Gesichter und Logos der Kandidaten prangten. Die Politiker selbst – es waren fast ausschließlich Männer – kamen nie persönlich vorbei, um zu beantworten, was sie, einmal im Amt, zu tun gedachten.
Einige der anderen Mitglieder warfen Caro Arroganz vor, weil sie sich weigerte, Reis und Öl anzunehmen oder sich Kleider aus den nutzlosen Waxprint-Stoffen zu nähen. Doch sie fühlte sich deshalb niemandem überlegen; die meisten, wenn nicht gar alle, hatten Kinder, für die sie die Lebensmittel gut gebrauchen konnten. Außerdem wussten sie, dass diese Dinge das Einzige waren, was sie in den nächsten vier Jahren von den Politikern bekommen würden. Warum sollten sie also nicht so viel Reis und Öl an sich raffen, wie sie konnten, wenn es die einzige sogenannte Dividende der Demokratie war, die sich für sie in Reichweite befand? Caro hatte Verständnis für die Beweggründe ihrer Kolleginnen und Kollegen, aber das machte das Ganze nicht weniger frustrierend. Wie oft hatten die Repräsentanten der Politiker schon versprochen, dass die Stromversorgung in Ordnung gebracht würde, sobald ihr Kandidat ins Amt gewählt wurde? Waren nicht alle im Schneiderverband immer noch von Generatoren abhängig? War nicht erst vor zwei Wochen eine von ihnen im Schlaf gestorben, weil sie die Abgase des Generators eingeatmet hatte? Das dritte Opfer in drei Jahren. Über diesen letzten Todesfall hatte Caro nicht einmal mehr weinen können. Stattdessen hatte sie tagelang die Wut als ein dumpfes Pulsieren in ihrem Kopf verspürt, obwohl sie sich kaum an das Gesicht der Verstorbenen erinnerte.
In knapp einem Jahr standen Wahlen an. In den nächsten Monaten würden überall Wahlplakate auftauchen, jeder Zaun, jede Mauer im Umkreis würde mit den Gesichtern der Männer zugekleistert werden, deren Lächeln schon jetzt zeigte, dass ihnen nicht zu trauen war. Beim letzten Mal war ihre Fassade von oben bis unten mit den Wahlplakaten irgendeines Senators zugeklebt worden, weil ihr Geschäft direkt an die Straße grenzte. Sie durfte nicht vergessen, bald »PLAKATEVERBOTEN!« an die Mauer malen zu lassen. Sie konnte einen ihrer Lehrlinge darum bitten. Wahrscheinlich Eniola.
TEIL I Sag allen, es wird gut
Erstickte Wut sucht heim wie der Wind, plötzlich und unsichtbar. Die Menschen haben keine Angst vor dem Wind, bis er einen Baum fällt. Dann sagen sie, er war zu stark.
Sefi Atta, Sag allen, es wird gut!
1
Eniola beschloss, so zu tun, als wäre es nur Wasser. Ein schmelzendes Hagelkorn. Nebel oder Tau. Vielleicht war es sogar etwas Gutes: ein vereinzelter Regentropfen, einsamer Vorläufer einer wahren Sintflut. Die ersten Regenfälle des Jahres bedeuteten, dass er bald endlich wieder eine Agbalumo-Frucht essen konnte. Die Obstverkäuferin am Stand vor seiner Schule hatte gestern einen Korb mit Agbalumo im Angebot gehabt, aber Eniola hatte keine gekauft, weil, wie er sich einredete, seine Mutter ihn oft gewarnt hatte, wenn man die Früchte vor dem ersten Regen esse, bekomme man Bauchkrämpfe. Doch wenn die Flüssigkeit in seinem Gesicht Regen war, würde er sich in ein paar Tagen den süßen, klebrigen Saft einer Agbalumo von den Fingern lecken, auf dem faserigen Fruchtfleisch herumkauen, bis es eine gummiartige Konsistenz hatte, die Samenkapseln knacken und seiner Schwester die Samen schenken, die sie halbieren und daraus Ohrringe zum Ankleben machen würde. Und so versuchte er, sich vorzumachen, es wäre nur Regen, auch wenn es sich nicht so anfühlte.
Er spürte die Blicke des guten Dutzend Männer, die sich um den Stand des Zeitungsverkäufers drängten, obwohl sie die Augen niedergeschlagen hatten. Stumm und starr standen sie da, wie die ungehorsamen Kinder, die von einem bösen Zauberer in Stein verwandelt worden waren, eine Geschichte, die ihm sein Vater früher oft erzählt hatte.
Als Kind hatte Eniola immer die Augen zugekniffen, wenn er in Schwierigkeiten war, in der Gewissheit, für jeden, den er nicht sehen konnte, unsichtbar zu sein. Obwohl er wusste, dass die Augen zu schließen und zu hoffen, dass er sich in Luft auflöste, ebenso albern war, wie zu glauben, dass Menschen in Stein verwandelt werden konnten, machte er auch jetzt die Augen zu. Natürlich löste er sich nicht in Luft auf. So viel Glück hatte er nicht. Der wackelige Verkaufstisch befand sich immer noch so dicht vor ihm, dass seine Oberschenkel die daraufliegenden Zeitungen berührten. Der Verkäufer, den er Egbon Abbey nannte, stand noch immer neben ihm, und die Hand, die er schwer auf Eniolas Schulter gelegt hatte, bevor er sich geräuspert und ihm ins Gesicht gespuckt hatte, ruhte immer noch dort.
Eniola strich sich über die Nase, und sein Finger näherte sich dem feuchten Gewicht des Schleims. Stumm vor Verblüffung, dass etwas so Unerwartetes ihre Alltagsroutine unterbrach, schienen alle Männer, selbst Egbon Abbey, den Atem anzuhalten und darauf zu warten, was als Nächstes passieren würde. Nicht einer von ihnen zog die Chelsea-Fans damit auf, dass Tottenham ihr Team am Vorabend vernichtend geschlagen hatte. Niemand stritt über den offenen Brief, den ein Journalist und Politiker über andere Politiker verfasst hatte, die angeblich in Menschenblut badeten, um sich vor bösen Geistern zu schützen. Alle waren verstummt, als der Speichel des Verkäufers Eniola im Gesicht traf. Und jetzt ließen die Männer, die sich jeden Morgen um den Stand scharten, um über die Schlagzeilen zu diskutieren, Eniola nicht aus den Augen. Sie wollten sehen, wie er reagieren würde. Sie wollten, dass Eniola den Verkäufer schlug, ihn anschrie, ihn beleidigte, in Tränen ausbrach, oder noch besser, sich ebenfalls räusperte, den Auswurf im Mund sammelte und Egbon Abbey seinerseits ins Gesicht spuckte. Eniola fuhr sich mit der Hand über die Stirn; er war zu langsam gewesen. Der Schleim war ihm schon seitlich die Nase hinuntergelaufen und hatte eine feuchte, klebrige Spur auf seiner Wange hinterlassen. Die zähe Flüssigkeit wegzuwischen kam nicht mehr infrage.
Er spürte, wie etwas gegen seine Wange gedrückt wurde, verzog das Gesicht und stieß gegen den Zeitungsstand. Um ihn herum murmelten ein paar Leute »Tut mir leid«, als er sich am Tisch festhielt, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Einer der Männer hatte ihm ein blaues Taschentuch ins Gesicht gedrückt.
»Hin se, Sir«, sagte Eniola, als er es annahm; und er war dankbar, obwohl das Stück Stoff schon mit weißen Striemen überzogen war, die abblätterten, als er es sich an die Wange hielt.
Eniola sah sich in der kleinen Menschentraube um und straffte die Schultern, nachdem er sich vergewissert hatte, dass niemand von seiner Schule dort war. Nur Erwachsene drängten sich um den Tisch. Manche Männer waren schon für die Arbeit angezogen und zupften an zu fest gebundenen Krawatten oder schlecht sitzenden Jacketts herum. Viele trugen verblichene Pullover oder Bomberjacken, deren Reißverschlüsse bis zum Hals hochgezogen waren. Die meisten der Jüngeren, deren Namen er ein »Brother« voranstellen musste, um keine Kopfnuss zu kassieren, hatten vermutlich erst vor Kurzem ihren Abschluss an der Fachhochschule oder der Universität gemacht. Sie lungerten oft den ganzen Vormittag an Egbon Abbeys Stand herum, lasen, redeten oder notierten sich Stellenanzeigen aus den Zeitungen in Notizbücher oder auf Papierfetzen. Dann und wann halfen sie dem Verkäufer mit Kleingeld aus, aber keiner kaufte eine Zeitung.
Eniola wollte das Taschentuch zurückgeben, doch der Mann winkte ab und blätterte in einer Ausgabe der Wochenzeitung Alaroye. Wenigstens war niemand da, der seinen Klassenkameraden berichten konnte, wie der Verkäufer ihn fast eine Minute lang angefunkelt hatte, bevor er ihm ins Gesicht spuckte. Es war so überraschend gekommen, dass er den Kopf erst zur Seite gedreht hatte, als er schon spürte, wie die Feuchtigkeit an seiner Nase hinunterlief, und dass es selbst die Männer zum Schweigen brachte, deren Stimmen sonst in der ganzen Straße zu hören waren. Wenigstens hatten Paul und Hakeem, Klassenkameraden von ihm, die in dieser Straße lebten, es nicht mitbekommen. Nachdem Paul ein altes Video von einem Auftritt des Komikers Klint da Drunk in Night of a Thousand Laughs gesehen hatte, eiferte er Klint nach. Seitdem verbrachte er jede Unterrichtsstunde, in der ein Lehrer nicht aufgekreuzt war, damit, durch die Klasse zu taumeln, gegen Tische und Stühle zu stoßen und seinen Klassenkameraden Beleidigungen zuzulallen.
Eniola rieb sich die Wange, um die übrige Feuchtigkeit auf der Haut zu verteilen. Wenn auch nur der kleinste Rest Speichel auf seiner Wange zu sehen war, wenn er auf dem Heimweg an Pauls Haus vorbeikam, würde es bei der knapp einstündigen Vorführung des Jungen vor der Klasse heute nur um ihn gehen. Paul würde behaupten, Eniola sabbere im Schlaf, habe sich nicht gewaschen, bevor er die Schuluniform anzog, oder komme aus einer Familie, die sich keine Seife leisten könne. Alle würden ihn auslachen. Er lachte ebenfalls, wenn Paul andere Schüler drangsalierte. Die meisten seiner Witze waren nicht einmal lustig, doch in der Hoffnung, dass Paul weiterhin seine Aufmerksamkeit auf das bedauernswerte Opfer konzentrierte, das er sich für den Nachmittag ausgesucht hatte, lachte Eniola über alles, was er sagte. Wenn Paul jemand anderen aufs Korn nahm, dann normalerweise ein Mädchen, das nicht über seine Witze lachte. Normalerweise. Doch an einem schrecklichen Nachmittag hatte Paul aufgehört, über die abgewetzten Schuhe einer Klassenkameradin herzuziehen, um zu verkünden, Eniolas Stirn sehe aus wie das dicke Ende einer Mango. Eniola, der immer noch über das Mädchen mit den abgewetzten Schuhen lachte, merkte, während die Klasse stattdessen in Gelächter über ihn ausbrach, welches er noch Monate später in seinen Träumen hörte, dass er den Mund nicht mehr zubekam. Er wollte aufhören zu lachen, konnte es jedoch nicht. Weder als ihm vor lauter Tränen der Hals wehzutun begann, noch als seine Klassenkameraden verstummten, weil die Chemielehrerin fünf Minuten vor dem Ende ihrer Stunde in den Raum platzte. Er lachte und lachte, bis sie ihm befahl, sich mit dem Gesicht zur Wand in eine Ecke zu knien.
Er bräuchte einen Spiegel … nein. Nein. Er würde keinen der Männer hier fragen, ob auf seinem Gesicht noch Flecken zurückgeblieben waren. Auf keinen Fall. Eniola nahm die Hand von der Wange und schaute mit zusammengekniffenen Augen zu dem dreistöckigen Gebäude auf, in dessen erster Etage Pauls Familie lebte. Sie teilten sich die vier Räume der Wohnung mit zwei anderen Familien und einer alten Frau, die keine Verwandten hatte. Diese Frau stand jetzt vor dem Haus und streute Körner für die gackernden Hühner zu ihren Füßen in den Sand. Kein Paul. Vielleicht hatte er sich schon auf den Weg zur Schule gemacht. Aber vielleicht lungerte er auch nur im Treppenhaus oder im Flur herum, bereit, aus dem Haus zu treten, sobald Eniola vorbeiging.
Eniola drückte gegen die vorspringende Stelle an seiner Stirn, die seine Nasenwurzel überragte, als wollte er sie in den Schädel zurückpressen. Vielleicht sollte er einfach an dem Haus vorbeirennen. All das war die Schuld seines Vaters. Die Dinge, die Paul womöglich über ihn sagen würde, die Männer, die seine geballten Fäuste beäugten, als erwarteten sie, er würde den Zeitungsverkäufer verprügeln, die Wut des Verkäufers selbst. Besonders die Wut des Verkäufers. Denn es war sein Vater, der dem Mann Tausende Naira schuldete, sein Vater, der seit Monaten The Daily auf Pump kaufte, damit er alle Stellenanzeigen lesen konnte, sein Vater, der heute Morgen darauf bestanden hatte, dass Eniola den Verkäufer um eine weitere Ausgabe anbetteln sollte. Und so hätte die stinkende Mischung aus Speichel und Auswurf eigentlich im Gesicht seines Vaters landen sollen.
Er spürte eine Hand auf der Schulter und wusste, wem sie gehörte, noch bevor er sich zu dem Verkäufer umdrehte. Der Mann stand so dicht bei ihm, dass Eniola den Gestank seines Atems riechen konnte. Wobei der auch von seinem eigenen Gesicht stammen konnte. Denn obwohl er sich den Speichel abgewischt hatte, der Geruch war geblieben. Egbon Abbey hustete, und Eniola wappnete sich. Was konnte der Verkäufer ihm noch antun? Ihm ins Gesicht schlagen, sodass er mit einem nicht zu übersehenden Bluterguss im Gesicht oder einer gebrochenen Nase nach Hause käme, was Eniolas Vater verraten würde, was hier passiert war?
»Du wolltest die Daily? Hier hast du sie.« Der Verkäufer gab Eniola mit der aufgerollten Zeitung einen Klaps auf den Arm. »Aber wehe, ich erwische dich oder deinen Vater noch einmal hier, hörst du? Sag’s ihm. Sag ihm, wenn ich einen von euch beiden noch mal sehe, werde ich mit meiner Faust in eurem Gesicht ein blaues Wunder vollbringen, verstanden? Jeder, der euch begegnet, wird glauben, ihr wärt von einem Laster überfahren worden. Ich warne dich – entscheidet euch nicht für das Unglück.«
Eniola hätte dem Verkäufer am liebsten die Zeitung in den Rachen gestopft. Er wünschte sich, sie auf die rote Erde zu werfen und darauf herumzutrampeln, bis sie völlig zerfetzt war – oder zumindest, sich umzudrehen und Egbon Abbey einfach stehen zu lassen, ohne die Zeitung angenommen zu haben. Solchen Unsinn musste er sich ständig von Erwachsenen gefallen lassen, selbst von seinen Eltern. Er wusste, der Verkäufer würde sich nie für seinen Wutausbruch entschuldigen; er würde eher aus dem Rinnstein trinken, als zuzugeben, dass es falsch gewesen war, Eniola ins Gesicht zu spucken. Die Zeitung diente auch als Entschuldigung. Bei der Vorstellung, ein Erwachsener, seine Mutter oder sein Vater, könnte sich für irgendetwas bei ihm entschuldigen, hätte er fast laut aufgelacht.
»Hast du dich in eine Statue verwandelt?«, fragte der Verkäufer und stupste Eniola mit der Daily gegen die Brust. Bald würde sein Vater wieder genug Geld haben, um ihn loszuschicken, eine Zeitung zu kaufen. An dem Tag würde er den ganzen weiten Weg zum Wesley Guild Hospital laufen und sie dort erstehen. Auf dem Rückweg würde er am Stand von Egbon Alley vorbeigehen und darin blättern, sodass der boshafte Mann es sehen würde. Aber zuerst musste sein Vater eine Stelle finden. Und so nahm Eniola die Zeitung an, murmelte etwas, was man mit einem Dank hätte verwechseln können, und rannte davon. Weg von dem Verkäufer mit seinem stinkenden Atem, vorbei an Pauls Haus, wo die alte Frau mit einem Küken kämpfte, an dessen Federn sie einen roten Faden befestigen wollte, schneller und schneller, den Abhang hinunter nach Hause.
*
Sein Vater schien die Seiten der Daily beim Umblättern nur mit den Fingerspitzen zu berühren. Oder vielleicht auch nur mit den Fingernägeln – das konnte Eniola, der bei der Tür stand, nicht genau erkennen. So viel Vorsicht, und das, nachdem er sich zweimal die Hände gewaschen und es abgelehnt hatte, sie sich an einem Stück Stoff abzutrocknen; er hatte sogar die Spitzenbluse verschmäht, die Eniolas Mutter aus ihrer Spezialbox gefischt hatte, in der sie ihre Sammlung von Spitze und Aso-oke-Stoffen aufbewahrte. Stattdessen war er im Zimmer auf und ab geschritten – von der Wand zum Bett, vom Bett zur Matratze auf dem Boden, von der Matratze auf dem Boden zum Schrank mit den Töpfen, Tellern und Tassen – und hatte die Arme hochgehalten, bis die Feuchtigkeit verdunstet war. Er hatte sich sogar mit jedem Finger gegen die Augenlider getippt, bevor er Eniola bat, ihm die Daily zu reichen. Wenn sie zehn Ausgaben beisammenhatten, konnten sie sie gegen Geld oder Essen bei einer der Frauen eintauschen, die Erdnüsse, gebratene Yamswurzel und geröstete Kochbananen in ihrer oder einer benachbarten Straße verkauften. Eniola wäre Essen lieber gewesen, besonders wenn es von jener Verkäuferin kam, die die Kochbananen genau so briet, wie er es mochte, außen knusprig, innen noch saftig. Aber seine Eltern verlangten immer Geld für die Zeitungen, und je sauberer sie waren, desto mehr waren die Frauen bereit, dafür zu bezahlen.
Sein Vater war noch zu jung, um zu ergrauen. Das hatte zumindest seine Mutter gesagt, als sie zum ersten Mal ein graues Haar auf Baamis Kopf ausgerissen hatte; sie behauptete, wenn man sie mitsamt der Wurzel auszupfe, würden sie schwärzer nachwachsen als zuvor. Und doch war im letzten Jahr innerhalb eines Monats jede einzelne Strähne auf Baamis Kopf grau geworden. Das Grau hatte sich rasend schnell von Baamis Schläfen über jeden Quadratzentimeter seiner Kopfhaut ausgebreitet, sodass Eniola sich innerhalb weniger Wochen alte Fotos seines Vaters anschauen musste, um sich daran zu erinnern, wie dieser ausgesehen hatte, als seine Haare noch schwarz gewesen waren.
Auf einem zerknitterten, abblätternden Bild steht Baami neben einer Tür und schaut mit schmalen Augen in die Kamera, als wollte er den Fotografen warnen, ja kein schlechtes Bild zu machen. Sein Haar war nicht nur an den Schläfen, sondern auch überall sonst schwarz. Ein Scheitel auf der linken Seite enthüllte ein Stück seiner glänzenden Kopfhaut. An der Tür prangte – so, dass man es gerade noch auf dem Bild erkennen konnte, obwohl ein Ende davon abgeschnitten war – ein schwarzes Namensschild mit der Aufschrift »Vizedirektor« in goldener Kursivschrift. Darunter stand, auf ein rechteckiges Blatt Papier getippt, das aussah, als wäre es erst vor Kurzem angebracht worden und würde bald wieder abgerissen werden, Baamis Name: Mr. Busuyi Oni. Baami stand kerzengerade da, die Schultern so weit zurückgenommen, dass Eniola sich fragte, ob er vielleicht deshalb nicht lächelte, weil ihm die Schulterblätter wehtaten. In den Jahren, seitdem das Foto aufgenommen worden war, hatte Baami aufgehört, Kameras oder Menschen direkt anzublicken. Nur Eniolas Mutter bestand immer noch drauf, dass er ihr in die Augen sah, wenn er mit ihr redete. Sprach er dagegen mit Eniola oder seiner Schwester, schaute er mit unruhigem Blick auf ihre Füße hinunter, als würde er wieder und wieder ihre Zehen zählen.
Baami faltete die Daily zusammen und räusperte sich. »Was, wenn du das Gemüse verkaufst, das wild im Hinterhof wächst? Ich kann dir bei der Ernte helfen …«
»Nein, nein, nein, das kann man auf keinen Fall verkaufen, Baba Eniola. Schau dir die Zeitung bitte genau an. Hast du sie von vorn bis hinten studiert?«, fragte Eniolas Mutter.
»Hast du etwas gefunden?«, fragte Eniola.
Sein Vater schlug die Zeitung erneut auf, ohne zu antworten. Eniola wäre am liebsten nach draußen gegangen, um sich das Gesicht zu waschen, doch er fühlte sich genötigt, bei seinen Eltern zu bleiben. Außerdem hatte er sich heute schon gewaschen, und seine Mutter hatte die Seife in einem ihrer zahllosen Verstecke deponiert. Wenn er sie jetzt um Seife bat, würde sie wissen wollen, wozu er sie brauchte. Sie würde nicht lockerlassen, bis er ihr erklärte, warum er sie haben wollte, nicht einmal dann, wenn er seine Meinung änderte und ihr erzählte, dass er sie doch nicht brauchte. Sie würde ihn dazu bringen, ihr zu gestehen, was passiert war, sie fand immer einen Weg. Und er wusste, sobald er seine Geschichte zu Ende erzählt hatte, würde sie zu dem Verkäufer eilen und ihm ins Gesicht spucken, bis sie einen trockenen Mund bekam. Und das wollte er nicht. Ja, er hätte liebend gern erlebt, wie der Verkäufer versuchte, dem Zorn seiner Mutter zu entgehen, aber das hätte bedeutet, dass noch mehr Leute von seiner Demütigung an diesem Morgen erfuhren. Im Grunde brauchte er keine Seife. Vielleicht sollte er sich das Gesicht nur mit Wasser und dem Schwamm waschen, den er benutzte, wenn ihnen die Seife ausging.
Er hätte gleich in den Hinterhof gehen können, aber Busola war nicht im Zimmer. Vielleicht fegte sie gerade den Hof, wusch Teller ab oder schrubbte den Topf, in dem ihre Mutter am Vorabend amala gekocht hatte. Es war besser zu warten, bis sie zurückkam, denn er wollte seinen Vater nicht mit der Zeitung allein lassen. Wann immer es ging, blieb er bei seinem Vater, damit der nicht allein war. Seine Mutter war zwar ebenfalls hier, aber sie verhielt sich seltsam. Sie saß am Fußende des Bettes und faltete wieder und wieder die Bluse, die sie Baami zuvor angeboten hatte.
»Niemand kauft gbure«, sagte sie. »Die wächst jetzt überall im Hinterhof, niemand kauft sie. Selbst Hunde und Ziegen haben gbure-Blätter im Hinterhof.«
Eniola lehnte sich gegen die Wand; es machte keinen Unterschied, ob gbure überall im Hinterhof oder auf jedem Quadratzentimeter dieses Zimmers, auf seinem Kopf oder dem seiner Eltern wuchs. Wie viel hätte sie seiner Mutter schon eingebracht? Es würde nie für Busolas und seine Schulgebühren reichen. Das wusste er, weil er selbst in den Ferien gbure auf der Straße verkauft hatte. Obwohl er den ganzen Weg zum Krankenhaus gegangen war, im Zickzack über den Markt, am Palast vorbei, dann bis zur Christ Apostolic Church neben der Brauerei, hatte er kaum mehr als die Hälfte davon losbekommen.
Eniolas Vater hustete. Anfangs schien es, als würde er sich nur räuspern, aber bald wurden seine Schultern von einem Anfall geschüttelt, bis er nach Luft schnappte. Seine Mutter warf die Bluse aufs Bett, füllte einen Becher bis zum Rand mit Wasser, ging, ein Rinnsal in ihrem Kielwasser hinterlassend, zu Baami und legte ihm die Hand auf die Schulter. Sein Vater trank das Wasser in einem Zug aus, doch der Husten blieb hartnäckig, bis er seine Knie umfasste und sich auf das Bett setzte.
»Und du, wann willst du in die Schule gehen?«, fragte Eniolas Mutter und rieb ihrem Mann den Rücken, während der Husten langsam nachließ.
»Ich … ich wollte nur wissen, ob Baami etwas in der Zeitung gefunden hat.«
»Nimm jetzt deine Tasche und geh«, sagte seine Mutter.
Baami deutete mit dem Finger in Eniolas Richtung. »Keine Sorge, ich habe etwas Vielversprechendes gesehen, etwas sehr, sehr Vielversprechendes, Eniola. Ich schreibe noch heute die Bewerbung.«
»Ich kann dir helfen, sie zur Post zu bringen«, sagte Eniola.
»Das ist nicht nötig – deine Mutter kann sie mitnehmen, wenn sie zum Markt geht.«
»Ich dachte, sie geht nicht zum –«
»Wieso sehe ich immer noch deinen Schatten in diesem Haus?« Seine Mutter deutete mit weit ausholender Geste auf das Zimmer. »Sag deiner Schwester, sie soll aufhören zu tun, was auch immer sie tut, und zur Schule gehen. Wozu sollen wir versuchen, eure Schulgebühren aufzubringen, wenn ihr sowieso zu spät kommt?«
»Ja, ma.« Eniola nahm seine Schultasche. »Kann ich Salz haben?«
»Wieso bittet das Kind mich um Salz, obwohl es längst in der Schule sein müsste? Willst du etwa heute Morgen einen Topf Suppe kochen, Eniola?«
»Ich – ich habe mir noch nicht die Zähne geputzt.«
Seine Mutter sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an, als wäre da, wo sein Kopf sein sollte, eine große Kokosnuss. Er rührte sich nicht, schaute weiter in ihre Richtung, denn er wusste, wenn er den Blick abwandte, würde sie ihn verdächtigen zu lügen. Gleichzeitig vermied er es, ihr direkt in die Augen zu sehen. Das hätte sie als Mangel an Respekt betrachtet, als einen Beweis, dass er sich in einen wilden Vogel verwandelt hatte, der ihr ins Gesicht fliegen würde, wenn sie ihn nicht mit einem gezielten Schlag abwehrte. Er hatte nicht bemerkt, dass er den Atem anhielt, bis sie mit dem Kopf auf den Schrank mit den Töpfen, Tellern und einem kleinen Sack Salz deutete.
Eniola schaufelte einen gehäuften Löffel voll in seine Hand und ballte sie zur Faust.
Busola war gerade damit fertig, den Topf auszuwaschen, als Eniola den Hinterhof betrat. Sie gab ihm eine große Schüssel Wasser, die sie nicht benutzt hatte, damit er keins vom Brunnen in der Ecke des Hofs holen musste. Der Harmattan überzog seine Beine mit einer feinen Staubschicht, trocknete seine Lippen aus und ließ seine Arme von den Ellbogen bis zu den Fingerspitzen kribbeln wie eine Million Nadelstiche. Er spritzte sich Wasser ins Gesicht und schrubbte sich mit dem Salz die Nase, bis die Haut sich wund anfühlte, als könnte sie sich jeden Moment schälen. Wieder und wieder wusch er sich das Gesicht, bis die Schüssel leer war. Und doch glaubte er immer noch, das feuchte Gewicht zu spüren, schale Zwiebeln und faule Eier zu riechen. Und noch etwas anderes, das er nicht einordnen konnte, obwohl er den ganzen restlichen Vormittag darüber nachdachte.
2
Herniorrhaphie – der Patient schnarchte mit offenem Mund, sein Schnurrbart zitterte. Achtzehn Stunden waren seit dem Eingriff vergangen. Keine Komplikationen. Wuraola notierte ihre Empfehlung. Er konnte am nächsten Morgen entlassen werden. Sie hielt die Fallunterlagen schräg, um das Licht vom Gang auszunutzen; die Lampen über den Patientenbetten wurden immer schon lange vor Mitternacht abgeschaltet.
Appendektomie – septisch und sediert. Er war im Bad gewesen, und nachdem seine Tochter ihn eine Stunde lang gefragt hatte, warum er nicht herauskam, hatte sie in Panik die Tür aufgebrochen und den Siebzigjährigen halb bewusstlos in der Dusche gefunden. Sie hatte ihn in die Notaufnahme gebracht, trotz seines Protests, der Schmerz sei erträglich, er brauche nur etwas Ruhe und seine Kräutermischung, den er selbst dann noch wiederholte, als er in den Operationssaal gebracht wurde. Als man ihn am nächsten Morgen bei der postoperativen Besprechung fragte, warum er tagelang den Schmerz eines perforierten Blinddarms ausgehalten habe, ohne jemandem davon zu erzählen, hatte er die Arme verschränkt und dem Chirurgen erklärt: »Boo ni hin se a mo wiako ni mere? Ako ra i sojo.« Und Professor Babajide Coker, Allgemeinchirurg und derzeitiger Vorsitzender der Ijesa Elite Men’s Progressive Union, hatte genickt, als hätte er jedes Wort des alten Mannes verstanden.
Professor Coker war ein guter Freund von Wuraolas Vater. Ihre Familie richtete die Treffen der IEMPU oft bei sich zu Hause aus, und Wuraola hatte den Mitgliedern Chili-Schnecken serviert oder ihre Whiskeygläser aufgefüllt, seit sie ein Teenager war. Professor Coker, der exakt fünf Jahre vor der Unabhängigkeit in Lagos geboren worden war, informierte neue IEMPU-Mitglieder stets schon Minuten nach Beginn der Veranstaltungen, dass er direkt von der Christ Church School in der Broad Street auf das King’s College gewechselt sei, als man in diesem Land noch eine anständige Bildung bekommen habe. Meist gelang es ihm, die Anekdote einfließen zu lassen, wie er seine Frau kennenlernte, die anlässlich einer interschulischen Debatte das Queen’s College besucht habe, bevor er damit schloss, dass seine Jahre an dieser erstklassigen Institution die Krönung seiner Ausbildung gewesen seien. Wo sonst sei es möglich, sich ein so tadelloses medizinisches Grundverständnis anzueignen? Wo? Waren andere Ärzte anwesend, wischte er ihre Beteuerungen, die Great Ife University oder die Medilag der Universität von Lagos seien besser, kurzerhand beiseite. Die Stimmen der Männer wurden lauter, überschlugen sich, bis Wuraola nicht mehr verstehen konnte, was sie sagten. Ihr Vater, der in Lagos Jura studiert hatte, beteiligte sich nicht an den Gesprächen, bei denen es hoch herging, nicht einmal dann, wenn er von Medilag-Absolventen und anderen Alumni der Universität von Lagos darum gebeten wurde, für seine Alma Mater Partei zu ergreifen. Er schwieg, bis eins der Hausmädchen ihm etwas ins Ohr flüsterte. An dem Punkt schlug er dann mit der Gabel gegen sein Glas, woraufhin es wieder so ruhig wurde, dass er – hauptsächlich den neuen Mitgliedern zuliebe – verkünden konnte, die Pfeffersuppe werde in Kürze aufgetragen und die Männer sollten Wuraola oder einem aushelfenden Dienstmädchen Bescheid geben, ob sie die Suppe mit Ziegenfleisch oder mit Wels serviert haben wollten. Seit Beginn ihres Medizinstudiums in Ife wurde Wuraola oft von Ärzten, die diese Hochschule besucht hatten, in dieselbe Diskussion verwickelt. Und obwohl ihr Vater meist noch ein paar lobende Worte über seine Universität fand, ehe die dampfenden Schüsseln mit Pfeffersuppe alle für eine Weile zum Schweigen brachten, schien es ihm nichts auszumachen, wenn Wuraola die besseren Argumente hatte und seine Alma Mater in ein schlechtes Licht rückte. Sie merkte, wie stolz er darauf war, dass aus ihr eine Person geworden war, die man für diesen schon seit einer Ewigkeit schwelenden Streit vereinnahmen konnte. Er verbarg sein Lächeln, indem er an seinem Glas nippte, das sich jedoch kaum zu leeren schien.
Seitdem Professor Coker den Vorsitz der IEMPU von Wuraolas Vater übernommen hatte, richtete ihre Familie die Treffen nur noch dann aus, wenn Professor Cokers Frau unter einer ihrer Allergien litt und tagelang unpässlich war.
Professor Babajide und Professorin Cordelia Coker waren vor mehr als zwei Jahrzehnten in die Stadt gezogen, als sie noch zum alten Bundesstaat Oyo gehörte. Damals hatten die Gründungsmitglieder der IEMPU sich dafür eingesetzt, dass die Stadt zur Hauptstadt würde, wenn der neue Staat irgendwann aus dem alten entstand. Es ging das Gerücht, Professor Coker – fest entschlossen, als Gouverneur zu kandidieren, sobald das, was alle immer noch als militärisches Intermezzo betrachteten, ein Ende fand – habe noch am selben Abend, als der Bundesstaat Osun und seine neue Hauptstadt geschaffen wurden, jemanden angeheuert, der ihm Ijesha beibringen sollte. Doch nach all der Zeit und etlichen angeblichen Unterrichtsstunden konnte der Mann nicht mehr auf Ijesha sagen oder verstehen als »hinle awe«, was er mit dem Selbstvertrauen eines kompetenten Sprechers äußerte, ehe er sich stotternd wieder auf Yoruba oder Englisch beschränkte, sobald das Gespräch über den Austausch von Höflichkeiten hinausging. All das hielt ihn nicht davon ab zu nicken, als würde er den Siebzigjährigen verstehen, der wiederholte: »Ako i sojo awe, ako i sojo.« Später am Tag, als er Wuraola Instruktionen für die Überwachung seiner Patienten gab, fragte Professor Coker sie, was der alte Mann gesagt habe.
Wuraola seufzte, als sie sich erneut den Fallunterlagen zuwandte. Wenn es dem Patienten gelang, das hier zu überstehen, würde er seine Worte vielleicht zurücknehmen, denn das, was er Feigheit nannte, hätte ihm besagte Scherereien erspart und ein freies Bett für die Männer bedeutet, die die Notaufnahme womöglich heute Nacht abweisen musste. Ihr Handy vibrierte an ihrem Oberschenkel, als sie zum nächsten Bett ging.
Rektopexie – der Mann zögerte, als er sich umzudrehen versuchte, und verzog das Gesicht, als der Katheter seinen Körper daran erinnerte, was möglich war und was eine ganze Weile lang nicht möglich sein würde.
Sie nahm das Handy aus dem Stationskittel und klappte es auf. Kunle. Sie klappte es wieder zu und schob es in die hintere Tasche ihrer Jeans, wo es erneut zu vibrieren begann, als sie die nächsten Fallunterlagen zur Hand nahm.
Pankreatektomie – er war seit dem Mittag bewusstlos, konnte jedoch jeden Moment aufwachen und würde dann den Rest der Nacht kein Auge mehr zutun. Aber wenigstens hätte er dank des Morphins keine Schmerzen. Seine Pankreatektomie war die erste, bei der Wuraola assistiert hatte, seit sie in der Chirurgie eingesetzt wurde. In der Nacht vor der OP war sie kurz vor Sonnenaufgang mit dem Kopf auf den Seiten von Clinical Pancreatology for Practising Gastroenterologists and Surgeons eingeschlafen. Doch am Ende hatte sie während des Eingriffs nicht einmal das Instrumentensieb berühren dürfen.
Im Krankenhaus gab es seit über einem Monat keinen Strom mehr, was an sich nicht ungewöhnlich war. Das wahre Problem war die Treibstoffkrise, die seit einer Woche anhielt, weil die Tankwagenfahrer, die Bohrinselarbeiter oder sonst wer streikten. Wuraola war oft zu müde, um mehr als die Schlagzeilen zu lesen, doch sie vermutete, dass irgendeine Gewerkschaft zum Streik aufgerufen hatte, dass das die Treibstoffkrise ausgelöst hatte und dem Krankenhaus das Dieselöl für den Generator ausging. Ein Memo über ein weiteres Energiesparprogramm wurde in die Verteilfächer einsortiert und mit bunten Reißzwecken am Schwarzen Brett befestigt, als der Streik begann. Während die Intensiv- und die Neonatalintensivstation ununterbrochen mit Strom versorgt wurden, bekamen andere Stationen und OPs nur welchen zugeteilt, wenn ein Eingriff es erforderte. Und so operierten die Fachärzte, ohne dabei zu unterrichten. Sie ließen die Ärzte in der Ausbildung nicht einmal assistieren. Es schien, als wären die beiden Chirurgen zu dem Schluss gekommen, dass die zusätzlichen Sekunden, die ein unerfahrener Arzt in der Ausbildung oder im Praktikum brauchte, um einen Schnitt auszuführen oder eine Wunde zu vernähen, ein Neugeborenes den Strom für das Beatmungsgerät kosten konnten, wenn die Treibstoffknappheit anhielt.
Als Wuraola die Aufgabe zugeteilt bekam, vor den Pflegekräften herzugehen, die den Patienten nach der OP durch die dunklen Flure schoben, musste sie kichern, als sie aus dem OP trat. Sechs Jahre Ausbildung, und die einzige Fähigkeit, die man ihr bei einer zwölfstündigen Operation abverlangte, war, ein Handy hochzuhalten, um mit der Taschenlampe die Pflegekräfte zu lotsen?
Der Eingriff war gut verlaufen. Aber die Ärzte wussten schon jetzt, dass die OP sein Leben nicht retten würde. Verlängern? Ja, um ein paar Wochen oder Monate, wenn er Glück hatte. Aber konnte man wirklich von Glück reden, wenn man in seinen noch verbleibenden Tagen von Schmerzen gequält wurde oder von Morphin benebelt war? Wuraola wusste es nicht.
Der Bruder des Patienten kam jeden Abend vorbei, um für ihn zu beten. Er hatte Wuraola mehr als einmal erklärt, dass die Ärzte sich irrten, dass aus den wenigen Monaten, die sie ihm prognostiziert hatten, Jahre, Jahrzehnte werden würden, weil es dem Patienten nach diesem vorübergehenden Rückschlag vorherbestimmt sei, ein seltenes, kostbares Wunder zu erleben: ein langes und glückliches Leben. Er hatte so überzeugt geklungen, dass Wuraola sich grausam vorkam, als sie ihn an die Prognose erinnerte und die Warnung wiederholte, die man dem Patienten vor der Operation mit auf den Weg gegeben hatte. Eine Pankreatektomie war in diesem Krebsstadium eine reine Palliativmaßnahme.
Der Bruder kniete auch jetzt wieder vor dem Bett des Patienten, die Stirn auf das Metallgitter gelegt, und murmelte seine Gebete. Wie gewöhnlich presste er sich ein ledergebundenes Buch an die Brust. Die Pflegekräfte hatten Wetten darüber abgeschlossen, ob es eine Bibel oder ein Koran war, weil er während der Besuchszeit bei verschiedenen Gelegenheiten mal in Begleitung von Frauen aufgetaucht war, die im Schneidersitz um das Bett herumhockten und ihren Hidschab zurechtzupften, bevor sie ihre Gebete an der Tasbih abzählten, und mal von Frauen in weißen Gewändern, die dem Patienten Holzkreuze auf die Stirn pressten.
In der letzten Woche hatte er, ehe er fragte, ob einige der Frauen ihn auch nachts begleiten oder an seiner Stelle kommen könnten, zu Wuraola gesagt: »Doktor, ihr Frauen seid Gott näher, und wir alle wissen, dass Gebete nach Mitternacht besser wirken.«
Wuraola hatte ihm erklärt, dass die Krankenhausvorschriften das nicht gestatteten, es sei denn, die Frau, die die Nacht dort verbringen wolle, sei die Ehefrau, Tochter oder Mutter eines Patienten. Vielleicht auch eine Cousine, wenn man es nicht so genau nahm und die diensthabenden Pflegekräfte einverstanden waren, aber wer auch immer dort bleiben wolle, müsse zur Familie gehören. Als der Mann erklärte, sein Bruder sei kinderlos und unverheiratet, ihre Mutter sei vor Jahren gestorben und keine ihrer Schwestern lebe in Nigeria, hätte Wuraola ihm fast geraten zu lügen, eine der betenden Frauen sei seine Schwester. Obwohl sie seine Beterei als störend empfand und sich vorstellte, dass es noch schlimmer wäre, zwei oder mehr Frauen nach den Besuchszeiten dort zu haben, war sie geneigt, ihm den Wunsch zu erfüllen. Und sei es nur, um ihm eine Verschnaufpause zu verschaffen. Sie war sich recht sicher, dass der nächste histologische Befund den Betenden dazu zwingen würden, sich dem Verlust trotz seiner unermüdlichen Hingabe eher früher als später zu stellen.
Der Patient war, einen Monat bevor Wuraola ihre Assistenzzeit in der Chirurgie angetreten hatte, in die Chirurgie eingeliefert worden. Als eine Pflegekraft Wuraola informierte, der Betende habe jede Nacht am Fußende des Bettes ausgeharrt, seit der Patient eingeliefert worden war, hatte sie ihn dafür bewundert. Bis dahin hatte sie eine so unermüdliche Hingabe nur auf der Kinderstation erlebt. Dort schliefen die Mütter, und auch der eine oder andere Vater, wochenlang auf dem Flur, lagen auf Holzbänken oder in Waxprint-Stoffe gehüllt auf dem Boden, benutzten Handtaschen oder ihre Arme als Kissen. In ihrer ersten Woche in der Chirurgie fragte sie sich immer, wenn sie Dienst hatte, ob ihre Geschwister an ihrem Bett wachen würden, sollte sie selbst so krank werden. Motara würde sich bestenfalls in der Nähe des Krankenhauses ein Hotelzimmer nehmen, Layi würde Geld schicken und vielleicht alle paar Wochen zu Besuch kommen. Er hasste Krankenhäuser, obwohl er der erste Arzt der Familie gewesen war, und sein Abschlussfoto war auch das Erste, was man sah, wenn man das Schlafzimmer ihrer Mutter betrat. Wuraola wäre es ohnehin lieber, wenn sie sich fernhielten; sie würden sich am Ende nur zanken und die anderen Patienten stören. Ihre Eltern würden kommen, kein Zweifel. Wenn sie die Wahl hätte, wer bei ihr sein sollte, hätte sie sich für ihren Vater entschieden. Anders als ihre Mutter, deren Besorgnis sich in diversen Versuchen äußern würde, dem medizinischen Personal seine Arbeit zu erklären, würde er sich zurückhalten. Er würde ihr etwas von I. K. Dairo auf seinem Discman vorspielen und dazu leise summen.
Der Betende versprach stets, leise zu sein, aber sein Gemurmel wurde unweigerlich zu lautem Stöhnen, das auf der ganzen Station zu hören war. Es dauerte keinen Monat, bis Wuraolas Bewunderung in Gereiztheit umschlug. Und gerade in dem Moment, als ihr Handy erneut vibrierte, gab er plötzlich ein widerhallendes Stöhnen von sich, das ein Pulsieren in ihrem Kopf auslöste.
In all den endlosen Stunden und Jahren ihrer Ausbildung hatte ihr niemand erklärt, wie viel Übung man für den Umgang mit Verwandten und Freunden brauchte. Nichts hatte Wuraola auf den Mann vorbereitet, der sich an sie klammerte und ihren Kittel mit Rotz beschmierte, als der Fötus seiner Frau nach einem Abort ausgeschabt werden musste, oder auf die erboste Frau, die sie geschlagen hatte, als sich herausstellte, dass ihrem Sohn ein Bein amputiert werden musste, oder auf den Mann, der sich, obwohl man ihm erklärt hatte, sein Freund sei in die Leichenhalle gebracht worden, weigerte, die Station zu verlassen, bis der Sicherheitsdienst ihn nach draußen zerrte. Niemand hatte ihr beigebracht, wie man einen Mann davon überzeugte, dass sein Bruder an Bauchspeicheldrüsenkrebs starb und er an dieser Tatsache nichts ändern konnte.
Fairerweise musste man sagen, dass einer ihrer Professoren das sehr wohl erwähnt haben konnte und sie nur in Gedanken woanders gewesen war, weil die Bemerkung während ihres Einsatzes in der Psychiatrie oder in der Gesundheitsvorsorge fiel. In ihrem vorletzten und letzten Jahr im Medizinstudium hatte sie sich ständig ausgemalt, wie es sein würde, Ärztin im Praktikum zu sein. Einlieferungen betreuen, Operationen vorbereiten, Patientendaten aufnehmen und einen tadellosen Behandlungsplan aufstellen. In den endlosen Stunden im überfüllten multidisziplinären Labor II im vormedizinischen Jahr hatte sie sich mit detaillierten Träumen über zukünftige Klinikeinsätze die Zeit vertrieben. Wie erleichtert würde sie sein, das Labor hinter sich zu lassen und im Krankenhaus zu arbeiten. Auf Stationen, in Operationssälen, sogar in der Leichenhalle ein und aus zu gehen. Seit sie den Abschluss in der Tasche hatte und Assistenzärztin war, hatte sich ihr Fokus darauf verlagert, wie es in der Facharztausbildung sein würde. Vor Kurzem war ihr der Verdacht gekommen, dass sie immer rastlos sein würde. Vielleicht gehörte sie zu den Menschen, bei denen Zufriedenheit immer in der Zukunft verortet war, knapp außer Reichweite.
Sie berührte den Betenden an der Schulter. Er verstummte und sank auf das Bettgitter. Er wirkte hager, fast ausgezehrt. War das schon immer so gewesen, oder lag es daran, dass er die Brille abgenommen hatte, sodass seine Augen eingesunkener aussahen als sonst? Sie trat näher an ihn heran, während er mühsam auf die Beine kam. Hatte er bei ihrer ersten Begegnung nur schlank gewirkt, sah er jetzt aus, als könnte ihn ein Windhauch davonwehen.
Bevor sie etwas sagen konnte, setzte er zu seinen üblichen Entschuldigungen an. »Liebes, ich kann einfach nicht gehen. Ich werde ganz leise sein, ja? Flüstern.« Er senkte die Stimme, bis sie kaum noch hörbar war. »Ich flüstere nur noch, hören Sie?«
Er wandte sich von ihr ab und legte die Hände auf das Bettgitter, bereit, sich wieder hinzuknien.
Wuraola holte tief Luft. »Mr. … Mr. … Sie müssen gehen, Sir.«
Der Mann drehte ihr den Oberkörper zu und umklammerte das Gitter, als würde er sonst hinfallen. »Liebes, ich kann ihn nicht verlassen.«
»Sie müssen gehen, Sir. Sofort.«
Er öffnete den Mund, als wollte er noch etwas sagen, tat es jedoch nicht. Sie versuchte, Blickkontakt zum Pflegepersonal herzustellen, das hinter einem Schreibtisch neben der Tür saß. Eine Schwester schlief, ein Pfleger war in ein Lehrbuch vertieft, das er in einem scheinbar unmöglichen Winkel auf dem Schoß hielt, vermutlich, um sich wach zu halten. Wenn die Situation außer Kontrolle geriet, konnte sie immer noch seinen Namen oder auch nur »Pfleger« rufen, da sie zu erschöpft war, um sich an einen anderen Namen als ihren eigenen zu erinnern.
»Ich habe Verständnis dafür, dass Sie beten möchten«, sagte sie. »Aber Sie sind zu laut.«
Sie wartete, doch der Mann widersprach nicht. Still stand er da. Sagte kein Wort, schloss jedoch auch nicht den Mund. Seine Haltung hatte nichts Herausforderndes, und sie erkannte, dass es keinen Streit und keinen Grund dafür geben würde, den Sicherheitsdienst zu rufen. Dieser Mann hatte nicht vor, die Stellung zu halten; er konnte sich nur nicht mehr erinnern, was er mit seinem Körper anstellen sollte, wenn er gerade nicht kniete.
»Ich habe Sie mehrfach verwarnt.«
Dann flüsterte der betende Mann, sodass sie es kaum hören konnte: »Yeye mi.«
Wuraola war sich nicht sicher, ob er sich mit dieser höflichen Anrede an sie richtete oder ob er wirklich nach seiner verstorbenen Mutter rief, nach dem Trost suchte, den sie ihm einst geschenkt hatte, und sie bitten wollte, ihn, seinen Bruder oder sie beide zu retten.
»Ich muss auch an die anderen Patienten denken«, sagte Wuraola.
Der Mann nickte, ließ das Gitter los und schickte sich an zu gehen. Sie sah zu, wie er zur Tür schlurfte, und zum ersten Mal fiel ihr auf, dass er das linke Bein stärker belastete als das rechte.
Wuraola wandte sich dem Patienten zu. Puls: achtzig Schläge pro Minute. An der Stelle, wo sein Handgelenk, dessen Falten in die Lebenslinie übergingen, kaum noch von seiner Handfläche zu unterscheiden war, war die Haut des Mannes papierdünn und schuppig. Sie griff in die Tasche ihres Arztkittels – Kaugummi, Stift, Kaugummi, Ersatzstift, Notizblock, noch mehr Kaugummi, Zopfband – ah, da! Sie fischte eine winzige Flasche Handdesinfektionsmittel heraus und gab etwas davon in ihre Handfläche. Als sie es einmassierte, fiel ihr die Silberrandbrille des Betenden ins Auge, die bei den Füßen seines Bruders lag. Er musste sie zum Beten abgenommen hatte. Die Gläser brachen das Licht aus einer Glühbirne in der Nähe, sodass es in ihre Richtung fiel. Die Strahlen trafen ihr Gesicht wie eine scharfe Zurechtweisung. Vielleicht hätte sie ihn bleiben lassen sollen. Sie stellte sich vor, wie er durch die Krankenhausflure irrte, gegen Wände stieß, Mülleimer umwarf oder in den Rinnstein fiel, während er den Weg zum Parkplatz suchte. Sie hätte ihn nicht wegschicken sollen, doch noch während sie die Brille nahm und zur Tür ging, beschlich sie der Verdacht, dass er seine Stimme sehr wohl dämpfte, sobald der diensthabende Arzt ein Mann war. Einen der Jungs hätte er wahrscheinlich auch nicht »Liebes« genannt. Da war sie sich fast sicher.
Die schlafende Krankenschwester am Empfang war mittlerweile aufgewacht und gähnte.
»Ich bin nur mal kurz …« Wuraola deutete mit der Brille auf die Tür. »Rufen Sie mich, wenn …«
Der Pfleger und die Schwester nickten.
Der Flur war menschenleer, aber bis zum Sonnenaufgang waren es noch zwei Stunden, und selbst mit der Brille hätte er das Krankenhaus wohl nicht verlassen können. In den meisten Vierteln, zumindest jenen, in denen der Betende wahrscheinlich wohnte, gab es selbst auferlegte Ausgangssperren von Mitternacht bis Sonnenaufgang. Der Ein- und Ausgang war in den Stunden dazwischen nur bei medizinischen Notfällen möglich. Etliche Straßen würden noch abgesperrt sein, und die Zugangspunkte waren mit zwei bis sechs bewaffneten Wachen bemannt. Es hieß, einige von ihnen zwangen diejenigen, die gegen die Ausgangssperren verstießen, bis zum Morgengrauen auf dem Asphalt auf und ab zu wandern. Selbst die Gnädigeren bestanden darauf, dass die Übeltäter bis zum Ende der Ausgangssperre warteten, ehe sie sie passieren ließen.
Am Ende des Flurs erspähte sie ihn draußen auf dem Asphalt; er ging auf die Krankenhauskapelle zu. Sie wollte ihm zurufen: »Mister? Mister?« Dann erwog sie, es mit »Entschuldigung, Sir« zu versuchen, brachte es jedoch nicht über sich. Sie kannte seinen Namen, aber wie lautete er noch mal?
Während des Studiums hatte sie verächtlich die Lippen geschürzt, als sie einen der Ärzte im Praktikum hören sagte, sie müssten nach dem chronischen Leberschaden auf der Männerstation sehen, denn sie war stolz darauf, die Namen aller Patienten zu kennen, die sich in ihrer Obhut befanden. Und jetzt, kaum ein Jahr später, rannte sie einem Mann nach, den sie fast jeden Tag sah, und konnte sich weder an seinen Namen noch an den seines schwer kranken Bruders erinnern.
Allerdings hatte sie seit drei Tagen kaum geschlafen. Eigentlich durfte man nicht an drei Tagen hintereinander Dienst haben, aber das Krankenhaus konnte sich nicht mehr Assistenzärzte leisten. Und so hatte sie vor zwei Nächten Dienst auf der chirurgischen Männerstation gehabt, gestern Nacht in der Notaufnahme und heute Nacht wieder auf der chirurgischen Männerstation. Auf ihrem Rotationsplan war lediglich ihr Dienst in der Chirurgie verzeichnet. Schichten in der Notaufnahme dauerten nur bis Mitternacht, waren also nicht so anstrengend. Doch in der letzten Nacht war der Strom der Patienten nicht abgerissen, und der Typ, der sie um Mitternacht ablösen sollte, war einfach nicht aufgekreuzt und hatte ihre Anrufe nicht angenommen, und so war sie bis zum Morgen geblieben. Ja, sie war hungrig und müde und konnte sich nicht an den Namen des Betenden erinnern, aber eine Infusion hätte sie immer noch mit verbundenen Augen legen können. Sie hatte den ganzen Tag nur eine Packung Kekse gegessen, doch sie wusste, sie konnte immer noch mit ruhiger Hand einen Luftröhrenschnitt durchführen, und vielleicht war das die Hauptsache. Dass sie Wie-auch-immer-er-hieß ein, zwei zusätzliche Stunden verschaffen, ihn so lange wie möglich am Leben erhalten konnte, bevor sein Körper zwangsläufig Verrat an ihm beging, wozu alle Körper verdammt waren.
Der Mann blieb schwankend auf der kleinen Rasenfläche vor der Kapelle stehen. Dann sank er auf die Knie. Wuraola rührte sich nicht, aus Angst, er könne in Tränen ausbrechen oder wieder zu jenem Gott beten – welcher auch immer es war –, den er schon seit Monaten anflehte. Aber er legte sich nur ins Gras, das Gesicht dem mondlosen Himmel zugewandt.
»Mr. … Verzeihen Sie, Sir, es tut mir sehr leid, aber ich habe Ihren Namen vergessen. Sie haben Ihre Brille liegen gelassen.«
Der Betende sagte nichts und machte keine Anstalten, die Brille anzunehmen.
»Sir?«
Wuraola näherte sich ihm, kniete sich neben ihn und griff instinktiv nach seinem Handgelenk. Er fing an zu schnarchen, noch ehe sie ihn berührte, und sie atmete auf. Neben ihm lag sein ledergebundenes Buch. Vorsichtig, um ihn nicht zu wecken, legte sie die feine silberne Brille darauf. Auf dem Rückweg zur Station fischte sie ihr Handy aus der Jeanstasche.
Kunle hatte neun Mal angerufen.
3
Es nützte nichts, wenn Eniola sie daran erinnerte, dass ihre Klassenzimmer in verschiedenen Gebäuden lagen. Seine Mutter bestand trotzdem darauf, dass er auf Busola wartete, bevor er aufbrach. Sie sollten den Weg zur und von der Glorious Destiny Comprehensive Secondary School möglichst jeden Tag gemeinsam gehen, und sie hatte Eniola sogar das Versprechen abgenötigt, seine jüngere Schwester bis zu ihrem Sitzplatz zu begleiten, bevor er sich zu seinem eigenen begab.
An den meisten Tagen waren ihre weißen Socken bereits mit rotem Staub bedeckt, wenn sie nach knapp zehn Minuten Fußmarsch das erste Schulgebäude erreichten, und Eniola dachte an die weiterführende Schule, die er ursprünglich hatte besuchen sollen, wie ihm sein Vater versprochen hatte. Dort gab es bestimmt keinen roten Staub auf den Wegen. Wahrscheinlich führten dort Straßen mit Gehsteigen, Fußwege und grasbewachsene Pfade von den Wohnheimen zu den Klassenzimmern und Laboren.
Eniola war neun gewesen, als sein Vater ihm das Versprechen gegeben hatte. Damals hatte er sich nicht vorstellen können, dass er auf dieser dummen Glorious Destiny School landen würde. Er war in der fünften Grundschulklasse gewesen, und seine Mitschüler waren dabei, sich auf die allgemeine Aufnahmeprüfung für die Sekundarstufe vorzubereiten. Da das Grundschulsystem eigentlich auf sechs Schuljahre ausgelegt war, bestand sein Vater jedoch darauf, dass Eniola dort noch die sechste Klasse absolvierte, anstatt wie die meisten anderen auf die weiterführende Schule zu wechseln.
Eniola hatte sich wochenlang den Kopf zerbrochen, wie er seine Eltern davon überzeugen konnte, dass er bereit für die weiterführende Schule war. Er war größer als die meisten Schüler der ersten Jahrgangsstufe der Junior Secondary School, denen er auf seinem Schulweg begegnete, und hatte bessere Noten als die Hälfte seiner Klasse. Er hatte alle Umrechnungs- und Multiplikationstabellen auf der Rückseite seines Olympic-Übungshefts auswendig gelernt und beherrschte das Einmaleins von eins mal eins gleich eins über zwölf mal zwölf gleich einhundertvierundvierzig bis hin zu vierzehn mal vierzehn gleich einhundertsechsundneunzig. In den Wochen vor seinem neunten Geburtstag fegte Eniola das Wohnzimmer, bevor seine Mutter am Morgen dazukam, hörte auf, sich darüber zu beklagen, dass er nicht draußen mit den Nachbarskindern Fußball spielen durfte, weil er auf Busola aufpassen sollte, und verbrachte – da er nicht groß genug war, um das Auto komplett zu waschen – seine Samstagvormittage damit, die Reifen des blauen VW Käfers seines Vaters zu schrubben. Obwohl er vermutete, dass er kurz vor der Heiligsprechung stand, hatte er Sorge, all seine guten Taten könnten von den Eltern unbemerkt bleiben, und so verkündete er eines Sonntags auf dem Weg zum Gottesdienst, er wolle Messdiener werden. Er war erleichtert, als seine Mutter entgegnete, sie werde es nicht erlauben, da es ihn von der Schule ablenken könnte. Dennoch sprach er in den folgenden Tagen oft davon, wie gern er Messdiener werden wolle, weil das einen guten Eindruck bei seinem Vater hinterließ, der glaubte, dieser brennende Wunsch beweise, dass er in Ehrfurcht vor dem Herrn aufwachse.
Ihre damalige Wohnung lag nicht weit von der Crystal Nursery and Primary School entfernt, und an den meisten Tagen ging Eniola zusammen mit den Nachbarskindern dorthin. Doch an seinem neunten Geburtstag fuhr sein Vater ihn zur Schule. Schmollend saß er auf dem Beifahrersitz neben seinem Vater, während der Geburtstagskuchen, der auf seinen Wunsch mit weißem, blauem und gelbem Zuckerguss verziert worden war, auf dem Rücksitz zusammen mit den Oxford Cabin Biscuits und einigen eisgekühlten Flaschen Zobo hin und her rutschte. Auch wenn sein Vater vorsichtig fuhr, holperten sie von einem Schlagloch ins nächste. Eniola wollte etwas sagen, als sie vor dem Schulgebäude anhielte, brachte jedoch nur heraus: »Ich bin der Einzige in meiner Klasse, der keinen Ugo C. Ugo hat. Alle anderen haben das Buch. Ist das fair?« Dann brach er in Tränen aus. »Ist das fair?«, heulte er wieder und schluchzte noch lauter. Sein Vater tätschelte ihm den Rücken in dem vergeblichen Versuch, ihn zu beruhigen. Als Eniola bemerkte, dass einige seiner Klassenkameradinnen und -kameraden ihn im Vorbeigehen durch das heruntergekurbelte Fenster anstarrten, nahm er sich schließlich zusammen.
»Was für ein Benehmen … Hör mal, ich darf nicht zu spät zur Arbeit kommen. Lass uns heute Abend darüber reden«, sagte Eniolas Vater und trommelte mit den Fingern auf das Lenkrad. »Komm schon, bringen wir die Sachen rein.«
Eniola blieb im Wagen sitzen, als sein Vater ausstieg und die Rückbank abräumte. Einige Schüler versammelten sich ums Auto, um zu helfen, und riefen Eniola »Herzlichen Glückwunsch« zu, doch der antwortete nicht. Er konnte nicht glauben, wie dumm er gewesen war. Wie hatte er nur all die Stunden vor dem Badezimmerspiegel verschwenden können, um sich auf den Moment nach dem heutigen Abendessen vorzubereiten, wo er in aller Ruhe mit seinen Eltern hatte reden wollen? Schweigend saß er da, starrte auf seine Sandalen und kämpfte gegen den Drang an, mit dem Klettverschluss zu spielen. Wo waren all die Argumente, die er sich zurechtgelegt hatte, all die vernünftigen Dinge, die er hätte sagen können, anstatt wie der kleine Junge, für den seine Eltern ihn hielten, zu jammern: »Ist das fair?« Warum waren ihm die richtigen Worte nicht über die Lippen gekommen, wie er es geplant hatte? Er begann wieder zu weinen, schniefte jedoch diesmal nur leise vor sich hin, statt zu schluchzen.
Er merkte erst, dass sein Vater wieder ins Auto eingestiegen war, als es ruckelnd und quietschend ansprang. Eniola tastete nach dem Türgriff.
Sein Vater hielt ihn am Handgelenk fest. »Komm, wisch dir das Gesicht ab, bevor du reingehst. Lass die anderen nicht sehen, dass du geweint hast.«
An diesem Abend überreichte Eniolas Vater ihm eine brandneue Ausgabe von Ugo C. Ugos Buch mit Übungsfragen für die Aufnahmeprüfung. Einen Moment lang glaubte er, er hätte sich endlich gegen seine Eltern durchgesetzt, aber sein Glück währte nur so lange, bis sein Vater zu sprechen begann.
»Du kannst die Prüfung jetzt ablegen, wenn du das willst, aber« – er hob einen Finger – »wenn du noch ein Jahr wartest und die sechste Klasse abschließt, was, wie ich dir unzählige Male erklärt habe, eine unverzichtbare Station auf dem Weg durch unser Bildungssystem ist – unverzichtbar, sage ich dir. Obwohl die meisten Schulen heutzutage ohnehin machen, was sie wollen. Wie auch immer, wenn du dich an die Regeln hältst und bis zur sechsten Klasse wartest, kannst du auf die Unity School in Ikirun gehen. Deine Entscheidung.«
Eniola hatte auf die Unity gehen wollen, seit Collins, dessen Familie in der Wohnung über ihm wohnte, vor drei Jahren dorthin gewechselt war und in den Ferien immer mit Geschichten über Spaß und Freiheit zurückkehrte, von denen Eniola wusste, dass er sie nie erleben würde, wenn er auf eine Schule in der Nähe wechselte. Wann immer er das College erwähnte, sagte seine Mutter, sie werde ihm nie erlauben, dieses oder irgendein anderes Internat zu besuchen. Sie hielt ihm endlose Vorträge, er sei zu jung, die Älteren würden ihn schikanieren, womöglich schließe er sich einer üblen Gang an, und am Ende werde er ohne Manieren und Bildung nach Hause kommen. Nun, da es seinem Vater irgendwie gelungen war, sie zu überzeugen, Eniola auf die Unity School gehen zu lassen, brauchte er nicht lange zu überlegen, bevor er zustimmte, ein weiteres Jahr auf der Grundschule zu bleiben.
Nach dem Versprechen seines Vaters fiel es Eniola leichter zuzuhören, wenn seine Klassenkameraden mit der weiterführenden Schule prahlten. Nun konnte er erzählen, dass er nach Ikirun gehen würde. Zwar ein Jahr, nachdem alle anderen auf die weiterführende Schule gewechselt waren, aber ging irgendwer von ihnen aufs Internat? Auf eine Unity School? Eniola schaffte es fast jeden Tag, das College zu erwähnen, und er erzählte Collins’ Geschichten weiter, bis er sah, dass einige seiner Freunde neidisch wurden. Ihr Neid tröstete ihn, als sie ihre Aufnahmeprüfungen ablegten, auf verschiedene weiterführende Schulen gingen und ihn zurückließen, um zusammen mit zwei anderen Jungen, die beide durch die Aufnahmeprüfungen gefallen waren, die sechste Grundschulklasse abzuschließen. Bald würde er wie Collins sein. Er würde dreimal im Jahr nach Hause kommen, und die anderen Jungs aus der Nachbarschaft würden sich um ihn scharen, wenn er Geschichten darüber zum Besten gab, was er ohne elterliche Aufsicht alles angestellt hatte. Er dachte jeden Tag daran, während er allein zur Schule und nach Hause ging. Die Freunde, die ihn früher begleitet hatten, waren nicht mehr in seiner Klasse, und auch wenn sie ihm fehlten, machte das nichts. Er würde bald wie Collins sein. Das würde alles wettmachen, er brauchte nur abzuwarten.
Und dann, am Ende des ersten Halbjahrs der sechsten Klasse, nur wenige Wochen vor Weihnachten, wurde sein Vater zusammen mit knapp viertausend anderen Lehrerinnen und Lehrern im ganzen Land entlassen. Zuerst änderte sich zu Hause nichts. Sein Vater verließ an den Werktagen das Haus um 7 Uhr morgens, die Krawatte ordentlich gebunden, mit Klecksen von nicht überall gründlich verteilter, glänzender Pomade im Haar, doch mit stets untadeligem Seitenscheitel. Eniola glaubte immer noch, er werde wie geplant auf die Unity School in Ikirun wechseln. Schließlich war es nur eine Frage der Zeit, bis der Gouverneur erkennen würde, dass er im Begriff war, die öffentlichen Schulen zugrunde zu richten, und die Lehrerinnen und Lehrer allesamt mit einer persönlichen Entschuldigung wieder einstellte. Zumindest einige Lehrkräfte müssten zurückkommen, und Eniolas Vater, mit all seiner Erfahrungen und seinen Qualifikationen, würde bestimmt zu denen gehören, die unverzichtbar waren. Es würde nicht mehr lange dauern. Wie sollte die Schule ohne das Fach Geschichte den Lehrplan einhalten? Wie? Nacht für Nacht schlief Eniola neben Busola auf dem Sofa ein, während seine Eltern diese Diskussion führten, anstatt das Abendgebet zu sprechen.
Im Radio erklärte einer der Berater des Gouverneurs, dass die meisten der eingesparten Lehrkräfte Fächer wie Kunst, Yoruba, Ernährung, islamische und christliche Religionslehre unterrichteten, die die Entwicklung des Landes nicht vorantrieben.
Was sollen unsere Kinder in der heutigen Zeit noch mit Yoruba anfangen? Was? Sehen Sie, was wir jetzt brauchen, ist Technik – Technik und Wissenschaft. Und was haben sie davon, wenn sie mit Wasserfarben malen? Das ist doch alles, was sie im Kunstunterricht lernen, oder? Mit Wasserfarben zu malen.
Der Mann im Radio lachte.
Weihnachten war vorbei. Es war der erste Tag des neuen Jahres, und einige Eltern seiner Freunde, von denen viele ebenfalls ihre Arbeit verloren hatten, waren zum Abendessen gekommen. Während der Mann weiterlachte, merkte Eniola, dass er die Schärfe der Pfeffersuppe in der Schale vor sich nicht mehr wahrnahm und das Fleisch nach nichts mehr schmeckte. Es war, als würde er Wasser löffeln. Als er nach den Ferien wieder zur Schule ging, setzte er Ausgabenkürzung und Wiederanstellung auf die Liste der neuen Wörter, die er während der Weihnachtsferien gelernt hatte.
Einige Monate später raste der blaue Käfer seines Vaters auf dem Nachhauseweg an ihm vorbei. Am Steuer saß ein ihm unbekannter glatzköpfiger Mann. Als er nach Hause kam, war die einzige Reaktion seiner Mutter auf die Frage nach dem Auto, dass sie ihn aufforderte, erst seine Hausaufgaben zu erledigen, bevor er dumme Fragen stellte, den Küchenboden zu wischen, bevor er ihre Ruhe störte, und den Vorgarten zu fegen, bevor er ihr den letzten Nerv raubte. Erst eine Woche später erzählte sie ihm, dass das Auto verkauft worden war. Da hatte sein Vater schon aufgehört, um 7 Uhr morgens das Haus zu verlassen, aß nicht mehr mit der Familie zu Abend und verließ sein Zimmer kaum noch. Seine Mutter begann, die Morgengebete zu übernehmen, und verhaspelte sich bei Worten, die Eniola im Schlaf aussprechen konnte, während sie ihm und Busola aus der Andacht zum kostbarsten Blut unseres Herrn Jesu Christ vorlas.