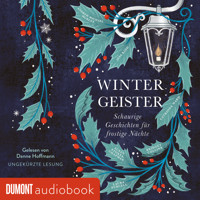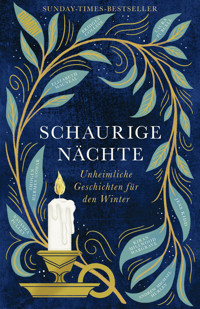14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wann wirst du wagen, dich der Liebe zu stellen …
In Montverre, einer altehrwürdigen Eliteschule, werden die besten Köpfe ausgebildet – für das große Spiel, eine geheimnisvolle Kombination von Musik, Kunst, Poesie und Philosophie. Léo Martin war einst an dieser Schule, bevor er in die Politik ging und scheiterte. Nun ist er zurück, gewissermaßen im Exil, das man ihm auferlegt hat. Vormals eine Bastion der Männer, steht nun eine Frau an der Spitze: Claire Dryden ist die Meisterin des großen Spiels. Léo fühlt sich auf mysteriöse Weise zu ihr hingezogen, doch je mehr sich die Nacht des großen Spiels nähert, desto unheimlicher scheint sie ihm zu sein. Vor allem, als er ihrem Geheimnis nahekommt – und sich in sie verliebt. Ein betörend poetisches Buch über Kunst, Zauber und die Frage: Was ist wahr und bedeutsam für das Leben? "
Eine perfekt konstruierte Geschichte voller gewagter Wendungen – Bridget Collins spielt ihr eigenes Spiel mit großer Kunstfertigkeit." The Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 705
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Wann wirst du wagen, dich der Liebe zu stellen …
In Montverre, einer altehrwürdigen Eliteschule, werden die besten Köpfe ausgebildet – für das große Spiel, eine geheimnisvolle Kombination von Musik, Kunst, Poesie und Philosophie. Léo Martin war einst an dieser Schule, bevor er in die Politik ging und scheiterte. Nun ist er zurück, gewissermaßen im Exil, das man ihm auferlegt hat. Vormals eine Bastion der Männer, steht nun eine Frau an der Spitze: Claire Dryden ist die Meisterin des großen Spiels. Léo fühlt sich auf mysteriöse Weise zu ihr hingezogen, doch je mehr sich die Nacht des großen Spiels nähert, desto unheimlicher scheint sie ihm zu sein. Vor allem, als er ihrem Geheimnis nahekommt – und sich in sie verliebt.
Ein betörend poetisches Buch über Kunst, Zauber und die Frage: Was ist wahr und bedeutsam für das Leben?
»Eine perfekt konstruierte Geschichte voller gewagter Wendungen – Bridget Collins spielt ihr eigenes Spiel mit großer Kunstfertigkeit.« The Times
Über Bridget Collins
Bridget Collins hat an der London Academy of Music and Dramatic Art studiert. Sie hat bisher mehrere Romane geschrieben sowie zwei Stücke, die beim Edinburgh Festival uraufgeführt wurden. »Das große Spiel« wurde in mehrere Länder verkauft. Im Aufbau Taschenbuch liegt ebenfalls ihr Roman »Die verborgenen Stimmen der Bücher« vor.
Ulrike Seeberger, geboren 1952, Studium der Physik, lebte zehn Jahre in Schottland, arbeitete dort u.a. am Goethe-Institut. Seit 1987 freie Übersetzerin und Dolmetscherin in Nürnberg. Sie übertrug u.a. Autoren wie Lara Prescott, Philippa Gregory, Vikram Chandra, Alec Guiness, Oscar Wilde, Charles Dickens, Yaël Guiladi und Jean G. Goodhind ins Deutsche.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Bridget Collins
Das grosse Spiel
Roman
Aus dem Englischen vonUlrike Seeberger
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Teil 1: Spätsommersemester
1 Die Rättin
2 Léo
3 Magister Ludi
4
5 Magister Ludi
6 Léo
7
8 Magister Ludi
9 Léo
10
11 Die Rättin
12 Magister Ludi
13
14 Léo
15
16 Die Rättin
Teil 2: Frühjahrssemester
17 Léo
18
19 Magister Ludi
20
21 Léo
22
23 Léo
24 Magister Ludi
25 Léo
26 Die Rättin
27
28 Magister Ludi
29
30 Léo
31 Die Rättin
32 Léo
33 Magister Ludi
34
35 Magister Ludi
36 Léo
37 Magister Ludi
38 Léo
39 Die Rättin
40 Magister Ludi
41 Léo
42 Die Rättin
Anmerkungen der Autorin
Danksagungen
Impressum
Für Sarah Ballard
»Dass aber diese Ordnung der Dinge sich keineswegs von selbst verstehe, dass sie eine gewisse Harmonie zwischen Welt und Geist voraussetze, deren Störung immer wieder möglich war, dass die Weltgeschichte, alles in allem genommen, das Wünschenswerte, Vernünftige und Schöne keineswegs anstrebe und begünstige, sondern höchstens je und je als Ausnahme dulde, dies wussten sie nicht …«
Das Glasperlenspiel, Hermann Hesse
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Teil 1: Spätsommersemester
1 Die Rättin
2 Léo
3 Magister Ludi
4
5 Magister Ludi
6 Léo
7
8 Magister Ludi
9 Léo
10
11 Die Rättin
12 Magister Ludi
13
14 Léo
15
16 Die Rättin
Teil 2: Frühjahrssemester
17 Léo
18
19 Magister Ludi
20
21 Léo
22
23 Léo
24 Magister Ludi
25 Léo
26 Die Rättin
27
28 Magister Ludi
29
30 Léo
31 Die Rättin
32 Léo
33 Magister Ludi
34
35 Magister Ludi
36 Léo
37 Magister Ludi
38 Léo
39 Die Rättin
40 Magister Ludi
41 Léo
42 Die Rättin
Anmerkungen der Autorin
Danksagungen
Impressum
Teil 1 Spätsommersemester
1 Die Rättin
Heute Nacht verwandelt das Mondlicht den Boden der Großen Halle in ein Spielbrett. Jedes der hohen Fenster wirft ein helles Gitter, teilt die Halle in Schwarz und Weiß auf, in Quadrate und Ränder. Die Reihen hölzerner Bänke stehen einander an drei Seiten gegenüber; im Raum dazwischen ist nichts außer den schnurgeraden Schatten auf dem Stein, eine abstrakte Tuschzeichnung. Es ist so still hier wie ein angehaltener Atem. Nicht einmal ein wirbelnder Wind rappelt an den Fenstern oder summt im großen Kamin. Kein Stäubchen tanzt über den dunkel gestreiften Boden. Die leeren Bänke warten. Wenn die Halle je für den ersten Spielzug in einem Grand Jeu bereit war, dann jetzt: Mitternacht, Stille, diese Geometrie des Lichtes. Jemand anderer würde wissen, wie man spielt, wie man anfängt.
Aber heute ist hier nur die Rättin, fröstelt ein wenig in ihrem verschlissenen Hemd, hat die Arme eng um den Brustkorb geschlungen. Sie streckt einen mageren Fuß ins Licht, zieht ihn wieder heraus, denkt: dunkel, hell, dunkel, hell. Sie verengt die Augen, als sie ihre Fußnägel schimmern sieht. Sie lauscht auf Schritte; aber sie lauscht ständig auf Schritte. Sie hat Hunger; aber sie hat immer Hunger. Sie hat vergessen, diese Dinge überhaupt zu bemerken. Sie krampft ihre Zehen zusammen. Der Stein ist kalt. Der Stein ist immer kalt; selbst im Sommer sind die Nächte mit ihrer dünnen Luft kühl, und die Hitze des Tages hat nicht genug Zeit, durch die Mauern zu sickern. Aber heute Nacht fällt es ihr auf, denn sie hat den eben vergangenen Tag unter der Dachtraufe verbracht – hat atemlos unter den heißen Dachschindeln geschmort, beobachtet, wie dünne Goldfäden über ihre verschwitzten Knie krochen, als die Sonne versank. Sie presst ihren Fußballen auf den Boden und genießt die Kühle. Kalter Stein, kalter Knochen. Sie würde das gern in die Tasche stecken und während der langen Tage des Versteckens daran saugen. Aber es ist eine späte Hitze. Das Ende des Sommers ist da. Gestern haben die Grauen Türen aufgesperrt, Fenster geöffnet, Sandkörner und welke Blätter aus den Kaminen gefegt. Heute sind sie eifrig mit ihren Körben auf Rädern hin und her gewuselt, haben Betten gemacht, nach Seife und Lavendel stinkende Laken geschwenkt. Morgen werden sie auf der anderen Seite des Innenhofs sauber machen, Böden schrubben und mit Eimern klappern. Sie werden miteinander grummeln und nach Schweiß riechen. Die Jungen unter ihnen werden sich zur Seite schleichen und Rauch aus dem Fenster blasen. Die Rättin versteckt sich immer, aber schon bald wird sie sich gründlicher verstecken. Und dann werden die Schwarzen kommen, die Männlichen, laut und gierig. Es wird mehr Essen geben und mehr Gefahr. Ein paar Wochen lang wird sie sich eher durch die Kamine als durch die Flure bewegen. Und dann, wenn die Tage vergehen, werden Feuer angezündet, und sie wird die Simse, Dächer und Lücken in den Mauern nutzen oder sich nur nachts in die Küche und zurück bewegen. Sie wird durch den ganzen langen Schnee hindurch schlafen und bibbern. So wandelt sich das Jahr.
Ohne einen bestimmten Grund tritt sie weiter in die Halle hinaus, Mondlicht sickert ihr an den Knöcheln hinauf. Sie geht nicht in den Raum zwischen den Bänken, steht aber nah am Rand. Eine silberne Linie rahmt das nackte Rechteck ein, wie ein Rinnsal aus Quecksilber zwischen den Steinen. Sie hebt einen Fuß, stellt sich aber nur selbst auf die Probe. Sie weiß schon, dass sie die Linie nicht überschreiten wird. Jemand anderer würde das tun; jemand anderer würde vortreten, hätte einen Eröffnungszug vorbereitet, würde sich vor den leeren Bänken verneigen. Aber sie ist die Rättin, und sie könnte einen Eröffnungszug nicht von einer Krallenspur an der Wand unterscheiden. Alles, was sie über diesen Ort weiß, ist, dass er nicht ihr gehört. Für die Rättin ist diese silberne Linie wie ein Draht, der Zwischenraum ist eine Falle, die nur darauf wartet, hinter ihr zuzuschnappen. Es ist alles so fremd, dass ihr die Kopfhaut kribbelt. Die Stille dehnt sich.
Draußen geht kein Wind. Doch plötzlich ist im Kamin ein Keuchen und Flüstern zu hören, ein halber Takt eines undeutlichen Geräuschs, als zerrisse Stoff. Die Rättin fährt herum, ist auf dem Sprung. Etwas fällt in die Feuerstelle, klatscht mit den Flügeln und scharrt. Ein trockenes Bündel aus sich bewegenden Federn, Krallen kratzen über den Stein. Die kleinen Geräusche hallen laut wider, werden von der Stille verstärkt. Ein unmenschliche Stimme ruft ihr zu, wild und klagend. Einen Augenblick lang steht sie wie erstarrt da. Dann macht sie einen Schritt auf den Kamin zu, so langsam, dass sie jedes einzelne Fußknöchelchen spürt, wo es auf den Boden auftrifft.
Ein Uhu im Kamin. Er ist klein, kein Küken mehr, aber ein Jungvogel, der Umriss noch durch die letzten Daunenfedern ein wenig verschwommen. Doch die wilden Augen starren sie unverwandt an. Der Uhu bewegt den Kopf auf und ab, ruft erneut, zunehmende Verzweiflung schwingt in der Frage. Die Flügel breiten sich zu einem ungeschickten, schiefen Federfächer aus. Der Uhu hüpft, faltet sich wieder zusammen. Eine Linie aus Mondlicht fällt ihm über den Rücken, so hell, dass die Rättin den Hauch von Braun und Sahneweiß im Gefieder erkennen kann, das feurige Funkeln in seinen Augen. Wieder versucht er zu fliegen: das gleiche schmerzliche Flattern, die gleiche scharfe, zuckende Niederlage. Die Rättin schaut zu.
Der Uhu versucht es immer und immer wieder. Er bringt einen langen zitternden Ton hervor, nun lauter. Echos summen von den Wänden, an der Schwelle des Hörbaren. Die Rättin stellt sich vor, aus welchem Nest er kommt, nackter Stein oben auf einem Turm oder einem Strebepfeiler, hoch und unerreichbar. Irgendwo wird es eine Uhumutter geben. Bisher war der Jungvogel in Sicherheit. Bisher ist er gefüttert und beschützt worden. Er ruft weiter, als würde ihm jemand zu Hilfe kommen. Jedes Mal, wenn er seine Flügel ausbreitet, spürt die Rättin ein Kribbeln in der Brust.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Innenhofs schlägt die Uhr einen einzelnen, reinen Ton.
Sie geht quer durch den Raum zur Feuerstelle, und der Jungvogel zappelt. Sie hält inne, bis er sich wieder beruhigt hat. Sie schaut auf die starken Klauen, wie sie sich immer und immer wieder auf dem Stein verkrallen. Sie wartet, bis sie bereit ist. Dann kauert sie sich hin und schnellt die Arme vor, blitzschnell wie ein Zwinkern, packt mit beiden Händen die glatt-weichen Federn über den dünnen Knochen. Sie greift um, eine schnelle Drehung.
Ein Knacken. Die Rättin ist wieder allein.
Sie steht auf. Sie lässt den Jungvogel fallen. Irgendein Instinkt, tiefer als jede Logik, hat sie ein Klirren wie von splitterndem Glas erwarten lassen, aber jedes Geräusch, das der Uhu macht, als er auf dem Boden auftrifft, wird vom Rauschen des Bluts in ihren Ohren übertönt. Sie tötet nicht oft etwas. Nun hat es ihr den Puls zu einem Trommeln anschwellen lassen, zu einem dröhnenden Pochen im Kopf, das nicht langsamer werden will. Sie löst ihre Fäuste. Irgendwie ist Blut darauf gekommen. Ein Kratzer quer über ihre Fingerknöchel beginnt zu brennen. Am einen Ende, wo der Kratzer am tiefsten ist, quillt eine dunkle Perle hoch, fließt über, rinnt ihr das Handgelenk entlang. Sie führt die Hand an den Mund und saugt an der verletzten Haut, schmeckt Eisen. Der Herzschlag bebt ihr in den Knochen, als wären sie hohl.
Schritte auf dem Korridor. Einen Sekundenbruchteil lang glaubt die Rättin, der Rhythmus ihres Herzen hätte sich verdoppelt, verdreifacht. Aber sie lauscht immer: Sie braucht nur diesen kurzen Moment, um den Unterschied zwischen dem heißen, dumpfen Dröhnen ihres Herzens und dem Klappern von Schuhen auf Stein zu hören. Sie krallt sich mit den Zehen innen im Kamin fest, schwingt sich hinauf, die Muskeln straff, tief in die dunkelsten Schatten hinein. Eine Bewegung an der Tür, das Wehen einer hellen Robe. Die Rättin schließt die Augen vor Angst, dass sich das Mondlicht in ihnen spiegeln könnte. Es ist zu spät, um noch höher zu klettern; jede Bewegung würde ein Geräusch verursachen.
Die Gestalt schreitet in den Raum vor. Die Schritte halten inne. Die Rättin atmet flach, die Rippen sind ihr eng von der Anstrengung des Stillseins. Ihre Nase ist mit dem Aroma alter Asche angefüllt. Eine lange Zeit – eine Minute, eine Sekunde – verstreicht. Dann kann sie nicht anders, sie öffnet die Augen einen Spalt weit. Sie starrt durch das flimmernde verschmierte Schwarz ihrer Wimpern. Sie erkennt die Gestalt in Weiß: die Frau. All die anderen Gestalten in Weiß sind Männer, außer dieser. Die Weiblich-Männliche, die aus der Reihe fällt. Sie steht jetzt da, wo die Rättin gestanden hat: am Rand der Fläche, hinter der silbernen Linie, bereit. Auch sie schaut auf das Mondlicht. Aber was immer sie sieht, es ist nicht das, was die Rättin gesehen hat. Die Rättin beißt die Zähne zusammen. Ihre Muskeln brennen.
Die Weiße macht eine Bewegung. Es ist eine seltsame, losgelöste Geste, der Anfang von etwas und gleichzeitig sein Ende. Es ist, als wäre ein Faden an ihr Handgelenk gebunden. Sie lässt die Hand sinken und ist wieder reglos.
Dann, als hätte die Rättin ein Geräusch gemacht, schaut sie sich um. Die Stille strafft sich. Die Rättin erstarrt, zieht sich tiefer in den Schatten zurück. Sie hält die Luft an. Irgendwas kitzelt sie innen am Unterarm. Eine feuchte Spur kriecht ihr vom Handgelenk auf den Ellbogen zu, dunkel auf ihrer blassen Haut. Jeden Augenblick wird es tropfen.
Die Weiße runzelt die Stirn. Sie legt den Kopf schief, als wolle sie Licht und Schatten aus einem anderen Winkel betrachten. Im Mondlicht ist ihr Gesicht wie eine vertikale Halbmaske. Ihr Mund öffnet sich.
Der Blutstropfen fällt. Einen Augenblick lang spürt die Rättin sein Fehlen, das kaum merkbare Leichterwerden ihres Körpers. Dann tickt er zu Boden.
»Wer ist da?«
Die Rättin rührt sich nicht. Falls die Weiße näher kommt, wird sie sich nach oben krallen, wild verzweifelt so lange klettern, bis sie die Verengung im Schornstein erreicht, wo sie sich abstützen und ausruhen kann. Doch jede Bewegung wird einen Schauer von altem Ruß und Mörtel auf die Feuerstellen herunterregnen lassen, und dann werden die wissen, dass sie hier ist. Sie werden suchen und spähen und sie herauszerren. Da werden Männer mit Händen sein und Gesichter mit Augen. Sie werden versuchen, einen Menschen aus ihr zu machen, und sie hassen, wenn es ihnen nicht gelingt. Sie weiß genug von der Welt, um das zu wissen.
»Ist da jemand?«
Manchmal haben die Grauen sie gesehen. Ein kurzer Blick, ein Aufblitzen, ein halber Fußabdruck im Staub. Aber niemand hört auf sie, wenn sie sagen, dass da entweder ein Mädchen in den Mauern lebt oder dass es in der Schule spukt. Dieser hier würden sie Glauben schenken.
Die Weiße macht einen weiteren Schritt. Die Schatten gleiten über sie. Sie sieht den Uhu, ein gebrochenes Bündel, in der Feuerstelle liegen. Sie bleibt stehen.
Die Rättin zittert nun am ganzen Leib. Ihre Schultern brennen. Schweiß tränkt ihr Hemd, ihr eigener heißer Geruch weht ihr aus den Achselhöhlen und von der Kopfhaut entgegen. Ihre Hand schmerzt. Neben ihrem Kopf ist ein loser Stein, den ein groß gewachsener Mann erreichen könnte. Sie würde fallen, wenn sie danach griffe. Aber sie würde mit dem Stein in der Hand fallen. Er ist schwer genug, groß genug, um einen Schädel zu zertrümmern. Ihr Herzschlag beschleunigt sich, ist so laut, dass sie sicher ist, die Weiße könnte ihn hören. Wenn die Weiße sie hört …
Die Finger der Rättin biegen sich um den Stein. Sandkörner dringen in den empfindlichen Spalt unter ihren Fingernägeln ein.
Die Weiße wendet sich ab. Im einen Moment ist sie da, starrt mit einer Falte zwischen den Brauen in den Schatten der Rättin; dann ist sie fort, in einem Wirbel von Weiß durch die Tür, von mondbeschienen bis dunkel in einem Augenblick. Ihre Schritte verhallen.
Die Rättin wartet. Nach langer Zeit lässt sie sich herunter. Ihre nackten Füße drücken auf den Boden. Sie streckt die Arme, ganz langsam, weiß, dass sie nicht entspannen darf. Selbst wenn eine Gefahr vorüber ist, gibt es immer gleich eine andere. Doch zumindest kann sie frei atmen. Sie ist froh, dass sie die Weiße nicht töten musste. Der Gedanke ist wie eine frische Zahnlücke. Sie erkundet diese Form. Vielleicht ist sie gar nicht froh. Vielleicht ist sie enttäuscht.
Sie schüttelt sich. Froh, enttäuscht … Sie ist die Rättin. Für Ratten ist das Leben einfach. Sie tut, was sie tun muss, nicht mehr, nicht weniger. Mehr und weniger, das ist was für Menschen. Mehr und weniger, das ist dieser Saal, das ist der leere Raum, die Geste-die-keine-war der Weißen. Die Rättin hat keinen Anteil daran. Sie will kein Mensch sein, was auch geschieht. Nur heute Nacht hat das Mondlicht sie hereingelockt.
Ihr Fuß streift den toten Uhu. Eine Ratte würde daran schnüffeln und sie liegen lassen: mageres, schwieriges Fleisch, voller Knochen und wenig appetitlich. Es ist einfacher, Essen aus der Küche zu stehlen, und sie hat für dieses Bündel aus Knochen und Federn sonst keine Verwendung. Aber sie hebt es auf. Sie durchquert den Saal, lässt es in ihrem Griff schwingen. Sie hat das gerinnende Blutklümpchen heruntergestreift, als sie die Füße auf den Boden setzte, und jetzt spürt sie, wie ein frisches Kitzeln aus Blut ihr zwischen den Fingern herunterrinnt. Der Kratzer pocht. Sie wird Wein und Honig aus der Küche stehlen, die Wunde säubern und einen Lappen darumwickeln; selbst eine Ratte würde sich entscheiden, die Pfote nicht zu verlieren.
Der Mond ist weitergewandert. Die Rechtecke aus eingesperrtem Licht sind nach unten und wieder hinauf geglitten, falten sich in die rechten Winkel zwischen Wänden und Boden. Jetzt ist die Mitte des Bodens dunkel, und die Linie aus Silber ist verborgen. Schon bald wird der Berg den Mond völlig verschlucken, und der Saal wird dunkel sein, das Spielbrett ausgelöscht. Heute Nacht wird es kein Grand Jeu geben.
Die Rättin nimmt sich keine Zeit zum Nachdenken; oder vielleicht ist es die neue Lücke in ihrem Kopf – der Gedanke an einen Stein in ihrer Hand –, die sie ohne Zögern über die unsichtbare Grenze stößt. Sie hockt sich hin und legt den toten Jungvogel mitten auf die Fläche. Sie breitet die Flügel zu einem schiefen Federfächer aus. Die Dunkelheit liegt darauf wie Staub. Blut tropft ihr von der Hand auf den Boden neben ihren Zehen. Sie schaut hoch, kann aber von hier den Mond nicht sehen, nur den ausgebleichten blauschwarzen Himmel und den Buckel des Bergs.
Sie erhebt sich auf die Füße und starrt in die Dunkelheit, als erwiderte sie jemandes Blick. Ein weiterer Blutstropfen fällt, aber sie scheint es nicht zu bemerken. Sie lauscht auf etwas anderes, etwas, das sie nicht versteht. Dann tritt sie zurück aus dem freien Raum, breitet die Arme weit aus, wie zu einer Einladung.
2 Léo
Als Léo aufwacht, spukt ihm ein Thema durch den Kopf. Eine Sekunde lang kann er es nicht zuordnen. Es könnte ein Traum sein: eine flüchtige Melodie, eine Form, die sich zu etwas Abstraktem ausweitet, das Bruchstück eines Gedichts mit dem stechenden Schmerz einer halb erinnerten Gedankenkette. Er dreht sich auf die andere Seite, kneift die Augen zu, als könnte er sich in den Schlaf zurückflüchten, aber es hilft nichts. Die Melodie hallt in seinem Hirn wider, ärgerlich, verhöhnt ihn. Dann plötzlich erkennt er sie. Die verdammten Brücken von Königsberg. Sie vermischt sich mit dem Geräusch einer zugeknallten Tür und dem Klappern von Tellern in der Küche unter ihm. Das hatte ihn wohl aufgeweckt; sonst hätte er lange geschlafen, unruhig gedöst nach einer beinahe schlaflosen Nacht.
Er zieht sich das Bettzeug fester um die Schultern, aber nun, da er wach ist, friert er. Die Decken sind kratzig und dünn, und das Kopfkissen fühlt sich feucht an. Gestern Abend hat ihm der Wirt mit Verschwörermiene zugelächelt und erklärt: »Die Arnauld-Suite, Sir. Ich muss sagen, es ist uns eine Ehre.« Und das Zimmermädchen hatte ihn aus den Augenwinkeln angeschaut, als sie ihm das Zimmer zeigte, hatte wohl erwartet, dass er beeindruckt sein würde von den prächtigen Vorhängen und den schweren goldgerahmten Porträts der Meister des Grand Jeu. Doch am Kopfende des Betts sind Häufchen dunkler Punkte, wo in den Ritzen die Wanzen nisten, und die Matratze beult sich in der Mitte nach unten wie eine Hängematte. Jedes Mal, wenn er sich in der Nacht herumgedreht hat, quietschte und knarzte sie, und jetzt gräbt sich ihm eine Sprungfeder in die Rippen. Gerade in diesem Augenblick wird Chryseïs mit weit ausgestreckten Armen und Beinen zwischen Laken aus ägyptischer Baumwolle liegen, wird ihr ganzes gemeinsames Bett für sich beanspruchen. Sie wird noch schlafen, das goldene Haar wirr, ein verirrter Fleck von Lidschwarz über die Schläfe geschmiert, während die Gardinen sich an der geöffneten Terrassentür bauschen und der Geruch des heißen Staubs und der Autoabgase sich mit dem der Rosen auf dem Kaminsims mischen. Manchmal hat er das Gefühl, als würde ihn der Sommer in der Stadt ersticken, aber gerade in diesem Moment, hier in diesem modrigen Zimmer, würde er ein Jahresgehalt dafür geben, wieder in seinem alten Leben zu sein. Er fährt sich mit den Händen durchs Gesicht, versucht, das klebrige Gefühl wegzuwischen, dass er nicht richtig geschlafen hat, und setzt sich auf. Das Thema der Brücken von Königsberg macht sich erneut in seinem Kopf bemerkbar. Es ist wie eine Schallplatte mit einem Sprung, die Bewegung zwischen der Melodie und der ersten Entwicklung des Eulerschen Wegs, dann zurück zu dieser Ärgernis erregenden Melodie … Von allen Spielen, die ihm in den Kopf kommen könnten, muss es ausgerechnet das eine sein, das er partout nicht leiden kann. Er steht auf, zieht sich Hose und Hemd über und klingelt nach Rasierwasser. »Und Kaffee«, fügt er hinzu, als das Zimmermädchen einen Knicks vollführt und sich zum Gehen wendet. Sie schwingt so übereifrig zu ihm zurück, dass sie fast ins Straucheln gerät, und er bemerkt leidenschaftslos, dass man ihm die Hübscheste geschickt hat. »Zuerst den Kaffee. Und achten Sie drauf, dass er heiß ist.«
»Jawohl, Sir. Natürlich, Sir. Haben Sie sonst noch Wünsche?«
»Nein. Danke.« Er setzt sich ans Fenster, den Rücken zu ihr. Ungehobelt, aber was bedeutet das schon? Er ist kein Politiker mehr.
Der Kaffee, der irgendwann endlich kommt, ist furchtbar – halb Zichorie, halb verbrannt –, aber zumindest ist er beinahe so heiß, wie er ihn gern hat, heiß genug, um sich durch die Tasse die Hände daran zu wärmen. Er nippt langsam daran, beobachtet, wie der Himmel über den Häusern gegenüber die Farbe verändert. Die Sonne ist noch nicht über die Berge gestiegen, und die Straße draußen ist noch dämmrig, obwohl es schon beinahe acht Uhr ist. Er sollte jetzt zu Hause sein, in seinem Studierzimmer, die zweite Kanne halb ausgetrunken, und in einen von Dettlers Berichten vertieft. Es fühlt sich unbehaglich an, es juckt ihn in den Fingern, dass er hier herumsitzt und nichts zu tun hat. Nicht im Traum würde es ihm einfallen, sich in der Morgendämmerung diesen verdammten Berg hochzuquälen, als wäre er ein Student. Gestern hat er mit Vorbedacht einen Wagen für nach dem Mittagessen bestellt, doch nun weiß er bereits jetzt nicht mehr weiter, rutscht unruhig auf dem muffig riechenden Stuhl herum, fragt sich, ob er genug Hunger hat, um nach dem Frühstück zu klingeln. Wie soll er bloß die Stunden herumbringen? Er zuckt zusammen; diese Frage lässt ihn an Chryseïs denken, wie sie da auf dem Balkon stand und ihn anstarrte, am Abend nach seiner Besprechung mit dem Schatzkanzler. »Und was mache ich jetzt?«, fragte sie, und er hätte beinahe laut herausgelacht darüber, wie berechenbar sie war.
»Noch einen Martini trinken, schätze ich«, antwortete er.
Sie zuckte kaum mit der Wimper. »Während du weg bist«, sagte sie. Sie fischte mit einem scharlachrot lackierten Fingernagel in ihrem Glas, zog die winzige Spirale Orangenschale heraus und schnippte sie über die Schulter auf die Straße. »Was erwartest du, was soll ich tun?«
»Ich zahle die Miete für die Wohnung weiter.«
»Du meinst, ich soll hier bleiben, ganz allein?«
»Zumindest, bis du jemand Besseren findest.« Es wäre freundlicher gewesen, »etwas Besseres« zu sagen, aber ihm war nicht freundlich zumute. »Du wirst schon zurechtkommen.«
»Oh, herzlichen Dank. Ich weiß deine Fürsorge zu schätzen.« Sie legte den Kopf schief und starrte ihn an, doch diesmal entfachte das in ihm keinen Funken, er verspürte nichts als Müdigkeit. »Herrgott Sakrament, Léo! Ich kann doch nicht …«
»Ich habe dich gebeten, nicht so zu reden.«
»Oh, nicht das schon wieder. Ich bete ja nicht gerade den Rosenkranz, oder? Was gedenkst du jetzt zu tun, wirst du mich beim Register anzeigen?« Sie drängte sich an ihm vorbei, stieß ihn mit dem Ellbogen an. Sie hatte ihr Haar frisch ondulieren lassen; ein Hauch von den Chemikalien kratzte ihn im Hals. »Ich kann einfach nicht glauben, dass du das vermasselt hast. Ich dachte, du wärst angeblich der Goldene Junge der Regierung. Hat der Alte nicht gesagt, du wärst …«
»Augenscheinlich nicht.«
»Du verdammter Idiot, wie konntest du nur? Du bist ein Feigling, das ist es – jetzt, da die Partei an der Macht ist, kannst du den Druck nicht aushalten – du hast einfach kein Rückgrat.« Sie trat wütend gegen das Bein der Chaiselongue. Flüssigkeit schwappte aus ihrem Martiniglas und spritzte auf ihr Kleid. »Scheiße! Das Kleid ist neu.«
»Ich kaufe dir ein anderes.« Er ging quer durch den Raum zum Cocktailschrank und schenkte sich einen Whisky ein. Das Eis war ihnen ausgegangen, aber er klingelte nicht nach mehr.
»Das will ich dir auch geraten haben. Und wenn du schon mal da bist, bezahle gleich die restliche Rechnung.« Ihre Stimme brach. Sie sackte auf einen Stuhl. »Oh, schau mich einer an, im besten Festtagsstaat … ich dachte, er würde dich befördern – nach dem Posten als Kulturminister, da dachte ich, endlich gibt man ihm was wirklich Wichtiges. Ich habe mich bereit gemacht zum Feiern.«
»Dann feiere.« Sie starrten einander an. Hätte er das Richtige gesagt, wäre sie vielleicht sanfter geworden; andererseits, wäre sie sanfter geworden, er hätte es nicht ertragen.
Sie stand auf. Sie trank den Rest ihres Martinis in einem Zug aus und nahm ihre Stola. »Schöne Ferien, Léo«, sagte sie und ging.
Nun versucht er, die Erinnerung mit einem Schulterzucken abzutun. Von allem, was er zurückgelassen hat, ist Chryseïs seine kleinste Sorge. Sie ist besser dran als er, gähnt jetzt wohl und setzt sich im Bett auf, zieht sich ihr Negligé über und klingelt nach heißer Schokolade. Ihr wird es gut gehen. Und selbst wenn nicht, würde es ihn so sehr bekümmern? Er wendet sich von diesem Gedanken ab. Vor einem Monat hatte er sich noch vorgestellt, wie er ihr einen Heiratsantrag machen würde: die atemlos aufgeregten Artikel in den Gesellschaftsspalten, das Blitzen eines extravaganten Brillanten an ihrer linken Hand, die Glückwünsche des Alten. Jetzt …
Es klopft an der Tür. Er fährt zusammen; als die Tür aufgeht, steht er auf den Beinen, und das Zimmermädchen weicht erschrocken zurück. »Verzeihung, Sir, ich dachte, ich hätte gehört, wie Sie ›herein‹ rufen.«
»Natürlich. Ja. Vielen Dank.« Er wartet, bis sie fort ist, ehe er zum Waschtisch geht und sich das Gesicht mit Wasser bespritzt, Luft durch den Mund auspustet, bis sein Puls sich beruhigt und sein Kragen durchnässt ist. Er hat keine Angst; es gibt nichts, wovor er Angst haben müsste. Doch manchmal erwischen ihn Dinge für einen kurzen Augenblick auf dem falschen Fuß: das unerwartete Klopfen, das Auto, das zu schnell fährt, als er die Straße überquert, das metallische Aufblitzen, als ein Betrunkener ihm über den Weg wankt und lässig nach seinem Flachmann greift. Seit der Besprechung mit dem Schatzkanzler. Seit ihn der Schatzkanzler mit dieser Miene angeschaut hat, als wolle er abwägen, wie viel er wert war. Er spürt das Frösteln noch immer; als hätte auf der Hälfte einer Jagdpartie ein Freund auf einmal sein Gewehr lässig herumgeschwenkt und auf Léos Gesicht gerichtet. Und einen Sekundenbruchteil später die Beschämung darüber, dass er so ein verdammter Narr gewesen war, dass er es nicht hatte kommen sehen; dass er gedacht hatte, es wäre ein freundliches, zivilisiertes Spiel … Dass er ins Büro spaziert war, ein wenig nervös, natürlich – so als würde man vor den Magister Scholarium zitiert –, aber doch sicher, dass der Alte sich umstimmen lassen würde, lediglich ein wenig befremdet, als der Schatzkanzler und nicht der Alte selbst hinter dem Schreibtisch saß und Léos Brief vor sich liegen hatte. »Ah, Léo«, sagte er. »Danke, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges unterbrochen?«
»Ich bin sicher, dass Dettler eine Stunde ohne mich klarkommt.«
»Nun, das wollen wir doch hoffen.« Er nahm den Telefonhörer zur Hand. »Tee bitte. Ja, zwei Tassen. Vielen Dank. Setzen Sie sich, Léo.«
Er setzte sich. Der Schatzkanzler faltete die Hände und neigte den Kopf, als wolle er ein Gebet sprechen. »Léo«, sagte er schließlich. »Vielen Dank für Ihren Brief. Wir bewundern alle Ihre Leidenschaft und Ihre Energie, das wissen Sie. Und es liegt in der Natur eines jungen Mannes, ohne Umschweife zu sprechen. Also danke für Ihre Aufrichtigkeit.«
»Als Kulturminister hatte ich das Gefühl, dass es nur recht und billig ist, wenn ich darum bitte, die Dinge mit dem Premierminister durchzusprechen, ehe das Gesetz zur Abstimmung vorgelegt wird.«
»Natürlich. Und es tut ihm sehr leid, dass er heute nicht hier sein kann. Ich weiß, dass ihn Ihre Sichtweise sehr interessiert. Er hat mich gebeten, Ihnen auszurichten, dass er Ihren Mut bewundert.«
Vielleicht war das der Moment, in dem Léo das erste Unbehagen kalt über den Rücken rann. »Die Vorschläge im Gesetz sind ziemlich extrem, Herr Schatzkanzler – alles, was ich anregen wollte, war, dass wir noch einmal erwägen …«
»Er war auch recht … überrascht.« Der Schatzkanzler schaute an ihm vorüber zur Tür. »Herein! Ah, Kekse! Braves Mädchen. Ja, stellen Sie alles da hin. Auf den Couchtisch.« Die Sekretärin begann, ihr Teetablett abzuladen, und der Schatzkanzler deutete auf das Sofa. »Léo, bitte …«
Léo stand auf, schritt zum Sofa hinüber und nahm wieder Platz; aber der Schatzkanzler zögerte, schritt zum Fenster und blickte hinaus, die Hände auf dem Rücken verschränkt. »Wo war ich stehen geblieben?«
»Sie sagten, der Alte … den Premierminister hätte sehr interessiert, was ich geschrieben habe.«
»Eine bessere Formulierung wäre wohl ›verblüfft‹, denke ich.« Er deutete mit einer Handbewegung auf die schimmernde Ansammlung von Porzellan. »Bitte halten Sie sich nicht mit Förmlichkeiten auf, junger Mann. Nehmen Sie sich eine Tasse Tee.«
Léo schenkte sich Tee ein, goss Zitrone dazu, rührte um und hob die Tasse an die Lippen. Dann stellte er Tasse und Untertasse ab, war sich der Anspannung in seinem Handgelenk bewusst. Wie oft, wenn er hier mit dem Alten saß, hatte er das verräterisch Klirren von Porzellan gehört, wenn andere Männer versuchten, ihre zitternden Hände unter Kontrolle zu bringen? Aber das hier war anders; er war anders. Es war doch sicher schlicht und ergreifend Gastfreundlichkeit. Kein Test, keine Tortur. Als er aufschaute, lächelte der Schatzkanzler ihn an.
»Ah, Léo, mein lieber Junge. Nun, eigentlich kein Junge mehr … verzeihen Sie mir, das ist das Privileg des Alters … Wie alt sind Sie, helfen Sie meiner Erinnerung auf die Sprünge? Achtundzwanzig, neunundzwanzig?«
»Zweiunddreißig.«
»Wirklich? Nun ja, das ist jetzt nicht wichtig …« Er drehte sich weg, um aus dem Fenster zu blicken, zog gedankenverloren an der Vorhangschnur. »Die Sache ist die, Léo«, fuhr er fort, »dass Ihr Brief recht bedauerlich war.«
Léo antwortete nicht. Einen schwindelerregenden, verrückten Augenblick lang erwartete er, der Schatzkanzler würde die Vorhänge zuziehen, als wäre jemand gestorben.
»Um ganz ehrlich zu sein … Wir sind enttäuscht, Léo. Sie schienen eine so vielversprechende Laufbahn vor sich zu haben. Wir waren uns Ihrer Fähigkeiten so gewiss. Da ist mal ein junger Mann, dachten wir, der uns helfen kann, das Land in eine neue, wohlhabende, befreite Zeit zu geleiten, der die Vision der Partei versteht, der die nächste Generation anführen wird, wenn wir zu alt sind, um die Bürde weiter zu schultern … Ich dachte, Sie hätten den gleichen Traum, Léo.«
Die Vergangenheitsform grub sich wie eine Nadel tiefer und immer tiefer in ihn ein. »Den habe ich, Herr Schatzkanzler – ich teile die Ideale der Partei absolut.«
»Und doch deutet Ihr Brief an, dass Sie das nicht tun.«
»Es geht nur um diese eine spezielle – diesen einen Abschnitt der Gesetzes …«
»Sie finden, dass die Maßnahmen – wie haben Sie es formuliert? – ›irrational und moralisch verwerflich‹ sind.«
»Das habe ich geschrieben? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich verwerf…«
»Bitte – gerne –, wenn Sie Ihr Gedächtnis auffrischen möchten.« Der Schatzkanzler deutete auf den Schreibtisch. Der Brief lag da auf der Schreibunterlage, Léos Unterschrift ein dunkles Gekrakel unten auf dem Blatt. Es trat eine Pause ein.
Léo schluckte. Sein Mund war sehr trocken geworden. Er schüttelte den Kopf. »Da war ich vielleicht ein wenig zu nachdrücklich, Herr Schatzkanzler. Ich entschuldige mich, wenn ich …«
»Nein, nein, mein lieber Junge.« Der Schatzkanzler schnippte mit der Hand nach den Worten. Léo konnte beinahe sehen, dass sie wie tote Fliegen auf den Teppich fielen. »Zu spät. Niemand bedauert Ihre Impulsivität mehr als ich, aber es nützt nichts, sich damit zu lange aufzuhalten.« Schließlich wandte er sich um und sah Léo direkt in die Augen. So hatte Léos Vater die zerbrochenen Gegenstände auf seinen Schrottplätzen angeschaut, wenn er sich fragte, ob sie den Platz wert waren, den sie einnahmen. »Die Frage ist nur«, sagte er, »was wir jetzt mit Ihnen machen?«
»Ich … wie bitte? Sie meinen …?
»Wir können unmöglich einen Minister im Kabinett haben, der eine so halbherzige Einstellung zu unserer Politik hat.« Der Schatzkanzler runzelte die Stirn. »Sie sind ein scharfsinniger Politiker, Léo, das müssen Sie doch verstehen.«
»Wohl kaum halbherzig.«
»Also bitte.« Er hob eine Hand. »Es tut mir ebenso leid wie Ihnen, das müssen Sie mir glauben. Dem Alten auch. Aber wenn wir Ihnen nicht vertrauen können …«
»Herr Schatzkanzler, bitte … Ich bin ehrlich nicht der Meinung …«
»Seien Sie still.« Die Sirene eines vorbeirumpelnden Krankenwagens war in der Ferne zu hören. Léo hatte einen bitteren Geschmack im Mund, traute sich aber nicht zu, seine Teetasse hochzuheben, ohne etwas zu verschütten. Der Schatzkanzler schritt zu seinem Schreibtisch, nahm ein Blatt Papier zur Hand und legte es auf dem niedrigen Tisch vor Léo hin. Ein Brief. Erklärung … »Hier ist eine Rücktrittserklärung.« Er legte einen Füllfederhalter daneben. »Seien Sie vernünftig, Léo. Wenn Sie das lesen, werden Sie feststellen, dass wir Ihnen die Sache leicht gemacht haben. In Anerkennung der Leistungen, die Sie für die Partei erbracht haben. Der Alte mag Sie, müssen Sie wissen. Ich denke, Sie stimmen mit uns überein, dass es eine elegante Lösung ist.«
Er musste blinzeln, ehe die Wörter scharf zu lesen waren … eineEhre, hier gedient zu haben … Beitrag zur Vision des Premierministers … wunderbarer Wohlstand, Einheit und Reinheit … aber andere sind besser geeignet … in meinem innersten Wesen habe ich mich stets danach gesehnt … Er blickte auf. »Ich verstehe nicht recht.«
»Ich hätte gedacht, dass es ziemlich offensichtlich ist.«
»Sie wollen sagen … Sie wollen, dass ich sage …« Er unterbrach sich und schaute erneut auf den Brief. »›Ich bin stolz darauf, als Kulturminister stets mein Bestes gegeben zu haben, aber ich sehne mich danach, als bescheidener Student des Grand Jeu meinen Beitrag zu leisten.‹ Was soll das bedeuten?«
Der Schatzkanzler nahm ihm gegenüber Platz. Er schenkte sich eine Tasse Tee ein und ließ den Löffel mit einem spröden Ting gegen den Goldrand klirren. »Sie waren der einzige Student im zweiten Jahr, der je in Montverre eine Goldmedaille gewonnen hat, oder nicht?«
»Das wissen Sie doch. Hat das etwas zu sagen?« Seine Aussage klang kämpferischer, als er es beabsichtigt hatte.
»Sie haben bei der Wahl dieser Regierung eine wirklich hochgeschätzte Rolle gespielt, Léo. Aber Sie sind nicht wirklich zum Politiker geboren – Sie haben Ihre persönlichen Bedürfnisse so lange hintangestellt, wie sie konnten, um dabei mitzuhelfen, den größten politischen Erfolg dieses Jahrhunderts zu erreichen – aber es ist Ihnen nie gelungen, den Traum zu vergessen, dass sie einmal nach Montverre zurückkehren würden, um dort das Spiel unserer Nation zu studieren – und jetzt, da die Zukunft des Landes gesichert ist, haben Sie endlich die Gelegenheit dazu … Das ist eine anrührende Geschichte: der Künstler, der zu seinen Wurzeln zurückkehrt, seine Berufung erfüllt. Wer weiß, möglichweise können Sie dort für uns von Nutzen sein.«
»Aber ich habe nicht …«
Der Schatzkanzler setzte seine Teetasse ab. Es war eine flüssige Bewegung, beinahe lässig, und doch ließ sie Léo leicht zusammenzucken. »Entweder stellen Sie sich absichtlich dumm«, sagte er, »oder Sie sind ein völliger Einfaltspinsel. Was Sie, das hätte ich bis gestern schwören können, nicht sind.« Er seufzte. »Ich weiß nicht, wie viel deutlicher ich das noch ausdrücken kann.«
Léo hörte sich sagen: »Vielleicht in knappen Wörtern von einer Silbe.«
Der Schatzkanzler zog die Augenbrauen in die Höhe. »Sie stehen vor einer sehr einfachen Wahl. Entweder unterschreiben Sie diesen Brief, erzählen den Zeitungen dieselbe Geschichte und ziehen sich nach Montverre zurück, solange wir das für nötig befinden. Oder der Premierminister wird sich gezwungen sehen, mit Ihnen … energischer zu verfahren.«
»Sie meinen, irgendjemand wird mich mit durchgeschnittener Kehle in einem Graben finden?« Es war wie ein Scherz formuliert. Doch die Frage hing unbeantwortet in der Stille, massiv und monströs, bis ihm klar wurde, dass es kein Scherz gewesen war. Er nestelte am Füllfederhalter, um die Kappe abzuschrauben, und unterschrieb den Brief, ohne den Rest zu lesen. Seine Unterschrift war kaum wiederzuerkennen. Unter dem ersten Exemplar lag noch ein zweites. Er hielt inne, ohne aufzusehen. »Das sind zwei.«
»Eines ist für Ihre Akten bestimmt. Damit Sie später darauf Bezug nehmen können. Wir werden sehen, welche Vorkehrungen wir für Montverre treffen müssen – es wird ein paar Wochen dauern. Bis dahin ist Ihr Rücktritt offiziell angenommen. In der Zwischenzeit wird Dettler Ihre Amtsgeschäfte übernehmen.« Der Schatzkanzler nippte an seinem Tee. »Es versteht sich von selbst, dass Sie keinerlei Versuch unternehmen werden, den Fortschritt des Gesetzes zu behindern.«
»Verstehe.« Er zögerte. Dann schraubte er die Kappe wieder auf den Füllfederhalter, konzentrierte sich auf seine Finger, als könnten ihm nur seine Augen sagen, was sie machten. »Herr Schatzkanzler … bitte glauben Sie mir, dass ich nicht die Absicht hatte …«
Der Schatzkanzler erhob sich. »Ich glaube, ich muss Sie nicht mehr länger aufhalten.«
Léo faltete das zweite Exemplar des Briefs zusammen und steckte es in seine Jackentasche, dicht neben sein Herz. Dann stand auch er auf. Irgendwo klingelte ein Telefon, eine Sekretärin tippte, die Staatsgeschäfte nahmen ihren Lauf. Es war, als hätte er die Hände von einer Klaviatur genommen und hörte die Musik noch weiterspielen. Er rückte seine Krawatte zurecht. »Nun … danke, Herr Schatzkanzler. Wenn wir einander nicht mehr wiedersehen sollten, viel Glück in der Regierung.«
»Ich danke Ihnen, Léo. Ich hoffe, dass sich unsere Wege irgendwann wieder kreuzen.« Der Schatzkanzler begab sich zum Schreibtisch, setzte sich und griff nach seinem Adressbuch. »Auf Wiedersehen, Léo. Von jetzt an wäre ich an Ihrer Stelle sehr, sehr vorsichtig.«
Léo schloss die Tür hinter sich. Die Sekretärin – Sarah – blickte zu ihm auf und dann rasch wieder nach unten. Er lächelte sie an, doch sie hielt den Kopf gesenkt, kritzelte etwas in ein Notizbuch. Als er an ihrem Schreibtisch vorüberging, sah er über ihre Schulter hinweg, dass es nichts als ein Gekrakel sinnloser Linien war, nicht einmal Stenografie.
Er trat auf den Treppenabsatz. Zwei Beamte kamen die Stufen hinauf, ins Gespräch vertieft. »… Maßnahmen spiegeln immer nur die Zeiten«, sagte der erste und unterbrach sich, um Léo zuzunicken. Der nickte automatisch zurück und sah dann mit einem kleinen Schrecken, dass der zweite, der ein wenig hinterherhing, Emile Fallon war. Es war zu spät, um sich noch wegzuducken. Stattdessen sagte Léo: »Emile, lange nicht gesehen. Wie geht’s, wie steht’s? Ich bin leider sehr in Eile«, alles in einem angespannten Atemzug.
»Ah, Herr Minister«, sagte Emile. »Ja, das stimmt, wir müssen das bald einmal nachholen«, wobei er sich mitten im Schritt zu Leó drehte und ihm im Vorübergehen ein flüchtiges Lächeln zuwarf. In seiner Miene lag etwas Schlimmeres als unverhohlene Boshaftigkeit: Ironie vielleicht, oder – o Gott, das Allerschrecklichste – Mitleid. Eindeutig hatte die Nachricht von Léos Rücktritt bereits im Informationsministerium die Runde gemacht. Léo wartete ab, dass die beiden durch die Tür gegenüber verschwinden würden, hielt sein Lächeln aufrecht, als wäre es ein körperlicher Test.
Er war allein. Leichenblasse Porträts von Staatsmännern beobachteten ihn ungerührt von den Wänden herab. Der dunkle Teppich dämpfte jeden Schall; er hätte genauso gut taub geworden sein können. Er lehnte sich an die Wand; dann glitt er in die Hocke hinunter, und das Blut sang ihm in den Ohren, Übelkeit wrang ihm Schweiß aus allen Poren. Seine Brust schmerzte. Die Luft strömte mit einem leisen Kratzen in seine Lungen und wieder heraus. Er schloss die Augen.
Allmählich ebbte die Übelkeit ab. Er hievte sich wieder auf die Beine und stützte sich mit einer Hand an der Wand ab, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Wenn ihn jemand so sehen würde, wenn der Schatzkanzler herauskäme oder Emile zurückkehrte … Er richtete sich vollständig auf, wischte sich das Gesicht am Ärmel ab und strich sich das Haar glatt. Jetzt konnte ihn nur noch sein feuchter Kragen verraten, und es war ja ein warmer Tag. Er würde an der jungen Frau in der Halle unten vorbeigehen, und sie würde ihn keines zweiten Blickes würdigen. Er konnte so tun, als sei nichts geschehen – als hätte tatsächlich er seine Rücktrittserklärung geschickt und sich dann dem Schatzkanzler erklärt, und man hätte ihn gehen lassen. Er glaubte es beinahe schon selbst.
Doch als er auf dem halben Treppenabsatz angekommen war, veranlasste ihn irgendetwas zu einem Blick zurück. Da auf der Tapete, beinahe schwarz auf dem grünen Muster, war ein dunkler Schmierfleck zu sehen: der Abdruck, den seine verschwitzte Hand hinterlassen hatte, während er versuchte, sich nicht zu übergeben.
* * *
Er rasiert sich, zieht Jackett und Krawatte an und bestellt mehr Kaffee. Das Zimmermädchen bietet ihm ein Frühstück an, doch er kann es nicht über sich bringen, das anzunehmen. Als er den Kaffee getrunken hat, ist die Sonne bereits über die Häuser hinaufgestiegen und scheint auf die Straße. Wärme kriecht den Boden entlang, greift nach ihm. Er kann nicht den ganzen Morgen hier sitzen. Er geht zum Bahnhof und kauft sich am Bücherstand ein Taschenbuch, einen Roman. Eine Reihe von Gepäckträgern erwartet den ersten Zug; die Studenten des zweiten und dritten Studienjahrs müssen wohl bereits letzte Woche angekommen sein, mit ein paar Tagen Zwischenraum. Heute sind die aus dem ersten Studienjahr dran und werden eine Nacht lang die Stadt überschwemmen. Der Zug kommt an, als der Buchhändler Léo gerade das Wechselgeld reicht. Er hält inne, hält die Münzen fest in der Hand und beobachtet, wie die jungen Männer aufgeregt auf den Bahnsteig stürmen. Es sind auch ein paar Familien darunter – blaustrümpfige Schwestern, stolze Mamas, störrische kleine Brüder –, die mitgekommen sind, um ihre schlauen Jungs gebührend zu verabschieden und um, wenn sie schon einmal hier sind, ein paar Tage lang Bergluft zu atmen. Sie dürfen natürlich nicht mit in die Schule hinauf, und sie werden wahrscheinlich nicht einmal wach sein, um den jungen Studenten zum Abschied zu winken, wenn die sich in der Morgendämmerung den Berg hinaufschleppen. »Oh – wie wunderbar«, ruft eine Frau ihrem Sohn zu, während sie über das Tal hinweg auf Montverre-les-Bains schaut. Sie deutet auf das Römische Badehaus in der Ferne. »Das da muss es sein.«
Léo stopft sich das Wechselgeld in die Tasche. Er senkt den Kopf, als er sich in den Menschenstrom einreiht, der durch die Schalterhalle flutet, weil er Angst hat, es könnte ihn jemand erkennen. Aber sie sind alle zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Sie müssen Taxis herbeirufen, Schrankkoffer einladen, die Hotels mit den großartigen Namen finden, ehe die Sonne zu stechend wird. Niemand schenkt Léo einen zweiten Blick. Er duckt sich in ein schmieriges kleines Café und schaut zu, bis sich der Platz vor dem Bahnhof wieder geleert hat und im ruhigen Sonnenschein den nächsten Zug erwartet. Auf dem Tresen liegt eine Zeitung, und er erhascht einen Blick auf die Schlagzeile: Schock: Kulturminister tritt zurück. Aber er streckt die Hand nicht danach aus. Dettler hat ihm vor ein paar Tagen einen Entwurf gezeigt. »Wenn Sie irgendwelche Änderungsvorschläge haben, Herr Minister?«, sagte er und hielt Léo mit dem Feingefühl eines Bestatters einen blauen Stift hin. »Es wird am Montag in der Zeitung stehen; so sind Sie dann sicher – das heißt, Sie werden nicht allzu sehr von der Aufmerksamkeit belästigt.« Aber Léo winkte den Stift fort. Es lag ihm damals nichts mehr daran, was die über ihn sagten; und das ist immer noch so. Er zerrt seine Augen von der Zeitung fort, setzt sich an einen Fenstertisch und schlägt den billigen Roman auf, den er gekauft hat. Es ist eine Übersetzung aus dem Englischen, eine Detektivgeschichte, die Art von Buch, die Chryseïs in einem Satz verschlingt, auf eine Chaiselongue hingekuschelt, mit einer Schachtel Sahnepralinés. Er weiß nicht, was ihn dazu veranlasst hat, das Buch zu kaufen, außer dass ihm keine andere Methode einfällt, sich die Zeit zu vertreiben. Doch nachdem er die erste Seite dreimal gelesen hat, legt er den Roman zur Seite. Sobald das Gesetz zum nationalen Erbe verabschiedet ist, wird man Fiktion bis an die Grenzen des Möglichen besteuern, und ausländische Romane werden praktisch unerschwinglich sein, sogar für Leute wie ihn. Was hatte der Alte gesagt? Wir müssen Methoden finden, um das Spiel unserer Nation wertzuschätzen und zu schützen, das ja, wie Sie wissen, Léo, so viel mehr ist als nur ein Spiel … Damals hatte Léo gedacht, dass er recht hätte; zumindest nicht so unrecht, dass es einen Widerspruch gerechtfertigt hätte. Er widersprach dem Alten nie; auf diese Weise war er so schnell so hoch aufgestiegen. Bis zum Gesetz über Kultur und Integrität.
Er steht auf. Der Kellner, der irgendwo im Schatten herumgesessen und ein Kreuzworträtsel gelöst hat, springt auf die Füße und fragt: »Was kann ich Ihnen bringen, mein Herr?« Aber Léo schlüpft bereits aus der Tür. Die Bahnhofsuhr schlägt zehn. Erst zehn! Vielleicht lässt er sich den Wagen früher schicken. Er geht den Hang hinauf zum Palais Hotel, doch als er dort ankommt, ist das Foyer voller Menschen. Eine stattliche Frau mit einem Federhut auf dem Kopf gestikuliert wild mit dem Besitzer. »Sein Vater hat vor dreißig Jahren in der Arnauld-Suite übernachtet«, sagt sie. »Ich habe die speziell angefordert – ja, aber warum konnte dann das Zimmermädchen nicht …?« Léo wendet sich zur Seite, macht sich nicht die Mühe, auch noch den Rest anzuhören. Er geht die Straße hinauf, bis er das Ende erreicht, eine kleine, heruntergekommene Kirche und ein paar baufällige Häuser. Ein Pfad führt von hier in den Wald hinauf, steigt steil an, doch es gibt keinen Wegweiser. Es könnte eine Abkürzung zur Schule sein, es könnte aber auch nur ein Pfad sein, der die Ziegenhirten auf die hohen Weiden oder nach Montverre-les-Bains führt. Es ist jedenfalls nicht der Weg, den er als Student hier zum Beginn jedes Semesters hinaufgekeucht ist – der Weg, den man ihn heute hochfahren wird, während ihn die Steigung in den Sitz presst und der Chauffeur bei jedem Schlagloch zusammenzuckt. Er kann hier eine Pause einlegen, sich an eine halb verfallene Mauer lehnen, ohne an irgendetwas erinnert zu werden.
Er schließt die Augen. Die Sonne scheint hell durch seine Lider. Er überlegt, ob man im Palais Hotel wohl ein anständiges Mittagessen serviert oder ob es dort die gleiche unverdauliche Mischung von Käse und Pampe geben wird, die man gestern zum Abendessen gereicht hat. »Das beste Hotel in Montverre, Sir«, hatte Dettlers neue Sekretärin gesagt, als sie ihm vorgestern die Fahrkarten und seinen Reiseplan aushändigte, ohne ihm in die Augen zu schauen. »Ich hoffe sehr, es ist angemessen.« Teils würde er ihr gern eine äußerst knappe Notiz schicken, in der er ihr vorschlägt, wenn sie sich bei den Parteifunktionären einschmeicheln wolle, könne er empfehlen, sie nicht Bettwanzen und Sodbrennen auszusetzen; aber das ist der Mühe nicht wert, jetzt ist er ja auch kein Parteifunktionär mehr. Und außerdem ist er heutzutage wirklich verwöhnt. Als er das erste Mal in Montverre übernachtet hat, hatte er nicht einmal ein Hotelzimmer, nur ein Bett in einem stinkigen Anbau, der eindeutig im restlichen Jahr eine Spülküche war, dazu noch in einem Haus, in dem ihn die Familie ohne jegliche Freundlichkeit betrachtete und für die Benutzung der Seife extra einen Obolus haben wollte. Ja, jetzt erinnerte er sich – das hatte ihm einer der Schreiber seines Vaters gebucht, und das musste bedeuten, dass sein Vater Anweisungen gegeben hatte, nicht mehr als nötig auszugeben. Doch es hatte ihm nicht viel ausgemacht, obwohl er bei diesem ersten Mal in der Kälte vor dem Morgengrauen zehn Minuten gehen musste, ehe er beim Wegweiser angekommen war. Er kann sich noch daran erinnern, wie er dazu hochgeschaut hat, Schola Ludi 5½, und dass ihm mit einem kleinen elektrisierten Schock klar wurde, dass er nun endlich wirklich angekommen war. Er war Stunden früher aufgestanden, als eigentlich nötig war, wild entschlossen, als Erster am Schultor anzukommen, und die Sterne waren noch am Himmel. Der ausladende Bogen der Milchstraße war prächtiger und klarer, als er ihn je gesehen hatte. Er stand da und atmete, froh, allein zu sein, den Kopf voller Ehrgeiz und Grand Jeu. Er hatte seinen Schrankkoffer am Tag zuvor beim Rathaus hinterlassen, wo ihn die Gepäckträger abholen würden, hatte also nur einen Rucksack zu tragen. Er klopfte auf das Holz des Wegweisers, damit er ihm Glück bringen würde, holte tief Luft und machte sich auf den Weg, als hätte er vor der Morgendämmerung eine ganze Gebirgskette zu erklimmen.
Seine Schritte wurden rasch langsamer, und das Brennen in seinen Waden breitete sich allmählich nach oben aus. Nach einer Weile vergaß er, sich ringsum umzuschauen, und ging wie im Traum, mit gesenktem Kopf. Beinahe wäre er über seine eigenen Füße gestolpert, als ihn ein unbewusster Impuls aufschauen ließ. Vor sich auf dem Weg sah er jemanden, der die gleiche dunkle Uniform trug. Das Erste, was er verspürte, war Entrüstung. Er wollte der Erste in Montverre sein, nicht dieser dürre Jüngling, der da stocksteif mitten auf dem Pfad stand und ins Nichts starrte. Der Himmel war nun tiefblau, angefüllt mit dem Versprechen des Sonnenaufgangs, und allmählich begannen die Umrisse der Dinge aus den Schatten aufzutauchen. Es hätte wunderschön sein können, aber er wollte allein sein, der Erste …
»Was machst du da?«
Der junge Mann sah sich um. Sein Gesicht hatte etwas Unerwartetes, etwas, das Léo nicht genau ausmachen konnte. »Ich schaue«, erwiderte er. Seine leise Stimme schien über Léos Grobheit zu spotten.
»Was schaust du an?«
Er antwortete nicht. Stattdessen hob er den Arm mit ausgestreckter Hand. Irgendetwas an der Anmut dieser Bewegung erinnerte Léo an die Eröffnungsgeste des Grand Jeu. Hier, sagte sie, das ist meine Schöpfung, und du hast keine andere Wahl, als sie zu bewundern.
Léo blinzelte. »Ich sehe nichts.« Doch dann entdeckte er etwas.
Ein Spinnengewebe. Es war riesig, ein geblähtes Segel aus Silber, das glitzerte und funkelte, wenn die Brise es hin und her zog, das sich quer über den Pfad erstreckte. An jedem Schnittpunkt bebten winzige Tauperlen: blitzend blau, wo das Licht der Himmels sie streifte, dunkel und sternenbesetzt im Schatten. Léo starrte darauf, war erfüllt von einer seltsamen Welle der Begeisterung und Melancholie, etwas wie Heimweh nach einem Ort, an dem er noch nie gewesen war. Es war das Gefühl, das er hatte, wenn er ein perfektes Grand Jeu beobachtete – und dies hier war so symmetrisch und komplex wie ein Spiel, ein perfektes klassisches Spiel. Er wünschte, er hätte es selbst entdeckt; wenn dieser andere Junge nicht hier gewesen wäre …
Er machte einen Schritt nach vorn – spürte, wie sich die Fäden kaum merklich an sein Gesicht schmiegten – und hindurch. Ein zerrissener Fetzen Gaze hing an seinem Ärmel.
»Hast du das nicht gesehen? Du bist mitten durchgetrampelt – da war ein Spinnennetz.«
»Oh«, erwiderte er und zupfte sich die grauen Fäden vom Mantel. »Stimmt. War es das, was du so angeglotzt hast?«
»Es war wunderschön«, sagte der andere Student, als wäre es eine Anschuldigung.
Léo zuckte mit den Achseln. »Ich muss weiter«, sagte er und deutete mit dem Kinn auf den Pfad, der bergauf führte. »Ich denke, wir sehen uns.«
Er spürte, wie der andere ihm hinterherstarrte. Aber was hätte er sonst tun sollen? Die Spinnwebe war über den ganzen Pfad hinweg gespannt gewesen; irgendjemand hätte sie schließlich heruntergerissen. Er weigerte sich, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Er war auf dem Weg bergauf zur Schule, und er würde der Erste sein.
In der Aufregung, dass er durch das Tor schritt und über diese berühmte Schwelle trat, vergaß er diese Begegnung beinahe. Später dann, als er versuchte, den Weg vom Studentenkorridor zum Speisesaal hinunter zu finden, war Felix mit ausgestreckter Hand auf ihn zugesprungen gekommen und hatte in einem Atemzug gesagt: »Bist du auch neu? Ich bin Felix Weber, ich habe mich verirrt, das ist ja hier das reinste Labyrinth, versuchen wir es mal hier«, und sie waren zusammen in einen neuen Flur eingebogen, als sich weiter hinten eine Tür öffnete. Dort stand mit schweren Augen und völlig zerzaust der junge Mann, den er auf dem Pfad getroffen hatte. Automatisch wanderten Léos Augen zu dem Namen über der Tür. Aimé Carfax de Courcy. »Du bist es«, sagte er dümmlich. »Hallo.«
»Ich bin Felix Weber«, sagte Felix. »Wir wollen uns etwas zu essen suchen. Bist du auch im ersten Studienjahr?«
Er schaute zu Léo und nickte dann. »Carfax«, erwiderte er.
»Carfax de Courcy?«, fragte Léo und deutete auf die adretten weißen Druckbuchstaben. »De Courcy, wie der Wahnsinnige von der London Library?«
»Edmund Dundale de Courcy war mein Großvater.«
Léo pfiff leise durch die Zähne. Neid durchzuckte ihn. Was hätte er nicht darum gegeben, wenn er kraft seines Geburtsrechts hier sein könnte, nicht nur wegen seiner Prüfungsergebnisse? Er grinste, versuchte das zu verbergen. »Nun, dann will ich mal hoffen, dass sie dich am Eingang nach Streichhölzern gefilzt haben.«
Carfax schaute ihn an, ohne zu lächeln. Ohne ein weiteres Wort drängte er sich an ihnen beiden vorbei und verschwand um die Ecke.
»Was ist denn mit dem?«, fragte Léo. Er hatte doch nur lustig sein wollen, und sicher sollte doch niemand wegen einer Sache so empfindlich sein, die vor Jahrzehnten passiert war? »Es war ein Witz.«
»Der hat offensichtlich den Hang zum Wahnsinn geerbt«, meinte Felix und schaute Léo an. Sie begannen beide gleichzeitig zu lachen, Felix mit einem hohen, japsenden Kichern, das von den Wänden widerhallte.
Aber es stimmte, denkt Léo nun. Oder nicht? Die Anzeichen waren verdammt offensichtlich, schon damals.
Er schlägt die Augen auf. Die plötzliche Helligkeit blendet ihn; er blinzelt und wischt sich die Tränen fort, die ihm automatisch gekommen waren. Nach einem Augenblick verfestigen sich die wabernden Formen wieder zu Häusern und Bäumen.
Aus dem Augenwinkel nimmt er eine Bewegung wahr. Ein Mann zieht sich rückwärts in ein schattiges Fleckchen zurück. Eine Sekunde später geht er auf ein Knie und nestelt an seinen Schnürsenkeln herum. Doch obwohl er den Kopf gesenkt hat, huschen seine Augen immer wieder zu Léo. Er bleibt eine unglaubwürdig lange Zeit da unten, ehe er sich wieder aufrichtet und eine Zigarette anzündet. Der Rauch weht über den Pfad, gräulich im Sonnenschein.
Ein Aufpasser. Das sollte ihn nicht überraschen. Doch irgendwie tut es das doch, und ein wütender Schrecken steigt ihm wie Übelkeit aus dem Magen hoch. Er will schreien oder einen Stein werfen, als wäre der Mann ein Geier, den er verjagen kann. Er krampft den Kiefer zusammen. Dumm. Kindisch. Natürlich schicken sie jemanden los, der ihm folgt, natürlich wollen sie sichergehen, dass er sich wirklich nach Montverre begibt. Möglicherweise ist es sogar eine Form der Höflichkeit, dass man ihm erlaubt, die Überwachung zu bemerken. Oder eine Warnung. Tu, was man dir sagt. Sonst gibt es da steile Klippen und trügerische Pfade … Er hält an der Wut fest, denn er weiß, dass er darunter Furcht verspürt. Und als er sich umwendet, um den Pfad zum Dorf hinunterzugehen – und so nah an dem Mann vorübergeht, dass er ihm beinahe die Zigarette zu Boden schlägt –, zuckt der andere ein wenig zusammen, und Léo ist froh.
* * *
Er bestellt den Wagen eine Stunde früher. Er isst im Hotelrestaurant zu Mittag, blickt dabei auf das Dorf am Hang, schaut auf den aufsteigenden Dampf, als der nächste Zug in den Bahnhof und wieder fort schnauft. Noch mehr Studenten aus dem ersten Jahr überfluten die Straßen, während er an schlechtem Kaffee und Kognak nippt. Endlich schlägt die Uhr, er bezahlt seine Rechnung und macht sich auf den Weg hinaus zum Wagen. Der Chauffeur hat seine Koffer bereits eingeladen. Léo steigt ein und schließt die Augen. Die Straße, die den Berg hinaufführt, ist so steil und holprig, wie er sie in Erinnerung hat. Eine Melodie schwirrt ihm durch den Kopf, beinahe, aber nicht ganz im Rhythmus mit den Schlaglöchern. Schon wieder Die Brücken von Königsberg. Er schlägt die Augen auf und blickt aus dem Fenster, versucht sich abzulenken, doch das Spiel hat ihn gepackt und lässt ihn nicht mehr los. Diese verdammte Melodie, der Spielzug zum Eulerschen Weg, der mathematische Beweis, der große Bogen der preußischen Geschichte. Das Spiel ist unelegant, ungeschickt, und er hat es immer schon gehasst. Es ist das meistüberschätzte Spiel, das je gespielt wurde. Während sie die letzte Kurve nehmen und in Sichtweite des Tores kommen, erreicht die Melodie ein Crescendo. Der Chauffeur steigt aus und klopft an die Tür des Torhäuschens, um zu bitten, dass man ihnen öffnet. Léo steigt ebenfalls aus, verspürt plötzlich eine verzweifelte Gier nach frischer Luft. Die Musik singt in seinen Ohren. Er dreht sich um, schaut auf den Weg, den sie gekommen sind, hinunter zum Tal, zum Wald und zu den verstreuten Wasserfällen, wo die Straße aus dem Blickfeld verschwindet. Es ist beinahe die Aussicht, die er als Student aus seiner Zelle hatte. Die Luft ist hier oben dünner, und das Atmen fällt schwer.
Die Tore öffnen sich. Der Chauffeur sagt: »Entschuldigen Sie bitte, Sir«, und nimmt wieder auf dem Fahrersitz Platz.
Die Melodie legt eine Pause ein, um gleich wieder mit frischer Giftigkeit einzusetzen. Léo bleibt, wo er ist. Gleich wird er sich umdrehen und den Torwächter anlächeln, sich von einem der Bediensteten zu seinen Räumen geleiten lassen, sich charmant und bescheiden und beinahe schmerzhaft begeistert vom Grand Jeu zeigen. Doch dies ist sein letzter Augenblick in Freiheit, und er will ihn so lange wie möglich ausdehnen.
Dann begreift er, warum sich von allen Spielen der Welt ausgerechnet Die Brücken von Königsberg in seinem Kopf festgesetzt hat. Es liegt nicht nur an seinem Unterbewussten, das ihm ein höhnisches Geschenk gemacht hat, ein Spiel, das er stets verachtet hat. Es liegt am Thema des Spiels: dem unmöglichen Problem, das einen immer und immer wieder zu denselben Brücken bringt und dem man nie entfliehen kann.
3 Magister Ludi
Sie steht an einem Fenster auf dem mittleren Korridor, blickt über den Innenhof zum Großen Saal und lässt sich von einer Brise die feuchte Stirn und den Nacken kühlen. Sie schiebt einen Finger unter das Band ihres Baretts und wünscht, sie könnte es absetzen, weil das heiße Gewicht ihres Haars sie irritiert. Das Unterhemd klebt ihr am Leib. Sie hat in dem Klassenzimmer, das hinter ihr liegt, gearbeitet und den letzten ruhigen Tag vor dem Beginn des Semesters genossen, die Stille fern vom Lachen und Lärm der Studenten, aber schließlich hat die schwüle Hitze der Sonne sie vertrieben. Sie legt ihre Notizen auf das Fenstersims und atmet tief ein. Die Luft, die sie umspielt, trägt schon eine leichte, köstliche Kühle in sich. Auf dieser Seite, im Schatten, kann man riechen, dass der Herbst kommt.