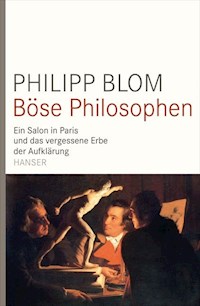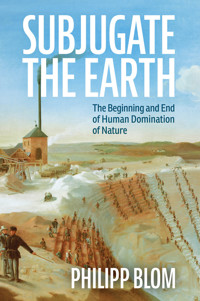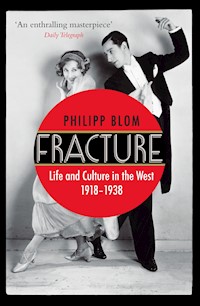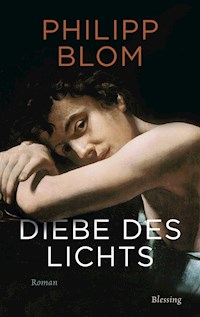Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
„Das große Welttheater ist ein Ort, an dem die Welt sich neu erfinden kann.“ Philipp Bloms Analyse der gegenwärtigen Umbrüche
Wir leben in der besten aller Welten: Nie zuvor gab es so lange Frieden bei uns, nie waren wir so reich, so sicher. Diese Geschichten erzählen wir uns selbst. Was aber, wenn sie nicht der Wirklichkeit entsprechen? Wenn die Demokratien bröckeln, der Hass zwischen den sozialen Gruppen wächst, das Wirtschaftswachstum stagniert, die Gefahr einer Klimakatastrophe steigt? In seinem großen Essay zeigt Philipp Blom, wie es möglich ist, dass der Westen nicht trotz, sondern wegen Frieden und Wohlstand in einer Krise steckt. Nichts in unserer Vergangenheit hat uns darauf vorbereitet. Die Zeichen stehen auf Sturm, und der Kampf um die Zukunft wird auch ein Kampf der Geschichten sein, vor aller Augen, auf der Bühne des Welttheaters.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
»Das große Welttheater ist ein Ort, an dem die Welt sich neu erfinden kann.« Philipp Bloms Analyse der gegenwärtigen UmbrücheWir leben in der besten aller Welten: Nie zuvor gab es so lange Frieden bei uns, nie waren wir so reich, so sicher. Diese Geschichten erzählen wir uns selbst. Was aber, wenn sie nicht der Wirklichkeit entsprechen? Wenn die Demokratien bröckeln, der Hass zwischen den sozialen Gruppen wächst, das Wirtschaftswachstum stagniert, die Gefahr einer Klimakatastrophe steigt? In seinem großen Essay zeigt Philipp Blom, wie es möglich ist, dass der Westen nicht trotz, sondern wegen Frieden und Wohlstand in einer Krise steckt. Nichts in unserer Vergangenheit hat uns darauf vorbereitet. Die Zeichen stehen auf Sturm, und der Kampf um die Zukunft wird auch ein Kampf der Geschichten sein, vor aller Augen, auf der Bühne des Welttheaters.
Philipp Blom
Das große Welttheater
Von der Macht der Vorstellungskraft in Zeiten des Umbruchs
Paul Zsolnay Verlag
Für Ann-Sophie
Das neue Klimaregime stellt nicht die zentrale Position des Menschen in Frage, sondern hinterfragt dessen Zusammensetzung, Präsenz, Gestaltung und letztlich dessen Schicksal. Wenn sie alles verändern, ändern sie auch die Definition seiner Interessen.
Bruno Latour
Ein Wort voraus
Die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler, und Markus Hinterhäuser, der Intendant, haben mich gebeten, zum 100. Jubiläum der Festspiele einen Essay mit dem Titel »Das große Welttheater« zu verfassen. Sie haben mir bei der Themenwahl freie Hand gelassen, ein Vertrauensbeweis, für den ich ihnen hier Dank sagen möchte.
»Das große Welttheater« — das ist ein gewichtiger, weit offener, aber auch verpflichtender Titel. Ich möchte den Salzburger Festspielen deswegen Überlegungen widmen, die über die unmittelbaren Fragen der Bühnenkunst hinausgehen. Hugo von Hofmannsthal schrieb, die Festspiele sollten ein Friedensprojekt in unsicheren Zeiten sein. Ihr hundertjähriges Jubiläum fällt wieder auf einen historischen Moment des Umbruchs, den rapiden Kollaps einer kollektiven Erzählung, der Wachstumsökonomie, der industriellen Moderne und ihrer Strukturen, der Herrschaft über die Natur.
Um aber eine unabänderliche Transformation denken zu können und um sie fühlen zu lernen, müssen neue Bilder angeboten, Räume für Experimente geöffnet werden, die eine Verbindung zwischen Begriffen und Gefühlen schaffen. Genau das können Bühnen, ob real oder metaphorisch. Die Geschichte eines neuen Zusammenlebens aber braucht sie, um entstehen zu können und denkbar zu werden.
Max Reinhardt, der zweite Gründervater der Salzburger Festspiele, schrieb 1917, er glaube nicht, dass »der ungeheure Weltenbrand für die Dauer ohne dichterischen Wiederschein bleiben wird«. Heute droht ein neuer Weltenbrand, und die Welt braucht nicht nur poetische Resonanz, sondern schöpferischen Mut, um einer neuen globalen Krise auch auf der Bühne der kulturellen Debatten und politischen Fantasie zu begegnen. So können die Salzburger Festspiele und andere zentrale Orte der Hochkultur tatsächlich, wie Reinhardt es formulierte, »nicht nur ein Luxusmittel für die Reichen und Saturierten, sondern ein Lebensmittel für die Bedürftigen« sein.
Deswegen erschien es mir angemessen und sinnvoll, das Zeitgeschehen als großes Welttheater zu verstehen und darüber nachzudenken, welche Geschichten sich Gesellschaften erzählen, welche Bilder sie schaffen, wie diese Geschichten eine Landkarte von Gegenwart und Zukunft zeichnen und was sie verbergen. Schon jetzt drängen sich Figuren und Ideen auf die Bühne der öffentlichen Aufmerksamkeit und der kollektiven Ambitionen, die verschieben, was möglich ist, was als normal angesehen wird und was als sinnvoll — nicht nur in der Politik.
Nach dem klassischen Verständnis des Dramas ist die Welt längst in der Krisis angekommen. Was aber danach kommen mag, eine Katastrophe oder der Schimmer einer Katharsis, ist völlig offen. Das Welttheater wartet auf Akteure, um eine andere Erzählung zu beginnen.
Narzisstische Kränkung Eins
Drehmoment und Angelpunkt
»Und sie bewegt sich doch«, soll der untersetzte italienische Gelehrte 1633 gesagt haben beim Verlassen des Gerichtssaals. Das ist wohl eine Erfindung, eine postume Legende. Der Prozess aber fand tatsächlich statt.
Galileo Galilei sollte der ketzerischen Meinung abschwören, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht andersrum. Er wurde gezwungen zu widerrufen, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist, dass die Menschheit nicht Zentrum und Ziel der Schöpfung bildet, dass Jerusalem nicht der Omphalos des Weltalls ist, wie auf mittelalterlichen Karten abgebildet.
Schon Archimedes hatte gemeint, mit einem einzigen festen Punkt könne er die Welt aus den Angeln heben. Jetzt war sie aus den Angeln gehoben worden.
Ich denke nach über die Dinge im Land
Wandlungen geschehen
Nichts ist wie im Vorjahr
Ein Jahr lastet schwerer als das vorige
Die Welt ist voller Unheil
Klage überall
Wehgeschrei
Totenklage
Das Gesicht schreckt zurück vor dem, was geschieht.
Chacherperreseneb, Ägypten, um 1800 vor Christus
In einem längst verschwundenen Theater
Ich kannte den Bruder meiner Großmutter nur aus Geschichten, denn er war lange vor meiner Geburt gestorben, noch bevor die Nazis gekommen waren. Er war verunglückt, als dreizehnjähriger Junge (wie mir immer wieder warnend eingeschärft wurde), als er sich mit seinem Fahrrad an einem fahrenden Lastwagen festgehalten hatte, an einem aus ihm ragenden Balken. Man hat mir nie erklären können, was genau passiert war, ob der Lkw gebremst oder er einfach die Kontrolle über sein Rad verloren hatte. Er war sofort tot gewesen.
Der so tragisch ums Leben gekommene ferne Großonkel hatte etwas hinterlassen, was ihn mir als Kind sehr nahe brachte. Er war ein begabter Zeichner gewesen und hatte eine bewegliche Szenerie aus kunstvoll ausgeschnittenem und bemaltem Papier gebaut, mit den verschiedensten Figuren und fünf auswechselbaren Landschaftsprospekten, auf denen große Horizonte, Prärien und ein Gebirge angedeutet waren, davor zerklüftete Felsen und Büsche, die sich wie Kulissen verschieben ließen, Bäume und Blockhütten und eine Büffelherde. Dies war der Wilde Westen, wie ihn sich ein Kind um 1930 vorgestellt hatte, und die Figuren auf ihren Pferden, die wie der Wind über die Ebene galoppierten, waren schwer bewaffnete Cowboys und Indianer mit fliegendem, schwarzem Haar.
Und gleich verband mich etwas mit diesem vor Jahrzehnten gestorbenen Kind, denn zwei Generationen später las auch ich die Romane von Karl May, dem verurteilten Hochstapler und unermüdlichen Romanschreiber der Gründerzeit, der seinen ganzen Wilden Westen in symphonischem Technicolor erfunden hatte, obwohl er selbst niemals in den USA gewesen war, und der seine Abenteuer vor einer großen Leserschaft ausbreitete.
Wie viele Jungen seiner Generation war auch mein ferner Onkel ein Verehrer dieser imaginären Welt gewesen und hatte die Luft der Freiheit um seine Nase gespürt, die durch diese Geschichten wehte. Mit seinem kleinen Theater hatte er dieser Sehnsucht einen Altar gebaut. Nur selten durfte ich mit seinem Wunderwerk spielen, das wie eine Reliquie aufbewahrt wurde. Nur nach heftigem Bitten und Betteln durfte ich sie mir ansehen und aufstellen, vorsichtig, damit es nicht einriss, immer unter der ängstlichen Aufsicht von Erwachsenen.
Was einer Generation kostbar war, wurde von der nächsten auf den Müll geworfen. Das kleine Theater mit seinen prächtigen Kulissen ist längst verrottet in irgendeiner Mülldeponie im Norden Deutschlands. Ich kann es nicht mehr aufbauen, es ist ein Theater meiner Erinnerung. Ich sehe die Felsen noch vor mir, zerklüftet in schwarzer Tinte gezeichnet und dann in verschiedenen Schattierungen von Grau und Braun mit Wasserfarben koloriert, ausgeschnitten und präzise auf einen Ständer aus Pappe geklebt, ebenso die Hütten und Büsche, die Büffelherde und die Cowboys um sie herum, die Indianer mit ihren Wigwams und Lagerfeuern und Pferden, die an zwei Stangen einen Schlitten hinter sich herziehen.
In meiner Erinnerung sind die Landschaften des Papiertheaters so erhaben wie die Fotos von Ansel Adams, auch wenn der junge Zeichner wohl andere Quellen der Inspiration hatte. Er konnte vielleicht Fotos in Illustrierten oder in Bildbänden ausfindig machen, Landschaften in Westernfilmen im Kino, die allerdings selbst schon Kulisse waren, professionell gescoutet und abfotografiert oder überhaupt gemalt. Die Landschaft seiner Kindheit, das flache Land um Hamburg herum, wird ihm kaum Ideen dafür gegeben haben.
Für mich als Kind der 1970er Jahre war die Idee von Abenteuer nicht so sehr mit dem Wilden Westen verbunden, sondern mit Asterix und Obelix, mit Astrid Lindgren und mit den Fernsehserien, die ich bei meinen Cousins in den Niederlanden sah, The Incredible Hulk und The Persuaders, alles Eindrücke, die mein ferner Onkel noch nicht gekannt hatte. Aber er hätte sie verstanden, weil seine und meine Geschichten gemeinsame Ursprünge haben, nicht nur in den Romanhelden und Filmen, die wir beide kannten, sondern auch in unserer täglichen Erfahrung.
Wir wurden mit fünfzig Jahren Abstand in derselben Stadt geboren, und auch wenn sich das Stadtbild durch die Bombardierung des Zweiten Weltkriegs geändert hatte, so stand nicht nur das Haus, in dem mein Onkel sein kurzes Leben verbracht hatte, noch immer. Wenn ich dort im Garten spielte, sah ich dieselben Bäume, roch den gleichen Geruch nach Herbstlaub und bitteren Walnüssen, sah denselben fahlen und doch ewig wechselhaften Himmel.
Auch Familiengeschichten verbanden uns. Manche von ihnen, sorgfältig auf Hochglanz gebracht, reichten fast ein Jahrhundert zurück, zentrale Stücke in einem ganzen Repertoire. Es gab Abenteuergeschichten und Geschichten von Aufstieg und Fall, Reiseerzählungen, peinliche Begebenheiten und kleine Abenteuer, tragische Unfälle und Seitensprünge, Liebesgeschichten und einen Selbstmord, Männergeschichten aus dem Krieg (wenige, selten) und Frauengeschichten aus dem Krieg (viele und häufig).
Es gab Kindheitsgeschichten und Fluchtgeschichten; es gab Geschichten, für die die Erwachsenen die Sprache wechselten oder miteinander zu tuscheln begannen, unanständige Geschichten und Details, über die sie aus mir unerklärlichen Gründen mit roten Gesichtern lachten, Schnurren über die schwarzen Schafe der Familie und sogar über Verbrechen, große und verzweigte Epen über Schuld und Sühne, in Andeutungen wiedergegebene Schilderungen von Verrat und langsamem Verfall.
Neben diesem Familienrepertoire gab es auch eine andere Art von Geschichten, wie ich beim mehr oder weniger heimlichen Belauschen der Erwachsenengespräche herausfand. Es gab umstrittene Geschichten, die eine Person so und eine andere ganz anders erzählte, Begebenheiten oder Zitate, die unterschiedlichen Leuten zugeschrieben wurden, über deren Beurteilung Erzähler und Publikum uneins waren, Geschichten, die in verschiedenen Versionen zirkulierten, über die man nur Andeutungen machte, die wie Löcher in der Unterhaltung klafften.
Am stärksten war das bei meiner Mutter und meinem Vater. Ihre nach vierzehn Jahren geschiedene Ehe wurde im Lauf der Jahre zu einem Schlachtfeld der Erinnerung. Beide appellierten mit immer dringlicheren Erzählungen an mich, sie zum moralischen Sieger zu erklären. Beide brauchten das Gefühl, im Recht zu sein, die Bestätigung von ihrem Kind, dass nur sie moralisch und gut und vor allem zu meinem Wohl gehandelt hatten. Beide sagten mir immer wieder, dass sie nie so tief sinken würden, schlecht übereinander zu reden, nur um mit dem nächsten Satz zum Sinkflug anzusetzen.
Meine Mutter berichtete, verklausuliert zuerst, dann mit den Jahren immer direkter, wie er sie gedemütigt und belogen hatte, wie sie für seinen ausschweifenden Lebensstil und seine Schulden hatte schuften müssen, wie er immer alles bekam und sie nie etwas, wie er sie runtermachte und wie ein dummes Kind behandelte.
Mein Vater erzählte mir diese Begebenheiten von der entgegengesetzten Perspektive, so, als wäre die Wirklichkeit einfach umgedreht worden wie eine Drehbühne oder eine Zeichnung, die unterschiedliche Bilder zeigt, je nachdem, was der Betrachter in den Linien sucht und sieht. In seiner Version hatte er alles getan, um die Ehe zu retten, waren seine Fehltritte nur die Reaktion auf ihre gewesen, hatte er gerackert wie ein Schwerarbeiter, hatte sie geschützt und ihr geholfen und sie auf Händen getragen, nur um völlig grundlos von ihr verlassen zu werden, mit seinem Kind, seinem Sohn, seinem Ein und Alles, mit mir.
Diese Geschichte ist, wie fast alle Familiengeschichten, vollkommen banal. Sie ist kompliziert und verwinkelt, so wie die meisten Familiengeschichten kompliziert und verwinkelt sind, wenn man einmal anfängt zu graben, Mythologien, die sich in unsicheren Grenzgebieten und Erinnerungssümpfen verlieren. Ich könnte einen ausladend barocken Roman über diese Familie und ihre Geschichten schreiben, und doch ist sie nur für mich besonders, weil ich ihre Protagonisten kenne, ihre Stimmen in den Ohren habe, ihre Art zu gehen, ihren Geruch. Dieses Universum ist real für mich, weil ich unmittelbare Eindrücke mit den Helden und Schurken der Erzählungen verbinde, weil ich mit ihnen einen Resonanzraum gemeinsamer Erinnerungen teile. Tatsächlich aber ist absolut nichts besonders an ihnen.
Tolstoi meinte, jede Familie sei auf ihre ganz eigene Art unglücklich, aber seine schöne Formulierung ist längst durch Statistiker widerlegt worden. Was von meinen Eltern und von mir als einzigartig erlebt wurde, passt exakt zu den demographischen und sozialen Trends der Zeit. Sie trafen ihre individuellen Entscheidungen, studierten, heirateten, bekamen Kinder, ließen sich scheiden, als die Trends es dekretierten. Ihre Berufe, ihre Todesursachen, ihre Vornamen, die Bücher in ihren Regalen und ihr Einkommen — typisch für Menschen ihrer Generation, Klasse und Herkunft, dem allgemeinen demographischen Muster ihrer vom Krieg und später von Vietnam, Woodstock und dem deutschen RAF-Terrorismus geprägten Generation.
Aber wenn sie schon durch nichts auffällig wurden und sich für jede ihrer vielen Eigenheiten und Eskapaden ein historischer oder demographischer Faktor finden lässt — was sie zu meiner Familie machte, waren die norddeutschen, holländischen, plattdeutschen Akzente, in denen sie erzählt wurden, ihr Lachen und ihre Eigenarten, die unerwartete Ähnlichkeit in Mimik oder Gesten, das Gefühl der gemeinsamen Erfahrung, der Zusammengehörigkeit, die verschiedenen Versionen derselben Anekdoten, die Andeutungen und Redensarten, die alle teilten. Was sie einzigartig machte, war, dass ich unter ihnen und nicht unter anderen aufwuchs.