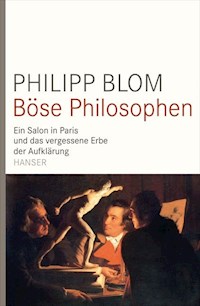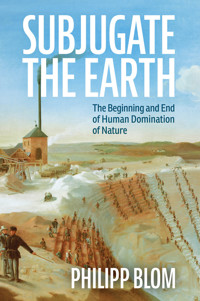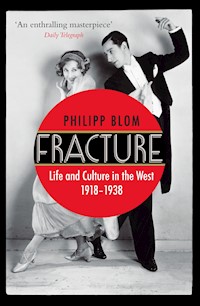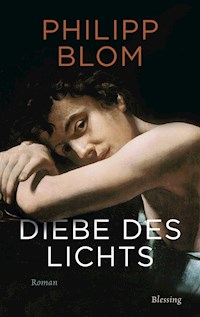Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Um 1700 machte sich ein Geigenbauer aus dem Allgäu auf den Weg nach Italien. Seinen Namen kennen wir nicht, aber eines seiner Instrumente: gebaut in süddeutscher Tradition, aber vermutlich in Venedig fertiggestellt. Es legt Zeugnis ab von einem Netzwerk, in dem bereits vor mehr als drei Jahrhunderten Menschen, Waren und Wissen durch Europa zirkulierten.
Philipp Blom hat diese Geige entdeckt und kommt von ihrem Klang nicht mehr los. Nun hat er ihre Geschichte erforscht. Sie handelt von Migration, von der Lebenswelt der Handwerker, aber auch von Venedig, der damaligen Hauptstadt der Musik. Die Suche nach dem namenlosen Geigenbauer liefert den Schlüssel zu einer ganzen Epoche – die unserer Gegenwart gar nicht so fremd ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Es muss um 1700 gewesen sein. Kriege und Krankheiten waren über Deutschland hinweggezogen, und so machte sich ein Geigenbauer aus dem Allgäu auf den Weg nach Italien. Seinen Namen kennen wir nicht, aber eines seiner Instrumente: gebaut in süddeutscher Tradition, aber vermutlich in Venedig fertiggestellt. Es legt Zeugnis ab von einem Netzwerk, in dem bereits vor mehr als drei Jahrhunderten Menschen, Waren und Wissen durch Europa zirkulierten. Vor einigen Jahren hat Philipp Blom diese Geige entdeckt und kommt von ihrem Klang nicht mehr los. Nun hat er ihre Geschichte erforscht. Sie handelt von Migration, von der Lebenswelt der Handwerker, aber auch von Italien und Venedig, der damaligen Hauptstadt der Musik. Die Suche nach dem namenlosen Geigenbauer liefert den Schlüssel zu einer ganzen Epoche – die unserer Gegenwart gar nicht so fremd ist.
Hanser E-Book
Philipp Blom
Eine italienischeReise
Auf den Spuren des Auswanderers, der vor 300 Jahren meine Geige baute
Carl Hanser Verlag
»Biographie« hieß ein Buch über das Leben von irgendeinem Menschen. Nur wurde es für mich zu einer Art Suche, einem Nachspüren der Fährte, die jemand in der Vergangenheit hinterlassen hatte, ein Verfolgen seiner Fußspuren. Du wirst sie nie einholen; nein, du wirst sie nie ganz einholen. Aber vielleicht, wenn du Glück hast, kannst du über die Suche nach dieser nicht greifbaren Figur so schreiben, dass sie in der Gegenwart lebendig wird.
Richard Holmes, Footsteps, S. 27
Für Marcel
Inhalt
Eine Geige
I Eine Begegnung
II Lautenspäne
III Den Haag
IV Lektüre
V Eine Stadt voller Geister
VI Totentanz
VII Nichts als zerklüfteter Stein
VIII Mailand
IX Sei Solo
X London
XI Der Scharlatan
XII Ein Akzent
XIII Verbindungen
XIV Der gewisse Schwung
XV Paris, über das Scheitern
XVI Venedig
XVII Herkules und seine Keule
XVIII Eine Vatersuche
XIX Signaturen
XX Eine Werkstatt
XXI Stimmriss
XXII Verschlungene Pfade
XXIII Die Möglichkeit eines Gesichts
XXIV Über Fetischismus
XXV Calle dei Stagneri
XXVI Bassano
XXVII As you like it
Danksagung
Bibliographie
Abbildungen
Dies ist die Geschichte einer Leidenschaft. Es ist die Suche nach einem Menschen, eine Reise in eine Welt, die drei Jahrhunderte zurückliegt. Es ist eine Erkundung auf den Spuren eines Mannes, dessen Leben und Sterben scheinbar spurlos von den Gezeiten der Ereignisse weggespült wurde. Nichts und niemand erinnert mehr an ihn – außer dem Instrument, das seine Hände gebaut haben und das heute in meinen Händen liegt.
Dieses Buch ist kein Roman. Ich habe nichts dazuerfunden, erlogen, erdichtet oder ausgeschmückt. Wo immer möglich habe ich mit historischen Dokumenten gearbeitet. Spekulation ist als solche ausgewiesen. Einige Unterhaltungen, die ich im Laufe der Recherchen geführt habe, werden hier nacherzählt, nach Notizen und aus dem Gedächtnis.
Und noch etwas: Die Geige, um die es geht, ist keine Stradivari, und ja: Es könnte alles ganz anders gewesen sein.
Aber eins nach dem anderen. Vorhang auf für eine bescheidene Arie, die Beschreibung des Objekts, das gleichzeitig Anfang und Ziel dieser Reise ist.
Eine Geige
Der Körper leuchtet in einer goldenen Bernsteinfarbe, die Decke ist aus dicht gemasertem Fichtenholz gearbeitet, der Umriss hat einen schönen Schwung, die f-Löcher rechts und links vom Steg, über den die Saiten laufen, sind sehr aufrecht, klar geschnitten und in ihrer Linienführung gut ausgewogen. Rücken und Zargen des Instruments bestehen aus schön geflammtem Ahorn, in dessen Reflexionen sich die hervorragende Qualität des Lacks zeigt. Dies ist das Werk von jemandem, der sein Fach beherrscht.
Die Proportionen des Korpus sind elegant und mit klarem Formbewusstsein ausgeführt, die flache, spannungsreiche Wölbung erinnert an Instrumente der Amati-Schule. Auffällig sind die stark geschnitzten, expressiven und fast eigensinnigen Ecken, die abstehen wie die Flügel eines Stehkragens. Die Schnecke, die den Abschluss des Instruments bildet, oben am Wirbelkasten, ist bemerkenswert klein, eng gewunden und schmal; fein geschnitzt, sehr ungewöhnlich. Schnecke und Korpus gehören zusammen, wie sich unter UV-Licht zeigt, ist der Lack noch größtenteils original.
Eine Ansicht des Inneren ergibt einerseits, dass das Instrument einen Stimmriss hatte, ein potenziell kritischer Schaden, der hier aber perfekt repariert wurde, von außen fast nicht zu erkennen ist. Die Innenansicht offenbart auch zwei Zettel, die schon vor sehr langer Zeit in das Instrument eingeklebt wurden. Direkt unter dem linken f-Loch, so platziert, dass das Tageslicht darauf fallen kann, findet sich der übliche gedruckte Geigenbauer-Zettel, in diesem Falle:
Carlo Giuseppe Testore in Contrada largii (? schwer lesbar)
in Milano al segno dell’ Aquila, 1605
Die letzten beiden Ziffern sind handschriftlich eingetragen. Darüber klebt ein zweiter Zettel:
Reparirt
H. Voigt Geigenmacher
Wien, 1882
Derselbe H. Voigt hat sich auf dem Hals des Instruments auch mit einem kleinen Brandzeichen verewigt, wohl um zu zeigen, dass er es war, der dieses Instrument im Jahr 1882 modernisiert und ihm dabei auch, wie bei fast allen barocken Geigen geschehen, einen neuen, etwas längeren und vor allem etwas stärker zurückgeneigten Hals angeschäftet hat, wobei er den alten Wirbelkasten und die originale Schnecke sorgfältig an den neuen Hals anpasste. Es ist ein gutes Stück Arbeit, auch wenn im Zuge dieser Restauration wohl ein kleines Fragment an der Schulter des Instruments beschädigt und von Voigt ersetzt wurde.
Das Instrument wurde vor einigen Jahren von Grund auf restauriert und ist in hervorragendem Zustand.
IEine Begegnung
»Ach die?«, sagte MR beiläufig, »die ist ganz interessant. Sie wurde um 1700 in Italien gebaut, aber von einem Deutschen.«
Mit diesem Satz begann es, begann meine Reise, auch wenn ich das noch nicht wissen konnte. Jahrelang kam ich jetzt schon hierher, zu diesem unscheinbaren Haus, in dem so viele Fäden meines Lebens zusammenliefen, obwohl ich höchstens als Amateur zugelassen war in diesen heiligen Hallen, denn hier gingen die größten Musiker ein und aus.
Ich selbst hatte einmal Musiker werden wollen und hatte alles darangesetzt als junger Mann, musste aber schließlich einsehen, dass meine Begabung trotz aller Willenskraft und Anstrengung nicht ausreichte. Ich war Historiker geworden und Schriftsteller. Für meine ehemals große Liebe, die Geige, blieb mir immer zu wenig Zeit, wenn ich auch immer noch spielte, allein oder mit Freunden. In diesem Haus aber verkehrten die größten Virtuosen. Nein, ich war ein Amateur, ein Gast.
MRs Werkstatt befindet sich nicht in der Innenstadt, mit einem polierten Messingschild und adretten Empfangsdamen, wie es sich manche seiner Kollegen leisten. Sie liegt in einem anonymen Vorstadthaus verborgen, direkt neben einer Fabrik, in einem Viertel mit Billigläden, Handwerksbetrieben, bosnischen Cafés, türkischen Bäckereien, Thai-Massage-Salons und Discount-Supermärkten. Keine sehr feine Gegend. Und doch kommen die erstaunlichsten Musiker hierher, und doch gibt es in diesem Haus jemanden, der die größten Meisterwerke der Instrumentenbaukunst zu reparieren versteht, Stimmen aus vier Jahrhunderten, alle großen Namen, eine unsichtbare Gemeinde aus Lebenden und Toten. Das einzige Namensschild, das auf seine Existenz hinweist, ist das an der Klingel, neben der unscheinbaren, aber dick gepanzerten Haustür.
Ich hatte diesen Klingelknopf im Laufe der vergangenen Jahre oft gedrückt, nicht nur, um meine eigene Geige reparieren zu lassen (MR war nicht beeindruckt von meinem bescheidenen Instrument und bemerkte nur: »Wenn einer meiner Lehrlinge das so lackiert hätte, würde ich ihm sofort sagen, er soll den Lack wieder abnehmen und von vorne anfangen«), sondern auch immer wieder aus Neugier, weil ich mich für Instrumente interessierte, weil ich Werkstätten mochte. MR gab mir dann einen guten, bitteren Espresso aus einer chromglänzenden italienischen Maschine. Ab und zu nahm er auch eine seiner wunderbaren Geigen aus dem großen Safe, dem Allerheiligsten, nicht selten ein Instrument von einem legendären Geigenbauer. »Das Anspielzimmer ist gerade frei«, sagte er dann mit einem einladenden Zwinkern, »du kannst dir Zeit nehmen und sie ausprobieren.«
So hatte ich über die Jahre viele große Cremoneser und andere Meisterwerke in Händen gehalten. Nicht alle von ihnen klangen großartig, einige der Stradivaris und andere Instrumente dieser Kragenweite hatten einen erstaunlich durchschnittlichen Klang, vielleicht, weil ich nicht gut genug spielen konnte, vielleicht, weil Beschädigungen und viele und schlechte Restaurierungen sie ruiniert hatten, vielleicht aber auch, weil auch diese Instrumente nicht ausnahmslos großartig waren und man sie gelegentlich nicht nur von Jahrhunderten von Schmutz befreien musste, sondern auch von einer noch dickeren und hartnäckigeren Schicht aus Mythos, Markt und Messiaskult.
Was mich immer wieder faszinierte, war, dass es oft wirklich berühmte Instrumente waren, die sich besonders schwer spielen ließen, die erst einmal gebändigt werden mussten und deren Persönlichkeit man über Wochen und Monate verstehen und ergründen musste, um zu merken, wie viel mehr an Klängen und Resonanzen und Farben möglich wäre, wenn man das Instrument nur verstehen lernen könnte, denn es war einem in jeder Hinsicht voraus. Ein besserer Geiger würde die Tiefen und verschiedenen Facetten eines großen Instruments rascher entdecken, aber auch die größte Musikerin kann nicht finden, was nicht da ist.
Immer wieder nahm ich auch eines der Instrumente, die nicht im Safe lagerten, aus einem der massiven Eichenschränke, um sie mir anzusehen, den Stil zu vergleichen und etwas über ihre Geschichte zu erfahren. Geigen haben Gesichter wie Menschen; alle ähnlich und doch unterschiedlich, ausgewogen oder asymmetrisch, lang oder gedrungen, elegant oder unbeholfen, von unterschiedlicher Farbe, mit sprechenden Details, mit einer eigenen Mimik. Sie haben eine Geschichte, einen Ursprung, ein klingendes Leben.
Eine der Geigen in diesem Schrank schien mir besonders interessant, mit einem besonders sicher geschnittenen Umriss, einer reizvollen Wölbung und einer ungewöhnlich kleinen Schnecke – dem gewundenen obersten Teil des Instruments, da, wo die Saiten von den Wirbeln gehalten werden.
Es war viel los an diesem Tag, an dem ich diese Geige entdeckte, wie eigentlich immer, wenn ich hier war. MR war fast unablässig damit beschäftigt, mehrere Dinge simultan zu erledigen: ein Kundengespräch, ein Instrument begutachten, davor wenn möglich eine kleinere Reparatur oder Feineinstellung, Fragen der Mitarbeiter, ein Telefongespräch mit einem Kollegen auf der Jagd nach einem raren Instrument, eine Studentin bei der Instrumentenwahl beraten. MR reichte mir die Geige.
»Woher weißt du, dass der Handwerker aus Deutschland kam?«, fragte ich, neugierig geworden, bevor er wieder verschwand.
»Einfach so«, antwortete er. »Das sieht man. Solche Ecken, solche Einkehlungen am äußeren Rand, die Positionierung der f-Löcher: Das kann nur jemand gewesen sein, der in Süddeutschland gelernt hat, im Allgäu, um genau zu sein, sehr wahrscheinlich in Füssen. Da kamen besonders im 17. Jahrhundert sehr viele Geigenbauer her, aber eigentlich ist das noch weitgehend unerforscht. All das deutet darauf hin, dass er im Allgäu zumindest in die Lehre gegangen ist. Aber die Wölbung und die Form, die sind schon ganz italienisch. Der Lack auch übrigens. Das konnte man damals nur in Italien. Nördlich der Alpen hat man noch nicht so gebaut, nicht so gut, nicht mit einer solchen Amati nachempfundenen Wölbung, nicht mit einer so schönen Grundierung.«
Während MR sprach, las ich mithilfe einer Lampe den Zettel auf der Innenseite des Instruments, der sie als eine Arbeit des großen Mailänder Meisters Carlo Giuseppe Testore ausweist.
»Also keine Testore?«, fragte ich.
»Nein, natürlich nicht, dann wäre sie zehnmal so teuer, der Zettel ist selbstverständlich falsch. Sie sieht eigentlich recht mailändisch aus, aber Testore ist es auf keinen Fall. Es gibt da zum Beispiel ein kleines Problem mit dem Datum: 1605 ist fast 60 Jahre vor seiner Geburt. Da hat jemand nicht aufgepasst.«
»Und du weißt nichts weiter über denjenigen, der sie gemacht hat, oder wo sie gemacht wurde?«
»Leider nicht! Ich habe sie irgendwann einmal gekauft, sie war damals in sehr schlechtem Zustand, und ich dachte, sie sei etwas ganz Besonderes, ein bislang nicht identifiziertes italienisches Meisterinstrument – aber ich habe nichts weiter über sie herausbekommen, auch mithilfe einiger sehr guter Kollegen nicht. Sie stammt offensichtlich aus dem frühen 18. Jahrhundert und ist ebenso offensichtlich in Italien gebaut worden, aber mit einem starken Allgäuer Einfluss, was nicht ungewöhnlich ist für die damalige Zeit. Nimm sie mit nach Hause und spiele sie ein bisschen, sie braucht das, sie ist gerade erst restauriert worden. Ich muss weiter, aber ich werde dir noch einen Kasten organisieren. Keine Zeit für Kaffee, heute leider nicht, mein nächster Kunde ist schon verspätet.«
MR ist keiner von diesen Händlern in Nadelstreifen, die auftreten wie Anwälte oder Bankiers. Ich habe ihn überhaupt noch nie in einem Anzug gesehen. Er ist ein Besessener – sehr zu seiner eigenen Unzufriedenheit –, ein Perfektionist, ein Herr oder Untertan verschiedener Sammlungen, in den Augen vieler Musikerinnen ein Magier, dem sie unbedingt vertrauen. Er hatte nie ein großes Geschäft gewollt, aber dann war es so passiert, durch einige seltsame Wendungen des Schicksals, bis er plötzlich selbst und mit eigener Firma zu einer der maßgeblichen Adressen in der winzigen Welt des Instrumentenhandels geworden war. Als Jugendlicher spielte er bretonischen Folk in einer Band, so war er zur Musik gekommen. Dann hatte er sich in eine Geigenbauerin verliebt, eine Weichenstellung.
Nach meinem Besuch bei MR war ich auf dem Weg nach Hause, die unbekannte Geige in einem Kasten, den er mir geliehen hatte, unter dem Arm. Gleich nachdem ich angekommen war, probierte ich sie aus. Sie klang jämmerlich; dünn und kellerfeucht, schrill und hohl, als hätte der Klang sich tief in ihrem Inneren verschanzt. Ein so schönes Instrument – und es hatte seine Stimme verloren, wenn es denn jemals eine gehabt hatte. Ich spielte es weiter, aus Neugier und auch um MR einen Gefallen zu tun, ein eingespieltes, gut eingestelltes Instrument verkauft sich besser, spricht besser an unter den Händen von Interessierten.
Dann aber, nach einigen Tagen intensiven Spiels, machte sie langsam auf; neue Resonanzen erschienen, der Ton wurde wärmer und tragender, auf der untersten Saite entstanden dunkel gemaserte Klänge, warm und hauchend wie die Stimme einer Jazz-Sängerin, die kein einfaches Leben gehabt hat, eine Stimme, die Freude und Leiden gleichermaßen tief in sich aufgesogen hatte. Die Höhe war klar und warm wie poliertes Silber, dazwischen lag eine ganze Landschaft von Klangfarben, die sich langsam erschlossen, erst zufällig, dann immer kontrollierter.
Ich spielte jeden Tag und hörte zu, erstaunt über das, was sich unter meinen Händen öffnete und entwickelte. Es ist ein Phänomen, das kein Physiker erklären kann: Instrumente können ihre Stimme verlieren. Wenn sie gerade repariert worden sind, wenn sie jahrelang nicht mehr gespielt wurden, dann klingt ihr Ton wie eingerostet, wie eingesperrt und muss erst wieder befreit werden. Aus irgendeinem Grunde bewirkt die Vibration beim Spielen, dass der Klang sich vertieft und verstärkt. In diesem Fall erfolgte die Befreiung rasch. Das kleine Instrument begann zu singen.
MR hatte es nicht eilig damit, die Geige von mir zurückzufordern. Ich bat ihn um Aufschub, er gab mir den Rat, ich solle mich ja nicht verlieben in dieses Instrument, obwohl es gut zu mir passe. Ich konnte nur staunen über meinen Freund und sein Geschick als Heiratsvermittler. Mit jedem Ton, den ich spielte, wuchs meine Liebe zu der Stimme, die das Instrument langsam fand. Liebe ist das richtige Wort, denn die Beziehung zu einem Instrument hat immer eine intime, sinnliche Seite. Allerdings auch eine finanzielle. MR kam mir entgegen, als ich mich nach Monaten dazu durchgerungen hatte, sie zu kaufen. Er wolle mich und die Geige zusammen sehen, sagte er und machte mir ein gutes Angebot. Er selbst hatte das Instrument außerdem lange genug gehabt, sagte er, und viel Zeit und Arbeit in es investiert. Trotzdem war seine Wette nicht aufgegangen: Die Geige war unbekannt geblieben, anonym, keinem großen Namen zuzuordnen.
*
Und so begann die Reise, die ihren Ursprung in einer Frage hatte, einer Berührung, einer Begegnung. Jedes Mal, wenn ich meine Geige zur Hand nahm – jeden Tag, wenn meine Arbeit und meine Reisen es erlaubten – fühlte ich, dass ich jemandem begegnete: einem Menschen, der vor zehn Generationen gelebt und etwas erschaffen hatte, das auch nach so langer Zeit noch immer seine Stimme erheben und die Menschen berühren konnte.
Die Hände des Spielers und des Erbauers trafen sich auf diesem kleinen Instrument, über die Jahrhunderte, über historische Revolutionen hinweg. Unsere Finger hatten denselben Lack berührt, dieselben sanft geschwungenen Formen, die er damals geschaffen hatte. Die Resonanzen, die ich heute hörte, hatte auch dieser Unbekannte einst gehört, er hatte das Holz so lange bearbeitet, bis er diesen Klang erreicht hatte, mit warmen, lebenden Händen. Das ist es, warum ich Historiker geworden war: Die Finger vergangener Leben griffen nach mir.
Wer war dieser Mensch, mit dem mich eine gemeinsame Praxis verband, eine Technik, vielleicht eine Leidenschaft, eine Reihe von Unbekannten? Hatte er Heimweh gehabt, wenn er tatsächlich ein Auswanderer war, den es aus dem Allgäu nach Italien verschlagen hatte? War er glücklich, was hatte er als Kind erlebt? Woran glaubte er? War er ein guter Liebhaber? Wurde er jeden Tag satt, und wovor hatte er Angst? Hat er jemals einen Gedanken daran verschwendet, wer sein Instrument einmal in Händen halten würde?
Ich wollte diesem Menschen begegnen, ihn kennenlernen, aber ich wusste nichts über ihn: keinen Namen, keinen Ort, ich hatte nicht den geringsten Anhaltspunkt. Der Zettel, der die Geige identifizierte, war falsch. Der Mann, der dieses Instrument so meisterhaft gebaut hatte, war im Abgrund der Geschichte verschwunden, ins historische Vergessen gefallen. Vielleicht hatte er der Nachwelt nichts weiter hinterlassen als dieses Stück Holz, das einzige Zeugnis seines Lebens.
Das, fühlte ich, war Grund genug, dieses Zeugnis als Schlüssel zu gebrauchen, um das Leben eines Unbekannten zu erschließen.
IILautenspäne
Das kleine Städtchen Füssen im Allgäu, das hatte MR mir gesagt, war mit großer Wahrscheinlichkeit der Herkunftsort des unbekannten Geigenbauers, nach dem zu suchen ich mich entschlossen hatte. Füssen liegt zwischen Kempten und Garmisch-Partenkirchen, direkt bei Schloss Neuschwanstein am Fuße der Alpen, 20 Kilometer nordöstlich der Zugspitze. Heute leben etwa 14.000 Menschen dort, vor 400 Jahren waren es um die 2000. Damals wie heute (das lässt sich der Rechtschreibung in den historischen Dokumenten entnehmen) war Füssen eine schwäbische Stadt, auch wenn sie von bayrischen Ländereien umgeben war.
In vielerlei Hinsicht ist Füssen typisch für eine Stadt ihrer Größe in der Region. Eine Tatsache aber macht sie vollkommen einzigartig: Über die Jahrhunderte sind Hunderte von Lauten- und Geigenbauern hier ausgebildet worden, sind von hier aus nach ganz Europa emigriert und haben von Paris bis Prag und von London bis Neapel den Bau und den Handel mit Lauten und später auch Geigen und anderen Streichinstrumenten über den ganzen Kontinent wesentlich mitbestimmt und zeitweise dominiert.
Seltsamerweise war diese einzigartige Position im musikalischen Europa der Armut geschuldet. Der Boden der Alpenregion ist an vielen Ort karg, das Gelände oft zu bergig, um größere Felder bewirtschaften zu können, und die Winter sind lang und hart, eine Gegend, die keine große Bevölkerung ernähren kann. Gerade für kleine Bauern war es daher schon immer schwierig, sich ausschließlich von der Landwirtschaft zu ernähren, weswegen die gesamte Alpenregion schon seit der Antike eine Auswanderungsregion gewesen ist. Viele Schweizer aus armen Alpentälern wurden Söldner (die päpstliche Schweizergarde erinnert noch daran), andere verdingten sich als Knechte, Dienstboten oder Handwerker, während viele Buben aus dem Tessin als lebende Schornsteinbesen durch die Kamine von italienischen Häusern klettern mussten, eine Form von Kindersklaverei, die viele nicht lang überlebten. Ihre Eltern aber hatten oft keine Wahl, als ihre Kinder wegzuschicken. Was der Hof erwirtschaftete, konnte unmöglich so viele Münder stopfen.
Im Vergleich mit diesen Orten hatte Füssen großes Glück. Es lag an der alten Via Claudia Augusta, der römischen Handelsroute über die Alpen, die Augsburg und Venedig verband und so letztendlich auch Teil des langen Landweges war, der von Peking über Samarkand, Bagdad und Konstantinopel bis nach Flandern und Nordeuropa führte. Gleichzeitig lag die Stadt am Lechfluss und war so ausgezeichnet situiert, um Holz aus den Alpen per Floß ins Flachland zu bringen. Die Fichten, Tannen, Lärchen, Eiben und anderen Hölzer aus höheren Lagen wurden besonders geschätzt, weil die Bäume in großer Höhe langsamer wuchsen und dichteres Holz produzierten, was besonders für hochwertige Möbel und Waffen von Interesse war.
Auch für den Instrumentenbau war dieses Holz wertvoll. Saiteninstrumente wie Lauten, Fiedeln und Violen, bei denen die Resonanzfähigkeit des Holzes wichtiger ist als seine statischen Eigenschaften, wurden vorrangig aus Nadelhölzern hergestellt, und die eng gewachsenen Bäume der Alpen waren perfekt geeignet dafür. Die Füssener Flößer, junge und kräftige Männer, verbrachten den warmen Teil des Jahres damit, in die Alpen hinaufzuwandern, Flöße via Füssen nach Augsburg zu steuern und dann zu Fuß den Heimweg anzutreten. Im Winter saßen sie am Herdfeuer und produzierten im Akkord Gerätschaften und Instrumententeile aus Holz, um ihr mageres Einkommen aufzubessern.
Die geographische Lage von Füssen bedeutete, dass die Handwerker dort Zugang zu einem besonders lukrativen Markt hatten. Im 15. und 16. Jahrhundert war Venedig eine der mächtigsten Städte in Europa – und eine der kultiviertesten. Der große Monteverdi arbeitete am Markusdom, und zahllose weniger berühmte Komponisten und Musiker schufen in der Stadt eine Atmosphäre und eine musikalische Dynamik, die vor allem während der Renaissance alles übertraf, was sich in Europa sonst abspielte.
Die musikalische Kultur Venedigs war zudem ein Abbild seiner internationalen Handelsverbindungen. Besonders die Kultur der moslemischen Welt erreichte mit den Händlern aus Konstantinopel und der Levante hier ihren ersten europäischen Hafen. So kamen nicht nur musikalische Formen, sondern auch Instrumente aus der islamischen Tradition nach Venedig. Das vielleicht wichtigste darunter war ein besonders vielseitiges Saiteninstrument, die Oud, die in Konstantinopel und im islamischen Spanien al oud genannt wurde und in Europa bald als lute (englisch), liuta (italienisch) oder als Laute bekannt werden sollte.
Lauten sind in ihrer Konstruktionsweise außergewöhnlich komplex. Sie haben im Wesentlichen die Form einer halbierten Birne und bestehen aus einem halbrunden Bauch, einer flachen Decke und einem langen Hals, über den je nach Art des Instruments unterschiedlich viele Saiten laufen. Die Spannung, Länge und Anzahl der Saiten, die Stimmlage und der Kontext, in dem die Laute gespielt werden soll, bestimmen die Größe des Instruments, wie stark der Bauch gewölbt ist, wie stabil die Konstruktion sein muss und wie die Einzelteile geformt sein müssen. Das erfordert nicht nur viel Erfahrung, sondern auch ein erhebliches geometrisches Wissen, um die Form und Beschaffenheit der einzelnen Teile richtig zu berechnen.
Wenn diese Kalkulation einmal gemacht ist, können die präzise berechneten Einzelteile auch in Heimarbeit hergestellt werden. Die »Lautenspäne«, die wie Orangenscheiben zugeschnittenen und über Hitze gebogenen Einzelteile, aus denen der Lautenbauch zusammengesetzt wird, sind relativ einfach anzufertigen. Genau darauf spezialisierten sich die Bauern und Flößer in Füssen, die über den Winter weder auf dem Fluss noch auf dem Land arbeiten konnten, aber trotzdem Geld verdienen mussten.
Die fertigen Lautenspäne wurden entweder von Werkstätten vor Ort zusammengebaut oder über die Alpen nach Venedig geschickt, wo Füssener Lautenbauer, die sich dort niedergelassen hatten, sie zu verkaufsbereiten Instrumenten montierten. Diese Methode war der Schlüssel zum Erfolg des Füssener Instrumentenbaus. Eine Laute ist ein voluminöses und zerbrechliches Instrument, das sehr viel Raum einnimmt und einen soliden Kasten braucht, um transportabel zu sein. Es wäre fast unmöglich gewesen, mehr als zwei oder drei dieser Instrumente gleichzeitig über die Alpen zu befördern, sei es auf dem eigenen Rücken oder auf dem eines Maulesels, nicht zuletzt, weil es noch keine sicheren und das ganze Jahr über befahrbaren Straßen durch das Gebirge gab.
Mit Lautenspänen war die Situation nun eine völlig andere. Die dünnen und flachen Späne ließen sich, genau wie auch die Decken und Hälse der Lauten, bequem und sicher flach packen und in großen Mengen transportieren. Die Füssener Heimwerker machten die Vorarbeiten für die venezianischen Instrumentenbauer, die aus dem gelieferten und halbfertigen Material Instrumente zusammensetzten.
Quellen zur Frühgeschichte des Lautenbaus in Füssen sind rar und fragmentarisch, und es ist noch nicht erforscht, wie genau eine kleine Stadt in den deutschen Voralpen das Wissen und die Expertise erlangen konnte, um eine derartige Schlüsselposition im venezianischen und bald auch im gesamten europäischen Instrumentenbau einzunehmen. Ein faszinierender Anhaltspunkt ist allerdings die Einbürgerung eines gewissen Jörg Wolff, der in den Quellen als »Lauter« bezeichnet wird und am 10. Oktober 1493 von der Stadt offiziell als Bürger aufgenommen wurde.
Zu diesem Zeitpunkt war Füssen schon seit einigen Generationen ein Zentrum für den Instrumentenbau gewesen. Schon früher im 15. Jahrhundert wurden Lautenmacher in der Stadt urkundlich erwähnt, und es gab bereits mehrere Werkstätten und durch die Handelsroute zwischen Augsburg und Venedig auch weitreichende Handelsverbindungen. Füssen war zur Zeit des Jörg Wolff schon etabliert als Instrumentenstadt und hatte trotz seiner ländlichen Position häufig Zugang zu höfischem Leben und damit auch zu höfischer Musik. Beim Konzil von Konstanz kamen 1417 nicht weniger als 1700 Musiker in die Nachbarschaft und mit ihnen auch die aktuellsten Instrumente. Der Dichter und Minnesänger Oswald von Wolkenstein hielt sich dort auf und war mit einer Frau aus dem nahen Schwangau verheiratet. Außerdem war das Benediktinerkloster St. Mang mit seiner Bibliothek und seinen vielen Gottesdiensten ein wichtiges Zentrum der Gelehrsamkeit und der Musik in der Region.
Die Einbürgerung von Jörg Wolff ist vielleicht ein Hinweis darauf, wie weit die Verbindungen der kleinen Stadt gereicht haben könnten. Die spanische Übersetzung von Wolf ist Lopez, und das Datum seiner Einbürgerung, 1493, legt zumindest die Möglichkeit nahe, dass Jörg Wolff ursprünglich Jorge Lopez gewesen sein könnte, ein spanisch-jüdischer Musiker und Lautenbauer, der ein Jahr nach der spanischen Reconquista auf der Flucht ins Alpenvorland kam, weil die Juden und Moslems Spaniens zwangsgetauft, vertrieben oder ermordet wurden, weil er sich einen anderen Ort zum Leben und Arbeiten suchen musste, und weil Füssen offensichtlich schon damals als Ort der Lautenbauer einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hatte, was übrigens auch der Fall wäre, wenn Jörg Wolff nicht aus Spanien stammte.
Die Idee, dass mit Jörg Wolff ein Stück mediterrane Expertise nach Füssen kam, lässt sich nicht beweisen, aber sie ist tragfähig. Eine bekannte spanisch-jüdische Musikerfamilie namens Olmaliach oder Almaliach (wohl eine Version von El-Malech) nannte sich nach ihrer erzwungenen Konversion Lopez. In den folgenden Jahrzehnten verließen mehrere Mitglieder dieses Musikerclans Spanien, um anderswo in Europa ein besseres Leben zu suchen. Musiker dieses Namens finden sich kurz darauf in Antwerpen, in London und auch in Venedig, wo 1542 ein Ambrosio Lupo als Violist [sic] und sonadore de lironj an der Scuola Grande di San Marco verpflichtet wurde.
Wenn Jörg Wolff tatsächlich aus einer berühmten spanischen Musikerfamilie stammte, die sich von der iberischen Halbinsel aus ins Exil geflüchtet hatte, dann brachte er wohl ein musikalisches Niveau und als »Lauter« auch Konstruktionstechniken mit, die in Füssen bis dahin kaum üblich gewesen sein dürften. Mit ihren maurischen, christlichen und jüdischen Einflüssen war die musikalische Kultur von Al-Andalus ungeheuer vielfältig und verfeinert, und die wenigen Instrumente, die aus dieser Periode erhalten sind, zeugen von einer raffinierten Handwerkskunst. Diese könnte der neue Bürger aus seiner alten Heimat nach Füssen mitgebracht haben.
Ob der Lautenmacher Jörg Wolff ursprünglich ein spanischer Jude war oder nicht, das christliche Europa des ausgehenden Mittelalters verdankte besonders seine höfische Musik den vielen Begegnungen mit dem Orient, gerade während der Kreuzzüge, aber auch durch den Handel zwischen Konstantinopel und Venedig und anderen Hafenstädten im Mittelmeer. Die Handwerker im kleinen Füssen kamen an ihrer Werkbank mit fernen Welten in Berührung. Sie verarbeiteten exotische Hölzer und Elfenbein, sie handelten mit Kunden in anderen Ländern, kamen in Kontakt zu Hofmusikern und weitgereisten Herren.
Es war wohl weniger dieser Hauch von Weltläufigkeit als die schöne und praktische Lage, die den römisch-deutschen Kaiser Maximilian I. (1459–1519) dazu bewog, oft und gelegentlich auch mehrere Monate lang in Füssen zu residieren. Auch mit ihm kamen Musiker, Musikliebhaber und Handwerker in den Ort, der um diese Zeit seine größte Blüte erlebte. Welche Bedeutung die kleine Stadt durch diese Bedingungen für den europäischen Instrumentenbau entwickelte, zeigt sich besonders an dem Netzwerk, das sich rasch von Füssen aus über den Kontinent zu spannen begann.
Diese Geschichte von einer Art frühem Kapitalismus wäre nichts ohne ihren legendären Entrepreneur, den Lautenmacher Caspar Tieffenbrucker (1514–1571), der lange der bekannteste Exilant und Netzwerker im Namen des Lautengeschäfts war. Er machte seine Lehre in Füssen und in Norditalien, zog aber Mitte des 16. Jahrhunderts nach Lyon, von wo aus er Instrumente, deren Teile er wahrscheinlich noch immer aus Füssen bezog, in ganz Europa verkaufte.
Tieffenbrucker dürfte auch einer der ersten Instrumentenbauer gewesen sein, der kleine Violen herstellte, Instrumente, die der heutigen Violine sehr ähnlich sind. Zwar sind keine originalen Instrumente von ihm erhalten, aber auf einem Porträt, das offensichtlich auch zu Werbezwecken angefertigt und als Druck herausgegeben wurde, ist ganz vorn im Bild ein Instrument zu sehen, das aussieht wie eine moderne Geige. Das Gemälde entstand 1548 – also mehr als ein Jahrzehnt, bevor der Cremoneser Meister Andrea Amati, der heute als Vater der modernen Geige gilt, die erste noch erhaltene moderne Geige schuf, die heute im Metropolitan Museum of Art zu bewundern ist. Dass Tieffenbrucker Amati tatsächlich zuvorgekommen ist, bleibt jedoch eine Vermutung, aber die größten Erfindungen der Menschheit erscheinen oft plötzlich und an verschiedenen Stellen gleichzeitig, wie Pilze, wenn Zeitpunkt und Witterung es erlauben.
Während die Familie Tieffenbrucker versuchte, den Handel mit Füssener Instrumenten von Lyon und bald auch von anderen europäischen Städten aus zu kontrollieren, bekam sie bald Konkurrenz aus der alten Heimat. Mang (eigentlich Magnus) Sellas verließ Füssen und ging als Lautenmacher nach Prag, vier weitere Männer der Familie zogen als Händler und Instrumentenbauer nach Venedig, andere nach Innsbruck und Linz.
Das Netzwerk der Füssener war bald weit gespannt. Ein Gerichtsfall von 1569 zeigt, welche Implikationen das haben konnte. In der Verhandlung ging es um gefälschte Münzen aus Italien, die von Schmugglern im Raum Füssen in Umlauf gebracht worden waren. Da die Reichweite der Füssener Justiz sich nicht bis jenseits der Alpen erstreckte, um die Falschmünzer selbst zu belangen, waren die Angeklagten die Schmuggler selbst, die in den Gerichtsakten als Lautenträger bezeichnet wurden, also als Männer, die Lautenteile von Füssen nach Venedig brachten, wo sie offenbar mit Falschgeld bezahlt worden waren – ohne es zu wissen, wie sie beteuerten. Allerdings hatten sie pfundweise Münzen bei sich, als sie nach Füssen zurückkehrten, was ihre Glaubwürdigkeit erheblich untergrub.
Lautenträger war schon gegen 1570 ein bekannter Beruf im Füssener Raum, und das Gewerbe florierte. Um 1600 hatte Füssen mit seinen circa 2000 Einwohnern 18 bei der Innung gemeldete Lauten- und Geigenbauer. Zum Vergleich: Nürnberg hatte 40.000 Bürgerinnen und Bürger, aber nur fünf Geigenbauer, die Handelsmetropole Augsburg hatte nur drei.
Für die frühen Unternehmer des europäischen Instrumentenbaus bot der Arbeitsprozess von Heimarbeit bis zum Zusammensetzen in der eigenen Werkstatt große Verdienstmöglichkeiten, und besonders der in Füssen geborene venezianische Instrumentenhändler Matteo Sellas, ein Cousin von Mang Sellas in Prag, sollte in Venedig als reicher Mann sterben. Die einfachen Leute aber wurden für diese Arbeit mit einem Hungerlohn bezahlt.
Gerade in unsicheren Zeiten, als durch die sogenannte Kleine Eiszeit die Ernten schlechter waren als normal und Epidemien und Kriege immer wieder in das Leben einbrachen, bot der Instrumentenbau aber auch einen Ausweg aus der ländlichen Armut. Als Instrumentenbauer konnte ein Junge auf ein relativ stabiles Einkommen hoffen, aber die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass er wegziehen musste, um sein Glück in irgendeiner großen Stadt zu versuchen. Wie überall sonst kontrollierte auch in Füssen eine Innung nicht nur den Preis und die Qualität der Instrumente, sondern auch die Anzahl der zugelassenen Werkstätten. Ein Junge, der als Lehrling bei einem Lauten- oder Geigenbauer anfing, musste sich an den Gedanken gewöhnen, eines Tages in die Welt zu müssen.
Viele der Füssener Instrumentenbauer, die ihre Heimat verlassen mussten, taten dies schon als Kinder. Die meisten von ihnen wählten den Weg über die Alpen, nach Italien, wohin auch der Großteil der halbfertigen Instrumente verkauft wurde und wohin sie bereits Verbindungen hatten. Füssener Namen erscheinen in den Registern der Innungen bis hinunter nach Neapel und Sizilien, und Instrumentenbauer aus dem Allgäu und dem angrenzenden Tirol sind in fast allen norditalienischen Städten nachweisbar, besonders aber in Rom und Venedig, wo Kirchen, Theater, offizielle Anlässe und private Feiern, Aristokraten und Touristen immer nach Musik verlangten. Schon 1480 verzeichneten römische Zollbücher die kistenweise Lieferung von Lautenholz und sogar von fertigen Lauten aus dem Allgäu.
Mit den Handwerkern verbreitete sich auch ihre Methode, Instrumente zu konstruieren, ihre Ästhetik, ihre Formensprache, die am neuen Lebensort der Auswanderer oft auf lokale Traditionen und Schönheitsideale traf, sodass sich verschiedene Mischformen entwickelten. Händler und Instrumentenbauer aus Füssen wurden tatsächlich zu einem einzigartig dominanten Einfluss im musikalischen Europa.
Die Fertigung der Instrumente hatte allerdings schon im 16. Jahrhundert wenig mit der romantischen Idee des authentischen und einsamen Handwerkers zu tun. Der Füssener Lautenbauer Laux Maler, der 1552 in Bologna starb, hinterließ laut Testament 1100 fertige Lauten sowie 127 noch nicht vollendete, Hunderte von noch unbearbeiteten Lautendecken und ein ganzes Lager voller Späne für den Korpus und voller anderer Instrumententeile und Saiten, die von Spezialisten aus Schafsdärmen hergestellt worden waren. Ein Handwerker allein hätte für diese Instrumente wohl mehr als 50 Jahre gebraucht. Im Testament von Moisè und Magno Tieffenbrucker in Venedig erschienen 1581 sogar »335 fertige Lauten und 8 Gitarren, 150 Lautenkorpora und 60 unfertige Instrumente … 15.200 Eibenspäne, 2000 Decken, 300 Stege, 600 Hälse, 160 Wirbel«. Näher konnte man im vorindustriellen Zeitalter der Produktion auf industriellem Niveau nicht kommen.
*
Füssen war eine wohlhabende, selbstbewusste und hervorragend vernetzte Stadt, als 1618 der Dreißigjährige Krieg begann. In den ersten Kriegsjahren fanden die Kämpfe in anderen Gebieten statt und verschonten die Stadt weitgehend, auch wenn die für sie so wichtigen Handelsverbindungen schon bald unter der zunehmenden Unsicherheit der Straßen und den marodierenden Soldaten litten. Trotzdem ging es der Stadt gut. Sie war nicht von strategischer Bedeutung, und die Einwohner konnten mit einiger Berechtigung hoffen, dass die Kampfhandlungen sie nicht direkt betreffen würden.
So trieben die Instrumentenbauer auch in diesen ersten Kriegsjahren einen schwunghaften Handel. Die Mautstation Donaustauf, die alle Güter kontrollierte, die über die Donau verschifft wurden, notierte immer wieder Ladungen mit Lauten, Geigen und halbfertigen Instrumenten auf dem Weg nach Augsburg und von da aus in Richtung Flandern oder nach Wien.
Ein kostbares historisches Dokument vermittelt einen Eindruck davon, was die Füssener in diesen Jahren bewegte. Der Färbermeister Hanns Faigele schrieb während der Kriegsjahre eine private Stadtchronik, eine Mischung aus Dokumentation und persönlichem Tagebuch. Seine Eintragungen beginnen im Jahr 1618 und zeigen gleich, dass diese Welt auch in Friedenszeiten von Angst und Gewalt geprägt war. Am 19. Januar »hat man allhier Hexe mit dem Schwerte gerichtet und verbrannt«, wie Faigele ungerührt zu Protokoll gibt. Einige Monate später schreibt er über die Kapriolen der Natur mit einem typischen Frühjahrstag während der Kleinen Eiszeit, die besonders während des 17. Jahrhunderts das europäische Wetter prägte:
Am Markustag [25. April 1618] schneite es den ganzen Tag, und es herrschte eine so große Kälte, die den gefallenen Schnee hart gefrieren ließ; es war so kalt, dass mir noch am darauffolgenden Freitag das Wasser in den Tüchern am Netz in der Mange gefror.
Die nächsten Jahre gingen ruhig dahin. 1625 wurde ein Hanns Dieffenbruger, sehr wahrscheinlich ein entferntes Mitglied der Instrumentenmacher-Familie in Lyon und Venedig, wegen Diebstahls enthauptet, im Jahr darauf erlebte die Stadt noch einmal einen Höhepunkt:
Am St. Andreastag ist Herzog Leopoldus allhie herkommen. Ziemlich starkh mit seinem Gemachell die war schwanger, und ist von unserm gnädigen Fürstbischof so damal allhie war, selbs empfangen worden mit sammt der bewerten Burgerschaft, und ist ihr Durchleicht mit sammt Ihrem Volk allhie in der Stat ein gelossieret worden in den firnembsten Heusern, und ist 1 Tag und Nacht hier blieben, darnach weiter in das Schwabenlandt zogen.
Faigele beschreibt eine Welt, die allem Anschein nach in sich ruhte und florierte. Der Handel mit Musikinstrumenten entwickelte sich tatsächlich weiter. Im Jahr 1623 gab es 27 Lauten- und Geigenbau-Werkstätten in Füssen. Trotzdem neigten sich die guten Zeiten auch hier dem Ende zu. Die unsicheren Straßen und die immer unsicherer erscheinende Zukunft trafen den Instrumentenhandel wie auch den Holzhandel. Die ersten Menschen verließen ihre Häuser und Höfe in und um Füssen im Jahr 1624, um anderswo ein besseres Leben zu finden. Die, die Spuren hinterließen, gingen nach Wismar, nach Ulm und nach Mantua, andere verschwanden, ohne dass man ihre Wege heute nachverfolgen kann.
Langsam, aber sicher kam der Krieg näher und brach in den Füssener Alltag ein. Soldaten aus den verschiedensten Ländern und Gegenden marschierten durch das Land, hungrige und verlauste Flüchtlinge zogen in Kolonnen des Elends auf der Suche nach Nahrung und Unterschlupf durch die Gegend. Ganze Regionen wurden leergekauft oder geplündert, und die umherwandernden Menschen waren die idealen Überträger von ansteckenden Krankheiten.
Schon 1627 kam die erste Pestepidemie nach Füssen und kostete einige Einwohner das Leben. Drei Jahre später wütete sie dann mit voller Wucht. Faigele schreibt: »Am 12. November hat allhie die Bestilenz anfachen Regieren; die nahm ihren Anfang bei Hanns Heimen, Balbierer. – Am 9. December haben die von Reutten im Gericht Ehrenberg die Statt Füssen banisirt der bösen Sucht halber.«
Etwa die Hälfte der Füssener Bevölkerung wurde von der Seuche in den Tod gerissen. Faigele nennt die verdächtig runde Zahl von 1600 Toten in einem Jahr, die wahrscheinlich übertrieben ist, aber die Wirkung auf die Stadt war verheerend. Nach dem Krieg sollen noch immer 94 der 266 Häuser und Wohnungen in der Stadt unbewohnt gewesen sein, 56 von ihnen baufällig. Faigele notiert über diese schreckliche Zeit: »Diess verflossen Jar send allhie gestorben und vergraben worden Jung und Alt bei 1600 an der Pestilenz und sonst. Gott sey in gnedig und barmherzig und uns allen.«
Mit dem Zusammenbruch der Stadt kollabierte auch der Instrumentenbau. Es ist wahrscheinlich, dass auch viele der Lautenbauer durch die Seuche umkamen. Hinzu kam: Die Pest hatte flächendeckend den gesamten Alpenraum heimgesucht, nachdem deutsche Soldaten sie von Norden aus nach Italien eingeschleppt hatten, wo sie eine geschätzte Million Menschen das Leben kostete. Überall fehlte es an Menschen, an Sicherheit, an Geld. Die Füssener hatten ihre Instrumente immer für den Export gebaut, aber die Nachfrage brach nun ein, bis kaum noch ein Meister von seinem Handwerk leben konnte. Mehrere von ihnen begannen nebenher als Kornmeister, Waagmeister, Postmeister oder in anderen Berufen zu arbeiten.
In der zweiten Kriegshälfte blieb Süddeutschland auch vom Blutvergießen nicht mehr verschont. Die Schweden nahmen Füssen ein, woraufhin Faigele fast verwundert bemerkt:
Gleichwoll ist nit so ein grosser Schaden geschehen in der Statt am Sturmen, dann in einer Stund ist die Statt vom schwedischen gewonnen worden; auch ist nit viel Volkh blieben auf beiden Saiten, allein viel Volkh vom thyrollschen ist bei dem schwedischen gefangen worden, da sy nit viel werth zum Wehren, nur zum Stehlen waren.
Nach den Schweden aber kamen die Franzosen, die anders mit der Bevölkerung umgingen: »Die haben die Leut dermassen dribellirt und plaget und geschlagen, dass zum erbarmen war. Man hat ihnen miessen essen und drinken geben, man nehm’s wo man wöll. Auch war das Weibsbild nit sicher vor ihnen; es war halt ausserdermassen ein Elend.« Auf die Franzosen folgte Herzog Leopold von Tirol und belagerte Füssen mit 12.000 Mann, dann, im Juli, belagerte der Fürst von Weimar »sammbt seinem Bruder Ernst« die Stadt mit 6000 Soldaten, die Besatzer wurden niedergemetzelt, und es begann wieder ein »blindern und Rauben … dass es ein Erbarmen war«.
Ein anderer Tagebuchschreiber, Pfarrer Matthäus Schalk, war Zeuge des schwedischen Angriffs auf Füssen:
Am 23. Juni frühmorgens rückten die Schwedischen mit Reiterei und Fußvolk an die Stadt heran. 25 Pfund schwere Kugeln schossen sie in die Stadt. Von diesen schlug eine durch den Kuglerturm und fiel erst vor dem Rathaus nieder. Ein Widerstand der Tiroler mit der geringen Besatzung von 300 Mann war aussichtslos. Die Tiroler Truppen machten sich rottenweise in die Berge auf, raubten dabei fliehende Bürgersleute aus. Den Schulmeister Paulus Paudrexl zogen sie bis aufs Hemd aus und mir dem Tagebuchschreiber Pfarrer Schalkh stahlen sie 100 Gulden.