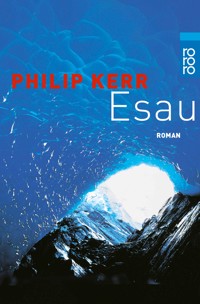9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bernie Gunther ermittelt
- Sprache: Deutsch
Das Böse hat viele Gesichter. München 1949: Von der Doppelmoral der Nachkriegszeit desillusioniert versucht sich Privatdetektiv Bernie Gunther als Gastwirt. Doch dann bittet ihn eine schöne Fremde um Hilfe. Der Auftrag führt Bernie auf die Spur eines gesuchten Naziverbrechers. Viel zu spät erkennt er, dass die alten Machthaber noch immer aktiv sind – und gefährlicher denn je. «Exzellent! Kerrs Stil macht jede Seite zum Lesevergnügen.» (Publishers Weekly) «Kerr ist die europäische Krimi-Entdeckung der letzten Jahre.» (Radio Bremen)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Philip Kerr
Das Janusprojekt
Roman
Übersetzt von Cornelia Holfelder-von der Tann
Über dieses Buch
Das Böse hat viele Gesichter.
München 1949: Von der Doppelmoral der Nachkriegszeit desillusioniert versucht sich Privatdetektiv Bernie Gunther als Gastwirt. Doch dann bittet ihn eine schöne Fremde um Hilfe. Der Auftrag führt Bernie auf die Spur eines gesuchten Naziverbrechers. Viel zu spät erkennt er, dass die alten Machthaber noch immer aktiv sind – und gefährlicher denn je.
«Exzellent! Kerrs Stil macht jede Seite zum Lesevergnügen.» (Publishers Weekly)
«Kerr ist die europäische Krimi-Entdeckung der letzten Jahre.» (Radio Bremen)
Vita
Philip Kerr wurde 1956 in Edinburgh geboren. 1989 erschien sein erster Roman «Feuer in Berlin». Aus dem Debüt entwickelte sich die Serie um den Privatdetektiv Bernhard Gunther. Für Band 6, «Die Adlon-Verschwörung», gewann Philip Kerr den weltweit höchstdotierten Krimipreis der spanischen Mediengruppe RBA und den renommierten Ellis-Peters-Award. Kerr lebte in London, wo er 2018 verstarb.
Weitere Veröffentlichungen:
Das Wittgenstein-Programm
Gesetze der Gier
Game over
Esau
Der Plan
Der zweite Engel
Der Tag X
Newtons Schatten
Der Coup
Der Pakt
sowie die «Berlin-Trilogie» um Privatdetektiv Bernhard Gunther:
Feuer in Berlin
Im Sog der dunklen Mächte
Alte Freunde – neue Feinde
und weitere Bernhard Gunther-Romane:
Das letzte Experiment
Die Adlon-Verschwörung
Mission Walhalla
Für Jane
Gott, gib uns die Gnade, in Demut anzunehmen, was wir nicht ändern können; den Mut, zu verändern, was verändert werden muss, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Reinhold Niebuhr
Prolog
Berlin, September 1937
Ich weiß noch, wie schön das Wetter damals im September war. Hitlerwetter, sagten die Leute. Als ob die Elemente es ausgerechnet mit Adolf Hitler gut meinten. Ich erinnere mich, wie der Führer eine pathetische Rede hielt, in der er Kolonien für Deutschland forderte. Das war wohl das erste Mal, dass ihn irgendjemand von uns das Wort «Lebensraum» verwenden hörte. Niemand dachte auch nur eine Sekunde darüber nach, dass Lebensraum für uns hieß, andere sollten erst mal ihr Leben lassen.
Der Raum, in dem ich damals lebte und arbeitete, war Berlin. Dort gab es für einen Privatdetektiv jede Menge Arbeit. Es ging natürlich immer um vermisste Personen. Und die meisten waren Juden. Und von diesen waren wiederum die meisten in irgendwelchen dunklen Gassen ermordet oder aber in ein Konzentrationslager verfrachtet worden, ohne dass die Behörden es für nötig gehalten hatten, die Angehörigen zu informieren. Die Nazis hatten an diesem Vorgehen ziemlich viel Spaß. Offiziell wurden die Juden natürlich zur Auswanderung ermutigt, aber da es ihnen untersagt war, Eigentum mitzunehmen, wanderten nur wenige aus. Einige Leute ersannen allerdings raffinierte Tricks, um ihr Geld dennoch aus Deutschland hinauszuschaffen.
Ein solcher Trick war beispielsweise, ein großes, versiegeltes Päckchen, das verschiedenste Wertgegenstände enthielt, mit der Aufschrift «Mein Letzter Wille» bei einem deutschen Amtsgericht zu hinterlegen, ehe man eine «Urlaubsreise» machte. Die betreffende jüdische Person «verstarb» dann im Ausland und sorgte dafür, dass das zuständige französische oder englische Gericht das deutsche Amtsgericht um die Übersendung des «Letzten Willens» ersuchte. Deutsche Amtsgerichte, an denen ja deutsche Juristen wirkten, waren im Allgemeinen nur zu gern bereit, den Ersuchen anderer Juristen nachzukommen, selbst wenn es französische oder englische waren. Auf diese Weise gelang es einigen wenigen Juden, ausreichend Bargeld oder Wertsachen wiederzuerlangen, um ein neues Leben in einem neuen Land anzufangen.
Es ist vielleicht schwer zu glauben, aber ein weiteres raffiniertes Verfahren dachte man sich ausgerechnet am Judenreferat des SD aus – des Sicherheitsdienstes Reichsführer-SS. Eine Methode, die, so fand man, doppelten Vorteil hatte: Einerseits wurde die Auswanderung von Juden gefördert, und andererseits war der Bereicherung gewisser SD-Beamter gedient. Es war der sogenannte Schacher, benannt nach dem jiddischen Wort Socher für umherziehender Händler, und ich kam zum ersten Mal damit in Berührung, als sich zwei äußerst seltsame Klienten an mich wandten.
Der eine, Paul Begelmann, war ein reicher jüdischer Geschäftsmann, Eigentümer mehrerer Autohäuser in ganz Deutschland. Der andere war SS-Sturmbannführer Dr. Franz Six, Leiter des Judenreferats des SD. Ich wurde zu einem Treffen mit ihnen in den bescheidenen, aus drei Räumen bestehenden Sitz der Abteilung im Hohenzollernpalais in der Wilhelmstraße bestellt. Hinter Six’ Schreibtisch hingen ein Führerbild und eine ganze Reihe Universitätsurkunden aus Heidelberg, Königsberg und Leipzig. Six mochte ja ein Nazigauner sein, aber dafür ein hochqualifizierter. Und er war nicht gerade Himmlers idealtypischer Arier. Um die dreißig, dunkelhaarig und mit einem selbstgefälligen Zug um den Mund, sah er im Ganzen unwesentlich weniger jüdisch aus als Paul Begelmann. Ihn umgab ein leichter Geruch von Rasierwasser und Heuchelei. Auf seinem Schreibtisch stand eine kleine Büste von Wilhelm von Humboldt. Der Gründer der Berliner Universität war berühmt dafür, dass er die Grenzen definiert hatte, jenseits derer der Staat nichts zu suchen hatte. Es schien mir unwahrscheinlich, dass Sturmbannführer Six da mit ihm einer Meinung war.
Begelmann war älter und größer, mit dunklem, welligem Haar und Lippen, so dick und rosa wie zwei Scheiben Frühstücksfleisch. Er lächelte, aber seine Augen sagten etwas ganz anderes. Seine Pupillen waren klein, als ob er es eilig hätte, dem Scheinwerferlicht des SD zu entkommen. In diesem Gebäude und inmitten all der schwarzen Uniformen wirkte er wie ein Chorknabe, der versucht, sich mit einem Rudel Hyänen gutzustellen. Er sprach nicht viel. Das Reden übernahm Six. Ich hatte gehört, Six stamme aus Mannheim. In Mannheim gab es eine berühmte Jesuitenkirche. Und genau so kam er mir vor, dieser Franz Six in seiner schnittigen schwarzen Uniform: Nicht wie der typische rohe SD-Scherge. Eher wie ein Jesuit.
«Herr Begelmann hat den Wunsch geäußert, nach Palästina auszuwandern», sagte er glattzüngig. «Natürlich macht er sich Gedanken wegen seiner hiesigen Firmen und der Auswirkungen, die ein Verkauf auf die deutsche Wirtschaft hätte. Um Herrn Begelmann zu helfen, haben wir ihm eine Lösung vorgeschlagen. Eine Lösung, bei der Sie uns helfen könnten, Herr Gunther. Wir schlagen vor, dass er nicht offiziell auswandern, sondern vielmehr ein im Ausland tätiger deutscher Staatsbürger bleiben soll. Genauer gesagt, dass er in Palästina als Vertreter seiner eigenen Firma fungieren soll. So kommt er in den Genuss eines Gehalts und eines Teils der Firmengewinne, und gleichzeitig wird der Aufgabe dieser Abteilung, die jüdische Auswanderung zu fördern, entsprochen.»
Ich hatte keinen Zweifel, dass die restlichen Firmengewinne des armen Begelmann nicht etwa dem Reich zukommen würden, sondern Franz Six. Ich zündete mir eine Zigarette an und musterte den SD-Mann mit einem zynischen Lächeln. «Meine Herren, das klingt, als ob Sie beide sehr glücklich miteinander werden könnten. Aber ich verstehe nicht, wozu Sie mich dabei brauchen. Eheschließungen sind nicht mein Metier. Nur Eheprobleme.»
Six wurde ein wenig rot und sah verlegen zu Begelmann hinüber. Er hatte Macht, aber nicht die Sorte, die für jemanden wie mich eine Bedrohung darstellen konnte. Er war es gewohnt, Studenten und Juden zu drangsalieren, aber einen erwachsenen arischen Mann unter Druck zu setzen, schien jenseits seiner Möglichkeiten.
«Wir brauchen jemanden … jemanden, dem Herr Begelmann vertrauen kann … der ein Schreiben des Berliner Bankhauses Wassermann an die Anglo-Palestine Bank in Jaffa überbringt. Es geht darum, bei der dortigen Bank einen Kontokorrentkredit zu beantragen und in Jaffa Räumlichkeiten für eine neue Automobilhandlung anzumieten. Der Mietvertrag wird dann als Beleg für Herrn Begelmanns wichtige neue Auslandsunternehmungen dienen. Ferner soll unser Mittelsmann der Anglo-Palestine Bank gewisse Besitztümer überbringen. Natürlich ist Herr Begelmann bereit, für diese Dienste ein beträchtliches Entgelt zu zahlen. Den Betrag von eintausend britischen Pfund, auszahlbar in Jaffa. Und natürlich wird der SD die nötigen Dokumente bereitstellen und den Papierkram übernehmen. Sie würden offiziell als Vertreter von Begelmann Automobile dorthin reisen. Inoffiziell agieren Sie als Geheimagent des SD.»
«Tausend Pfund. Das ist eine Menge Geld», sagte ich. «Aber was ist, wenn mir die Gestapo irgendwelche Fragen stellt? Ein paar Antworten würden denen vielleicht gar nicht gefallen. Haben Sie daran gedacht?»
«Natürlich», sagte Six. «Halten Sie mich für einen Dummkopf?»
«Nein, aber die vielleicht.»
«Es trifft sich günstig, dass ich demnächst noch zwei weitere Agenten nach Palästina schicken werde, in einer Erkundungsmission, die von höchster Stelle abgesegnet ist», sagte er. «Im Zuge ihrer sukzessiven Aufhebung wurde diese Abteilung beauftragt, die Möglichkeiten einer Zwangsemigration nach Palästina zu untersuchen. Für die Sipo sind Sie einfach Teil dieser Mission. Falls Ihnen die Gestapo irgendwelche Fragen zu Ihrem Auftrag stellen sollte, könnten Sie mit Fug und Recht das Gleiche antworten wie die anderen beiden: dass es eine geheimdienstliche Angelegenheit ist. Dass Sie Befehle von Gruppenführer Heydrich ausführen. Und dass Sie aus Sicherheitsgründen nichts Näheres darüber sagen können.» Er zündete sich eine scharfriechende, kleine Zigarre an. «Sie haben doch schon für den Gruppenführer gearbeitet, oder nicht?»
«Ich versuche immer noch, es zu vergessen.» Ich schüttelte den Kopf. «Bei allem Respekt, Herr Sturmbannführer. Wenn Sie bereits zwei Männer nach Palästina schicken, wozu brauchen Sie mich dann noch?»
Begelmann räusperte sich. «Wenn ich bitte etwas sagen dürfte, Herr Sturmbannführer?», fragte er vorsichtig und in feinstem Hanseatisch. Six zuckte die Achseln und nickte gleichgültig. Begelmann sah mich mit stummer Verzweiflung an. Auf seiner Stirn stand Schweiß, und ich glaube nicht, dass es nur an dem ungewöhnlich warmen Septemberwetter lag. «Weil Ihnen, Herr Gunther, der Ruf vorausgeht, ein ehrlicher Mensch zu sein.»
«Von Ihrem Ruf, gern eine schnelle Mark zu machen, mal ganz abgesehen», sagte Six.
Ich sah Six an und nickte. Ich war es leid, zu diesem Gauner in Uniform höflich zu sein. «Sie wollen also sagen, Herr Begelmann, dass Sie dieser Abteilung und den Leuten, die für sie arbeiten, nicht trauen.»
Der arme Begelmann machte ein entsetztes Gesicht. «Nein, nein, nein, nein, nein», sagte er. «Das will ich ganz und gar nicht.»
Aber inzwischen amüsierte ich mich zu gut, um diesen Knochen loszulassen. «Und ich kann es Ihnen nicht verdenken. Ausgeraubt zu werden, ist eine Sache. Aber eine ganz andere ist es, wenn der Bandit auch noch verlangt, dass man ihm die Beute zum Fluchtwagen bringt.»
Six biss sich auf die Lippe. Ich sah ihm an, dass er wünschte, es wäre meine Halsschlagader. Er schwieg lediglich, weil ich noch nicht abgelehnt hatte. Vermutlich erriet er, dass ich es nicht tun würde. Tausend Pfund sind tausend Pfund.
«Bitte, Herr Gunther.»
Six schien ganz froh, das Betteln Begelmann überlassen zu können.
«Meine gesamte Familie wäre Ihnen für Ihre Hilfe äußerst dankbar.»
«Tausend Pfund», sagte ich. «Diesen Teil kenne ich schon.»
«Ist an der Entlohnung irgendetwas auszusetzen?» Begelmann sah Six an, wartete auf eine Hilfestellung, bekam aber keine. Six war SD-Mann, kein Pferdehändler.
«Ganz und gar nicht, Herr Begelmann», sagte ich. «Die ist sehr großzügig. Nein, das Problem bin wohl eher ich. Ich kriege immer einen Juckreiz, wenn mir eine bestimmte Sorte Hund zu dicht auf die Pelle rückt.»
Aber Six ließ alle Beleidigungen an sich abprallen. «Sie sind doch hoffentlich nicht unhöflich zu einem Vertreter der deutschen Staatsmacht, Herr Gunther», sagte er tadelnd. «Man könnte ja meinen, Sie wären gegen den Nationalsozialismus, so wie Sie reden. Keine besonders gesunde Einstellung heutzutage.»
Ich schüttelte den Kopf. «Sie missverstehen mich», sagte ich. «Ich hatte letztes Jahr einen Kunden. Einen gewissen Hermann Six. Der Industrielle, Sie wissen ja? Er hat sich mir gegenüber alles andere als anständig verhalten. Ich hoffe, Sie sind nicht mit ihm verwandt.»
«Leider nein», sagte er. «Ich stamme aus einer armen Mannheimer Familie.»
Ich sah Begelmann an. Er tat mir leid. Ich hätte ablehnen sollen, doch ich ließ mich auf den Deal ein. «In Ordnung, ich mache es. Aber Sie beide sollten in dieser ganzen Sache die Karten lieber offen auf den Tisch legen. Ich bin nicht der Typ, der verzeiht und vergisst. Und ich habe noch nie die andere Wange hingehalten.»
Schon bald bereute ich, mich auf den Schacher von Six und Begelmann eingelassen zu haben. Am nächsten Tag saß ich allein in meinem Büro. Draußen regnete es. Mein Partner, Bruno Stahlecker, war angeblich in einer Ermittlungssache unterwegs, was vermutlich hieß, dass er an einem Kneipentresen irgendwo im Wedding herumlungerte. Es klopfte an der Tür, und ein Mann trat ein. Er trug einen Ledermantel und einen breitkrempigen Hut. Es musste wohl an meinem überdurchschnittlichen Spürsinn liegen, dass ich, noch ehe er seine Marke zückte, wusste, dass er von der Gestapo kam. Er war Mitte zwanzig, mit dünnem Haar, einem kleinen, schiefen Mund und einem spitzen, zart wirkenden Kinn, das darauf schließen ließ, dass er es eher gewohnt war, Schläge auszuteilen, als welche einzustecken. Wortlos warf er seinen Hut auf meine Schreibunterlage, knöpfte seinen Mantel auf, was einen adretten, marineblauen Anzug enthüllte, setzte sich auf den Stuhl auf der anderen Schreibtischseite, nahm seine Zigaretten heraus und zündete sich eine an – die ganze Zeit sah er mich dabei an wie ein Seeadler einen Fisch.
«Hübscher Hut», sagte ich schließlich. «Wo haben Sie den geklaut?» Ich nahm den Hut von meiner Schreibunterlage und warf ihn ihm auf den Schoß. «Oder wollten Sie mich nur wissen lassen, dass es draußen regnet?»
«Am Alex haben sie mir gesagt, dass Sie ein harter Bursche sind», sagte er und aschte auf meinen Teppich.
«Am Alex war ich ein harter Bursche», sagte ich. Gemeint war das Polizeipräsidium am Berliner Alexanderplatz. «Sie haben mir so ein kleines Blechding gegeben. Mit der Biermarke der Kripo in der Tasche kann jeder den harten Burschen mimen.» Ich zuckte die Achseln. «Aber wenn die das sagen, muss es wohl stimmen. Richtige Polizisten wie die am Alex lügen nicht.»
Das Mündchen dehnte sich zu einem dünnen Lächeln. Er lutschte an seiner Zigarette, als wäre sie ein Faden, den er durch ein Nadelöhr stecken wollte. «Sie sind also der Polyp, der den Mörder Gormann erwischt hat.»
«Das ist lange her», sagte ich. «Mörder zu fangen, war wesentlich leichter, bevor Hitler an die Macht kam.»
«Ach? Wieso?»
«Zum einen waren sie längst nicht so dicht gesät wie heute. Und zum anderen hatte es mehr Gewicht. Damals habe ich echte Befriedigung daraus gezogen, die Gesellschaft zu schützen. Heute wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte.»
«Klingt, als missfiele Ihnen, was die Partei für Deutschland tut», sagte er.
«Aber nicht doch», sagte ich, jetzt vorsichtiger. «Mir missfällt nichts, was für Deutschland getan wird.» Ich zündete mir eine Zigarette an und überließ es ihm, meine Äußerung zu interpretieren. In der Zwischenzeit unterhielt ich mich damit, mir auszumalen, wie meine Faust auf das spitze Kinn dieses Jünglings krachte. «Haben Sie auch einen Namen, oder dürfen den nur Ihre Freunde wissen? Das sind die Leute, die Ihnen zum Geburtstag eine Glückwunschkarte schicken, Sie erinnern sich? Vorausgesetzt, Sie wissen noch, wann der ist …»
«Vielleicht können Sie ja mein Freund werden», sagte er lächelnd. Dieses Lächeln gefiel mir gar nicht. Es besagte, dass er sicher war, etwas gegen mich in der Hand zu haben. Da war so ein Blitzen in seinen Augen. «Vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Dazu sind Freunde doch da, oder? Vielleicht tue ich Ihnen ja einen Gefallen, Gunther, und Sie sind mir so verdammt dankbar, dass Sie mir eine von diesen Glückwunschkarten schicken.» Er nickte. «Ja, das würde mir gefallen. Wäre richtig nett. Mit ein paar freundlichen Worten.»
Seufzend blies ich Rauch in seine Richtung. Langsam wurde ich seine Harter-Hund-Nummer leid. «Ich glaube nicht, dass Sie Sinn für meine Art von Humor haben», sagte ich. «Aber ich lasse mir gern das Gegenteil beweisen. Wäre mal eine nette Abwechslung, sich in der Gestapo getäuscht zu haben.»
«Ich bin Inspektor Gerhard Flesch», sagte er.
«Freut mich, Flesch.»
«Ich leite die Judenabteilung der Sipo», setzte er hinzu.
«Wissen Sie was? Ich überlege mir, hier auch so was aufzumachen», sagte ich. «Plötzlich scheint ja jeder eine Judenabteilung zu haben. Muss gut fürs Geschäft sein. Der SD, das Außenministerium und jetzt auch die Gestapo.»
«Die Operationsbereiche des SD und der Gestapo sind durch eine Weisung des Reichsführers-SS klar voneinander abgegrenzt», sagte Flesch. «Theoretisch ist es Aufgabe des SD, die Juden zu überwachen und uns dann Bericht zu erstatten. In der Praxis sieht sich die Gestapo allerdings in einem Machtkampf mit dem SD, und kein Bereich ist so heftig umstritten wie die jüdischen Angelegenheiten.»
«Klingt ja alles hochinteressant, Flesch. Aber ich wüsste nicht, was ich da tun könnte. Ich bin ja noch nicht mal Jude.»
«Nein?» Flesch lächelte. «Dann will ich es Ihnen erklären. Uns ist zu Ohren gekommen, dass Franz Six und seine Leute sich von den Juden bezahlen lassen. Dass sie Bestechungsgelder annehmen, um Juden die Auswanderung zu erleichtern. Was wir noch nicht haben, sind Beweise. Und da kommen Sie ins Spiel, Gunther. Sie werden sie uns beschaffen.»
«Sie überschätzen meine Fähigkeiten, Flesch. Ich bin nicht sehr gut darin, in der Scheiße zu wühlen.»
«Diese SD-Erkundungsmission in Palästina. Warum genau fahren Sie dorthin?»
«Ich brauche Urlaub, Flesch. Ich muss mal hier weg und ein paar Orangen essen. Anscheinend sind Sonne und Orangen sehr gut für die Haut.» Ich zuckte die Achseln. «Und außerdem erwäge ich, zum Judentum zu konvertieren. Man hat mir gesagt, in Jaffa machen sie ziemlich gute Beschneidungen, wenn man vor der Mittagszeit drankommt.» Ich schüttelte den Kopf. «Hören Sie, Flesch. Das ist eine geheimdienstliche Angelegenheit. Sie wissen, dass ich mit niemandem außerhalb des Referats darüber reden kann. Wenn Ihnen das nicht passt, wenden Sie sich an Heydrich. Der macht die Spielregeln, nicht ich.»
«Die beiden Männer, mit denen Sie reisen werden», sagte er, ohne eine Miene zu verziehen. «Wir möchten, dass Sie sie im Auge behalten. Um sicherzugehen, dass sie ihre Vertrauensstellung nicht missbrauchen. Ich bin sogar befugt, Ihnen dafür eine Aufwandsentschädigung anzubieten. Tausend Reichsmark.»
«Das ist sehr nobel von Ihnen, Flesch», sagte ich. «Tausend Mark sind ein ganz hübsches Stückchen Zuckerbrot. Aber natürlich wären Sie nicht die Gestapo, wenn Sie nicht auch einen kleinen Vorgeschmack auf die Peitsche anzubieten hätten, die mir droht, falls ich doch nicht so ein Süßschnabel sein sollte.»
Flesch lächelte wieder sein schmales Lächeln. «Es wäre doch unangenehm, wenn Ihre rassische Abstammung Gegenstand genauerer Nachforschungen würde», sagte er und drückte seine Zigarette in meinem Aschenbecher aus. Als er sich auf seinem Stuhl vorbeugte und wieder zurücklehnte, quietschte sein Ledermantel so laut, als hätte er ihn gerade erst im Souvenirladen der Gestapo gekauft.
«Meine Eltern waren beide brave Kirchgänger», sagte ich. «Ich kann mir nicht denken, dass Sie da irgendwas gegen mich finden würden.»
«Ihre Urgroßmutter mütterlicherseits», sagte er. «Es besteht die Möglichkeit, dass sie Jüdin war.»
«Studieren Sie mal Ihre Bibel, Flesch», sagte ich. «Wir sind alle Juden, wenn wir nur weit genug zurückgehen. Aber in diesem konkreten Fall liegen Sie falsch. Sie war Katholikin. Eine ziemlich fromme sogar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.»
«Aber sie hieß doch Adler, oder nicht? Anna Adler?»
«Adler, ja, ich glaube, das stimmt. Und?»
«Adler ist ein jüdischer Name. Wenn sie noch leben würde, müsste sie heute wahrscheinlich den zweiten Vornamen Sarah führen, damit sie gleich als das kenntlich wäre, was sie war. Jüdin.»
«Selbst wenn es so wäre, Flesch. Dass Adler ein jüdischer Name ist. Und ich habe, offen gestanden, keine Ahnung, ob das stimmt. Auch dann wäre ich nur Achteljude. Und nach Paragraph zwo, Absatz fünf, der Nürnberger Gesetze bin ich somit kein Jude.» Ich grinste. «Ihre Peitsche peitscht nicht, Flesch.»
«Nachforschungen erweisen sich oft als kostspielige Belastung», sagte Flesch. «Selbst für rein arische Geschäftsunternehmen. Und Fehler kommen vor. Es könnte Monate dauern, bis alles wieder seinen normalen Gang geht.»
Ich nickte, weil mir aufging, dass das stimmte. Niemand wies ein Ansinnen der Gestapo ab. Nicht ohne schwerwiegende Folgen. Ich hatte nur die Wahl zwischen dem Ruinösen und dem Widerwärtigen. Eine sehr deutsche Alternative. Wir wussten beide, dass mir kaum etwas anderes übrigblieb, als mich auf ihr Spiel einzulassen. Aber das brachte mich, gelinde gesagt, in eine missliche Lage. Schließlich hatte ich ja bereits den starken Verdacht, dass Franz Six seine Taschen mit Paul Begelmanns Schekeln füllte. Aber ich hatte keine Lust, mich in einen Machtkampf zwischen SD und Gestapo verwickeln zu lassen. Andererseits war ja nicht gesagt, dass die beiden SD-Leute, die ich nach Palästina begleiten sollte, irgendetwas zu verbergen hatten. Außerdem würden sie natürlich den Verdacht haben, das ich ein Spitzel war, und sich mir gegenüber entsprechend vorsichtig verhalten. Es sprach vieles dafür, dass ich gar nichts entdecken würde. Aber würde sich die Gestapo mit gar nichts zufriedengeben? Es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden.
«In Ordnung», sagte ich. «Aber ich werde für euch nicht das Sprachrohr machen und Leute verleumden. Das kann ich nicht. Und ich werd’s gar nicht erst versuchen. Wenn sie krumme Sachen machen, werde ich es euch mitteilen und mir sagen, dass das nun mal die Aufgabe von Detektiven ist. Vielleicht wird es mich ein paar Stunden Schlaf kosten, vielleicht auch nicht. Aber wenn sie keine krummen Sachen machen, dann war’s das, klar? Ich schiebe niemandem getürkte Beweise unter, nur damit Sie und die übrigen Hartschädel in der Prinz-Albrecht-Straße einen Punkt für sich verbuchen können. Das werde ich nicht tun, nicht mal, wenn Ihre besten Reinemacher es mir nahelegen. Und Ihr Zuckerbrot können Sie auch behalten. Ich möchte nicht auf den Geschmack kommen. Ich werde Ihren schmutzigen kleinen Job machen, Flesch. Aber das Spiel läuft, wie es läuft. Keine gezinkten Karten. Klar?»
«Klar.» Flesch stand auf, knöpfte seinen Mantel zu und setzte seinen Hut auf. «Angenehme Reise, Gunther. Ich war noch nie in Palästina. Aber ich habe gehört, es soll dort sehr schön sein.»
«Vielleicht sollten Sie selbst mal hinfahren», sagte ich munter. «Ich wette, es würde Ihnen gefallen. Sie würden sich dort im Nu zurechtfinden. In Palästina hat jeder eine Judenabteilung.»
Ich verließ Berlin in der letzten Septemberwoche und fuhr mit dem Zug durch Polen in die rumänische Hafenstadt Constanza. Dort ging ich an Bord des Dampfers Romania, wo ich die beiden SD-Leute traf, die ebenfalls nach Palästina reisten. Beide waren SD-Scharführer, und beide gaben sich als Journalisten des Berliner Tageblatts aus, einer Zeitung, die bis zur Übernahme durch die Nazis 1933 in jüdischem Besitz gewesen war.
Der Oberscharführer hieß Herbert Hagen, der andere war Hauptscharführer Adolf Eichmann. Hagen war Anfang zwanzig und ein milchgesichtiger Intellektueller, Akademiker aus gutem Hause. Eichmann war ein paar Jahre älter und bestrebt, etwas Besseres zu werden als österreichischer Reisevertreter einer Ölfirma, was er vor seinem Eintritt in die Partei und die SS gewesen war. Die beiden waren auf eine bizarre Art vom Judentum fasziniert – merkwürdige Antisemiten. Eichmann hatte mehr Erfahrung im Judenreferat, sprach Jiddisch und verbrachte den größten Teil der Seereise mit der Lektüre von Theodor Herzls Buch Der Judenstaat. Die Reise war Eichmanns Idee gewesen. Er schien überrascht, dass seine Vorgesetzten sich darauf eingelassen hatten, und auch ein bisschen aufgeregt, weil er noch nie über Deutschland und Österreich hinausgekommen war. Hagen war ideologischer Nazi und ein glühender Zionist, denn er glaubte, die Partei habe «keinen größeren Feind als den Juden» (oder etwas ähnlich Blödsinniges) und die «Lösung der Judenfrage» könne nur in der «restlosen Entjudung» Deutschlands bestehen. Es machte mich ganz krank, ihn reden zu hören. Für mich klang das alles völlig verrückt. Wie aus Alice im Wunderland, nur unter bösen Vorzeichen.
Beide begegneten mir, wie ich geahnt hatte, mit Argwohn. Nicht nur, weil ich nicht aus dem SD und ihrem speziellen Referat kam, sondern auch, weil ich älter war als sie – in Hagens Fall fast zwanzig Jahre. Und bald schon nannten sie mich scherzhaft «Papi», was ich gutmütig hinnahm – jedenfalls gutmütiger als Hagen den Spitznamen, den ich ihm, sehr zu Eichmanns Belustigung, im Gegenzug verlieh: Hiram Schwartz, nach dem gleichnamigen jungen Tagebuchschreiber. Daher hatte, als wir um den 2. Oktober Jaffa erreichten, Eichmann mehr für mich übrig als sein junger, unerfahrener Kollege.
Eichmann war keineswegs eine beeindruckende Erscheinung, und damals dachte ich, er sei wahrscheinlich der Typ Mann, der in Uniform besser aussieht. Ja, mir kam sogar bald der Verdacht, dass die Uniform der Hauptgrund für seinen Eintritt in die SA und dann in die SS gewesen war. Ich bezweifelte nämlich, dass ihn die reguläre Armee genommen hätte, wenn es denn eine solche gegeben hätte. Er war gerade mal mittelgroß, o-beinig und sehr dünn. Im Oberkiefer hatte er zwei Goldbrücken und viele Füllungen. Sein Kopf hatte Ähnlichkeit mit dem Totenkopf auf dem Mützenabzeichen der SS: Er war extrem knochig, mit auffallend eingesunkenen Schläfen. Mir fiel auf, wie jüdisch Eichmann aussah. Und mir kam der Gedanke, dass seine Antipathie gegen Juden damit zu tun haben könnte.
Ab dem Moment, als die Romania in Jaffa anlegte, lief es für die beiden SS-Leute gar nicht gut. Die Briten hatten offenbar den Verdacht, dass Eichmann und Hagen in deutschem Geheimdienstauftrag standen, und nach langem Hin und Her ließen sie sie schließlich für ganze vierundzwanzig Stunden an Land. Ich hingegen erhielt problemlos ein Dreißig-Tage-Visum für Palästina. Das war eine ziemliche Ironie, da ich höchstens vier, fünf Tage bleiben wollte, und für Eichmann ein ziemlicher Schlag, weil es seine gesamten Pläne über den Haufen warf. Er schimpfte, während eine Pferdekutsche uns und unser Gepäck vom Hafen ins Hotel Jerusalem am Rand der berühmten «deutschen Kolonie» der Stadt brachte.
«Was sollen wir jetzt machen?», klagte Eichmann. «Unsere wichtigsten Treffen sind alle übermorgen, wenn wir schon wieder auf dem Schiff sein müssen.»
Ich lächelte stillvergnügt vor mich hin. Jeder Knüppel zwischen die Beine des SD war mir willkommen, und dieser ganz besonders, weil er es mir ersparte, mir eine Geschichte für die Gestapo ausdenken zu müssen. Männer, die kein Visum bekommen hatten, konnte ich ja wohl schlecht bespitzeln. Ich dachte, es würde die Gestapo vielleicht sogar so sehr erfreuen, dass sie über den Mangel an konkreten Informationen hinwegsehen würde.
«Vielleicht kann Papi ja zu den Treffen gehen», sagte Hagen.
«Ich?», sagte ich. «Kommt nicht in Frage.»
«Ich verstehe immer noch nicht, warum er ein Visum gekriegt hat und wir nicht», sagte Eichmann.
«Weil er diesem Juden von Dr. Six hilft», sagte Hagen. «Der Jid hat das vermutlich für ihn geregelt.»
«Kann sein», sagte ich. «Kann aber auch sein, dass Sie beide einfach nicht besonders gut in diesem Metier sind. Sonst hätten Sie sich keine Legende ausgedacht, der zufolge Sie ausgerechnet bei einer Nazizeitung arbeiten. Noch dazu bei einer Nazizeitung, die ihren jüdischen Eigentümern weggenommen wurde. Sie hätten vielleicht etwas Unauffälligeres gewählt.» Ich lächelte Eichmann an. «So was wie Reisevertreter einer Ölfirma vielleicht.»
Hagen begriff. Aber Eichmann war immer noch zu aufgebracht, um zu kapieren, dass ich ihn veräppelte.
«Franz Reichert», sagte er. «Vom deutschen Pressebüro in Jerusalem. Den kann ich anrufen. Er wird wohl wissen, wie man Feivel Polkes erreichen kann. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir Hadsch Amin benachrichtigen sollen.» Er seufzte. «Was sollen wir bloß machen?»
Ich fragte: «Was hätten Sie denn jetzt gemacht? Heute. Wenn Sie Ihr Dreißig-Tage-Visum gekriegt hätten.»
Eichmann zuckte die Achseln. «Vermutlich hätten wir die deutsche Freimaurerkolonie in Sarona besucht. Wären auf den Karmel gefahren. Hätten uns ein paar jüdische Landwirtschaftssiedlungen im Jezreeltal angesehen.»
«Dann würde ich Ihnen raten, genau das zu tun», sagte ich. «Rufen Sie Reichert an. Erklären Sie ihm die Situation, und gehen Sie morgen wieder an Bord. Das Schiff fährt doch morgen schon nach Ägypten weiter, oder nicht? Gehen Sie doch einfach zur britischen Botschaft in Kairo und beantragen Sie dort noch einmal ein Visum.»
«Er hat recht», sagte Hagen. «Das sollten wir tun.»
«Wir können neue Anträge stellen», rief Eichmann aus. «Natürlich! Wir können uns die Visa in Kairo holen und dann auf dem Landweg wieder hierherreisen.»
«Wie die Kinder Israel», sagte ich.
Die Kutsche verließ jetzt die engen, schmutzigen Gassen der Altstadt und fuhr schneller, als wir auf eine breitere Straße kamen, die in die neue Stadt Tel Aviv führte. Gegenüber von einem Glockenturm und mehreren arabischen Kaffeehäusern lag die Anglo-Palestine Bank, wo ich mit dem Filialleiter sprechen und ihm die Beglaubigungsschreiben von Begelmann und dem Bankhaus Wassermann übergeben sollte. Und natürlich den Truhenkoffer, den ich für Begelmann außer Landes gebracht hatte. Ich hatte keine Ahnung, was darin war, aber dem Gewicht nach handelte es sich wohl kaum um seine Briefmarkensammlung. Ich sah keine Veranlassung, den Besuch der Bank noch hinauszuschieben. Nicht in einer Stadt wie Jaffa, die voller feindselig wirkender Araber war. (Sie hielten uns wahrscheinlich für Juden. Und für Juden hatte die einheimische palästinensische Bevölkerung nicht viel übrig.) Also ließ ich den Kutscher anhalten. Den Truhenkoffer im Gepäck und die Briefe in der Tasche stieg ich aus, und Eichmann und Hagen fuhren mit meinen übrigen Sachen weiter zum Hotel.
Der Filialleiter war ein Engländer namens Quinton. Seine Arme waren zu kurz für sein Jackett, und sein helles Haar war so fein, dass es kaum vorhanden schien. Er hatte eine Stupsnase, umgeben von Sommersprossen, und ein Lächeln wie eine junge Bulldogge. Unwillkürlich sah ich im Geiste Quintons Vater vor mir, der ganz genau aufpasste, was der Deutschlehrer seines Sohnes sagte. Das konnte kein schlechter Lehrer gewesen sein, denn Mr. Quinton sprach ein ausgezeichnetes Deutsch mit einer so inbrünstigen Modulation, als deklamierte er Goethes «Die Zerstörung Magdeburgs».
Quinton führte mich in sein Büro. An der Wand hingen ein Cricketschläger und Fotos von unterschiedlichen Cricket-Teams. Ein Deckenventilator kreiste träge vor sich hin. Es war heiß. Durchs Fenster hatte man einen prächtigen Blick auf den Mohammedanischen Friedhof und das dahinterliegende Mittelmeer. Die Uhr des nahen Turms schlug die volle Stunde, und der Muezzin der Moschee auf der anderen Seite der Howard Street rief die Gläubigen zum Gebet. Berlin war weit, weit weg.
Er öffnete die Umschläge, die mir anvertraut worden waren, mit einem Brieföffner, der wie ein kleiner Krummsäbel geformt war. «Stimmt es, dass es Juden in Deutschland verboten ist, Beethoven oder Mozart zu spielen?», fragte er.
«Es ist ihnen verboten, Werke dieser Komponisten auf jüdischen Kulturveranstaltungen zu spielen», sagte ich. «Aber erwarten Sie von mir keine Erklärung. Ich habe keine. Wenn Sie mich fragen, ist das ganze Land verrückt geworden.»
«Sie sollten mal versuchen, hier zu leben», sagte er. «Hier gehen sich die Juden und die Araber gegenseitig an die Gurgel. Und wir sind mittendrin. Es ist eine unmögliche Situation. Die Juden hassen die Briten, weil wir nicht noch mehr Juden ins Land und in Palästina leben lassen. Und die Araber hassen uns, weil wir überhaupt Juden ins Land lassen. Aber eines Tages wird uns dieses ganze Land noch um die Ohren fliegen, und wir werden gehen, und dann wird es noch schlimmer sein als vorher. Merken Sie sich meine Worte, Herr Gunther.»
Während er sprach, hatte er die Briefe überflogen und diverse Blätter heraussortiert. Einige waren leer bis auf eine Unterschrift.
«Das hier sind Beglaubigungsschreiben», sagte er. «Und Unterschriftsproben für neue Bankkonten. Eins dieser Konten soll ein Gemeinschaftskonto für Sie und Dr. Six sein, ist das richtig?»
Ich runzelte die Stirn, wenig angetan von der Vorstellung, irgendetwas mit dem Chef des SD-Judenreferats gemeinsam zu haben. «Ich weiß nicht», sagte ich.
«Nun ja, von diesem Konto sollen Sie das Geld nehmen, um die Immobilie hier in Jaffa zu mieten», erklärte er. «Und Ihr Honorar und Ihre Spesen ebenfalls. Das Guthaben ist auszahlbar an Dr. Six gegen Vorlage seines Reisepasses und eines Bankbuchs, das ich Ihnen zur Weitergabe an ihn geben werde. Bitte stellen Sie sicher, dass er das weiß. Die Bank besteht darauf, dass sich der Bankbuchinhaber durch einen Reisepass ausweist, ehe das Geld ausgehändigt wird. Klar?»
Ich nickte.
«Dürfte ich Ihren Reisepass sehen, Herr Gunther?»
Ich reichte ihn ihm.
«Die beste Adresse, um eine gewerbliche Immobilie in Jaffa zu finden, ist Solomon Rabinowicz», sagte er, während er meinen Pass überflog und sich die Nummer notierte. «Er ist ein polnischer Jude, aber wohl der findigste Mensch, den ich bis jetzt in diesem nervtötenden Land getroffen habe. Er hat ein Büro in der Montefiore Street. In Tel Aviv. Das ist etwa eine halbe Meile von hier. Ich gebe Ihnen seine Adresse. Immer in der Annahme natürlich, Ihr Klient möchte keine Räumlichkeiten im Araberviertel. Das würde nur Ärger provozieren.»
Er gab mir meinen Pass zurück und deutete mit dem Kinn auf Herrn Begelmanns Truhenkoffer. «Da drin sind wohl die Wertgegenstände Ihres Klienten?», sagte er. «Die, die er bis zu seiner Ankunft hier in unserem Tresor lagern möchte?»
Ich nickte wieder.
«Eines dieser Schreiben enthält ein Inventar des Inhalts dieses Truhenkoffers», sagte er. «Möchten Sie es vor der Aushändigung überprüfen?»
«Nein», sagte ich.
Quinton kam um den Schreibtisch herum und nahm den Truhenkoffer an sich. «Lieber Gott, ist der schwer», sagte er. «Wenn Sie einen Moment hier warten möchten, lasse ich Ihr Bankbuch ausstellen. Darf ich Ihnen Tee anbieten? Oder vielleicht Limonade?»
«Tee», sagte ich. «Tee wäre großartig.»
Nachdem ich meine Bankgeschäfte getätigt hatte, ging ich zu Fuß zum Hotel und stellte fest, dass Hagen und Eichmann bereits ausgegangen waren. Also nahm ich ein kühles Bad, fuhr nach Tel Aviv, suchte Herrn Rabinowicz auf und wies ihn an, eine geeignete Immobilie für Paul Begelmann zu finden.
Die beiden SD-Leute sah ich erst am nächsten Morgen im Frühstücksraum wieder, als sie leicht zerknittert herunterkamen, auf der Suche nach schwarzem Kaffee. Sie hatten sich die Nacht in einem Club in der Altstadt um die Ohren geschlagen. «Zu viel Arrak», flüsterte Eichmann. «Das ist die hiesige Spezialität. Eine Art mit Anis versetzter Tresterschnaps. Meiden Sie ihn nach Möglichkeit.»
Ich lächelte und zündete mir eine Zigarette an, wedelte aber den Rauch weg, als er mich gequält ansah. «Haben Sie Reichert erreicht?», fragte ich.
«Ja. Er hat sogar den gestrigen Abend mit uns verbracht. Aber Polkes nicht. Der wird also höchstwahrscheinlich hier auftauchen und uns suchen. Würden Sie kurz mit ihm sprechen, nur fünf oder zehn Minuten, und ihm die Situation erklären?»
«Wie ist denn die Situation?»
«Unsere Pläne ändern sich leider von Minute zu Minute. Vielleicht kommen wir gar nicht mehr hierher zurück. Reichert meint, in Kairo würden wir mit den Visa auch nicht mehr Glück haben.»
«Das tut mir leid», sagte ich. Es tat mir kein bisschen leid.
«Sagen Sie ihm, wir sind nach Kairo gefahren», sagte Eichmann. «Und werden dort im National wohnen. Er soll uns dort treffen.»
«Ich weiß nicht», sagte ich. «Ich will mit all dem eigentlich nichts zu tun haben.»
«Sie sind Deutscher», sagte er. «Sie haben damit zu tun, ob es Ihnen passt oder nicht.»
«Ja, schon, aber Sie sind die Nazis, nicht ich.»
Eichmann sah mich schockiert an. «Wie können Sie für den SD arbeiten und kein Nazi sein?», fragte er.
«Die Welt ist manchmal komisch», sagte ich. «Aber nicht weitersagen.»
«Hören Sie, bitte, reden Sie mit ihm», sagte Eichmann. «Und sei es nur formhalber. Ich könnte ihm zwar einen Brief hinterlassen, aber es würde sich so viel besser machen, wenn Sie es ihm persönlich sagen.»
«Wer ist dieser Feivel Polkes überhaupt?», fragte ich.
«Ein palästinensischer Jude, der bei der Haganah ist.»
«Und was ist das?»
Eichmann lächelte gequält. Er war blass und schwitzte reichlich. Er tat mir fast schon leid. «Sie wissen wirklich nicht viel über dieses Land, was?»
«Immerhin genug, um ein Dreißig-Tage-Visum zu kriegen», erwiderte ich spitz.
«Die Haganah ist eine jüdische Miliz- und Nachrichtenorganisation.»
«Sie meinen, eine terroristische Organisation.»
«Wenn Sie so wollen», räumte Eichmann ein.
«Na gut», sagte ich. «Ich rede mit ihm. Formhalber. Aber ich muss alles wissen. Ich treffe mich nicht mit dem Kerl von einer solchen Mörderbande, wenn ich nur die halbe Geschichte kenne.»
Eichmann zögerte. Ich wusste, er traute mir nicht. Aber entweder war er so verkatert, dass ihm alles egal war, oder aber er begriff jetzt, dass ihm keine andere Wahl blieb, als offen zu mir zu sein.
«Die Haganah will, dass wir Waffen für ihren Kampf gegen die Briten hier in Palästina liefern», sagte er. «Und wenn der SD weiter die jüdische Auswanderung aus Deutschland fördert, bieten sie uns an, uns Informationen über britische Truppen- und Flottenbewegungen im östlichen Mittelmeer zu liefern.»
«Die Juden helfen ihren Verfolgern?» Ich lachte. «Aber das ist doch absurd.» Eichmann lachte nicht. «Oder?»
«Im Gegenteil», sagte Eichmann. «Der SD finanziert bereits mehrere zionistische Vorbereitungslager in Deutschland. Orte, wo junge Juden die landwirtschaftlichen Kenntnisse erwerben, die sie brauchen werden, um dieses Land hier zu bestellen. Palästinensisches Land. Die Finanzierung der Haganah durch die Nationalsozialisten wäre nur eine mögliche Erweiterung dieser Politik. Aus diesem Grund bin ich hier. Um mir ein Bild von den Leuten zu machen, die an der Spitze der Haganah, der Irgun und anderer jüdischer Milizen stehen. Hören Sie, ich weiß, das ist schwer zu glauben, aber gegen die Briten haben die noch mehr als gegen uns.»
«Und wie passt Hadsch Amin in das Ganze?», fragte ich. «Der ist doch Araber, oder nicht?»
«Hadsch Amin ist die Rückversicherung», sagte Eichmann. «Für den Fall, dass unsere prozionistische Politik nicht aufgeht. Wir hatten vor, hier in Palästina Gespräche mit dem Arabischen Hochkomitee und einigen seiner Mitglieder zu führen – insbesondere mit Hadsch Amin. Aber jetzt haben die Briten offenbar die Auflösung des Hochkomitees und die Verhaftung seiner Mitglieder befohlen. Anscheinend wurde in Nazareth vor ein paar Tagen der stellvertretende Distriktkommissar von Galiläa ermordet. Hadsch Amin hält sich derzeit in der Altstadt von Jerusalem versteckt, wird sich aber heimlich außer Landes begeben und uns in Kairo treffen. Wie Sie sehen, geht es hier in Jaffa nur noch um Polkes.»
«Erinnern Sie mich dran, nie mit Ihnen Karten zu spielen, Eichmann», sagte ich. «Oder wenigstens vorher dafür zu sorgen, dass Sie Ihr Jackett ausziehen und die Hemdärmel aufkrempeln.»
«Sagen Sie Polkes einfach nur, er soll nach Kairo kommen. Das versteht er dann schon. Aber um Himmels willen kein Wort über den Großmufti.»
«Großmufti?»
«Hadsch Amin», sagte Eichmann. «Er ist Großmufti von Jerusalem. Der oberste islamische Rechtsgelehrte in Palästina. Die Briten haben ihn 1921 dazu ernannt. Damit ist er der mächtigste Araber des Landes. Und er ist ein fanatischer Antisemit. Gegen den nimmt sich der Führer wie ein Judenfreund aus. Hadsch Amin hat den Juden den Dschihad erklärt. Deshalb wollen ihn die Haganah und die Irgun aus der Welt haben. Und das ist auch der Grund, weshalb Feivel Polkes lieber nicht erfahren sollte, dass wir uns auch mit dem Großmufti treffen. Vermuten wird er es natürlich. Aber das ist sein Problem.»
«Ich hoffe nur, es wird nicht zu meinem», sagte ich.
Am Tag nachdem Eichmann und Hagen mit dem Schiff nach Alexandria abgefahren waren, erschien Feivel Polkes im Hotel Jerusalem. Polkes war ein kettenrauchender polnischer Jude von Mitte dreißig. Er trug einen zerknitterten Tropenanzug und einen Strohhut. Er hatte eine Rasur nötig, aber nicht so dringend wie der kettenrauchende russische Jude, der ihn begleitete. Der war Mitte vierzig, mit Ringerschultern und einem verwitterten Gesicht. Sein Name war Eliahu Golomb. Beide hatten die Jacketts zugeknöpft, obwohl es wie immer glühend heiß war. Wenn ein Mann in solcher Hitze sein Jackett zugeknöpft lässt, kann das gewöhnlich nur eins bedeuten. Nachdem ich ihnen die Situation erklärt hatte, fluchte Golomb auf Russisch, und um gut Wetter zu machen – diese Männer waren schließlich Terroristen –, deutete ich auf die Bar und erbot mich, ihnen einen Drink zu spendieren.
«In Ordnung», sagte Polkes, der gut Deutsch sprach. «Aber nicht hier. Gehen wir woanders hin. Ich habe einen Wagen draußen.»
Beinahe hätte ich abgelehnt. Mit ihnen an der Hotelbar etwas zu trinken, war unproblematisch. Aber mit Männern, deren Art, ihre Anzüge zu tragen, mir sagte, dass sie bewaffnet und vermutlich gefährlich waren, in einen Wagen zu steigen, schien mir schon zweifelhafter. Als Polkes mein Zögern bemerkte, sagte er: «Keine Bange, mein Freund. Wir kämpfen gegen die Briten, nicht gegen die Deutschen.»
Wir gingen nach draußen und stiegen in einen zweifarbigen Riley Saloon. Golomb fuhr so langsam wie jemand, der keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen will. Wir fuhren nach Nordosten, durch eine deutsche Kolonie aus hübschen, weißen Villen, bekannt unter dem Namen Klein-Walhalla, dann nach links über die Bahn auf die Hashachar Herzl und wieder links auf die Lilienblumstraße, wo wir vor einer Bar neben einem Kino hielten. Wir seien, erklärte Polkes, mitten in der Gartenvorstadt von Tel Aviv. Es roch nach Orangenblüten und Meer. Alles wirkte hier sauberer und ordentlicher als in Jaffa. Europäischer jedenfalls. Ich sprach es an.
«Natürlich fühlen Sie sich hier zu Hause», sagte Polkes. «Hier wohnen nur Juden. Wenn es nach den Arabern ginge, wäre dieses ganze Land nicht viel mehr als ein Pinkelplatz.»
Wir gingen in ein Café mit einer Glasfront, auf der eine hebräische Beschriftung prangte. Es war das Café Kapulski. Aus dem Radio kam das, was ich als jüdische Musik bezeichnet hätte. Eine zwergenhafte Frau wischte den schwarz-weiß gefliesten Boden. An der Wand hing ein Bild von einem alten Mann mit einer wilden Haarmähne und offenem Hemdkragen. Er sah aus wie Einstein, nur ohne die Rotzbremse. Ich hatte keine Ahnung, wer das war. Daneben hing ein Bild von jemandem, der Ähnlichkeit mit Marx hatte. Dass es Theodor Herzl war, erkannte ich nur, weil Eichmann ein Foto von ihm in seiner sogenannten Judenakte gehabt hatte. Der Blick des Barmanns folgte uns, als wir durch einen Perlenvorhang in einen stickigen Nebenraum gingen, der voller Bierkästen und aufgestapelter Stühle stand. Polkes nahm drei Stühle herunter und platzierte sie auf dem Boden. Golomb nahm unterdessen drei Flaschen Bier aus einem Kasten, öffnete sie mit dem Daumen und stellte sie auf den Tisch.
«Hübscher Trick», bemerkte ich.
«Sie sollten ihn mal eine Dose Pfirsiche aufmachen sehen», sagte Polkes.
Es war heiß. Ich zog das Jackett aus und krempelte die Ärmel hoch. Die beiden Juden hielten sich immer noch geschlossen. Ich deutete mit dem Kinn auf die Beulen unter ihren Achseln. «Ist schon gut», sagte ich zu Polkes. «Ich habe schon mal eine Pistole gesehen. Ich kriege nicht gleich Albträume, wenn ich Ihre sehe.»
Polkes übersetzte das ins Hebräische, und Golomb nickte grinsend. Seine Zähne waren groß und gelb. Er legte das Jackett ab. Polkes tat es ihm nach. Sie trugen jeder einen britischen Webley, so groß wie ein Hundebein. Wir zündeten uns Zigaretten an, kosteten unser warmes Bier und musterten einander. Schließlich sagte Polkes: «Eliahu Golomb ist in der Haganah-Führung. Er ist für die radikale Judenpolitik Ihres Staates, weil die Haganah der Überzeugung ist, dass das nur eine Stärkung der jüdischen Bevölkerung Palästinas bedeutet. Mit der Zeit wird es hier mehr Juden als Araber geben, und dann können wir das Land übernehmen.»
Ich habe warmes Bier immer schon gehasst. Und ich hasse es, aus der Flasche zu trinken. Es macht mich rasend, Bier aus der Flasche trinken zu müssen. Lieber trinke ich gar keins.
«Damit eins gleich klar ist», sagte ich. «Es ist nicht mein Staat. Ich hasse die Nazis, und wenn Sie einen Funken Verstand hätten, würden Sie sie auch hassen. Die Nazis sind eine verdammte Horde von Lügnern, und man kann ihnen kein Wort glauben. Sie beide glauben an Ihre Sache. Gut. Aber in Deutschland gibt es nicht viel, an das es sich zu glauben lohnte. Außer vielleicht, dass ein Bier immer kalt sein und eine anständige Blume haben sollte.»
Polkes übersetzte alles, was ich gesagt hatte, und als er fertig war, brüllte Golomb etwas auf Hebräisch. Aber ich war mit meiner Kampfrede noch nicht am Ende.
«Wollen Sie wissen, woran sie glauben? Die Nazis? Leute wie Eichmann und Hagen? Sie glauben, Deutschland sei es wert, dafür zu lügen und zu betrügen. Und Sie sind verdammte Narren, wenn Sie das nicht begreifen. Gerade jetzt, in diesem Moment, sind diese beiden Nazihanswurste im Begriff, Ihren Freund, den Großmufti, in Kairo zu treffen. Sie werden einen Handel mit ihm schließen. Und am nächsten Tag werden sie dann einen Handel mit Ihnen schließen. Und dann werden sie wieder nach Deutschland fahren und abwarten, auf welche Seite Hitler setzt.»
Der Barmann kam mit drei Gläsern kaltem Bier und stellte sie uns hin. Polkes lächelte. «Ich glaube, Eliahu mag Sie», sagte er. «Er möchte wissen, was Sie hier in Palästina wollen. Mit Eichmann und Hagen.»
Ich sagte, ich sei Privatdetektiv, und erklärte ihnen die Sache mit Paul Begelmann. «Und nur damit Sie wissen, dass da keine edlen Motive im Spiel sind», setzte ich hinzu, «ich werde für meine Bemühungen ziemlich gut bezahlt.»
«Sie kommen mir nicht wie jemand vor, für den Geld die einzige Motivation ist», ließ Golomb mir mitteilen.
«Ich kann mir keine Prinzipien leisten», sagte ich. «Nicht in Deutschland. Leute mit Prinzipien landen im Konzentrationslager Dachau. Ich war in Dachau. Da hat es mir gar nicht gefallen.»
«Sie waren in Dachau?», fragte Polkes.
«Letztes Jahr. Eine Stippvisite, könnte man sagen.»
«Waren dort viele Juden?»
«Etwa ein Drittel der Häftlinge waren Juden», sagte ich. «Die übrigen waren Kommunisten, Homosexuelle, Zeugen Jehovas und ein paar Deutsche mit Prinzipien.»
«Und wozu gehörten Sie?»
«Ich war nur jemand, der seine Arbeit macht», sagte ich. «Ich bin, wie gesagt, Privatdetektiv. Und da rutscht man schon mal in Sachen rein, die man so nicht vorhergesehen hat. Im Moment kann einem das in Deutschland leicht passieren. Das vergesse ich manchmal.»
«Vielleicht möchten Sie ja für uns arbeiten?», sagte Golomb. «Es wäre nützlich zu wissen, was in den Köpfen der beiden Männer vorgeht, die wir treffen sollen. Und vor allem wäre es nützlich zu wissen, was sie mit Hadsch Amin vereinbaren.»
Ich lachte. Zurzeit schien mich jeder als Spitzel zu wollen. Die Gestapo wollte, dass ich den SD bespitzelte. Und jetzt wollte es die Haganah auch noch. Manchmal schien ich wirklich den falschen Beruf gewählt zu haben.
«Wir können Sie dafür bezahlen», sagte Golomb. «An Geld fehlt es uns nicht. Feivel Polkes hier ist unser Mann in Berlin. Sie könnten sich ja ab und zu treffen und Informationen austauschen.»
«Ich würde Ihnen nichts nützen», sagte ich. «Nicht in Deutschland. Ich bin, wie gesagt, nur ein Privatdetektiv, der seine Brötchen zu verdienen versucht.»
«Dann helfen Sie uns hier in Palästina», sagte Golomb. Er hatte eine tiefe, heisere Stimme, die perfekt zu seiner Körperbehaarung passte. Er sah aus wie ein dressierter Bär. «Wir bringen Sie nach Jerusalem, wo Sie und Feivel den Zug nach Suez nehmen können, um von dort nach Alexandria weiterzufahren. Wir zahlen Ihnen, was Sie verlangen. Helfen Sie uns, Herr Gunther. Helfen Sie uns, etwas aus diesem Land zu machen. Alle hassen die Juden, und das mit Recht. Wir kennen weder Ordnung noch Disziplin. Wir haben uns zu lange nur um unser individuelles Wohl gekümmert. Das Heil unseres Volkes kann einzig und allein in der Auswanderung nach Palästina liegen. Europa ist für die Juden passé, Herr Gunther.»
Polkes übersetzte und setzte dann achselzuckend hinzu: «Eliahu ist ein ziemlich extremer Zionist. Wenn auch seine Meinung innerhalb der Haganah durchaus verbreitet ist. Ich persönlich kann der Ansicht, dass wir den Judenhass verdient haben, nicht zustimmen. Aber er hat recht, wir brauchen Ihre Hilfe. Wie viel wollen Sie? In Pfund? Mark? Goldsovereigns vielleicht?»
Ich schüttelte den Kopf. «Ich helfe Ihnen nicht für Geld», sagte ich. «Geld bieten mir alle.»
«Aber Sie werden uns helfen», sagte Polkes. «Nicht wahr?»
«Ja, ich werde Ihnen helfen.»
«Warum?»
«Weil ich in Dachau war, meine Herren. Einen besseren Grund wüsste ich nicht. Wenn Sie dort gewesen wären, würden Sie’s verstehen.»
Kairo war der Diamantschmuck am Griff des Nildeltafächers. Jedenfalls behauptete das mein Baedeker. Für mich schien es wesentlich profaner. Es war einfach die größte Stadt des Kontinents. Wobei «Stadt» in diesem Fall ein unzureichendes Wort schien. Kairo schien so viel mehr zu sein als nur eine Metropole. Es war wie eine Insel – ein historisches, religiöses und kulturelles Herzland, eine Stadt, die das Vorbild aller später entstandenen Städte war und zugleich ihr Gegenentwurf. Kairo faszinierte und beängstigte zugleich.
Ich nahm mir ein Zimmer im National im Ismailiya-Viertel, keine halbe Meile östlich des Nils und des Ägyptischen Museums. Feivel Polkes ging ins Savoy am südlichen Ende derselben Straße. Das National war kaum kleiner als ein stattliches Dorf, mit Zimmern, so groß wie Kegelbahnen. Einige dienten als verräucherte Hukah-Höhlen, wo nicht weniger als ein Dutzend Araber im Schneidersitz auf dem Boden saßen und an großen Wasserpfeifen saugten. Die Halle dominierte ein mächtiges Reuters-Anschlagbrett, und wenn man die Gästelounge betrat, rechnete man schon fast damit, Lord Kitchener in einem Sessel sitzen zu sehen, Zeitung lesend und seinen Schnurrbart zwirbelnd.
Ich hinterließ Eichmann eine Nachricht und traf mich dann später mit ihm und Hagen in der Hotelbar. Sie waren in Begleitung eines weiteren Deutschen – Dr. Franz Reichert vom Deutschen Nachrichtenbüro in Jerusalem, der sich aber bald entschuldigte, da er, wie er sagte, an Magenbeschwerden litt.
«Vielleicht was Falsches gegessen», sagte Hagen.
Ich klatschte nach einer Fliege, die sich auf meinem Hals niedergelassen hatte. «Oder was Falschem als Nahrung gedient.»
«Wir waren gestern Abend in einem bayerischen Restaurant», erzählte Eichmann. «Beim Hauptbahnhof. War aber leider nicht sonderlich bayerisch. Das Bier war in Ordnung. Aber das Wiener Schnitzel war vom Pferd, würde ich sagen. Wenn nicht sogar vom Kamel.»
Hagen stöhnte und hielt sich den Magen. Ich erklärte, ich hätte Feivel Polkes mitgebracht und er wohne im Savoy. «Da hätten wir auch hingehen sollen», beschwerte sich Hagen. Dann sagte er: «Warum Polkes nach Kairo gekommen ist, weiß ich ja. Aber warum sind Sie hier, Papi?»
«Zum einen hatte ich das Gefühl, dass unser jüdischer Freund nicht recht glauben wollte, dass Sie wirklich hier sind», sagte ich. «Also sehen Sie es als Zeichen guten Willens. Zum anderen waren meine Geschäfte schneller erledigt, als ich gedacht hatte. Und da habe ich mir gesagt, dass eine solche Chance, Ägypten zu sehen, wohl nicht so bald wiederkommt. Ergo bin ich jetzt hier.»
«Danke», sagte Eichmann. «Ich weiß es zu schätzen, dass Sie ihn hergebracht haben. Sonst hätten wir ihn wahrscheinlich gar nicht mehr getroffen.»
«Gunther ist ein Spitzel», sagte Hagen. «Warum sollten wir ihm irgendwas glauben?»
«Wir haben wieder versucht, Visa für Palästina zu beantragen», sagte Eichmann, ohne auf Hagens Einwand einzugehen. «Und sie wurden uns wieder verweigert. Morgen probieren wir es nochmal. Vielleicht erwischen wir dann einen Konsularbeamten, der nichts gegen Deutsche hat.»
«Die Briten haben nichts gegen Deutsche», erklärte ich ihm. «Sie haben was gegen Nazis.» Ich schwieg, aber als mir aufging, dass dies eine gute Gelegenheit war, mich bei ihnen lieb Kind zu machen, sagte ich: «Aber wer weiß, vielleicht war ja der Beamte vom letzten Mal Jude.»
«Eher nicht», sagte Eichmann. «Ich glaube, er war Schotte.»
«Hören Sie», sagte ich im Ton müder Aufrichtigkeit. «Ich weiß nicht, warum ich nicht ehrlich sein sollte. Es war nicht Ihr Chef, Franz Six, der mich beauftragt hat, Sie zu bespitzeln. Es war Gerhard Flesch. Von der Judenabteilung der Gestapo. Er hat mir gedroht, Nachforschungen über meine rassische Abstammung anzustellen, wenn ich’s nicht tue. Was natürlich reiner Bluff ist. In meiner Familie gab es keine Juden. Aber Sie kennen ja die Gestapo. Die können einen durch alle möglichen Reifen springen lassen, bis man bewiesen hat, dass man kein Jude ist.»
«So nichtjüdisch wie Sie sieht doch kaum jemand aus, Gunther», sagte Eichmann.
Ich sagte achselzuckend: «Er sucht Beweise dafür, dass Ihr Referat korrupt ist. Na ja, ich hätte es ihm natürlich sagen können, bevor wir abgereist sind. Das mit meinem Gespräch mit Six und Begelmann, meine ich. Aber ich hab’s nicht getan.»
«Und was werden Sie ihm sagen?», fragte Eichmann.
«Nicht viel. Dass Sie beide kein Visum bekommen haben. Dass ich gar keine Gelegenheit hatte, mehr mitzukriegen, als dass Sie bei Ihren Spesenabrechnungen mogeln. Ich meine, irgendwas muss ich ihm ja erzählen.»
Eichmann nickte. «Ja, das ist gut. Ist natürlich nicht das, was er will. Er will viel mehr. Zum Beispiel sämtliche Funktionen unseres Referats übernehmen.» Er klopfte mir auf die Schulter. «Danke, Gunther. Sie sind ein feiner Kerl, wissen Sie das? Ja. Sie können ihm sagen, ich hätte mir auf Spesen einen schicken neuen Tropenanzug gekauft. Das wird ihn auf die Palme bringen.»
«Den haben Sie ja auch auf Spesen gekauft», sagte Hagen. «Von dem übrigen Zeug mal ganz abgesehen. Tropenhelme, Moskitonetze, Wanderstiefel. Er hat mehr Material mitgeschleppt als die italienische Armee. Nur nicht das, was wir wirklich brauchen. Wir haben keine Pistolen. Wir sind im Begriff, uns mit dem gefährlichsten Terroristen in ganz Nahost zu treffen, und haben nichts zu unserer Selbstverteidigung.»
Eichmann zog eine Grimasse, was ihm nicht weiter schwerfiel. Sein normaler Gesichtsausdruck war schon fratzenhaft genug. Sooft er mich ansah, dachte ich, er würde mir gleich erklären, dass ihm meine Krawatte missfiel. «Es tut mir leid», sagte er zu Hagen. «Ich sagte es ja schon. Es ist nicht meine Schuld. Aber ich weiß nicht, was wir da jetzt noch machen könnten.»
«Wir waren auf der deutschen Botschaft und haben dort um Waffen gebeten», erklärte mir Hagen. «Aber ohne offizielle Genehmigung aus Berlin wollen sie uns keine geben. Und wenn wir die anfordern würden, stünden wir da wie die letzten Dilettanten.»
«Können Sie nicht einfach zu einem Waffenhändler gehen und sich Pistolen kaufen?», fragte ich.
«Die Briten sind wegen der Lage in Palästina so nervös, dass sie den Verkauf von Waffen in Ägypten verboten haben», sagte Hagen.
Ich hatte schon die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie ich es schaffen könnte, bei ihrem Treffen mit Hadsch Amin dabei zu sein. Jetzt sah ich eine Möglichkeit. «Ich kann eine Waffe besorgen», sagte ich. Ich wusste schon, wer mir eine leihen würde.
«Wie denn?», fragte Eichmann.
«Ich war schließlich mal bei der Kripo», erklärte ich ausweichend. «Es gibt immer Mittel und Wege, an Waffen zu kommen. In einer Stadt wie Kairo erst recht. Man muss nur wissen, wo man zu suchen hat. Die Unterwelt funktioniert überall auf der Erde gleich.»
Ich suchte Feivel Polkes in seinem Zimmer im Savoy auf.
«Ich weiß jetzt, wie ich bei ihrem Treffen mit Hadsch Amin dabei sein kann», erklärte ich. «Sie haben Angst vor der Istiqlal und vor den Moslembrüdern. Und sie haben Angst vor der Haganah. Und irgendwie haben sie es geschafft, ohne Pistolen zu reisen.»
«Die Angst ist vollkommen berechtigt», sagte Polkes. «Wenn Sie sich nicht bereit erklärt hätten, die beiden auszuhorchen, hätten wir sie vermutlich umgebracht und es dann den Arabern in die Schuhe geschoben. Wäre nicht das erste Mal gewesen. Gut möglich, dass der Großmufti seinerseits auf die Idee gekommen ist, uns etwas anzuhängen. Sie sollten vorsichtig sein, Gunther.»
«Ich habe mich erboten, in der Kairoer Unterwelt eine Waffe zu beschaffen und als ihr Leibwächter zu fungieren», sagte ich.
«Wissen Sie denn, wo Sie hier eine Waffe kaufen können?»
«Nein. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir Ihren Webley borgen.»
«Kein Problem», sagte Polkes. «Ich kriege jederzeit einen neuen.» Er zog das Jackett aus, schnallte sein Holster ab und reichte es mir. Der Webley war so schwer wie ein enzyklopädisches Lexikon und beinah ebenso unhandlich. «Das ist ein Kipplaufrevolver mit Spannabzug, Kaliber fünfundvierzig», erklärte Polkes. «Wenn Sie damit schießen müssen, bedenken Sie zwei Dinge: Zum einen gibt es einen Rückschlag, als ob Sie ein Maultier tritt. Und zum Zweiten hängt da eine gewisse Geschichte dran, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also werfen Sie das Ding in den Nil, wenn Sie können. Und noch eins. Seien Sie vorsichtig.»
«Das sagten Sie schon.»
«Ich meine es ernst. Das sind die Kerle, die Lewis Andrews ermordet haben, den Hochkommissar von Galiläa.»
«Ich dachte schon, das waren Ihre Leute.»
Polkes grinste. «In diesem Fall nicht. Wir sind jetzt in Kairo. Kairo ist nicht Jaffa. Hier sind die Briten zurückhaltender. Hadsch Amin wird nicht zögern, Sie alle drei umzubringen, wenn er glaubt, Sie könnten mit uns ins Geschäft kommen, also tun Sie so, als gefiele Ihnen das, was er sagt, auch wenn es nicht der Fall ist. Diese Leute sind Irre. Religiöse Fanatiker.»
«Ihre Leute doch auch, oder nicht?»
«Nein, wir sind einfach nur Fanatiker. Das ist etwas anderes. Wir gehen nicht davon aus, dass Gott erfreut ist, wenn wir jemandem den Schädel wegpusten. Die schon.»
Das Treffen fand in Eichmanns riesiger Suite im National statt.
Der Großmufti, einen Kopf kleiner als alle Übrigen im Raum, trug einen weißen Turban und ein schwarzes Gewand. Er war absolut humorlos und ziemlich aufgeblasen, was durch das kriecherische Verhalten seiner Gefolgsleute zweifellos noch gefördert wurde. Am meisten verblüffte mich, wie ähnlich er Eichmann sah. Eichmann mit ergrautem Bart. Vielleicht verstanden sie sich deshalb so gut.
Hadsch Amin war in Begleitung von fünf Männern, alle im sandfarbenen Tropenanzug mit Tarbusch, der ägyptischen Version des Fez. Sein Dolmetscher hatte ein graues Hitlerbärtchen, ein Doppelkinn und die Augen eines Mörders. Er hielt einen dicken, geschnitzten Gehstock in der Hand und trug wie die übrigen Araber – bis auf Hadsch Amin selbst – ein Schulterhalfter.
Hadsch Amin sprach nur Arabisch und Französisch, aber das Deutsch seines Dolmetschers war gut. Der Mann vom deutschen Nachrichtenbüro, Franz Reichert, der inzwischen von seinen Magenbeschwerden genesen war, übersetzte ins Arabische, was die beiden SD-Leute sagten. Ich saß neben der Tür, lauschte dem Gespräch und mimte eine Wachsamkeit, wie sie mir als selbsternanntem SD-Leibwächter zukam. Hauptsächlich redete Hadsch Amin, und was er sagte, war zutiefst schockierend – nicht zuletzt, weil ich nicht auf seinen abgrundtiefen Antisemitismus gefasst war. Auch Hagen und Eichmann mochten Juden nicht. Das war in Deutschland nichts Ungewöhnliches. Sie rissen Witze über die Juden und wollten sie aus dem öffentlichen Leben in Deutschland verbannt sehen, aber Hagens Antisemitismus schien mir naiv und der von Eichmann nicht viel mehr als Opportunismus. Hadsch Amin hingegen war von einem erbitterten Judenhass erfüllt.
«Die Juden», sagte Hadsch Amin, «haben eine Veränderung des Lebens in Palästina gebracht. Und wenn sie ungehindert so weitergeht, führt sie unweigerlich zur Vernichtung der Araber in Palästina. Wir haben ja nichts dagegen, dass Leute als Besucher in unser Land kommen. Aber die Juden kommen als Invasoren nach Palästina. Sie kommen als Zionisten, ausgestattet mit allen Äußerlichkeiten des modernen europäischen Lebens, die als solche schon einen Angriff auf die heiligsten Grundsätze des Islam darstellen. Wir sind die europäische Lebensart nicht gewohnt. Wir wollen sie nicht. Wir wollen, dass unser Land so bleibt, wie es war, ehe die Juden es überschwemmten. Wir wollen keinen Fortschritt. Wir wollen keinen Wohlstand. Fortschritt und Wohlstand sind die Feinde des wahren Islam. Und es wurde bereits genug geredet. Mit den Briten, den Juden, den Franzosen. Jetzt reden wir mit den Deutschen. Aber ich sage Ihnen, von nun an wird allein das Schwert über das Geschick dieses Landes entscheiden. Dessen sollten die Deutschen sich bewusst sein, bevor sie den Zionismus unterstützen. Unsere Politik ist es, alle Zionisten und diejenigen, die den Zionismus befördern, bis auf den letzten Mann zu vernichten. Aber ich bin nicht hierhergekommen, um Ihrem Führer zu drohen, Herr Eichmann. Deutschland ist kein imperialistisches Land wie Großbritannien. Es hat keinem einzigen arabischen oder moslemischen Land jemals etwas angetan. Es war im Krieg mit dem Osmanenreich verbündet. Ich habe selbst in der Osmanenarmee gedient. Deutschland hat immer gegen unsere imperialistischen und zionistischen Feinde gekämpft. Gegen die Franzosen. Die Briten. Die Russen. Die Amerikaner. Dafür gebührt Ihrem Volk unsere Dankbarkeit und Bewunderung. Nur dürfen Sie uns keine Juden mehr schicken, Herr Eichmann. Ich habe das großartige Buch des Führers gelesen. Zwar nur in der Übersetzung. Aber ich glaube dennoch behaupten zu dürfen, dass ich das Denken des Führers kenne, meine Herren. Er hasst die Juden wegen der Niederlage, die sie 1918 über Deutschland gebracht haben. Er hasst die Juden, weil es der Jude Chaim Weizmann war, der das Giftgas erfand, das den Führer im Krieg verletzte und zu seiner vorübergehenden Erblindung führte. Für seine Wiederherstellung danken wir Gott. Der Führer hasst die Juden, weil sie Amerika dazu gebracht haben, an der Seite der britischen Zionisten in den Krieg einzutreten, und die dazu beitrugen, dass Deutschland den Krieg verlor. Das alles verstehe ich nur zu gut, meine Herren, weil auch ich die Juden hasse. Aus unzähligen Gründen. Vor allem aber hasse ich den Juden als Verfolger Jesu, der ein Prophet Gottes war. Deshalb sichert einem Moslem die Tötung eines Juden den sofortigen Eingang in den Himmel und in die erhabene Gegenwart des allmächtigen Gottes. Meine Botschaft für den Führer ist folgende: Juden sind nicht nur die erbittertsten Feinde der Moslems, sie sind auch ein verderbliches Element in der Welt. Dies aufzudecken, war die größte Erkenntnis, die der Führer der Welt beschert hat. Nach dieser Erkenntnis zu handeln, wird in meinen Augen das größte Vermächtnis des Führers an die Welt sein. Entschieden danach zu handeln. Denn es ist keine Lösung der Judenfrage in Deutschland und Europa, immer weiter Juden nach Palästina zu exportieren. Es muss eine andere Lösung gefunden werden, meine Herren. Die endgültige Lösung. Dies ist die Botschaft, die Sie Ihren Vorgesetzten überbringen müssen. Dass der beste Weg, mit dem Judenproblem fertig zu werden, darin besteht, die Quelle in Europa trockenzulegen. Und ich leiste dem Führer dieses feierliche Gelöbnis. Ich werde ihm helfen, das britische Empire zu vernichten, wenn er verspricht, die gesamte jüdische Bevölkerung Palästinas zu liquidieren. Alle Juden, überall, müssen getötet werden.»