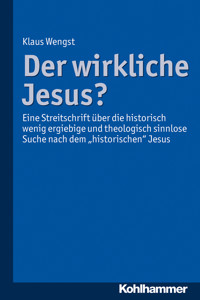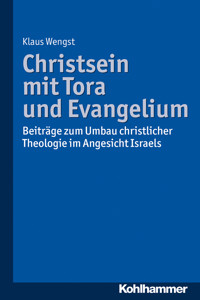Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
One of the reviewers of this commentary called it a ?commentary you can read=. This new edition has tried to make it even more readable. Following two previous editions, it has now not only been revised stylistically but also shortened, in order to publish it in a single volume. The commentary=s primary goal still applies, of course: renewal of the relationship between Christians and Jews, combined with a non-polemical, sympathetic and theologically deep-rooted perception of the Jewish people. This is in no sense an ideological narrowing, but rather is required by the text. The Gospel according to St John & like the other New Testament scriptures as well & is based on the Jewish Bible and arose in a Jewish context. To speak of ?Christianity= in the first century is simply anachronistic. In interpreting polemical statements made in an internal Jewish dispute, the commentary takes into account not only the situation in which they arose, but also the fact that our own situation today is substantially different from that. This prohibits a responsible interpretation from simply repeating statements that occur in such a context. More recent publications are also taken into account in the new edition, and fresh debate is sought particularly on passages in which contradictory interpretative approaches diverge.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1743
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Theologischer Kommentar zum Neuen Testament
Herausgegeben von
Ekkehard W. Stegemann Angelika Strotmann Klaus Wengst
Band 4
Klaus Wengst
Das Johannesevangelium
Neuausgabe
Verlag W. Kohlhammer
Umschlagbild entnommen aus „Nestle-Aland – Novum Testamentum Graece“, S. 247
27. revidierte Auflage
© 1898, 1993 Deutsche Bibelgesellschaft
1. Auflage 2000/2001
2. Auflage 2004/2007
Neuausgabe in einem Band 2019
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-033331-4
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-033336-9
epub: ISBN 978-3-17-033337-6
mobi: ISBN 978-3-17-033338-3
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Ein Rezensent nannte diesen Kommentar einen 'Kommentar zum Lesen'. Die Neuausgabe versucht, ihn noch lesbarer zu machen. Dafür wurde er nach zwei Auflagen nicht nur sprachlich überarbeitet, sondern auch gekürzt, sodass er in einem Band erscheinen kann. Das primäre Ziel der Kommentierung gilt selbstverständlich weiter: eine Erneuerung des christlich-jüdischen Verhältnisses, verbunden mit einer unpolemischen, verstehenden und theologisch vertieften Wahrnehmung des jüdischen Volkes. Das ist keine ideologische Verengung, sondern vom Text geboten. Das Johannesevangelium - wie andere neutestamentliche Schriften auch - basiert auf der jüdischen Bibel und ist in einem jüdischen Kontext entstanden. Für das 1. Jahrhundert von 'Christentum' zu reden, ist schlicht anachronistisch. Bei der Auslegung der in einem innerjüdischen Streit gemachten polemischen Aussagen bedenkt der Kommentar nicht nur diese Entstehungssituation, sondern auch, dass sich die eigene Situation davon beträchtlich unterscheidet. Das verbietet es einer verantwortlichen Auslegung, in solchem Kontext stehende Aussagen einfach nachzusprechen.
In die Neuausgabe wurde neuere Literatur aufgenommen und dabei vor allem an Stellen, an denen sich gegensätzliche Interpretationswege scheiden, die Diskussion gesucht.
Prof. Dr. Klaus Wengst lehrte Neues Testament und Judentumskunde an der Universität Bochum.
Vorwort
Mit dieser Bearbeitung zur Neuausgabe schließe ich, inzwischen schon elf Jahre pensioniert, meine Arbeit am Johannesevangelium ab. Sie hat mich über Jahrzehnte hin begleitet. Dass es dazu kam, hatte einen eher beiläufigen Anlass. Nachdem ich als Habilitierter – noch sehr jung und ziemlich „grün“ – zunächst nur weiter Seminare angeboten und eine sich an der Frühzeit des „Urchristentums“ orientierende Vorlesung gehalten hatte, sollte ich im Sommersemester 1972 meine erste exegetische Vorlesung halten. Ich traute mir nur eine „kleine“ Schrift zu und wählte den 1. Johannesbrief. In der Beschäftigung mit ihm bin ich dann erst zum Theologen geworden. Dafür war der Auftrag förderlich, für den Ökumenischen Taschenbuch-Kommentar die Johannesbriefe auszulegen. Mit der Kommentierung der gewichtigen Briefeinleitung konnte ich erst beginnen, nachdem ich einen Zugang zum Prolog des Johannesevangeliums und eine Einsicht über das Verhältnis beider Texte zueinander gefunden hatte. Das führte mich zum Johannesevangelium. Meine erste vierstündige Vorlesung hielt ich wenig später über die Abschiedsreden Joh 13–17. Sie ist mir vor allem deshalb in Erinnerung, weil ich vor den beiden wöchentlichen Vorlesungstagen oft erst nachts zwischen zwei und halb fünf genug Text niedergeschrieben hatte, dass der „Stoff“ für die um 9 Uhr c.t. beginnende Vorlesung ausreichte. Von damals bis heute habe ich mich nicht als kühler Beobachter über den Texten empfunden, sondern als in sie Verwickelter, der immer wieder versucht, von innen her und mit ihnen eine Verstehensperspektive zu finden.
Dabei haben sich natürlich Veränderungen ergeben. Die damals aufkommende sozialgeschichtliche Fragestellung, wie sich die Aussagen der Texte und die Lebensbedingungen ihrer Autoren und ersten Rezipienten zueinander verhalten, hat mein Suchen zunächst vorwiegend bestimmt. Aber genau diese Fragestellung führte mich hinsichtlich des Johannesevangeliums dazu, es im jüdischen Kontext zu verorten, in einem innerjüdischen Streit um Jesus als Messias. Das nötigte mich, verstärkt jüdische Tradition und gerade und besonders jüdisch-rabbinische wahrzunehmen. Dabei merkte ich, dass das am Anfang des Studiums in einem einzigen Semester gelernte und danach ab und an etwas aufgefrischte Bibelhebräisch nicht dazu befähigte, die rabbinischen Texte im Original zu lesen. Dazu bedurfte es einer intensiven Nachhilfe an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Zum Verstehen dieser Texte verhalf danach weiter gemeinsame Lektüre mit Jüdinnen und Juden. Ich habe dadurch einen tiefen Respekt vor dieser in Mischna, Talmudim und Midraschim gesammelten großen Tradition gewonnen, die die Grundlage aller Ausgestaltungen des Judentums bis heute bildet.
Schon während meiner noch anfänglichen Beschäftigung mit jüdischen Texten bei der Auslegung des Neuen Testaments bin ich durch glückliche Zufälle in das christlich-jüdische Gespräch hineingekommen – und nehme weiter an ihm teil. Ich habe dieses Gespräch als ein von gegenseitigem Respekt getragenes erlebt, von wirklicher Wahr-Nahme des und der jeweils anderen. Ich musste mich nicht selbst behaupten, sondern erfuhr mich in meiner Identität als Christ akzeptiert. Das ließ keine Verluste befürchten und machte offen dafür, mich ohne Angst verändern zu können. So ergab es sich für mich ganz selbstverständlich, keinen Absolutheits- und Exklusivitätsanspruch zu stellen. Dagegen beobachte ich im Johannesevangelium, dass genau ein solcher Anspruch das Gespräch immer wieder scheitern und zusammenbrechen lässt. Wie ist damit in der Auslegung dieses Evangeliums umzugehen?
Das primäre Ziel dieser von Peter von der Osten-Sacken angestoßenen Kommentarreihe war und ist: eine „Erneuerung des christlich-jüdischen Verhältnisses in Gestalt der Art und Weise der historisch-theologischen Auslegung des Neuen Testaments“, verbunden mit einer „unpolemischen, verstehenden und theologisch vertieften Wahrnahme des jüdischen Volkes“. Das ist keine ideologische Verengung, sondern vom Text geboten. Das Johannesevangelium – wie andere neutestamentliche Schriften auch – basiert auf der jüdischen Bibel und ist in einem jüdischen Kontext entstanden. Für das 1. Jahrhundert von „Christentum“ zu reden, ist schlicht anachronistisch. Bei der Auslegung der in einem innerjüdischen Streit im Johannesevangelium gemachten polemischen Aussagen bedenke ich nicht nur diese Entstehungssituation, sondern auch, dass sich die eigene Situation davon beträchtlich unterscheidet. Das verbietet es einer verantwortlichen Auslegung, in einem völlig anderen Kontext entstandene Aussagen einfach nachzusprechen. Der Unterschied der eigenen Situation zur Entstehungssituation der Texte ist bei deren Auslegung mit zu reflektieren.
Eine Rezension zur 1. Auflage dieses Kommentars war überschrieben: „Ein Kommentar zum Lesen“. Diese nach zwei Auflagen unternommene Neubearbeitung ist auch ein Versuch, ihn noch lesbarer zu machen. Ich habe ihn dabei nicht nur sprachlich überarbeitet, sondern ihn auch um nicht nur Weniges gekürzt, sodass er nun in einem Band erscheinen kann. Zugleich musste ich ihn aber auch wieder erweitern durch Aufnahme neuerer Literatur. Dabei habe ich die Diskussion vor allem an Stellen gesucht, an denen sich gegensätzliche Interpretationswege scheiden.
Bochum, im September 2018
Klaus Wengst
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1. Einige Erwägungen vorab
2. Die Entstehung des Johannesevangeliums in einer innerjüdischen Kontroverse
3. Konsequenzen für die Interpretation
4. Der zu interpretierende Text
5. Gattung und Gliederung
Der Prolog (1,1–18)
1. Zur Frage einer Vorlage
2. Zum religionsgeschichtlichen Hintergrund
3. Aufbau
4. Funktion
5. Einzelauslegung
Erster Teil: Das Wirken Jesu als des von Gott Gesandten findet Glaubende und Nichtglaubende (1,19–12,50)
I. Die erste Woche (1,19–2,12)
1. Das indirekte Zeugnis des Johannes (1,19–28)
2. Das direkte Zeugnis des Johannes angesichts Jesu (1,29–34)
3. Die ersten beiden Schüler aufgrund des Zeugnisses des Johannes (1,35–39)
4. Das Hinzukommen des Simon Petrus (1,40–42)
5. Das Hinzukommen des Philippus und Natanael beim Aufbruch nach Galiläa (1,43–51)
6. Hochzeit in Kana (2,1–12)
II. Erste Wirksamkeit in Jerusalem und Judäa (2,13–3,36)
1. Die Austreibung aus dem Tempel und das Wort über ihn (2,13–22)
2. Die Geburt aus dem Geist (2,23–3,21)
3. Das letzte Zeugnis des Johannes (3,22–36)
III. Durchreise durch Samarien und Wirken in Galiläa (4,1–54)
1. Einleitung: Aufbruch von Judäa nach Galiläa (4,1–3)
2. Jesus auf der Durchreise in Samarien (4,4–42)
3. Rückkehr nach Galiläa (4,43–54)
Exkurs: Ist die Textfolge in Kap. 5–7 zerstört?
IV. Zweites Wirken in Jerusalem: die Heilung eines Kranken am Teich Betesda (5,1–47)
1. Die Heilung eines Kranken (5,1–9a)
2. Überleitung (5,9b–16)
3. Weiterführung der Wundergeschichte im Blick auf Jesu Person (5,17–47)
V. Letztes Wirken am galiläischen Meer. Rückzug und Bekenntnis angesichts Jesu als des Lebensbrotes (6,1–71)
1. Speisung und Überfahrt (6,1–25)
2. Die Deutung des Speisungswunders (6,26–58)
3. Die Folge: Trennung in der Schülerschaft (6,59–71)
VI. Drittes Wirken in Jerusalem. Von Sukkot bis Chanukka (7,1–10,42)
1. Jesu Teilnahme an Sukkot (7,1–52)
[Nicht den Stab brechen über die, die sich verfehlen (7,53–8,11)]
2. Diskussionen im Tempel (8,12–59)
3. Die Heilung eines Blindgeborenen (9,1–10,21)
4. Erneute Auseinandersetzung an Chanukka und Rückzug Jesu (10,22–42)
VII. Die Auferweckung des Lazarus und ihre Folgen (11,1–57)
1. Einleitung (11,1–16)
2. Gespräch über die Auferstehung (11,17–17)
3. Die Wundertat der Auferweckung (11,28–44)
4. Die Folgen (11,45–57)
VIII. Abschluss des öffentlichen Wirkens Jesu am Beginn der letzten Woche seines Lebens (12,1–50)
1. Die Salbung in Betanien (12,1–11)
2. Jesu Einzug in Jerusalem (12,12–19)
3. Letzter Auftritt Jesu in der Öffentlichkeit (12,20–36)
4. Abschluss des ersten Teils (12,37–50)
Zweiter Teil: Der ans Kreuz gehende Jesus gibt sich den Glaubenden als zu Gott Zurückkehrender zu verstehen und verheißt seine Gegenwart im Geist (13,1–20,29)
I. Das letzte Mahl Jesu mit seinen Schülern vor Pessach (13,1–17,26)
1. Die Fußwaschung (13,1–20)
2. Die Ansage des Verrats (13,21–30)
3. Die erste Abschiedsrede (13,31–14,31)
4. Die zweite Abschiedsrede (15,1–16,33)
5. Das Gebet Jesu (17,1–26)
II. Die Festnahme Jesu, sein Prozess und seine Hinrichtung als Rückkehr zum Vater (18,1–19,42)
1. Die Festnahme Jesu, die Vernehmung vor Hannas und die Verleugnung des Simon Petrus (18,1–27)
2. Der Prozess Jesu vor Pilatus (18,28–19,16a)
3. Die Hinrichtung und Bestattung Jesu (19,16b–42)
III. Der auferweckte Gekreuzigte (20,1–29)
1. Mirjam aus Magdala und die beiden Schüler am leeren Grab (20,1–10)
2. Die Begegnung Jesu mit Mirjam aus Magdala (20,11–18)
3. Die Begegnung Jesu mit seinen Schülern (20,19–23)
4. Die Begegnung Jesu mit Thomas (20,24–29)
Epilog (20,30f.)
Nachtrag (21,1–25)
1. Erneute Begegnung Jesu mit Schülern am Meer von Tiberias (21,1–14)
2. Jesu Worte an Simon Petrus und über den Schüler, den er liebte (21,15–24)
3. Buchschluss (21,25)
Über- und Unterschrift
Anhang
Abkürzungen
Quellenverzeichnis
a) Bibel
b) Außerrabbinisches Judentum
c) Samaritanische Texte
d) Rabbinische Texte
e) Nichtjüdische antike Literatur
f) Inschriften
Sekundärliteratur
a) Kommentare zum Johannesevangelium
b) Übrige Literatur
Register
Altes Testament einschließlich Apokryphen
Neues Testament
Zwischentestamentliches und nachneutestamentliches Judentum
Alte Kirche
Nichtjüdische und nichtchristliche antike Autoren
Einleitung
1. Einige Erwägungen vorab
Ich beginne, indem ich von zwei widersprüchlichen Erfahrungen erzähle, die ich mit dem Johannesevangelium gemacht habe. Wenn ich einen Abendmahlsgottesdienst hielt und mich nicht ausdrücklich auf die Voten zur Entlassung der Abendmahlsgäste am Altar vorbereitet hatte, kamen mir in der Regel Worte aus dem Johannesevangelium in den Sinn. Dieses Evangelium ist offenbar ein Text, der in hohem Maße christliche Identität zum Ausdruck zu bringen vermag.
Als ich, spät genug, im März 1988, als Mitglied einer Gemeindegruppe zum ersten Mal in Israel war, ließ unser Pfarrer am Morgen des ersten Tages, einem Sonntag, den Bus am Stadtrand von Tel Aviv für eine Andacht halten. Für den Text hielt er sich an die fortlaufende Bibellese. Für jenen Tag war ein Ausschnitt aus Joh 8 vorgesehen. Ich konnte nicht anders, als den Text mit den Ohren unseres jüdischen Reiseleiters zu hören – und hätte mich am liebsten vor Scham unter meinem Sitz verkrochen. Als ich ihn einige Tage später auf sein Empfinden beim Hören eines solchen Textes ansprach, sagte er: „Ach, Johannes! Immer nur ‚die Juden‘, ‚die Juden‘. Das geht bei mir in ein Ohr hinein und sofort aus dem anderen wieder heraus.“
Ich stelle also fest, dass ich einerseits das Johannesevangelium in großer Selbstverständlichkeit zur christlichen Selbstvergewisserung benutzte und dass ich andererseits schamrot wurde, als es vor mithörenden jüdischen Ohren gelesen wurde. Wie kann ich das beides zugleich in seiner Widersprüchlichkeit aushalten und welche Konsequenzen sollte das für meine Lektüre dieses Evangeliums haben? Soll ich doch lieber alles beim Alten lassen und mir das jüdische Mithören wieder aus dem Kopf schlagen, weil es meine christliche Selbstvergewisserung stört? Soll ich es mir gar verbitten und verbieten, weil es nichts zur Sache tue? Aber das geht nicht, nachdem es mir einmal bewusst geworden ist. Es geht schon deshalb nicht, weil zumindest ein Jude anwesend ist, sooft Christen sich versammeln – wenn sie denn ernst nehmen, was ihnen Mt 18,20 verheißen ist. Aber ist das nur eine Frage höflicher Rücksichtnahme oder tut es auch etwas zur Sache? Für jüdisches Mithören sensibel zu sein, ist keine Frage bloßer Höflichkeit. Es gehört vielmehr zur Sache selbst, weil Jesus und die neutestamentlichen Zeugen keinen neuen und anderen Gott verkündet haben, der bis dahin unbekannt und unbezeugt gewesen wäre, sondern den in Israel bezeugten und bekannten Gott. Gott, den Jesus im Johannesevangelium immer wieder „Vater“ nennt, ist Israels Gott, der seinem Volk Treue zugesagt hat und hält und dem dieses Volk seinerseits Treue erwiesen hat und erweist.
Wenn ich also um Gottes willen nicht auf jüdisches Mithören verzichten kann, wäre es dann angezeigt, dass das Johannesevangelium – oder zumindest bestimmte Teile von ihm – besser nicht gelesen würde? Aber das geht auch nicht. Es ist Teil unseres Kanons, den wir nicht beliebig verändern können, sondern dem wir uns zu stellen haben. Es ist Teil unserer Geschichte, die wir nicht verdrängen dürfen. Müsste die Frage also lauten: Gibt es eine Möglichkeit, das Johannesevangelium zu lesen, ohne angesichts Israels schamrot zu werden? Aber so wäre die Frage nicht präzis genug, zumindest missverständlich gestellt. Es gibt ja im Blick auf die Auslegungs- und Wirkungsgeschichte realen Anlass zur Scham gegenüber Israel; und diese Scham ist nicht durch andere Auslegung schnell beiseitezuschieben, sondern wirklich anzunehmen und auszuhalten. Zu fragen wäre, ob sie dazu verhelfen kann, so zu lesen, dass bei der Lektüre des Johannesevangeliums nicht von vornherein ein Gespräch mit Jüdinnen und Juden unmöglich gemacht, sondern ermöglicht wird.
Wie können wir dieses Evangelium lesen und verstehen – wirklich verstehen? Es kann nicht darum gehen, bei bestimmten Stellen festzustellen, dass sie mir nicht „passen“, und sie sich dann irgendwie zurechtzulegen. Zum Versuch des Verstehens gehört es auch, die Frage zu stellen, warum die im Johannesevangelium überlieferten Aussagen, die angesichts Israels Befremden hervorrufen, so sind, wie sie sind. Es ist also die Frage nach den Entstehungsbedingungen des Evangeliums zu stellen, nach der Intention seiner Aussagen in der ihm vorgegebenen Situation. Zum Verstehen gehört es dann aber auch, die eigene Situation zu reflektieren und ihre Unterschiedenheit von der Ursprungssituation wahrzunehmen. Eine Sinnerhebung des Textes, losgelöst von seinen Situationen – der seines Autors und denen seiner Rezipienten –, wäre eine abstrakte Exegese. Dieselben Aussagen, in veränderter Situation wiederholt, bleiben nicht dieselben Aussagen. Das nötigt zum Mitbedenken der eigenen Situation schon in der Exegese – und nicht erst in der Homiletik.
Die Rede gegen eine „Exegese aus schlechtem Gewissen“ hat nur vordergründige Evidenz, ist aber nichtsdestotrotz ein unbedachtes Schlagwort. Können wir denn ein „gutes Gewissen“ haben? Wäre das nicht allenfalls ein ignorantes? Haben wir nicht mit Recht ein „schlechtes Gewissen“? Die allein wichtige Frage wäre dann, wie wir damit – auch exegetisch – umgehen. Wenn das schlechte Gewissen dazu führt, neutestamentliche Aussagen „umzudrehen“ oder vorschnell Sachkritik zu üben, wäre man von diesem Gewissen m. E. schlecht beraten. Ich halte es aber für unbedingt nötig, dass es sensibel macht für die Wirkung neutestamentlicher Aussagen in anderen Kontexten und dazu anleitet, deren Beachtung in die Auslegung einzubeziehen. Gegen eine Trennung in einen scheinbar objektiven wissenschaftlichen und einen „moralischen“ Bereich, für den Betroffenheit zugelassen werden könnte, ginge es um die Integration des Gewissens in den Vollzug exegetischer Arbeit selbst, um eine wirklich „gewissenhafte“ Exegese.
Von diesem Zugang, der Erschließung der Ursprungssituation mit ihren spezifischen Bedingungen und der Reflexion der Veränderungen, die zu unserer anderen Situation führten und sie ausmachen, erhoffe ich mir eine im Horizont des jüdisch-christlichenGesprächs mögliche Lektüre des Johannesevangeliums.
2. Die Entstehung des Johannesevangeliums in einer innerjüdischen Kontroverse1
Der meiner Einsicht nach entscheidende Ansatzpunkt für das Verständnis des Johannesevangeliums ist damit gegeben, dass es im Kontext einer scharfen Auseinandersetzung entstanden ist. Sie wurde geführt zwischen jüdischen Menschen, die den gekreuzigten Jesus für den Messias hielten, und der Mehrheit ihrer Landsleute, die diesen Glauben entschieden ablehnten – und dafür Gründe hatten. Zuvor sei aber herausgestellt, dass der Umgang mit der Schrift durch den Evangelisten mit Zitaten, Anspielungen und Hinweisen deutlich macht, dass die von ihm intendierte Leser- und Hörerschaft jüdisch bestimmt ist. Was Moser im Blick auf die von ihr untersuchten Kapitel 4 und 7 feststellt, wird vom gesamten Evangelium erhärtet: „Mit den Schriftbezügen wird also vorausgesetzt, dass die Mitglieder der Gemeinde Schriftkenner sind. Es wird zugleich bekräftigt, dass die Schrift für diese religiöse Gemeinschaft, die aus dem Judentum stammt, eine bleibende Bedeutung behält. […] Damit wird die jüdische Identität der joh(anneischen) Gemeinde betont und verstärkt.“2 Entsprechend konstatiert Felsch: „Die grundlegenden Traditionen, auf deren Hintergrund Johannes das Leben und Wirken Jesu erzählt, sind […] das Alte Testament, der jüdische Kult und die sonstigen Überlieferungen des Judentums seiner Zeit, aus denen sich parallel zur Kirche das rabbinische Judentum entwickelte“.3
Hier ist jedoch einen Augenblick innezuhalten und auf die Frage einzugehen: Ist das Johannesevangelium für eine Gemeinde geschrieben oder setzt es eine allgemeine Leserschaft voraus? Zum Bedenken dieser Frage fordert vor allem der Kommentar von Thyen heraus. Er schreibt: „Als literarisches Werk ist unser Evangelium kein an eine vermeintliche johanneische Gemeinde gerichteter Brief, aus dem deren Irrungen und Wirrungen erschlossen werden könnten, sondern ein Buch für Leser, für Menschen aller Generationen, die des Lesens fähig sind“ (4). Dass das Johannesevangelium und auch die drei anderen Evangelien zuerst und vor allem als immer wieder zu gebrauchende Lesetexte in den Versammlungen einer Gemeinde oder auch mehrerer Gemeinden geschrieben wurden, die der jeweilige Evangelist kannte, zeigt schon der bloße Umstand ihrer Erhaltung. Wer anders als Gemeinden hätte ein Interesse am regelmäßigen Gebrauch dieser Texte haben können, sodass sich die Notwendigkeit ergab, sie, auf schlecht haltbarem Papyrus geschrieben, immer wieder abzuschreiben? Natürlich können des Lesens Fähige auch späterer Generationen die Evangelien lesen. Aber wäre es für diese Späteren nicht wichtig, sich über die höchst wahrscheinlich große Unterschiedlichkeit ihrer Situation von der der ersten Leser-und Hörerschaft eine mögliche annähernde Vorstellung zu machen? Ein Text bleibt nicht derselbe, wenn er unvermittelt in völlig anderer Situation gelesen und gehört wird. Auch Thyen stellt sich eine vom Evangelisten Johannes intendierte Leserschaft vor. Sie erscheint mir als verdächtig bildungsbürgerlich bis professoral. „Angesichts des hohen literarischen Anspruchs an seinen impliziten Leser und zumal wegen der poetischen Raffinesse seines Prologs […] dürfte das sich selbst nachdrücklich als ‚geschrieben‘ deklarierende Evangelium (20,30f u. 21,24) auf ein Publikum gebildeter Leser bzw. Vorleser zielen“ (101). Außerordentlich oft spricht Thyen hinsichtlich des Evangelisten von einem „intertextuellen Spiel“ und vom „Spielen“ mit Texten, außer mit denen der jüdischen Bibel auch mit denen aller drei anderen Evangelien. Er spiele mit diesen literarischen Texten so, „daß er seinem Leser damit zugleich das Vermögen zutraut und zumutet, dieses Spiel zu würdigen und seine Freude daran zu haben“ (101). Dass das Johannesevangelium sozusagen für den Markt zum literarischen Genuss für Gebildete geschrieben sei und „einer unvorhersehbaren Leser- oder Zuhörerschaft allererst zu einem christlichen Selbstverständnis erschließen“ wolle (540; sic), halte ich für extrem unwahrscheinlich, ganz davon abgesehen, dass für die Zeit der Entstehung dieses Evangeliums die Rede vom „christlichen Selbstverständnis“ schlicht ein Anachronismus ist. Ich bleibe daher dabei, dass dieses Evangelium für eine „bedrängte Gemeinde“ geschrieben wurde, die ihres Glaubens an Jesus als den Gesalbten vergewissert und so zum „Bleiben“ veranlasst werden soll. Was Johannes in ihr an „Bildung“ voraussetzt, ist Kenntnis der jüdischen Bibel. Und das ist im Judentum auch der Antike nichts Ungewöhnliches.
Der Evangelist Johannes4 schreibt die Geschichte Jesu neu. Er schreibt sie so, dass die das Evangelium lesende und hörende Gemeinde in den Auseinandersetzungen Jesu mit „den Juden“ und „den Pharisäern“ ihre eigenen Auseinandersetzungen mit der jüdischen Mehrheitspositionin ihrer Umgebung wiedererkennen, dass sie in der Darstellung der Schülerschaft Jesu sich selbst entdecken kann. Die Erfahrungen, die Johannes und seine Gemeinde in ihrer Gegenwart machen, wirken sich also aus auf seine Darstellung der Geschichte Jesu, färben sozusagen darauf ab. Und so schreibt er die Geschichte Jesu in solcher Weise neu, dass die Gemeinde in den Auseinandersetzungen ihrer Situation gestärkt wird.
Dass in der Tat die Auseinandersetzung einer jüdischen Minderheit mit der jüdischen Mehrheit die die Gegenwart des Johannes und seiner Gemeinde bestimmende Situation ist, zeigt sich am deutlichsten in dem dreimal im Evangelium begegnenden Motiv der Distanzierung von der synagogalen Gemeinschaft. An allen drei Stellen sind Verhältnisse vorausgesetzt, die für die erzählte Zeit, die Zeit Jesu, nicht vorstellbar sind, die aber ausgezeichnet in die Zeit nach 70 n. Chr. passen, sodass damit ein Datum für die frühest mögliche Abfassung des Evangeliums gegeben wäre.
Die erste Stelle ist 9,22. Sie steht innerhalb der Erzählung von der Blindenheilung. Nachdem der Geheilte selbst behördlich vernommen worden ist, werden seine Eltern herbeizitiert. Die Vernehmenden wollen von ihnen wissen, ob es sich bei dem fraglichen Menschen um ihren Sohn handle, der blind geboren worden sei, und wieso er jetzt sehe (V. 19). Die Eltern beantworten klar und eindeutig die Frage nach der Identität ihres Sohnes. Der Frage nach seiner Heilung aber, bei deren Beantwortung Jesus ins Spiel kommen müsste, weichen sie aus, und verweisen auf die Mündigkeit ihres Sohnes (V. 20f.). Zu diesem Verhalten merkt Johannes zunächst an: „Das aber sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten“ (V. 22a). Auf das Jerusalem der Zeit Jesu bezogen, wäre diese Aussage mehr als seltsam. Was sollte es da heißen, dass die Eltern, als wären sie selbst keine Juden, „die Juden“ fürchteten? So kann nur in einer Umgebung geredet werden, in der Juden nicht die einzigen Bewohner sind, in der sie aber die dominierende Kraft bilden. Die Eltern fürchten „die Juden“, obwohl sie gar nicht als Anhänger Jesu geschildert werden, und geben deshalb Nichtwissen vor, sobald die Person Jesu ins Blickfeld gerät. Hier ist eine Atmosphäre der Angst vorausgesetzt, in der es opportun erscheint, nicht mit Jesus in Verbindung gebracht zu werden. Das unterstreicht die in V. 22b gegebene Begründung für die Furcht der Eltern: „Denn schon hatten die Juden untereinander verabredet, dass – wer immer ihn als Gesalbten bekenne – von der synagogalen Gemeinschaft ferngehalten würde.“ Aufschlussreich ist das Wörtchen „schon“. Es schließt ein, dass – wie immer es sich mit dem hier genannten Geschehen auf der Zeitebene der Erzählung verhalten haben mag – es sich auf alle Fälle um ein solches handelt, das Johannes und seiner ersten Leser- und Hörerschaft als gegenwärtige Erfahrung vertraut und also auf ihrer Zeitebene zu Hause ist. Als Grund des Distanzierung gilt, Jesus als Gesalbten, als Messias, zu bekennen. Am Schluss einer zweiten Vernehmung des Geheilten, in der er sich zu Jesus bekennt, heißt es: „Und sie jagten ihn hinaus“ (V. 34). Vordergründig ist natürlich das Hinausjagen aus dem Versammlungsraum gemeint. Aber dieser Satz kann nicht ohne Bezug auf V. 22 gelesen werden. Was dort die Eltern befürchteten und wovor sie sich durch klug taktierendes Verhalten zu schützen wussten, das trifft hier ihren Sohn: Er wird von der synagogalen Gemeinschaft entfernt.
Die zweite Stelle, 12,42, redet nach der Feststellung allgemeinen Unglaubens von doch vorhandenem Glauben, der aber nicht wirklich zum Zuge kommt: „Gleichwohl waren doch auch viele von den Ratsherren zum Glauben an ihn gekommen, aber wegen der Pharisäer bekannten sie das nicht, damit sie nicht von der synagogalen Gemeinschaft ferngehalten würden.“ Diese Aussage ist für die Zeit vor 70 n. Chr. unvorstellbar, in der die Pharisäer eine Gruppe unter anderen waren, aber keineswegs über die ihnen hier zugeschriebene Macht verfügten. Die Aussage von 12,42 wird aber verstehbar, wenn sich in ihr Erfahrungen zur Zeit der Abfassung des Evangeliums widerspiegeln: Die Gemeinde hatte Sympathisanten aus der Führungsschicht, die aber aus Furcht vor den Folgen ein offenes Bekenntnis unterließen und sich lieber bedeckt hielten. Für sich selbst „glauben“ sie zwar, aber sie „bekennen“ nicht, machen ihren Glauben nicht öffentlich.
Die dritte Stelle schließlich ist 16,2, an der der Abschied nehmende Jesus seinen Schülern ankündigt: „Man wird euch von der synagogalen Gemeinschaft fernhalten.“ Hier ist nun ganz deutlich, dass es nicht um eine Maßnahme zur Zeit Jesu geht, sondern dass die nachösterliche Zeit im Blick ist. Da auch sonst in den Abschiedsreden die Schüler transparent für die Gemeinde sind, sodass Johannes Jesus über die Schüler zu seiner Leser- und Hörerschaft sprechen lässt, ist es von vornherein wahrscheinlich, dass es bei dem hier angekündigten Geschehen nicht um ein für die Gemeinde längst vergangenes und sie nicht mehr berührendes Problem geht. Es ist vielmehr bedrängende Erfahrung ihrer Gegenwart; und weil sie diese Erfahrung macht, lässt sie Johannes von Jesus vorausgesagt sein, um sie aushalten zu können.
Wie lässt sich diese durch die Distanzierung von der synagogalen Gemeinschaft gekennzeichnete Situation genauer bestimmen und beschreiben? In 16,2 steht daneben die Ankündigung von Tötungen. Was immer hier genauer im Blick ist, zeigt doch das bloße Nebeneinander beider Ankündigungen, dass die Distanzierung eine einschneidende Erfahrung gebildet haben muss. Es kann daher nicht der Synagogenbann gemeint sein, ein zeitlich befristeter Ausschluss aus der synagogalen Gemeinschaft, der Besserung eines Mitgliedes, das sich verfehlt hat, beabsichtigt und dessen volle Wiedereingliederung zum Ziel hat. Auf Trennung tendierende Maßnahmen sind am besten vorstellbar für die Zeit nach 70, und zwar gegenüber Häretikern. Für die Zeit vor 70 von „Häretikern“ zu reden, ist nicht sinnvoll, da in ihr das Judentum aus unterschiedlichen Gruppen bestand. Durch die Zeitumstände bedingt und gefordert, bildet sich erst nach 70 ein pharisäisch-rabbinisch bestimmtes Judentum heraus, das die weitere Geschichte des jüdischen Volkes ermöglicht und prägt. Erst von ihm Abweichende können als Häretiker bezeichnet werden.
Das Jahr 70 mit dem Ende des vierjährigen jüdisch-römischen Krieges bildet einen tiefen Einschnitt in der Geschichte des Judentums: das Land vom Krieg ausgesaugt, ein großer Teil der Bevölkerung getötet oder in die Sklaverei verkauft, viele Städte und Orte zerstört, Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht, sein Tempel – der einzige religiöse Mittelpunkt – niedergebrannt. Die Aufständischen, soweit sie überlebten, hatten durch den Ausgang des Krieges jede Perspektive verloren. Die Sadduzäer waren mit dem Tempel ihrer geistigen und ökonomischen Basis verlustig gegangen. Das Zentrum der Essener in Qumran war schon im Sommer 68 von den Römern völlig zerstört worden. Die unmittelbar vorher in benachbarten Höhlen versteckten Bibliotheksbestände blieben dort. Diejenigen, die sie hatten retten wollen, vermochten sie nicht zu neuem Gebrauch herauszuholen. Wie konnte in dieser katastrophalen und trostlosen Situation jüdisches Überleben möglich sein?
Noch vor dem Ende des Krieges schmuggelten zwei Schüler ihren sich tot stellenden Lehrer Jochanan ben Sakkaj im Sarg aus dem belagerten Jerusalem.5 Der erwirkte beim römischen Feldherrn Vespasian, dem späteren Kaiser, dass dieser ihm die Eröffnung eines Lehrhauses in dem in der Küstenebene gelegenen kleinen Ort Javne erlaubte. Dieses Lehrhaus wurde zur Keimzelle jüdischen Überlebens nach der Katastrophe des Jahres 70. In der Bindung an die Tora und in Aufnahme und Weiterführung der Tradition wurden Wege jüdischer Identitätsbildung in veränderter Situation gesucht und gefunden. Die Lehrer von Javne mussten mit dem von den Siegern gesetzten Faktum, der Zerstörung des Tempels ohne Aussicht auf Wiederaufbau, umgehen. Dieses Faktum schien weite Teile der Tora, die den Tempel und seine vielfältigen Funktionen betreffen, hinfällig zu machen. Die Zerstörung des Tempels war bittere Wirklichkeit. Die Lehrer von Javne ignorierten diese von den Römern bestimmte Wirklichkeit zwar nicht, sondern trugen ihr durchaus Rechnung, aber sie erkannten sie auch nicht als die entscheidende Wirklichkeit an. Die Wirklichkeit schlechthin war für sie die Tora. Deshalb beschäftigten sie sich auch weiter mit ihr in allen ihren Teilen. So sagten sie etwa im Blick auf die vielfältigen Opfervorschriften: Wer sich mit ihnen beschäftige, dem rechne Gott es an, als habe er die Opfer dargebracht. Was die Opfer im Tempel für das Verhältnis des Volkes und der Einzelnen zu Gott und für das Verhältnis untereinander geleistet hatten, sollte erhalten bleiben. Dafür fand man nichtkultische Formen. Für eine solche Vorgehensweise waren Pharisäer dadurch prädestiniert, dass sie schon zur Zeit des Tempels die Reinheitsvorschriften, die nach der Tora nur den Priestern und Leviten während ihres Tempeldienstes gelten, in die täglichen Lebensvollzüge umgesetzt hatten. Diese Waschungen erinnerten als äußere Zeichen das Tempelpersonal an die Heiligkeit Gottes, dem sie in dessen Gegenwart im Tempel zu entsprechen hatten. Indem Pharisäer diese Waschungen im Alltag übernahmen, trugen sie der Einsicht Rechnung, dass Gott nicht nur im Tempel gegenwärtig ist, sondern dass sie überall und jederzeit in der Verantwortung vor dem lebendigen und heiligen Gott stehen. Sich das an Punkten des Tagesablaufs in Erinnerung zu rufen, dazu dienten die aus den Tempelvorschriften übernommenen Waschungen. So gab es hier schon einen Gottesdienst im Alltag der Welt. Die Lehrer von Javne wiesen für den konkreten Lebensvollzug Wege, die als von Gott gebotene gegangen werden konnten. Sie taten das, indem sie in der Auslegung der Tora die Tradition aufnahmen und im Diskurs weiterführten. Während der Tempelzeit gab es auch schon Synagogen, in denen man sich zur Verlesung von Tora und Propheten, zum Beten sowie zum Lehren und Lernen versammelte. Sie wurden jetzt umso wichtiger.
Dabei gab es eine breite Diskussion. Abweichende Stellungnahmen, die auf derselben Basis erfolgten, wurden nicht unterdrückt und ausgeschieden, sondern mit der Mehrheitsmeinung weiter überliefert. Darin zeigt sich ein Bemühen um weite Integration. Die Lehrer von Javne waren nicht auf scharfe Abgrenzung aus, sondern auf Sammlung.6 Doch gab es auch Gruppen, die sich nicht integrieren ließen. Zu ihnen gehörte diejenige jüdische Gemeinschaft, die Jesus für den Messias hielt und darauf aus war, dass alle anderen sich diesem Glauben anschlössen, und für den Fall, dass sie es nicht täten, mit dem Gericht Gottes drohte. Gerade in der Phase der Neukonsolidierung nach dem Krieg schien es für die Vertreter der jüdischen Mehrheit schon aus politischen Überlebensgründen geboten, sich von einer messianischen Bewegung zu distanzieren, die dem Verdacht der Illoyalität ausgesetzt war. Darüber hinaus gab es theologische Gründe, dem Anspruch zu widersprechen, Jesus sei der Messias. In der auf Jesus als Messias bezogenen Gemeinschaft wurden gewiss Erfahrungen von schon bestehender Gegenwärtigkeit des messianischen Reiches gemacht. Aber für die Menschen außerhalb ihrer war es ein wesentlicher Punkt, dass für sie vom messianischen Reich nichts zu bemerken war, sondern nur das unveränderte Weitergehen des alten Weltlaufs festgestellt werden konnte. Wie sollte da der Messias schon gekommen sein? Wenn die Bibel unter der Voraussetzung des Glaubens an die Messianität Jesu gelesen wird, ist es möglich und naheliegend, dass dieser Glaube sich dabei bestätigt findet. Aber fehlt diese Voraussetzung, erbringt die Lektüre Gegengründe. So kann auf Aspekte der Biographie Jesu hingewiesen werden, die zu einschlägigen Aussagen von Schrift und Tradition in Widerspruch stehen. Das lässt dann nur die Folgerung zu: Jesus kann nicht der Messias sein; der für ihn erhobene Anspruch wird zu Unrecht geltend gemacht. Kein Evangelium spiegelt so stark die Diskussion darüber wider, ob Jesus der Messias sei oder nicht, wie das Johannesevangelium. Das wird je im Einzelnen bei der Kommentierung der betreffenden Stellen zu besprechen sein.
Gruppen, die einen exklusiven Anspruch vertraten und damit die jüdische Gemeinschaft zu sprengen drohten und sie gefährdeten, wurden von den Lehrern des sich herausbildenden und die Mehrheit repräsentierenden pharisäisch-rabbinischen Judentums als Häretiker bezeichnet und negativer eingeschätzt als Nichtjuden. So wird auf Rabbi Tarfon folgende Aussage zurückgeführt: „Wenn mich ein Verfolger verfolgte, würde ich in einen Götzentempel eintreten, aber ich würde nicht in ihre (der Häretiker) Häuser eintreten. Denn die Götzendiener kennen ihn (Gott) nicht und leugnen ihn, aber diese kennen ihn und leugnen ihn.“ Auf die Häretiker bezieht er anschließend die Schriftstelle Jesaja 57,8 und ihren Kontext über solche, die sich von Gott abgewandt haben.7 Das hatte zur Folge, dass die Abweichenden religiös bekämpft wurden und sich sozialer Isolierung sowie wirtschaftlichem Boykott ausgesetzt fanden. Rabbinische Stellen halten dazu an, gegenüber Häretikern alle Bindungen abzuschneiden, jeden persönlichen und geschäftlichen Verkehr zu unterbinden und Hilfe in jeder Richtung auszuschließen. Es geht also nicht um eine isolierte religiöse Maßnahme, sondern um ein die ganzen Lebensverhältnisse einschneidend veränderndes Geschehen, das vor allem auch Auswirkungen auf die ökonomische Basis hatte. So heißt es: „Man verkauft ihnen nicht und kauft von ihnen nicht. Man nimmt von ihnen nicht und gibt ihnen nicht. Man lehrt ihre Söhne kein Handwerk und man lässt sich von ihnen nicht ärztlich behandeln, weder eine ärztliche Behandlung von Besitz noch eine ärztliche Behandlung von Personen“.8 Hiernach waren also gegenüber Häretikern wirtschaftliche Boykottmaßnahmen zu verhängen und ihre Söhne faktisch einem Ausbildungsverbot zu unterwerfen. Die Einschätzung als Häretiker hatte daher für die Betroffenen schwerwiegende soziale und wirtschaftliche Folgen.
Solche Erfahrungen der Distanzierung dürften im Blick sein, wenn Johannes von aposynágogos spricht. Er bringt sie damit gleichsam auf den Begriff.9 Aus der Sicht der Betroffenen sind es bittere Erfahrungen, die ihre Lebensmöglichkeiten stark beeinträchtigen. Setzt man diese Situation für die Abfassung des Johannesevangeliums voraus, also den Abgrenzungsprozess zwischen der rabbinisch geleiteten Mehrheit und einer auf Jesus bezogenen Minderheit, wird ein weiteres Textphänomen verstehbar, das sonst unbegreiflich bleibt: die eigenartig pauschale Redeweise von „den Juden“ und „den Pharisäern“. Auffällig häufig ist im Johannesevangelium von „den Juden“ die Rede und an der Mehrzahl dieser Stellen erscheinen sie als feindlich gegenüber Jesus. Von den jüdischen Gruppen begegnen so gut wie ausschließlich die Pharisäer. Dabei können im selben Zusammenhang dieselben handelnden Personen einmal als „die Juden“ und dann als „die Pharisäer“ bezeichnet werden, auch in umgekehrter Reihenfolge.10 Das ist als Wiedergabe von historischer Wirklichkeit sowohl für die Zeit Jesu als auch für die Zeit nach Jesu Tod bis zum Ende des jüdisch-römischen Krieges im Jahr 70 ausgeschlossen. Nimmt man hinzu, dass an manchen Stellen die Bezeichnung „die Juden“ mit der Bezeichnung „die Welt“ wechseln kann und dass diese Welt ebenfalls als feindlich gegenüber Jesus und seinen Schülern eingestellt erscheint, kann man verstehen, dass die These aufgestellt wurde: Unter „den Juden“ im Johannesevangelium seien gar keine wirklichen Juden verstanden, sondern sie gälten als Repräsentanten der feindlichen Welt. Allerdings hat diese Annahme zur Konsequenz, dass man mit ihr „die Juden“ zu negativen Typen macht – und das ist etwas, was der Antisemitismus immer wieder getan hat. So abwegig die Darstellung des Johannesevangeliums auf den ersten Blick in ihrer Identifizierung von „den Juden“ und „den Pharisäern“ erscheint, gilt es doch wahrzunehmen: Ein pharisäisch bestimmtes Judentum ist keine Fiktion. Ein solches Judentum hat es zwar nicht vor dem Jahr 70 gegeben, aber es hat sich danach herausgebildet.
Aus dem, was der Text dieses Evangeliums über die Situation seiner Entstehung erkennen lässt, ist deutlich, dass Johannes in einem ganz und gar jüdischen Kontext schreibt.11 Das legt nahe, auch ihn für einen Juden zu halten. Er schreibt ein einfaches, fehlerfreies, stark semitisierendes Griechisch. Dass er auch des Hebräischen und Aramäischen mächtig war, zeigen einige seiner Bibelzitate. Darauf wird jeweils im Kommentar eingegangen werden. Als einziger Autor der im Neuen Testament gesammelten Schriften bietet Johannes das aramäische Wort für den Gesalbten in gräzisierter Form: messías (1,41; 4,15) und gibt an beiden Stellen anschließend die griechische Übersetzung: christós. An zwei weiteren Stellen im Evangelium argumentiert Jesus formal und sachlich ganz analog zu dem, wie es auch Rabbinen tun (7,22–23; 10,34–36). Auch das wird im Kommentar ausführlich dargelegt werden.
Will man das Johannesevangelium geographisch verorten, passen die aufgezeigten Phänomene am besten auf die südlichen Teile des Herrschaftsgebiets von König Agrippa II., die Landschaften Gaulanitis und Batanäa im nördlichen Ostjordanland. Sie werden von Josephus so beschrieben: „[…] die Gebiete von Gamala und Gaulanitis, Batanäa und Trachonitis; das sind auch Teile des Königreichs Agrippas. Beginnend im Libanongebirge und den Jordanquellen dehnt sich das Land bis zum See von Tiberias aus (…). Das bewohnen Juden und Syrer gemischt“.12 Agrippa II. war ein Urenkel Herodes des Großen und Sohn von König Agrippa I. Wie viele herodäische Prinzen wurde er am Kaiserhof in Rom erzogen, wo er schon als junger Mann jüdische Interessen vertrat. Im Jahr 53 erhielt er als Königreich die ehemalige Tetrarchie seines Großonkels Philippus mit den Landschaften Gaulanitis, Batanäa und Trachonitis. Sein Herrschaftsgebiet wurde ihm in den folgenden Jahren mehrfach nach Norden vergrößert. Er hatte die Oberhoheit über den Tempel in Jerusalem, solange dieser bestand. Am Beginn des jüdischen Aufstands versuchte er beschwichtigend zu wirken. Nachdem er damit gescheitert war, kämpfte er auf Seiten Roms. In seinem Militär und in seiner Verwaltung hatten Juden führende Stellungen inne. Für die Zeit nach dem Krieg lassen sich verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Gelehrten im Lehrhaus in Javne und führenden Juden in Batanäa und Gaulanitis wahrscheinlich machen.13
Johannes nennt am Anfang seines Evangeliums als Ort für das Wirken des Täufers Johannes und für das erste Auftreten Jesu „Betanien jenseits des Jordans“ (1,28). Ein Ort dieses Namens ist „jenseits des Jordans“ nirgends belegt. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist damit die Landschaft Batanäa gemeint. In deren Nähe liegt auch Betsaida. Von dort kommt nach Johannes Jesu Schüler Philippus. Zudem nennt er diesen Ort „die Stadt des Andreas und Petrus“ (1,44). In diesem geographischen Bereich beginnt also nach ihm das öffentliche Wirken Jesu und hierhin lässt er ihn sich noch einmal zurückziehen, bevor Jesus dann nach Betanien in Judäa aufbricht und von dort zum letzten Mal nach Jerusalem geht (10,40–42). Dass Johannes so lokalisiert, ist umso einleuchtender, wenn das die Gegend ist, in der er und seine erste Leser- und Hörerschaft leben.
Der jüdische Kontext des Johannes und seines Schreibens zeigt sich an weiteren Aspekten seiner Darstellung. In diesem Evangelium verlässt Jesus an keiner Stelle das Gebiet, das biblisch als „Land Israel“ gilt. Nichtjüdischen Menschen begegnet er erst bei seiner Festnahme in Gestalt der als beteiligt vorgestellten römischen Kohorte und bei seinem Prozess und seiner Hinrichtung in Gestalt seines Richters Pilatus und dessen Soldaten. Vorher trifft er außer Jüdinnen und Juden nur Menschen aus Samaria, die sich ebenfalls auf die Tora beziehen. Der nichtjüdische Hauptmann von Kafarnaum bei Matthäus und Lukas ist bei Johannes ein jüdischer Hofmann. Als „Griechen“ Jesus sehen wollen und über die Vermittlung des Schülers Philippus das Gespräch mit ihm suchen und dieser zusammen mit Andreas deren Bitte an Jesus heranträgt, kommt eine Begegnung dennoch nicht zustande (12,20–23). Nur ganz gelegentlich ist davon die Rede, dass sich nichtjüdische Menschen auf Jesus beziehen werden. Das geschieht da, wo Jesus bildlich davon spricht, dass er „auch andere Schafe“ habe, „die nicht aus dieser Hürde sind“, die auf seine Stimme hören werden und die er ebenfalls leiten müsse (10,16). Diese „anderen Schafe“ sind wahrscheinlich auch mit im Blick im Gebet Jesu, wenn er nicht nur für seine Schüler bittet, „sondern auch für diejenigen, die durch ihr Wort an mich glauben“ (17,20). Entsprechend wird Jesus von den Samaritern als „der Retter der Welt“ bekannt (4,42). Auf diese Dimension weisen auch eine Reihe weiterer Stellen, die „die Welt“ erwähnen (z. B. 1,29; 3,16). Es gibt aber auch Stellen, an denen mit „der Welt“ die jüdische Welt gemeint ist (z. B. 7,4; 12,19).14
Die theologische Gegenargumentation und die Erfahrungen sozialer Isolierung und ökonomischer Gefährdung haben offenbar dazu geführt, dass Glieder der Gemeinde sich von ihr abwandten und den Weg zurück zur Mehrheit einschlugen (vgl. 6,66; 8,31). In solcher Situation schreibt Johannes sein Evangelium. Er will zum Bleiben veranlassen und die Gebliebenen dessen vergewissern, „dass Jesus der Gesalbte ist, der Sohn Gottes“ (20,31). Auch das fügt sich in den durchgehenden jüdischen Kontext. Die Bezeichnung „der Gesalbte“ und ihre Zusammenstellung mit „der Sohn Gottes“ lassen sich nur innerhalb der biblisch-jüdischen Tradition verstehen. Johannes geht es darum herauszustellen, dass Jesus der messianische König ist, und dessen Königtum ist ausdrücklich bezogen auf Israel, auf das jüdische Volk. Diese Zielangabe wird nicht von den im Evangelium vorher gemachten Hoheitsaussagen überboten, die davon sprechen, dass Jesus von Gott gekommen sei und wieder zu Gott gehe, dass er erhöht und verherrlicht werde. Sie dienen vielmehr dazu, es möglichst einsichtig zu machen, dass der am Kreuz hingerichtete Jesus dennoch der Messias, der Gesalbte, sei. So ist es nicht verwunderlich, dass der Streit darüber, ob Jesus der Gesalbte sei, im Johannesevangelium breiten Raum einnimmt.
Aus den Auseinandersetzungen und den darin gemachten bitteren Erfahrungen, die Johannes und seine Gemeinde machen, resultiert es, dass sein Evangelium immer wieder auch das Zeugnis eines gescheiterten Gesprächs ist. Es bietet Dialoge, die in Wirklichkeit keine sind, sondern sich bei näherem Hinsehen als Proklamationen der eigenen Position erweisen, der auch die Gegenseite letztlich dienen muss. Die verfahrene Gesprächssituation sei im Spiegel eines kurzen Abschnitts aus dem achten Kapitel aufgezeigt. Dort wird übereinander geredet und nicht miteinander und wo dennoch zum jeweils anderen gesprochen wird, tauscht man verhärtete Positionen aus und giftet einander an. Auf die Ankündigung Jesu an seine Gesprächspartner, wieder als „die Juden“ benannt, wo er hingehe, könnten sie nicht hinkommen, reagieren sie so, dass sie über ihn sprechen und dabei eine abwegige Vermutung anstellen: „Er wird sich doch nicht selbst umbringen?“ In seiner Antwort verortet Jesus ihre Herkunft „unten“ und seine „oben“, worauf sie verächtlich fragen: „Wer bist du denn schon?“ und Jesus seinerseits kontert: „Was rede ich überhaupt noch mit euch?“ und hinzufügt: „Über euch könnte ich viel reden und urteilen“ (8,22–26a). Auf die eigene Infragestellung durch die anderen, wer man denn schon sei, folgt die Ankündigung, viel Negatives über die anderen sagen zu können. Sie wird nicht ausgeführt, aber doch ausgesprochen, was dem Gesprächsklima gewiss nicht förderlich ist. Allerdings, es gibt auch Auseinandersetzungen um die Sache.
3. Konsequenzen für die Interpretation
Von der im vorigen Abschnitt nachgezeichneten wahrscheinlichen Entstehungssituation des Johannesevangeliums ist die Situation, in der wir es lesen, in denkbar deutlicher Weise unterschieden. Die Veränderung der Situation ist vielleicht uns Heutigen besonders bewusst geworden, aber sie ist bereits in der frühen Zeit der Verbreitung des Johannesevangeliums eingetreten. Johannes hatte – zumindest primär – jüdische Adressaten im Blick, die sich gegenüber der Mehrheit ihrer Landsleute in einer bedrängten Minderheitenposition vorfanden. In dieser noch innerjüdischen Kontroverse macht er harte Aussagen über die andere Seite, die ganz und gar diktiert sind von den eigenen negativen Erfahrungen und in der vollen Überzeugung gemacht werden, selbst im Recht zu sein, weshalb mögliche Gründe der Gegenseite kaum in den Blick kommen. Was wird aus solchen Aussagen, wenn sie in einer Situation jenseits dieser Kontroverse wiederholt, wenn sie von nichtjüdischen Menschen gelesen, gehört und nachgesprochen werden? Werden sie nicht von einer Kirche, die faktisch nur noch aus Menschen aus der Völkerwelt besteht und sich im Gegenüber zum Judentum befindet und sich im Gegensatz zu ihm sieht, im Sinne einer prinzipiellen Judenfeindschaft rezipiert werden? Und ist die Kirche erst einmal mächtig geworden, wird es nicht ausbleiben, dass solche Texte – einfach nachgesprochen – zur Legitimation einer höchst handfesten und praktischen Judenfeindschaft herhalten müssen. Aus einer bedrängten Minderheitenposition heraus formulierte Sätze werden so zu skrupellos gebrauchten Hilfsmitteln einer mächtigen Mehrheit gegen die jüdische Minderheit. Ich weise jetzt nur auf die äußerste Zuspitzung dieser Entwicklung hin. Sie besteht darin, dass der Satz aus Joh 8,44, der die Juden als Kinder des Teufels bezeichnet, der legitimierenden Vorbereitung des massenhaften Judenmordes durch Deutschland im 20. Jahrhundert diente.
Das Erschrecken darüber – über den Mord und die christliche Schuld daran aufgrund christlicher Judenfeindschaft – führte in erheblichem zeitlichen Abstand zu einer Neubesinnung, die nach einer Veränderung des Verhältnisses zum Judentum sucht. Was aber bedeutet das für die Exegese – sicherlich nicht nur, aber gerade auch – des Johannesevangeliums? In aufmerksamer Wahrnehmung der gründlich veränderten Situation kann es schlechterdings nicht mehr darum gehen, einfach nur nachzusprechen und verstehend zu umschreiben, was dasteht. Gefordert ist vielmehr ein kritisches Nach-denken der Texte, das sich eine fundamentale Voraussetzung der damaligen Kontroverse bewusst machen muss, die trotz aller Schärfe unhinterfragt feststand: der gemeinsame Bezug auf den einen Gott, Israels Gott. Diese Voraussetzung gilt, auch wenn sie dadurch verdeckt wird, dass das Johannesevangelium immer wieder Zeugnis eines gescheiterten Gesprächs ist. Zum kritischen Nachdenken und somit zum wirklichen Verstehen gehört es deshalb konstitutiv dazu, den möglichen Gesprächshintergrund der Texte des Johannesevangeliums wieder sichtbar zu machen, die andere Seite mit demselben Ernst zu hören wie die Argumentation des Johannes und sie von ihren Voraussetzungen her und mit ihren eigenen Texten einsichtig und stark zu machen. Vielleicht könnte so das im Johannesevangelium manifeste Nichtgespräch aufgebrochen werden, um heute ins Gespräch zu kommen.15 Von der wahrscheinlichen Verortung des Johannesevangeliums her ergibt es sich, dass ich in religionsgeschichtlicher Hinsicht bei der Auslegung nicht alle möglichen Bezugstexte heranziehe und diskutiere. In bewusster Einseitigkeit beschränke ich mich vielmehr im Wesentlichen auf jüdische – und d. h. vor allem jüdisch-rabbinische – Quellen. Es soll für den gesamten Text des Johannesevangeliums erprobt werden, ob und wie weit der hier vorgestellte Ansatz trägt. Dabei geht es nicht darum, Kontrastfolien zu gewinnen oder bloße „Parallelen“ zu verbuchen. Ziel ist es vielmehr einmal, mit Hilfe der jüdischen Texte Gesprächszusammenhänge zu entdecken und genau zu beschreiben, in denen die Aussagen des Johannesevangeliums möglicherweise entstanden sind. Ziel ist es zum anderen, in der verstehenden Wahrnehmung der jüdisch-rabbinischen Texte ihnen gegenüber Respekt zu gewinnen und dabei auch zu erkennen, dass es in der Sache mehr Verbindendes gibt, als die aus der Situation sich ergebende Polemik vermuten lässt. Da die jüdisch-rabbinischen Texte Grundlage des Judentums bis heute sind, bedeutet Respekt ihnen gegenüber zugleich auch Respekt gegenüber gegenwärtigem Judentum.16
Gegenüber dem möglichen methodischen Einwand, die jüdisch-rabbinischen Texte seien in ihrer Masse viel zu jung, um für das Verstehen des Johannesevangeliums eine Rolle spielen zu können, ist zweierlei zu bemerken. Der erste Punkt ist nicht entscheidend, soll aber doch angeführt werden: Auch wenn eine Tradition sich in einer „jungen“ Sammlung findet, kann sie doch sehr alt sein.17 Das wird sich jedoch in den meisten Fällen nicht nachweisen lassen. Das Altersargument hätte Gewicht, wenn intendiert wäre, „Abhängigkeiten“ zu erweisen. Darum aber – und das ist der zweite Punkt – geht es nicht, sondern um den Aufweis jüdischer Sprachmöglichkeiten und Denkmuster; und dafür ist es relativ unerheblich, wie alt oder jung ein Text ist. Dabei ist auch zu bedenken: Gegenüber dem starken Wandel in der Zusammensetzung der auf Jesus bezogenen Gemeinschaft von ihren Anfängen bis zur Mitte des zweiten Jahrhunderts – von einer jüdischen Gruppierung zur Völkerkirche – besteht auf der jüdischen Seite eine viel stärkere Traditionskontinuität. Auch das relativiert das Altersargument. Im Lehrhaus in Javne wurde in Aufnahme schon älterer Traditionen der Grund gelegt für eine kontinuierliche Entwicklung, die sich literarisch in Mischna, Talmudim und Midraschim niedergeschlagen hat. Auch ein nachweislich junger Text aus dieser Tradition zeigt, dass eine ihm entsprechende Aussage im Neuen Testament eine jüdische Sprachmöglichkeit ist.18
4. Der zu interpretierende Text
Die Frage, welcher Text interpretiert werden soll, mag seltsam erscheinen. Natürlich ist das Johannesevangelium auszulegen. Aber ein Blick in zumindest zwei Kommentare zeigt, dass es offenbar gar nicht von vornherein ausgemacht ist, was denn nun als „Johannesevangelium“ verstanden werden soll. Wer sich in Rudolf Bultmanns Kommentar zu einer Stelle des Johannesevangeliums informieren will und entsprechend ihrem Ort im Evangelium ihre Erörterung im Kommentar sucht, kann die Erfahrung machen, sie auf diese Weise nicht zu finden, sondern dafür die Tabelle „Die Abschnitte der Erklärung in der Reihenfolge des Textes des Evangeliums“ im Anschluss an das Inhaltsverzeichnis zu benötigen. Denn Bultmann hat gegenüber dem überlieferten Text erhebliche Umstellungen vorgenommen und damit gemeint, das „ursprüngliche“ Evangelium wiederherzustellen. Das interpretiert er und nicht das Evangelium in seiner überlieferten Gestalt. Darüber hinaus hat er die Bearbeitung einer „kirchlichen Redaktion“ vom „ursprünglichen“ Evangelium abgehoben.19
Der „kirchlichen Redaktion“ ist in der „neueren Literarkritik“ erheblich mehr Stoff zugewiesen worden. Darüber hinaus wurde ein vielschichtiger Entstehungsprozess des Johannesevangeliums zu rekonstruieren versucht.20 Einen der ausführlichsten und gründlichsten Versuche in dieser Hinsicht hat Jürgen Becker unternommen und vor allem in seinem Kommentar durchgeführt. Was er im Grunde interpretiert, ist das von ihm selbst hypothetisch rekonstruierte „Evangelium“. Vor aller Kritik im Einzelnen ist gegenüber einem solchen Unterfangen grundsätzlich einzuwenden, dass das überlieferte Evangelium zunächst die Vermutung verdient, ein so gewollter und in sich stimmiger Text zu sein. Nur wenn in ihm selbst ausdrücklich ein Hinweis auf nachträgliche Redaktion gegeben wird, wenn es in der Textgeschichte und Textrezeption entsprechende Zeugnisse gibt oder wenn der ernsthaft unternommene Versuch, ihn als Einheit zu verstehen, offensichtlich scheitert, ist es geboten, hinter die jetzt vorliegende Textgestalt zurückzugehen. Historische Kritik ist voreilig und verfehlt ihr Ziel, wenn sie – statt sich um das Verständnis des ihr Überlieferten zu bemühen – sich den Gegenstand der Auslegung mit fragwürdigen Kriterien erst selber schafft und dabei über Mutmaßungen nicht hinauskommt.21
Dass es schon am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine johanneische Literarkritik gab und im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts eine „neuere“ Literarkritik am Johannesevangelium in Gang gekommen ist, zeigt zumindest, dass der überlieferte Text dazu Anstöße bietet, die auf eine Vorgeschichte hinweisen. Die Frage ist jedoch, ob und wie weit diese Vorgeschichte durch Scheidung von Schichten und Herauslösung von Quellen erhellt werden kann, ob der jetzige Text nicht in einer Weise durchgeformt und überformt ist, die einem solchen Unternehmen enge Grenzen oder gar unüberwindliche Barrieren setzt. Das Johannesevangelium ist gewiss nicht ein in einem Guss geschriebenes schriftstellerisches Werk. Es hat eine Vorgeschichte. Zu bezweifeln ist jedoch, dass sie mit auch nur geringer Wahrscheinlichkeit rekonstruiert werden kann. Angesichts dieser Sachlage, dass es einerseits Hinweise auf Traditionen und Quellen sowie auf einen Entstehungsprozess gibt und sich andererseits ein das ganze Evangelium gestaltender Wille, eine durchgängige Konzeption und eine einheitliche Sprachgestalt zeigen, erscheint es angebracht, nicht vorab Modelle über Schichten, Traditionen und Quellen zu entwerfen und dann von ihnen her die Interpretation bestimmt sein zu lassen. Mir scheint hier ein pragmatisches Vorgehen angemessener zu sein, indem jeweils gefragt wird, was die eine oder andere Annahme über die Vorgeschichte zum besseren Verständnis einer Textstelle beitragen kann bzw. ob sie überhaupt etwas dazu austrägt. Das gilt auch für die immer wieder diskutierte Frage nach dem Verhältnis des Johannes zu den Synoptikern, ob er eins der anderen Evangelien oder auch alle drei gekannt oder eine gemeinsame oder ähnliche Tradition benutzt hat.22 Diese Frage sei offengelassen. Wo Berührungen mit den Synoptikern vorliegen, ist jeweils darauf einzugehen. Dann muss sich zeigen, ob etwas mit der einen oder anderen Annahme für das Verständnis der jeweiligen Textstelle gewonnen ist.
Ich werde also den Versuch machen, das Johannesevangelium in seiner überlieferten Gestalt als Einheit zu verstehen – mit einer Ausnahme. Denn an einer Stelle gibt der Text selbst einen ausdrücklichen Hinweis auf unterschiedliche Verfasserschaft. In 21,24 wird „der Schüler, den Jesus liebte“, als der bezeichnet, „der das geschrieben hat“. Daran schließt sich die Beteuerung an: „Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist.“ Im abschließenden V. 25 wird in der ersten Person Singular geredet: „Ich meine.“ Nach dieser klaren Auskunft will also der Schluss von jemand anderem, der sich mit weiteren zu einem „Wir“ zusammenschließen kann, geschrieben sein als das übrige Evangelium. Natürlich kann man diese Differenzierung für ein literarisches Mittel eines einzigen Verfassers halten. Man kann sie aber auch mit gleichem, wenn nicht mit größerem Recht beim Wort nehmen. Zusammen mit der Beobachtung, dass in 20,30f. ein regelrechter Buchschluss vorliegt, scheint mir daher nach wie vor mehr für die schon lange bestehende und weit verbreitete Annahme zu sprechen, dass es sich bei Kap. 21 um einen späteren Nachtrag von anderer Hand handelt.23
Besonders Thyen hat sich entschieden dafür eingesetzt, Joh 21 als integralen Bestandteil des Evangeliums zu betrachten. Er hat dafür vor allem auf die Textüberlieferung hingewiesen und daraus geschlossen: „Das Evangelium hat öffentlich nie in einer anderen als der uns überlieferten Gestalt existiert.“24 Die älteste uns bekannte Handschrift, die Joh 21 bezeugt, ist der Papyrus 66, der am Ende des zweiten oder zu Beginn des dritten Jahrhunderts geschrieben wurde. Der Abstand zur Abfassungszeit des Johannesevangeliums von etwa 100 Jahren ist zu groß, als dass das ausgesprochene Urteil als gesichert gelten könnte. Darüber hinaus hat Lattke auf eine Stelle aufmerksam gemacht, die für den Anfang des dritten Jahrhunderts Joh 20,31 als Schluss des Evangeliums bezeugt (Tertullian, Gegen Praxeas 25,4).25 Das lässt sich m. E. nicht als ein nur „unkritisch-textkritisches ‚Fündlein‘“ abtun (so Hengel, Frage 218f. Anm. 36 von S. 218; das Zitat auf S. 219) Wichtiger ist allerdings die Beobachtung am Text des Evangeliums selbst.
Da also im überlieferten Text des Evangeliums selbst, in 21,24f., eine Differenzierung in der Verfasserschaft angegeben wird und 20,30f. einen Buchschluss bildet, halte ich Kap. 21 für einen Nachtrag und sehe zunächst die Einheit 1,1–20,31 als den zu interpretierenden Text an.26 Sodann ist natürlich auch das Nachtragskapitel auszulegen und danach zu fragen, welche Akzente von ihm her rückwirkend im vorangehenden Text neu gesetzt werden.
5. Gattung und Gliederung
Wie immer man sich die Entstehung des Johannesevangeliums vorstellen mag, so ist doch das, was uns jetzt vorliegt – sowohl in der ursprünglichen Gestalt von Kap. 1 bis 20 als auch unter Einschluss von Kap. 21 –, seiner literarischen Form nach ein Evangelium. In dieser Hinsicht unterscheidet es sich nicht von den drei synoptischen Evangelien. Wie sie erzählt es die Geschichte Jesu von Nazaret, angefangen mit seinem Auftreten neben Johannes dem Täufer bis zu seinem Tod und seiner Auferweckung. Es bietet nicht die traktatmäßige Entfaltung eines theologischen Gedankens, sondern eine fortlaufende Erzählung. Bei aller Andersartigkeit gegenüber den synoptischen Evangelien in Sprache und „Stimmung“ ist doch der Charakter der Erzählung gegeben und auch für das Johannesevangelium prägend.
Das ist keine bloß formale Feststellung, sondern enthält wichtige Fingerzeige dafür, wie es – und insbesondere die Gestalt Jesu in ihm – zu verstehen ist. Es unterscheidet sich grundlegend von alsbald im 2. Jahrhundert produzierten gnostischen Schriften – seltsamerweise auch „Evangelien“ genannt –, die Jesus zu einem himmlischen Geistwesen verflüchtigen und die in einem Prozess harter Auseinandersetzungen von der Kirche als ketzerisch ausgeschieden werden. Indem Johannes die Geschichte Jesu erzählt, steht es überhaupt nicht in Frage, sondern ist selbstverständliche Voraussetzung, dass es um diesen bestimmten jüdischen Menschen geht.
Zum anderen ist festzuhalten, dass nicht nur die synoptischen Evangelien, sondern auch das Johannesevangelium wesentlich mehr enthält als das, was Sören Kierkegaard für einzig bedeutsam gehalten hat: „Das Historische, daß Gott in menschlicher Gestalt Dasein gehabt hat, ist die Hauptsache; das übrige historische Detail hat auch nicht die Wichtigkeit, wenn von einem Menschen statt von Gott die Rede wäre. Die Juristen sagen, daß ein Kapitalverbrechen alle kleineren Verbrechen in sich aufsaugt / so ist es mit dem Glauben; seine Absurdität saugt all das Kleinliche in sich auf. Differenzen, die sonst störend wirken, stören hier nicht und tun nichts zur Sache. Dagegen tut es sehr viel zur Sache, ob einer durch kleinliches Kalkulieren den Glauben an den Meistbietenden versteigern will; dies macht so viel zur Sache, daß er gar nie zum Glauben kommt. Hätte die gleichzeitige Generation nichts hinterlassen als die Worte: ‚wir haben geglaubt, daß anno soundsoviel Gott sich in geringer Knechtsgestalt gezeigt hat, unter uns gelebt und gelehrt hat und darauf gestorben ist‘ / das wäre mehr als genug. Das gleichzeitige Geschlecht hat das Nötige getan; denn dieses kleine Avertissement, dies weltgeschichtliche N(ota) B(ene) reicht hin, für den Späteren Veranlassung zu werden; und der weitläufigste Bericht kann ja in alle Ewigkeit für den Späteren nicht mehr werden.“27 Das ist von Bultmann aufgenommen und in seiner Interpretation des Johannesevangeliums durchgeführt worden.28 Gewiss, was doch auch Johannes über „diese kleine Anzeige“ hinaus erzählt, kann natürlich nicht den für Jesus erhobenen Anspruch begründen. Aber es ist andererseits offenbar nicht bedeutungslos, was von ihm erzählt werden kann. Für Kierkegaard und Bultmann ist allein entscheidend das Paradox, dass Gott in diesem bestimmten Menschen Jesus begegnet. Dieses Paradox ist schon mit dem Prolog gegeben; zu ihm kommt nach Bultmann sachlich nichts mehr hinzu. Aber die Erzählung einer Geschichte ist nicht schon an ihrem Anfang am Ziel, sondern sie erreicht es erst mit ihrem Ende. Es ist deshalb auch nicht gleichgültig, wie die Erzählung auf ihr Ziel zugeht, wie das Johannesevangelium aufgebaut und gegliedert ist.
Es erzählt die Geschichte Jesu anders als die synoptischen Evangelien – auch in zeitlicher und örtlicher Hinsicht. Diese setzen nur ein knappes Jahr der öffentlichen Wirksamkeit Jesu voraus. Sie vollzieht sich vor allem in Galiläa und greift bloß gelegentlich auf die angrenzenden Gebiete im Osten, Westen und Norden aus. Jesus reist nur einmal zu Pessach nach Jerusalem. Dort wird er festgenommen, verurteilt und hingerichtet. Bei Johannes setzt die Erzählung nicht lange vor einem Pessachfest ein. Der Ort ist das Ostjordanland (1,28). Von da geht Jesus nach Galiläa (1,43; 2,1.12). Anschließend steigt er zu Pessach nach Jerusalem hinauf (2,13) und hält sich dort auf (2,23), danach in Judäa (3,22). Er verlässt Judäa und durchzieht Samarien, um wieder nach Galiläa zu gelangen (4,3f.). In Sychar hat er einen Zwischenaufenthalt von zwei Tagen (4,5.40), bevor er wieder Kana in Galiläa erreicht (4,43.46.54). Anschließend aber steigt er wiederum zu einem Fest nach Jerusalem hinauf (5,1). Gedacht ist wohl an Schavuot. Danach wird ein größerer zeitlicher und örtlicher Sprung vorausgesetzt. Jesus geht auf die andere Seite des Sees Gennesaret (6,1) und setzt dann nach Kafarnaum über (6,17.21.59); zeitlich wird die Nähe von Pessach angemerkt (6,4). Zu diesem Pessach aber steigt er nicht nach Jerusalem hinauf, sondern zieht in Galiläa umher, weil er in Judäa tödliche Verfolgung fürchtet (7,1). Als aber Sukkot naht (7,2), stellt sich erneut die Frage, ob er nach Jerusalem hinaufsteigt; er tut es (7,10). Er ist dort das ganze Fest über (7,14.37) und auch im Anschluss daran. An Chanukka hält er sich immer noch in Jerusalem auf (10,22). Danach zieht er sich ins Ostjordanland zurück an den Ort, der Ausgangspunkt der Erzählung war (10,40). Von dort reist er in das Dorf Betanien in der Nähe von Jerusalem (11,1.17f.). Es erfolgt wiederum ein Rückzug aus der jüdischen Öffentlichkeit nach Efraim am Rande der Wüste (11,54). Pessach ist nahe (11,55); und sechs Tage vor dem Fest geht Jesus nach Betanien (12,1). Am nächsten Tag zieht er in Jerusalem ein (12,12f.). Am Abend des Tages vor Pessach hat er mit seinen Schülern eine Mahlzeit (13,1f.). Im Anschluss daran begibt er sich mit ihnen in einen Garten jenseits des Kidrontales (18,1). Dort wird er festgenommen und am nächsten Morgen vor Pilatus gebracht (18,28). Zur Zeit, da die Pessachlämmer zum Tempel gebracht und dann geschlachtet werden, wird er verurteilt und hingerichtet (19,14).
Johannes erzählt also von einer mehr als zweijährigen Wirksamkeit Jesu mit einem relativ häufigen örtlichen Wechsel zwischen dem Ostjordanland, Galiläa und Judäa mit dem Zentrum Jerusalem, wobei auf dieser Stadt ein deutlicher Schwerpunkt liegt. Diese zeitliche und örtliche Anordnung ist mit der synoptischen nicht harmonisierbar. Die Beobachtung, dass die Zeit der Wirksamkeit Jesu bei Johannes mehr als doppelt so lang ist als in den synoptischen Evangelien, ist nun mit einer Beobachtung zur Gliederung zu verbinden. Ohne Zweifel liegt zwischen Kap. 12 und Kap. 13 ein tiefer Einschnitt vor, der das Evangelium in zwei Teile teilt. In 12,37–43 reflektiert Johannes im Rückblick ausführlich über den Unglauben, den Jesus gefunden hat, und lässt ihn – mit betonter Einleitung versehen – in V. 44–50 eine Rede halten, die Art und Absicht seines Wirkens konzentriert zusammenfasst. Es folgt in 13,1–3 ein hervorgehobener und breit angelegter Neueinsatz, der nicht nur die unmittelbar anschließende Fußwaschungsszene einleitet, sondern zugleich auch den ganzen zweiten Teil des Evangeliums, indem er die Thematik der Abschiedsreden anschlägt und Passion und Ostern in den Blick nimmt. Das von 1,19–12,50 erzählte Geschehen umfasst einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren, während die in 13,1–19,42 geschilderten Ereignisse nur einen einzigen Tag ausmachen. Mit 20,1–23 kommt der dritte Tag nach Jesu Tod hinzu, mit 20,24–29 eine weitere Woche. Die jeweilige Zeit, über die sich die beiden Teile des Evangeliums erstrecken, ist also völlig disproportional zum jeweiligen Umfang. Daraus aber ist zu schließen, dass dem Geschehen und Verstehen des letzten Lebenstages Jesu – und das heißt vor allem seines Todes am Kreuz – ein außerordentlich großes Gewicht zukommt. Dass auch schon im ersten Teil Passion und Tod Jesu immer wieder in den Blick kommen, unterstreicht das. Hier scheint das entscheidende Problem zu liegen. Hier erfolgt in der dargestellten Gemeindesituation offenbar die stärkste Infragestellung: Wie kann derjenige der Messias sein, der am Kreuz so schmählich hingerichtet worden ist, wo doch mit dem Messias das Reich der Gerechtigkeit kommt, in dem das Unrecht der Gewalttäter nicht mehr triumphieren kann?29 Johannes versucht, dem nachzuspüren und es auszusagen, wie denn Gottes Gegenwart und Handeln in diesem bestimmten Schicksal Jesu gedacht werden kann. Er greift dazu unterschiedliche Vorstellungen auf und arbeitet sie aus. Eine, die immer wieder begegnet und das ganze Evangelium übergreift, ist die des Gesandten. Von ihr her ist vielleicht am ehesten eine Charakterisierung der beiden Teile des Evangeliums möglich: 1. Das Wirken Jesu als des von Gott Gesandten findet Glaubende und Nicht-Glaubende (1,19–12,50). 2. Der ans Kreuz gehende Jesus gibt sich den Glaubenden als zu Gott Zurückkehrender zu verstehen und verheißt seine Gegenwart im Geist (13,1–20,29). Doch bevor Johannes die Geschichte Jesu zu erzählen beginnt, gibt er mit dem Prolog vorab einen grundsätzlichen Hinweis, in welcher Perspektive diese Geschichte gelesen und gehört werden soll.
Der Prolog (1,1–18)
1 Am Anfang war das Wort
und das Wort war bei Gott
und gottgleich war das Wort.
2 Das war am Anfang bei Gott.
3 Alles ward durch es
und ohne es ward auch nicht eins, was geworden.
4 In ihm war Leben
und das Leben war das Licht der Menschen.
5 Und das Licht scheint in der Finsternis,
aber die Finsternis hat es nicht gefasst.