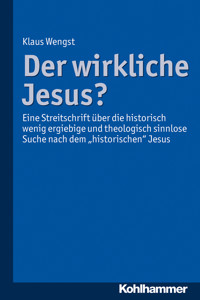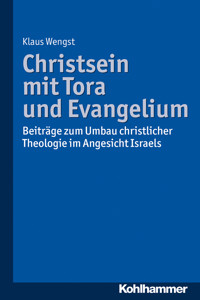14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die konfliktreichen Hintergründe der Frühen Kirche
»Jesus war der erste Christ!« – dass dieser Satz Unsinn ist, ist selbst in kirchlichen Kreisen nicht immer unmittelbar klar. Jesus war Jude und blieb es bis zu seinem Tod. Und auch die ersten Anhänger der Jesusbewegung waren Juden und blieben es. Wie aber entstand aus einer innerjüdischen Bewegung das Christentum? Und warum bestimmte dieses seine Identität sofort antijüdisch? Klaus Wengst erzählt die Geschichte einer neuen religiösen Bewegung im pluralen Panorama des Römischen Reiches. Eine Geschichte voller Eifer und Enthusiasmus, Konflikt und Leidenschaft – spannend, überraschend und erhellend.
- Die Geschichte der frühen Jesus-Anhänger
- Die historischen Wurzeln des christlichen Antijudaismus erkennen
- Spannend und kenntnisreich erzählt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Klaus Wengst
Wie das
Christentum
entstand
Eine Geschichte mit Brüchen im 1. und 2. Jahrhundert
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umsetzung E-Book: Greiner & Reichel, Köln
Umschlagmotiv: Joshua Koffman »Synagoga and Ecclesia in Our Time«,
Standort: Saint Joseph’s University in Philadelphia, © Joshua Koffman
ISBN 978-3-641-27342-2V002
www.gtvh.de
Der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum
Vorwort
Das Umschlagbild dieses Buches ist keine symbolische Entsprechung zu dem in ihm Dargestellten. Wohl aber steht es für ein Ziel, zu dessen Erreichen es beitragen möchte. Seit mehr als zwei Jahrzehnten beschäftigt mich die Frage, seit wann es Christentum gibt. Ausgangspunkt waren und sind dabei zwei gegensätzliche Beobachtungen, die einen äußerst spannungsvollen Zusammenhang aufzeigen. Das Christentum führt sich auf Jesus und dessen Anhängerschaft zurück. Er und sie, sie alle, waren jüdisch. Als einige von seiner Anhängerschaft nach seinem Tod zu dem Glauben kamen, Gott habe ihn von den Toten aufgeweckt, haben sie das nicht als eine Konversion vom Judentum zum Christentum verstanden. Der Anfang war jüdisch und nur jüdisch – und das recht lange. Wie lange? In Texten des 1. Jahrhunderts gibt es keinen einzigen Beleg dafür, dass sich Menschen in der auf Jesus bezogenen Gemeinschaft als »Christinnen und Christen« bezeichnet hätten. Das ist erst in Texten aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts der Fall. Dort taucht auch erstmals der Begriff »Christentum« auf – und er wird sofort in einem ausschließenden Gegensatz zum Judentum bestimmt. Wie kam es von dem jüdischen Anfang zu dieser antijüdischen Fortsetzung? Das ist das Thema dieses Buches.
Ich habe dabei kein nur historisches Interesse. Zum einen bin ich davon überzeugt, dass die Wahrnehmung der Jüdischkeit neutestamentlicher Texte wie auch die Wahrnehmung der Abwesenheit von Jüdischem in anderen dem besseren Verstehen und Auslegen dieser Texte heute dienen. Und zum anderen: Die Beschreibung der eigenen christlichen Identität in Schriften des frühen 2. Jahrhunderts erfolgt nicht nur im Gegensatz zum Judentum, sondern ist zugleich mit einem Gestus der Überlegenheit verbunden, mit der Vorstellung der Ablösung Israels durch die Kirche, mit verzerrenden Darstellungen von Jüdischem. Es gab andererseits noch lange – bis weit in das 4. Jahrhundert hinein – Christinnen und Christen, die den Zusammenhang mit dem Judentum festhielten, indem sie z. B. am Schabbat in die Synagoge gingen und am Sonntag in die Kirche. Aber für sehr viele Jahrhunderte dominant wurde die judenfeindliche Ausrichtung, deren Erben wir sind. Seit etwa sechzig Jahren hat in Teilen der Christenheit ein Umdenken im Verhältnis und im Verhalten zum Judentum begonnen. Dazu möchte mein Betrachten der etwa 100 Jahre von Jesus bis in die erste Hälfte des 2. Jahrhunderts einen Beitrag leisten. Im Verfolg der gekennzeichneten Fragestellung erstrebe ich keine Vollständigkeit. Weitere Schriften des Neuen Testaments und außerhalb seiner könnten herangezogen werden. Ich hoffe jedoch, dass die gewählte Textbasis groß genug ist für eine nachvollziehbare Darstellung.
Ich widme dieses Buch, das vielleicht mein letztes ist, der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, deren Mitglied ich 53 Semester lang von 1981 bis 2007 war. Es waren gute Jahre; ich habe Bochum für mich als einen Glücksfall empfunden. Ich denke an die offene Atmosphäre und den direkten Umgang miteinander, nicht nur unter den Kollegen, sondern auch mit dem »Mittelbau«, den Studierenden, den Sekretärinnen und den Mitarbeiterinnen in der Bibliothek. Es gab damals noch einmal jährlich eine gemeinsame Unternehmung. Ich denke an die beherzte Mitarbeit der Studierenden in den Gremien und besonders an diejenigen unter ihnen, die mich in meiner frühen Bochumer Zeit nach Vorlesungsstunden in Diskussionen verwickelten, wenn ich Unzutreffendes über Jüdisches von mir gegeben hatte. Sie trugen dazu bei, dass ich mich ernsthaft mit jüdischen Texten befasste. Ich denke bei den älteren Kollegen besonders an Hans-Ekkehard Bahr (†), Günter Brakelmann und Dieter Vetter (†), bei den etwa gleichaltrigen an Horst Balz, Konrad Raiser, Christian Link, Erich Geldbach und Jürgen Ebach, bei den jüngeren an Traugott Jähnichen und Peter Wick. An Bochum denke ich gerne zurück. Dass meine Frau und ich jetzt in Braunschweig wohnen und auch hier gerne leben, ist eine andere Sache.
Ganz herzlich danke ich Pfarrer Dr. Jürgen Seim. Er hat das ursprünglich umfangreichere Manuskript sorgfältig durchgesehen und mir zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung gemacht. Ich habe sie gerne angenommen und bedacht. Diedrich Steen vom Gütersloher Verlagshaus danke ich sehr dafür, dass er mich zu kräftigen Kürzungen veranlasst hat. Sie haben das Buch strukturierter und damit lesbarer gemacht. Mein herzlicher Dank gegenüber dem Verlag gilt namentlich auch Beate Nottbrock für die ansprechende Umschlaggestaltung und Gudrun Krieger, die das Manuskript kompetent und zügig zur Druckfassung gebracht und die Korrekturarbeit sorgfältig und freundlich mitgetragen hat. Einmal mehr danke ich meiner Frau Helga, die alle Durchgänge des Manuskripts kritisch gelesen und wesentlich zu dessen Verbesserung beigetragen hat.
Braunschweig, im Januar 2021
Klaus Wengst
Inhalt
Vorwort
Einleitung: »Die ersten Christen waren Juden!«?
I. Der Anfang ist jüdisch
Von Jesus bis zum ersten jüdisch-römischen Krieg
1. Jesus – ein Jude
a) Das Wenige, was historisch über Jesus festgestellt werden kann – und das ist jüdisch
b) Der Jesus der Evangelien – ein Jude unter Juden
2. Jesu Schülerschaft: alle jüdisch – auch nach »Ostern«
a) Der Anfang: »Gott hat Jesus von den Toten aufgeweckt«
b) »Pfingsten« – »Geburtstag der Kirche«?
c) Taufe und Erinnerungs-Mahl als rituelle Identitätsmerkmale
3. Der Fall Stephanus – »der erste christliche Märtyrer«?
4. Hinzugekommen: Menschen aus den Völkern stoßen zur messiasgläubigen Gemeinde
a) Wo die Botschafter Jesu in der nichtjüdischen Welt auftraten
b) »Gottesfürchtige«/»Gottesverehrende« im Umfeld der Synagogen
c) »Gottesfürchtige«/»Gottesverehrende« als Adressaten der messianischen Verkündigung
d) Die Gruppe aus Juden und Nichtjuden: noch nicht der Beginn des Christentums
e) Die messiasgläubigen Gruppen: Judentum zu billigem Eintrittspreis?
f) Christianoí/Chrestiani (»Christen und Christinnen«) – lange keine Selbstbezeichnung
5. Paulus: ein Jude, vor und nach »Damaskus«
a) »Vom Saulus zum Paulus«?
b) Der »Eiferer« – Paulus vor seiner Berufung
c) »Apostel für die Völker« – die Berufung des Paulus und ihre Folgen
d) Wie Paulus nach seiner Berufung von Jesus redet
6. Der Streit um die Beschneidung: Keine Ablehnung des Bundeszeichens Israels!
a) Wie es zum Streit kam und worum es ging
b) Das Treffen in Jerusalem und seine Ergebnisse
7. Eine offen gebliebene Frage: Zusammenleben unter jüdischen oder nichtjüdischen Bedingungen?
8. Noch einmal: Die messiasgläubige Gruppe in Jerusalem
Rückblick auf den ersten Teil
II. Bruchstellen
Vom jüdisch-römischen Krieg bis ca. 100 d. Z.
1. Die Situation nach dem Ende des Krieges
a) Was zum Krieg führte und wie er verlief
b) Das Ergebnis des Krieges: ein verheertes Land
c) Wer die Katastrophe bestehen und überstehen konnte und wer nicht
d) Der Neubeginn mit dem Lehrhaus in Javne – zur Entstehung des rabbinischen Judentums
2. Zunehmende Auseinandersetzungen zwischen dem sich herausbildenden rabbinischen Judentum und den Jesusgläubigen
a) Die Abfassung der Evangelien als Antwort auf die Situation nach dem Krieg
b) Auseinandersetzungen im Spiegel des Matthäusevangeliums
c) Auseinandersetzungen im Spiegel des Johannesevangeliums
3. Auseinandersetzungen im politischen Kontext des Imperium Romanum
a) Mögliche Folgen des fiscus iudaicus – auch für »Gottesfürchtige«
b) Das lukanische Werk im Verhältnis zu Israel und zum Imperium
c) Das Festhalten an einem jüdischen Identitätsmerkmal als Widerstand gegen Rom Zur Offenbarung des Johannes
d) Wie die Fremdbezeichnung christiani zur Eigenbezeichnung wurde
4. Israelbezug und Israelvergessenheit Zu den Briefen nach Ephesus und Kolossae
a) Die Imagination einer Gemeinde aus jüdischen Menschen und Menschen aus den Völkern Zum Brief nach Ephesus
b) Ein Stück Hellenisierung Zum Brief nach Kolossae
Rückblick auf den zweiten Teil
III. Im und nach dem Bruch
Von der Zeit um 100 bis zur Zeit um 150 d. Z.
1. Eine römisch gewordene Gemeinde Zum 1. Clemensbrief
a) Clemens: ein Römer, kein Jude
b) Die von Rom gesetzte politische Ordnung als Muster für die Wahrnehmung
c) Das militärische Vorbild: Hierarchisierung der Gemeinde
d) Gott, die Schrift und Israel
e) Überformung des Jüdischen vom Römischen: ein stillschweigend vollzogener Bruch
2. Im Streit um die Schrift Der Barnabasbrief
a) Wer dieses Schreiben wann verfasste
b) Wogegen der Verfasser sich wendet
c) Wie mit der »Schrift« umgegangen wird
d) Identitätsbildung durch schärfste Abgrenzung im Gemeinsamen
3. Wie im Versuch, sich in die römisch-hellenistische Welt einzufinden, Israel vergessen wird Die Pastoralbriefe
a) Die Situation, von der sich der Verfasser herausgefordert sieht
b) »Das Wort Gottes«, »die Schriften« und »die heilsame Lehre«
c) Reden in der Sprache des kulturellen Kontextes – unter Vergessen Israels und des Jüdischen
4. Nicht jüdisch, sondern christlich leben als Identitätsmerkmal des entstehenden Christentums
a) Ignatius aus Antiochia: Person, Situation, Stellung und Einstellung
b) Die geringe Bedeutung dessen, was »geschrieben steht«
c) »Jesus Christus« in der Perspektive griechischen Denkens
d) »Christentum« statt »Judentum« – nicht nur bei Ignatius
Rückblick auf den dritten Teil
Schluss: Was nun?
Stellenregister (Auswahl)
Einleitung: »Die ersten Christen waren Juden!«?
Der Satz »Die ersten Christen waren Juden« hat unmittelbare Überzeugungskraft. Er bewirkt ein Aha-Erlebnis: Ja klar, das waren Juden! Bei weiterem Nachdenken stellt sich jedoch die Frage: Aber wieso »Christen«? Von welchen Menschen kann man als »den ersten Christen« reden, von wem als »der ersten Christin« oder »dem ersten Christen«? Noch in den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts schrieb eine evangelische Religionslehrerin an die Tafel in der Klasse eines westdeutschen Gymnasiums: »Jesus war der erste Christ«. Das dürfte im allgemeinen Bewusstsein immer noch eine verbreitete Meinung sein. Jesus galt – und gilt manchmal noch immer – als »Stifter des Christentums«. Das zeigte und zeigt Wirkung. Es ist noch nicht so lange her, dass man im wissenschaftlichen Bereich das besondere Profil Jesu im Gegensatz zu dem ihm zeitgenössischen Judentum bestimmte. Heute ist weithin klar erkannt, dass Jesus Jude war und es geblieben ist bis zu seinem Tod. Dennoch gibt es immer wieder Versuche, bei ihm etwas zu finden, das aus dem Judentum heraus- und zum entstehenden Christentum hinführt. Daher ist im ersten Teil zunächst auf Jesus einzugehen – auf das Wenige, was sich in historischer Hinsicht als mit hoher Wahrscheinlichkeit gesichert über ihn sagen lässt. Und dieses Wenige erweist sich als jüdisch.
Es gilt aber auch zu betrachten, wie die vier kanonischen Evangelien als die einzig relevanten Quellen Jesus darstellen. Die Evangelisten schreiben über ihn aus dem Glauben heraus, dass Gott ihn von den Toten aufgeweckt hat. Und so stellen sie seine Geschichte als eine Geschichte des Mitseins Gottes dar. Sie tun das auf der Grundlage der heiligen Schriften Israels ihrer Zeit und mit ihnen – in legendarischer Erzählung. Sie wollen damit zeigen, dass in dem, was Jesus redet, tut und erleidet, Gott zu Wort und Wirkung kommt. Ich werde hier ihre unterschiedlichen Jesusdarstellungen nicht je für sich betrachten, sondern thematische Zusammenhänge in den Blick nehmen in Verbindung mit anderen jüdischen Quellen. Dabei zeigt sich: Auch der Jesus der Evangelien ist jüdisch.
Die dann zu stellende Frage lautet: Haben die Schüler und Schülerinnen Jesu aufgrund ihres Glaubens an ihn als den auferweckten Gekreuzigten, aufgrund des Glaubens, dass er der Messias sei, ein anderes als jüdisches Selbstverständnis gewonnen? Damit im Zusammenhang steht die weitere Frage, ob ihre nicht an Jesus glaubenden Landsleute sie als außerhalb des Judentums stehend betrachteten.
Hinsichtlich zweier Einzelpersonen, Stephanus und Paulus, wissen wir über den einen sehr wenig, über den anderen aufgrund der von ihm erhaltenen Briefe und der Berichte über ihn in der Apostelgeschichte etwas mehr. Auch sie hatten ein jüdisches Selbstverständnis, bezeichneten sich nicht als »Christen« und wurden von ihren jüdischen Landsleuten als Juden angesehen und behandelt.
Die Auseinandersetzungen innerhalb der auf Jesus bezogenen messianischen Gruppe vollzogen sich im jüdischen Kontext. Das gilt auch für das Phänomen, dass sich die messianische Verkündigung alsbald als attraktiv für »Gottesfürchtige« erwies, für bereits mit dem Judentum verbundene nichtjüdische Menschen, die aber nicht konvertiert waren. Es gab einen Streit darüber, wie mit ihnen zu verfahren sei, ob sie – die Männer durch Beschneidung, die Frauen durch ein Tauchbad – ins Volk Israel zu integrieren seien oder nicht. Dieser Streit wurde aller Wahrscheinlichkeit nach auf der Grundlage von Israels heiligen Schriften entschieden. Die Frage ist, welches Selbstverständnis diese zu der messianischen Gemeinde hinzugekommenen, nichtjüdischen Menschen hatten. Dass es ein »christliches« gewesen sei, ist durch nichts angedeutet.
Das Zusammenkommen von jüdischen und nichtjüdischen Menschen in den messianischen Versammlungen führte im politischen Kontext dazu, dass die römische Provinzverwaltung diese Gruppe wahrnahm und als chrestiani/christianoí (»Christen«) bezeichnete. Diese Fremdbezeichnung wurde zunächst nicht zur Eigenbezeichnung. Das geschieht unter sehr bestimmten Bedingungen anfangshaft frühestens gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Der Begriff »Christentum« begegnet – und das als Selbstbezeichnung – erstmals im zweiten Jahrhundert. Und das geschieht sofort im Gegensatz zum Begriff »Judentum«. Dieser Gegensatz manifestiert sich vor allem in bestimmten Riten in antithetischer Abgrenzung zu jüdischen Riten. Das jetzt entstehende und sich so bezeichnende Christentum gewinnt seine Identität als eine antijüdische. Darüber wird im dritten Hauptteil zu handeln sein.
Wie kommt es, dass aus der ganz und gar jüdisch bestimmten Gemeinschaft, die sich auf Jesus als Messias bezieht, in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts die christliche Kirche entsteht, die ihre Identität sofort antijüdisch bestimmt? Welche Weichenstellungen lassen sich dafür in der Zeit nach dem Ende des jüdisch-römischen Krieges im Jahr 70 bis etwa zum Ende des ersten Jahrhunderts erkennen? Diese Zeit ist im Judentum vor allem dadurch geprägt, dass es pharisäische Lehrer sind, die vom Lehrhaus in Javne aus nach dem katastrophalen Ende des Krieges Möglichkeiten jüdischen Überlebens und Weiterlebens finden. Hier beginnt das rabbinische Judentum als ein die jüdische Mehrheit prägendes, normatives Judentum. Auch die jüdische Minderheit der Messiasgläubigen erweist sich in dieser Situation als überlebensfähig. Es kommt zu sich verstärkenden Auseinandersetzungen zwischen Mehrheit und Minderheit. In ihnen nimmt die Mehrheit handfeste Distanzierungen vor, während die Minderheit in schärfster Weise gegen die Mehrheit polemisiert. Dabei handelt es sich aber immer noch um einen innerjüdischen Streit. In ihm spielen auch Konflikte eine Rolle, die sich im politischen Kontext des Imperium Romanum ergeben. Dieser Streit ist im zweiten Hauptteil nachzuzeichnen und dabei herauszustellen, was sich in ihm als derart konfliktverschärfend erweist, dass es zu einer Tendenz auf Abgrenzung und Trennung führt, sodass sich Bruchstellen andeuten.
Im Schlussteil wird zu fragen sein, welche Folgerungen aus dieser Betrachtung der Anfangszeit für unser Christsein im Verhältnis zum Judentum zu ziehen sind.
I. Der Anfang ist jüdisch
Von Jesus bis zum ersten jüdisch-römischen Krieg
1. Jesus – ein Jude
a) Das Wenige, was historisch über Jesus festgestellt werden kann – und das ist jüdisch
Unter strengen historischen Gesichtspunkten kann man nur sehr wenig über Jesus sagen. So mag es nicht verwundern, dass auch eine extreme Position vertreten wurde, die gelegentlich heute noch begegnet. Die historische Existenz eines Menschen Jesus aus Nazaret sei zu verneinen, »der Jesus der Evangelien nur als vermenschlichter Gott zu verstehen«. Diese Darstellungen der Lebensgeschichte Jesu hätten einen »ursprünglich religiösen Mythus« vergeschichtlicht. So – nach Vorgängern – der Philosophieprofessor Arthur Drews Anfang des 20. Jahrhunderts. Er wollte damit positiv »den Grundgedanken erneuern, aus dem das Christentum hervorgegangen, und der unabhängig ist von aller geschichtlichen Beziehung«. Dabei ging es ihm um die von den Zufälligkeiten der Geschichte befreite, sozusagen reine Religion. (Arthur Drews, Die Christusmythe, Jena 1909; verbesserte und erweiterte Ausgabe 1910; die Zitate auf S. 198 199 228)
Eine solche »reine Religion« gibt es nicht in den heiligen Schriften Israels, auf die sich die Judenheit bezieht, und es gibt sie nicht in der um die neutestamentlichen Schriften erweiterten christlichen Bibel, auf die sich die Christenheit bezieht. Es macht die Besonderheit des biblischen Redens von Gott aus, dass eine Geschichte in Geschichten erzählt wird, in Israels heiligen Schriften die Geschichte dieses Volkes, im Neuen Testament die Geschichte des einen Juden Jesus aus Nazaret. Da diese Geschichten das Wirken Gottes bezeugen wollen, können sie keine bloßen historischen Berichte sein. Sie transzendieren immer wieder historisch möglich Erscheinendes, erzählen also legendarisch. Gerade weil sie »sagenhaft« sind, haben sie etwas zu sagen – jenseits der Feststellung historischer Fakten und über sie hinaus. Indem sie in Gemeinschaften erinnert und begangen werden, wird das in ihnen erzählte vergangene Geschehen gegenwärtig und eröffnet gangbare Wege im Jetzt. Die neutestamentlichen Autoren hatten eine grundlegende Vorgabe: die in ihrer Zeit im Judentum als »heilig« geltenden Schriften, sozusagen ihre jüdische Bibel. Diese anachronistische Bezeichnung werde ich im Folgenden der Einfachheit halber öfter gebrauchen. Vom Zeugnis dieser Bibel her, wie es in ihrer Verlesung und Auslegung in versammelter Gemeinschaft laut wurde, wussten sie, wer Gott ist. Diesen Gott, Israels Gott, meinen die Evangelisten, wenn sie vom Wirken Gottes im Reden, Handeln und Erleiden Jesu erzählen. Deshalb ist es nur selbstverständlich, dass sie die Geschichte Jesu auf der Grundlage dieser Bibel und mit ihr schreiben. Auf ihr Zeugnis – und auf das der ganzen Bibel – bezieht sich christlicher Glaube und ist damit auf konkrete Geschichte bezogen. Ohne die Annahme der Historizität der Gestalt Jesu wäre die Entstehung einer auf ihn bezogenen Gemeinschaft und die Entstehung und Art ihres Traditionsgutes, wie es sich in den Evangelien niedergeschlagen hat, völlig unerklärlich.
Dass es eine historische Person Jesus aus Nazaret gab, die einen Schülerkreis um sich versammelte, aus dem eine Gemeinde hervorging, die sich schließlich zum Christentum entwickelte, lässt sich nicht gut bestreiten. Aber die – um Gottes willen! – notwendig legendarische Erzählweise der Evangelien erlaubt es in nur sehr begrenzter Weise, über diese Person im Sinn historischer Wissenschaft verlässliche Daten zu gewinnen.
Im Alter von nur 27 Jahren hat David Friedrich Strauß sein epochales Werk »Das Leben Jesu« verfasst, das 1835 in zwei Bänden erschien. (Das Leben Jesu. Erster Band, Tübingen 1835; Zweiter Band, Tübingen 1836 [tatsächlich noch 1835 erschienen, vom Verleger auf 1836 datiert]; die folgenden Zitate auf S. V und 72 in Band 1) In ihm unterzieht er sämtliche Texte der Evangelien unter ausschließlich historischem Gesichtspunkt einer kritischen Überprüfung. Bei dieser gründlichen Durchsicht bleibt als »historischer Grund und Boden« der Evangelien – im Sinne von: für die historische Wissenschaft verifizierbar – lediglich »das einfache historische Gerüste des Lebens Jesu« übrig. Zählt man die von Strauß dafür gemachten Angaben, kommt man auf acht Punkte. Von ihnen sind zwei zu streichen. Strauß meinte, Jesus habe »überall dem Pharisäismus sich entgegengestellt« und sei »am Ende dem Haß und Neid der pharisäischen Partei erlegen«. Hier ist er dem negativen Pharisäerbild erlegen, das sich in der christlichen Tradition immer stärker herausgebildet hat. Die übrigen sechs Punkte halten jedoch einer strengen historischen Nachfrage stand. Sie seien jetzt im Einzelnen besprochen.
1. Jesus stammt aus Nazaret: Alle Evangelien geben Nazaret in Galiläa als Herkunftsort Jesu an. Nazaret wird in den jüdischen heiligen Schriften nicht erwähnt und auch nicht in der älteren jüdischen Traditionsliteratur bis hin zum Talmud. Es war in der Antike ein unbedeutender Ort. Nach allen Evangelien wird Jesus bei seiner Hinrichtung durch die Angabe »aus Nazaret« genauer identifiziert. Dass man Jesus eine solche Herkunft sekundär zugeschrieben hätte, ist höchst unwahrscheinlich. Wo etwas über Jesu Eltern ausgeführt wird, werden sie als fromme Juden geschildert. Ansonsten ist ihre und seine jüdische Identität als selbstverständlich vorausgesetzt.
2. Jesus ist von Johannes getauft worden: Drei Evangelien erzählen, dass sich Jesus, wie viele andere aus dem jüdischen Volk auch, von Johannes hat taufen lassen. (Matthäus 3,13–17; Markus 1,9–11; Lukas 3,21–22) Das Johannesevangelium setzt die Tradition von der Taufe Jesu durch Johannes voraus, ohne davon zu berichten. (Johannes 1,29–34) Hinter diesem Nichterzählen könnte ein apologetisches Interesse stehen: es nämlich zu verhindern, dass der Täufer gegenüber Jesus als dominant erscheine. Dieses Interesse zeigt sich deutlich, wenn der Evangelist Matthäus den Johannes das Taufbegehren Jesu zunächst abweisen und ihn sagen lässt: »Ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir?« Das Faktum der Taufe Jesu durch Johannes hat also hohe historische Wahrscheinlichkeit. Und diese Taufe war ein innerjüdisches Ereignis.
3. Jesus hat Schüler um sich gesammelt: Auch das ist historisch wahrscheinlich. Die Evangelien stellen Jesus fast durchgängig von Schülern umgeben dar oder setzen das voraus. Ohne eine solche Schülerschaft wäre es unerklärlich, dass es nach seiner Hinrichtung eine so intensive Erinnerung an ihn gab, wie sie sich schließlich in den Evangelien niedergeschlagen hat. Es wäre weiter unerklärlich, dass »Schüler und Schülerinnen« zu einer Selbstbezeichnung der nachösterlich auf Jesus bezogenen Gemeinschaft wurde. Positiv entspricht dem, dass Jesus in allen Evangelien als Lehrer angeredet, bezeichnet und dargestellt wird.
4. Jesus ist im jüdischen Land lehrend umhergezogen: Dass Jesus in der Zeit seines Wirkens umhergezogen ist und nicht sehr ortsfest war, legen die Darstellungen der Evangelien nahe. Sie lassen ihn immer wieder aufbrechen und sich an einen anderen Ort begeben. Das ist kaum bloße Fiktion. Die von ihnen aufgenommenen Traditionen sind mit unterschiedlichen Ortsnamen verbunden. Außerdem bieten sie Aussagen über eine nicht ortsfeste Existenz. Daraus lässt sich auf ein gewisses Wanderdasein Jesu und seiner Schüler schließen.
Mit Strauß ist zu betonen, dass er im jüdischen Land umhergezogen ist. Nach dem Johannesevangelium hat Jesus das Gebiet des biblischen Israel nie verlassen. Ebenso wenig erzählt es von Begegnungen mit Nichtjuden. Mit den »Griechen«, die zum Pessachfest nach Jerusalem hinaufgestiegen sind und Jesus sprechen wollen, kommt es nicht zur Begegnung. (Johannes 12,20–23) In den anderen Evangelien trifft Jesus gelegentlich nichtjüdische Personen und betritt zuweilen auch nichtjüdisches Gebiet, allerdings nur im ländlichen Bereich. Es ist bezeichnend, dass an keiner Stelle erzählt wird, er habe innerhalb Israels die stark hellenisierten Städte Sepphoris und Tiberias betreten, obwohl er sich in deren unmittelbarer Nachbarschaft aufgehalten hat.
5. Jesus hat das Reich bzw. die Herrschaft Gottes verkündet: David Friedrich Strauß hat an dieser Stelle formuliert, Jesus habe »zum Messiasreiche eingeladen«. Das ist so zu präzisieren, dass im Zentrum seiner Verkündigung das Reich bzw. die Herrschaft Gottes stand. Die Dominanz dieses Begriffs ist in den Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas so stark – im Matthäusevangelium in der Fassung »Himmelreich« bzw. »Himmelsherrschaft«, wobei »Himmel« wie in der rabbinischen Tradition als Bezeichnung für Gott steht –, dass sie kaum anders als durch ihre zentrale Stellung in Jesu Verkündigung erklärt werden kann. Sie nimmt auf, was schon der jüdischen Bibel wesentlich ist, dass Gott zur Herrschaft komme und Raum gewinne. Dazu gehört vor allem die Herstellung von Recht und Gerechtigkeit. Schon das bloße Faktum dieser Begriffe mit ihrem biblischen Bezug erweist Jesus als einen jüdischen Lehrer.
6. Jesus ist am Kreuz gestorben: Das ist ein Datum mit größter historischer Wahrscheinlichkeit. Denn es war für diejenigen, denen der für Jesus nach dessen Tod erhobene Anspruch nicht einleuchtete und die ihn ablehnten, ein starkes Argument. Sie führten es auch kräftig ins Feld und damit musste sich die auf Jesus bezogene Gemeinschaft auseinandersetzen. Dieses Faktum lässt sich in örtlicher Hinsicht präzisieren, insofern Jesu Verurteilung zum Tod in Jerusalem erfolgte und seine Hinrichtung in unmittelbarer Nachbarschaft der Stadt. Es lässt sich in zeitlicher Hinsicht präzisieren, insofern Jesus während der Präfektur des römischen Ritters Pontius Pilatus in Judäa zwischen 26 und 36 d. Z. hingerichtet wurde. Nach allen vier Evangelien geschah das an einem Rüsttag zu einem Schabbat (Freitag), und zwar in engem zeitlichen Zusammenhang mit dem Pessachfest. Doch in der genauen Zuordnung unterscheiden sich das Johannesevangelium und die drei anderen Evangelien. Nach Johannes war dieser Rüsttag zum Schabbat zugleich Rüsttag zu Pessach, also nach dem jüdischen Kalender der 14. Nissan, nach den anderen war er der erste Festtag, also der 15. Nissan. Beide Angaben lassen sich nicht miteinander harmonisieren. Je nachdem, wie man hier entscheidet, lassen sich zwischen 26 und 36 d. Z. unterschiedliche Jahre benennen, in denen der 14. oder 15. Nissan ein Rüsttag zum Schabbat war. Hinzu kommt die Unsicherheit, ob die durch Augenschein vorgenommene Bestimmung des Monatsanfangs mit den heutigen astronomischen Berechnungen immer übereinstimmt. Wichtiger als eine genaue chronologische Festlegung ist jedoch der Umstand, dass die Kreuzigung eine römische Strafe war. Jesu Richter war der römische Präfekt Pontius Pilatus. Gekreuzigt wurden in Rom Sklaven, die sich etwas zu Schulden hatten kommen lassen, in den Provinzen Menschen, die für Aufrührer gehalten wurden. Zu Letzterem passt es, dass alle vier Evangelien eine die Schuld Jesu angebende Aufschrift an seinem Kreuz nennen: »der König des jüdischen Volkes«. Das war die römische Wahrnehmung. Für sie reichte es, »Auflauf« erzeugt zu haben. Damit ist aber auch klar, dass Jesus nicht nur als Jude geboren wurde und nicht nur als Jude gelebt und gewirkt hat, sondern auch als Jude gestorben ist.
b) Der Jesus der Evangelien – ein Jude unter Juden
Nicht nur das Wenige, was sich historisch über Jesus mit relativ großer Gewissheit sagen lässt, ist jüdisch. Auch in den legendarischen Erzählungen der Evangelien erscheint er als ein Jude unter Juden. Das will ich nun so aufzeigen, dass ich sie in Beziehung setze zur Darstellung einer bestimmten Gruppe von Menschen in der rabbinischen Literatur, den frühen chassidím, den »Frommen«. Sie gehören in die Gesamtströmung des Pharisäismus, zeigen aber innerhalb ihrer ein besonderes Profil. Auch über sie wird legendarisch erzählt – und damit das Mitsein Gottes mit ihnen und das Wirken Gottes durch sie zum Ausdruck gebracht.
Die Nähe zu Gott
Chanina ben Dossa war ein Chassid, der eine Generation nach Jesus ebenfalls in Galiläa lebte. Über ihn heißt es: »Tag um Tag geht eine Himmelsstimme hervor und sagt: ›Die ganze Welt wird um Chaninas, meines Sohnes, willen ernährt; Chanina, mein Sohn, jedoch hat genug an einem Kav [ca. 2 Liter] Bohnen von einem Vorabend des Schabbat bis zum nächsten.‹« (Babylonischer Talmud Ta’anit 24b) Wenn die ganze Welt um Chaninas willen ernährt wird, dann geschieht hier ein Stück Stellvertretung. Gott sieht Chanina so an, dass er seinetwegen sozusagen die ganze Welt in Kauf nimmt und weiter am Leben erhält. So nennt er Chanina auch zweimal »meinen Sohn«. Das Verhältnis ist so eng und vertraut wie zwischen Vater und Sohn. Der Vater wird tun, was der Sohn ihn bittet. Entsprechend wird folgende Geschichte erzählt: »Der Sohn Rabban Gamliels war krank. Er schickte zwei Gelehrtenschüler zu Rabbi Chanina ben Dossa, um für ihn Erbarmen zu erbitten. Als der sie erblickte, stieg er hinauf zum Obergemach und erbat für ihn Erbarmen. Beim Herabsteigen sagte er ihnen: ›Geht, denn das Fieber hat ihn verlassen!‹ […] Sie setzten sich und schrieben genau die Stunde auf. Und als sie zu Rabban Gamliel kamen, sagte er ihnen: ›Beim Gottesdienst! Ihr habt nichts abgezogen und nichts hinzugetan, sondern genau so geschah es. Zu dieser Stunde verließ ihn das Fieber und er fragte nach Wasser, um zu trinken.‹« (Babylonischer Talmud B’rachot 34b) Hier zeigt sich eine verblüffende Nähe zu der Geschichte vom Hauptmann in Kafarnaum in den Evangelien, besonders in der Fassung des Johannesevangeliums. (Johannes 4,46–53) In ihr ist der Bittende ein jüdischer Hofmann. Er steigt nach Kana hinauf, während sich Jesus dort aufhält, um für seinen Sohn Heilung zu erbitten. Als der nicht sofort auf ihn eingeht, macht er sein Bitten dringlicher: »›Herr, steige hinab, bevor mein Kind stirbt!‹ Jesus sagte ihm: ›Geh! Dein Sohn lebt.‹ Der Mensch vertraute dem Wort, das Jesus ihm gesagt hatte und ging fort. Und bereits während er hinabstieg, kamen ihm seine Bediensteten entgegen und sagten: ›Dein Kind lebt.‹ Da erfragte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Da sagten sie ihm: ›Gestern die siebte Stunde hat ihn das Fieber verlassen.‹ Da erkannte der Vater, dass es jene Stunde war, zu der ihm Jesus gesagt hatte: ›Dein Sohn lebt.‹ Und er gewann Vertrauen, er und sein ganzes Haus.‹« Im Vergleich hierzu weist die Geschichte über Chanina ben Dossa an einer Stelle noch eine Steigerung auf: Er weiß schon Bescheid, bevor die Bittsteller ihm überhaupt etwas sagen können. Dieser Aspekt zeigt sich in ähnlicher Weise auch bei Jesus: Über eine große Entfernung hinweg weiß er, dass der kranke Lazarus inzwischen gestorben ist. (Johannes 11,11–13)
Die außerordentliche Nähe zu Gott zeigt sich in einer weiteren Geschichte. Nach ihr lernt Chanina ben Dossa Tora bei Rabban Jochanan ben Sakkaj. Als dessen Sohn erkrankte, bittet er ihn: »›Chanina, mein Sohn, erbitte für ihn Erbarmen, dass er am Leben bleibe!‹ Der legte seinen Kopf zwischen seine Knie und erbat für ihn Erbarmen. Da blieb er am Leben. Rabban Jochanan ben Sakkaj sagte: ›Selbst wenn der Sohn Sakkajs seinen Kopf den ganzen Tag zwischen seine Knie gequetscht hätte, hätte man ihn nicht beachtet.‹ Da sagte seine Frau zu ihm: ›Ist denn Chanina größer als du?‹ Er sagte zu ihr: ›Nein, aber er ist gleichsam wie ein Diener vor dem König und ich bin gleichsam wie ein Fürst vor dem König.‹« (Babylonischer Talmud B’rachot 34b) Will der Fürst zum König, muss er Audienz gewährt bekommen. Der Kammerdiener aber hat unmittelbaren Zugang, und zwar im vertrautesten Bereich. So verhält es sich bei Chanina gegenüber Gott.
Bei Choni dem Kreiszieher, der im 1. Jahrhundert v. d. Z. lebte, wird diese vertraute Nähe wiederum mit der Beziehung von Vater und Sohn zum Ausdruck gebracht. Als es kurz vor Pessach immer noch nicht geregnet hat, fordert man ihn auf, für Regen zu beten. Er ist sich sicher, sein Beten werde Erfolg haben. Aber es regnet nicht. »Was tat er? Er zog einen Kreis, stellte sich mitten hinein und sprach vor Ihm: ›Herr der Welt, Deine Kinder haben sich an mich gewandt, weil ich wie ein Hauskind vor Dir bin. Ich schwöre bei Deinem großen Namen, dass ich nicht von hier weiche, bis dass Du Dich über Deine Kinder erbarmst.‹ Da fing der Regen an zu tröpfeln. Er sagte: ›Nicht so habe ich gebeten, sondern um Regen für Zisternen, Gruben und Höhlen.‹ Da fing der Regen an, stürmisch zu fallen. Er sagte: ›Nicht so habe ich gebeten, sondern um Regen des Wohlgefallens, des Segens und der Wohltat.‹ Da fiel der Regen, wie es sich gehört. […] Schim’on ben Schetach sandte zu ihm: ›Wenn du nicht Choni wärst, hätte ich über dich den Bann erlassen. Aber was kann ich dir tun? Denn du benimmst dich quengelnd vor dem Ort [= Gott] und er tut dir deinen Willen wie einem Sohn, der seinen Vater quengelt, und der tut ihm seinen Willen.« (Mischna Ta’anit 3,8) Das Verhältnis Chonis zu Gott wird dargestellt wie das eines Kindes, das seinem Vater mit seinen Bitten auf die Nerven geht. Aber der liebt es und erfüllt ihm jeden Wunsch. Entsprechend sagt Jesus vor der Erweckung des Lazarus: »Vater, ich danke Dir, dass Du auf mich gehört hast. Ich wusste ja, dass Du immer auf mich hörst.« (Johannes 11,41–42)
Die Chassiden haben in der rabbinischen Literatur nicht die außerordentliche Stellung und Bedeutung, wie Jesus sie in den Evangelien hat, schon gar nicht ein Einzelner von ihnen. Aber immerhin gilt der Chassid Rabbi Pinchas ben Jair, weil er für sich, für einen Pilger und auch für einen Araber einen Fluss zum Durchzug teilte, nach einer Meinung für »größer als Mose« beim Schilfmeerwunder, nach einer anderen zumindest »wie Mose«. (Babylonischer Talmud Chullin 7a) Die besondere Stellung Jesu in den Evangelien kommt ihm einzig und allein von dem Grundzeugnis her zu, »dass Gott ihn von den Toten aufgeweckt hat«. Aber was dann von dieser Voraussetzung her konkret erzählt wird, hat sofort Entsprechungen. Sie stellen ihn hinein in die jüdische Welt.
Das Vollbringen wunderbarer Taten
In einer langen Aufzählung nach dem Schema, dass mit dem Tod des jeweils Genannten etwas aufhörte, heißt es: »Mit dem Tod des Rabbi Chanina ben Dossa hörten die Menschen der Tat auf.« (Mischna Sota 9,15) Damit wird Chanina als ein besonders herausragendes Beispiel dieser Gruppe von Menschen hervorgehoben. In erster Linie ist dabei an sie als solche gedacht, die es vermögen, wunderbare Taten zu vollbringen. Auf einige wunderbare Taten der Chassiden wurde schon hingewiesen. Auf die zitierte Stelle, nach der täglich eine Himmelsstimme spricht, dass die gesamte Welt um Chaninas willen erhalten werde, folgen Erzählungen wunderbarer Taten. Sie stehen mit Armut im Zusammenhang. »Seine Frau pflegte an jedem Rüsttag des Schabbat den Ofen anzuheizen und etwas Rauch Erzeugendes hineinzuwerfen, weil sie sich schämte. Sie hatte eine böse Nachbarin. Die sagte: ›Ich weiß doch, dass sie nichts hat. Was soll das alles?‹ Sie ging und klopfte an die Tür. Jene schämte sich und stieg ins Zimmer hinauf. Da geschah ihr ein Wunder. Als die andere in den Ofen blickte, war er voll Brot und der Backtrog voll Teig. Sie sagte ihr: ›Du, du, hole eine Schaufel! Dein Brot brennt ja an!‹ Sie sagte ihr: ›Genau dazu war ich hinaufgestiegen.‹ Es wird gelehrt, dass sie auch wirklich hinaufgestiegen war, eine Schaufel zu holen, weil sie an Wunder gewöhnt war.« (Babylonischer Talmud Ta’anit 24b–25a) Darauf folgen noch zwei weitere Wunder. Zwischen dem Erzählen solcher wunderbaren Taten und der darin vorausgesetzten Armut besteht ein unmittelbarer Zusammenhang. Das ist auch der Fall bei vielen in den Evangelien erzählten Wundern Jesu. Dass sich die Erzählung von der Speisung sehr vieler mit wenig Brot und noch weniger Fisch dort sechsmal findet, ist gewiss kein Zufall. Die ebenfalls oft erzählte Heilung von Blinden und Lahmen setzt voraus, dass diese notgedrungen bettelten und also bettelarm waren. Den gerade gestorbenen jungen Mann aus Nain, der zur Bestattung aus dem Ort hinausgetragen wird, erweckt Jesus zum Leben – aus Mitleid mit der Mutter. Als Witwe ist sie arm und mit dem Tod ihres einzigen Sohnes jetzt auch noch um ihre Alterssicherung gebracht. (Lukas 7,11–17) Von solchen wunderbaren Dingen erzählt nicht, wer in Saus und Braus lebt, nicht einmal, wer jederzeit genug zum Leben hat. Sie werden von Menschen erzählt, die um das tägliche Brot bangen müssen, die immer wieder unter das Existenzminimum fallen. Es sind Hoffnungs- und Vertrauensgeschichten gegen eine notvoll erfahrene Wirklichkeit, mit der man sich nicht resigniert abfinden will, in der man aber auch schon Bewahrung und Hilfe erlebt hat und auf solche Bewahrung und Hilfe von Gott her weiter setzt.
So wenig wie die Wundergeschichten in den Evangelien sind die Geschichten über die Chassiden Anekdoten. Durch den Wundertäter handelt der rettende Gott, dessen Möglichkeiten das Menschenmögliche transzendieren. Ihn lässt schon die jüdische Bibel rhetorisch fragen: »Sollte dem Ewigen eine Sache zu wunderbar sein?« (1. Mose 18,14) Diese und weitere Stellen nimmt Jesus auf, wenn er mit Bestimmtheit sagt: »Bei Gott ist alles möglich.« (Markus 10,27) Gott wird das letzte Wort haben. Dass auf ihn auch in notvoller Erfahrung gesetzt werden kann und das so gewonnene Vertrauen Kraft gibt, sie zu bestehen, dazu wollen die Geschichten über die wunderbaren Taten Mut machen. Deshalb werden sie erzählt.
Das Tun des Willens Gottes
Bei den Chassiden steht Gott fraglos an erster Stelle. Deshalb ist allein seinem Willen zu folgen. Ihre Charakterisierung als »Menschen der Tat« hat auch die Bedeutung, dass es nach ihnen auf das konkret und tatsächlich zu vollziehende Tun des Willens Gottes ankommt. Daher schätzen sie das Tun höher ein als die Lehre. Von Chanina ben Dossa wird die Aussage überliefert: »Bei jedem, dessen Taten mehr sind als seine Weisheit, bleibt seine Weisheit bestehen. Bei jedem aber, dessen Weisheit mehr ist als seine Taten, bleibt seine Weisheit nicht bestehen.« (Mischna Avot 3,9) Weisheit bewährt und bewahrheitet sich in guten Taten. Tut sie das nicht, ist sie nichts wert und erweist sich faktisch als nicht existent. Entscheidend ist nicht, dass man etwas sagt; entscheidend ist, dass man tut, was man sagt. Diese Höherschätzung des Tuns vor der Lehre wurde nicht überall geteilt. Es gab auch die gegenteilige Position. Die rabbinische Tradition hat die Lösung des Streits in folgender Erzählung gefunden: »Einst waren Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva und Rabbi Josse der Galiläer als Gäste im Pächterhaus in Lod. Es wurde diese Frage vor ihnen gestellt: Was ist größer, die Lehre oder das Tun? Rabbi Tarfon sagte: ›Das Tun ist größer.‹ Rabbi Akiva sagte: ›Die Lehre ist größer.‹ Sie alle huben an und sprachen: ›Die Lehre ist größer; denn die Lehre führt zum Tun.‹« (Sifrej D’varim § 41) Hier ist reflektiert, dass Tun ohne Lehre zwar möglich ist und das Richtige treffen kann, aber vielleicht nur zufällig. Tun braucht Anleitung, um Richtung und Linie zu bekommen. Dafür ist die Lehre da; führt sie nicht zum Tun, taugt sie nichts. Das ist die schließlich gefundene Lösung. Aber bevor es dazu kam, betonten »die Menschen der Tat« den Vorrang des Tuns.
Entsprechend sagt Jesus: »Nicht alle, die zu mir ›Herr, Herr!‹ sagen, werden in das Himmelreich hineinkommen, sondern nur diejenigen, die den Willen meines Vaters im Himmel tun.« (Matthäus 7,21) Und an anderer Stelle fragt er: »Was nennt ihr mich aber ›Herr, Herr!‹ und tut nicht, was ich sage?« (Lukas 6,46) Entsprechend erzählt er das Gleichnis von den beiden Söhnen, die der Vater auffordert, in seinem Weinberg zu arbeiten. Der erste sagt »nein« und geht dann doch, der zweite sagt »ja« und geht nicht. Es ist klar, wer von beiden den Willen des Vaters getan hat. (Matthäus 21,28–31) Auf das Tun kommt es an. Dass dieses Tun getragen ist vom Vertrauen auf Gott, zeigt sich im Matthäusevangelium an all den Stellen, die die väterliche Fürsorglichkeit Gottes betonen. (z. B. Matthäus 6,32; 7,11) Aber auch in der jüdisch-rabbinischen Tradition fragen die Späteren, die auf Menschen wie Chanina ben Dossa als große Beispiele zurückblicken, schließlich: »Auf wen sollen wir uns stützen?« Und sie antworten: »Auf unseren Vater im Himmel.« (Mischna Sota 9,15)
Von den Chassiden wird berichtet, dass bei ihnen, wie im Pharisäismus überhaupt, das Verzehnten eine wichtige Rolle gespielt hat. Trotz ihrer Armut scheinen sie es besonders ernst genommen zu haben. Auch das zeigen einige eindrückliche Geschichten. So wie die Evangelien Jesus darstellen – nicht bodenständig, sondern umherziehend, keiner geregelten Arbeit nachgehend und also auch ohne Ernte und Einkommen –, hatte er mit dem Problem des Verzehntens nicht eben viel zu tun. Dennoch findet sich dazu eine Äußerung. In Matthäus 23,23 heißt es: »Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr verzehntet Minze, Dill und Kümmel. Aber das Gewichtigere in der Tora lasst ihr beiseite: das Recht und das Erbarmen und die Verlässlichkeit. Dies muss man tun, aber darf jenes nicht lassen.« Nebenbei: Was Jesus nach Matthäus als »das Gewichtigere in der Tora« anführt, findet sich bei Rabban Schim’on ben Gamliel in der Form: »Auf drei Dingen steht die Welt: auf dem Recht, auf der Verlässlichkeit und auf dem Frieden.« (Mischna Avot 1,18) Bei Matthäus heißt es nach der Betonung des Gewichtigeren: »Aber jenes darf man nicht lassen« – also auch Minze, Dill und Kümmel sind zu verzehnten. Das ist nach der Schrift selbst nicht vorgesehen, steht aber in der schriftgelehrten Auslegung, der mündlichen Tora. »Aber jenes darf man nicht lassen« – das wird gerne übersehen oder heruntergespielt. Matthäus bietet es als Wort Jesu. Als solches steht es auch in Lukas 11,42. Hier wird besonders deutlich, wie jüdisch der Jesus der Evangelien ist.
Außer beim Verzehnten waren die Chassiden in der Heiligung des Schabbat besonders streng. Auch dazu gibt es Geschichten über sie. An dieser Stelle zeigt sich ein Unterschied Jesu zu ihnen. Von ihm wird eine solche Strenge nicht berichtet. Aber sein Verhalten liegt nicht außerhalb des Judentums. Es stimmt mit der Mehrheitsmeinung des Pharisäismus überein. Die Aussage Jesu in Markus 2,27: »Der Schabbat ist um des Menschen willen geschaffen, aber nicht der Mensch um des Schabbat willen« hat eine genaue Entsprechung in dem rabbinischen Satz: »Euch ist der Schabbat übergeben, aber nicht seid ihr dem Schabbat übergeben.« (Mechilta de Rabbi Jischmael KiTissa [Schabta] 1; vgl. babylonischer Talmud Joma 85b) Der Schabbat soll dem Leben dienen und es nicht schädigen. Deshalb gilt der oft formulierte Grundsatz, dass Lebensrettung den Schabbat verdrängt. Das fängt früh an; schon bei Halsschmerzen kann man nicht wissen, wo sie hinführen. (Mischna Joma 8,6) So bezieht sich auch der Grundsatz: »So groß ist die Ehre der Menschen, dass sie jedes Verbot in der Tora verdrängt« mehrmals auf am Schabbat Verbotenes. (z. B. babylonischer Talmud Eruvin 41b) Was am Schabbat gegen dessen Verbote dennoch getan werden darf und muss, ist von den Auslegern der Tora verantwortlich zu entscheiden. Bei diesen Entscheidungen gilt es, sich von Barmherzigkeit leiten zu lassen, die sich der Not der Menschen annimmt. Das zeigt sehr anschaulich eine rabbinische Geschichte, die zugleich deutlich macht, dass die eigene Betroffenheit eine wichtige Rolle spielt. In ihr erlaubt es ein Rabbi nicht nur, ein am Schabbat erkrankendes Auge mit Salbe zu bestreichen. Man dürfe, falls die Salbe nicht zuhanden ist, sie auch am Schabbat bereiten und über öffentliches Gebiet herbeibringen. Ihn nennt ein anderer Rabbi daraufhin einen Schabbatfrevler, dem nicht zu folgen sei. Als er aber selbst an einem Schabbat an den Augen litt, lässt er fragen: »Ist es erlaubt oder verboten?« Er bekommt zur Antwort: »Der ganzen Welt ist es erlaubt, dir aber verboten.« (Babylonischer Talmud Avoda Sara 28b)
Zeigt sich also bei den Chassiden im Unterschied zur Hauptströmung des Pharisäismus und im Unterschied zu Jesus eine strengere Einhaltung des Schabbat, so stimmen sie mit Jesus in Abweichung zur Hauptströmung des Pharisäismus überein in einer gewissen Vernachlässigung der Reinheitsgebote. Eine mehrfach überlieferte Geschichte über Chanina ben Dossa hat zunächst mit der Reinheitsfrage nichts zu tun. Sie stellt heraus, dass sich die Chassiden in ihrem Gebet von nichts unterbrechen ließen: »Man erzählt über Rabbi Chanina ben Dossa, dass er stand und betete. Da kam eine Giftschlange und biss ihn. Er jedoch unterbrach sein Gebet nicht. Man ging hin und fand die Giftschlange tot neben ihrem Loch liegen. Man sagte: ›Wehe dem Menschen, den eine Giftschlange gebissen hat! Aber wehe der Giftschlange, die den Rabbi Chanina ben Dossa gebissen hat!‹« (Jerusalemer Talmud B’rachot 5,1) In der Fassung im babylonischen Talmud ist dieser Geschichte ein bedeutsamer Aspekt zugewachsen. Da heißt es von Chanina, nachdem die Schlange tot ist: »Er nahm sie auf seine Schulter und brachte sie zum Lehrhaus. Er sagte ihnen: ›Seht, meine Kinder, nicht die Giftschlange tötet, sondern die Verfehlung tötet.‹« (Babylonischer Talmud B’rachot 33a) Die Schlange gehört nach 3. Mose 11,41–43 zu den unreinen Tieren. Erst recht ist die tote Schlange unrein und macht kultisch unrein, was mit ihr in Berührung kommt. Das scheint Chanina nicht zu kümmern. Mit dem toten, unreinen und verunreinigenden Tier als Demonstrationsobjekt – auch jeder, der ihn berührte, würde jetzt kultisch unrein – sagt er im Lehrhaus: »Nicht die Giftschlange tötet, sondern die Verfehlung tötet.« Darin ist in solchem Kontext impliziert: Nicht die tote Giftschlange macht unrein, sondern die Verfehlung macht unrein. Es besteht daher in diesem Punkt sachliche Übereinstimmung mit dem Ausspruch Jesu nach Markus 7,15: »Nichts davon, was von außen in den Menschen eingeht, kann ihn unrein machen, sondern das, was aus dem Menschen hervorgeht, macht den Menschen unrein.« Als aus dem Menschen Hervorgehendes werden im Folgenden die im Herzen als dem Zentrum der Person entstehenden bösen Gedanken interpretiert, die zu bösen Taten, zu Verfehlungen führen.
Die Einbettung Jesu im Judentum tritt im Matthäusevangelium an einem Punkt besonders markant hervor. Er macht die Auslegung der Tora durch »die Schriftgelehrten und die Pharisäer«, also die mündliche Tora, für seine Schülerschaft verbindlich: »Auf dem Lehrstuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Alles nun, was immer sie euch sagen, tut und haltet!« (Matthäus 23,2–3) So sehr er ihnen auch im Folgenden ein ums andere Mal ein »Wehe!« entgegenschleudert, in allen angesprochenen Fragen lässt sich Übereinstimmung mit dem rabbinischen Judentum aufweisen bzw. bewegt er sich innerhalb des dort geführten Diskurses. Dementsprechend stellt er die unbedingte Geltung der Tora bis ins Kleinste heraus. (Matthäus 5,17–19) Auf dieser Basis kann es im folgenden Text in Matthäus 5,21–48 nicht um »Antithesen zum Gesetz« gehen, sondern es liegen Auslegungen der Tora vor.
Jesus – der Gesalbte
Aus dem bisher Dargestellten ist deutlich geworden, wie sehr der Jesus der Evangelien in die Welt des Judentums hineingehört. Wenn wir ihm begegnen, begegnen wir einem Juden, der nicht isoliert von seinem Volk gelebt hat, sondern mitten in ihm und mit ihm. Im Blick auf Aussagen, die ihn als Person herausheben, sei an die enge Beziehung zwischen Gott und Choni als eine von Vater und Sohn erinnert und an die Bezeichnung Chaninas als Sohn Gottes, dessentwegen Gott die ganze Welt erhält. »Mein Sohn« wird an anderer Stelle auch Rabbi Elieser von einer Himmelsstimme genannt. (Jerusalemer Talmud Moed Qatan 3,1[10b]) »Sohn Gottes« ist in Israels heiligen Schriften, im christlichen Alten Testament, auch Israel als Ganzes. (2. Mose 4,22–23; Hosea 11,1) So sind alle in Israel Gottes Kinder. (5. Mose 14,1) Das aber enthält zugleich die Verpflichtung, sich als Kinder Gottes zu verhalten. Aber die Gotteskindschaft geht nicht verloren, wenn diese Verpflichtung nicht eingelöst wird. Im Midrasch wird diese Bibelstelle zitiert: »Kinder seid ihr des Ewigen, eures Gottes« und dann fortgefahren: »Rabbi Jehuda sagt: ›Wenn ihr euch gemäß dem Verhalten von Kindern verhaltet – ja, dann seid ihr Kinder; wenn aber nicht, seid ihr auch nicht Kinder.‹ Rabbi Meïr sagt: ›Ob so oder so – ihr seid Kinder.‹« Und er belegt das an einer Reihe von Bibelstellen. (Babylonischer Talmud Qidduschin 36a) Beide Aussagen sind nicht gegeneinander auszuspielen. Die erste hebt die mit der Kindschaft gegebene Verpflichtung hervor. Die zweite betont für den Fall der Verfehlung die unbedingte Verlässlichkeit Gottes, der seinerseits das Verhältnis der Vaterschaft zu seinem Volk nicht aufkündigt, sondern in Treue dazu steht.
Die Verpflichtung, sich als Kinder Gottes zu verhalten, ist zugleich auch eine Beauftragung zur Zeugenschaft. Hält Israel die Verpflichtung ein, hält es sich an das von Gott Gebotene und steht so für Recht und Gerechtigkeit ein, für das, was Gott will, ist es damit auch Zeuge Gottes in der Welt und für sie. »Ihr seid meine Zeugen, Spruch des Ewigen, und ich bin Gott«, heißt es in Jesaja 43,12. Das ist ein hoher Auftrag, an dem alles hängt, wie der Midrasch deutlich macht, wenn er ausführt: »Wenn ihr meine Zeugen seid, bin ich Gott. Wenn ihr aber nicht meine Zeugen seid, bin ich gleichsam nicht Gott.« (Sifrej D’varim § 346) Gott ist im Wort und wirkt durchs Wort. Er spricht nicht anders als im Wort derer, die ihn bezeugen.
Als ein besonderer Sohn Gottes gilt der König. Nach Psalm 2,7 redet Gott den neuen König an: »Mein Sohn bist du; heute habe ich dich erzeugt.« Im vorangehenden Text war er von Gott als »mein König auf Zion« bezeichnet worden, und am Beginn des Psalms standen »der Ewige und sein Gesalbter« nebeneinander. In der jüdischen Tradition wird das idealisierte Königreich Davids zum Urbild des erhofften Reiches, der erhofften Herrschaft Gottes. Und dementsprechend erwartet man einen Davididen als »Gesalbten«, als messianischen König. »Messias« ist die griechische Transkription des aramäischen Wortes meschichá, das wie das entsprechende hebräische Wort maschíach die Bedeutung »gesalbt«, »Gesalbter« hat. Das griechische Wort dafür ist christós. In den Evangelien steht die Bezeichnung »Gesalbter« für Jesus oft neben der Bezeichnung »Sohn Gottes«. Auf dem Hintergrund von Psalm 2,7 und der jüdischen Tradition ist deutlich, dass es sich dabei um parallele Bezeichnungen handelt, dass also nicht die eine die andere überbietet, sondern das sie sich gegenseitig interpretieren. »Gesalbter« (Messias) ist die für Jesus im Neuen Testament am häufigsten gebrauchte Hoheitsbezeichnung. Das wird in unseren Übersetzungen in der Regel dadurch verdeckt, dass das griechische Wort christós meistens nicht übersetzt, sondern mit seiner lateinischen Transkription »Christus« wiedergegeben wird. Das erweckt den Eindruck, als handle es sich um einen Namen. Als »Gesalbter«, als »Messias« wird keiner der Chassiden bezeichnet. Damit sagen die Evangelien mehr über Jesus aus als die rabbinische Tradition über die Chassiden. Was führt sie dazu?
Im Matthäusevangelium wird Jesus gleich im Titel des Buches als »der Gesalbte, der Sohn Davids« eingeführt, (Matthäus 1,1), im Markusevangelium als »der Gesalbte, der Sohn Gottes«. (Markus 1,1) Im Lukasevangelium sagt der himmlische Bote den Hirten nach der Geburt Jesu: »Für euch wurde heute in der Stadt Davids ein Retter geboren: der Gesalbte des Ewigen.« (Lukas 2,11; vgl. 2,26) Nachdem der Evangelist Johannes im Prolog davon gesprochen hat, dass »das Wort«, Gottes schöpferisches Sprechen, Fleisch geworden sei, nennt er als Konkretion alsbald den Namen Jesus und bezeichnet dabei diesen Menschen als »Gesalbten«. (Johannes 1,14.17) Und schon in den ersten Tagen des Auftretens Jesu teilt Andreas, nachdem er zusammen mit einem anderen bei Jesus war, seinem Bruder Simon Petrus mit: »Wir haben den Messias gefunden.« Der Evangelist fügt sofort erklärend an: »Das ist übersetzt: Gesalbter.« (Johannes 1,41) In der Mitte von drei Evangelien bekennt Petrus Jesus als »den Gesalbten«. (Matthäus 16,16; Markus 8,29; Lukas 9,20) Der Evangelist Matthäus charakterisiert Jesu Handeln als »Taten des Gesalbten«, »messianische Taten«. (Matthäus 11,2) Im Johannesevangelium wird immer wieder darum gestritten, ob Jesus »der Gesalbte«, »der Messias« sei. Außenstehende bringen Einwände, Tatsachen, die in ihren Augen den für Jesus erhobenen Messiasanspruch widerlegen. Johannes bestreitet die angeführten Fakten nicht. Dennoch ist Jesus für ihn »der Gesalbte«. Gegen den stärksten Einwand, dass Jesus als an einem römischen Kreuz Hingerichteter gescheitert sei und also schlechterdings nicht der Messias sein könne, setzt er den Glauben, dass gerade an dieser Stelle tiefster Erniedrigung und tödlicher Endgültigkeit Gott neuschöpferisch gehandelt habe, indem er Jesus »erhöhte«, von den Toten aufstehen ließ. (Johannes 12,32–34; 20,9; vgl. 2,22) Entsprechend spannt der Evangelist Markus über die gesamte Erzählung der Geschichte Jesu hin die drei Akte eines Inthronisationsgeschehens. Bei der Taufe Jesu durch Johannes sagt eine Stimme vom Himmel in Aufnahme von Psalm 2,7 und Jesaja 42,1 zu ihm: »Du bist mein geliebter Sohn; an dir habe ich Gefallen gefunden.« (Markus 1,11) Bei der Verklärung Jesu »auf einem hohen Berg« präsentiert »eine Stimme aus der Wolke« Jesus den drei mitgenommenen Schülern in Aufnahme von Palm 2,7 und 5. Mose 18,15: »Das ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn!« (Markus 9,7) Nach dem Tod Jesu am Kreuz lässt Markus den Centurio des Hinrichtungskommandos angesichts des dabei Geschehenen bekennen: »Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.« (Markus 15,39) Er legt diesem nichtjüdischen Menschen nicht mehr in den Mund, als ihm in dieser Situation als denkbar erscheint. Dass aus dessen Aussage in Vergangenheitsform für die Lesenden und Hörenden des Evangeliums die Aussage vom Anfang – Jesus ist »der Gesalbte, der Sohn Gottes« – aufgenommen und durchgehalten werden kann, dafür muss noch die Botschaft des jungen Mannes im weißen Gewand im Grab Jesu an die drei Frauen erklingen, die Jesu Leichnam salben wollten. »Jesus sucht ihr, den aus Nazaret, den gekreuzigten. Er ist aufgeweckt worden; er ist nicht hier.« (Markus 16,6) Nach der Darstellung des Lukas in der Apostelgeschichte erfolgt am ersten Tag des Wochenfestes, des zweiten jüdischen Wallfahrtsfestes im Jahr, gemäß Joel 3 die Ausgießung von Gottes Geisteskraft über die versammelte Anhängerschaft Jesu. Das führt zu ekstatischen Phänomenen, was die Bevölkerung Jerusalems samt Festbesuchern zusammenlaufen lässt. (Apostelgeschichte 2,1–13) Diesen seinen Landsleuten hält Petrus eine Rede. Gegen deren Ende zitiert er David als den vorgestellten Autor vieler Psalmen und fasst das dann so zusammen: »Deshalb redete er vorausblickend von der Auferstehung des Gesalbten.« Er fährt selbst bekennend fort: »Diesen Jesus hat Gott aufstehen lassen; das bezeugen wir alle.« Unter Bezug auf Psalm 110,1 sagt er schließlich: »Das ganze Haus Israel soll also mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn zum Herrn und Gesalbten gemacht hat – diesen Jesus, den ihr habt kreuzigen lassen.« (Apostelgeschichte 2,31–36) Aufgrund des Glaubens an Jesu Auferweckung halten ihn die Evangelisten für den Messias und stellen von daher sein Wirken als ein messianisches dar. Und dieses Wirken ist primär auf Israel bezogen.
Der zur Rechten Gottes erhöhte Herr und Gesalbte greift nicht selbst unmittelbar in das Geschehen ein; er ist sozusagen in einem Wartestand. Von daher ergibt es sich, dass er angesichts all des Bedrängenden, das in der Welt weiterhin geschieht, dringlich um sein Kommen angerufen wird. Bei Paulus findet sich am Ende des 1. Korintherbriefes in griechischer Transkription der aramäische Ruf: marána tha. (1. Korinther 16,22) Paulus übersetzt ihn nicht. Er setzt ihn als bekannt voraus. Das heißt dann aber auch, dass er in den Gemeindeversammlungen im Gebrauch war. Dieser Ruf findet sich in derselben Form noch einmal in der ältesten erhaltenen Gemeindeordnung. (Didache 10,6) Am Ende der Offenbarung des Johannes, unmittelbar vor dem Schlussgruß, lässt der Autor den erhöhten Jesus sagen: »Ja, ich komme bald.« Darauf folgt als Bitte zum Einstimmen für die Lesenden und Hörenden: »Amen. Komm, Herr Jesus!« (Offenbarung 22,20) Das ist eine der Sache entsprechende Aufnahme des aramäischen Rufes marána tha. Dieser Ruf ist die bittende Entsprechung zu der biblischen an Gott gerichteten Frage: »Wie lange noch, Ewiger?« (z. B. Psalm 79,5) Sie wird aus bedrängenden Situationen heraus gestellt, ein Schrei aus der Erfahrung von Leid, Not und Unrecht. Gott möge doch endlich eingreifen und dem ein Ende machen. Er ist doch der Richter, der das letzte Wort hat und Recht und Gerechtigkeit herstellen wird! Das ist die Intention dieser Frage. In der Bitte um sein Kommen ist diese Intention auf Jesus als Herrn bezogen. Das setzt voraus, dass er von Gott dazu beauftragt ist, als sein Repräsentant diese Funktion des Richters wahrzunehmen. So wird Jesus auch mit der aus Daniel 7 hervorgegangenen Gestalt des »Menschensohnes« als des von Gott beauftragten endzeitlichen Richters identifiziert. Daher nimmt Jesus, besonders ausgeprägt im Matthäusevangelium, nicht nur die Rollen des Lehrers und des messianischen Königs ein, sondern auch die des Richters. Letztere wird er jedoch erst in der Zukunft ausfüllen.
Dass Jesus als Gesalbter, als Herr, erhöht zur Rechten Gottes, als endzeitlicher Richter gilt, geht über das hinaus, was über die Chassiden gesagt wird. Aber diese hohen Aussagen ergeben sich nicht von einer herausragenden Eigenschaft oder Aktivität Jesu her, dass er also irgendeine Einzigartigkeit aufwiese, die ihn von allen anderen Menschen abhöbe, dass er so Besonderes gesagt oder getan hätte wie niemand sonst. Sie gründen allein darin, dass Gott am gestorbenen Jesus gehandelt hat, als er selbst gar nichts mehr aufwies und gar nichts mehr tun konnte, dass Gott ihn in endzeitlich-neuschöpferischer Tat von den Toten aufgeweckt hat. Dieses Zeugnis konnte nur auf der Basis der heiligen Schriften Israels und innerhalb der sie auslegenden jüdischen Tradition gegeben werden.
Also nicht nur das Wenige, was historisch mit Gewissheit über Jesus gesagt werden kann, lässt uns einem Juden begegnen. Auch wenn wir Jesus wahrnehmen, wie ihn die Evangelien darstellen, begegnen wir einem Juden – und damit Jüdischem und nur Jüdischem.
Ein Theologe soll gesagt haben: Dass sich Gott durch Jesus, also einen Menschen aus dem jüdischen Volk, kundgetan habe, sei historisch zufällig und daher sachlich nicht von Gewicht. Er hätte sich dazu auch einen Menschen aus irgendeinem anderen Volk erwählt haben können. Die bestimmte Volkszugehörigkeit spiele keine Rolle. Träfe das zu, ginge es um einen zuvor unbekannten Gott, der erst durch Jesus in die Welt gekommen wäre, der erst in Jesus gezeigt hätte, wer er ist. Das ist nicht die Sicht des Neuen Testaments. Nach ihm gilt in aller Selbstverständlichkeit und wird auch immer wieder deutlich erkennbar: Es ist der in Israel bezeugte und dort längst schon bekannte Gott, der in und durch Jesus zu Wort und Wirkung kommt. Nach der Bibel ist Gott in Israel zur Welt gekommen und dieser Gott Israels kommt durch Jesus zu den Völkern der Welt. Wie das geschehen ist, darüber wird in diesem Buch noch zu handeln sein.
2. Jesu Schülerschaft: alle jüdisch – auch nach »Ostern«
a) Der Anfang: »Gott hat Jesus von den Toten aufgeweckt«
Unter den Punkten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit als historisch gesichert gelten können, wurde im vorigen Kapitel angeführt, dass Jesus einen Schülerkreis um sich gesammelt hat. Alle erwähnten Daten weisen darauf hin, dass es sich bei diesen Mitgliedern durchgehend um jüdische Personen handelt. Die Schülerschaft Jesu fand aber ein abruptes Ende, als er festgenommen wurde. Die Evangelien berichten, dass alle Schüler die Flucht ergriffen. Ihre Enttäuschung muss noch größer gewesen sein, nachdem er hingerichtet worden war. Das spiegelt sich deutlich in der wunderhaften und wunderbaren Erzählung von zwei Schülern auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus am dritten Tag nach Jesu Tod. (Lukas 24,13–32) Es ist ein Weg zurück, ein Weg der Resignation. Ihnen schließt sich Jesus unerkannt als Dritter an. Als scheinbar Unwissender zieht er sie in ein Gespräch über sich selbst. Ihm gegenüber sagt einer der beiden Schüler: »Wir aber hatten gehofft, dass er es sei, der Israel befreien würde.« (Lukas 24,21) Die auf Jesus gesetzte Hoffnung und damit auch ihre Schülerschaft ihm gegenüber haben mit Jesu Tod ein Ende gefunden.