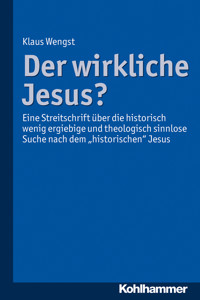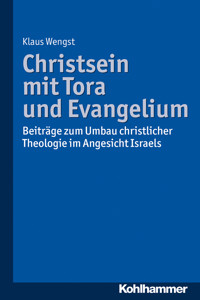32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Jesus, wie die Bibel ihn sieht
Das Bemühen, »hinter« den Evangelien zu suchen, wer der »historische Jesus« war, geht an dem für die Evangelisten zentralen Punkt vorbei. Sie wollen zeigen, wer Jesus ist, indem sie seine Geschichte als eine Geschichte von Gottes Mitsein erzählen. Wer wissen will, wer Jesus ist, muss darum die vier kanonischen Evangelien als die einzig relevanten Zeugnisse über ihn lesen und zu verstehen suchen. Deshalb stellt dieses Buch ihre Jesus-Darstellungen je für sich ins Zentrum, fragt nach deren Grundlinien, Inhalten, Hintergründen und nach ihrer Anschlussfähigkeit für heute. Wer den wirklichen Jesus sucht, findet hier Einsichten, die zum eigenen Weiterdenken herausfordern.
- Jesu Weg und Wirkung – verständlich erklärt
- Die Jesusbilder der Evangelien: Gundlinien, Inhalte und Hintergründe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1079
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Klaus Wengst
Mirjams Sohn -
Gottes Gesalbter
Mit den
vier Evangelisten
Jesus entdecken
Gütersloher Verlagshaus
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2016 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlagmotiv: Andrea del Sarto »Christ in pietà«, Accademy Gallery/Florence;
© der Vorlage: bpk / Alinari Archives / Tatge, George for Alianari
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-19611-0V001
www.gtvh.de
Für Helga
Vorwort
Beim Übergang in die Pensionszeit nahm ich mir eine Reihe von Projekten vor, die ich in Buchform zu einem vorläufigen Abschluss bringen wollte. Zu ihnen gehörte eins mit dem Arbeitstitel: »Der sogenannte historische Jesus und der Jesus der Evangelien«. Als ich mit dessen Ausarbeitung begann, stellte sich sehr schnell heraus, dass sich dieses Thema nicht in einem Band abhandeln lassen würde. So habe ich zunächst ein sozusagen negatives Buch geschrieben, in dem ich in wissenschaftlicher Auseinandersetzung an ausgewählten Beispielen der Forschungsgeschichte und zeitgenössischer Arbeiten zum »historischen« Jesus begründe, warum ich die Suche nach ihm mit Martin Kähler für einen »Holzweg« halte (Der wirkliche Jesus? Eine Streitschrift über die historisch wenig ergiebige und theologisch sinnlose Suche nach dem »historischen« Jesus, Stuttgart 2013). Das Ergebnis dieser Streitschrift habe ich in die Einleitung des hier vorliegenden »positiven« Gegenstücks aufgenommen. Dass dieses Gegenstück ein eigenes Buch sein müsste, ergab sich nicht nur vom zu erwartenden jeweils großen Umfang her. Dieses zweite Buch unterscheidet sich vom ersten auch in seiner Art. Ich führe in ihm keine ausdrücklichen Auseinandersetzungen und biete keine Anmerkungen. Indem ich so lediglich meine eigene Sicht darlege, verzichte ich jedoch nicht auf wissenschaftlichen Anspruch. Was ich hier vorlege, basiert ganz und gar auf meiner inzwischen über Jahrzehnte reichenden wissenschaftlichen Arbeit. Ich wollte jedoch so schreiben, dass auch Lese-rinnen und Leser, die nicht theologisch ausgebildet sind, aber Interesse an der theologisch zentralen Frage nach Jesus haben, von der Lektüre Gewinn haben könnten.
Ist das, was ich hier biete, nun ein Jesusbuch oder eine Christologie der Evangelien? Ich gestehe, dass mir an solchen Zuweisungen nichts liegt. Es handelt sich nicht um ein Jesusbuch im Sinne der historischen Fragestellung, wer Jesus war. Aber es geht mir entschieden um die Frage, wer Jesus nach dem Zeugnis der Evangelien ist. Ich lege dabei keine Lehre über den geglaubten Jesus vor. Aber indem ich mich streng am Text der Evangelien orientiere – und zwar eines jeden Evangeliums für sich –, kann es aufgrund des Charakters der Evangelien nicht anders sein, dass sich aus dieser Arbeit ein theologisches Buch ergibt.
Vor dem Verfassen der Darstellungen zu den einzelnen Evangelien habe ich jedes Evangelium im Ganzen übersetzt. Meine Übersetzung der Evangelien kann im Internet eingesehen werden unter: www.wengst.de/evangelien und über den QR-Code auf S. 2. Selbstverständlich behaupte ich nicht, die richtige Übersetzung zu bieten, beanspruche jedoch, dass es sich bei schwierigen und umstrittenen Stellen um philologisch und vom jeweiligen Kontext her zutreffende Lösungen und also um mögliche Übersetzungen handelt. Grundlage ist – mit wenigen Ausnahmen, an denen ich mich textkritisch anders entscheide – die 28. Auflage des in der Wissenschaft gebrauchten griechischen Neuen Testaments, des »Nestle-Aland« (Stuttgart 2012). Ich wünsche mir Leserinnen und Leser, die die von mir ausgelegten Texte in deren eigenem Zusammenhang nachlesen – am besten in nicht nur einer Übersetzung. Und noch mehr möchte ich Lust dazu machen, die Evangelien im Ganzen zu lesen und sich eigene Gedanken zu machen, am besten im Gespräch mit anderen. Dabei wird auch deutlich werden, wie viel Texte ich nicht besprochen habe, die doch auch bedacht werden sollten und von denen noch einmal ein anderes Licht auf die von mir besprochenen geworfen werden könnte. Das Auslegen kanonischer Texte hört nicht auf.
Zur Bezeichnung der Verfasser der Evangelien benutze ich die Namen, unter die sie die kirchliche Tradition sekundär gestellt hat, ohne dass ich meinte, sie seien von den damit bezeichneten Personen tatsächlich verfasst worden. Auf diese Zuschreibungen gehe ich am Ende des ersten Abschnitts zum Lukasevangelium in einem Exkurs am Beispiel des »Lukas« ein. Zitierte Stellen aus biblischen Büchern werden mit Titel, Kapitel- und Verszahl angegeben, bei den Evangelien im jeweiligen Teil nur mit Kapitel- und Verszahl.
Ich danke Christa und Dr. Manfred Buchholz, Christiane Hensing und meiner Frau, die in vier jeweils sehr langen Sitzungen den gesamten Text dieses Buches kritisch mit mir durchgegangen sind. Dabei haben wir auch viel gelacht – nicht zuletzt über von mir fabrizierte verunglückte Formulierungen. Sie haben mit ihrer Kritik nicht nur zu besserer Lesbarkeit beigetragen, sondern an vielen Stellen auch zu größerer sachlicher Klarheit. Ein entsprechender Dank gilt Dr. Jürgen Seim, pensionierter Pfarrer in Neuwied, der das Manuskript sorgfältig gelesen, Korrekturen angebracht und hilfreiche Hinweise gegeben hat, die ich gerne aufge-nommen habe.
Ich danke Diedrich Steen vom Gütersloher Verlagshaus, der mein Manuskript bereitwillig angenommen und die Veröffentlichung kräftig gefördert, und Gudrun Limberg vom Lektorat, die die Korrekturarbeit sorgfältig begleitet und vorangetrieben hat.
Noch einmal besonders danke ich meiner Frau Helga. An keinem meiner bisherigen Bücher hat sie so Anteil genommen wie an diesem. Während der Arbeit an der Streitschrift hat sie öfter gemeint, ich hätte zuerst das »positive« Buch schreiben sollen. Man würde sonst nicht verstehen, was ich mit der Streitschrift will. Jetzt liegt das »positive« Buch vor. Wie es sich nun mit dem besagten Verstehen verhält, bleibt natürlich eine offene Frage.
Bochum, im Juni 2016
Klaus Wengst
Inhalt
Vorwort
EinleitungDer sogenannte historische Jesus und der Jesus der Evangelien
1. Zuerst ist die Eigenart der Evangelien zu bedenken.
2. Der Ansatz historischer Jesusforschung steht im Gegensatz zum Grundsatz der Evangelien.
3. Was historisch als »sehr wahrscheinlich« gelten kann, ist sehr wenig.
4. Ist historische Jesusforschung theologisch notwendig?
5. Was Exegetinnen und Exegeten des Neuen Testaments tun und was sie lassen sollten.
I. Der Weltherrscher als Lehrer der Gerechtigkeit und als Richter Jesus im Evangelium nach Matthäus
1. Der Rahmen: Anfang und Schluss des Evangeliums
Die Geschichte Jesu in der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel
Das Lernen der Völker in der Geschichte Jesu als Ziel
Worauf Anfang und Ende des Evangeliums hinweisen:Jesus als endzeitlich-messianischer König
2. Die Rollen Jesu im Matthäusevangelium
Eine sich wiederholende Szenerie
Die Verbindung der Rollen von Lehrer und König in der literarischen Konzeption
3. Jesus als König
Die Wunder als Ausdruck königlicher Macht
Der Gesalbte: Davidssohn und Gottessohn – und das besondere Schicksal Jesu
Die Öffnung für die Völker
4. Jesus als Lehrer
Kennzeichnungen Jesu als Lehrer und seines Wirkens als Lehren
Die Hochschätzung der Tora und ihrer Auslegung durch Jesus
Jesus als Ausleger der Tora im innerjüdischen Diskurs
Der Lehrer des Himmelreichs
Der Lehrer von Recht und Gerechtigkeit und von Erbarmen
5. Jesus als der kommende Richter
Die Besonderheit der Rolle des Richters
Die Provokation der Rolle des kommenden Richters
Der kommende Richter: »der Menschensohn«
Das Gericht und seine Maßstäbe
6. Eine Anmerkung zum Miteinander der Rollenvon König, Lehrer und Richter
7. Die Situation, in der Matthäus schreibt
II. Einweisung in die Nachfolge des inthronisierten Gekreuzigten Jesus im Evangelium nach Markus
1. Der Rahmen: Anfang und Schluss des Evangeliums
Die Überschrift
Das programmatische Vorspiel
Der offene Schluss
Der Rückverweis ins Evangelium
2. Wem die Nachfolge gilt
Der Gesalbte
Der Gesalbte, der leiden und sterben muss
Leidensnachfolge
Jesus folgen ohne persönliche Nachfolge?
Der in Leiden und Tod gehende Gesalbte im himmlischen Glanz
3. Der Weg des Gottessohnes
Die Einsetzung Jesu zum messianischen König bei der Taufe
Die Proklamation und Präsentation Jesu als messianischer König
Die Akklamation gegenüber Jesus als dem messianischen König
4. Der König Israels, das Reich Gottes und der Wille Gottes
Keine Aufhebung der Partikularität Israels ins Universale
Die Darstellung Jesu in ihrem jüdischen Kontext
Das Reich Gottes
5. Geheimnis und Wunder
Die Schweigegebote
Das Nichtverstehen der Schüler
Durchbrechungen des Schweigegebots
Die Wunder
6. Die Situation, in der Markus schreibt
III. Der Messias Israels und der Völker Jesus im Evangelium nach Lukas
1. Der andere Anfang: ein literarisches Vorwort
2. Der Schluss, der wieder zum Anfang wird:die doppelte Himmelfahrtsgeschichte
Das Ende des Evangeliums
Der Anfang der Apostelgeschichte
3. Der Gesalbte und das Reich für Israel
Johannes, Jesus und die Befreiung Israels
Das Reich Gottes und das Reich für Israel
4. Gottes Herrschaft und Reich: Zuspruch und Anspruch
Der programmatische erste Auftritt: Jesus in der Synagoge von Nazaret
»… das Wort Gottes hören und tun«
5. »… machtvoll in Tat und Wort«Manifestationen von Gottes Herrschaft und Reich
Jesus, der Taten des Reiches Gottes vollbringt
Jesus, der Gottes Herrschaft proklamiert und von Gottes Reich erzählt
6. Das Ausstehen des Reiches Gottes in seiner Fülle
»Friede auf Erden« – und noch kein Frieden
Die in wacher Bereitschaft festgehaltene Hoffnung
7. Der Gesalbte, der leiden und aufstehen muss
8. Der Gesalbte, die Völker und »die Hoffnung Israels«
9. Die Situation, in der Lukas schreibt
IV. Der Verherrlichte und Erhöhte mit den Wundmalen des Gekreuzigten Jesus im Evangelium nach Johannes
1. Der Anfang und das doppelte Ende
Der Prolog als Leseanweisung
Die beiden Buchschlüsse
2. Die Spannung von Niedrigkeit und Hoheit –die beiden das Evangelium übergreifenden Bögen
3. Die Struktur des Evangeliums
4. Der Blick in die Zeit nach Jesu irdischem Wirken
»Halt mich nicht fest!« Die Begegnung Mirjams aus Magdala mit Jesus am Grab
Der Geist als Kraft, die Jesus wieder-holt
5. Die Situation, in der Johannes schreibt
6. Die gegen Jesus erhobenen Einwändeund die Gegenargumentation des Johannes
Die gegen Jesu Messianität angeführten Tatsachen
Der Vorwurf der Gotteslästerung
Die Folgen: Weggehen oder Bleiben?
7. Jesus als der verletzliche und tief verletzte Mensch
8. Der Souverän
Der König
Die wunderbaren Taten Jesu als Zeichen
»Ich bin …«
9. »Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs?« – »Bevor Abraham war, bin ich.«Versuch einer kurzen zusammenfassenden Betrachtung
10. Jesus und »die Juden« im Johannesevangelium:Brüske Entgegensetzung und doch auch Zwischentöne
Schluss Jesus, die vier Evangelien und die Verantwortung der Auslegenden
1. Das eine Evangelium und die vier Evangelien
2. Nur vier Evangelien?
3. Die Entstehung der vier Evangelien in der Zeitnach der Katastrophe des Jahres 70
4. Vier Evangelien – gemeinsame Voraussetzungenund unterschiedliche Profile
5. Die Verantwortung der Auslegenden
Stellenregister
Einleitung
Der sogenannte historische Jesus
und der Jesus der Evangelien
1. Zuerst ist die Eigenart der Evangelien zu bedenken.
In seinem berühmten Vortrag von 1892: »Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Christus« nennt Martin Kähler »die Bescheidenheit« als »die erste Tugend echter Geschichtsforschung«. Er fährt fort: »Bescheidenheit kommt von Bescheid wissen; und wer Bescheid weiß mit geschichtlichen Tatsachen und Quellen, der lernt Bescheidenheit sowohl im Wissen als im Verstehen.« Er hat dabei die Evangelien im Blick, die sich gegenüber der Rückfrage nach dem »historischen« Jesus als sehr widerständig erweisen. Man kann sie literarisch in die Gattung des bíos bzw. der vita, also einer Lebensbeschreibung, einordnen. Aber damit ist das Entscheidende noch nicht gesagt. An markanten Stellen unterscheiden sie sich auch formal von dieser Gattung, nämlich vor allem am Anfang und am Ende. Im Markus- und Johannesevangelium werden nicht einmal Geburt und Herkunft Jesu erwähnt. In keinem Evangelium ist von einer Entwicklung Jesu vom Kind über den Jugendlichen zum Mann die Rede. Er tritt sozusagen fertig vor uns. Bei Matthäus und Lukas finden sich zwar legendarische Geburtsgeschichten, bei Letzterem auch eine Erzählung über den Zwölfjährigen. Diese Geburtsgeschichten sind unter historischen Gesichtspunkten völlig unvereinbar miteinander und auch je für sich voller historischer Unwahrscheinlichkeiten. Sie bringen historisch nichts und lassen sich nur in Krippenspielen harmonisieren. Sie haben eine andere als historische Funktion, die den Anfängen auch der beiden anderen Evangelien entspricht, nämlich von vornherein deutlich zu machen, dass mit der dann erzählten Geschichte Jesu Gott zu tun hat, dass Gott in ihr zu Wort und Wirkung kommt. Und auch das Ende dieser Darstellungen ist ganz anders als bei üblichen Lebensbeschreibungen. Die Evangelisten beenden die Erzählung nicht mit dem Tod ihres »Helden« und sagen auch nichts über Bedeutung und Nachwirken seines Lebenswerkes. Am Ende steht das Zeugnis von der Auferweckung Jesu durch Gott – ein analogieloses Ereignis. Von historischer Forschung kann es nicht erfasst werden. Es gehört einer anderen Ebene an als der Ebene historisch verifizierbarer Fakten. So begegnet Jesus in den Evangelien nicht als einmal Gewesener und inzwischen Verstorbener, sondern als bleibend lebendig Gegenwärtiger. Dieses Zeugnis von der Auferweckung Jesu ist der Konstruktionspunkt der Evangelien: Gottes endzeitlich-neuschöpferisches Handeln am hingerichteten Jesus. Und keineswegs ist es irgendeine als ganz außergewöhnlich oder gar einzigartig behauptete Besonderheit am Menschen Jesus. Dieser Konstruktionspunkt bestimmt ihre Darstellung durchgehend. Das ist die Perspektive, in der sie schreiben. Aspekte des tatsächlichen Geschehens werden in dieser Rückschau so dargeboten, dass den Lesenden und Hörenden das Mitsein Gottes auf dem Weg Jesu deutlich werden soll. Da die Evangelisten Gott aus ihrer jüdischen Bibel kennen, bringen sie Gottes Mitsein mit Jesus dadurch zum Ausdruck, dass sie dessen Geschichte auf der Basis ihrer Bibel und mit ihr erzählen.
Damit teilen sie die Besonderheit des ihnen überlieferten biblischen Redens von Gott. Sie besteht darin, Gott und eine bestimmte partikulare Geschichte zusammenzudenken. Diese Besonderheit zeigt sich sehr deutlich im Spiegel einer Wahrnehmung von außen, nämlich in der ersten uns erhaltenen literarischen Auseinandersetzung mit dem Christentum von griechisch-philosophischer Seite. Es handelt sich um die Schrift »Wahre Lehre« des Kelsos aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Es ist genau das eben erwähnte Zusammendenken von Gott und konkreter, dazu noch so partikularer Geschichte, an dem Kelsos vor allem Anstoß nimmt. Daher ist seine Abrechnung mit den Christen zugleich auch eine mit den Juden. Über diese sagt er: »Die Juden sind aus Ägypten entlaufene Sklaven gewesen, haben niemals etwas der Rede wert vollbracht, weder qualitativ noch quantitativ sind sie jemals etwas gewesen« (Origenes, Contra Celsum IV 31). Bei den Christen ist dieses Negative eher noch gesteigert, da sie sich auf diesen einen Juden beziehen, wenn sie etwa sagen: »›Glaube, dass der, den ich dir anempfehle, Gottes Sohn ist!‹ – auch wenn er aufs Ehrloseste gebunden oder aufs Schmählichste bestraft worden ist, auch wenn er sich gestern und vorgestern vor aller Augen aufs Schimpflichste herumgetrieben hat« (VI 10). An anderer Stelle spottet er: »Überall findet man dort ›das Holz des Lebens‹ und ›die Auferstehung des Fleisches vom Holz‹, weil, glaube ich, ihr Lehrer an ein Kreuz genagelt worden ist und von Beruf Zimmermann war. So wie, wenn jener zufällig von einem Abhang hinuntergeworfen oder in eine Kluft hinabgestoßen oder mit einem Strick erdrosselt worden oder ein Schuster oder Steinmetz oder Schmied gewesen wäre, es dann ein ›Abhang des Lebens über dem Himmel‹ wäre oder eine ›Kluft der Auferstehung‹ oder ein ›Seil der Unsterblichkeit‹ oder ein ›seliger Stein‹ oder ein ›Eisen der Liebe‹ oder ein ›heiliges Leder‹. Welche alte Frau, die einem Kind beim Einschlafen einen Mythos vorsingt, würde sich nicht schämen, ihm solches zuzuflüstern?« (VI 34). In der Position des Kelsos, geprägt von mittelplatonischer Philosophie, ist klar definiert, wer oder was Gott ist: das höchste Vollkommene. Von daher ist das wichtigste Gottesprädikat: unveränderlich. Gott kann sich per definitionem nicht ändern. Als das Vollkommene könnte er sich nur zum Schlechteren hin verändern und dann wäre er nicht mehr vollkommen. Ebenso selbstverständlich gilt, dass Gott apathés ist: leidenslos und auch nicht leidenschaftlich. Von dieser Position aus liest Kelsos in den Evangelien und in der jüdischen Bibel und kann das alles nur lächerlich finden, was da über Gott steht. Und so spottet er über Juden und Christen gleicherweise. In der Tat, Gott, wie er ihn bei Juden und Christen findet, ist alles andere als unveränderlich und leidens- und leidenschaftslos. Da hat er Recht. Der in der Bibel bezeugte Gott ist nicht apathés, »apathisch«. Nein, er ist im tiefsten Sinn des Wortes sympathisch: mitleidend. Ja, er lässt sich geradezu in Mitleidenschaft ziehen.
Zurück zu den Evangelien und noch einmal zusammengefasst: Die Evangelisten bieten keinen historisch-protokollarischen Bericht und wollen ihn auch nicht bieten. Selbstverständlich beziehen sie sich auf eine bestimmte Geschichte, die Geschichte des jüdischen Menschen Jesus aus Nazaret, der tatsächlich in bestimmter Zeit an bestimmten Orten gelebt hat. Aber ihr Interesse ist, deutlich zu machen, dass in dieser Geschichte Gott zum Zuge kommt. Das kann ein historischer Bericht nicht leisten. Das leistet legendarisches Erzählen. Karl Barth hat einmal im Blick auf die Erzählungen am Ende der Evangelien vom leeren Grab und den Erscheinungen Jesu gesagt, selbstverständlich seien das Sagen. Aber es käme darauf an zu vernehmen, was denn diese Sagen zu sagen haben. Das gilt für die Evangelien im Ganzen.
Wer oder was wäre dann der »wirkliche« Jesus? Wir wissen von Jesus so gut wie ausschließlich nur aus den im neutestamentlichen Kanon überlieferten Evangelien. Deren Verfasser haben über Jesus nur deshalb geschrieben, weil sie glaubten, dass Gott den am Kreuz Hingerichteten von den Toten aufgeweckt hat, dass daher sein Leben nicht als ein gescheitertes betrachtet werden muss. Ohne diesen Glauben hätten sie nicht geschrieben und wüssten wir also überhaupt nichts von einem Jesus aus Nazaret. Noch einmal: Was ist dann der »wirkliche« Jesus? Wirklich einer, der erst mühsam aus ihren Texten und oft genug gegen sie herausdestilliert werden muss? Martin Kähler hat 1892 demgegenüber die These aufgestellt: »Der wirkliche Jesus ist der gepredigte Christus.« Ich würde nach dem bisher Gesagten formulieren: Der wirkliche Jesus ist der in den Evangelien als wirkend und leidend dargestellte und durch diese Darstellungen zur Wirkung kommende Jesus. Aber dazu wäre noch mehr zu sagen. Darauf will ich noch einmal am Schluss eingehen.
2. Der Ansatz historischer Jesusforschung steht im Gegensatz zum Grundsatz der Evangelien.
Gegenüber den Evangelien als ihren einzig relevanten Quellen hat historische Jesusforschung ein völlig anderes Interesse, nämlich historisch verwertbares Datenmaterial zu gewinnen. Sie muss dieses Datenmaterial Quellen abringen, die zwar die Geschichte eines bestimmten Menschen im Blick haben, aber sie auf einer anderen Ebene als der Ebene bloßer historischer Fakten bieten. Sie stellen die Geschichte Jesu in die Dimension Gottes und erzählen daher legendarisch. Historische Jesusforschung muss den Konstruktionspunkt der Evangelien, das Zeugnis von der Auferweckung Jesu, ausschalten und hinter den vorliegenden Texten nach dem tatsächlichen Geschehen suchen. Vor dieses Grundproblem sieht sie sich seit ihrem Beginn mit Hermann Samuel Reimarus im 18. Jahrhundert gestellt. Dieser sah in großer Klarheit, dass die Darstellung der Evangelien ganz und gar auf der Behauptung der Auferstehung gründet. Diese Behauptung hielt er für einen Betrug – eine Erfindung der Apostel, nachdem sie Jesu Leichnam hätten verschwinden lassen. Was sie von dieser Erfindung her der Darstellung der Geschichte Jesu hinzugefügt hätten, nannte er »die Tünche der Apostel«. Er war so optimistisch, diese »Tünche« wegnehmen zu können und so zu dem vorzudringen, was Jesus tatsächlich gesagt und getan hat.
Das ist in meinen Augen das Elend aller historischen Jesusforschung: Sie muss sich ihre Ausgangsbasis hinter ihren Quellen erst selbst konstruieren. Der Konstruktionspunkt der Evangelien, das Zeugnis von der Auferweckung Jesu, kann für sie nicht akzeptabel sein, da das damit Bezeichnete analogielos und also historisch nicht verifizierbar ist. So muss sie das jeweilige Gesamtbild der Evangelien und dessen Zusammenhang zerschlagen. Dadurch erhält sie kontextlose Trümmerstücke. Mit kontextlosen Trümmerstücken kann man aber historisch nichts anfangen. Also muss man für sie neue Kontexte imaginieren und zu einem selbstgemachten neuen Gesamtbild gestalten. Daran hat aller Wechsel der Methoden nichts geändert und kann er auch nichts ändern. Seit Rudolf Bultmann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und dann besonders während der »neuen Frage nach dem historischen Jesus« seit Ernst Käsemann zu Beginn der zweiten Hälfte meinte man, mit dem »doppelten Differenzkriterium« sicheren Boden unter die Füße bekommen zu haben. Danach gilt solche Tradition als »authentisch«, die »weder aus dem Judentum abgeleitet noch der Urchristenheit zugeschrieben werden kann« (Käsemann). Aus dem zuerst genannten Kriterium ergibt sich zwangsläufig ein unjüdischer Jesus. Dieses Kriterium hat man inzwischen fallen gelassen. Es wurde im Lehrbuch »Der historische Jesus« von Gerd Theißen und Annette Merz (1. Auflage 1996) durch das doppelte Plausibilitätskriterium ersetzt: »Historisch ist in den Quellen das, was sich als Auswirkung Jesu begreifen läßt und gleichzeitig nur in einem jüdischen Kontext entstanden sein kann.« In den Evangelien ist jedoch alles »als Auswirkung Jesu« dargestellt. Man müsste also schon vorgängig etwas über Jesus wissen, damit dieses Kriterium funktionieren kann. Aber dieses Wissen soll ja allererst mit Hilfe dieses Kriteriums erschlossen werden. Was den anderen Aspekt betrifft, dass historisch sei, was nur im jüdischen Kontext entstanden sein kann, so greift auch das nicht. Denn sowohl die von den Evangelisten aufgenommenen Traditionen als auch die Evangelien im Ganzen sind »in einem jüdischen Kontext entstanden«. Sie sind von Haus aus – das wird die Besprechung ihrer Jesusbilder zeigen – jüdische Schriften. Innerhalb dieses jüdischen Kontextes kann man zwischen der Zeit vor und nach 70 mit dem für das Judentum katastrophalen Ende des Krieges gegen Rom unterscheiden. Doch lässt sich damit nur negativ feststellen, dass in der Zeit nach 70 entstandene Aussagen nicht auf den »historischen« Jesus zurückgeführt werden können. Für Aussagen, die sich als davor entstanden wahrscheinlich machen lassen, ist damit noch nicht der positive Beweis erbracht, dass sie auch vom »historischen« Jesus stammen. Im Übrigen taugt für die Zuschreibung von Aussagen in die Zeit vor 70 das dabei häufig angewandte argumentum e silentio hier so wenig wie sonst, dass sich also über ein historisch fixierbares Geschehen in einem Text kein Wissen fände und daher dieser Text vor diesem Geschehen abgefasst sein müsse.
Man kann es daher verstehen, dass etwa Wolfgang Stegemann in seinem enzyklopädischen Buch über »Jesus und seine Zeit« (2010) auf Authentizitätsnachweise für einzelne Texte verzichtet und sich allgemein auf die Kategorie der Plausibilität verlegt. Er nimmt aus den Texten für den »historischen« Jesus das auf, was ihm unter dem Gesichtspunkt neuzeitlicher Vernunft als plausibel erscheint. Allerdings: Plausibel ist, was dem jeweils Argumentierenden als plausibel erscheint. Anderen erscheint anderes als plausibel, wie die äußerst divergenten Jesusrekonstruktionen zeigen, worauf noch einzugehen ist.
Zusammenfassend: Aufgrund des Gegensatzes zwischen dem eigenen Interesse und dem Interesse der Evangelien als den einzig relevanten Quellen gewinnt historische Jesusforschung aus ihnen nur zusammenhangloses, spärliches Datenmaterial und bedarf der eigenen Imagination, um ein Gesamtbild zu erhalten.
3. Was historisch als »sehr wahrscheinlich« gelten kann, ist sehr wenig.
David Friedrich Strauß hat in seinem »Leben Jesu« von 1835 unter der historischen Fragestellung den gesamten Textbestand der Evangelien einer kritischen Durchsicht unterzogen. Was ich im ersten Punkt als Eigenart der Evangelien herausgestellt habe, dass die Evangelisten aus der Perspektive ihres Glaubens an die Auferweckung Jesu dessen Geschichte betrachten und also auf einer anderen Ebene als der Ebene historischer Fakten darstellen, wird von Strauß mit dem Begriff »mythisch« gekennzeichnet. Er zitiert aus einem 1832 erschienenen Aufsatz von Usteri als »die richtige Einsicht«, »wie viel an den so entstandenen Mythen geschichtliche Grundlage auf der einen und poetische Symbolik auf der anderen Seite sei, lasse sich jetzt nicht mehr unterscheiden, durch kein noch so scharfes kritisches Messer lassen sich diese beiden Elemente jetzt noch voneinander sondern«. Diese Illusion haben allerdings die historischen Jesussucher. Als Ergebnis seiner Kritik, was sich als »historischer Grund und Boden« der Evangelien ergibt, benennt Strauß »das einfache historische Gerüste des Lebens Jesu, daß er zu Nazaret aufgewachsen sei, von Johannes sich habe taufen lassen, Jünger gesammelt habe, im jüdischen Lande lehrend umhergezogen sei, überall dem Pharisäismus sich entgegengestellt und zum Messiasreiche eingeladen habe, daß er aber am Ende dem Haß und Neid der pharisäischen Partei erlegen, und am Kreuze gestorben sei«. Von den acht Punkten dieses Gerüstes müssen noch zwei, die eng zusammengehören, gestrichen werden, nämlich die den Pharisäismus betreffenden. Hier ist Strauß dem negativen Bild der christlichen Tradition von den Pharisäern aufgesessen, das sich seinerseits von dem negativen Bild über die Pharisäer speiste, das vor allem das Matthäus- und Johannesevangelium bieten. Das wiederum resultiert aus den innerjüdischen Auseinandersetzungen, in denen sich diese Evangelisten und ihre Gemeinden als an Jesus glaubende jüdische Minderheit in der Zeit nach 70 vorfanden – im Gegenüber zu der sich unter pharisäischer Führung neu konstituierenden jüdischen Mehrheit. Diese Mehrheit ergriff gegenüber der Minderheit distanzierende Maßnahmen in sozialer, wirtschaftlicher und religiöser Hinsicht, was die Minderheit als bedrängend erfuhr. Diese Erfahrung bedingte das negative Pharisäerbild, das die Evangelisten in ihre Darstellung der Zeit Jesu zurückprojizieren. Also: Ohne diese beiden die Pharisäer betreffenden Punkte ist »das einfache historische Gerüste des Lebens Jesu« von David Friedrich Strauß im Wesentlichen alles, was eine im Sinne Martin Kählers bescheidene historische Kritik als »sehr« oder auch »höchst wahrscheinlich« herausbekommen kann. Was darüber hinausgehend vorgebracht wird, findet sich sofort im Streit der Meinungen wieder: Es kann so, es kann aber auch anders gewesen sein. Das zeigt sich selbst bei einem in der christlichen Tradition so zentral gewordenen Stück wie dem Vaterunser. In einer noch nicht lange zurückliegenden Kontroverse wurde es von dem einen Neutestamentler dem »historischen« Jesus abgesprochen und von dem anderen als authentisch verteidigt. Beide haben selbstverständlich Argumente. Aber es ist ein Streit um des Kaisers Bart. Was ist damit gewonnen, wenn der eine oder der andere Recht hätte? Was trägt das zum Verstehen dieses Gebetes bei? Es steht im Matthäusevangelium und in etwas kürzerer und variierter Fassung im Lukasevangelium. Das ist genug.
Dem unentwegten Streit der Meinungen, was Jesus zuzuschreiben ist und was nicht, entspricht es, dass es in allen Abschnitten der historischen Jesusforschung – wie immer man sie gliedert – ein Chaos unterschiedlichster Jesusbilder gab. Das ist für historische Forschung, die sich der Erkenntnis des tatsächlich Geschehenen nähern will, das ja immer nur ein bestimmtes Einziges gewesen sein kann, alles andere als eine Empfehlung. Käsemann hat gemeint, die »unverwechselbare Eigenart Jesu« herausstellen zu können, und jeder und jede andere, die oder der nach dem »historischen« Jesus sucht, intendiert das auch. Angesichts der Permanenz des Chaos von Darstellungen des »historischen« Jesus muss schlicht und klar festgestellt werden: Der »historische« Jesus ist ein Wechselbalg.
Die Unterschiedlichkeit der Rekonstruktionen gründet in der Unterschiedlichkeit der Rekonstrukteure, was sie jeweils aus den Quellen als vermeintlich sichere Ausgangsbasis ansehen, was ihnen jeweils als plausibel erscheint. So hat schon Martin Kähler 1892 festgestellt, es sei »zumeist der Herren [und inzwischen auch der Damen] eigner Geist, in dem Jesus sich spiegelt«. Wolfgang Stegemann meint, dieses Phänomen der Selbstspiegelung sei »inzwischen zu einem gleichsam trivialen Argument gegen die historische Jesusforschung geworden«. Ob es »trivial« ist, sei dahingestellt; ich finde es jedenfalls entlarvend. Stegemann versucht, damit offensiv umzugehen, indem er betont, »dass eine historische Jesusforschung wie alle Geschichtsdeutung und -schreibung eine Konstruktion im perspektivischen Interesse ihrer Autoren ist«. Im Blick auf Widersprüche zwischen den Evangelien auf der Ebene des Faktischen meint Stegemann, dass sich »jede aufmerksame Bibellektüre […] irgendwann die Frage stellen muss, was denn nun ›stimmt‹, d.h. welches Evangelium die historischen Ereignisse (am genauesten) abbildet«. Diese Frage ist gegenüber den Evangelien unangemessen, weil sie auf einer anderen Ebene darstellen und Widersprüche auf der historischen Ebene dort nichts zur Sache tun. Dagegen stellt sich diese Frage, »was denn nun ›stimmt‹«, zu Recht und verschärft gegenüber den widersprüchlichen Ergebnissen historischer Jesusforschung, der es ja dezidiert um die historische Ebene geht. Es gibt bei der historischen Jesussuche keinen Fortschritt. Im Nachhinein lässt sich immer wieder nur ihr Scheitern feststellen.
Knapp zusammengefasst: Bei der historischen Frage nach Jesus kommt über das von David Friedrich Strauß herausgestellte »einfache Gerüste« nicht gerade Hieb- und Stichfestes heraus.
4. Ist historische Jesusforschung theologisch notwendig?
Gibt es theologische Gründe für die Rückfrage nach dem »historischen« Jesus? Dafür wird angeführt, dass sich christlicher Glaube auf eine konkrete geschichtliche Gestalt zurückbezieht. Aber der Glaube bezieht sich auf diese geschichtliche Gestalt aufgrund des Zeugnisses, dass in ihr Gott zu Wort und Wirkung kommt. Das aber ist etwas, das sich nicht historisch verifizieren lässt. Wie sollte der Glaube dadurch wahrer oder gewisser werden, was sich historisch über diese Gestalt feststellen oder imaginieren lässt? Dass Jesus als Mensch unter Menschen gelebt und gewirkt hat, ist den Evangelien selbstverständlich und muss nicht erst durch historische Forschung dekretiert werden. Die den Evangelien öfters kritisch unterstellte oder auch beifällig behauptete Tendenz zur »Vergöttlichung« Jesu ergibt sich erst aus ihrer Lektüre von der späteren altkirchlichen Dogmatik her. In ihrem eigenen jüdischen Kontext gelesen, dienen die dafür beigebrachten Motive dazu, zum Ausdruck zu bringen, dass Gott durch Jesus wirkt. Die Evangelien erzählen vom Menschen Jesus – wenn man so will: vom irdischen Jesus. Wieso rechtfertigt das theologisch die Suche nach dem »historischen« Jesus, die zu einem Rekonstrukt führt? Doch nur dann, wenn man, was nicht nur bei Käsemann der Fall war, den irdischen Jesus unter der Hand mit dem »historischen« Jesus gleichsetzt. Der »historische Jesus« ist ein Rekonstrukt von Historikern oder – häufiger – von historisierenden Theologen. Der »irdische Jesus« ist die Person, von der die Evangelien als einem jüdischen Menschen aus Nazaret erzählen.
Im Blick auf »die dritte Suche nach dem historischen Jesus« seit dem Ende des 20. Jahrhunderts wird hervorgehoben, dass in ihr Jesus nicht mehr antijüdisch profiliert, sondern dass sein Judesein betont herausgestellt werde. Dazu kann man nur sagen: endlich! Und daraus können gute theologische Folgerungen gezogen werden, wie das z.B. bei Wolfgang Stegemann geschieht. Aber ist denn die Jüdischkeit Jesu ein Fündlein dieser »dritten Suche«? Sie ist in den Evangelien in aller Selbstverständlichkeit gegeben und muss nicht erst durch historische Kritik nachgewiesen werden.
Ich sehe nicht, was theologisch dazu nötigen könnte, historisch nach Jesus zurückzufragen. Ich sehe aber sehr wohl, dass diese Rückfrage zwangsläufig den sachlichen Ausgangspunkt der Evangelien und des ganzen Neuen Testaments, das Zeugnis von der Auferweckung Jesu durch Gott, hintergeht. Und das halte ich für eine theologische Unmöglichkeit. Ich sehe weiter, dass diejenigen, die diesen Ausgangspunkt hintergehen und dabei ein theologisches Interesse haben, vom Menschen Jesus, um ihn »glaubwürdig« zu machen, Außerordentliches und Besonderes, ja Einmaliges behaupten müssen. Da ist einmal zu fragen, ob so etwas überhaupt als historisches Unternehmen möglich ist, von einem Menschen Unvergleichliches auszusagen, da sich historisch nur verifizieren lässt, was Analogien hat. Und zum anderen würde so der Glaube abhängig von historischer Wissenschaft, die zudem in diesem Fall aufgrund der Quellenlage nur sehr Dürftiges mit großer Wahrscheinlichkeit sagen kann und darüber hinaus nur immer wieder wechselnde Hypothesengebilde bietet.
5. Was Exegetinnen und Exegeten des Neuen Testaments tun und was sie lassen sollten.
Nach dem Dargelegten halte ich es im Blick auf die vier kanonisch vorliegenden Evangelien ganz schlicht für mein Geschäft als theologischer Exeget, sie in ihrer Unterschiedenheit auszulegen. In der Disziplin Neues Testament hat historische Kritik hinsichtlich der Evangelien genug zu tun, wenn sie als ihren Gegenstand die vier kanonischen in ihrer vorliegenden Gestalt betrachtet, jedes für sich als jeweilige Einheit. Ich strebe also keineswegs eine »dogmatische Methode« an, sondern möchte vielmehr insofern »exakt historisch« arbeiten, als ich der Intention der Evangelisten zu folgen suche – und nicht von hypothetisch erschlossenen Quellen ausgehe.
Dass das die Aufgabe der Exegese sei, hatte Karl Barth schon 1928 in einem Brief an Paul Althaus vom 28. Mai innerhalb eines kritischen Blicks auf das Jesusbuch von Rudolf Bultmann formuliert. »Der Jesus, den er uns bietet, ist ganz schön, besonders weil er offenbar auch schon dialektischer Theologe gewesen ist, ich kann aber schlechterdings nicht einsehen, wie man, quo iure dazu kommt, sich gerade diesen Jesus aus dem N.T. heraus- und zurecht-zuschneiden. Ich hatte erwartet, die mir an sich sehr sympathische radikale Kritik Bultmanns werde dazu führen, dass man hinfort in der neutestamentlichen Wissenschaft von allen anderen Jesusbildern als den ganz konkreten der neutestamentlichen Schriften absehen und insbesondere die Evangelien in Zukunft, nachdem ihre Analyse zu nichts Erheblichem geführt, als solche und ohne sich für etwas Anderes als für sie selbst zu interessieren, exegesieren werde. Meine Enttäuschung bei Bultmanns Buch bestand darin, dass ich es darin, bei einem unkontrollierbarem Gemisch von üblicher historischer und neuer ›Sach‹-Kritik, prinzipiell in der alten Weise weitergehen sah: In der Weise, wonach das N.T. als Quelle statt als Zeugnis gelesen wird.«
Die profilierte Unterschiedenheit der Evangelien ist für die historische Rückfrage entweder Anlass, die Evangelisten der Ungenauigkeit und Fehlerhaftigkeit zu zeihen, was bei Reimarus zum Vorwurf des Betrugs gesteigert ist, oder Anlass zur Verlegenheit, die zu hilfloser apologetischer Harmonistik führt, wie sie sich zuletzt in den Jesusbänden von Ratzinger/Benedikt XVI. findet. Diese profilierte Unterschiedenheit lässt sich vielmehr als Gewinn wahrnehmen, wenn man herausarbeitet, wie die in österlicher Perspektive erfolgende Erinnerung an Jesus unter Einbeziehung jeweils inzwischen gemachter unterschiedlicher Erfahrungen in jeweils unterschiedlichen Situationen fruchtbar gemacht wird. Natürlich sind historische Aussagen über die Entstehungssituationen der Evangelien nie mehr als wahrscheinliche Annäherungen. Sie können jedoch hilfreich für die Auslegung sein. Vor allem helfen sie auch, die Unterschiedenheit zwischen der Entstehungssituation der Texte und der Situation der Auslegenden bewusst zu machen. Das ist auch deshalb wichtig, weil zwischen beiden ein starker Traditionsbruch liegt, insofern eine im jüdischen Kontext entstandene Tradition ab dem 2. Jahrhundert zunehmend in einem nichtjüdischen Kontext rezipiert und dabei gegen das Judentum gewandt wurde. Diese Unterschiedenheit und die antijüdische Wirkungsgeschichte der Texte sind in der Auslegung mit zu reflektieren.
Gegenüber der historischen Rückfrage nach Jesus hat die Auslegung der vorliegenden Texte einen doppelten Vorteil. Zum einen ist der Bezugstext, abgesehen von wenigen textkritischen Entscheidungen, für alle Beteiligten identisch und muss nicht erst jeweils selbst und anders hergestellt werden. Zum anderen gibt es keine »Opfer an Text«, die bei der Rückfrage unvermeidlich sind, da ja – um nochmals mit Reimarus zu sprechen – »die Tünche der Apostel« entfernt werden muss. Die Evangelien als ganze bieten als spannungsvolle Einheiten allemal mehr als die für den »historischen« Jesus jeweils reklamierten Bruchstücke.
Und schließlich, wenn man meint, den Hinweis auf das Chaos historischer Jesusdarstellungen mit dem Hinweis auf das Chaos von Auslegungen der kanonischen Texte kontern zu können: Wer diese Texte auslegt, kann deren nicht zu erschöpfendes Potenzial würdigen und die eigene Auslegung als eine – hoffentlich mögliche – verstehen, die neben vielen anderen möglichen Auslegungen steht. Der Streit ist dann zu führen zwischen möglichen und unmöglichen Auslegungen. Anders formuliert, es geht um Vielfalt ohne Beliebigkeit.
Noch einmal zurück zu der Frage: Wer ist der wirkliche Jesus? Ich hatte zu Anfang in Fortführung einer Aussage Martin Kählers gesagt: Der wirkliche Jesus ist der in den Evangelien als wirkend und leidend dargestellte und durch diese Darstellungen zur Wirkung kommende Jesus. Aber nun ist Jesus in der Geschichte der Kirche immer wieder auch auf höchst fragwürdige Weise zur Wirkung gekommen. Das weist auf die hohe Verantwortung der die Texte Auslegenden hin. Sie müssen den vorher genannten Traditionsbruch mitbedenken, dass im innerjüdischen Kontext entstandene Schriften ab dem 2. Jahrhundert von einer mehr und mehr nicht mehr jüdisch bestimmten Gemeinschaft gebraucht wurden, die ihre eigene Identität im Gegenüber und im Gegensatz zum Judentum bestimmte. Und so wurden polemische Partien in ursprünglich innerjüdischen Auseinandersetzungen zu scharfen judenfeindlichen Waffen, die Jesus zum Judenfeind machten. Dass er nicht mehr in dieser Weise zur Wirkung komme, dazu kann helfen, nicht nur die Jüdischkeit Jesu, sondern auch die der Evangelien wahrzunehmen. Als die ursprünglichen Zeugnisse über Jesus bleiben sie der Maßstab, an den wir im Fragen nach Jesus zurückgebunden sind. Wir haben Jesus nicht anders als im Wort, in den Wörtern der Evangelien. Wer Jesus wirklich ist, muss daher im Hören aufs Wort und die Wörter, auf das Wort in den Wörtern immer wieder neu entdeckt und erfahren werden. Es lässt sich nicht ein für alle Male festhalten. Die immer wieder neu zu stellende und zu beantwortende Frage ist nicht, wer Jesus wirklich war, sondern wie er jeweils durch verantwortungsvolle Auslegung – in all ihren Formen – zur Wirkung kommt und so wirklich wird. Das aber heißt dann auch, dass dieses Hören im Diskurs damit geschehen muss, was andere vor uns gehört haben und zeitgenössisch mit uns hören. Und so ist das selbst im Hören Entdeckte in den in dieser Weltzeit nicht endenden Diskurs einzubringen. Dass das seit Jesu Tod und dem Zeugnis von seiner Auferweckung nicht anders war, zeigt gerade auch unsere kanonische Grundlage in dieser Frage, dass es nämlich vier so unterschiedliche und nicht harmonisierbare Evangelien gibt. Die Nötigung zum Diskurs ist so von vornherein gegeben. Das ist nicht mit Bedauern zur Kenntnis zu nehmen, sondern als ein großer Gewinn anzusehen.
Ich bespreche die Evangelien in ihrer kanonischen Reihenfolge. Damit mache ich selbstverständlich keine Aussage darüber, in welcher Reihenfolge sie entstanden sind. Ich gestehe auch, dass ich das schlicht nicht weiß. Relativ sicher bin ich mir nur, dass sie alle vier in der Zeit nach dem jüdisch-römischen Krieg, aber keins von ihnen unmittelbar nach 70 und vor dem Ende des 1. Jahrhunderts verfasst worden sind. Über die mit dieser Zeit gegebenen gemeinsamen Entstehungsbedingungen wie auch darüber, dass diese vier Evangelien kanonisiert wurden, wird im Schlussteil dieses Buches zu reden sein. In der deutschen Forschung gilt seit etwa 150 Jahren weitgehend die sogenannte Zwei-Quellen-Hypothese als gesichert. Nach ihr hat Markus das älteste Evangelium geschrieben, das von Matthäus und Lukas unabhängig voneinander benutzt wurde. Darüber hinaus hätte beiden eine weitere Quelle zur Verfügung gestanden, die aus dem ihnen gemeinsamen Text, der über das Markusevangelium hinausgeht, rekonstruiert werden muss. Sie nennt man aufgrund ihres vorwiegenden Stoffes Spruchquelle oder Logienquelle. Von allen Theorien, die bisher über das literarische Verhältnis der ersten drei im Kanon stehenden Evangelien zueinander vorgelegt wurden, vermag diese Hypothese die meisten beobachtbaren Textphänomene zu erklären – aber eben nicht alle. Man braucht Zusatzhypothesen, die die Ausgangshypothese schwächen. Das lässt mich von ihr Abstand nehmen. Wer mit ihr arbeitet, sollte sich dessen bewusst sein, dass es nur eine Hypothese ist, und nicht so tun, als handle es sich um eine gesicherte Tatsache. Auch die Annahme, das Johannesevangelium sei als letztes geschrieben, und die oft damit verbundene weitere, dessen Verfasser habe die drei anderen Evangelien gekannt und benutzt, können nur als Hypothesen gebraucht werden. Die erste dieser Annahmen kann zutreffen, muss aber nicht; die zweite halte ich für unwahrscheinlich. Für die Auslegung der vier kanonischen Evangelien ist es jedoch auch keineswegs erforderlich, eine Theorie über ihr Verhältnis zueinander in Anschlag zu bringen. Ihre Texte liegen vor und können, um das besondere Profil eines jeden Evangeliums herauszustellen, gewinnbringend miteinander verglichen werden.
I.
Der Weltherrscher als Lehrer der Gerechtigkeit und als Richter
Jesus im Evangelium nach Matthäus
1. Der Rahmen: Anfang und Schluss des Evangeliums
Der Evangelist Matthäus stellt Jesus betont in die Geschichte seines jüdischen Volkes und bringt dabei doch zugleich eine Perspektive für die Völkerwelt ein. Dieser Doppelaspekt zeigt sich bereits im ersten Abschnitt des Evangeliums und wird in seinem letzten noch einmal aufgenommen. Er bildet einen Rahmen um das ganze Werk, der zu Beginn die Dimension vorgibt, in der die Geschichte Jesu verstanden werden kann und soll, und der am Schluss die durch den Tod scheinbar abgeschlossene Geschichte Jesu auf die Völkerwelt hin öffnet, die schon am Anfang in den Blick gekommen war. Deshalb seien zunächst der erste und letzte Abschnitt des Evangeliums betrachtet.
Die Geschichte Jesu in der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel
Das Matthäusevangelium beginnt mit einem prädikatlosen Satz, gleichsam einer Überschrift: »Buch der Geschichte Jesu, des Gesalbten, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams« (1,1). Die Wendung »Buch der Geschichte« nimmt den Beginn von 1. Mose 5,1 auf, der einzigen Stelle der jüdischen Bibel, an der sich diese Wendung findet: »Das ist das Buch der Geschichte des Menschen.« Das hier mit »Geschichte« übersetzte Wort hat im Griechischen neben anderen die Bedeutung »(Er-)Zeugung«, »Geburt«. Im hebräischen Text steht das entsprechende Wort im Plural: »Zeugungen«, »Geburten«. Geschichte ist hier verstanden als die Abfolge von Generationen, und so wird anschließend in 1. Mose 5 die Generationenfolge vom ersten Menschen, der nicht mit Namen benannt, von dem schlicht als »Mensch« geredet wird – adám ist im Hebräischen kein Name –, bis zu Noah aufgezählt. Entsprechend bietet auch Matthäus anschließend eine Generationenfolge im selben Stil. Mit dieser Einspielung von 1. Mose 5 lässt er also gleich mit den ersten Worten seines Evangeliums einen weltweiten Horizont aufscheinen. Allerdings will er keine Menschheitsgeschichte darstellen; an sie erinnert er hiermit nur. Es geht ihm um die Geschichte eines einzigen Menschen, den er nach rückwärts in die Geschichte seines Volkes hineinstellt.
Den benennt er anschließend mit dessen Namen: Jesus. Das ist die gräzisierte Form des hebräischen Namens jehoschúa (Josua). Das zugrunde liegende Verb, hier verbunden mit der Kurzform des Gottesnamens, hat die Bedeutungen »befreien«, »retten«, »helfen«. So ergibt sich für den Namen: »Der Ewige ist Befreiung/Rettung/Hilfe« (»Gotthilf«), ein im Judentum der Zeit häufig gegebener Name. Der Jesus, um den es hier gehen soll, wird dann dreifach näher gekennzeichnet, zunächst als »Gesalbter«.
Das an dieser Stelle stehende griechische Wort christós wird in den meisten Übersetzungen nicht übersetzt, sondern mit »Christus« wiedergegeben und so als Name verstanden. Die Stellen Johannes 1,41; 4,25 zeigen, dass das griechische christós Übersetzung des aramäischen meschichá (gräzisiert: messías; hebräisch: maschíach) ist: »Gesalbter«. Da es im griechischen Kulturbereich – anders als im Judentum – keine Gesalbtentradition gab, wurde dieser Begriff von Außenstehenden nicht als Titel, sondern – vor allem in der Zusammenstellung mit »Jesus« – als Name verstanden. Letzteres lag umso näher, da der Vokal eta schon damals wie im heutigen Griechisch mit i ausgesprochen wurde und so das Wort chrestós (»nützlich«), das auch als Name gebraucht wurde, christós lautete. Dass aber Mitglieder der auf Jesus bezogenen Gemeinschaft im 1. Jahrhundert, bei denen es sich um Jüdinnen und Juden handelte sowie um »Gottesverehrende«, also mit dem Judentum sympathisierende und deshalb sozusagen jüdisch gebildete Menschen, bei christós nicht an die Bedeutung dieses Wortes gedacht, sondern es als Namen missverstanden hätten, ist hochgradig unwahrscheinlich. Und diejenigen Hinzukommenden, die nicht vorher schon im Kontext von Synagogen gestanden hatten, mussten viel Jüdisches kennenlernen, vor allem die jüdische Bibel, um überhaupt etwas zu verstehen – nicht zuletzt, was es denn bedeutet, dass Jesus »der Gesalbte«, der Messias, ist.
Gesalbt wurden in Israel nach der biblisch-jüdischen Tradition Könige, Propheten und Priester. Dass Jesus hier als königlicher Gesalbter im Blick ist, wird sofort daran deutlich, dass Matthäus ihn anschließend als »Sohn Davids« bezeichnet. David gilt als der ideale König. Auf einen König wie ihn geht die Hoffnung, einen König, der seinem Volk aufhilft, es aus der Hand seiner feindlichen Bedränger befreit, Recht und Gerechtigkeit im Land herstellt und für die eintritt, denen es schlecht geht.
Schließlich nennt Matthäus Jesus am Schluss des ersten Satzes »Sohn Abrahams«. Und mit Abraham setzt dann auch die anschließende Generationenfolge ein. Über viele Glieder, unter denen David als »der König« hervorgehoben wird (1,6), führt sie auf Jesus als »den Gesalbten« (1,16). Abraham, David und »der Gesalbte« stehen danach gleich wieder zusammen in dem die Generationenfolge abschließenden Satz (1,17). Mit Abraham beginnt in der Bibel die besondere Bundesgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel (1. Mose 12,1), nachdem vorher in den Kapiteln 1–11 von der Schöpfung an die gesamte Menschheit im Blick war. Jetzt richtet sich das Augenmerk auf eine einzige Person und ihre Nachkommenschaft in bestimmter Linie. Hier liegt also ein entscheidender Punkt in der biblischen Darstellung vor, eine Nahtstelle: Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde; er ist Gott aller Menschen. Aber von nun an macht er sich kenntlich als »der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs« (2. Mose 3,6). Die hier genannten Namen stehen für die Bundesgeschichte Gottes mit seinem Volk. »Israel« ist der Ehrenname, der jedoch erst Jakob gegeben wird (1. Mose 32,29), der nach der biblischen Konstruktion ein Enkel Abrahams ist. Erst alle Nachkommen Jakobs sind »Israeliten«, nicht aber alle Nachkommen Abrahams. Abraham ist nicht nur der Vater Isaaks, sondern war zuvor schon Vater Ismaels (1. Mose 16) und ist danach Vater der Söhne der Ketura und der Kinder von Nebenfrauen (1. Mose 25,1–6). So wird Abraham auch »Vater vieler Völker« genannt (1. Mose 17,4–5). Die Völker kommen schon da in den Blick – und zwar in einer bezeichnenden Weise –, wo Gott erstmals zu Abraham spricht. Er verspricht ihm, ihn zu einem großen Volk zu machen, ihn zu segnen und seinen Namen großzumachen, und fordert ihn auf, selbst zum Segen zu werden. Im Blick auf diese Aufforderung verheißt Gott: »Ich will segnen, die dich segnen; die dich erniedrigen, verfluche ich. In dir sollen sich segnen lassen alle Völker der Erde« (1. Mose 12,2–3). Das Ergehen der Völker der Welt, ob sie von Gott gesegnet oder von ihm verflucht werden, wird an ihr Verhalten gegenüber Abraham gebunden, und Abraham steht hier, wie die weitere Erzählung der jüdischen Bibel zeigt, für Israel. Gott als Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs macht sein Verhalten gegenüber den Völkern von deren Verhalten gegenüber Israel abhängig. So kommen Universalität und Partikularität zusammen.
Schon mit dem ersten Satz, mit der Überschrift des Evangeliums, wird Jesus also betont in die Geschichte seines Volkes Israel hineingestellt und als aus dieser Geschichte hervorgehender königlicher Gesalbter herausgestellt. Aber zugleich wird angedeutet, dass er auch Bedeutung für die Völker der Welt gewinnen wird. Diese Doppelheit begegnet gleich wieder im anschließenden Stammbaum. Er ist vor allem charakterisiert durch seinen im Wesentlichen gleich bleibenden Fluss der Aufzählung im Schema: A erzeugte B und B erzeugte C und C erzeugte usw. Das unmittelbare Vorbild findet sich in Rut 4,18–22, einem Stammbaum von Perez bis David, den Matthäus im Ganzen übernimmt. Er beginnt mit den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob und führt die Generationenfolge durch bis auf Jesus. Er verortet mit dieser Konstruktion Jesus in bestimmter Linie in der Geschichte des Volkes Israel, die in ihrer Partikularität ausgezeichnet ist durch die konkret erwählende Gnade Gottes. Die Namen dieser Linie entnimmt er seiner Bibel, außer der genannten Stelle im Buch Rut vor allem dem 2. und 3. Kapitel des 1. Chronikbuches. Keine diesbezüglichen Informationen bietet die Bibel für die Zeit nach Serubbabel. Woher Matthäus die darauffolgenden neun Namen bis zum Großvater Jesu hat, lässt sich nicht erschließen. Es geht dabei nicht um bloße Namen. Die angeführten Namen stehen für eine Kurzfassung der Geschichte Israels. Mit den Namen werden auch die Geschichten in Erinnerung gerufen, die mit ihnen in der Bibel verbunden sind. An was Matthäus bei den Namen dachte, die er nicht mehr der Bibel entnehmen konnte, und welche Vorstellungen diese Namen bei den sein Evangelium Lesenden und Hörenden hervorgerufen haben mögen, wissen wir nicht. Mit dem Bezug auf die Bibel ist jedenfalls immer auch gegeben, dass es sich bei dieser Geschichte mit ihren vielfältigen Geschichten um eine Geschichte des Mitseins Gottes handelt. Und dieses Mitsein Gottes gilt dann auch für den, auf den die hier dargestellte Linie hinführt.
Der Fluss der Aufzählung ist an zwei Stellen unterbrochen, wodurch Matthäus Zäsuren kenntlich macht. An der ersten Stelle tut er es dadurch, dass er David ausdrücklich als »den König« bezeichnet (1,6), obwohl es sich bei den folgenden vierzehn Personen ebenfalls um Könige handelt. An der zweiten Stelle nennt er zweimal die babylonische Verbannung (1,11–12). Sie stellte die Fortexistenz nicht nur der davidischen Linie, sondern des ganzen Volkes in Frage, eine Zeit größter Gefährdung, die sich dann aber auch als eine Zeit der Bewahrung erwies. Das dürfte es veranlasst haben, dass nicht nur formuliert wird: »Joschija erzeugte den Jojachin während der Verbannung nach Babylon«, sondern dass zu dem einen mit Namen Genannten hinzugefügt wird: »und seine Brüder«. Das ist umso auffälliger, als nach 1. Chronik 3,15–16 Jojachin nur einen Bruder hatte. Den in der dortigen Generationenfolge unmittelbar vorher mit drei Brüdern genannten Jojakim lässt Matthäus aus. Wahrscheinlich fasst er ihn bewusst mit »Jojachin und seinen Brüdern« zusammen. Er betont damit die geschichtliche Kontinuität des ganzen Volkes und nicht nur eine in dieser Geschichte und von ihr isolierbare einzelne genealogische Linie. Mit Jojachin setzt dann der Fluss der Aufzählung wieder neu ein: »Nach der Verbannung nach Babylon erzeugte Jojachin […].«
»Brüder« hatte Matthäus schon früher angeführt: »Jakob erzeugte den Juda und seine Brüder« (1,2). Mit der Wendung »Juda und seine Brüder« wird das Zwölfstämmevolk Israel als Ganzes in den Blick gerückt und so an die damit verbundenen Geschichten erinnert, Geschichten von Gefährdung, von Rettung und Bewahrung. Die Hervorhebung Judas ist gewiss darin begründet, dass von ihm die genealogische Linie auf David hinführt. Aber dass sie so konstruiert wurde, hängt mit den Geschichten über »Juda und seine Brüder« zusammen. In ihrem Verlauf ändert sich Juda. Er ist es, der den Vorschlag macht, Josef, den Liebling des Vaters Jakob, an die nach Ägypten ziehende Karawane zu verkaufen (1. Mose 37,23–27). Er ist es, der seiner Schwiegertochter Tamar den dritten Sohn für die Schwagerpflicht verweigert, nachdem zwei Söhne gestorben sind. Als sie mit List von Juda selbst schwanger geworden ist, erkennt er, dass sie im Verhältnis zu ihm gerecht gehandelt, er dagegen sich unsolidarisch verhalten hat (1. Mose 38). Und so ist er es dann, der sich beim Vater für den jüngsten Sohn Benjamin verbürgt (1. Mose 43,9) und dann auch bereit ist, sich an dessen Stelle versklaven zu lassen (1. Mose 44,18–34). Und so ist er es auch, dem im Segen des Vaters Jakob über seine Söhne verheißen wird, dass von ihm »das Zepter nicht weichen wird« (1. Mose 49,10). Das alles klingt bei der Wendung »Juda und seine Brüder« für mit der Bibel Vertraute an.
Auffällig sind sodann die in das Schema »A erzeugte B« durch »mit X« integrierten vier Frauen. Mit ihnen kommt als ein Aspekt schon im Stammbaum Jesu die Völkerwelt in den Blick. Denn von ihnen ist Rut Moabiterin (Rut 1,4), Rahab aus Jericho Kanaanäerin (Josua 2). Über die Volkszugehörigkeit Tamars sagt die Bibel nichts (1. Mose 38). In Teilen der jüdischen Tradition gilt sie als Nichtjüdin. So stammt sie nach Philon von Alexandria »aus dem palästinischen (= philisteischen) Syrien« (Über die Tugenden 221). Die als Mutter Salomos gemeinte Batseba wird nicht mit Namen genannt, sondern als »die Frau des Urija« bezeichnet. Urija aber wird gekennzeichnet als »der Hethiter« (2. Samuel 11,4.6.17). Mit den hier Genannten werden jedoch auch die mit ihnen verknüpften Geschichten eingespielt. Auf die Geschichte Tamars wurde schon zu Juda hingewiesen. Veranlasst durch Judas Weigerung, ihr als zweimal kinderlos Verwitweter den dritten Sohn zu geben, handelt sie nicht gerade im üblichen Rahmen, indem sie sich als Prostituierte ausgibt und von Juda schwängern lässt. Sie trägt damit zur Konsolidierung des Zwölfstämmevolkes Israel in der Phase seiner Konstituierung bei. Darin dürfte es begründet sein, dass als mit ihr Erzeugtem nicht nur Perez genannt wird, über den die genealogische Linie auf David läuft, sondern auch sein Zwillingsbruder Serach. Rahab aus Jericho verhilft Israel dazu, ins Land zu kommen. Die Moabiterin Rut verhält sich auch nach dem Tod ihres Mannes solidarisch zu ihrer israelitischen Schwiegermutter und bekennt sich zu deren Gott und Volk: »Wo du hingehst, will ich hingehen, und wo du bleibst, will ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott« (Rut 1,16). »Urija, der Hethiter«, ein Soldat Davids, kämpft für Israel. Wenn Menschen aus der Völkerwelt, die durch die auf Jesus bezogene Verkündigung zum Vertrauen auf Israels Gott als den einen Gott gekommen sind, sich in diesen nichtjüdischen Personen im Stammbaum Jesu wiederfinden, werden sie damit auf die besondere Geschichte Israels hingewiesen und in ein Verhältnis der Solidarität zu Gottes Volk Israel gestellt. Es gibt hier keine Bewegung von Israel weg hin zu den Völkern, von der Partikularität zur Universalität unter Aufhebung des Partikularen. Vielmehr wird die universale Völkerwelt in die partikulare Geschichte Israels eingezeichnet. Das aber hält das Recht jedes Partikularen fest und bewahrt es vor der Aufhebung ins Allgemeine und Uniforme. Dementsprechend heißt es in der rabbinischen Tradition innerhalb einer Reihe von Antworten auf die Frage, warum Gott am Anfang nur einen Menschen geschaffen habe, in einer von ihnen: »um die Größe des Königs der Könige der Könige, des Heiligen, gesegnet er, anzuzeigen. Wenn nämlich ein Mensch hundert Münzen mit demselben Stempel prägt, sind sie alle einander gleich. Aber der König der Könige der Könige, der Heilige, gesegnet er, prägte jeden Menschen mit dem Stempel des ersten Menschen und doch gleicht kein einziger von ihnen seinem Mitmenschen. Daher ist jeder und jede Einzelne verpflichtet zu sagen: ›Um meinetwillen wurde die Welt erschaffen‹« (Mischna Sanhedrin 4,5).
Ein Stammbaum Jesu findet sich auch in dem an dritter Stelle im Kanon stehenden Evangelium, der von Jesus ausgehend bis auf »Adam« – den Menschen – zurückgeführt wird und über diesen auf Gott als dessen Schöpfer (Lukas 3,23–38). Versucht man, diese beiden Stammbäume historisch auszuwerten, so lässt sich nichts gewinnen – außer dem sich auch sonst aus den Evangelien ergebenden Tatbestand, dass Jesu Eltern Josef und Mirjam hießen. Die beiden Stammbäume widersprechen sich in großen Teilen und lassen sich nicht miteinander ausgleichen. Schon in dem Teil von Abraham bis David, der an den Angaben im 1. Mosebuch und in Rut 4,18–22 orientiert ist, findet sich eine Abweichung. Gravierender ist, dass Matthäus von David bis Jojachin der Reihe der Könige – zunächst der Könige Gesamtisraels, nach der Teilung der Könige Judas – folgt, dabei aber einige auslässt, während Lukas eine völlig andere Linie von David ausgehen lässt. Von den Namen, die Matthäus nach dem babylonischen Exil anführt, finden sich nur die ersten beiden (Schealtiel und Serubbabel) und die letzten beiden (Josef und Jesus) bei Lukas. Zudem bietet dieser zwischen David und Jesus 41 Namen, Matthäus nur 26. Dabei ist deutlich, dass die Anzahl der Generationen bei Matthäus zu gering ist, um die Zeit vom babylonischen Exil bis Jesus überbrücken zu können. In historischer Hinsicht müssen diese Stammbäume daher als Fiktionen beurteilt werden. Es handelt sich um theologische Konstruktionen, die Jesus von vornherein in die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel hineinstellen. Darin jedoch, dass Jesus in der Tat in diese Geschichte hineingehört, haben sie allerdings auch historisch Recht.
Matthäus ändert das Schema bei seinem letzten Glied, indem er nicht formuliert: Josef erzeugte Jesus mit Mirjam.
In der christlichen Tradition ist es geläufig geworden, die hier gemeinte Frau »Maria« zu nennen. Das ist die gräzisierte Form des hebräischen Namens »Mirjam«, auf Aramäisch »Marjam« ausgesprochen. In den neutestamentlichen Handschriften finden sich sowohl »Marjam« als auch das gräzisierte »Maria«. Da »Maria«, die Mutter Jesu, in der christlichen Tradition sozusagen völlig christianisiert worden ist und bei diesem Namen kaum jemand an eine junge jüdische Frau denkt, gebe ich ihn mit »Mirjam« wieder.
Während alle anderen innerhalb der Kette als Erzeugte und Erzeugende zweimal genannt werden, wird an Josef als von Jakob Erzeugten angeschlossen: »den Mann Mirjams, mit der Jesus erzeugt wurde« (1,16). Die meisten Übersetzungen geben den Relativsatz so wieder: »von der Jesus geboren wurde«, was möglich ist. Das hier gebrauchte griechische Verb – wie auch das entsprechende hebräische – kann auf beide Geschlechter bezogen werden, wäre also im Deutschen im Blick auf Männer mit »zeugen« und im Blick auf Frauen mit »gebären« zu übersetzen. Deshalb wird die auf Mirjam bezogene passive Form am Schluss des Stammbaums in deutschen Bibeln mit »geboren werden« wiedergegeben. Eine passive Form dieses Verbs begegnet auch im nächsten Abschnitt, wiederum auf Mirjam bezogen (1,20). Dort aber ist die Wiedergabe mit »geboren werden« nicht möglich. An beiden Stellen ist auch klar, dass nicht Josef als Zeugender gedacht ist, sonst hätte das Schema nicht geändert werden müssen. Als Versuch einer Übersetzung des Verbs in diesem Zusammenhang, die nicht geschlechtsspezifisch ist und so auch noch andere Möglichkeiten offenlässt, wird hier das Wort »erzeugen« gebraucht. In der passiven Formulierung gilt Gott als logisches Subjekt, selbstverständlich nicht in der Weise, dass er wie griechische Götter die Rolle des Mannes einnehmen würde. Mirjams Schwangerschaft wird vielmehr als Wunder von Gott her verstanden. So sagt ein Bote Gottes dem Josef im Traum über seine Frau Mirjam: »Was in ihr erzeugt worden ist, geschah kraft des heiligen Geistes« (1,20). Der Akzent liegt hier nicht auf der Jungfräulichkeit Mirjams, sondern auf Gott als dem eigentlichen Urheber, wobei in Anschlag zu bringen ist, dass im antiken Kontext anders als heute eine Jungfrauengeburt nicht außerhalb jeder Plausibilität liegt und dass im jüdischen Kontext Gott als Schöpfer bei jeder Zeugung und Geburt als mitbeteiligt gilt – als derjenige, der Leben gibt. Wörtlich übersetzt lautet die dem Josef gegebene Botschaft: »Das in ihr Erzeugte ist vom heiligen Geist.« Dabei ist der heilige Geist nicht an der Stelle des Mannes gedacht, was sich schon daran zeigt, dass »Geist« im Griechischen neutrisch ist, im Hebräischen feminin.
Dass Josef nicht der leibliche Vater Jesu ist, tritt im nächsten Abschnitt noch stärker hervor, wenn es von der mit ihm verlobten Mirjam heißt, sie sei schwanger gewesen, bevor sie zusammengekommen seien, worauf Josef sie aus der Ehe entlassen wollte, ohne das Aufsehen einer öffentlichen Bezichtigung des Ehebruchs zu erregen. Im Traum erhält er von einem himmlischen Boten Aufklärung, wie es sich mit der Schwangerschaft Mirjams verhalte. Er solle sich nicht scheuen, sie mit dem Kind als seine Frau anzunehmen (1,18–20). Er wird von diesem Boten ausdrücklich als »Sohn Davids« angeredet. Indem dieser Sohn Davids sich an dessen Aufforderung hält, macht er das Kind Mirjams auch zu seinem und damit auch Jesus zum »Sohn Davids«.
Einen Verstehenshintergrund für die dargestellte Besonderheit, wie Jesus zur Welt kommt, bilden biblische Geburtsgeschichten, in denen von einem schöpferischen Eingreifen Gottes geredet wird, was jeweils zur Geburt eines besonderen Menschen führt. Vor allem ist an die Geburtsgeschichte Simsons zu erinnern (Richter 13,2–24). Sie erzählt von der unfruchtbaren Frau eines Manoach, der ein Bote des Ewigen erscheint und ihr sagt: »Pass auf! Du bist unfruchtbar, hast nicht geboren. Aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Von jetzt an hüte dich, dass du weder Wein noch Bier trinkst, noch irgendetwas Unreines isst. Ja, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären: Ihm soll kein Schermesser aufs Haupt kommen. Denn von Mutterleib an wird der Junge ein Geweihter Gottes sein. Er wird damit anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu befreien« (Richter 13,3–5). Im Folgenden wird nicht gesagt, dass Manoach und seine Frau zusammengekommen seien. Der Text kann so verstanden werden, dass das selbstverständlich vorausgesetzt ist. In jedem Fall sind Zeugung und Geburt Simsons als Wunder von Gott her verstanden. Es sei noch einmal betont, dass in dem matthäischen Text der Geist nicht als Medium der Befruchtung in Analogie zum männlichen Samen gedacht ist. Der heilige Geist steht hier für Gottes schöpferische Macht, die Jesu Geburt als Wunder Gottes begreifen lässt. Die Aufnahme des Motivs der Jungfrauengeburt, das nicht Einmaligkeit, wohl aber Besonderheit und Größe betont, stellt Jesu Zeugung und Geburt in den Zusammenhang des besonderen Handelns Gottes, wie es sich in den Geschichten der Bibel über die Ankündigung der Geburt besonders hervorgehobener Menschen zeigt. Ein Bezug auf die Geburtsgeschichte Simsons ergibt sich auch von daher, wie der himmlische Bote den Namen Jesus deutet, den Josef dem Kind Mirjams geben soll: »Denn er wird sein Volk von ihren Sünden befreien« (1,21). Für Simson war angekündigt worden: »Er wird damit anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu befreien« (Richter 13,5). In die Hand der Philister aber hatte Gott die Israeliten gegeben, weil sie fortwährend taten, »was böse ist in den Augen des Ewigen« (Richter 13,1).
Indem schon der Umstand, wie Jesus zur Welt kommt, als Wunder von Gott her geschildert wird, will Matthäus von vornherein deutlich machen, dass im Leben Jesu, seinem Handeln und Erleiden, Gott zu Wort und Wirkung kommt. Diese Intention wird dadurch entschieden verstärkt, dass Matthäus in diesem Abschnitt zum ersten Mal ein ausdrückliches Zitat aus seiner Bibel bringt und betont mit einer Wendung einführt, die sich so oder ähnlich noch weitere zwölf Mal in seinem Evangelium findet. Sie lautet an dieser Stelle: »Das alles aber ist geschehen, sodass ausgeführt wurde, was vom Ewigen durch den Propheten gesagt worden ist« (1,22).
Alle gängigen deutschen Übersetzungen sprechen an dieser und den entsprechenden Stellen davon, dass das, was als Schriftwort angeführt wird, »erfüllt« worden oder »in Erfüllung gegangen« sei. So zu übersetzen ist jedoch problematisch. Einmal verbindet sich in diesem Zusammenhang mit dem Gebrauch von »erfüllen« das in der Christentumsgeschichte schon früh beliebt und dominant gewordene Schema von »Verheißung und Erfüllung«. Dieses Schema reduziert das Alte Testament auf eine Funktion für das Neue und lässt es in diesem aufgehoben sein. Demgegenüber ist zu fragen: Was von den großen messianischen Verheißungen der jüdischen Bibel ist denn tatsächlich »erfüllt« worden? In der auf Jesus bezogenen Gemeinschaft und danach in der aus ihr im 2. Jahrhundert hervorgegangenen christlichen Kirche sind in der Geschichte, die weiterlief, als wäre nichts geschehen, immer nur fragmentarische Erfahrungen des Erhofften gemacht worden. »Erfüllt« wurde, dass zwar nicht die Völker der Welt, aber doch immerhin zahlreiche Menschen aus der Völkerwelt zum Glauben an den in der Bibel bezeugten Gott Israels als den einen Gott gekommen sind. Damit finden sie sich nicht in einer Erfüllungsgeschichte vor, sondern zusammen mit Israel, mit dem Judentum, in einer Hoffnungsgeschichte.