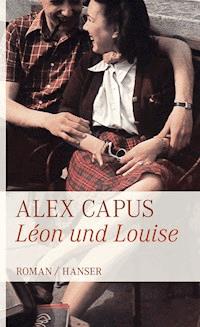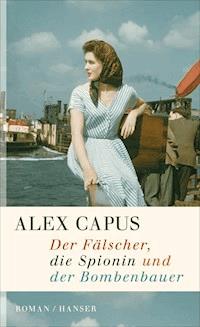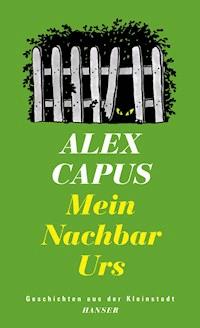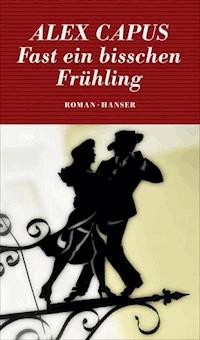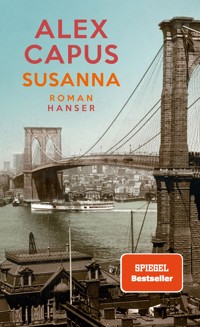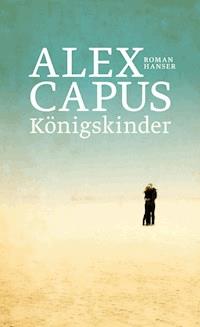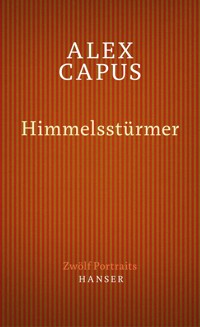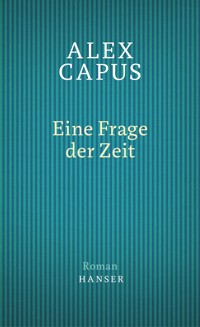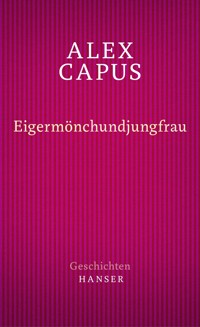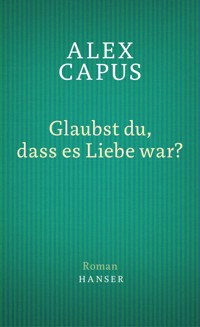Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ich war glücklich in dem kleinen Haus." – Ein Buch voll Charme und Leichtigkeit, eine Ode auf die Zufriedenheit, erzählt von Alex Capus
Eine kleine Philosophie der Gelassenheit und des stillen Glücks: Alex Capus erzählt eine persönliche Geschichte über die Liebe zur Literatur und ein Leben im Einklang mit sich selbst. – Es sind die neunziger Jahre in Italien. In den Kneipen wird geraucht, an den Tankstellen wird man bedient. Alex Capus bezieht ein einsam stehendes Steinhaus am Sonnenhang eines Weinbergs. Dort verbringt er viel Zeit mit seiner Freundin und Freunden, dort sucht er die Einsamkeit, um an seinem ersten Roman zu schreiben. Wie findet man Zufriedenheit im Leben? Warum stets eine neue Pizza ausprobieren, wenn doch die gewohnte Pizza Fiorentina völlig in Ordnung ist? Warum Jagd nach immer noch schöneren Stränden machen, wenn schon der erste Strand gut ist?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Eine kleine Philosophie der Gelassenheit und des stillen Glücks: Alex Capus erzählt eine persönliche Geschichte über die Liebe zur Literatur und ein Leben im Einklang mit sich selbst. — Es sind die neunziger Jahre in Italien. In den Kneipen wird geraucht, an den Tankstellen wird man bedient. Alex Capus bezieht ein einsam stehendes Steinhaus am Sonnenhang eines Weinbergs. Dort verbringt er viel Zeit mit seiner Freundin und Freunden, dort sucht er die Einsamkeit, um an seinem ersten Roman zu schreiben. Wie findet man Zufriedenheit im Leben? Warum stets eine neue Pizza ausprobieren, wenn doch die gewohnte Pizza Fiorentina völlig in Ordnung ist? Warum Jagd nach immer noch schöneren Stränden machen, wenn schon der erste Strand gut ist?
Alex Capus
Das kleine Haus am Sonnenhang
Hanser
1
Als ich noch ein ziemlich junger Mann war, nicht mehr Student und noch nicht Schriftsteller, habe ich für fast kein Geld im Piemont ein kleines Haus gekauft. Es war ein wirklich kleines Haus. Ganz allein stand es in einem Seitental eines Seitentals an einem terrassierten Sonnenhang, der wohl einst ein Rebberg gewesen war. Hinter dem Haus befand sich ein Schuppen fürs Brennholz, davor ein kleiner Ziegenstall und das Waschhaus. Auf den obersten Terrassen wucherten ein paar alte, knorrige Stöcke, die im Herbst schwarze, süße Trauben trugen.
Wenn meine damalige Freundin und ich mit unserem gelben Renault 4 aus der Schweiz anreisten, bogen wir in Sichtweite des Hauses von der Strada Provinciale ab und schlingerten auf einem Feldweg hinunter zu einem ausgetrockneten Bachbett, das wir mit Karacho durchqueren mussten, um es auf der anderen Seite den steilen Hang hinauf bis zum Haus zu schaffen.
Wir blieben den ganzen Sommer in dem kleinen Haus. Meine Freundin studierte Rechtswissenschaften in Bern, ich hatte meine Anstellung als politischer Journalist bei der Schweizerischen Depeschenagentur gekündigt, um meinen ersten Roman zu schreiben. Das Leben war billig. Ums Geldverdienen würden wir uns im Winter wieder kümmern. Und wir hatten noch keine Kinder. Oder noch nicht so viele.
Das Haus bestand im Wesentlichen aus vier meterdicken Bruchsteinmauern, von denen niemand wusste, wie alt sie waren, und einem Ziegeldach obendrauf. Der wichtigste Raum war die Wohnküche, dort gab es einen langen Eichentisch und einen offenen Kamin; nebenan zwei Kammern, in denen man schlafen konnte. Getragen wurde das Ganze von einem dunklen, feuchten Gewölbekeller, in dem hinten aus einer moosigen Felswand das ganze Jahr frisches, kühles Quellwasser sprudelte. Von der Quelle floss das Wasser in einer offenen Rinne über den Kellerboden zur Tür, dann unter der Schwelle hindurch ins Freie und hinüber zur Tränke des Ziegenstalls, um schließlich als dünn gewordenes Rinnsal durch ein Loch in der rückseitigen Stallmauer hinunter auf die nächste Terrasse zu tröpfeln, wo ein knorriger Feigenbaum im immerfeuchten Erdreich prächtig gedieh.
Ich stellte mir gerne vor, dass in grauer Vorzeit einer unserer Ahnen die Quelle entdeckt haben mochte, als er am damals noch bewaldeten Sonnenhang einem Hirsch nachstellte oder ein entlaufenes Schaf suchte, und dass er eine Lichtung in den Wald schlug und über der Quelle das Haus baute, um das kostbare Wasser für sich und die Seinen in Besitz zu nehmen.
Es stand an unverbaubarer Lage mit freier Sicht aufs Dorf, das sich jenseits des Bachbetts in etwa einem Kilometer Entfernung auf der Schattenseite des Tals befand, weil dort die Strada Provinciale durchführte. Dicht an dicht standen die Häuser beisammen, beschützten einander vor den Widrigkeiten der Zeitläufte und bildeten ein hübsches kubistisches Ensemble in Terrakotta, Schiefergrau und Glyziniengrün, das ich während der trägen Mittagsstunden, die wir oft im Schatten des Nussbaums in der Hängematte verbrachten, gern betrachtete.
Ich sah leuchtende Gemäuer und glitzernde Dächer, mattes Blattgrün und schlafende Hunde im Schatten moosiger Torbögen, gelegentlich einen vorüberfahrenden Wagen oder einen Traktor, aber kaum Menschen. Überall geschlossene Fensterläden, zugezogene Vorhänge, verriegelte Türen. Und wenn mal ein Fenster offen stand, war darin nur leere Schwärze zu sehen. Das Dorf lag da wie ausgestorben. Manchmal hing Wäsche zum Trocknen vor einem Fenster, wo zuvor keine gehangen hatte, oder ein Tor war geschlossen, das eben noch offen gestanden hatte. Aber nirgends war ein Mensch zu sehen. Die Leute hatten augenscheinlich jahrhundertelange Übung darin, sich unsichtbar zu machen.
2
Die letzte Kneipe im Dorf hatte vor vielen Jahren zugesperrt, die Bäckersfamilie war weggezogen und im Pfarrhaus wohnte niemand mehr; die Gemeindeverwaltung war nur am Freitagnachmittag besetzt. Das Postamt aber war noch täglich geöffnet. Seit der alte Posthalter gestorben war, führte es dessen Witwe. Sie hatte ein böses Knie und eine schwarze Katze, die ihr auf Schritt und Tritt folgte, wenn sie frühmorgens von Haus zu Haus humpelte und die Post verteilte.
Zu uns hinüber an den Sonnenhang schaffte die Posthalterin es nicht. Nur einmal ganz zu Beginn war sie den ganzen Weg zu uns gehumpelt und hatte, während die Katze uns um die Beine strich, um Verständnis dafür gebeten, dass sie wegen ihres Knies nicht in der Lage sein werde, uns die Post dienst- und pflichtgemäß ins Haus zu liefern.
Also ging ich alle paar Tage zu ihr und sah nach, ob Zeitungen oder Briefe für mich eingetroffen waren. Es waren die neunziger Jahre, elektronische Post gab es noch nicht. Man schrieb einander Briefe, und Zeitungen las man auf Papier. Auf meinem Weg durchs Dorf sah ich dann tatsächlich ein paar Menschen; es waren fast immer dieselben.
Auf einer Sitzbank aus Granit saß ein grauer Schnauzbärtiger mit einem Gewehr, der mich erstaunlicherweise schon beim ersten Mal mit Namen grüßte.
Bei der Bushaltestelle stand eine junge Frau mit Kinderwagen, die mich geflissentlich übersah.
In einem schmalen Gärtchen zwischen zwei Häusern jätete ein Mütterchen im geblümten Rock Unkraut. Sie führte ihre Harke mit kurzen, scharfen Bewegungen.
Oben an der Strada Provinciale hatte ein Automechaniker seine Werkstatt, der jedes Mal, wenn ich an ihm vorbeiging, unter einem Traktor oder einem Fiat 127 lag. Ich habe von ihm nie mehr als die Hosenbeine und die Stiefel gesehen.
Und dann die Posthalterin in ihrem Kabuff mit dem Bullerofen und dem Portrait Papst Paulus des Sechsten an der Wand, die mich, um mir auch ja genügend Ehre anzutun, immer mit allen möglichen Titeln versah. Buongiorno, Professore! Certo, Ingeniere! Un attimo, Direttore! ArrivederLa, Dottore!
Wenn ich dann mit meiner Post auf dem Rückweg war, spürte ich die Blicke der Leute in meinem Rücken, wie sie hinter ihren Fensterläden, Jalousien und Vorhängen standen und mich beobachteten, während ich das Bachbett durchquerte, den Sonnenhang hinaufstieg und ins Haus ging, um einen Kaffee zu brauen und das Tablett hinaus zum Nussbaum zu tragen, wo meine Freundin es sich in einem Liegestuhl bequem gemacht hatte.
Die Leute lasen in unserem Alltag wie in einem offenen Buch. Das machte uns nichts aus. Ihre Neugier hatte nichts Hinterhältiges oder Bösartiges, sie nahmen nur Anteil. Wenn sie sich hinter ihren Jalousien versteckten, taten sie das aus Feingefühl. Sie wollten vermeiden, dass wir uns beobachtet fühlten.
Gerade viel gab es ja nicht zu sehen. Ich werkelte am Haus oder schichtete auf einer Terrasse die Steine einer eingestürzten Trockenmauer wieder auf, während meine Freundin viele Stunden mit ihren juristischen Büchern verbrachte. Mittags machten wir Pause. Wir spielten Schach, schossen mit einem rostigen Luftgewehr auf Blechdosen oder gingen auf eine Stunde ins Haus.
Gegen Abend versank das Dorf in schattigem Blau, während unser Sonnenhang noch eine Stunde golden leuchtete. In der Nacht konnten die Dorfbewohner dann durchs offene Küchenfenster sehen, wie wir Spaghetti aßen, Barbera tranken und hernach noch viele Stunden am Küchentisch saßen — sie über ihren Fachbüchern, ich an meiner Schreibmaschine.
Mein Schreibgerät war noch kein Laptop, sondern eine lindgrüne Hermes Baby. Ohne Stromkabel oder Korrekturtaste, dafür mit Tipp-Ex. Damals musste ich noch wirklich scharf nachdenken, bevor ich einen Satz in die Maschine hämmerte. Heute klappe ich den Laptop auf und tippe drauflos, und dann lese ich durch, was ich so geschrieben habe. Gut ist das auf Anhieb nie. Also versuche ich es andersrum und nochmal und nochmal anders, streiche ein paar Adjektive und füge sie gleich wieder hinzu, unterteile lange Schachtelsätze in einfache Hauptsätze und mache alles wieder rückgängig, versuche eine neue Version mit mehr Tempo und weniger Melodie, verschärfe den Rhythmus und streiche das Gesäusel, verlangsame das Tempo wieder und achte mehr auf Melodie, lösche alles und kehre zu einer alten Fassung zurück, die doch eigentlich die gradlinigste und ungekünsteltste war und zudem eine Metapher enthielt, die mir gefiel, obwohl oder gerade weil sie ein wenig schräg war. Dann rufe ich mich zur Ordnung, lösche alles und versuche einfach möglichst schlicht und geradeaus zu sagen, was ich sagen will.
Und immer so weiter.
Es ist das Spiel, das ich am liebsten spiele auf der Welt. Ich betreibe es mit großer Ausdauer. Zufrieden bin ich erst, wenn alles richtig fließt und klingt und für mein Empfinden die klarste, einfachstmögliche Form gefunden hat. Wann es so weit ist, weiß ich nicht. Vielleicht schlicht dann, wenn mir der Kram zum Hals raushängt.
Mit der Hermes Baby von damals, das ist mir klar, hätte ich mir diese Arbeitsweise nicht leisten können. Ich konnte sie mir erst aneignen, nachdem ich irgendwann für achthundert Franken meinen ersten Computer gekauft hatte. Es war ein gebrauchter Macintosh SE20. Er hat mein Leben verändert. Steve Jobs und Bill Gates haben wirklich viel für mich getan, ich bin ihnen zu großem Dank verpflichtet. Ohne sie würde ich womöglich immer noch an meinem ersten Roman sitzen. Keine Ahnung, wie Thomas Mann ohne Microsoft die »Buddenbrooks« schreiben konnte.
Aber der Macintosh war ein sperriges, schweres Ding und für Reisen nicht geeignet. Im kleinen Haus am Sonnenhang schrieb ich weiter auf der Hermes Baby. Quer durch die Küche liefen zwei schwarze, alte Eichenbalken. Dort pinnte ich, um jederzeit die Übersicht zu haben, die Blätter mit den Versionen einzelner Szenen, Dialoge und Beschreibungen fest.
Irgendwann aber muss der Spaß mit dem Um- und Umschreiben ein Ende haben. Ich habe Verträge und Abgabetermine, ich muss Geld verdienen. Die Verlagsleute sind freundliche Menschen und würden mir einen Aufschub gewähren, aber das hätte keinen Sinn. Ein Aufschub wäre nur ein Aufschub, abgeben müsste ich sowieso. Also gebe ich lieber termingerecht ab.
Ich bin der Sohn einer Grundschullehrerin und habe es tief verinnerlicht, dass man seine Hausaufgaben rechtzeitig erledigen muss. Stolz bin ich nicht darauf. Es hat schon etwas Zwanghaftes, wie verlässlich ich Termine einhalte. Am liebsten gebe ich schon eine Woche vor der Deadline ab, dann fühle ich mich gut. Oder zwei Wochen vorher, da geht es dem Streber, der ich bin, noch besser. Mein Über-Ich ist in dieser Beziehung sehr stark, ich komme nicht dagegen an. Meist ziehe ich schon vor der eigentlichen Deadline meine persönliche Deadline und versehe diese nochmal mit zwei Wochen Sicherheitsabstand, und diese vielleicht nochmal. So würde sich der Abgabetermin, wenn ich mein Über-Ich nicht im Zaum hielte — wofür ich eine Art Über-Über-Ich entwickelt habe —, immer weiter aus der Zukunft in Richtung Gegenwart verschieben, bis er im Hier und Heute angelangt wäre und mir überhaupt keine Zeit zum Schreiben mehr bliebe.
3
Den ganzen Sommer über kamen Freunde zu Besuch. Dann musste das Romanschreiben Pause machen, ich packte meine Hermes Baby weg und entfernte die Manuskriptseiten von den Eichenbalken. Es war ein stetes Kommen und Gehen, immer standen Autos und Motorräder auf dem Vorplatz. Wenn im kleinen Haus kein Bett mehr frei war, richteten sich die Neuankömmlinge im Holzschuppen oder im Ziegenstall ein, oder sie stellten oberhalb des Hauses, wo es unter all den abschüssigen Terrassen eine einzige halbwegs waagrechte Wiese gab, ihre Zelte auf.
Es war eine schöne Zeit. Tagsüber sangen die Zikaden, nachts leuchteten am ganzen Sonnenhang die Glühwürmchen. Wir veranstalteten Schaukelstuhlrennen auf den Terrassen mit riskanten Schanzensprüngen über die Trockenmauern, Schießwettbewerbe mit dem rostigen Luftgewehr und abendliche Gesangsfeste mit italienischem Liedgut; manchmal erforschten wir wandernd die umliegenden Hügel oder unternahmen Ausflüge ans Meer. Vom zweiten Jahr an pflanzten wir im Mai Kartoffeln an, die wir Stadtkinder, die wir waren, im September staunend ernteten.
Natürlich gab es auch Liebesdramen mit überstürzter nächtlicher Abreise, frühmorgendlicher Rückkehr und heißer Versöhnung, und das eine oder andere Kind, das unsere Generation seither großgezogen hat, wird wohl auch im kleinen Haus gezeugt worden sein. Einmal hatten wir Hornissen im Dachstock, und einmal brach sich Thomas den rechten großen Zeh, als er barfuß mit einer Wassermelone jonglierte.
Anfang September fuhren alle nach Hause, weil an der Uni das Semester wieder anfing. Meine Freundin fuhr ebenfalls, den gelben Renault 4 nahm sie mit. Ich blieb allein zurück, weil ich an meinem Roman arbeiten wollte. Am Tag des Abschieds gab es Gelächter und Umarmungen. Autotüren fielen ins Schloss, Motoren wurden gestartet. Ich stand auf dem Vorplatz und winkte, bis alle hinter der Biegung jenseits des Bachbetts verschwunden waren. Dann ging ich ins Haus, pinnte die Manuskriptseiten wieder an die Balken und stellte die Hermes Baby auf den Küchentisch, wo sie für die nächsten Monate bleiben würde.
An manchen Tagen wollte mir nichts einfallen, was niederzuschreiben die Mühe wert gewesen wäre. Dann legte ich den Deckel auf die Schreibmaschine und ging zu meiner Baustelle. Ich hatte immer eine Baustelle. Mal legte ich hinter dem Haus den verschütteten Graben frei, damit die feuchte Rückmauer wieder austrocknen konnte. Ein anderes Mal deckte ich das Schieferdach des Ziegenstalls ab, wechselte morsche Sparren und Dachlatten aus und deckte das Dach wieder ein. Oder ich betonierte am Hinterausgang eine neue Türschwelle. Wenn der Herbst kam, erntete ich Baumnüsse und Feigen und aß sie sofort alle auf, und später pflückte ich die schwarzen Trauben auf den obersten Terrassen. Ansonsten ernährte ich mich im Wesentlichen von Spaghetti al aglio, olio e peperoncino. Das schmeckte mir und verleidete mir nie, und es kostete nicht viel und war rasch zubereitet. Meist aß ich mittags einen großen Teller davon und abends die Reste. Und wenn am nächsten Morgen immer noch etwas übrig war, wärmte ich es mir zum Frühstück auf. Weshalb sollten mir Spaghetti bei Sonnenaufgang nicht schmecken, wenn sie bei Sonnenuntergang so lecker gewesen waren?
Jeden zweiten oder dritten Abend spazierte ich ins Dorf und rief am Telefonautomaten, der neben dem Eingang zum Postamt an der Mauer hing, meine Freundin an. Es waren die neunziger Jahre, wie gesagt, das tragbare Telefon war eben erst auf den Markt gelangt. Und selbst wenn ich damals schon eines besessen hätte — ich besitze bis heute keines —, wäre ich im Seitental des Seitentals ganz sicher weitab vom nächsten Sendemast gewesen. Um beim Postamt telefonieren zu können, musste ich ausreichend münzenförmige Telefonmarken gekauft haben, die ich dann während des Ferngesprächs in rascher Folge einwarf. Diese gab es aber nicht im Postamt, sondern nur bei konzessionierten Tabakhändlern. Und weil es im Dorf längst keinen mehr gab, musste ich sie vorgängig in der Stadt besorgt haben.
An den Tagen, an denen ich auf meiner Baustelle zugange war, rührte ich die Schreibmaschine nicht an. In all den Jahren meines Schriftstellerlebens sind die Tage stets überwältigend in der Überzahl gewesen, an denen mir nichts zu schreiben einfiel. Das hat mich nie beunruhigt. Wenn mir nichts einfällt, stehe ich auf und mache etwas anderes; am liebsten etwas, bei dem ein Bohrhammer, eine Stichsäge oder eine Schaufel im Spiel ist. Die Angst vor dem weißen Blatt kenne ich nicht, und an die Schreibblockade glaube ich nicht. Wenn ich nicht vorankomme, steckt keine Metaphysik dahinter. Ich habe dann einfach noch nicht genug nachgedacht und gebrütet. Dagegen hilft nur brüten und nachdenken. Und das kann dauern. Manchmal Wochen, manchmal Monate. Beschleunigen lässt es sich kaum. Am besten brüte ich, wenn ich auf einer Baustelle werkle.
Ich blieb jeweils bis in den Oktober und den November in dem kleinen Haus, manchmal auch über Weihnachten und Neujahr. Die Leute in der Gegend sagen zwar: »Ach, der Herbst ist doch die schönste Jahreszeit! Dann gibt es keine Stechmücken mehr, und die Schweizer sind alle nach Hause gefahren.« Aber an mich gewöhnten sie sich. Ich war einfach der Alex, der halt noch da war. Immerhin hatte ich rasch einigermaßen Italienisch gelernt. Zudem konnte man vom Dorf aus sehen, was ich so trieb den ganzen Tag.
Es gab ein paar Männer, die gelegentlich am Sonnenhang vorbeischauten; da war der Maurer Urbanin, der mit seinem Traktor Sand und Kies für den Zementmischer aus dem Bachbett holte, oder der Trüffelsucher Dante, der auf dem Weg in den Wald mit seinem Hund die Abkürzung über meine Terrassen nahm. Meist hoben sie nur kurz die Hand zum Gruß. Manchmal aber stieg einer den steilen Feldweg zu meinem Haus hinauf. Dann tranken wir ein Glas im Stehen und sprachen über die Qualität des heurigen Weins, die Intelligenz von Trüffelhunden oder über den Erdrutsch, der die Straße nach Cairo verschüttet hatte.
Mit dem Roman kam ich in jenen Monaten, weil ich kaum Ablenkung hatte, flott voran. Das heißt, ich schrieb immer neue Versionen derselben Geschichte, die ich, kaum dass sie fertig waren, für ungenügend befand und beiseitelegte, um mit einer neuen Fassung anzufangen. Aber ich war guter Dinge. Ich fühlte, dass jede Fassung ein bisschen weniger unbrauchbar war als die vorangegangene. Zudem hatte ich mir vorgenommen, nicht zu ermüden und nicht vor der Zeit zufrieden zu sein. Jedenfalls ging es vorwärts. Und die Richtung stimmte.
Die Einsamkeit tat mir gut. Seit die Freunde nicht mehr da waren, trank und rauchte ich weniger, und ich ging früher schlafen. Ich nahm ab, rasierte mich alle drei Tage und achtete auf ordentliche Kleidung. Und ich hielt die Küche sauber. Gerade als Einsiedler, finde ich, muss man die Zivilisation aufrechterhalten.
4
Einmal die Woche hatte ich das Bedürfnis, unter Leute zu gehen. Weil der Renault 4 nicht mehr da war, holte ich das verrostete Fahrrad aus dem Ziegenstall, das ich im ersten Sommer in einem Brombeergestrüpp gefunden und notdürftig hergerichtet hatte. Ich rollte damit den Hang hinunter, schob es durchs Bachbett und pedalte auf der anderen Seite den Feldweg hinauf zur Strada Provinciale. Dann bog ich aber nicht nach links ins Dorf ab, sondern fuhr rechts geradeaus den Fluss entlang, bis ich nach etwa drei Kilometern ins nahe gelegene Städtchen kam. Dort gab es Kneipen, Büros und allerlei Läden. Und ein paar hundert sichtbare Frauen, Männer und Kinder.
Im Sommer dauerte die Fahrt eine knappe Viertelstunde. Nach den ersten großen Herbstregen aber bestand die Schwierigkeit, dass das Bachbett nicht mehr trocken war, sondern ziemlich viel Wasser führte. Und wenn im Dezember Schnee und Eis hinzukamen, konnte keine Rede mehr davon sein, den Bach zu durchqueren, außer vielleicht mit einem Traktor. Aber ich hatte keinen Traktor.
Es waren die letzten Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts, damals hat es noch geschneit. Spätestens im Advent war das kleine Haus von der Umwelt abgeschnitten. Vermutlich war das einer der Gründe, weshalb ich es für fast kein Geld hatte kaufen können. Die Ruhe war dann noch größer, der Friede noch tiefer. Auf den Terrassen staksten Rehe durch den Schnee. Manchmal kam eine Wildschweinfamilie aus dem Wald, um im Bach zu saufen.
An sonnigen Tagen schmolz der Schnee auf den Terrassen. Unten im Bach aber blieb er liegen, und die dicken Bruchsteinmauern des kleinen Hauses blieben, wenn sie einmal ausgekühlt waren, bis zum nächsten Frühjahr kalt.