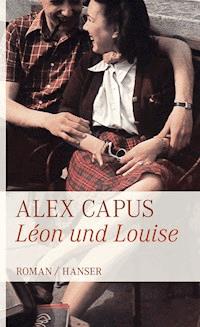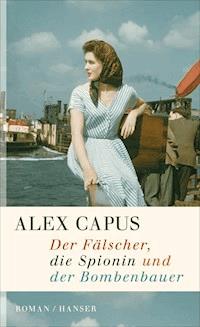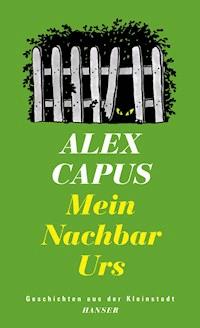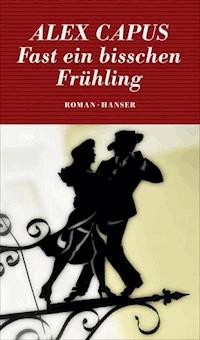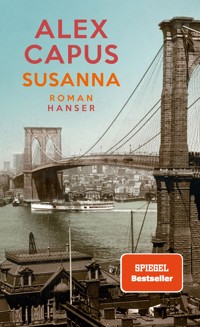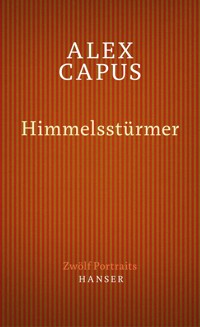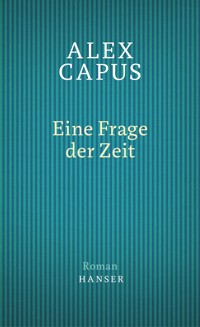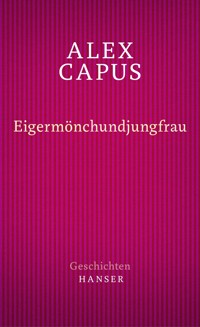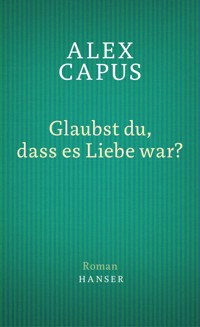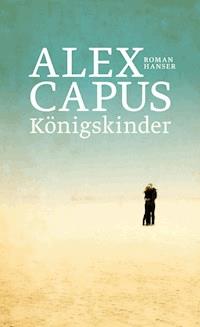
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Max und Tina in ihrem Auto eingeschneit auf einem Alpenpass ausharren müssen, erzählt Max eine Geschichte, die genau dort in den Bergen, zur Zeit der französischen Revolution, ihren Anfang nimmt.
Jakob ist ein Knecht aus dem Greyerzerland. Als er sich in Marie, die Tochter eines reichen Bauern, verliebt, ist dieser entsetzt. Er schickt den Jungen erst in den Kriegsdienst, später als Hirte an den Hof Ludwigs XVI. Dort ist man so gerührt von Jakobs Unglück, dass man auch Marie nach Versailles holen lässt. Meisterhaft verwebt Alex Capus das Abenteuer des armen Kuhhirten und der reichen Bauerntochter mit Max` und Tinas Nacht in den Bergen. Ein hinreißendes Spiel zwischen den Jahrhunderten. Alex Capus` schönste Liebesgeschichte seit "Leon und Louise".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Als Max und Tina in ihrem Auto eingeschneit auf einem Alpenpass ausharren müssen, erzählt Max eine Geschichte, die genau dort in den Bergen, zur Zeit der französischen Revolution, ihren Anfang nimmt.Jakob ist ein Knecht aus dem Greyerzerland. Als er sich in Marie, die Tochter eines reichen Bauern, verliebt, ist dieser entsetzt. Er schickt den Jungen erst in den Kriegsdienst, später als Hirte an den Hof Ludwigs XVI. Dort ist man so gerührt von Jakobs Unglück, dass man auch Marie nach Versailles holen lässt. Meisterhaft verwebt Alex Capus das Abenteuer des armen Kuhhirten und der reichen Bauerntochter mit Max’ und Tinas Nacht in den Bergen. Ein hinreißendes Spiel zwischen den Jahrhunderten. Alex Capus’ schönste Liebesgeschichte seit »Leon und Louise«.
Alex Capus
Königskinder
Roman
Carl Hanser Verlag
Mühsam kämpfte sich im nächtlichen Schneetreiben ein roter Toyota Corolla auf der Passstraße um die Haarnadelkurven. Die Scheinwerfer suchten zwischen den roten Leitpfosten den Weg, die Räder knirschten im Schnee und hinterließen eine einsame Spur, die rasch wieder unter neuem Schnee verschwand. Längst hatte der Wagen die letzte menschliche Siedlung, das letzte erleuchtete Fenster hinter sich gelassen. Jetzt waren da nur noch abschüssige, tief verschneite Alpweiden mit mächtigen Felsblöcken, die jederzeit weiter talwärts zu rollen drohten, und da und dort in einer unzugänglichen Kluft ein knorriges, winterlich erstarrtes Fichtenwäldchen, das seit langer Zeit keines Menschen Fuß mehr betreten hatte.
Gut möglich, dass wegen des Motorenlärms in einem dieser Wäldchen ein einsamer alter Steinbock erwachte, der sich unter den Ästen einer Fichte für die Nacht zur Ruhe gelegt hatte. Dann kann man sich vorstellen, wie er sein mächtig gehörntes Haupt hob und auf den Toyota hinunterschaute, und dass er durch die Windschutzscheibe die fahl erleuchteten Gesichter einer Frau und eines Mannes sah, die geradeaus ins Schneetreiben starrten. Noch hat die Wissenschaft nicht herausgefunden, ob Steinböcke sich über das Tun der Menschen irgendwelche Gedanken machen; aber wenn sie es tun, dachte dieser Steinbock in diesem Augenblick zweifellos dies: dass die Frau und der Mann bei diesem Wetter und um diese Uhrzeit keinesfalls auf der Passstraße unterwegs sein sollten. Und schon gar nicht bergauf.
»Jetzt ist es fürs Umkehren endgültig zu spät«, sagte die Frau.
»Vor zehn Minuten wär’s vielleicht noch gegangen«, sagte der Mann.
»Das haben wir vor zehn Minuten auch schon gesagt.«
»Und vor zwanzig Minuten auch.«
»Aber jetzt ist es wirklich zu spät.«
»Ich wüsste nicht, wie wir hier wenden sollten.«
»Und rückwärts wieder hinunter geht auch nicht.«
»Dann fahren wir eben weiter. Allzu weit kann es nicht mehr sein bis zur Passhöhe. Drei oder vier Kehren noch, würde ich sagen.«
»Ich bin wirklich froh um die Scheibenwischer«, sagte sie. »Bist du auch froh um die Scheibenwischer?«
»Ja.«
»Wie?«
»Ja.«
»Was sagst du?«
»Ist gut jetzt.«
»Bist du nicht froh um die Scheibenwischer? Bei dem Schneesturm?«
»Hör zu, ich finde Scheibenwischer super«, sagte er. »Reicht dir das? Können wir es jetzt bitte gut sein lassen?«
Tina und Max waren ein Paar, das sich in den großen Dingen des Lebens immer einig war. Über die kleinen Dinge zankten sie sich unablässig, aber in den großen Dingen verstanden sie sich blind.
Vor einer halben Stunde noch, als sie in der Abenddämmerung auf schwarzem Asphalt durch die spätsommerlichen Wiesen des Berner Oberlands gefahren waren, hatten sie heftig über die Frage gestritten, zu welchem Zeitpunkt die Scheibenwischer eines Automobils vernünftigerweise in Betrieb genommen werden sollten. Kurz zuvor waren aus dem grauen Herbsthimmel die ersten Schneeflocken gefallen, worauf Tina die Scheibenwischer eingeschaltet und Max seufzend den Kopf in den Nacken gelegt hatte.
»Was ist?«
»Nichts.«
»Sag schon.«
»Nichts.«
»Was?«
»Die Scheibenwischer.«
»Was ist mit denen?«
»Du hast sie wegen drei Schneeflocken eingeschaltet.«
»Und?«
»Jetzt ist die Scheibe verschmiert, die Sicht ist schlechter als vorher.«
»Und?«
»Gib zu, dass die Sicht jetzt schlechter ist.«
»Wenn’s anfängt zu schneien, schalte ich die Scheibenwischer ein. Wenn’s nicht mehr schneit, schalte ich sie wieder aus.«
»Aber doch nicht wegen drei Flocken!«
»Ich sehe nicht ein, was daran falsch sein soll«, sagte sie. »Scheibenwischer schaltet man bei einsetzendem Niederschlag ein, zu diesem Zweck haben die Jungs von der Toyota-Fabrik die Dinger eingebaut. Ich gehe stark davon aus, dass dies als Empfehlung so auch im Handbuch steht.«
»Lass mich mit dem Handbuch in Frieden.«
»Es liegt im Handschuhfach. Schlag nach. Unter S wie Scheibenwischer.«
»Ich rede nicht von Dienstvorschriften, sondern von Erfahrungswerten. Von gesundem Menschenverstand.«
»Klar.«
»Nach meiner Erfahrung schaltet man Scheibenwischer mit Vorteil erst dann ein, wenn die Windschutzscheibe ordentlich eingenässt ist. So schmiert der Kautschuk nicht übers Glas, sondern gleitet schön sauber darüber und hinterlässt eine kristallklare Scheibe.«
»Okay, der war gut. Du machst Spaß, oder?«
»Wieso?«
»Sag mir, dass das nicht dein Ernst ist. Lüg mich an und sag, dass du Spaß machst.«
»Keineswegs. Im Übrigen finde ich das ziemlich spießig.«
»Was?«
»Dieses ständige Wischen bei geringfügigstem Anlass.«
»Du findest Scheibenwischen spießig?«
»Dieses dauernde Putzen. Diese zwanghafte Saubermacherei die ganze Zeit.«
»Ich verstehe. Da liegt der Hund begraben. Dir ist daran gelegen, kein Spießer zu sein.«
»Ich rede von Scheibenwischern.«
»Du findest Scheibenwischer spießig?«
»Eigentlich schon. Offen gestanden.«
»Grundsätzlich?«
»Genauso wie Schonbezüge auf Sitzmöbeln. Und Gummimatten in Duschkabinen. Oder Reisekostenversicherungen. Und Laubbläser und Dampfdruckreiniger. Und Fahrradhelme.«
»Fahrradhelme auch?«
»Extrem spießig. Außer auf Radrennbahnen. Oder bei Vierundzwanzigstundenrennen und auf den Köpfen von Kleinkindern unter vier Jahren. Ich bin froh, dass du keinen Fahrradhelm trägst. Fahrradhelme sind ein Scheidungsgrund.«
»Gummimatten und Schonbezüge auch?«
»Streng genommen schon. Man hat als Ehegatte natürlich die Pflicht, gegenüber der Gefährtin auch mal fünf gerade sein zu lassen, aber die Langmut muss doch ihre Grenzen haben. Selbstgestrickte Schutzhüllen für Smartphones beispielsweise führen zu weit, ebenso Welcome-Fußabstreifer vor Hauseingängen. Wobei die Spießigkeit dieser Gegenstände nicht in ihrer Natur selbst liegt, sondern in der Handhabung durch den Anwender beziehungsweise die Anwenderin.«
»Willst du damit sagen, dass du mich spießig findest? Weil ich die Scheibenwischer zu früh einschalte?«
»Ich sage nur, dass eine verfrühte Inbetriebnahme nicht zielführend ist.«
»Ich fasse es nicht.«
»Was?«
»Dass du es deinem Rebellentum schuldig zu sein glaubst, den Einsatz von Scheibenwischern zu verweigern.«
»Ich verweigere überhaupt nichts, und meinem Rebellentum schulde ich gar nichts. Sonst wäre es übrigens keines.«
»Aber eine längere Diskussion ist dir diese Lappalie immerhin wert.«
»Damit hast du angefangen.«
»Nein, du.«
»Nein, du.«
»Meinetwegen. Das Leben besteht nun mal, wenn man es in seine atomaren Einzelteile zerlegt, aus lauter Lappalien. Es sind die Zusammenhänge zwischen den Lappalien, welche die ganze Sache erst interessant machen.«
»Und deswegen müssen wir über Scheibenwischer diskutieren?«
»Findest du das blöd?«
»Eigentlich schon. Offen gestanden. Und kindisch.«
Über solche Sachen stritten Tina und Max die ganze Zeit. Sie stritten über Vollkorn-Pasta und Überwachungskameras, über Geschirrspüler und die korrekte Anwendung des Genitivs im Schweizer Dialekt; aber in den großen Dingen des Lebens — den Dingen, auf die es wirklich ankam — waren sie sich schon immer einig gewesen.
Das hatte seinen Anfang an einem heißen Sommernachmittag vor sechsundzwanzig Jahren genommen, als sie einander in der Basler Innenstadt in einer Eisdiele über den Weg gelaufen waren. Er hatte ihr den Vortritt gelassen, worauf sie mit ihrem Himbeer-Pistazien-Eis draußen gewartet hatte, bis er mit seinem Haselnuss-Vanille-Eis herauskam, und dann waren sie zusammen am Rhein spazieren gegangen, als wären sie schon lange verabredet gewesen; als wären sie bereits das Liebespaar, das sie wohl von der Sekunde an gewesen waren, da sich ihre Blicke in der Eisdiele gekreuzt hatten. Auf jenem Spaziergang hatten sie sich zum ersten Mal gestritten, und zwar über Birkenstock-Sandalen, feministischen Sprachgebrauch und die ethische Verantwortbarkeit von Vergnügungsreisen in Militärdiktaturen, und beim Abschied hatten sie sich für den nächsten Tag zum Mittagessen verabredet. Dann hatten sie eine gemeinsame Wohnung bezogen und ohne erkennbare Planung in unregelmäßigen Abständen einvernehmlich eine ganze Anzahl Kinder gezeugt, und nun, da sie ihren Jüngsten in einer Hotelfachschule im Berner Oberland abgeliefert, den Nachmittag mit einem Spaziergang um den Schwarzsee verbracht und abends in einer Dorfkneipe Speck mit Sauerkraut, Dörrbohnen und Kartoffeln gegessen hatten, waren sie auf dem Gästeparkplatz nach kurzer Beratung übereingekommen, für den Heimweg hinunter ins Flachland nicht die öde Schnellstraße über Thun und Bern, sondern die abwechslungsreiche Abkürzung über den Jaunpass hinunter ins Greyerzerland zu nehmen; dies, obwohl die Wetterprognosen intensiven Schneefall vorausgesagt hatten und die Passstraße für die Nacht gesperrt war.
Die Wiesen im Simmental waren wie gesagt noch sommerlich grün gewesen und die Straße hatte schwarz und schnurgerade ins Tal hinaufgeführt. Aber als sie in Boltigen auf die Passstraße einbogen, die in weiten Schlaufen tausend Meter in die Höhe stieg, hatte es zu schneien angefangen. Nach den ersten Haarnadelkurven waren die Wiesen weiß geworden und unter den Reifen hatte der Matsch zu schmatzen begonnen, und dann war die Straße unter einer Schneeschicht verschwunden, die von Minute zu Minute dicker wurde.
»Wir hätten die Absperrung nicht umfahren dürfen«, sagte Max. »So etwas Saublödes machen nur Touristen.«
Tina nickte. »Nur die arrogantesten Blödiane unter den Touristen.«
»Und jetzt fahren wir auch noch weiter. Wie die letzten Idioten. Geradewegs ins Verderben.«
»Andrerseits kann man im Leben auch nicht immer alle Vorschriften einhalten«, sagte Tina. »Wer ein bisschen Spaß haben will, muss schon mal eine Absperrung umfahren.«
»Aber blöd ist es schon. Die Leute vom Straßenverkehrsamt sperren ihre Straßen nicht nur zum Spaß.«
Tina schaute angestrengt übers Lenkrad auf die Straße. »Ich glaube, wir sind gleich oben.«
Tatsächlich quälte sich der Corolla noch über zwei oder drei Serpentinen, dann auf einer Hochebene an ein paar Holzhäusern vorbei, die sich im Schneetreiben schwarz abzeichneten, und dann leuchtete im Scheinwerferlicht ein blaues Schild am Straßenrand, auf dem stand: Jaun-Pass, 1508 M. ü. M. Danach neigte sich die Straße spürbar wieder abwärts.
Das Problem war nur, dass auf der Westseite des Passes das Schneetreiben noch dichter war und der Schnee doppelt so hoch lag, weil der Wind die Schneewolken vom Atlantischen Ozean herantrieb und diese sich an der Westflanke des Alpenbogens stauten.
»Man muss auch den positiven Aspekt der Sache sehen«, sagte Max. »Wir sind vermutlich die letzte Generation in der Geschichte der Menschheit, die noch die Freiheit hat, Dummheiten wie diese zu begehen. Unsere Kinder werden in selbstfahrenden Autos mit Bordsystemen unterwegs sein, die automatisch eine Vollbremsung einleiten und selbsttätig um hundertachtzig Grad wenden, wenn jemand so blöd ist, im Winter bei Schneesturm eine gesperrte Passstraße befahren zu wollen.«
Langsam glitt der Toyota talwärts. An eine Umkehr zum Pass hinauf, gegen die Gravitation und durch den immer höher liegenden Schnee, war nicht mehr zu denken. Hin und wieder brach das Heck des Wagens seitlich aus, dann gab Tina Gas und Gegensteuer, um ihn aufzufangen.
»Ein bisschen gefährlich ist das schon, was wir hier machen«, sagte sie.
»Verdammt gefährlich«, sagte er.
»Wir könnten bald tot sein.«
»Nur gut, dass unsere Kinder schon einigermaßen groß sind.«
Wie zur Bestätigung rutschte der Wagen in der nächsten Kurve sachte, beinahe zärtlich von der Fahrbahn und blieb mit blockierten Rädern und abgewürgtem Motor bergseitig im Straßengraben stehen. Die Scheibenwischer flappten weiter hin und her.
»Das war’s«, sagte Tina. Ohne Hoffnung drückte sie die Kupplung durch und drehte den Zündschlüssel, gab Gas und ließ die Kupplung langsam los — die Räder drehten ohne Widerstand im Schnee. Tina schaltete den Motor wieder aus. In der Fahrerkabine wurde es still. Nur noch das Hauchen der Bordheizung und das Flappen der Scheibenwischer war zu hören.
»Tja«, sagte Max.
Spätestens von nun an war jeder Widerstand zwecklos, darüber waren Tina und Max sich einig. Um freizukommen, hätten sie die Vorderräder ausgraben und mit einer rutschfesten Unterlage versehen müssen, und selbst wenn das gelungen wäre — mit welchem Schaufelwerkzeug auch immer —, und selbst wenn sie es mit Schieben und Stoßen auf die Straße zurückgeschafft hätten, hätte sie nach wenigen Dutzend Metern die nächste Haarnadelkurve erwartet, und dann wieder eine und wieder eine. Und manche dieser Kurven, so stand zu befürchten, würden nicht entlang von Straßengräben, sondern vorbei an Abhängen und Schluchten führen.
»Mein Handy hat kein Netz«, sagte Tina.
»Meines auch nicht. Immerhin funktionieren die Scheibenwischer noch.«
»Sehr lustig«, sagte Tina. Sie schaltete die Scheibenwischer, die Scheinwerfer und die Bordheizung aus. In Sekundenschnelle bildete sich weißer Flaum auf der Scheibe.
»Ich verstehe gar nicht, wieso du die Scheibenwischer ausschaltest«, sagte Max. »Es hat doch gar nicht aufgehört zu schneien.«
»Ist gut jetzt.«
»Wir könnten immerhin versuchen, die nächste naheliegende Touristendummheit nicht zu begehen. Wir könnten es unterlassen, aus dem Wagen auszusteigen und den Abstieg ins Tal zu Fuß zu wagen.«
»Gute Idee. Dann sind wir in einer Stunde nicht tot.«
»Aber die Häuser bei der Passhöhe sind näher, dorthin könnten wir es schaffen. Es gibt dort eine Kneipe.«
»Hast du Licht gesehen?«
»Ich glaube nicht.«
»Dann ist es sinnlose Kraftverschwendung. Oder willst du auch noch einbrechen? Sachbeschädigung und Mundraub begehen?«
»Das wäre strafbar.«
»Mundraub nicht.«
»Doch.«
»Ich sage, wir bleiben hier sitzen und warten, bis die Schneefräse kommt.«
»Das kann die ganze Nacht dauern. Das wird die ganze Nacht dauern. Bis morgen früh.«
»Falls sie überhaupt kommt.«
»Die kommt schon. Der Pass hat keine Wintersperre.«
»Wie spät ist es jetzt?«
»Zwanzig Uhr sechsundvierzig.«
Fest und unverrückbar wie eine kleine Alphütte stand der Corolla am Straßenrand. Solange Tina und Max sitzen blieben und die Türen geschlossen hielten, drohte ihnen keine Gefahr. Selbst wenn es noch stundenlang weiterschneite und der Wagen vollständig zugedeckt würde, hätten sie in ihm ein warmes, windgeschütztes kleines Iglu. Das Thermometer am Armaturenbrett zeigte eine Außentemperatur von minus einem Grad Celsius an, im Innern waren es zwölf Grad; das war unangenehm, aber nicht lebensgefährlich. Sehr viel kälter würde es in dieser Nacht nicht werden, scharfer Frost war bei Westwind nicht zu erwarten. Im Kofferraum lag eine Picknickdecke, mit der Max und Tina sich zudecken konnten, und sie waren zu zweit und konnten einander warm geben. Proviant hatten sie zwar keinen dabei außer einer angebrochenen Packung Pefferminzbonbons, aber ihre Mägen waren gut gefüllt mit Speck und Kartoffeln; viel hätten sie an jenem Abend sowieso nicht mehr gegessen.
»Das wird eine lange Nacht«, sagte Max. »Ich schlage vor, wir schlafen ein bisschen.«
»Wenn du willst, dass ich unter diesen Umständen schlafe, musst du mich schon k. o. schlagen.«
»Das kann ich machen. Aber ich fürchte, du könntest dabei Schaden nehmen.«
»Die französische Polizei hat ihre Häftlinge früher gern mit Telefonbüchern verprügelt. Das hinterließ keine sichtbaren Spuren.«
»Ich glaube nicht, dass wir ein Telefonbuch dabeihaben.«
»Wenn wir eins dabeihätten, müsstest du mich damit nicht unbedingt k. o. schlagen. Du könntest mir daraus vorlesen, bis ich eingeschlafen wäre.«
»Ich würde auf Seite eins anfangen und dir quer durchs Alphabet alles vorlesen. Sämtliche Namen, Adressen und Telefonnummern.«
»Bis ich eingeschlafen wäre.«
»Und danach würde ich dir weiter vorlesen, damit du mir nicht plötzlich wieder aufwachtest. Die ganze Nacht würde ich vorlesen im Singsang eines Muezzins, und du würdest alle halbe Stunde ein wenig aus dem Tiefschlaf hochdämmern, mir eine Weile zuhören und dich wundern, wie viele Namen und Menschen es doch gibt auf der Welt. Und dann würdest du wieder hinübergleiten in die andere Welt.«
»Das wäre schön. Man sollte immer ein Telefonbuch an Bord haben.«
»Das steht bestimmt auch so im Toyota-Handbuch. Willst du, dass ich für dich nachschlage? Unter T wie Telefonbuch?«
»Lass gut sein.«
»Wenn ich es mir so überlege, brauche ich gar kein Telefonbuch. Ich kann dir aus dem Toyota-Handbuch vorlesen. Wart mal kurz, ich hab’s gleich.«
»Jetzt lass doch mal gut sein. Im Handschuhfach liegt gar kein Handbuch.«
»Nein? Du hast aber gesagt …«
»Das habe ich nur so gesagt. Toyota druckt keine Handbücher mehr. Die haben jetzt Websites.«
»Verstehe. Haben wir sonst etwas dabei, was ich dir vorlesen könnte? Eine alte Zeitung? Eine Packungsbeilage? Einen Reiseführer?«
»Ich glaube nicht.«
»Dann erzähle ich dir etwas. Soll ich dir eine Geschichte erzählen? Eine aus der Gegend hier?«
»Eine wahre Geschichte?«
»Selbstverständlich eine wahre Geschichte, was glaubst du denn. Wieso sollte ich dir eine unwahre Geschichte erzählen?«
»Alles klar.«
»Ich wüsste gar nicht, wie das gehen sollte, dir eine unwahre Geschichte zu erzählen. Ich kann mir keine Geschichten aus den Fingern saugen, meine Finger geben das nicht her.«
»Ich weiß.«
»Wobei es gar nicht so wichtig ist, ob eine Geschichte wahr ist oder nicht. Wichtig ist, dass sie stimmt.«
»Erzählst du mir jetzt die Geschichte?«
»In diesem Fall ist es aber doch wichtig, dass sie wahr ist. Diese Geschichte hier hat sich wirklich so zugetragen, ich schwöre es. Sonst könnte ich sie dir gar nicht erzählen.«
»Wieso nicht?«
»Du wirst schon sehen.«
»Fängst du jetzt an?«
»In Ordnung, pass auf. Siehst du die Melkhütte dort oben am gegenüberliegenden Hang?«
»Wo?«
»Geradeaus. Am Hang.«
»Ich sehe nur Schneesturm.«
»Am Fuß der Felswand. Die Melkhütte.«
»Da ist Schneesturm. Und schwarze Nacht.«
»Gleich da. Am Hang.«
»Ich sehe überhaupt nichts. Und ich wette, du siehst auch nichts.«
»Ich sehe alles. In der Gegend hier kenne ich mich aus.«
»Aber sicher.«
»Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Hier oben kenne ich jeden.«
»In Ordnung, alles klar. Nehmen wir also an, dort drüben stehe eine Melkhütte. Wie muss ich sie mir vorstellen?«
»Eine Blockhütte aus Rundhölzern, die im Schutz eines Felsblocks am Hang steht. Gleich da vorn, am Fuß der Felswand. Siehst du sie wirklich nicht?«
»Farbe?«
»Grau. Über Jahrhunderte in Ehren ergrautes Lärchenholz. Darüber ein mit Steinen beschwertes graues Schindeldach, als Fundament eine viereckige, leicht trapezförmige graue Trockenmauer von je etwa vier Metern Kantenlänge. Hölzerne Eingangstür ganz links an der talseitigen Front, ebenfalls grau.«
»Fenster?«
»Eines neben der Tür und eine kleine Luke im Dachgiebel.«
»Inneneinrichtung?«
»Eine offene Feuerstelle mit Kamin und Kupferkessel, ein paar Rührwerkzeuge, Töpfe und Siebe für die Käseherstellung. Daneben ein Regal, auf dem die fertigen Käselaibe reifen. In der Ecke eine Schlafstatt mit einem Strohsack.«
»Ein Strohsack?«
»Ein Strohsack aus Jute, darüber eine grobe Wolldecke. Und ein roh gezimmerter Tisch mit zwei Stühlen, darüber eine Öllampe. Alles ziemlich schwarz vom Ruß der Jahrhunderte.«
»Wer schläft auf dem Strohsack?«
»Ein Jüngling, ein Knabe fast noch. Schwarzes Kraushaar und hellgraue Augen, dunkle Schatten auf den Wangen; er rasiert sich einmal die Woche. Mit seinem Messer. Ein höllisch scharfes Messer. Er wetzt es täglich an einem Stein.«
»Klingt gut. Ein Freund von dir?«
»Er hat muskelbepackte Schultern wie ein Faustkämpfer und schmale Lenden wie ein Luchs. Und er ist flink auf den Beinen wie eine Gemse.«
»Nun übertreib mal nicht.«
»Wie eine Gemse, wenn ich es doch sage. Eigentlich sogar flinker. Er jagt die Gemsen, weißt du?«
»Dein Freund ist ein Jäger? Dann erzähl mir bitte eine andere Geschichte. Ich mag keine Jäger.«
»Den hier wirst du mögen. Er jagt nicht, um zu töten, sondern um sich zu ernähren.«
»Verstehe.«
»Und weißt du, wie er das macht? Er rennt den Gemsen hinterher. Wenn er irgendwo am Hang ein paar von ihnen sieht, holt er sein Gewehr aus der Hütte, eine vorsintflutliche französische Muskete mit Steinschloss übrigens, und nimmt die Verfolgung auf. Dann flüchten die Gemsen bergauf. Sie flüchten immer bergauf, das befiehlt ihnen ihr Instinkt. Für die Gemsen kommt alle Gefahr von unten, das haben sie gelernt aus zehntausendjähriger, bitterer Erfahrung seit dem Ende der letzten Eiszeit; der Säbelzahnlöwe, der Braunbär, der Wolf, der Luchs, der Mensch — immer sind ihre Mörder aus den Wäldern unten im Tal heraufgestiegen. Und darum flüchten die Gemsen hinauf, den Bergspitzen entgegen. Dort oben finden sie Ruhe, Frieden und Sicherheit.«
»Was ist mit Raubvögeln?«
»Na gut, die kommen von oben. Hin und wieder stürzt sich ein Lämmergeier oder Steinadler vom Himmel und holt sich ein Kitz. Aber ansonsten kommt alle Gefahr aus dem Tal.«
»Und Steinschlag?«
»Über Steinschlag zerbrechen sich Gemsen nicht den Kopf. Gegen Steinschlag kann man nichts machen.«
»Nein?«
»Steinschlag ist unvermeidlich. Langfristig stürzt jeder Berg ins Tal, diese geologische Tatsache ist allen Bergbewohnern überall auf der Welt jederzeit bewusst. Alles, was oben ist, muss nach unten, früher oder später endet jede Topographie in der Ebene. Wenn du Pech hast, trifft dich ein Stein am Kopf, wenn nicht, dann nicht. Lohnt sich nicht, darüber nachzudenken. Da kannst du nichts machen.«
»Es gibt aber doch geschützte Stellen.«
»An geschützten Stellen gibt es nicht genug zu fressen. Du kannst als Gemse nicht dein ganzes Leben an geschützten Stellen verbringen. Darum ist Steinschlag für Gemsen kein Thema.«
»Und Lawinen?«
»Soll ich jetzt mit meiner Geschichte fortfahren? Oder möchtest lieber du ein Referat über Lawinen halten?«
»Entschuldigung.«
»Die Gemsen flüchten also bergauf, und natürlich sind sie viel schneller als der Jüngling mit seiner Muskete. Würden sie dieses Tempo nur fünf oder zehn Minuten durchhalten, hätte der Jüngling ihre Fährte verloren und die Gemsen wären in Sicherheit.«
»Und deine Geschichte wäre zu Ende.«
»Das nicht, aber die Gemsen wären in Sicherheit. Nur tun sie das nicht, die einfältigen Viecher, sie laufen nicht weiter, sondern bleiben hinter dem nächsten Fels stehen und gucken um die Ecke, ob der Jüngling etwa schon angekeucht kommt. Und wenn er heran ist, tippeln sie wieder ein paar Schritte bergauf, bleiben erneut hinter der nächsten Felsnase stehen und gucken um die Ecke wie beim Räuber-und-Gendarm-Spiel.«
»Blöde Viecher.«
»Es ist die Arroganz des von Natur aus Überlegenen, der den Gemsen dieses Verhalten vorschreibt, sie können nicht anders. Ihr Instinkt befiehlt ihnen, niemals weiter oder schneller zu rennen als unbedingt nötig, denn sie müssen sparsam mit ihren Kräften umgehen. Das ist eine Frage des Überlebens, verstehst du, Gemsen verwenden Tag für Tag viele Stunden verdammt harte Arbeit darauf, genügend Energie für ihre Muskeln anzufressen mit dem spärlichen Grünzeug, das hier oben wächst. Darum dürfen sie nicht mehr Kalorien verbrennen als unbedingt nötig, und darum rennen sie bei Gefahr nicht panisch drauflos bis zur Erschöpfung, sondern tippeln immer nur um die nächste Ecke.«
»Max? Ist das zoologisch einigermaßen solid, was du mir da erzählst?«
»Der wissenschaftliche Name der Gemse ist Rupicapra rupicapra, ist das nicht hübsch? Die Viecher sind in diesem Gelände unschlagbare Sprinter, sie halten sich den Jüngling mit Leichtigkeit vom Leib. Er aber ist ein Marathonläufer und weiß, dass die Zeit auf seiner Seite ist; wenn er nur ihre Fährte nicht verliert, haben die Gemsen auf der langen Strecke keine Chance gegen ihn. Über kurz oder lang wird die Schwächste das Rennen entkräftet aufgeben und der Jüngling als Siegerpreis dreißig bis vierzig Kilogramm proteinreiche Nahrung nach Hause tragen. Er muss nur durchhalten.
So rennt und rennt der Jüngling den Gemsen hinterher, barfuß klettert er über Geröllhalden bergauf und stolpert über Bergwiesen hinunter …«
»Barfuß?«
»Den Sommer über läuft er barfuß, im Winter trägt er gamslederne Stiefel und Schneeschuhe, die er aus Zedernholz und Lederstreifen anfertigt. So durchsteigt er die tiefsten Schluchten und tänzelt über die schmalsten Grate, immer hinter den Gemsen her, er schlittert über Schneefelder und klettert an schrundigen Felswänden himmelwärts, bis die Herde allmählich langsamer wird, immer öfter Pausen einlegt und ihn immer näher herankommen lässt; dann dauert es nicht mehr lange, bis die schwächste Gemse erschöpft stehen bleibt und der Jüngling, endlich auf Schussdistanz herangekommen, mit der mitleidlosen Einfühlsamkeit des Jägers, für den die Unausweichlichkeit des Todes kein Skandal, sondern ein Faktum ist, sein Gewehr in Anschlag bringt. Nachdem er abgedrückt hat, hallt es wie Theaterdonner zwischen den Bergflanken, der Donner bricht sich, vervielfältigt sich und wird schwächer, und während die Bergdohlen aufflattern und schwarz in die Höhe steigen, kullern unter den Hufen der flüchtenden Gemsen die Steine zu Tale. Dann breitet sich Stille aus über dem toten Tier, und während noch im letzten Glimmen seiner erlöschenden Existenz die Hinterläufe zucken, ist der Jüngling schon heran und zieht sein Messer. Er lässt seine Beute ausbluten und weidet sie aus, dann schwingt er sie sich auf die Schultern und trägt sie den ganzen Weg zurück bis zur Melkhütte, manchmal viele Stunden lang. Dort zieht er ihr das Fell ab, schneidet das Muskelfleisch in Streifen und hängt es zum Räuchern in den Kamin.«
»Hat er kein Tiefkühlgerät? Keinen Strom in der Hütte?«
»Er lebt in dunkler Vorzeit, das solltest du schon bemerkt haben.«
»Ich hab’s geahnt.«
»Wir schreiben das Jahr 1779. Der Jüngling ist zweiundzwanzig Jahre alt und heißt Jakob Boschung. Das Fleisch der Gemse wird er essen, aus ihren Hörnern wird er Knöpfe schnitzen und aus ihrem Fell Leder gerben, und mit ihren Sehnen wird er das Leder in langen Winternächten zu Hosen, Handschuhen und Stiefeln vernähen.«
»Hat es den Jüngling wirklich gegeben?«
»Wenn ich es doch sage.«
»Wieso lebt er allein dort oben?«