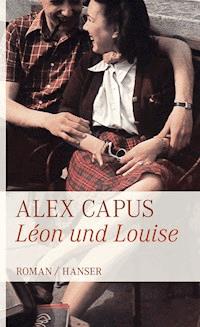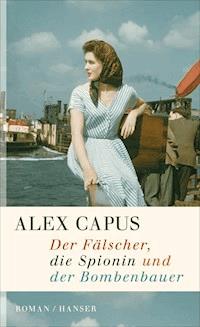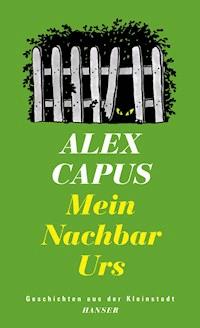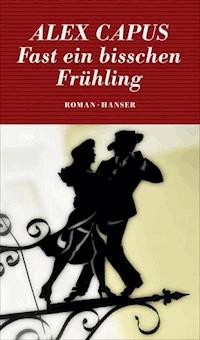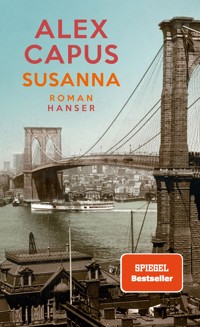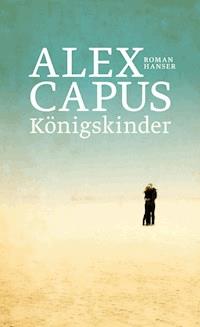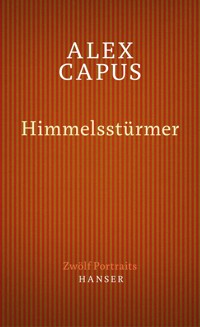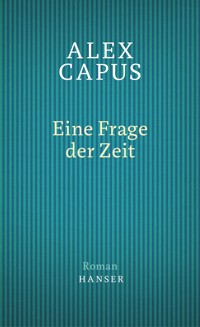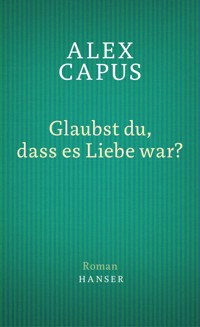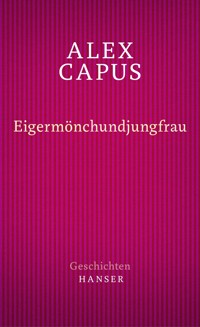
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Inhaltsbeschreibung folgt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Wir sind im Baseler Hinterland, genauer gesagt in der Kleinstadt Olten, und mittendrin in einem Bilderbogen über das Leben der heute gut Dreißigjährigen. Es ist der Alltag mit seinen kleinen Begebenheiten, die plötzlich ereignisreiche Veränderungen auslösen, es sind die Verheißungen und Hindernisse des Glücks und unter diesen Hindernissen das fatalste, der Tod, von denen Alex Capus in neunzehn kleinen Geschichten mal mit leiser Wehmut und mal mit bissiger Ironie erzählt.
Da gibt es solche in jenem besonderen Alter, die sich den Haaransatz blond nachfärben lassen, andere, die ihren Platz im Altersheim schon reserviert haben und sogar ein paar happy few, die gar den Ausbruch versuchen. Es sind, kurz gesagt, wie meist die Geschichten, die sozusagen auf der Straße liegen, die das Leben lebenswert machen.
Alex Capus
Eigermönchundjungfrau
Carl Hanser Verlag
Etwas sehr, sehr Schönes
Die Geschichte beginnt morgens um sieben Uhr an einem jener goldenen Herbsttage, wie sie das Basler Hinterland so leuchtend klar hat. Auf einem kleinen Hügel stehen einsam drei flammendgelbe Birken, dahinter liegt ein stattliches weißes Wohnhaus. Auf der Terrasse flattert eine Schweizerfahne im warmen Südwestwind. Die Tür geht auf, eine junge Frau kommt heraus. Sie ist vielleicht zwanzig, allerhöchstens fünfundzwanzig Jahre alt, trägt ein rot-weißes Reisekostüm, und ihr blondes Haar leuchtet in der Morgensonne. In weißen Sandalen läuft sie auf ihr Auto zu, während hinter ihr ein weißhaariger Mann aus dem Haus tritt. Der Mann ist bestimmt über Sechzig. Seinem ausrasierten Nacken und den harten Zügen um die Mundwinkel sieht man zwei Weltkriege an, seinen Schultern und dem flachen Bauch den lebenslang trainierten Leichtathleten. Er trägt zwei große Koffer, mühelos hält er sie seitlich auswärts, so daß sie ihm nicht gegen die Beine schlagen. Er legt das Gepäck auf den Beifahrersitz, denn das Auto ist rund und winzig wie ein Frosch, ein schwarzer Renault Heck, und anderswo ist kein Platz. Dann umarmt er die junge Frau, schaut ihr eindringlich in die Augen und sagt etwas. Sie nickt, steigt ein und fährt los, kurbelt das Fenster herunter, streckt einen nackten Arm heraus und winkt. Dabei knickt sie den Ellbogen einwärts, wie es nur Frauen können. Der weißhaarige Mann winkt zurück, bis der Renault hinter den Birken verschwindet, und geht dann schnell ins Haus. Es ist der 21. Oktober 1960.
Bis zur Grenze ist es nicht weit. Ein Zöllner mit steifem Hut und Stehkragen hebt den rot-weißen Schlagbaum, ein zweiter grüßt militärisch, und gemeinsam sehen sie dem schwarzen Renault hinterher. Am Straßenrand steht ein großer blauer Wegweiser, auf dem in weißer Schrift »Paris« steht.
Noch immer ist es früh am Morgen. Die Platanen links und rechts der Straße werfen lange Schatten westwärts auf die abgemähten Weizenfelder, der Mais ist feucht vom Tau, und weit hinten treibt ein Bauernbub Kühe auf die Weide. Im Innern des Wägelchens dröhnt und scheppert es, das Steuerrad vibriert, und das Bild im Rückspiegel ist verzittert. Die junge Frau fährt so schnell der Motor eben kann. Sie ist glücklich. In den Lärm hinein singt sie Bruchstücke eines Liedes von Edith Piaf. Plötzlich verstummt sie und zuckt zusammen, als ob sie etwas vergessen hätte. Sie angelt ihre Handtasche neben den Koffern hervor und nimmt eine Packung Zigaretten heraus. Camel, ohne Filter. Sie versucht vergeblich, die Packung einhändig aufzureißen, aber die andere Hand zu Hilfe nehmen kann sie auch nicht, weil die Straße ziemlich kurvig ist. Schließlich reißt sie die Packung mit den Zähnen auf, mit starken weißen Zähnen, zieht eine Zigarette heraus und zündet sie an. Ein aufmerksamer Beobachter würde auf den ersten Blick sehen, daß die junge Frau keine geübte Raucherin ist; sie hält die Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger, schürzt die Lippen bei jedem Zug zu einem spitzen Mündchen, und den Rauch zieht sie kaum tiefer hinein als bis zu den Backenzähnen. Der Qualm wird immer dichter im engen Auto, bis sie das Fenster herunterkurbelt und die halb gerauchte Zigarette hinauswirft.
Die Sonne steigt höher, die Schatten in den Alleen werden kürzer. Am Mittag fährt die junge Frau auf den Parkplatz eines Restaurants und stellt ihr Wägelchen zwischen zwei gewaltigen Lastwagen ab. Vor der Eingangstür hängen bunte Plastikstreifen und versperren die Sicht ins Lokal. Sie schiebt sie zur Seite und tritt ein. Sie ist die einzige Frau im Lokal; an den Tischen sitzen Männer mit stark behaarten Unterarmen. Sie reden miteinander, und höflich bemühen sich alle, die junge Frau nicht ungebührlich anzustarren. Sie setzt sich an einen freien Tisch. Der Wirt kommt und nimmt die Bestellung auf.
Dann fragt er: »Na, Mademoiselle, wohin fahren Sie denn, so ganz alleine?«
»Nach Paris.«
»Ah, Paris! Wie lange bleiben Sie da?«
»Nur eine Nacht. Dann geht's weiter nach England. Ich besuche einen Englischkurs in Oxford.«
»Studentin?«
»Lehrerin. Ich bilde mich weiter.«
»Das ist gut, Mademoiselle, das ist gut.« Der Wirt kehrt zurück in die Küche, um Mademoiselle einen gemischten Salat zu bereiten. Die junge Frau entdeckt die Musikbox in der Ecke. Sie geht hin, studiert das Verzeichnis und drückt drei Tasten. Unter der Glashaube erhebt sich ein halbkreisförmiger Arm, greift rückwärts in die nebeneinanderstehenden Schallplatten und legt eine auf den Plattenteller. Der Tonarm macht einen Schwenker, es knistert und kracht, und dann ertönt die Musik. Es ist ein Lied von Edith Piaf, dasselbe, das die junge Frau im Auto gesungen hat. Erst jetzt merkt sie, daß es still geworden ist im Restaurant. Sie dreht sich um. Die Männer sitzen schweigend da und starren sie an. Schnell kehrt die junge Frau an ihren Platz zurück. Sie zieht ein Buch aus der Handtasche, legt es vor sich auf den Tisch und schaut nicht mehr auf, bis der Salat kommt.
Bevor die Männer ihren Kaffee ausgetrunken haben, ist der kleine Renault schon wieder auf der Straße. Die Bäume werfen jetzt nur noch ganz kurze Schatten, und über dem Teer flimmert es wie im Sommer. Dann werden die Schatten wieder länger und zeigen nordostwärts. Aber bevor der erste Schatten den Horizont berührt, läßt die junge Frau den letzten Baum hinter sich und fährt in Paris ein. Auf dem Boulevard Saint-Michel fragt sie einen Polizisten nach einem bestimmten Hotel. Sie fährt hin und hat Glück: Gleich vor dem gläsernen Entrée ist ein Parkplatz frei. Sie geht hinein, spricht mit der Dame an der Rezeption und erhält sofort einen Zimmerschlüssel.
Der Hoteldiener holt die Koffer aus dem Wagen und geht voran die Treppe hoch. In ihrem Zimmer staunt die junge Frau über die Höhe des Fensters, das von der Decke bis knapp über den Boden reicht. Sie öffnet es, lehnt sich hinaus über das verschnörkelte gußeiserne Geländer, sieht hinunter ins emsige Treiben auf der Straße und hoch hinaus über die Dächer der großen Stadt und zündet ihre zweite Zigarette an.
Zerfließend geht die Sonne unter, die Nacht kommt. Die junge Frau hat sich gewaschen und einen leichten Sommerrock angezogen. Jetzt streift sie ihr weißes Strickjäckchen über, wirft einen prüfenden Blick in den Spiegel, hebt Handtasche und Zimmerschlüssel vom Bett auf und geht hinaus. Auf dem Boulevard Saint-Michel sind gutaussehende junge Leute zu Tausenden unterwegs. Zu Hause im Basler Hinterland gehörte die junge Frau zu den hübschesten, und mehrmals hatten liebeskranke Jünglinge unglückliche Nächte im Schatten von drei einsamen Birken verbracht. Aber hier, in Paris … die junge Frau ist beeindruckt.
Sie geht vorbei an den berühmten Literatencafés, in denen längst keine Literaten mehr sitzen, sondern nur noch blasierte Burschen in schwarzen Rollkragenpullovern, die gelangweilt dem Geschwätz ihrer hochtoupierten Freundinnen zuhören. Sie schnuppert den Dieselgestank der Busse, selig betrachtet sie die Auslagen der Buchhandlungen, heimlich schaut sie den vorbeiziehenden Menschen nach. An einer Ecke kauft sie ein paar Ansichtskarten und setzt sich ins nächste Café. Sie hat Vater versprochen, sich gleich am ersten Tag zu melden — nicht anzurufen, das wäre Geldverschwendung, aber doch eine Karte zu schreiben. Sie bestellt die erste Cola ihres Lebens, kramt den Federhalter aus der Handtasche und nimmt eine Ansichtskarte vom Stapel. Geschwind schreibt sie die Adresse und »Lieber Papa, liebe Mama«; dann stockt sie und beißt auf dem Füller herum.
Jemand spricht sie an. »Verzeihung, Mademoiselle. Wie ich sehe, haben Sie da einen ordentlichen Stapel Ansichtskarten. Wenn Sie eine entbehren könnten, würde ich Ihnen gerne ein paar Zeilen schreiben.«
Sie sieht den Mann an. Jung ist er, wahrscheinlich jünger als sie, und er kann unter seinen Augenbrauen hervorschauen wie James Dean. Das findet die junge Frau etwas lächerlich, aber immerhin trägt er keinen schwarzen Rollkragenpullover, sondern ein weißes Hemd und eine unglaublich schmale Krawatte. Groß und schlank ist er, und er spricht betont deutlich und langsam, damit sie ihn verstehen kann. Der junge Mann gefällt ihr. Sie reicht ihm eine Karte und den Füller. Er schreibt drei Zeilen, gibt ihr alles zurück, steht auf und verabschiedet sich: »Morgen um diese Zeit werde ich hier auf Sie warten. Auf Wiedersehen, Mademoiselle.« Und bevor die junge Frau antworten kann, daß sie in vierundzwanzig Stunden längst unterwegs nach England sein wird, vielleicht schon auf der Fähre oder jenseits des Ärmelkanals, ist der junge Mann im Strom der Menschen verschwunden.
Immer an dieser Stelle der Geschichte huscht ein frivoles Lächeln über das altersfaltige Mündchen meiner Mutter.
»Dein Vater hat unglaubliches Glück gehabt«, fährt sie dann jeweils fort, »ich hatte ihn am nächsten Morgen doch längst vergessen. Aber es regnete ziemlich stark, mir graute vor der Autofahrt, und so entschied ich mich, noch einen Tag in Paris zu bleiben. Ich lief den ganzen Tag im Louvre umher, und als ich abends zurück ins Hotel ging, führte mein Heimweg zufällig an jenem Café vorbei. Es war der pure Zufall, wie gesagt; dein Vater saß in der ersten Reihe, aber ich übersah ihn geflissentlich. Der eingebildete Laffe hätte sonst womöglich geglaubt, daß ich seinetwegen gekommen sei. Erst hat er nach mir gerufen und dann ist er hinter mir hergerannt, ich hörte seine Schritte und überlegte, ob ich weglaufen oder auf ihn warten sollte — da hielt ein Bus gerade neben mir, der Schaffner lächelte mich an wie ein rettender Engel und hielt mir die Hand hin, um mich auf die Plattform hochzuziehen. Ich zögerte einen Augenblick, eine Sekunde nur horchte ich auf die näher kommenden Schritte — da fuhr der Bus an, und eine sanfte Hand legte sich auf meine Schulter. Einen Monat später war ich immer noch in Paris und schwanger« — an dieser Stelle wird Mamas Lächeln jedesmal wehmütig — »und ich habe bis heute keinen Fuß auf britischen Boden gesetzt. Und Englisch kann ich auch kein Wort.«
»Mama«, sage ich dann immer, »jetzt verrate mir doch endlich: Was hat Papa auf die Ansichtskarte geschrieben?«
Und hier wird ihr Lächeln zu einem triumphierenden Strahlen. »Mein Sohn, das geht dich rein gar nichts an. Nur soviel: Es war etwas Schönes. Etwas sehr, sehr Schönes.«
Sommeridyll 1
Es war der Tag nach meinem fünften Geburtstag. Zwischen den schweren Samtvorhängen drang ein Sonnenstrahl ins Zimmer und brachte die rot-weißen Fliesen zum Leuchten. Alle schliefen noch: Mein kleiner Bruder Manuel, der neben mir in einem riesigen französischen Doppelbett lag; meine Cousins Pascal und Stephane und Christian, die viel größer waren als ich und jeder ein Einzelbett hatten. Ich horchte hinüber ins Mädchenzimmer. Auch dort war alles still. Von den Erwachsenen war sowieso noch nichts zu hören. Es war Sommer, die Männer unserer Familie hatten Urlaub und die Frauen braungebrannte Beine. Mein Geburtstagsfest hatte bis spät in die Nacht gedauert. Irgendwann waren wir Kinder reihum auf den Schößen unserer Mütter eingeschlafen. Dann waren die Väter aufgestanden und hatten uns auf ihren starken Armen zu Bett gebracht.
In Hemd und Unterhose lief ich über die kalten Fliesen durch den Knabenschlafsaal, den Flur und die Treppe hinunter bis zur Haustür, die eine riesige schwarze Türklinke hatte und deren graues Eichenholz so entsetzlich schwer war. Die Tür stand offen. Die Sonne war eben erst über dem dampfenden Apfelhain aufgegangen, und das Licht drang flach und tief ins Haus hinein. Ich trat hinaus in den normannischen Morgen. Die Steinchen des gekiesten Vorplatzes drangen spitz in meine weichen Fußballen. Der Wind hatte gedreht; gestern noch hatte er den ganzen Tag den süßen Geruch der nahen Tierkadaververbrennungsanlage herangetragen, heute brachte er einen Hauch von frischer Meeresluft vom Ärmelkanal herüber.
Der lange Tisch unter der großen Eiche war übervoll mit leeren und halbleeren Weingläsern, Flaschen, Kaffeetassen und Aschenbechern. Auf den Desserttellern hüpften aufgeregt ein paar Meisen umher und pickten die Krumen auf, die von Tante Louisettes Apfelkuchen übriggeblieben waren. Drei Stühle waren umgekippt, und im Gras lag Mamas Strickjäckchen, das immer so gut roch.
Der Tisch stank. Ich ließ ihn hinter mir und lief hinunter zum Bach, wo die Entenmutter ihre Jungen ausführte. Jenseits des Bachs weideten die Kühe des Bauern Antoine friedlich zwischen den Apfelbäumen, aber das war verbotenes Land für uns Kinder. Die Weiden des Bauern Antoine waren Sumpfland; immer wieder waren dort ungezogene Jungen steckengeblieben, hatten ungehört um Hilfe geschrien und waren kläglich erstickt, als der Schlamm über ihre Köpfe hinauswuchs. Jetzt lagen sie für immer und ewig dort drüben, und die Kühe weideten über ihren Köpfen.
»Aber Mama, warum sinken Antoines Kühe nicht ein?«
»Weil sie vier Beine und einen dicken Bauch haben. Wenn eine von Antoines Kühen in den Sumpf gerät, schwimmt sie mit ihrem dicken Bauch obenauf wie ein Schiff im Meer, und Antoine kann sie herausziehen. Du aber hast keinen dicken Bauch, und deshalb gehst du mir bis zum Bach und nicht weiter, hörst du!« Und Mama meinte das so ernst, und Ungehorsam war derart undenkbar, daß sie nicht einmal mit Strafe drohte.
Ich blickte zurück, ob mir niemand gefolgt war. Leuchtend weiß stand das große Haus zwischen Wiesengrün und Himmelblau, stolz wie unsere Familie und friedvoll wie Mamas Schoß. Ich wandte mich wieder dem Bach zu und ließ wohlig erschauernd die Beine ins Wasser gleiten. Ich watete gegen die Strömung hinauf zum moosbewachsenen Felsbrocken, der dort im Schatten mitten im Wasser stand. Für uns Kinder war er die einsame Insel, das Piratenschiff, das Ufo, der Mond. Massig und unverrückbar stand er in der Strömung, kleine Wirbel zogen an ihm vorbei, und unsere selbstgebastelten Boote drehten sich darin, wenn man sie nahe genug am Fels vorbeiziehen ließ. An einer geheimen, nur mir bekannten Stelle ging ich langsam in die Knie, tauchte erschauernd den Hintern ins Wasser und dann auch den Bauch. Schließlich saß ich am Grund des Bachs auf glitschigen Kieseln, Hemd und Hose klebten mir am Leib, und das Wasser stand mir bis zum Hals. Mit der rechten Hand tastete ich nach der geheimen Höhle unter dem Felsbrocken, die ich ganz alleine in den Kies gegraben hatte. Einen Moment erwog ich, daß über Nacht ein Flußkrebs oder ein Raubfisch eingezogen sein könnte, aber dann stieß ich mutig hinein, zog die Hand aus dem Wasser und hielt meinen Bergkristall ans Sonnenlicht. Er stammte aus Großvaters Sammlung; der alte Mann hatte ihn mir gestern zum Geburtstag geschenkt. Es war ein ziemlich kleiner Kristall, und so hatte ich mir vorgenommen, ihn ein Stück wachsen zu lassen. Das Wasser in diesem Bach war mindestens so klar wie ein Kristall, und kalt war es auch. Ich hatte mit niemandem darüber gesprochen, aber ich war mir ganz sicher, daß Kristalle nur in kaltem Wasser richtig wachsen können.
Der Kristall war an jenem Morgen halb so lang wie der Zeigefinger meiner rechten Hand und etwa gleich dick. Genau gleich wie gestern also. Vielleicht war eine Nacht nicht genug. Vielleicht würde ich ihn ein paar Tage in Ruhe lassen, damit er ungestört wachsen konnte.
Ich hatte den Kristall gerade wieder zuhinterst in der Höhle versteckt, als neben mir das Wasser aufspritzte. Ich wußte sofort, was das war: Jemand hatte einen Stein nach mir geworfen. Kampfbereit griff ich im Bachbett nach einem passenden Kiesel, stand auf und drehte mich um, den Wurfarm weit nach hinten ausgestreckt — aber dort unten stand mein Vater, groß und schlank wie ein Baum, frisch rasiert und lachend, nachlässig gekleidet in seinem verwaschenen Lieblingshemd und seiner zerknitterten Baumwollhose. Er winkte, und ich watete zu ihm hin.
»Guten Morgen, Frühaufsteher! Wie fühlt man sich so als Fünfjähriger?«
»Gut.«
»Gut? Ist das alles? Ab heute bist du ein richtiger großer Junge und kein Baby mehr — das ist doch was!«
»Ja, Papa.«
Vater sah mich prüfend an. Ich stand tropfnaß in Hemd und Unterhose vor ihm. »Daß du mir nicht ins Sumpfland gehst! Wenn du die Glocke hörst, kommst du frühstücken, klar? Und wenn du hier am Bach fertig bist, ziehst du dir was an.«
»Ja, Papa.«
Vater ging zurück zum Haus. Nach ein paar Schritten drehte er sich um und sah mich an. Er lächelte merkwürdig, und auf seiner rechten Wange zuckte der Kaumuskel. Ich fühlte mich unbehaglich.
»Hast du heute schon Tauben gesehen?«
»Tauben?«
»Ja, Tauben. Die wilden graubraunen Tauben, die manchmal auf dem Hausdach sitzen. Hast du sie heute schon gesehen?«
»Nein, Papa.«
»Wenn du eine siehst, ruf mich. Ich bin im Haus.«
Dann war er weg, und mir fiel ein, daß der Piratenhafen gestern schwer bombardiert worden war. Ich ging hin und reparierte die Quais und machte die Fahrrinne wieder frei und warf die Kanonenkugeln zurück ins Meer. Dann ließ ich die Schiffe zu Wasser, die aus Sicherheitsgründen an Land übernachtet hatten, und dann merkte ich, daß ich fror. Ich lief zurück zum Haus, um mich abzutrocknen und anzuziehen.
Auf dem Dach saß eine Taube. Ganz zuoberst auf dem Dachfirst.
Sie ruckelte mit dem Kopf und gurrte, tippelte ein wenig nach rechts und dann wieder ein paar Schritte nach links.
»Papa! Papaa!«
»Ja?«
»Eine Taube! Auf dem Dach sitzt eine Taube!«
Vater tauchte aus dem dunklen Hausflur auf und trat hinaus auf den Hof. In der Hand hielt er einen großen, silbern glänzenden Revolver. Mit zusammengekniffenen Augen schaute er hoch zum Dachfirst, zielte mit ausgestrecktem Arm und schoß. Es gab einen entsetzlichen Knall. Die Taube flatterte und verschwand hinter dem Hausdach; zwei Sekunden später kam sie flügelschlagend wieder hoch, flog über uns hinweg und setzte sich in die große Eiche direkt über dem langen Tisch mit den Weingläsern und den Kaffeetassen. Vater und ich liefen hin und spähten hoch in den Baum. Dort oben saß die Taube, tat keinen Wank und stellte sich schlafend. Diesmal zielte Vater lange und sorgfältig. Als der zweite Schuß die morgendliche Stille zerriß, fiel uns ein blutiges Bündel Federn vor die Füße, ganz nah neben Mamas weiße Strickjacke. Vater setzte sich auf einen Stuhl und hieß mich neben ihm Platz nehmen. Dann rupfte er die Taube. Die Federn fielen ins Gras, und die milde Meeresluft wirbelte sie auf und verstreute sie übers ganze Land. Als er damit fertig und die Taube ganz nackt war, nahm er sein Klappmesser aus der Hosentasche, stach ihr in den Bauch und zog die blauroten Gedärme und all die anderen Innereien heraus. Dann gingen wir in die Küche. Vater rieb den Vogel mit Senf ein und würzte ihn, steckte ihn in einen Topf und übergoß alles mit Rotwein. Und als die Taube gar war, mußte ich sie ganz alleine essen. Vater half mir mit den Knochen und sah zu, daß ich kein Fleisch übrigließ.
Um wieviel wächst eigentlich ein Bergkristall, wenn dreißig Jahre lang klares, kaltes Bachwasser über ihn hinwegfließt?
Sommeridyll 2
Der dicke Mann mit der blau-weiß-roten Schärpe hatte eine Rede gehalten. Er stieg schnaufend vom hölzernen Gestell, das man im Sand für ihn aufgebaut hatte. Jetzt würden die Erwachsenen lange am Strand promenieren und ernste Worte sprechen, die sich im Geschrei der Möwen verloren. Die Kinder würden Drachen in den bläulichfahlen Himmel steigen lassen, und am Abend würden alle auf dem Dorfplatz zu Akkordeonmusik tanzen. Das Meer hatte sich bis an den Horizont zurückgezogen, und es sah aus, als könne man zu Fuß nach England hinüberlaufen. Ich jagte die kleinen schwarzen Krebse, die seitwärts über den nassen Sand flohen. Vater hatte mir beigebracht, wie man sie anfassen muß: hinten am Panzer, damit sie einen mit ihren Scheren nicht klemmen können. Mein Eimer war schon halb gefüllt mit Krebsen. Sie versuchten vergeblich, die glatten Plastikwände hochzukriechen; es entstand ein schabendes Geräusch, das ich in den Fingern fühlte, und mich schauderte. Bald würde ich die Krebse wieder freilassen.
»Hast du deine Mama gesehen?«
»Dort.« Mama stand weit draußen bei den sich brechenden Wellen, hielt in der linken Hand ihre Schuhe und mit der rechten den Hut fest. Ihr hellblauer Rock verschwamm im Dunst mit dem Meer und dem Himmel. Unentwegt sah sie aufs Wasser hinaus. Papa seufzte und kauerte sich neben mir hin.
»Was hat der dicke Mann erzählt?« fragte ich.
»Ach, es ist jedes Jahr dasselbe. Er hat den tausend amerikanischen Soldaten gedankt, die über diesen Strand gerannt sind und von den Deutschen erschossen wurden. Sollen wir die Krebse freilassen?«
Ich nickte, und wir sahen gemeinsam hinaus.
»Papa?«
»Ja?«
»Was hat Mama eigentlich?«
»Ich weiß nicht. Sie ist traurig.«
»Worüber?«
»Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie möchte in die Schweiz fahren, oder nach England.«
»Wieso?«
»Sie will einfach weg von hier, das ist alles.«
»Glaubst du, daß sie es tut?«
Papa zuckte mit den Schultern. »Ich hoffe nicht. Was meinst du?«
»Ich glaub's nicht. Und wenn sie geht, dann gehen wir einfach mit.«
»Genau.« Papa lachte, zog mich an der Badehose zu sich heran und küßte mich. Seine Bartstoppeln pieksten. Es tat ein bißchen weh, und doch mochte ich es.
»Papa?«
»Ja?«
»Hast du schon mal einen amerikanischen Soldaten gefunden?«
»Einen toten, meinst du? Nein. Die haben sie alle eingesammelt, als der Krieg woandershin ging.«
»Und dann?«
»Dann haben sie sie in tausend Metallsärge gepackt. Dort hinten standen sie in langen, schnurgeraden Reihen. Dann ist ein Flugzeug gelandet und hat sie zurück nach Amerika geflogen.«
»Metallsärge?«
»Bei Holzsärgen wäre das Blut herausgetropft. Wir sollten jetzt wirklich die Krebse freilassen. Die ersticken sonst in deinem Plastikeimer.«
Ich kippte den Eimer aus, und die Krebse flohen in alle Richtungen.
»Waren es genau tausend Metallsärge?«
»Keine Ahnung. Ich habe sie nicht gezählt.«
»Dann könnte es sein, daß sie einen toten Amerikaner liegengelassen haben?«
»Ich weiß nicht. Die haben schon genau nachgesehen. So ein Amerikaner ist groß, den übersieht man nicht so leicht.«
»Aber wenn er am Strand lag, und ein paar große Wellen deckten ihn mit Sand zu? Dann könnte es doch sein, daß er immer noch hier irgendwo liegt, mit der Uniform und dem Gewehr und dem Helm und der Handgranate und allem?«
»Weißt du, das ist jetzt dreiundzwanzig Jahre her …«
»Wir könnten doch graben! Vielleicht finden wir ihn!«
»Nun, dreiundzwanzig Jahre sind eine lange Zeit, ich war damals noch nicht einmal so alt wie du, und Meerwasser ist eine ziemlich scharfe Sache. Da verrostet alles, und den Rest fressen die Krebse.«
»Wie viele Krebse braucht es, um einen Amerikaner zu fressen?«
»Keine Ahnung. Hundert vielleicht. Wollen wir Mama holen?«