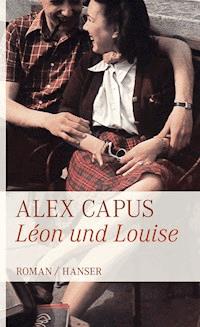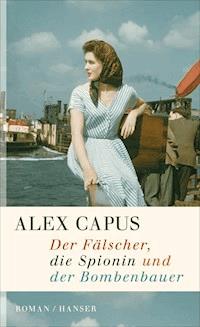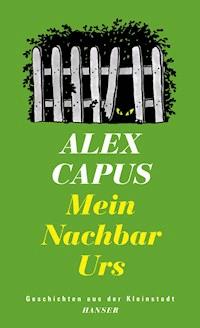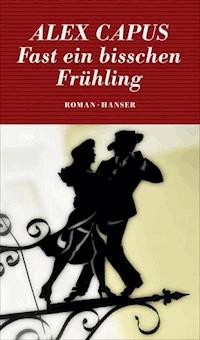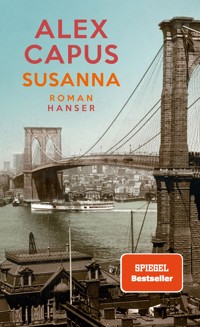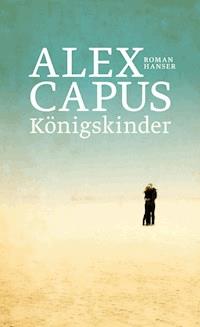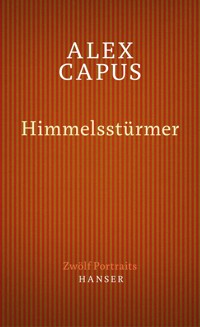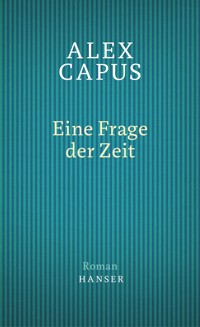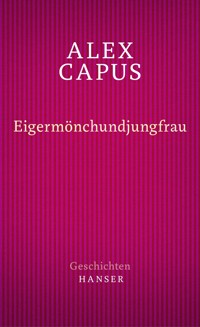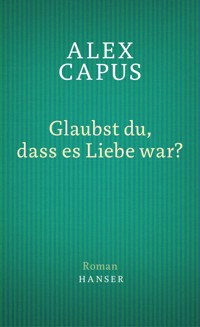Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dem jungen Autor Robert Louis Stevenson ist außer dem Abenteuerroman „Die Schatzinsel“ noch nicht viel gelungen. Gegen jede Konvention verliebt er sich in eine verheiratete Frau und reist mit ihr in die Südsee. Wie kommt Stevenson an das Geld, sich im Dschungel auf Samoa eine fürstliche Residenz zu errichten? Warum trotzt der lungenkranke Dichter bis zu seinem Tod dem Tropenklima? Eines ist gewiss: Der Verfasser der „Schatzinsel“ ist in der Südsee zu Reichtum gelangt, den literarische Erfolge kaum erklären können. Alex Capus folgt dem Weg zweier Liebender, die in der Südsee vielleicht Piratenschätze fanden, vor allem aber leidenschaftliche Jahre lebten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
ALEX CAPUS
Reisen im Lichtder Sterne
Carl Hanser Verlag
Das Hörbuch erscheint zeitgleich bei Der Hörverlag,
gelesen von Max Moor.
ISBN 978-3-446-24997-4
© Carl Hanser Verlag München 2015
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München © Winslow Homer, On a Lee Shore, 1900, Photography by Erik Gould, courtesy of the Museum of Art, Rhode Island School of Design, Providence
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
»Was hängt der hier auf dieser Scheißinsel rum? Ich sage euch: DER sucht hier keine Ostereier. Auf den wartet zu Hause ein Palast und ein Heer von gepuderten Arschkriechern; und wenn er nicht dorthin zurückkehrt, so muss er dafür einen verdammt guten Grund haben. Könnt Ihr mir folgen?«
Captain Davis in Robert Louis Stevensons The Ebb-Tide,
geschrieben 1890, im ersten Jahr auf Samoa.
Anmerkung und Zitatnachweis
Inhalt
1 Friedlich vor Anker
2 Ein wahrhaft fürstlicher Ort
3 Die Geschichte von Fanny und Louis
4 Cocos Island
5 Die Schatzinsel
6 »Ich will das Beste hoffen«
7 Der Kobold in der Flasche
8 Wo ist der Schatz?
9 Die abenteuerliche Fahrt von Willem Schouten und Jacob LeMaire
10 »Ist da eine Schraube locker?«
11 Göttlicher Schabernack
12 Blitz und Donner
13 Die Pirateninsel
14 »Sehe ich seltsam aus?«
15 Der Flaschenkobold zieht weiter
16 Der Atem, der vom Meer her kam
Dank
Anmerkungen und Zitatnachweise
Verwendete Literatur
Mein Vater ist Normanne, genauso wie sein Vater und sein Großvater und dessen Vater auch; allesamt große, starke und schwerblütige Männer, deren Schweigsamkeit nicht auf besonderen Tiefsinn hinweist, sondern nur auf Schweigsamkeit. Den Sommer verbrachte unsere Familie stets auf einem kleinen Gehöft in der Basse Normandie, das in grauer Vorzeit eine angeheiratete Tante geerbt hatte. Es muss am frühen Morgen des 6. Juni 1964 gewesen sein, am zwanzigsten Jahrestag von D-Day, als mein Vater mich auf den Rücksitz seines feuerwehrroten Renault Dauphine verfrachtete, dann seinen Vater auf den Beifahrersitz komplimentierte und uns über kurvige Landstraßen nordwärts zur Küste fuhr; wohin genau, weiß ich nicht. Ich habe vage Erinnerungen an Uniformen und Blasmusik und feierliche Reden. Ich weiß noch, dass ich an jenem Tag zum ersten Mal das Meer sah und dass ich es nicht sonderlich beeindruckend fand; und unvergesslich ist mir, mit welcher Begeisterung Großvater, Vater und ich Seite an Seite über den Strand schlurften, mit den Füßen im Sand scharrten und nach Zeugnissen der alliierten Invasion suchten. Wir fanden Granatringe, Schrapnellsplitter, Gürtelschnallen, Patronen. Projektile, Uniformknöpfe, Schraubenmuttern, Ösen. Brüchiges Leder, Grünspan, rostiges Eisen. Wir steckten alles in unsere Hosentaschen, und ich vermute, dass unsere Wangen glühten – meine vor kindlicher Begeisterung, die meines Vaters vor Verlegenheit über die kindische Schatzgräberei und Großvaters Wangen vor Scham über unsere pietätlose Gier.
Abends nach dem Essen saßen wir nebeneinander in der Küche am offenen Kamin und starrten ins Feuer, hatten die Hände in die Hosentaschen vergraben und fingerten an unseren Granatringen und Schrapnellsplittern herum, die wir, ich weiß nicht, weshalb, vor unseren Frauen, Müttern, Großmüttern verborgen hielten. Die große, gusseiserne Platte, die hinter dem Feuer an der Wand stand, strahlte wohlige Wärme ab – und vielleicht war es an jenem Abend, als Großvater die Rede darauf brachte, dass sich hinter solch gusseisernen Platten zuweilen die kostbarsten Gold- und Silberschätze verbergen. Dass es kein besseres Versteck als dieses geben konnte, leuchtete mir ein; denn welcher Räuber würde es wagen, seine Arme durchs Feuer zu strecken und die heiße Eisenplatte anzufassen?
Seit jenem Abend sind vierzig Jahre und achtunddreißig Tage vergangen. Großvater ist vor bald zwanzig Jahren gestorben, und mein Vater ist ein ganzes Stück älter geworden; ich selbst bin in der Zwischenzeit wohl mehr oder weniger der geworden, welcher mein Vater und mein Großvater einmal waren. Von jenem normannischen Kaminfeuer aber trennt mich in dem Augenblick, da ich dies schreibe, nicht nur die verflossene Zeit, sondern buchstäblich der Planet Erde. Ich sitze am anderen Ende der Welt vor dem »Outrigger Hotel« hoch über Apia, Samoa, schaue nordwärts hinaus auf die unendliche Weite des Südpazifik und ergebe mich dem Gedanken, dass von hier bis zum Nordpol, über gut ein Viertel des Erdumfangs, nicht mehr viel kommt. Jede Menge Wasser, ein bisschen Hawaii und die Beringstraße und dann das Packeis.
Ich bin hier, um zu beweisen, dass es Robert Louis Stevensons »Schatzinsel« tatsächlich gibt, und zwar ganz woanders, als Heerscharen von Schatzsuchern sie über Generationen gesucht haben – und dass Louis einzig und allein deshalb die letzten fünf Jahre seines Lebens auf Samoa verbrachte, weil er selber ein Schatzsucher war.
Und während die Sonne im Meer versinkt, füllt sich mein Herz mit den Empfindungen jenes Abends am Kaminfeuer vor vierzig Jahren: mit der kindlichen Begeisterung des Schatzgräbers, mit der väterlichen Verlegenheit über das eigene kindische Treiben und mit der großväterlichen Scham darüber, dass ich in fremder Leute Angelegenheiten wühle, die seit hundert Jahren tot sind und sich nicht mehr wehren können.
Apia, 12. Juli 2004
1
Friedlich vor Anker
Bis auf hundertneunzig Meilen hatte sich die Equator am 2. Dezember 1889 ihrem Ziel genähert, dann kam sie nicht mehr voran. Das kleine, kaum siebzig Tonnen schwere Handelsschiff schlingerte an Ort und Stelle in der aufgepeitschten See, Sturmböen stürzten aus allen Richtungen auf die flatternden Segel, und es fiel schwerer Regen bei vierzig Grad Hitze und hundert Prozent Luftfeuchtigkeit. Das war kein Klima für einen lungenkranken Schotten wie Robert Louis Stevenson; hätte er seinen Ärzten gehorcht, wäre er zur Kur in die kalte und trockene Alpenluft der Lungenklinik Davos gefahren, wo er schon zwei Winter verbracht hatte und fast gesund geworden war. Stattdessen saß er im Schneidersitz auf den feuchten Planken unter Deck, rauchte eine Zigarette nach der anderen und schrieb einen Brief an seinen Jugendfreund Sidney Colvin, Kunstprofessor in Cambridge. Er war barfuß und nackt bis auf eine schwarzweiß gestreifte Hose und ein ärmelloses Unterhemd, und um die Hüfte hatte er eine rote Schärpe gebunden. Neben ihm lag in unruhigem Schlaf seine seekranke Frau Fanny und neben ihr in jugendlichem Frieden der einundzwanzigjährige Lloyd Osbourne, Fannys Sohn aus erster Ehe. Das Schiff roch beißend nach fermentierter Kokosnuss, und es wimmelte von Läusen und daumengroßen Kakerlaken.
»Das Ende unserer langen Reise rückt näher. Regen, Windstille, eine Bö, ein Knall – und die Vormarsstange ist weg; Regen, Windstille, eine Bö, und fort ist das Stagsegel; noch mehr Regen, noch mehr Windstille und weitere Böen; eine ungeheuer schwere See die ganze Zeit, und die Equator schlingert wie eine Schwalbe im Sturm; unter Deck ist ein einziger großer Raum, der bedeckt ist von nassen Menschenleibern, und der Regen ergießt sich in wahren Sturmfluten aufs leckende Deck. Fanny hält sich sehr tapfer inmitten von fünfzehn Männern. (…) Wenn wir nur für zwei Pence brauchbaren Wind hätten, wären wir schon morgen zum Abendessen in Apia. Aber wir schlingern vor uns hin ohne das leiseste Lüftchen, und dann brennt auch wieder die Sonne über unseren Köpfen, und das Thermometer zeigt 88 Grad …«
Seit anderthalb Jahren bereiste Stevenson die Südsee, hatte die Marquesas, Tahiti, Hawaii und zuletzt die Gilbert-Inseln besucht, um Reisereportagen für amerikanische Zeitschriften zu schreiben. Er tat dies zur allseitigen Unzufriedenheit: Die Leser der Zeitschriften waren enttäuscht, dass der Autor der »Schatzinsel« ihnen derart langfädige und schulmeisterliche Abhandlungen zumutete; die Verleger waren enttäuscht über den ausbleibenden Verkaufserfolg; und für Louis selbst war die Arbeit eine qualvolle Pflicht, deren Ende er herbeisehnte. Er wollte nach Hause, erst nach London, dann nach Edinburgh. Mit keinem Gedanken dachte er zu der Zeit daran, sich auf Samoa niederzulassen. Und nichts deutete darauf hin, dass er nur sechs Wochen später, im Alter von neununddreißig Jahren, sein gesamtes verfügbares Vermögen in den Kauf eines Stücks undurchdringlichen Dschungels investieren und dort den Rest seines Lebens verbringen würde. Ganz im Gegenteil.
»Ich habe nicht im Sinn, sehr lange auf Samoa zu bleiben. Meine Studien werde ich wohl, soweit sich das voraussagen lässt, auf die jüngste kriegerische Geschichte beschränken. (…) Es ist möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass ich noch rasch einen Besuch auf Fidschi oder Tonga mache, oder sogar beides; aber in mir wächst die Ungeduld, dich wiederzusehen, und ich will spätestens im Juni in England sein. Wir werden, so Gott will, über Sydney, Ceylon, Suez und wahrscheinlich Marseille heimkehren. Einen Tag oder zwei werde ich wohl in Paris Station machen, aber das ist alles noch weit weg; obwohl – es rückt allmählich näher! So nahe, dass ich meine Droschke schon über Endell Street rattern höre. Ich sehe, wie die Tür aufgeht, und fühle, wie ich hinunterspringe und die monumentale Treppe hochlaufe und – hosianna! – wieder zu Hause bin.«
Die Flaute hielt weitere drei Tage an. Erst am Morgen des 7. Dezember 1889, am sechsundzwanzigsten Tag auf See, kam Upolu in Sicht, die lange und schmale Hauptinsel Samoas, gebirgig und von dichtem Dschungel überwuchert. Vom Land herüber wehte der Geruch von Kokosnussöl, Holzfeuern, tropischen Blüten und von Brotfrucht, die auf heißen Basaltsteinen gebacken wird. Die Hafenbucht war gesäumt von einer einzigen, mit weißem Korallenkies bedeckten Straße, an der, halb verdeckt durch eine Doppelreihe Kokospalmen, die Hauptstadt Apia lag: einige Dutzend weißgestrichene Holzhäuser, fast alle von Europäern bewohnt, die meisten von ihnen Deutsche. Das größte Gebäude war der Sitz der »Deutschen Handels- und Plantagen-Gesellschaft für Südsee-Inseln zu Hamburg«, das von Apia aus den pazifischen Kokosnuss-Markt beherrschte. Daran reihten sich ein paar Wellblechdächer, dann das deutsche, das englische und das amerikanische Konsulat, gefolgt von der französischen Bruderschaft römisch-katholischer Priester und ein paar Kirchen aus Vulkanstein sowie dem Postamt, an dem ein Schild mit der Aufschrift »Kaiserlich Deutsche Postagentur« hing, und dann fünf oder sechs Läden für Lebensmittel und Haushaltswaren. Nach einer Stadt sah das nicht aus; eher nach einem etwas improvisierten Badeort. Es gab sechs Spelunken und Bars, in denen man Gin, Brandy und Soda sowie deutsches Bier (Flensburger und Pschorrbräu, die Flasche für eine Mark fünfzig in deutschem Geld) bekam; weiter eine Billardhalle und eine Bäckerei sowie zwei Hufschmiede und zwei Baumwollentkörnungsanlagen. Etwas außerhalb der Stadt stand der deutsche Biergarten »Lindenau«, dessen Pschorrbräu immer dann angenehm kühl war, wenn das monatliche Postschiff aus San Francisco Eis mitgebracht hatte, und nahebei betrieb der deutsche Kegelklub seine Kegelbahn. Die wichtigste Attraktion in Apia aber war in jenen Jahren das alte Dampfkarussell am Hafen, letztes Überbleibsel einer US-amerikanischen Schaustellertruppe, die sich unter Zurücklassung des Arbeitsgeräts in alle Winde zerstreut hatte, als der Direktor die Löhne nicht mehr zahlen konnte. Ein französischer Barbesitzer übernahm das Karussell zu einem Spottpreis, und von da an stand es jeweils am Wochenende unter Dampf. Die jungen Männer des Städtchens spendierten ihren Mädchen für fünfundzwanzig Pfennig eine Fahrt auf einem wilden Löwen oder einem edlen Ross, und während das Karussell sich drehte, verkündete dessen Orgel endlos, dass das Männerherz ein Bienenhaus sei.
Als die Equator in den von Korallenriffs durchzogenen Hafen einfuhr, kamen ihr einige Samoaner in eleganten Auslegerbooten entgegen. Sie sangen zur Begrüßung wehmütig-fröhliche Lieder in ihrer schönen Sprache, die für die deutschen Kolonisten wie Italienisch klang, und stießen im Takt dazu ihre Paddel ins Wasser. Die Männer waren groß und kräftig und hatten feine, gitterartige Tätowierungen von der Hüfte bis zu den Knien; es sah aus, als trügen sie unter ihren Schürzen dunkle Kniehosen. Die Frauen hatten Hibiskusblüten im Haar und waren nur leicht tätowiert mit kleinen Sternen an der Schulter, auf dem Bauch oder an der Wade. Den Auslegerbooten folgte ein europäisches Hafenboot, in dessen Heck ein großer Mann mit Panamahut, leuchtend blauen Augen und weißem Leinenanzug stand. Das war der Amerikaner Harry J. Moors,1 der seit vierzehn Jahren in Apia ansässig war und mit allem Handel trieb, was sich irgendwie kaufen und verkaufen ließ. Er besorgte den deutschen Kolonisten australisches Bier, den Franzosen neuseeländischen Hummer, den Briten französischen Rotwein, den Samoanern Schusswaffen und bunten Baumwollstoff. Er verkaufte Kokosnuss und Ananas in alle Welt und vermittelte Immobilien, Reitpferde, Schiffspassagen und Bankkredite. Harry Moors hatte mehrere Filialen auf anderen Inseln und kannte im Südpazifik alles und jeden. Er zog heimlich seine Fäden in der Kolonialpolitik, schmuggelte Waffen für Aufständische, organisierte Ringkämpfe und Theateraufführungen und sollte der erste Kinobetreiber in Apia werden. Er kannte sämtlichen Tropenklatsch, und natürlich hatte er längst erfahren, dass Stevenson anreisen würde; sein alter Freund Joe Strong, mit dem er in Hawaii viele Nächte durchzecht hatte und der zufällig der Schwiegersohn des weltberühmten Dichters war, hatte ihn brieflich gebeten, sich um die Schwiegereltern während der zwei Wochen, die sie auf Samoa zu verbringen gedachten, ein wenig zu kümmern. Dass aus den zwei Wochen mehrere Jahre werden würden, konnte niemand ahnen. Als Harry Moors’ Hafenboot längsseits der Equator anlegte, stiegen die Stevensons eilig über die Bordleiter zu ihm hinunter. Nach einer kurzen Begrüßung bat Louis, dass man an Land gehen möge, ohne auf das Gepäck zu warten; denn sie waren fast vier Wochen auf See gewesen und konnten es nicht erwarten, endlich wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Vorsichtig steuerte Harry Moors das Boot zwischen den stählernen Wracks von vier Kriegsschiffen hindurch, die als bizarre Mahnmale das Hafenbecken säumten. Neun Monate zuvor waren die Schiffe in einer stürmischen Nacht gekentert infolge kolonialistischen Starrsinns und militärischer Unvernunft. Und das kam so:
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hatten sich die Völker Samoas einen blutigen Bruderkrieg geliefert. Dafür brauchten sie Waffen, und diese lieferten ihnen deutsche Handelsleute bereitwillig – im Tausch gegen Grundbesitz, von dem die Samoaner keinen Begriff hatten. Im März 1870 beispielsweise erwarb das Hamburger Handelshaus Godeffroy & Companie auf der Hauptinsel Upolu bei Salefata einskommadrei Quadratkilometer Land samt Kokospalmen und Brotfruchtbäumen und einem kleinen Fluss, der erstklassiges Trinkwasser führte, zum Kaufpreis von einer Snider-Pistole und hundert Schuss Munition – ein umso vorteilhafteres Geschäft, als die Pistole aus der firmeneigenen Waffenschmiede in Belgien stammte. Auf diese und ähnliche Weise erwarb Godeffroy & Companie in wenigen Jahren über hundert Quadratkilometer Land, rund ein Fünftel allen urbaren Bodens auf Upolu. Damit war die Hauptinsel faktisch in deutscher Hand, und die junge Kolonialmacht Deutschland nahm das Inselreich als »Schutzgebiet« in Anspruch. Dagegen wehrten sich sowohl die rivalisierenden samoanischen Chiefs als auch die pazifischen Kolonialmächte USA und Großbritannien. Als Reichskanzler Otto von Bismarck Deutschlands Interessen mittels Entsendung dreier Kriegsschiffe Nachdruck verlieh, schickte auch US-Präsident Grover Cleveland ein Geschwader nach Samoa. So ergab es sich, dass im März 1889, neun Monate vor Ankunft der Stevensons, sechs Kriegsschiffe im Hafen von Apia lagen: die US-amerikanische Dampffregatte Trenton, begleitet von der Korvette Vandalia und dem Kanonenboot Nipsic; auf deutscher Seite die Korvette Olga sowie die Kanonenboote Adler und Eber. Die Welt hielt den Atem an in Erwartung des Funkenschlags, der einen ersten deutsch-amerikanischen Krieg entfachen würde. Mit einigen Tagen Verspätung, am 15. März, traf auch noch die britische Fregatte Calliope ein, um für Queen Victoria Präsenz zu markieren. Da der Hafen schon ziemlich voll war, musste die Calliope weit draußen bei der Einfahrt ankern – eine Demütigung, die sich bald als segensreich erweisen sollte. Denn nun begab es sich, dass an jenem Nachmittag plötzlich das Gekreisch der Seevögel verstummte, und dass der Himmel sich grün verfärbte und alles Vieh an Land sich im Gebüsch verkroch. Die Kapitäne der sieben Kriegsschiffe beobachteten sorgenvoll, wie das Barometer dramatisch rasch in die nie gesehene Tiefe von 29,11 Inches Quecksilber fiel. Sie erkannten übereinstimmend, dass ein gewaltiger Hurrikan im Anzug war und dass es das einzig Vernünftige gewesen wäre, die Fregatten, Korvetten und Kanonenboote auf offener See in Sicherheit zu bringen. Nun brachte es aber US-Admiral Lewis A. Kimberley nicht über sich, den Hafen zu räumen, solange die Deutschen da waren. Den deutschen oberkommandierenden Kapitän Ernst Fritze seinerseits hinderte sein Schwur auf Kaiser und Vaterland, als Erster die Anker zu lichten. In dieser Lage wäre ein klärendes Gespräch hilfreich, ja lebenswichtig gewesen; aber dazu fehlte beiden Seiten erstens der Wille und zweitens die Fähigkeit. Kapitän Fritze war ein zurückhaltender Mensch, der kaum Englisch sprach und deshalb außerstande war, in nähere Beziehung zum US-Kommandanten zu treten. Der Amerikaner seinerseits war des Deutschen zwar ebenso wenig mächtig, empfand aber trotzdem Fritzes Unkenntnis des Englischen als persönliche Herablassung – und so blieben alle sechs deutschen und amerikanischen Schiffe schicksalsergeben im Hafen und erwarteten den Hurrikan in tödlicher Nähe der Korallenriffs. Gegen Abend wurde es unheimlich still. Die See lag wie flüssiges Blei in der Bucht. Die Eingeborenen zogen ihre Boote an Land; sie waren gewarnt, seit vor vielen Stunden Millionen von Kakerlaken und Ameisen schutzsuchend in ihre Hütten gekrabbelt waren. Der Kommandant der britischen Fregatte hatte in letzter Minute ein Einsehen und floh hinaus aufs offene Meer, wo sein Schiff den Sturm unbeschadet überstehen sollte. Über die Deutschen und Amerikaner aber brach in der folgenden Nacht ein Hurrikan herein, der schreckliche Fluten in den nach Norden offenen Hafen schob. Gewaltige Wellen stürzten auf den Strand nieder, Schaum und Gischt peitschten mehrere hundert Meter landeinwärts über die ächzenden Holzhäuser der Kolonisten hinweg. Die Schiffe stemmten sich in der pechschwarzen Nacht gegen die Wassermassen, ihre Dampfmaschinen arbeiteten mit voller Kraft und kämpften gegen die Wellen, um den mörderischen Zug auf die Ankerketten zu mindern – eine Nacht lang, einen Tag, noch eine Nacht. Längst waren alle Lichter ausgegangen, jede Verständigung zwischen den Schiffen unterbrochen; und auch an Bord war sie nicht mehr möglich, da der Orkan die Befehle der Kommandanten ungehört in die Nacht hinaustrug. Dann drang Wasser in die Maschinenräume und löschte das Feuer unter den Kesseln, die Ankerketten rissen, die Schiffe schlugen gegeneinander und gegen das Riff, Schiffsschrauben wurden verbogen und Steuerruder abgerissen, und am Morgen des dritten Sturmtages waren vier Schiffe am Riff zerborsten und zwei an den Strand geworfen. Einundfünfzig amerikanische und hundertfünfzig deutsche Matrosen kamen ums Leben. Die zwei gestrandeten Schiffe – die deutsche Olga und die amerikanische Nipsic – wurden zwei Wochen später zurück ins Wasser geschleppt und kamen wieder flott. Die vier anderen blieben liegen und sollten noch Jahrzehnte später das Hafenbecken versperren.2 In Deutschland und den USA war der Schrecken über die Katastrophe derart groß, dass alle Kriegspläne beigelegt und die Inseln Samoas zur neutralen Zone erklärt wurden.
An jenem 7. Dezember 1889 war das ganze Städtchen auf den Beinen, um die Equator und die Neuankömmlinge zu begrüßen. Louis, Lloyd und Fanny machten einen ersten Spaziergang durch den Ort und ließen sich begutachten vom bunten menschlichen Strandgut, das die Straße und die Bars bevölkerte. Etwa dreihundert Weiße lebten in Samoa. Einige Dutzend waren Kaufleute im Dienst der Deutschen Gesellschaft; die erkannte man an ihren tadellos weißen Anzügen, den glattrasierten Wangen und den sorgfältig gewienerten Schnurrbärten. Einen scharfen Gegensatz zu ihnen bildeten die meisten anderen Ansiedler, die unrasiert waren, sich so bequem als möglich in verschossene Schlafanzüge kleideten und irgendwie ein Auskommen fanden als Gastwirte, kleine Pflanzer oder als Händler, die bei den Eingeborenen Kokosnüsse kauften und sie an die Deutsche Gesellschaft weiterverkauften. Wie in jedem Südseehafen schließlich gab es auch in Apia ein paar Dutzend Beachcombers: desertierte Matrosen, konkursite Händler, gescheiterte Künstler, entflohene Häftlinge und verkrachte Aristokraten aus aller Herren Länder, die hier gestrandet waren und ihre Tage und Nächte unter selbstgebastelten Palmenblattdächern verbrachten, sich von den wilden Früchten des Dschungels nährten und gelegentlich ein paar Stunden auf einer Plantage arbeiteten, wenn anderswie durchaus kein Schnaps zu beschaffen war.
Unter all diesen Menschen stand unauffällig ein Mann in einem maßvoll ungepflegten schwarzen Anzug, den es zu beachten gilt: der presbyterianische Missionar William Edward Clarke. Noch hielt er sich im Hintergrund, aber binnen dreier Wochen sollte er zu Louis’ bestem Freund auf Erden werden. William Clarke war von der London Missionary Society beauftragt, Kirchen und Schulen für die Samoaner zu errichten und nebenbei für das Seelenheil der europäischen Bevölkerung zu sorgen. Er war erst fünfunddreißig Jahre alt, aber sein graumelierter Bart, der ihm spitz auf der Brust auslief, ließ ihn viel älter erscheinen. Vor sieben Jahren war er in Apia an Land gegangen, zusammen mit seiner jungen Gattin Ellen, die er drei Wochen vor der Abreise im heimatlichen St. Columb, Cornwall, geheiratet hatte. Clarke hatte sich rasch in Samoa zu Hause gefühlt, nicht aber seine Ellen. Sie litt unter dem mörderischen Tropenklima, vermisste Familie und Freunde, entbehrte die Annehmlichkeiten britischer Zivilisation. Nach nur zwei Jahren quittierte er den Dienst und kehrte mit seiner Gattin nach Cornwall zurück. Schon bald aber zog es ihn unwiderstehlich zurück nach Samoa. Warum, weiß man nicht. Sei es, dass er die sinnenfeindliche Förmlichkeit seiner Heimat nicht mehr ertrug oder dass ihn eine Idee, ein Ziel, ein Plan rief – jedenfalls gingen William und Ellen Clarke schon ein Jahr später, am 17. Juli 1887, wieder in Apia an Land.
Clarke sollte sich noch viele Jahre später an jene erste Begegnung mit Louis erinnern. »Es kam mir eine kleine Gruppe von drei fremden Europäern entgegen, zwei Männer und eine Frau. Sie trug ein weites Eingeborenenkleid, ein glänzendes Plaidtuch um die Schultern und auf dem Kopf einen Strohhut von den Gilbert-Inseln, der mit einem Kranz kleiner Muscheln geschmückt war. Um den Hals trug sie eine Kette aus scharlachroten Beeren, auf dem Rücken eine Mandoline. Ihr Haar war rabenschwarz, ihr Gesicht sonnengebräunt. An ihren Ohren hingen halbmondförmige, goldene Ohrringe, und ihre nackten Füße steckten in weißen Baumwollschuhen. Im Mittelpunkt der Gruppe stand ein großgewachsener, hagerer Mann in Hemdsärmeln, der einen braunen Samtmantel über die Schulter geworfen hatte. Er trug eine weiße Segelmütze und weiße Flanellhosen, die einmal sauber gewesen sein mochten. In seinem Mund steckte eine Zigarette, an seiner Hand baumelte eine Kamera mit Tragriemen. Zu seiner Linken ging ein jüngerer Mann. Dieser trug einen gestreiften Schlafanzug – das ist die gängige Freizeitkleidung der meisten europäischen Handelsleute in der Südsee – sowie einen breitkrempigen Strohhut und eine dunkelblaue Sonnenbrille. In der einen Hand trug er ein Banjo, in der anderen eine Ziehharmonika. Die drei waren offensichtlich gerade von Bord jenes kleinen Schoners gegangen, der jetzt so friedlich vor Anker lag. Mein erster Eindruck war, dass es sich um fahrende Varietékünstler auf dem Weg nach Australien oder den USA handelte, die mangels Geld auf einem billigen Handelsschiff reisten.«
Zu jener Zeit gab es in Apia nur ein Hotel, das »Tivoli«, und das war nicht sehr sauber. Harry Moors lud die Stevensons ein, fürs Erste bei ihm zu wohnen. Glaubt man seinen Memoiren, war er auf den ersten Blick von Louis begeistert: »Er war kein schöner Mann, aber seine Erscheinung hatte etwas unwiderstehlich Attraktives. Es war, als ob das Genie, das in ihm steckte, aus seinem Gesicht leuchtete, und ich war hingerissen von seinen lebhaften, neugierigen Augen. Sie waren braun und seltsam leuchtend, und sie schienen einen zu durchdringen wie die Augen eines Hypnotiseurs. Dass es um seine Gesundheit nicht zum Besten stand, sah ich auf den ersten Blick, denn es war ihm ins Gesicht geschrieben. Er kam mir sehr nervös vor, angespannt und leicht erregbar. Als ich ihn an Land brachte, sah er geschwächt aus; aber wir hatten kaum die Straße erreicht – Apia besteht sozusagen nur aus einer Straße –, da begann er schon hin und her zu laufen auf die lebendigste, um nicht zu sagen exzentrischste Weise. Still stehen konnte er nicht. Kaum bei mir zu Hause angekommen, löcherte er mich mit Fragen, ging ruhelos auf und ab und sprach von allen möglichen Themen ohne jeden Zusammenhang. Seine Frau war genauso zappelig, und Lloyd Osbourne kaum weniger. Die lange, einsame Schiffsreise hatte ihnen wohl stark zugesetzt, und sie waren selig, wieder an Land zu sein.«
Am nächsten Tag ging Louis zu Moors, lieh sich von ihm ein Pferd aus und begann pflichtbewusst mit den Recherchen für seine Reportage. Er wartete eine Regenpause zwischen zwei Wolkenbrüchen ab und preschte über die verschlammte Hauptstraße ans östliche Ende der Bucht, um Colonel de Coëtlogon, den englischen Konsul, zur jüngsten kriegerischen Vergangenheit Samoas zu interviewen. Dann galoppierte er zurück zu Moors’ Haus, um das Gespräch schriftlich festzuhalten; schwang sich erneut in den Sattel, um mit dem samoanischen Häuptling Mataafa zu reden; eilte zurück an den Schreibtisch und schrieb alles auf; ritt abermals im gestreckten Galopp in den Osten der Stadt, zum deutschen Generalkonsul Becker; und wieder zurück an den Schreibtisch, und dann zum US-Konsul Harold M. Sewall. Eine Woche lang war Louis unermüdlich unterwegs – hin und her, hin und her auf der einzigen Straße.
»Vorgestern wurde ich mitten auf der Straße angehalten und mit einer Buße wegen zu schnellen Reitens belegt. Ich gestehe, dass mich das recht erbittert hat; denn die Ehefrau des Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft hat mich schon zwei Mal beinahe über den Haufen geritten – und dieser Dame sagt anscheinend kein Mensch ein Wort.«
So vergingen die Tage. Auch an Weihnachten war die Lage noch unverändert. Louis vertiefte sich in die Geschichte Samoas, ohne aber für die Insel eine besondere Zuneigung zu fassen; und nichts deutete darauf hin, dass sich die Stevensons schon zwei Wochen später fürs ganze Leben auf Samoa niederlassen würden. Am 29. Dezember schrieb Louis einem Studienfreund, dem Edinburgher Rechtsanwalt Charles Baxter: »Samoa, Apia zumindest, ist längst nicht so schön wie die Marquesas oder Tahiti: Die Landschaft ist viel einförmiger, die Hügel sind sanfter, die Natur zahmer; hinzu kommen die großen deutschen Plantagen mit ihren zahllosen, gleichförmigen Palmenalleen, die andrerseits das Wandern natürlich angenehm machen. Die Samoaner finde ich nicht besonders anziehend, aber höflich, und die Frauen sind sehr hübsch und gut gekleidet. Die Männer sind gut gebaut, groß, schlank und würdevoll. Morgen, Montag – welches Datum das ist, will ich nicht beschwören, aber heute ist der Sonntag zwischen Weihnachten und Silvester – morgen, Montag also, gehe ich mit Mr. Clarke in einem Boot auf Entdeckungsreise die Küste entlang. Wir werden Schulen besichtigen, Tamasese3 besuchen und so weiter. Lloyd kommt als Fotograf mit. Hoffentlich ist das Wetter gut. Wir stecken mitten in der Regenzeit, und die Reise wird vier oder fünf Tage dauern. Wenn der Regen ausbleibt, wird mir das eine willkommene Abwechslung sein. Wenn’s regnet, wird’s scheußlich. Diese Zeilen schreibe ich auf Moors’ Balkon. Gerade jetzt kommt eine Brise auf. Die Türen fallen ins Schloss, und die Fensterläden fangen an zu klappern. Ein starker Luftzug streift um den Balkon. Das sieht nicht gut aus für morgen.«
Das ist nun interessant. In jenen Weihnachtstagen haben sich also der Missionar William Clarke und Robert Louis Stevenson gleich derart miteinander befreundet, dass sie zusammen auf Entdeckungsreise gingen. Über dieses Zusammentreffen der beiden Männer wüsste man gern Genaueres – denn in jenen Tagen war es, da Louis beschloss, sich für immer auf Samoa niederzulassen; ein sonderbarer Entschluss, auf den zuvor nichts hingedeutet hatte. Weshalb fand er, der sich in jungen Jahren dem Atheismus zugewandt hatte, ausgerechnet an einem bärtigen Missionar auf Samoa Gefallen? Was waren Anlass und Ziel des Ausflugs, und wie lange dauerte er? Und welcher Art waren die Entdeckungen, die man zu machen hoffte, und was entdeckten die zwei Freunde auf dieser Reise tatsächlich?
Leider hat Missionar Clarke in seinem Jahresbericht an die Londoner Zentrale den Ausflug mit keinem Wort erwähnt. Auch unter Lloyds Fotografien findet sich keine aus jenen Tagen. So bleiben als einzige Quelle Louis’ handschriftliche Notizen, denen zufolge die Entdeckungsreise ein paar Dutzend Meilen ostwärts der Nordküste Upolus entlangführte, man tatsächlich Schulen besichtigte und Tamasese besuchte »und so weiter«. Nur kurz erwähnt wird dabei eine zweite Reise, die Louis offenbar wenig später ohne Clarke unternahm. Von ihr weiß man einzig, dass sie vorerst in die entgegengesetzte Richtung führte, nach der dreißig Kilometer entfernten Westspitze Upolus. Schwer zu sagen, welches Ziel er ansteuerte. Im Westen der Insel laufen die vulkanischen Bergzüge aus in eine freundliche Hügellandschaft, auf der die Deutsche Handelsgesellschaft über viele Quadratkilometer Kokosplantagen angelegt hatte. Viel zu entdecken gab es da nicht. Gut möglich, dass er die Küste Samoas hinter sich ließ und am Westkap Kurs nach Süden nahm und dass er dort die eine oder andere verschwiegene Insel besuchte. Und Tatsache ist, dass Louis unmittelbar nach diesem Ausflug kurz entschlossen sein gesamtes verfügbares Vermögen in den Kauf eines undurchdringlichen Stücks Dschungel investierte.
Anmerkungen und Zitatnachweise zum Kapitel 1
2
Ein wahrhaft fürstlicher Ort
Spätestens am 20. Januar 1890 war Louis wieder zurück in Apia. An jenem Tag schrieb er seinem schottischen Leibarzt Thomas Bodley Scott einen Brief, der allem widersprach, was er zuvor über Samoa gesagt hatte: »Dieses Klima gefällt mir derart, dass ich beschlossen habe, mich hier niederzulassen. Ich habe sogar dreihundert oder vierhundert Acres Land gekauft; wieviel es genau ist, werde ich erst wissen, wenn alles exakt vermessen ist. Nächsten Sommer werde ich nur kurz nach England zurückkehren, um meine Angelegenheiten zu regeln.«4
Damit, so scheint es, ist das Rätsel gelöst. Das Klima also war’s. Es war das angenehme Wetter, das Louis derart für Samoa einnahm, dass er für immer bleiben wollte. Das ist schon sehr erstaunlich. Denn auch in jenem Januar 1890 war die Regenzeit in Samoa gekennzeichnet durch lähmende Hitze und sintflutartige Regenfälle sowie häufige Sturmwinde und extrem hohe Luftfeuchtigkeit.5 Falls Louis die tropische Regenzeit tatsächlich angenehm fand, bewies er damit einen sehr extravaganten Geschmack, den nicht viele teilten. Der britische Vizekonsul etwa schrieb in seinem Jahresbericht 1895: »Das Klima erlaubt es keinem Europäer, regelmäßig im Freien zu arbeiten und bei guter Gesundheit zu bleiben. Manche behaupten es zwar, aber wer das Land kennt, weiß es besser.« Und bei anderen Gelegenheiten bekannte Stevenson freimütig, dass er kein Liebhaber des Monsunregens sei. Genau ein Jahr später – die Regenzeit war wiederum auf ihrem Höhepunkt – schrieb er Colvin: »Meine Frau ist vor Ohrenschmerzen fast wahnsinnig; der Regen fällt in weißen Kristallfäden auf uns nieder und spielt ein Höllenkonzert auf unserem Blechdach, wie ein Tutti von prügelnden Holzpflöcken; der Wind murmelt dumpf über unseren Köpfen, oder er schlägt voll auf uns ein, sodass die großen Bäume über der Pferdekoppel laut aufschreien und die Hände ringen und drohend ihre weiten Arme recken. Die Pferde stehen im Stall wie dumme Gegenstände, die Schiffe in der Bucht verschwinden im Regen, und so geht das den ganzen Tag; ich sperre meine Papiere in die eiserne Kiste für den Fall, dass ein Hurrikan kommt und das Haus wegreißt. Wir gehen mit sehr gemischten Gefühlen zu Bett; es ist viel schlimmer als an Bord eines Schiffes, wo man nur eine Gefahr vor sich hat, nämlich jene des Ertrinkens; denn hier regnet es Gebälk und Wellblech auf einen nieder, und man rennt blind im Dunkeln durch einen Wirbelwind und sucht Unterschlupf in einem unfertigen Stall – und meine Frau mit Ohrenschmerzen! Ich habe stets das Geräusch des Windes mehr als alles andere gefürchtet. In meiner Hölle würde immer ein Sturm blasen.«
Ende Januar 1890 war der Handel abgeschlossen. Das Grundstück, das Louis einem erblindeten schottischen Hufschmied abkaufte, lag drei Meilen südlich von Apia, am Fuß der höchsten vulkanischen Gipfel. Es war gänzlich überwachsen von undurchdringlichem Dschungel, und Louis bezahlte dafür viertausend Dollar – mehr hatte er nicht. Wie er die Kosten für den Bau eines Wohnhauses aufbringen sollte, wusste er nicht. Sorgenvoll überschlug er, dass er in diesem Dschungel sehr schnell mindestens zwei oder drei sehr erfolgreiche Bücher würde schreiben müssen.