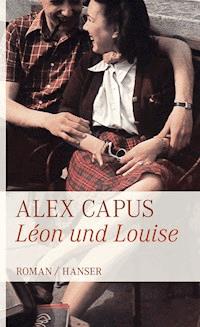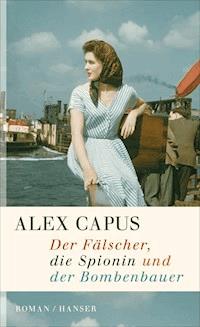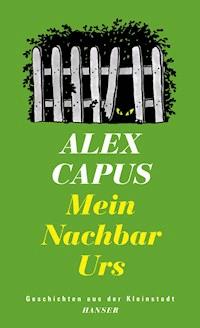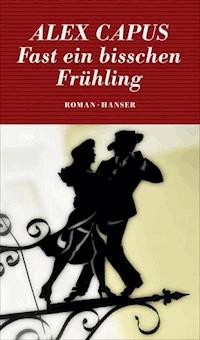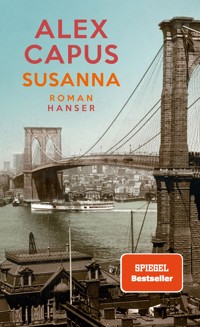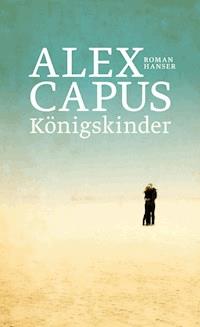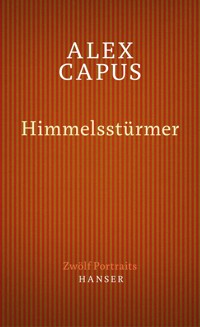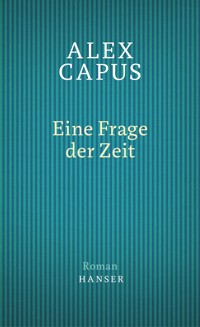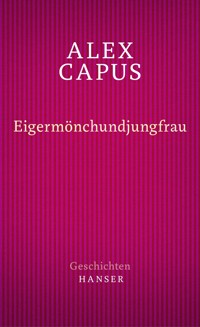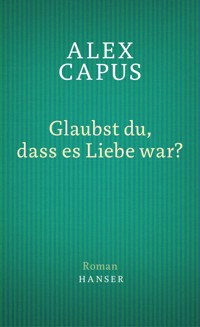Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Namen wie Maggi, Nestlé, Bally, Le Coultre oder Lindt sind jedem bekannt – aber wie sahen eigentlich die Anfänge dieser Firmen aus? Wie erfand Julius Maggi den Suppenwürfel? Was trieb Rudolf Lindt an, die beste Schokolade der Welt herzustellen? Alex Capus erzählt von Männern mit großen Ideen, Mut und Glück. Anschaulich und humorvoll zeichnet er den oft überraschenden Lebensweg von zehn Pionieren nach, deren Erfindungen die Welt veränderten und unser Leben nachhaltig prägten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Namen wie Maggi, Nestlé, Bally, Le Coultre oder Lindt sind jedem bekannt — aber wie sahen eigentlich die Anfänge dieser Firmen aus? Wie erfand Julius Maggi den Suppenwürfel? Was trieb Rudolf Lindt an, die beste Schokolade der Welt herzustellen? Alex Capus erzählt von Männern mit großen Ideen, Mut und Glück. Anschaulich und humorvoll zeichnet er den oft überraschenden Lebensweg von zehn Pionieren nach, deren Erfindungen die Welt veränderten und unser Leben nachhaltig prägten.
Das Rezept für einen Bouillon-Extrakt, Ende 1886 von Julius Maggi notiert, ist bis heute streng geheim und als Maggi-Würze legendär. Alex Capus folgt dem Mühlenbetreiber von ersten Experimenten über die unermüdliche Arbeit als Firmengründer bis zu seinem frühen Tod in den Armen einer schönen Pariserin. Er stellt den Dandy Rudolf Lindt vor, der Eindruck bei Damen der Gesellschaft schinden wollte und ganz nebenbei die weltberühmte Schokolade erfand, und schildert, wie Henri Nestlé 1867 das Milchpulver zuliebe seiner Frau entwickelte. Mit leichter Hand lässt Alex Capus zehn beeindruckende Persönlichkeiten in kurzen Geschichten lebendig werden und erschafft dabei das einprägsame Panorama einer Epoche, in der Erfindergeist, Neugierde und Tatendrang über alles triumphierten.
Alex Capus
Patriarchen
Über Bally, Lindt, Nestlé und andere Pioniere
Carl Hanser Verlag
Buchübersicht
Vorwort
Rudolf Lindt
Wie der schöne Berner Patriziersohn Rudolf Lindt übers Wochenende mit Kakao hantierte, um bei den jungen Damen Eindruck zu schinden, und wie er dabei versehentlich die beste Schokolade der Welt erfand.
Carl Franz Bally
Wie Carl Franz Bally in Paris seiner Frau gleich zwölf Paar schicke Stiefelchen kaufte, weil er ihre Schuhgröße vergessen hatte, und wie er nach der Heimkehr die größte Schuhfabrik der Welt begründete.
Julius Maggi
Wie der Italiener Michele Maggi in der Schweiz stolzer Besitzer einer Müllerei wurde und wie dessen Sohn Julius mit dem Maggi-Würfel die Essgewohnheiten der Menschheit revolutionierte.
Antoine Le Coultre
Wie der eigenbrötlerische Uhrmacher Antoine Le Coultre im Waadtländer Jura die schönsten und präzisesten Zahnräder herstellte und wie dank ihm die Schweizer Uhrenindustrie ihren Aufstieg nahm.
Henri Nestlé
Wie die kinderlose Apothekergattin Clementine Nestlé eine übersteigerte Zuneigung zu den schlecht ernährten Proletarierkindern fasste und wie Ehemann Henri Nestlé ihr zuliebe das Milchpulver erfand.
Johann Jacob Leu
Wie das zwinglianisch-strenggläubige Zürich im Geldreichtum zu ersticken drohte und wie Säckelmeister Johann Jacob Leu das Problem löste, indem er die erste moderne Bank der Schweiz begründete.
Fritz Hoffmann-La Roche
Wie der Basler Apotheker Fritz Hoffmann-La Roche einen gänzlich wirkungslosen, aber wohlschmeckenden Hustensaft erfand und wie daraus der größte Pharmakonzern der Welt entstand.
Charles Brown und Walter Boveri
Wie Charles Brown und Walter Boveri das elektrische Licht in die Welt hinaustrugen und wie die Freundschaft zwischen dem Genie und dem Kaufmann nach zwanzig Jahren in die Brüche ging.
Walter Gerber
Wie der Käsehändler Walter Gerber dem Schweizer Käse die Tropenkrankheit auszutreiben versuchte und wie ihm der schlaue Amerikaner James Louis Kraft das Produktionsgeheimnis des Schmelzkäses entriss.
Emil Bührle
Wie der empfindsame Kunststudent Emil Bührle sich im Weltkrieg zum harten und unnahbaren Mann wandelte und wie er nach dem Friedensschluss von Versailles zu Hitlers tüchtigstem Waffenschmied wurde.
Anhang
Vorwort
Meine Mutter war Grundschullehrerin — eine tüchtige, fleißige und strenge Schulmeisterin, die ihre Schüler nach Kräften förderte und viel von ihnen forderte. In den Jahren, da ich selbst Grundschüler war, geschah es oft, dass ich eine Stunde oder zwei vor ihr Schulschluss hatte. Dann saß ich in ihrem Klassenzimmer ganz hinten in einer leeren Bank, las Lederstrumpf und Winnetou und wartete, bis wir zusammen heimgehen konnten. Sie war damals eine temperamentvolle junge Frau, die ihren Schülern gern aus dem Stegreif Geschichten erzählte und sie zum Lachen brachte. Sie hatte eine Schwäche für die Schwachen; ihre Lieblingsschüler waren oft jene, denen die Siebnerreihe beim besten Willen nicht in den Schädel wollte. Gegenüber den Vorlauten und Frechen aber verlor sie rasch die Geduld und konnte ziemlich laut werden; warfen die Jungs aus der hintersten Reihe Papierkügelchen, so erwiderte sie das Feuer mit Schwämmen und Kreidestücken.
Wenn sie «meine Kinder» sagte, meinte sie nicht meinen Bruder und mich, sondern ihre Schüler. Ich bin mir sicher, dass sie «ihre Kinder» liebte und glücklich war, ihnen Lesen und Schreiben beizubringen. Ob sie aber auch ihren Beruf liebte — ob sie wirklich mit Leib und Seele Lehrerin war —, bezweifle ich. Ich neige eher zu der Annahme, dass das aufgeweckte Landmädchen, das sie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war, letztlich keine andere Wahl hatte, als Lehrerin zu werden. Gewiss hat sie das Schulamt freiwillig angetreten, und bestimmt hat niemand sie zu den vierzig Dienstjahren gezwungen, die sie mit soldatischer Disziplin absolvierte. Aber eines weiß ich ebenso sicher: Wirklich bei sich selbst war sie während der ganzen Zeit ihres Erwerbslebens nie. Bei sich selbst war sie nicht als Lehrerin, auch nicht als Ehefrau und nicht als Mutter — sondern als Musikerin. Meine Mutter war und ist eine große Musikerin. Nie habe ich sie so konzentriert, so stark und selbstbewusst erlebt wie zu Hause am Klavier oder in der Kirche an der Orgel. Sie spielt Bach und Haydn mit großer Autorität, stolz und unduldsam gegenüber den eigenen, seltenen Schwächen. Und wenn sie ans Ende gelangt und den Tastaturdeckel schließt, ist sie stets froh und entspannt wie sonst nie. Ich bin mir sicher, dass sie eine gefeierte Pianistin hätte werden können, die Konzerte auf allen fünf Kontinenten gab. Dass es nicht so weit kam, lag an den Irrungen und Wirrungen des Lebens — an ihrer Herkunft und einem Mangel an Mut, der häufig den Begabtesten eigen ist; es lag an der Liebe und den Früchten, die diese tragen sollte, und es lag am Brotpreis und an der Wohnungsnot und der unerfreulichen Tatsache, dass man Geld braucht, wenn man leben will; vielleicht lag es auch am Zeitgeist ihrer jungen Jahre, dessen Helden weder Bach noch Haydn, sondern Elvis Presley, Roger Vadim und Brigitte Bardot waren; möglicherweise lag es sogar ein wenig an jenem schwarzen Renault Heck, den sie sich von ihrem Lehrerinnenlohn kaufte und der ihr zu zahlreichen kleinen Fluchten verhalf. Was weiß ich. Jedenfalls lebte und lebt sie ihr Leben in Würde; und nirgends steht geschrieben, dass es ein glücklicheres, erfüllteres Leben gewesen wäre, wenn sie ihrer wahren Bestimmung hätte folgen können.
Ich bin mir nicht sicher, ob jeder Mensch seine Bestimmung hat, und noch weniger, ob es wirklich wünschenswert ist, dass jedermann — also auch jedes Scheusal — dieser auch folgt. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, deren Existenz sich an einem großen Gedanken, an einer Idee kristallisiert — und die dann alles daransetzen, beispielsweise die Sklaverei in Afrika abzuschaffen, die Welt in ihrer Ganzheit zu vermessen oder den Kosmos in seinen tiefsten Tiefen zu erfassen. Oder Damenstrümpfe ohne Laufmaschen zu erfinden. Solche Menschen sollte man nicht heiraten, denn sie lassen unter keinen Umständen von ihrem Ziel ab und fordern von sich selbst und ihren Nächsten große Opfer. Aber bewundern darf man sie — die Wunderkinder genauso wie die weniger Begabten, die den Fallstricken des Lebens trotzen und irgendwann den Mut zur großen, unerhörten Tat aufbringen. Es ist lehrreich und tröstlich, am Leben von Menschen teilzuhaben, die zumindest zeitweise ganz bei sich selbst sind. Und weil die unerhörte Tat der Kern jeder guten Geschichte ist, kann ich mir kein größeres Vergnügen vorstellen, als rückblickend nach deren Ursprung zu forschen.
Wie kam der Apotheker Henri Nestlé dazu, sein Milchpulver zu erfinden? Was bewog den Hosenträgerfabrikanten Carl Franz Bally, im ländlich abgeschiedenen Schönenwerd die erste und größte Schuhfabrik der Welt zu gründen? Weshalb erfand Julius Maggi den Suppenwürfel? In welchem Augenblick sprang bei Rudolf Lindt der zündende Funke? Wann und wo kristallisierte sich bei Fritz Hoffmann-La Roche die Idee heraus, aus der ein internationaler Konzern entstand?
Es sind zehn Patriarchen, die ich hier portraitiere. Jeder von ihnen hatte eine Idee, jeder hat eine Entdeckung gemacht, dank der er vom Pionier zum weltweit erfolgreichen Unternehmer wurde. Ich habe sie ausgewählt nach zahlreichen Kriterien, die alle gänzlich meiner Willkür unterworfen waren. Genauso gut hätte ich mich für zehn andere oder nochmal für zehn andere Namen entscheiden können, habe diese auch ernsthaft erwogen, dann jedoch aus unterschiedlichen Gründen verworfen. Trotz allem Suchen aber fand sich nie der Name einer Frau. Es waren, soweit ich es überblicke, immer Männer, und fast immer Männer des 19. Jahrhunderts, welche die Flaggschiffe der heutigen Ökonomie vom Stapel ließen. Die Gründerzeit war eine ausgesprochen patriarchalische Epoche, die den Frauen ökonomisch nur zwei mögliche Rollen zudachte — jene der proletarischen Arbeitssklavin oder die der gutbürgerlichen Braut mit opulenter Mitgift. Tatsächlich wäre die Mehrheit der hier vorgestellten Unternehmen ohne das Geld der Schwiegerväter kaum über die Gründungsphase hinaus gediehen; und was die übrigen vier Patriarchen betrifft, so waren sie auf das Geld der Ehefrauen nicht angewiesen, weil sie selber welches besaßen. Die klassische Tellerwäscherkarriere, so scheint es, führte im alten Europa nur selten bis ganz an die Spitze der ökonomischen Nahrungspyramide.
Vergleicht man die zehn Männer miteinander, so fallen einem viele Gemeinsamkeiten ins Auge: Alle verfügten sie über unglaublichen Schaffensdrang, Originalität des Denkens, unternehmerischen und politischen Weitblick sowie den unbedingten Willen, ihre Ziele durchzusetzen — wenn nötig, auch skrupellos und ohne Rücksicht. Viele waren Einwanderer, manche in erster, viele in dritter oder vierter Generation; gut möglich, dass das Gefühl der Fremdheit einem eigenständigen Lebensweg förderlich war. Sie umsorgten ihre Arbeiter mit paternalistischer Güte, bekämpften aber die Gewerkschaften bis aufs Messer; darin waren sie Söhne ihrer Zeit. Die meisten entwickelten mit zunehmendem Wohlstand Sinn für die angenehmen Seiten des Lebens und die schönen Künste. Jeder Einzelne von ihnen aber war unablässig getrieben von seiner Idee, die er rastlos weiterverfolgte, tagsüber im Büro und nachts in seiner Tüftelbude. Gemeinsam ist den zehn Patriarchen auch, dass sich ihre Schaffenskraft irgendwann zwischen dem fünfzigsten und sechzigsten Lebensjahr erschöpfte. Dann entglitt den befehlsgewohnten Männern ihr zu groß gewordenes Lebenswerk, worauf sie schwermütig wurden und viel zu jung starben. Nur einer von ihnen — der Protestant und Bankier Johann Jacob Leu — trieb sein Werk mit demütigem Arbeitsethos weiter bis ins hohe Alter. Und nur einer — der Katholik Henri Nestlé — verkaufte die Firma frohen Mutes rechtzeitig, um den Lebensabend als schwerreicher Mann am Genfersee in lichtdurchfluteten Villen und sechsspännigen Kutschen zu genießen.
Eine letzte Gemeinsamkeit teilen viele Patriarchen über den Tod hinaus, nämlich die Buddenbrooks-Karriere ihrer Nachfolger. Oft traten die Söhne in die großen Fußstapfen des Gründers, um das Werk fortzuführen und zu erweitern. Ihnen folgten die Enkel, die dank der wohl gefüllten Vorratskammern noch einigermaßen über die Runden kamen. Dann verweigerten die Urenkel die Nachfolge, weshalb die Schwiegersöhne auf den Plan traten und das Unternehmen aus Eigennutz an die Manager verkauften — was allerdings, das muss man zugeben, nicht immer zum Nachteil der Firma geschah.
Ob auch heute eine Gründerzeit ist, in der aus kühnen Ideen große Taten werden können — ich weiß es nicht. Das zu beurteilen ist wohl nur in der Rückschau möglich, denn gute Geschichten müssen vergangen sein, wie Thomas Mann im Zauberberg schreibt. Je vergangener, desto besser.
Paris, 21. Januar 2006
Rudolf Lindt
© Chocoladefabriken Lindt&Sprüngli AG
Vermutlich wollte Rudolf Lindt nur ein wenig Schokolade machen, um bei der «Jeunesse dorée» Eindruck zu schinden. Er war ein Dandy, ein hübscher und verwöhnter Sohn vornehmer Berner Bürger und alles andere als ein Kaufmann oder Techniker. Nie hätte der stockkonservative Jüngling sich träumen lassen, dass er mit einem revolutionären Verfahren die beste Schokolade der Welt herstellen würde. Die Konkurrenz lächelte, als er im Sommer 1879 im Berner Mattenquartier zwei brandbeschädigte Fabriken kaufte und dort eine alte Reibmaschine und einen Zylinderröster aufstellte, um nach alter Väter Sitte Kakaofett aus den Bohnen zu pressen, den Rest zu Pulver zu vermahlen und beides unter Beigabe von Zucker zu einer zähen Paste zu verrühren, die man schließlich unter großem Kraftaufwand in Tafelformen presste. Das Resultat war das damals übliche und nach heutigen Maßstäben ungenießbar — eine bittersüße, bröckelige Masse, die im Mund nicht schmolz, sondern sandig zerbröselte.
Die vornehmen Häuser Europas kannten die Kakaobohne, seit der spanische Eroberer Hernando Cortez sie 1528 aus Mexiko mitgebracht hatte. Während in Wien, Paris und Madrid schicke Schokoladestuben entstanden, in denen die feine Gesellschaft an ihrer heißen Schokolade nippte und dazu erlesenes Gebäck knabberte, sorgten in der Schweiz französische und italienische Wanderarbeiter für die Verbreitung des Kakaos. Die fliegenden Cioccolattieri und Chocolatiers zerstießen die Bohnen im Mörser, gaben groben braunen Zucker bei und formten das Gemisch zu einer Wurst, die sie in Scheiben schnitten und auf den Jahrmärkten für ziemlich teures Geld verkauften.
Dieses schlichte Handwerk verschwand, als François-Louis Cailler 1819 in Vevey eine erste, mit Wasserkraft betriebene Schokoladenfabrik gründete, um bessere und billigere Schokolade in großen Mengen herzustellen. 1826 folgte Philipp Suchard in Neuenburg, der die Industrialisierung weiter vorantrieb, dann Kohler 1830 in Lausanne, Sprüngli 1845 in Zürich und Klaus 1856 in Le Locle. Sie alle tüftelten und probten, verfeinerten den bittersüßen Geschmack mit Vanille, Honig oder Rosenwasser und gaben zusätzliches Kakaofett bei, damit die bröckelige Substanz sich zwischen den Zähnen nicht mehr wie trockene Haferflocken anfühlte. Die Erfolge waren beachtlich; Schweizer Schokolade wurde zarter, süßer und feiner und gewann auf internationalen Messen zahlreiche Preise. Als schließlich 1875 Daniel Peter die Milchschokolade erfand, indem er Kondensmilch zur Kakaomischung hinzufügte, hatten die Schweizer Chocolatiers ihren Spitzenplatz auf dem Weltmarkt erobert.
Der Markt war gesättigt und die Konkurrenz groß, als 1879 der vierundzwanzigjährige Rudolf Lindt auf den Plan trat. Er war der älteste Spross einer angesehenen Bernburger Apotheker- und Ärztefamilie, deren Stammvater 1768 aus Hessen eingewandert war. Wer ihn kannte, beschrieb ihn als schönen und feinsinnigen, aber auch hochfahrenden und starrköpfigen jungen Mann. Dass Rudolf Lindt sich in der Jugend als brillanter Student, fleißiger Arbeiter oder furchtloser Abenteurer hervorgetan hätte, ist nicht bekannt. Verbürgt ist lediglich, dass er eine Vorliebe für die Jagd und die schönen Künste hatte und dass er als Achtzehnjähriger zwei Lehrjahre in der Schokoladenfabrik seines Onkels Charles Kohler in Lausanne verbrachte, der ihm zum Abschied dreihundert Franken schenkte. Ob aber Kohler dem Neffen das Geld in Anerkennung der geleisteten Dienste gab oder nur froh war, ihn los zu sein, weiß niemand. Jedenfalls erscheint es kaum vorstellbar, dass der Patriziersohn mit der weißen Stirn, den mädchenhaft vollen Lippen und den hellblauen Augen sich tatsächlich zwei Jahre lang klaglos dem harten Fabrikalltag unterzog.
Um seinem Namen einen weltläufigeren Klang zu geben, nannte der junge Fabrikant sich nicht mehr Rudolf — oder Rüedu, wie man ihn in Bern wohl rief —, sondern «Rodolphe Lindt fils». Das edle Etikett stand in scharfem Kontrast zur schäbigen Fabrik an der Aare, und leider war in den Anfängen auch Lindts Schokolade nicht dazu angetan, die Berner «jeunes filles de famille» in Aufregung zu versetzen. Die altmodische Röstmaschine gab zu wenig Hitze ab, weshalb die Bohnen nicht recht austrockneten und in der Mühle zu einer schmierigen Masse wurden. Presste man diese in Formen, dauerte es ewig, bis sie trocknete — und dann überzog sich das Ganze schon bald mit einem grauen Belag, der stark an Schimmel erinnerte. Rodolphe Lindt war ratlos.
Dass ihm das schimmelige Phänomen derart unerklärlich war, lässt auf eine eher flüchtige Ausbildung in der Fabrik des Onkels schließen. Denn damals wie heute wusste jeder Konditorlehrling, dass es sich bei dem grauen Zeug um so genannten Fettreif handelte — also nicht um Schimmel, sondern um abgesondertes Fett. Das war zwar ungefährlich, aber unschön anzuschauen und dem Verkauf in höchstem Grade abträglich. In der Not rief Rodolphe seinen Vater herbei, der ihm als Apotheker die Herkunft des Fettreifs erklären konnte. Er riet, das Fett durch verlängertes Rühren im Längsreiber besser mit den übrigen Zutaten zu binden.
Das tat Rodolphe denn auch.
Was dann geschah, ist von Legenden umrankt und nicht mehr zu klären. Manche behaupten, Lindt habe monatelang getüftelt, bis er die Lösung fand; andere sagen, er habe an einem Freitag einfach seine vom Wasserrad betriebene Rührmaschine abzustellen vergessen, bevor er zur Jagd oder einem galanten Abenteuer aufbrach, weshalb die Schokoladenmasse drei Tage und drei Nächte lang ununterbrochen gerührt worden sei. Wie auch immer: Als Rodolphe am Montagmorgen in die Fabrik zurückkehrte, fand er in seinem Bottich eine dunkelsamten glänzende Masse vor, die mit herkömmlicher Schokolade keinerlei Ähnlichkeit mehr hatte. Diese Schokolade musste nicht mühevoll in die Formen hineingepresst werden, sondern ließ sich ganz leicht gießen. Und wenn man sie in den Mund nahm, zerstob sie nicht zu Sand, sondern zerging auf der Zunge und entfaltete eine nie gekannte Fülle köstlicher Aromen.
Rodolphe Lindt wusste sofort, dass er eine große Entdeckung gemacht hatte. Was die anderen herstellten, war vielleicht Schokolade. Dies hier war etwas anderes. Er taufte seine wundersame Kreation «Chocolat fondant» — schmelzende Schokolade. Dass man die Schokolade sehr, sehr lange rühren muss — das war Rodolphe Lindts ganzes Geheimnis. Dass er das zwanzig Jahre lang vor der neugierigen Konkurrenz verheimlichen konnte, ist schon sehr erstaunlich.
Während der tagelangen Bearbeitung im Längsreiber verflüchtigten sich alle unangenehmen Bitterstoffe, das Wasser verdampfte, und die einzelnen Zutaten gingen eine unauflösliche Verbindung ein. Mit diesem Rezept wurde Lindt zum reichen Mann.
Die Welt riss ihm seinen «Chocolat fondant» aus den Händen. Erst machte die Kunde von der neuen Köstlichkeit in Bern die Runde, dann in Zürich, Basel, Lausanne und Genf, und dann in ganz Europa. Nach wenigen Monaten hätte Rodolphe Lindt eine zweite, eine dritte, eine vierte Fabrik in Betrieb nehmen können — aber das wollte er nicht. Lindt weigerte sich, zum modernen Unternehmer zu werden. Er blieb der exzentrische und launische Patrizier, der seine Zeit lieber in eleganten Salons als in der Fabrikhalle verbrachte und für den Arbeit eine niedere Verrichtung war, die es, wenn möglich, zu vermeiden galt. Es war ihm keineswegs daran gelegen, möglichst viel Schokolade zu verkaufen. Wenn seine Fabrik gerade so viel produzierte, wie ihm die Kundschaft aus den Händen riss, war er zufrieden. Es war ihm recht, wenn nicht jeder Dahergelaufene eine Lindt-Schokolade kaufen konnte; sein Produkt sollte Seltenheitswert haben und die Kundschaft umso sehnsüchtiger auf die Lieferung warten, je länger sie ausblieb. Seine treuesten Abnehmerinnen fand Lindt — der übrigens zeitlebens ledig blieb — in den vornehmen Berner und Neuenburger Töchterpensionaten, in denen «les jeunes filles de famille» aus aller Welt den letzten Schliff fürs Leben erhielten.
Schließlich ließ Lindt sich aber doch herbei, ein wenig Kommerz zu betreiben. Er gab seine Schokolade dem Berner Zuckerbäcker Jean Tobler in Kommission, der zwei Handlungsreisende übers Land schickte. Diese kehrten mit dicken Bündeln von Bestellscheinen zurück, und Lindt gewährte Tobler achtzehn Prozent Grossistenrabatt. Das ging fast zehn Jahre gut. Die Nachfrage stieg Jahr um Jahr, die Wartefristen wurden länger und länger, das Geld floss in Strömen — aber Rodolphe Lindt fils war keineswegs gewillt, deswegen mehr Schokolade herzustellen. Statt die Produktionskapazität seines Fabrikleins zu erhöhen, suchte er die Nachfrage zu vermindern, indem er den Grossistenrabatt erst auf dreizehn, dann auf zehn und schließlich auf acht Prozent kürzte. Als Lindt gar den Nerv hatte, den Rabatt auf fünf Prozent herabzusetzen, kündigte Tobler das Abkommen und gründete eine eigene Schokoladenfabrik.
Nun hatte Rodolphe Lindt ein Problem. Zwar war seine Schokolade die beste der Welt, was ihm sogar die Konkurrenz neidvoll attestierte, und die Kundschaft bereit, jeden Preis zu zahlen — aber es gab jetzt niemanden mehr, der für den Patrizier die peinliche Prozedur des Anpreisens, das demütigende Feilschen um den Preis und die niedere Verrichtung des Verkaufens erledigte. Lindt musste sich nach jemandem umsehen, der das für ihn übernahm. Es war nicht so, dass er lange hätte suchen müssen — Ende des 19. Jahrhunderts hätten sämtliche Schokoladeproduzenten der Welt jeden Preis bezahlt, um sich Lindts Schokoladengeheimnis anzueignen. Als ruchbar wurde, dass er einen neuen Partner suche, überboten sich die renommiertesten Chocolatiers mit Anträgen auf Fusion, Beteiligung, Übernahme, Kooperation. Lindt lehnte alle ab. Anfang 1899 aber erhörte er — man weiß nicht, weshalb — den Zürcher Schokoladefabrikanten Johann Rudolf Sprüngli. Am 25. Januar 1899 empfing Lindt einen Zürcher Unterhändler in Bern, am 12. Februar dann schon in Olten, auf halber Strecke zwischen Zürich und Bern. Laut Verwaltungsratsprotokoll vom 14. Februar teilte der schöne Berner Patrizier dem plebejischen Zürcher mit, dass die Nachfrage nach seiner Schokolade «solche Dimensionen angenommen hat, dass er denselben bei weitem nicht mehr zu entsprechen vermag. Da er aber dazu hinneigt, sich selbst etwas zu entlasten, kann er sich nicht entschließen, die natürlich bedingte, unumgänglich nothwendige Erweiterung des Geschäfts ausschließlich sich selbst auf die Schultern zu laden, andrerseits will er aber auch nicht der ruhmreich erworbenen Kundschaft durch Nichtbelieferung der immer größer und zahlreicher werdenden Bestellungen und neuen Anfragen verlustig gehen. Der Zeitpunkt zu einem entscheidenden Schritt ist also gekommen; es würde sich für ihn nur darum handeln, einer der verschiedenen zum Theil ganz glänzenden Kaufsofferten Gehör zu schenken und damit aus dem selbst aufgebauten Geschäft ganz herausgestossen zu werden, oder aber theilweise ein Interesse im Geschäft zu behalten so wie z.B. die proponierte Fusion die Möglichkeit dazu böte.»