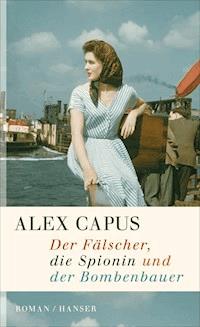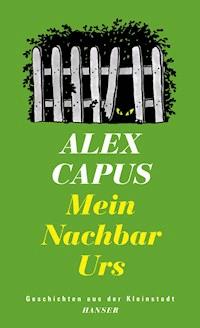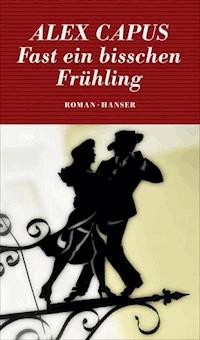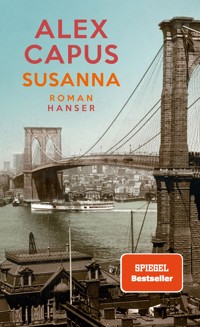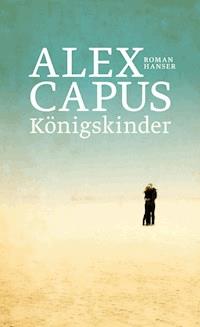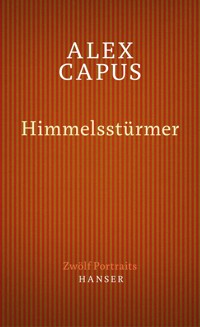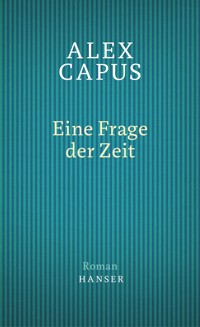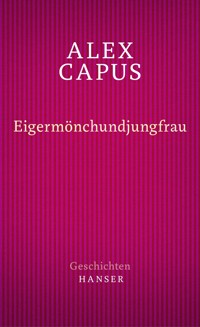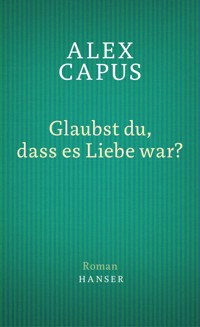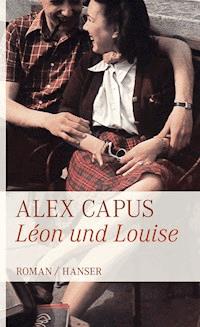
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei junge Leute verlieben sich, aber der Krieg bringt sie auseinander: Das ist die Geschichte von Léon und Louise. Sie beginnt mit ihrer Begegnung im Ersten Weltkrieg in Frankreich an der Atlantikküste, doch dann trennt sie ein Fliegerangriff mit Gewalt. Sie halten einander für tot, Léon heiratet, Louise geht ihren eigenen Weg - bis sie sich 1928 zufällig in der Pariser Métro wiederbegegnen. Alex Capus erzählt mit wunderbarer Leichtigkeit und großer Intensität von der Liebe in einem Jahrhundert der Kriege, von diesem Paar, das gegen alle Konventionen an seiner Liebe festhält und ein eigensinniges, manchmal unerhört komisches Doppelleben führt. Die Geschichte einer großen Liebe, gelebt gegen die ganze Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
ALEX CAPUS
Léon und Louise
Roman
Carl Hanser Verlag
eBook ISBN 978-3-446-23692-9
© 2011 Carl Hanser Verlag München
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Il ne faut pas trop regarder
la nudité de ses parents.
Erik Orsenna
Für Ruben
ERSTES KAPITEL
Wir saßen in der Kathedrale von Notre-Dame und warteten auf den Pfarrer. Buntes Sonnenlicht fiel durch die Fensterrose auf den offenen Sarg, der blumengeschmückt vor dem Hauptaltar auf einem roten Teppich stand. Im Chorumgang kniete ein Kapuzinermönch vor der Pietà, im linken Seitenschiff stand ein Maurer auf einem Gerüst und machte mit seiner Kelle schabende Geräusche, die im achthundertjährigen Gemäuer widerhallten. Ansonsten herrschte Ruhe. Es war neun Uhr morgens, die Touristen waren noch in ihren Hotels beim Frühstück.
Unsere Trauergemeinde war klein, der Verstorbene hatte lange gelebt; die meisten, die ihn gekannt hatten, waren vor ihm gestorben. Auf der vordersten Bank saßen in der Mitte seine vier Söhne, die Tochter und die Schwiegertöchter, daneben die zwölf Enkel, von denen sechs noch ledig, vier verheiratet und zwei geschieden waren; ganz außen die vier der insgesamt dreiundzwanzig Urenkel, die an jenem 16. April 1986 schon geboren waren. Hinter uns erstreckten sich im Dämmerlicht zum Ausgang hin achtundfünfzig leere Bankreihen – ein Meer von leeren Bänken, in dem wohl Platz genug gewesen wäre für alle unsere Ahnen bis zurück ins zwölfte Jahrhundert.
Wir waren ein lächerlich kleines Häuflein, die Kirche war viel zu groß; dass wir hier saßen, war ein letzter Scherz meines Großvaters, der Polizeichemiker am Quai des Orfèvres und ein großer Pfaffenverächter gewesen war. Falls er jemals sterben sollte, hatte er in den letzten Jahren oft verkündet, wünsche er sich eine Totenmesse in Notre-Dame. Wenn man dann zu bedenken gab, dass ihm als Ungläubigem die Wahl des Gotteshauses doch gleichgültig sein müsste und für unsere kleine Familie die Quartierkirche gleich um die Ecke angemessener wäre, entgegnete er: »Die Eglise Saint-Nicolas du Chardonnet? Aber nein, Kinder, besorgt mir Notre-Dame. Das ist ein paar hundert Meter weiter und wird etwas kosten, aber ihr schafft das. Übrigens hätte ich gern eine lateinische Messe, keine französische. Nach alter Liturgie, bitte, mit viel Weihrauch, langen Rezitativen und gregorianischem Choral.« Und dann schmunzelte er unter seinem Schnurrbart bei der Vorstellung, dass seine Nachkommen sich auf den harten Bänken zweieinhalb Stunden lang die Knie wundscheuern würden. So gut gefiel ihm sein Scherz, dass er ihn ins Repertoire seiner festen Redewendungen aufnahm. »Falls ich bis dahin nicht einen Abstecher nach Notre-Dame mache«, sagte er etwa, wenn er sich beim Friseur anmeldete, oder: »Frohe Ostern und auf Wiedersehen in Notre-Dame!« Mit der Zeit wurde der Scherz zur Prophezeiung, und als meines Großvaters Stunde tatsächlich geschlagen hatte, war uns allen klar gewesen, was zu tun war.
So lag er nun also mit wächserner Nase und verwundert hochgezogenen Brauen exakt an der Stelle, an der Napoleon Bonaparte sich zum Kaiser der Franzosen gekrönt hatte, und wir saßen auf jenen Bänken, auf denen hundertzweiundachtzig Jahre vor uns dessen Brüder, Schwestern und Generäle gesessen hatten. Die Zeit verging, der Pfarrer ließ auf sich warten. Die Sonnenstrahlen fielen schon nicht mehr auf den Sarg, sondern rechts daneben auf die schwarzweißen Steinplatten. Aus der Dunkelheit tauchte der Kirchendiener auf, steckte ein paar Kerzen an und kehrte in die Dunkelheit zurück. Die Kinder rutschten auf den Bänken umher, die Männer rieben sich den Nacken, die Frauen hielten den Rücken gerade. Mein Cousin Nicolas nahm seine Marionetten aus der Manteltasche und machte eine Vorstellung für die Kinder, die im Wesentlichen darin bestand, dass der stoppelbärtige Räuber mit seinem Knüppel auf Guignols Zipfelmütze eindrosch.
Da ging weit hinter uns neben dem Eingangsportal mit leisem Kreischen eine kleine Seitentür auf. Wir drehten uns um. Durch den breiter werdenden Spalt strömte das warme Licht des Frühlingsmorgens und der Lärm der Rue de la Cité ins Halbdunkel. Eine kleine graue Gestalt mit einem leuchtend roten Foulard schlüpfte ins Kirchenschiff.
»Wer ist das?«
»Gehört die Frau zu uns?«
»Still, man kann euch hören.«
»Gehört die zur Familie?«
»Oder ist das vielleicht …?«
»Glaubst du?«
»Ach woher.«
»Bist du ihr nicht einmal im Treppenhaus …«
»Ja, aber da war’s ziemlich dunkel.«
»Hört auf zu gaffen.«
»Wo nur der Pfarrer bleibt?«
»Kennt die jemand?«
»Ist es …«
»… vielleicht …«
»Meinst du?«
»Würdet ihr jetzt bitte alle still sein?«
Es war mir auf den ersten Blick klar, dass die Frau nicht zur Familie gehörte. Diese kleinen, energischen Schritte und die harten Absätze, die auf den Steinplatten klangen wie Händeklatschen; dieses schwarze Hütchen mit dem schwarzen Schleier, darunter das stolz gereckte spitze Kinn; diese flinke Bekreuzigung am Weihwasserstein und der elegante kleine Knicks – das konnte keine Le Gall sein. Zumindest keine gebürtige.
Schwarze Hütchen und flinke Bekreuzigungen liegen uns nicht. Wir Le Galls sind großgewachsene, schwerblütige Leute normannischer Herkunft, die sich mit langen, bedächtigen Schritten fortbewegen, und vor allem sind wir eine Familie von Männern. Natürlich gibt es auch Frauen – die Frauen, die wir geheiratet haben –, aber wenn ein Kind zur Welt kommt, ist es meistens ein Junge. Ich selbst habe vier Söhne, aber keine Tochter; mein Vater hat drei Söhne und eine Tochter, und dessen Vater – der verstorbene Léon Le Gall, der an jenem Morgen im Sarg lag – hatte ebenfalls vier Jungen und ein Mädchen gezeugt. Wir haben starke Hände, breite Stirnen und breite Schultern, tragen keinerlei Schmuck außer Armbanduhr und Ehering und haben einen Hang zu einfacher Kleidung ohne Rüschen und Kokarden; mit geschlossenen Augen wüssten wir kaum zu sagen, welche Farbe das Hemd hat, das wir gerade auf dem Leib tragen. Wir haben niemals Kopf- oder Bauchschmerzen, und wenn doch, verschweigen wir das schamhaft, weil nach unserer Konzeption von Männlichkeit weder unsere Köpfe noch unsere Bäuche – schon gar nicht die Bäuche! – schmerzempfindliche Weichteile enthalten.
Vor allem aber haben wir auffällig flache Hinterköpfe, über die sich unsere angeheirateten Frauen gern lustig machen. Wird in der Familie eine Geburt vermeldet, fragen wir als Erstes nicht nach Gewicht, Körperlänge oder Haarfarbe, sondern nach dem Hinterkopf. »Wie ist er – flach? Ist es ein echter Le Gall?« Und wenn wir einen von uns zu Grabe tragen, trösten wir uns mit dem Gedanken, dass der Schädel eines Le Gall beim Transport niemals im Sarg umherkullert, sondern immer schön flach auf dem Sargboden aufliegt.
Ich teile den morbiden Humor und die fröhliche Melancholie meiner Brüder, Väter und Großväter, und ich bin gern ein Le Gall. Obwohl manche von uns eine Schwäche für Alkohol und Tabak haben, erfreuen wir uns einer guten Aussicht auf Langlebigkeit, und wie viele Familien glauben wir fest daran, dass wir zwar nichts Besonderes, aber doch immerhin einzigartig seien.
Diese Illusion ist durch nichts zu begründen und entbehrt jeder Grundlage, denn noch nie hat, soweit ich es überblicke, ein Le Gall etwas vollbracht, woran die Menschheit sich erinnern müsste. Das liegt erstens am Fehlen ausgeprägter Begabungen und zweitens an mangelndem Fleiß; drittens entwickeln die meisten von uns während der Adoleszenz eine hochmütige Verachtung gegenüber den Initiationsritualen einer ordentlichen Ausbildung, und viertens vererbt sich vom Vater auf den Sohn fast immer eine schwere Aversion gegen Kirche, Polizei und intellektuelle Autorität.
Deshalb enden unsere akademischen Karrieren meist schon am Gymnasium, spätestens aber im dritten oder vierten Semester an der Hochschule. Nur alle paar Jahrzehnte schafft es ein Le Gall, sein Studium regulär abzuschließen und sich mit einer weltlichen oder geistlichen Autorität auszusöhnen. Der wird dann Jurist, Arzt oder Pfarrer und erntet in der Familie Respekt, aber auch einiges Misstrauen.
Zu ein wenig Nachruhm gelangte immerhin mein Ururgroßonkel Serge Le Gall, der kurz nach dem Deutsch-Französischen Krieg wegen Opiumkonsums vom Gymnasium flog und Gefängniswärter im Zuchthaus von Caen wurde. Er ging in die Geschichte ein, weil er eine Gefangenenrevolte friedlich und ohne das übliche Massaker zu beenden versuchte, wofür ihm ein Häftling zum Dank mit einer Axt den Schädel spaltete. Ein anderer Vorfahr zeichnete sich dadurch aus, dass er eine Briefmarke für die vietnamesische Post entwarf, und mein Vater baute als junger Mann Erdölpipelines in der algerischen Sahara. Ansonsten aber verdienen wir Le Galls unser Brot als Tauchlehrer, Staplerfahrer oder Verwaltungsbeamte. Wir verkaufen Palmen in der Bretagne und deutsche Motorräder an die Straßenpolizei von Nigeria, und einer meiner Cousins fahndet halbtags als Detektiv für die Société Générale nach flüchtigen Kreditnehmern.
Wenn die meisten von uns trotzdem ganz ordentlich durchs Leben kommen, so verdanken wir das zur Hauptsache unseren Frauen. Alle meine Schwägerinnen, Tanten und Großmütter väterlicherseits sind starke, lebenstüchtige und warmherzige Frauen, die ein diskretes, aber unbestrittenes Matriarchat ausüben. Sie sind beruflich oft erfolgreicher als ihre Männer und verdienen mehr Geld, und sie kümmern sich um die Steuererklärung und schlagen sich mit den Schulbehörden herum. Die Männer ihrerseits danken es ihnen mit Verlässlichkeit und Sanftmut.
Wir sind, glaube ich, eher friedfertige Ehemänner. Wir lügen nicht und geben uns Mühe, nicht in gesundheitsschädigendem Maß zu trinken; wir halten uns von anderen Frauen fern und sind willige Heimwerker, und ganz gewiss sind wir überdurchschnittlich kinderlieb. Bei unseren Familienzusammenkünften ist es guter Brauch, dass die Männer sich nachmittags im Garten um die Säuglinge und Kleinkinder kümmern, während die Frauen an den Strand oder zum Einkaufen fahren. Unsere Frauen wissen es zu schätzen, dass wir für unser Lebensglück keine teuren Autos brauchen und nicht zum Golfspielen nach Barbados fliegen müssen, und sie sehen es uns milde nach, dass wir zwanghaft auf Flohmärkte gehen und sonderbares Zeug nach Hause schleppen – fremder Leute Fotoalben, mechanische Apfelschäler, ausgediente Lichtbildprojektoren, für die es längst keine Lichtbilder im richtigen Format mehr gibt, echte Ferngläser der Kriegsmarine, durch die man alles verkehrt herum sieht, chirurgische Sägen, rostige Revolver, wurmstichige Grammophone und elektrische Gitarren, denen jeder zweite Bund fehlt – wir schleppen gern sonderbares Zeug nach Hause, das wir dann monatelang polieren und putzen und instand zu setzen versuchen, bevor wir es verschenken, zurück zum Flohmarkt tragen oder auf den Müll werfen. Wir tun das zur Erholung unseres vegetativen Nervensystems; Hunde essen Gras, höhere Töchter hören Chopin, Hochschulprofessoren gucken Fußball, und wir basteln an altem Zeug rum. Erstaunlich viele von uns fertigen übrigens abends, wenn die Kinder schlafen, im Keller kleinformatige Ölbilder an. Und einer schreibt, das weiß ich aus erster Hand, heimlich Gedichte. Nur leider nicht sehr gute.
Die vorderste Sitzbank von Notre-Dame vibrierte vor tapfer unterdrückter Aufregung. War das wirklich Mademoiselle Janvier, die da gekommen war, hatte sie es gewagt? Die Frauen blickten wieder starr nach vorn und machten gerade Rücken, als gelte ihre Aufmerksamkeit ausschließlich dem Sarg und dem Ewigen Licht über dem Hauptaltar; wir Männer aber, die wir unsere Frauen kannten, wussten, dass sie gespannt dem klackenden Stakkato der kleinen Schritte lauschten, die sich seitlich zum Mittelgang hin bewegten, dann rechtwinklig abbogen und ohne das geringste Zögern, ohne jedes Ritardando oder Accelerando mit dem regelmäßigen Taktschlag eines Metronoms nach vorne eilten. Dann konnte, wer zur Mitte schielte, in den Augenwinkeln die kleine Gestalt sehen, wie sie leichtfüßig wie ein junges Mädchen über den roten Teppich die zwei Stufen hinauf zum Fußende des Sargs lief, die rechte Hand auf die Sargwand legte und lautlosen Schrittes daran entlangfuhr bis zum Kopfteil, wo sie endlich stehen blieb und ein paar Sekunden in nahezu soldatisch strammer Haltung verharrte. Sie hob den Schleier über den Hut und beugte sich vor, breitete die Arme aus und legte sie auf die Sargwand, küsste meinen Großvater auf die Stirn und legte ihre Wange an sein wächsernes Haupt, als wollte sie eine Weile ruhen; dabei wandte sie ihr Gesicht nicht schützend dem Hauptaltar zu, sondern bot es uns offen dar. So konnten wir sehen, dass sie die Augen geschlossen hielt und dass ihr rot geschminkter Mund sich zu einem Lächeln verzog, das breit und immer breiter wurde, bis ihre Lippen sich zu einem lautlosen kleinen Lachen öffneten.
Schließlich löste sie sich vom Toten und kehrte in ihre aufrechte Haltung zurück, nahm die Handtasche aus der Armbeuge, öffnete sie und holte mit raschem Griff einen faustgroßen, runden, matt schimmernden Gegenstand hervor. Es war, wie wir wenig später feststellen sollten, eine alte Fahrradklingel mit halbkugelförmiger Glocke, deren Chromschicht von Haarrissen durchzogen und an einigen Stellen abgeblättert war. Sie verschloss die Handtasche und hängte sie zurück in ihre Armbeuge, und dann betätigte sie die Klingel zwei Mal. Rrii-Rring, Rrii-Rring. Während das Klingeln im Kirchenschiff widerhallte, legte sie die Klingel in den Sarg, drehte sich nach uns um und sah uns einem nach dem anderen gerade in die Augen. Sie begann links außen, wo die kleinsten Kinder mit ihren Vätern saßen, ging die ganze Reihe durch und verharrte bei jedem einzelnen für vielleicht eine Sekunde, und als sie rechts außen angelangt war, schenkte sie uns ein sieghaftes Lächeln, setzte sich in Bewegung und eilte klackenden Schrittes an der Familie vorbei durch den Mittelgang, dem Ausgang entgegen.
2. KAPITEL
Zu der Zeit, da mein Großvater Louise Janvier kennenlernte, war er siebzehn Jahre alt. Ich stelle ihn mir gern als ganz jungen Mann vor, wie er im Frühling 1918 in Cherbourg seinen Koffer aus verstärkter Pappe aufs Fahrrad band und das Haus seines Vaters für immer verließ.
Was ich über ihn als jungen Mann weiß, ist nicht sehr viel. Auf der einen Familienfotografie, die es aus jener Zeit gibt, ist er ein kräftiger Bursche mit hoher Stirn und unbändig blondem Haar, der das Treiben des Studiofotografen neugierig und mit spöttisch zur Seite geneigtem Kopf beobachtet. Weiter weiß ich aus seinen eigenen Erzählungen, die er im Alter wortkarg und mit gespieltem Widerwillen vortrug, dass er am Gymnasium oft fehlte, weil er lieber mit seinen besten Freunden, die Patrice und Joël hießen, an den Stränden von Cherbourg unterwegs war.
Zu dritt hatten sie an einem stürmischen Januarsonntag 1918, als kein vernünftiger Mensch sich dem Ozean auf Sichtweite nähern wollte, im Schneegestöber an der Ginsterböschung das angeschwemmte Wrack einer kleinen Segeljolle gefunden, die mittschiffs ein Loch hatte und auf ganzer Länge ein bisschen angesengt war. Sie hatten das Boot hinters nächste Gebüsch geschleppt und es in den folgenden Wochen, da der rechtmäßige Besitzer sich partout nicht bei ihnen melden wollte, eigenhändig mit großem Eifer repariert und geschrubbt und knallbunt angemalt, bis es aussah wie neu und nicht mehr wiederzuerkennen war. Von da an fuhren sie in jeder freien Stunde hinaus auf den Ärmelkanal, um zu fischen, zu dösen und getrockneten Seetang zu rauchen in Tabakpfeifen, die sie aus Maiskolben geschnitzt hatten; wenn etwas Interessantes im Wasser dümpelte – eine Planke, das Sturmlicht eines versenkten Schiffes oder ein Rettungsring –, nahmen sie es mit. Manchmal fuhren Kriegsschiffe so nah an ihnen vorbei, dass ihr kleiner Kahn auf und ab hüpfte wie ein Kalb am ersten Frühlingstag auf der Weide. Oft blieben sie den ganzen Tag draußen, umrundeten das Kap und fuhren westwärts, bis am Horizont die britischen Kanalinseln auftauchten, und kehrten erst im letzten Licht der Abenddämmerung an Land zurück. An den Wochenenden verbrachten sie die Nächte in einer Fischerhütte, deren Besitzer am Tag seiner Einberufung nicht mehr die Zeit gehabt hatte, das rückseitige kleine Fenster ordentlich zu verbarrikadieren.
Léon Le Galls Vater – also mein Urgroßvater – wusste nichts von der Segeljolle seines Sohnes, nahm aber dessen Streunerei am Strand mit einiger Besorgnis zur Kenntnis. Er war ein zigarettenverschlingender, vor der Zeit gealterter Lateinlehrer, der sich in jungen Jahren nur deswegen fürs Lateinstudium entschieden hatte, weil er damit seinem Vater den größtmöglichen Verdruss hatte bereiten können; dieses Vergnügen hatte er in der Folge mit jahrzehntelangem Schuldienst bezahlt und war darob kleinlich, engherzig und bitter geworden. Um sein Latein vor sich selbst zu rechtfertigen und sich weiterhin lebendig zu fühlen, hatte er sich ein enzyklopädisches Wissen über die Zeugnisse römischer Zivilisation in der Bretagne angeeignet und betrieb dieses Steckenpferd mit einer Leidenschaft, die in groteskem Gegensatz zur Geringfügigkeit des Themas stand. Seine endlosen, quälend eintönigen und von Kettenrauch begleiteten Referate über Tonscherben, Thermalbäder und Heeresstraßen waren am Gymnasium legendär und gefürchtet. Die Schüler hielten sich schadlos, indem sie seine Zigarette beobachteten und darauf warteten, dass er damit an die Wandtafel schrieb und die Kreide rauchte.
Dass er am Tag der Generalmobilmachung wegen seines Asthmas zurückgestellt worden war, empfand er einerseits als Glück, andrerseits als Schande, da er im Lehrerzimmer der einzige Mann unter lauter jungen Frauen war. Fürchterlich war sein Zorn gewesen, als er von den Kolleginnen hatte erfahren müssen, dass sein einziger Sohn seit Wochen kaum mehr an der Schule gesehen worden war, und endlos waren seine Vorträge am Küchentisch gewesen, mit denen er den Jüngling vom Wert klassischer Bildung zu überzeugen versuchte. Dieser hatte über den Wert klassischer Bildung nur gelächelt und seinerseits dem Alten darzulegen versucht, weshalb seine Anwesenheit am Strand gerade jetzt unabdingbar nötig sei: weil die Deutschen in den letzten Wochen dazu übergegangen seien, ihre U-Boote mit hölzernen Aufbauten und bunter Lackfarbe, mit behelfsmäßigen Segeln und falschen Netzen als Fischerboote zu verkleiden.
Darauf wünschte der Vater zu erfahren, worin bitte der kausale Zusammenhang zwischen deutschen U-Booten und Léons Präsenz am Gymnasium liege.
Die verkleideten U-Boote, erklärte der Sohn geduldig, würden sich unerkannt französischen Fischkuttern nähern und diese gnadenlos versenken, um die Versorgungslage des französischen Volkes zu verschlechtern.
»Und?«, fragte der Vater, hustete und versuchte sich zu beruhigen. Jede Aufregung konnte ihn in eine asthmatische Krise stürzen.
Tag für Tag werde wertvollstes Treibgut an Land gespült – Teakholz, Messing, Stahl, Segeltuch, fassweise Petroleum …
»Und?«, fragte der Vater.
Diese kostbaren Rohstoffe müsse man bergen, bevor das Meer sie wieder mitnehme, sagte Léon.
Während ihre Auseinandersetzung unaufhaltsam dem dramaturgischen Höhepunkt zustrebte, saßen Vater und Sohn in jener scheinbar lässig-entspannten Haltung am Küchentisch, die allen Le Galls eigen ist; sie hatten die Beine lang unter dem Tisch ausgestreckt und lehnten sich weit über die Stuhllehne hinaus nach hinten, sodass ihr Hintern nur noch knapp auf der Stuhlkante auflag. Da sie beide große und schwere Männer waren, hatten sie ein feines Empfinden für die Schwerkraft und wussten, dass die horizontale Lage dem Zustand des Schwebens am nächsten kommt, weil in ihr jedes Körperglied nur sein Eigengewicht zu tragen hat und von der Masse des restlichen Leibs befreit ist, während im Sitzen oder Stehen ein Glied sich auf das andere türmt und sich in der Summe eine zentnerschwere Last ergibt. Jetzt aber waren sie wütend, und ihre Stimmen, die kaum voneinander zu unterscheiden waren, seit der Sohn den Stimmbruch hinter sich hatte, bebten vor mühsam im Zaum gehaltenem Zorn.
»Du gehst morgen wieder zur Schule«, sagte der Vater und unterdrückte einen Hustenreiz, der aus der Tiefe seiner Brust die Kehle hochstieg.
Die nationale Kriegswirtschaft sei dringend auf Rohstoffe angewiesen, erwiderte der Sohn.
»Du gehst morgen wieder zur Schule«, sagte der Vater.
Der Vater solle an die nationale Kriegswirtschaft denken, sagte der Sohn und registrierte beunruhigt, wie schwer der väterliche Atem ging.
»Die nationale Kriegswirtschaft kann mich am Arsch lecken«, keuchte der Vater. Dann hatte er einen Hustenanfall, der das Gespräch für eine Minute unterbrach.
Und ein hübsches Taschengeld lasse sich damit auch verdienen, sagte der Sohn.
»Erstens ist das kriminelles Geld«, keuchte der Vater. »Und zweitens gilt das Absenzenreglement des Gymnasiums für alle, also auch für dich und deine Freunde. Es gefällt mir nicht, dass ihr euch jede Freiheit herausnehmt.«
Was der Vater gegen Freiheit einzuwenden habe, fragte der Sohn, und ob er jemals bedacht habe, dass jedes Gesetz, um Beachtung zu verdienen, Ausdruck einer Sinngebung sein müsse.
»Ihr nehmt euch jede Freiheit allein schon deshalb heraus, weil sie eine Freiheit ist«, ächzte der Vater.
»Und?«
»Es ist aber gerade das Wesen eines Reglements, dass es für jeden ohne Ansehen der Person gilt – auch und gerade für jene, die sich für schlauer halten als andere.«
»Es ist doch aber eine nicht zu leugnende Tatsache, dass manche Menschen schlauer sind als andere«, wandte der Sohn vorsichtig ein.
»Erstens tut das nichts zur Sache«, sagte der Vater, »und zweitens hast gerade du dich bisher, soweit ich orientiert bin, im Unterricht keineswegs überragender geistiger Kräfte verdächtig gemacht. Du gehst morgen wieder zur Schule.«
»Nein«, sagte der Sohn.
»Du gehst morgen wieder zur Schule!«, brüllte der Vater.
»Ich gehe überhaupt nie wieder zur Schule!«, brüllte der Sohn.
»Solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, tust du, was ich sage!«
»Du hast mir gar nichts zu befehlen!«
Nach diesem geradezu klassischen Wortwechsel artete die Auseinandersetzung in eine Prügelei aus, bei der die beiden sich auf dem Küchenboden wälzten wie Schulbuben und nur deshalb kein Blut vergossen, weil die Mutter rasch und beherzt eingriff.
»Jetzt ist Schluss«, sagte sie und hob ihre zwei Männer, von denen der eine weinte und der andere zu ersticken drohte, an den Ohrläppchen hoch. »Du, Chéri, nimmst jetzt dein Laudanum und gehst zu Bett, ich komme gleich nach. Und du, Léon, gehst morgen früh zum Bürgermeister und meldest dich zum Arbeitsdienst. Wo dir doch die nationale Kriegswirtschaft so sehr am Herzen liegt.«
Wie sich am nächsten Morgen herausstellte, konnte die nationale Kriegswirtschaft den Gymnasiasten Le Gall aus Cherbourg tatsächlich gebrauchen – aber nicht am Strand, wie er gehofft hatte. Der Bürgermeister drohte ihm im Gegenteil drei Monate Gefängnis an für den Fall, dass er sich noch einmal widerrechtlich Strandgut aneigne, und befragte ihn eingehend nach seinen anderweitigen kriegswirtschaftlich relevanten Kenntnissen und Fähigkeiten.
Dabei erwies es sich, dass Léon zwar kräftig gebaut war, aber keinerlei Neigung zum Einsatz seiner Muskelkraft hatte. Er wollte kein Bauernknecht sein und auch kein Fließbandarbeiter, und den Handlanger für einen Schmied oder Zimmermann machen wollte er auch nicht. Ähnlich war’s mit seinen geistigen Kräften: Zwar war er nicht eigentlich dumm, aber am Gymnasium hatte er für kein Fach eine Vorliebe erkennen lassen und in keinem sonderlich dicke Stricke zerrissen, weshalb er auch für seine berufliche Zukunft keine festen Pläne oder Wünsche hatte. Natürlich wäre er gern im Dienst des Vaterlands mit seiner Segeljolle auf Spionagefahrt in die Nordsee gefahren und hätte gefälschte Reichsmark an der deutschen Küste in Umlauf gebracht, um die feindliche Währung zu destabilisieren; aber weil das keine realistische Berufsperspektive war, zuckte er nur mit den Schultern, als der Bürgermeister ihn nach seinen Plänen fragte. Das Interesse an der nationalen Kriegswirtschaft war ihm schon gänzlich abhandengekommen. Erschwerend kam hinzu, dass der Bürgermeister einen Hals wie ein Truthahn und eine rotblau geäderte Nase hatte. Wie die meisten jungen Leute hatte Léon ein starkes ästhetisches Empfinden und konnte sich nicht vorstellen, dass man einen Menschen mit so einem Hals und so einer Nase ernst nehmen konnte. Der Bürgermeister ging mürrisch die Liste der offenen Stellen durch, die der Kriegsminister ihm geschickt hatte.
»Na, mal sehen. Ah, hier. Kannst du Traktor fahren?«
»Nein, Monsieur.«
»Und hier – Lichtbogenschweißer gesucht. Kannst du schweißen?«
»Nein, Monsieur.«
»Verstehe. Optische Linsen schleifen kannst du wohl auch nicht, wie?«
»Nein, Monsieur.«
»Und Spulen für Elektromotoren wickeln? Eine Straßenbahn lenken? Pistolenläufe drehen?« Der Bürgermeister lachte ein wenig, die Sache begann ihm Spaß zu machen.
»Nein, Monsieur.«
»Bist du vielleicht Facharzt für innere Medizin? Experte für internationales Handelsrecht? Elektroingenieur? Tiefbauzeichner? Sattler oder Wagner?«
»Nein, Monsieur.«
»Dachte ich mir. Von Ledergerberei und doppelter Buchhaltung verstehst du auch nichts, wie? Und Kisuaheli – sprichst du Kisuaheli? Kannst du stepptanzen? Morsen? Die Zugkraft von Hängebrückenstahlseilen berechnen?«
»Jawohl, Monsieur.«
»Wie … Kisuaheli? Hängebrückenstahlseile?«
»Morsen, Monsieur. Ich kann morsen.«
Tatsächlich hatte die Jugendzeitschrift Le Petit Inventeur, auf die Léon abonniert war, wenige Wochen zuvor das Morsealphabet abgedruckt, und Léon hatte es aus einer Laune heraus auswendig gelernt an einem regnerischen Sonntagnachmittag.
»Stimmt das denn auch, Kleiner? Schwindelst du mich nicht an?«
»Nein, Monsieur.«
»Dann wäre das doch etwas! Der Bahnhof von Saint-Luc-sur-Marne sucht einen Morseassistenten als Stellvertreter des ordentlichen Stelleninhabers. Frachtbriefe ausstellen, Ankunft und Abfahrt der Züge vermelden, aushilfsweise Fahrkarten verkaufen. Traust du dir das zu?«
»Jawohl, Monsieur.«
»Mindestalter sechzehn, männlich, Homosexuelle, Geschlechtskranke und Kommunisten unerwünscht. Du bist doch nicht etwa – Kommunist?«
»Nein, Monsieur.«
»Na, dann morse mir mal was. Morse mir, mal sehen, ah ja: Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Na los, gleich hier auf dem Schreibtisch!«
Léon hielt die Luft an, schaute kurz zur Decke hoch und begann mit dem Mittelfinger der rechten Hand zu trommeln. Kurz-kurz-lang, kurz-lang-kurz, kurz-kurz-kurz …
»Das reicht«, sagte der Bürgermeister, der das Morsealphabet nicht beherrschte und außerstande war, Léons Fingerfertigkeit zu bewerten.
»Ich kann morsen, Monsieur. Wo bitte liegt Saint-Luc-sur-Marne?«
»An der Marne, du Holzkopf, irgendwo zwischen Schnittlauch und Stangenbohnen. Keine Angst, die Front verläuft jetzt woanders. Dringliche Ausschreibung, du kannst sofort anfangen. Bekommst sogar Lohn, hundertzwanzig Franc. Wir können es ja versuchen.«
So kam es, dass Léon Le Gall an einem Frühlingstag des Jahres 1918 seinen Pappkoffer aufs Fahrrad band, innig seine Mutter küsste und nach kurzem Zögern auch den Vater umarmte, aufs Rad stieg und in die Pedale trat. Er beschleunigte, als müsste er am Ende der Rue des Fossées vom Boden abheben wie Louis Blériot, der kürzlich mit seinem aus Eschenholz und Fahrradrädern selbstgebastelten Flugzeug den Ärmelkanal überquert hatte. Er raste vorbei an den armseligen, tapfer wohlanständigen Kleinbürgerhäusern, in denen seine Freunde Patrice und Joël gerade sägemehlhaltiges Kriegsbrot vom Vortag in ihren Milchkaffee tunkten, vorbei an der Bäckerei, aus der fast jeder Bissen Brot stammte, den er in seinem Leben gegessen hatte, und vorbei am Gymnasium, an dem sein Vater noch vierzehn Jahre, drei Monate und zwei Wochen sein täglich Brot verdienen würde. Er fuhr vorbei am großen Hafenbecken, in dem ein amerikanischer Getreidetanker friedlich neben britischen und französischen Kriegsschiffen lag, überquerte die Brücke und bog rechts in die Avenue de Paris ein, glücklich und ohne jeden Gedanken daran, dass er das alles möglicherweise nie wiedersehen würde, fuhr vorbei an Lagerhäusern, Hebekränen und Trockendocks, hinaus aus der Stadt und hinein in die endlosen Wiesen und Weiden der Normandie. Nach zehn Minuten Fahrt versperrte eine Herde Kühe die Straße, er musste halten; danach fuhr er langsamer.
In der Nacht zuvor hatte es geregnet, die Straße war angenehm feucht und staubfrei. Auf dampfenden Wiesen standen blühende Apfelbäume und weidende Kühe. Léon fuhr der Sonne entgegen. Er hatte leichten Westwind im Rücken und kam rasch voran. Nach einer Stunde zog er die Jacke aus und band sie auf den Koffer. Er überholte ein Fuhrwerk, das von einem Maulesel gezogen wurde. Dann kreuzte er eine Bäuerin mit einer Schubkarre und fuhr an einem Lastwagen vorbei, der mit rauchendem Motor am Straßenrand stand. Pferde sah er keine; Léon hatte im Petit Inventeur gelesen, dass nahezu sämtliche Pferde Frankreichs an der Front Dienst taten.
Am Mittag aß er das Schinkenbrot, das ihm die Mutter eingepackt hatte, und trank Wasser aus einem Dorfbrunnen. Nachmittags legte er sich unter einen Apfelbaum, blinzelte hoch in die weißrosa Blüten und zartgrünen Blätter und stellte fest, dass der Baum seit Jahren nicht mehr geschnitten worden war.
Am Abend traf er in Caen ein, wo er bei Tante Simone übernachten sollte. Sie war die jüngste Schwester jenes Serge Le Gall, dem ein Gefängnisinsasse mit einer Axt den Schädel gespalten hatte. Es war ein paar Jahre her, dass Léon sie zum letzten Mal gesehen hatte; er erinnerte sich an die vollen Brüste unter ihrer Bluse, an ihr Gelächter und ihren großen roten Frauenmund und dass ihr Drachen am Strand höher gestiegen war als alle anderen. Aber dann waren kurz nacheinander ihr Mann und ihre beiden Söhne in den Krieg gezogen, und seither schrieb Tante Simone, fast wahnsinnig vor Kummer und Sorge, jeden Tag drei Briefe nach Verdun.
»Da bist du also«, sagte sie und ließ ihn eintreten. Das Haus roch nach Kampfer und toten Fliegen. Ihr Haar war wirr, der Mund fahl und rissig. In der rechten Hand hielt sie einen Rosenkranz.
Léon küsste sie auf beide Wangen und richtete die Grüße seiner Eltern aus.
»Auf dem Küchentisch stehen Brot und Käse«, sagte sie. »Und eine Flasche Cidre, wenn du willst.«
Er überreichte ihr die gebrannten Mandeln, die seine Mutter ihm als Gastgeschenk mitgegeben hatte.
»Danke. Geh jetzt in die Küche und iss. Du schläfst neben mir heute Nacht, das Bett ist breit genug.«
Léon machte große Augen.
»Das Bubenzimmer kannst du nicht haben, das habe ich zusammen mit dem Schlafzimmer vermieten müssen an Flüchtlinge aus dem Norden. Und das Sofa im Salon habe ich verkauft, weil ich Platz für das Bett brauchte.«
Léon machte den Mund auf und wollte etwas sagen.
»Das Bett ist breit genug, stell dich nicht so an«, sagte sie und fuhr sich mit der Hand durchs matte Haar. »Ich bin müde vom langen Tag und habe nicht die Kraft, mich mit dir herumzuschlagen.«
Ohne ein weiteres Wort ging sie hinüber in den Salon und schlüpfte mit all ihren Röcken, Blusen, Schlüpfern und Strümpfen unter die Decke, drehte sich zur Wand und rührte sich nicht mehr.
Léon ging in die Küche. Er aß Brot und Käse, schaute durchs Fenster auf die Straße und trank, während er auf die Dunkelheit wartete, die ganze Flasche Cidre leer. Erst als er Tante Simone schnarchen hörte, ging er hinüber in den Salon und legte sich neben sie, atmete den süßsauren Duft ihres weiblichen Schweißes und wartete darauf, dass ihn die Zauberkraft des Cidre hinübertrug in die andere Welt.
Als er am nächsten Morgen die Augen aufschlug, lag Tante Simone in unveränderter Haltung neben ihm, aber sie schnarchte nicht mehr. Léon fühlte, dass sie sich schlafend stellte und darauf wartete, dass er aus ihrem Haus verschwand. Er nahm seine Schuhe in die rechte Hand und den Koffer in die linke und schlich leise die Treppe hinunter.
Es war ein windstiller, sonniger Morgen. Léon nahm die Küstenstraße über Houlgate und Honfleur; weil gerade Ebbe war, hievte er sein Fahrrad über die Mauer hinunter zum Strand und fuhr einige Kilometer auf dem nassen, harten Sand der Wasserlinie entlang. Der Sand war gelb, das Meer war grün und wurde zum Himmel hin blau; die wenigen Kinder, die im Sand spielten, trugen rote Badeanzüge, ihre Mütter weiße Röcke; manchmal standen alte Männer in schwarzen Jacketts im Sand und stocherten mit ihren Stöcken in vertrocknetem Algengewirr.
Weil sein Vater und der Bürgermeister von Cherbourg weit weg waren und ihn unmöglich sehen konnten, hielt Léon ein wenig Ausschau nach Strandgut. Er fand ein ziemlich langes, nicht sehr zerfranstes Stück Seil, ein paar Flaschen, ein Fensterkreuz samt Verschlussgestänge und einen halbvollen Kanister Petroleum.
Mittags traf er in Deauville ein und abends in Rouen, wo er bei Tante Sophie übernachten sollte; zuvor aber, das hatte ihm der Vater dringend ans Herz gelegt, sollte er die Kathedrale besichtigen, weil sie eines der schönsten Zeugnisse gotischer Baukunst sei. Léon zog in Erwägung, sowohl die Tante als auch das Zeugnis gotischer Baukunst fahren zu lassen und irgendwo auf freiem Feld zu übernachten. Dann bedachte er, dass die Tage im Juni zwar lang, die Nächte aber immer noch feucht und kühl waren und dass Tante Sophie weder Mann noch Söhne in Verdun haben konnte, weil sie zeitlebens ledig geblieben war; zudem war sie berühmt für ihren Apfelkuchen. Als er bei ihr eintraf, stand sie in ihrer weiß gestärkten Schürze im Vorgarten und winkte ihm zu.
Am dritten Tag stellte er beim Aufstehen fest, dass er fürchterlichen Muskelkater hatte. Das Treppensteigen war eine Qual, die erste Stunde auf dem Rad eine Tortur; danach ging es besser. Der Wind hatte auf Norden gedreht, Nieselregen setzte ein. Von Süden her kreuzten lange Kolonnen von Armeelastwagen seinen Weg; unter den Planen saßen Soldaten mit mürrischen Gesichtern, die Zigaretten rauchten und ihre Gewehre zwischen den Knien hielten. Mittags kam er an einem abgebrannten Bauernhof vorbei. Grüne Wicken rankten sich an schwarzen Balken empor, im Schweinekoben wuchsen junge Birken, aus den schwarzen Fensterlöchern drang modriger Kohlegeruch; im Miststock steckte eine rostige Mistgabel ohne Stiel. Er nahm sie an sich und steckte sie zu den anderen Fundsachen auf dem Gepäckträger.
Léon wusste, dass er seinem Ziel nun nahe war; hinter dem nächsten oder übernächsten Hügel musste der Kirchturm von Saint-Luc-sur-Marne auftauchen. Tatsächlich lag hinter der nächsten Anhöhe ein Dorf mit einer Kirche, aber es war nicht Saint-Luc. Léon durchquerte das Dorf und erklomm den nächsten Hügel, fuhr hinunter ins nächste Dorf und hinauf auf den nächsten Hügel, hinter dem wiederum ein Dorf lag und hinter diesem wiederum ein Hügel. Er beugte sich tief über den Lenker, versuchte seine Schmerzen zu ignorieren und stellte sich vor, er sei eine fest mit dem Rad verbundene Maschine, der es gleichgültig war, wie viele Hügel hinter dem nächsten Hügel noch folgen mochten.
Es war später Nachmittag, als es mit den Hügeln endlich ein Ende hatte. Vor Léon lag eine Allee, die schnurgerade über eine endlose Ebene führte. Die Fahrt in der Waagrechten war eine Wohltat, zudem schien es ihm, als schützten ihn die Platanen ein wenig vor dem Seitenwind. Da hörte er in seinem Rücken ein Geräusch – ein kurzes Quietschen, das sich in hastiger Folge gleichmäßig wiederholte und stetig lauter wurde. Léon drehte sich um.
Was er sah, war eine junge Frau auf einem alten, ziemlich rostigen Herrenfahrrad, die locker aufrecht auf dem Sattel saß und rasch näher kam; das Quietschen wurde offenbar durch das rechte Pedal verursacht, das bei jeder Umdrehung das Blech des Kettenschutzes streifte. Sie kam sehr rasch näher, gleich würde sie ihn überholen; um das zu verhindern, stieg er aus dem Sattel. Aber nach wenigen Sekunden war sie heran, winkte ihm zu, rief »Bonjour!« und zog leichthin vorbei, als würde er am Straßenrand stillstehen.
Léon schaute ihr hinterher, wie sie in der weiten Ebene unter leiser werdendem Quietschen klein und immer kleiner wurde und schließlich an jenem Punkt verschwand, an dem die Doppelreihe der Platanen an den Horizont stieß. Ein sonderbares Mädchen war das gewesen. Sommersprossen und dichtes dunkles Haar, das sie, womöglich eigenhändig, am Hinterkopf von einem Ohrläppchen zum anderen durchgehend auf gleicher Höhe abgesäbelt hatte. Ungefähr in seinem Alter, vielleicht etwas jünger oder älter, das war schwer zu sagen. Großer Mund und zartes Kinn. Ein nettes Lächeln. Kleine weiße Zähne und eine lustige Lücke zwischen den oberen Schneidezähnen. Die Augen – grün? Eine weiße Bluse mit roten Punkten, die sie zehn Jahre älter gemacht hätte, wenn nicht der blaue Schülerinnenrock sie wieder zehn Jahre jünger gemacht hätte. Hübsche Beine, soweit er das in der Kürze der Zeit hatte beurteilen können. Und verdammt schnell gefahren war sie.
Léon fühlte seine Müdigkeit nicht mehr, die Beine taten wieder ihren Dienst. Ein sensationelles Mädchen war das gewesen. Er versuchte sich ihr Bild vor Augen zu halten und wunderte sich, dass es ihm schon nicht mehr gelingen wollte. Wohl sah er die rotweiß gepunktete Bluse, die strampelnden Beine, die ausgetretenen Schnürschuhe und das Lächeln, das übrigens nicht nur nett, sondern hinreißend, umwerfend, beglückend, atemberaubend, herzzerreißend gewesen war in seiner Mischung aus Freundlichkeit, Klugheit, Spott und Scheu. Aber die einzelnen Teile wollten sich, sosehr er sich bemühte, nicht zu einem Ganzen fügen, immer sah er nur Glieder, Farben, Formen – die Erscheinung als Ganzes verweigerte sich ihm.
Deutlich im Ohr hatte er immerhin das Quietschen der Pedale auf dem Kettenschutz, ebenso ihr helles »Bonjour!« – da fiel ihm ein, dass er nicht zurückgegrüßt hatte. Verärgert schlug er mit der rechten Hand auf die Lenkstange, dass das Rad einen Schlenker machte und er beinahe gestürzt wäre. »Bonjour, Mademoiselle!«, sagte er leise, als ob er üben würde, dann kräftiger, entschiedener: »Bonjour!«, und dann noch eine Nuance männlicher, selbstbewusster: »Bonjour!«
Léon erneuerte seinen vor der Abreise gefassten Vorsatz, in Saint-Luc ein neues Leben zu beginnen. Er würde ab sofort seinen Kaffee nicht mehr zu Hause, sondern im Bistro trinken und immer fünfzehn Prozent Trinkgeld auf den Tresen legen, und er würde nicht mehr den Petit Inventeur lesen, sondern den Figaro und den Parisien, und er würde auf dem Trottoir nicht mehr rennen, sondern schlendern. Und wenn eine junge Frau ihn grüßte, würde er nicht mit offenem Mund gaffen, sondern ihr einen kurzen, scharfen Blick zuwerfen und dann lässig zurückgrüßen.
Bleischwer war die Müdigkeit in seine Beine zurückgekehrt. Jetzt verwünschte er die uferlose Ebene. Die Hügellandschaft vorhin hatte immerhin ein Wechselspiel von Hoffnung und Enttäuschung geboten, jetzt gab es nur mehr illusionslose Klarheit, dass das Ziel noch fern war. Um die Weite nicht mehr sehen zu müssen, legte er seine Unterarme auf die Lenkstange und ließ den Kopf zwischen die Schultern fallen, beobachtete das Auf und Ab seiner Füße und behielt, damit er nicht vom Weg abkam, den Straßengraben im Auge.
So bemerkte er nicht, dass weit vor ihm die Wolkendecke aufriss und ein Bündel schräger Sonnenstrahlen auf die grünen Weizenfelder fiel und dass am Horizont zwischen den Platanen ein Punkt auftauchte, der rasch größer wurde und eine rotweiß gepunktete Bluse trug. Léon bemerkte auch nicht, dass die junge Frau diesmal freihändig fuhr, und als er das vertraute Quietschen hörte, war sie schon heran, zeigte ihm ihre Zähne mit der hübschen Lücke in der Mitte, winkte ihm zu und fuhr vorbei.
»Bonjour!«, rief Léon und ärgerte sich, dass er aufs Neue zu spät gekommen war. Fehlte nur noch, dass sie ihn, da sie nun wieder in seinem Rücken war, ein zweites Mal überholte; diese Demütigung wollte er sich ersparen. Er beugte sich über den Lenker, versuchte zu beschleunigen und schaute schon nach wenigen hundert Metern besorgt nach hinten, ob sie wieder am Horizont auftauche; bald aber richtete er sich auf und zwang sich, langsamer zu fahren. Schließlich war es sehr unwahrscheinlich, dass die rasante Person binnen weniger Minuten ein drittes Mal über dieselbe Straße fahren würde. Und falls doch, würde er das Rennen – das für sie ja noch nicht mal eines war – sowieso verlieren. Er hielt an und legte sein Rad in den Kies, sprang über den Straßengraben und streckte sich lang im Gras aus. Nun konnte sie ruhig kommen. Er würde im Gras liegen und an einem Grashalm kauen wie einer, der gerade Lust auf eine kleine Rast hatte, und er würde mit dem Zeigefinger an den Mützenrand tippen und laut und deutlich »Bonjour!« rufen.
Léon aß das letzte der drei Käsebrote, die Tante Sophie ihm mitgegeben hatte. Er zog die Schuhe aus und rieb seine brennenden Füße, und ab und zu schielte er nach links über die einsame Straße. Ein Windstoß brachte etwas Nieselregen, der aber rasch wieder aufhörte. Ein nachtblauer Lastwagen fuhr vorbei, an dessen Seitenwänden in goldener Schrift »L’Espoir« stand, etwas später trottete ein schwarzweißer Hund querfeldein. Plötzlich wurde ihm klar, wie sehr er sich gerade zum Affen machte mit seinem Grashalm und der ostentativen Entspanntheit; selbstverständlich würde das Mädchen, falls es nochmal vorbeikäme, die Komödie auf den ersten Blick durchschauen. Er spuckte den Grashalm aus und zog seine Schuhe wieder an, sprang über den Wassergraben zurück auf die Straße und stieg aufs Rad.
3. KAPITEL
Der Bahnhof von Saint-Luc-sur-Marne lag einen halben Kilometer vor der Stadt zwischen Weizenfeldern und Kartoffeläckern an einer Nebenlinie der Chemins de Fer du Nord. Das Stationsgebäude bestand aus rotem Backstein, der Güterschuppen aus verwittertem Fichtenholz. Léon bekam eine schwarze Uniform, die Sergeantenstreifen an den Ärmeln hatte und ihm erstaunlicherweise wie angegossen saß. Er war der einzige Untergebene seines einzigen Vorgesetzten, des Bahnhofsvorstehers Antoine Barthélemy. Dieser war ein hageres, friedfertiges Männchen mit Tabakpfeife und einem Schnurrbart à la Vercingetorix, das wortkarg und gewissenhaft seinen Dienst tat. Tag für Tag brachte er viele Stunden damit zu, im Dienstbüro kleine geometrische Muster auf seinen Schreibblock zu zeichnen in geduldiger Erwartung des Augenblicks, da er in seine Dienstwohnung im Obergeschoss über der Schalterhalle zurückkehren durfte. Dort erwartete ihn seit vielen Jahrzehnten rund um die Uhr sehnsüchtig seine Frau Josianne, die rosige Wangen und runde Hüften hatte, leicht in herzhaftes Lachen ausbrach und eine ausgezeichnete Köchin war.
Gerade viel zu tun gab es nicht am Bahnhof von Saint-Luc-sur-Marne. Am Morgen wie am Nachmittag hielten fahrplanmäßig je drei Regionalzüge in beide Richtungen; die Schnellzüge fuhren mit großer Geschwindigkeit vorüber und zogen einen Fahrtwind hinter sich her, dass einem auf dem Bahnsteig die Atemluft wegblieb. Nachts um zwei Uhr siebenundzwanzig fuhr der Nachtzug Calais-Paris vorbei mit seinen dunklen Schlafwagen, in denen ab und zu ein Fenster erleuchtet war, weil ein reicher Reisender in seinem weichen Bett nicht in den Schlaf fand.
Zu Léon Le Galls eigener Überraschung war er seiner Aufgabe als Morseassistent vom ersten Tag an einigermaßen gewachsen. Sein Dienst begann morgens um acht und endete abends um acht, mit einer Stunde Pause am Mittag. Sonntags hatte er frei. Es gehörte zu seinen Pflichten, bei der Einfahrt eines Zuges auf den Bahnsteig hinauszutreten und dem Lokführer mit einer kleinen roten Fahne zu winken. Morgens musste er den Postsack und den Sack mit den Pariser Zeitungen gegen die leeren Säcke vom Vortag tauschen. Wenn ein Bauer eine Kiste Lauch oder Frühlingszwiebeln als Stückgut zum Spedieren aufgab, musste er die Ware wiegen und einen Frachtbrief ausstellen. Und wenn das Morsegerät tickte, musste er den Papierstreifen abreißen und die Nachricht auf ein Telegrammformular übertragen. Es waren stets dienstliche Mitteilungen, das Morsegerät diente ausschließlich der Bahn.
Natürlich hatte Léon dreist gelogen, als er behauptet hatte, er könne morsen, und den Praxistest auf dem Schreibtisch hatte er nur deswegen bestanden, weil der Bürgermeister von der Materie noch weniger Ahnung hatte als er selbst. Glücklicherweise aber war der Bahnhof von Saint-Luc ein abgeschiedener Ort, an dem höchstens vier oder fünf Telegramme täglich eintrafen; so hatte Léon alle Zeit der Welt, diese mithilfe des Petit Inventeur, den er vorsorglich eingesteckt hatte, zu entziffern.
Etwas umständlicher war’s, wenn er selbst eine Nachricht verschicken musste, was etwa jeden zweiten Tag vorkam. Dann schloss er sich, bevor er ans Morsegerät ging, mit Papier und Bleistift auf der Toilette ein und übertrug die lateinischen Buchstaben in Punkte und Striche. Das ging gut, solange die Telegramme aus nur wenigen Wörtern bestanden. Am Montag der dritten Woche aber drückte ihm der Chef den Monatsrapport in die Hand und beauftragte ihn, diesen vollumfänglich und wortgetreu an die Kreisdirektion nach Reims zu übermitteln.
»Per Post?«, fragte Léon und blätterte den Rapport durch, der aus vier ziemlich eng beschriebenen Seiten bestand.
»Telegrafisch«, sagte der Chef. »Ist Vorschrift.«
»Wieso?«
»Keine Ahnung. Ist einfach Vorschrift. War schon immer so.«
Léon nickte und überlegte, was zu tun sei. Als der Chef wie gewohnt pünktlich um halb zehn zum Kaffeetrinken hinauf zu seiner Josianne stieg, griff er zum Telefon, ließ sich mit der Kreisdirektion in Reims verbinden und begann den Rapport zu diktieren, als wäre das seit Jahrzehnten so und nicht anders guter Brauch. Und als die Telefonistin sich über die ungewohnte Mehrarbeit beschwerte, erklärte er ihr, letzte Nacht habe der Blitz eingeschlagen und das Morsegerät außer Funktion gesetzt.
Léons Zimmer lag weitab von der Wohnung des Bahnhofsvorstehers im Obergeschoss des Güterschuppens. Er hatte ein eigenes Bett und einen Tisch samt Stuhl sowie einen Waschtisch mit Spiegel und ein Fenster mit Blick auf das Gleis. Hier war er ungestört und konnte tun und lassen, was er wollte. Meist tat er nicht viel, sondern lag nur auf dem Bett mit am Hinterkopf verschränkten Händen und betrachtete die Maserung des Gebälks.
Mittags und abends brachte ihm die Frau des Bahnhofsvorstehers, die er Madame Josianne nennen durfte, sein Essen; dabei überschüttete sie ihn mit mütterlicher Fürsorge und verbalen Zärtlichkeiten, nannte ihn Liebling, Engel, Pferdchen und Goldstück, erkundigte sich nach der Qualität seiner Verdauung, seines Schlafs und seines seelischen Befindens und bot sich an, ihm die Haare zu schneiden, Wollsocken zu stricken, die Beichte abzunehmen und die Wäsche zu waschen.