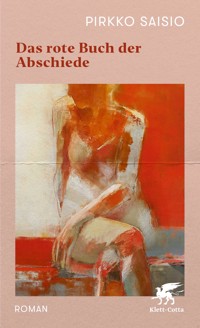19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Wie Annie Ernaux, aber lustig« Irène Bluche, rbb Kultur Das kleinste gemeinsame Vielfache« ist ein Meisterwerk der Erzählkunst und eine berückend schöne Geschichte über ein unangepasstes Mädchen, das unbeirrt seinen Weg geht. Der plötzliche Tod des Vaters staubt die Erinnerung an eine Kindheit im Helsinki der 50er Jahre ab und übermalt sie mit neuer Farbe: Die Ich-Erzählerin wächst im Arbeiterviertel Kallio auf und hat schon mit acht Jahren das Gefühl, nirgends richtig hinzupassen. Weder zu ihren Eltern, die nur Augen und Ohren für die internationale sozialistische Arbeiterbewegung haben. Noch in ihr Zuhause, wo die einzigen Bücher im Regal von Lenin und Stalin stammen. Aber auch nicht in den Religionsunterricht, auch wenn die Sache mit Jesus erstmal verführerisch klingt. Und obendrein will sie viel lieber ein Junge sein, Kniebundhosen tragen und im Stehen pinkeln. Doch dann entdeckt sie, dass sie die Erzählerin ihrer eigenen Geschichte sein kann. Das ist wie ein Wunder, auf einmal scheint alles möglich. »Das kleinste gemeinsame Vielfache« ist die Geschichte einer Verwandlung und die erste Selbstermächtigung eines kleinen Mädchens, einer zukünftigen Schriftstellerin. Erzählt von der bedeutendsten Ikone Finnlands, deren Werk nun endlich auch auf Deutsch zu entdecken ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Pirkko Saisio
Das kleinste gemeinsame Vielfache
Roman
Aus dem Finnischen von Elina Kritzokat
Klett-Cotta
Impressum
Die Übersetzung und Veröffentlichung dieses Buches wurde gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds, FILI – Finnish Literature Exchange.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Pienin yhteinen jaettava« im Verlag WSOY, Helsinki
© 1998 by Pirkko Saisio
Published by agreement with Helsinki Literary Agency
Für die deutsche Ausgabe
© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Anzinger und Rasp Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung einer Abbildung von © Melinda Cootsona
Stadtplan Helsinki: VH-7 Medienküche GmbH, Stuttgart
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98726-3
E-Book ISBN 978-3-608-12375-3
Sie
Ich war acht, als es zum ersten Mal passierte.
Es war ein Morgen im November.
Die Straße glänzte schwarz und wölbte sich vor den schneeregennassen Fenstern.
Ich sah mich in der Scheibe, ich war rundlich und schlecht gelaunt.
Ich zerrte mir die engen Wollstrümpfe über die Beine.
An den Miederschnüren fehlte unten ein Knopf.
Mutter holte ein Fünfmarkstück aus ihrer Handtasche, und ich drückte es als Ersatzknopf von innen in die Strumpfwolle.
Da passierte es zum ersten Mal.
In meiner Vorstellung schrieb ich einen Satz: Sie wollte nicht aufstehen.
Ich korrigierte den Satz: Sie wollte noch nicht aufstehen.
Ich fügte einen zweiten hinzu: Sie war zu müde, um in die Schule zu gehen.
Ich verbesserte den zweiten Satz: Sie war viel, viel zu müde, um in die Schule zu gehen.
Triumphierend sah ich zu meinem Vater, der im bloßen Hemd die Arbeiterzeitung las und schwarzen Kaffee trank.
Mutter stand vor dem Flurspiegel, tupfte sich Lippenstift vom Mund auf die Wangen und summte das Lied Ahoi Mannschaft.
Keiner hatte bemerkt, dass aus meinem Ich ein Sie geworden war, das ich einer ständigen Beobachtung unterwarf.
Die Hitze hatte noch immer nicht nachgelassen, dabei war schon September: Zwei Wochen war ich weg gewesen.
Die Linden am Nordufer ließen müde und niedergeschlagen ihre staubigen Blätter hängen, und auf meinen funkelnagelneuen Fenstern klebte bereits eine zähe Schmutzschicht. Steife Plastikplanen verhüllten die Wohnzimmereinrichtung. Stühle, Bücher, das tibetische Thangka und die schwarzen Musiker des Puppenorchesters aus Stockholm schimmerten durch dieses Plastikeis wie Treibgut von der Titanic.
Während meines Aufenthalts in Südkorea hatten sie wie vereinbart die Fenster ausgetauscht.
Ich holte meine Mitbringsel aus dem Koffer. Umgeben von dem Meer aus Plastik, wirkten die kleinen koreanischen Gegenstände verloren und absurd, als hätten auch sie Schiffbruch erlitten.
Mein Fieber stieg; seit über einer Woche hatte ich erhöhte Temperatur.
Ich lächelte und sagte etwas, vom Fieber aber schwieg ich.
Ab jetzt hatte ich wieder Mutter zu sein, und Lebensgefährtin.
Und Tochter.
In Korea wohnte ich im Zentrum des alten Seouls, in einer wachsenden Enge aus Schaufelbaggern, Parkhäusern, McDonald’s-Filialen und Bürogebäuden aus Beton.
Aus der aufgerissenen Straße vor dem Hotel ragten Kabel; zum Eingang gelangte man nur über ein paar lose hingeworfene Planken, die über die in der Erde klaffende Wunde führten.
Doch hinter der schwarzlackierten Tür öffnete sich eine hübsche koreanische Ansicht.
In der Mitte des Innenhofs stand ein Baum. Seinem krummen Wuchs zum Trotz schob er die Zweige unermüdlich in die Sonne.
Neben dem Stamm ruhte ein aus Ton gemauerter Ofen, leere Coca-Cola-Kästen stapelten sich vor der Brennkammer, die unbenutzt blieb, das Hotel hatte einen Abrissbescheid erhalten.
Papierne Schiebetüren umrahmten den Innenhof. Hinter ihnen lagen zwei Quadratmeter große Zimmerchen, auf deren Boden man zum Schlafen eine dünne Bastmatte ausrollte.
Bevor das Haus ein Hotel wurde, hatten in den Zimmern Söhne und Töchter, Schwiegersöhne und Schwiegertöchter gewohnt.
Zu der Zeit führten die Großeltern das Haus, und zu den Mahlzeiten aus Kimchi und Reis versammelten sich alle um den Ofen, durch dessen schmales Abzugsrohr der Rauch aus dem Hof in den Himmel stieg.
Jetzt zogen Staubwolken von der Baustelle über dem Haus entlang.
Die dauerlächelnden alten Hotelbesitzer taten, als sähen sie es nicht.
Und wir Hotelgäste, Jäger der Vergangenheit, husteten in unsere Taschentücher.
Der Plankenweg, der zum Hoteleingang führte, wurde mit jedem Tag länger.
Hinaus gelangte man nur noch durch die Hintertür.
Sie ging auf eine Gasse, in der es nach Urin und Fischabfällen stank.
Als ich am Abreisetag meinen Koffer zum Taxi schleppte, das nicht bis zum Hotel hatte vorfahren wollen, sah ich, wie ein deutscher Tourist in Wanderkleidung mit einem Schweizer Armeetaschenmesser eine gebrannte Keramikverzierung von der Regenrinne des Hotels löste.
Erst abends rief ich in der Hämeentie an, der Straße, in der ich lange gewohnt hatte.
Ich musste warten, bis abgehoben wurde.
Vaters Stimme klang müde und depressiv, mal wieder.
»Ich bin’s nur.«
Ihre Stimme klang weich, irgendwie süßlich.
Seit einiger Zeit redete sie mit ihrem Vater wie mit einem
Kind.
»Ach so.«
Dann legte er den Telefonhörer auf den Tisch, es war deutlich zu hören.
Ich probierte den Calvados, den ich auf dem Rückweg über Paris gekauft hatte. Er war vierundzwanzig Jahre alt, besaß ein dezentes Raucharoma und eine noch dezentere Apfelnote, wie es sich für guten Calvados gehörte. Trotzdem schmeckte er mir nicht, und das Fieber jagte mir unangenehme Schauer über Rücken und Beine.
Eine Minute verging, eine zweite.
Ich hörte ein Rauschen, das Poltern des Gehstocks, das vertraute Husten. Dann:
»So, ich habe mir einen Stuhl geholt. Du bist also wieder zurück.«
»Ja, seit einer Stunde.«
Warum log sie?
»Aha.«
»Ja.«
Ich nahm einen weiteren Schluck. Der Alkohol brannte in der Kehle und trieb mir Schweiß auf die Stirn, den das Fieber gleich trocknete.
»Schon wieder eine Reise. Dauernd unterwegs.«
»Es war wegen der Arbeit.«
Sie verteidigte sich.
Aus irgendeinem Grund hatte sie das Bedürfnis, sich zu verteidigen.
»Wie geht’s denn so?«, fragte ich.
»Kann mich nicht beschweren.«
»Aha.«
»Rumsitzen. Wie’s Leben halt ist.«
»So ist es. Oft jedenfalls.«
Wie eine Wasserpflanze im warmen Meeresstrom schaukelte sie in Vaters Sprachrhythmus.
»Ja, oft«, brummte er.
»Tja.«
»Das ganze Leben.«
»Hmm.«
»Ja.«
»Und wie geht’s Kerttu?«
Kerttu war sechsundachtzig Jahre alt, doch Vater bezeichnete sie als seine Freundin.
Als sie Kerttu vor zehn Jahren kennenlernte, saß diese in dem Sessel, in dem schon ihre Mutter gesessen hatte. Und aus dem Sessel waren seit dem Tod ihrer Mutter schon mindestens Aune, Lempi, die Wermut trank und ab acht Uhr morgens Patiencen legte, und Siviä geflohen, die sich auf eine Brieffreundschaftsannonce gemeldet hatte.
Kerttu war eine stilvoll gealterte Witwe, die adrett hüstelnd den Cognac trank, den Vater ihr zum Kaffee servierte. Im Laufe von zehn Jahren machte er sie auch mit Whisky, Koskenkorva, Smirnoff, süßen Beerenlikören, Bier und Longdrinks mit Gin vertraut.
»Sie holen sie jeden Abend ab und bringen sie irgendwohin.«
»Kerttu?«
»Ja.«
»Wohin denn?«
»Ich weiß nicht.«
Vaters Stimme klingt jetzt erregt.
Sie muss die fiebrigen Wogen verlassen.
»Aber wohin bringen sie sie denn?«
»Wo man alte Menschen eben hinbringt. Sie verraten es nicht.«
Ich zünde mir eine Zigarette an. Auch die schmeckt nach Fieber.
»Und wer holt sie ab?«
»Raimo, ihr Sohn. Jeden Abend, mit dem Auto. Jeden Abend.«
»Oh je.«
»Ja.«
Im Hörer rauscht es wieder.
Es klingt ungeduldig.
»Vielleicht rufst du da mal an«, tönte es ängstlich in mein Ohr.
»Wo denn?«
»Da, wo man sie hinbringt.«
Die Pause wird unangenehm lang.
Ich müsste Fieber messen, denkt sie.
»Gut, ich rufe da an«, lüge ich.
»Ja, mach das.«
»Klar.«
»Die werden dir schon was sagen.«
Ich schaffe das nicht, denkt sie.
Tochter sein. Heute, mit diesem Fieber.
Wieso denke ich mich als sie, denkt sie.
»Ich komme morgen bei dir vorbei«, sage ich und spreche noch tiefer und sanfter.
»Mach das.«
»Ich würde schon heute kommen, aber ich habe wohl etwas Temperatur.«
»Aha.«
»Na dann, halte durch.«
»Muss ich ja.«
»Bis morgen.«
Sie legt auf und schaut durchs Küchenfenster in den Innenhof.
Der Hausmeister fegt den Asphalt und wischt sich den Schweiß von der Stirn.
Die im Frühling gepflanzten Blumen ragen aus ihren Pressspankästen vertrocknet in die Abendsonne.
Dieser Sommer endet nie, denkt sie.
Nachts im Traum war ich wieder einmal in der Fleminginkatu, auch dort habe ich als Kind gewohnt.
Mutter war von einer langen Reise zurück, aber einen Koffer hatte sie nicht dabei.
Heiter und abwesend saß sie im Sessel und trug den Rock aus Bukarest mit den tanzenden Nationen unten am Saum.
Ich stand an der Flurtür und suchte nach einem Wort, einem Satz oder einem Lied, mit dem ich Mutter davon abhalten konnte, erneut fortzugehen.
Die Sonne stach durch den Spalt zwischen den Vorhängen und malte ihr strenge Schatten unter die Augen und die markanten Nasenlöcher.
Sie lächelte zufrieden in sich hinein und sah mich nicht an.
An dieser Stelle wachte ich auf. Das Fieber war ein wenig gesunken.
Schon um neun rief ich Vater an.
Er ging nicht ans Telefon.
Um zehn rief ich Raimo an.
Der erzählte, dass Kerttu seit vorigem Dienstag in einem Heim für Demenzkranke wohne und seitdem garantiert nicht mehr in der Hämeentie gewesen sei.
Sofort machte ich mich dorthin auf.
Aber
bereits am Nordufer bleibt sie stehen, denn hinter den schlaffen Linden liegt das ölig-stille Meer, auf dem ein Schoner mit roten Segeln geruhsam dahingleitet.
Den Schoner prägt sie sich ein.
Sie braucht ihn und das Meer und diesen Moment dringend und betet, er möge nicht enden, damit sie nicht in die Hämeentie gehen, die Tür aufmachen und vorfinden muss, was sie schon vorzufinden weiß, auf der anderen Seite.
Letztes Jahr im Juni hat Vater das Sommerhaus verkauft.
Als ich meine Sachen abholte, schaute ich nicht mehr auf den See, aber ich wusste, dass er glitzerte und die Birken das saftige Grün des Frühsommers feierten, so, wie wir es seit achtundzwanzig Jahren bewundert hatten.
Im November musste Vater sich im Gesundheitszentrum einen Gehstock holen, und im Januar verkaufte er das Auto.
Als der Lada in die Päijänteentie einbog und verschwand, bemerkte Vater seinen Fehler, umklammerte meinen Arm und stützte sich mit der freien Hand an der Betonwand der Garage ab.
»Jetzt habe ich gar nichts mehr.«
Im März war die Beerdigung von Jopi, einem alten Verwandten.
Ich holte Vater ein Schinkenbrot und ein Stück Karamellkuchen vom Büfett im neuen Gemeindehaus, das irgendwann plötzlich neben dem Friedhof Malmi aufgetaucht war; das Speisenangebot für den Leichenschmaus hatte ich im Laufe der letzten Jahre gründlich kennengelernt.
»Nach und nach verschwinden alle«, klagte Vater,
und
wieder muss sie vor der abgenutzten Trostlosigkeit seiner Stimme fliehen, und so ist sie mitten im gleichmütigen Kerzenlicht und dem kühlen Klirren der Kaffeetassen weit, weit weg, auf einem glitzernden Meer ohne Ufer, in ihrem nach Benzin riechenden Boot, das in diesem kurzen Tagtraum eine stolze Barke ist, schwerfällig, aber nicht morsch und auf dem Weg fort, weit fort.
Im Juli wurde meine Patentante Sisko beerdigt.
Vater trug seinen weißen Trainingsanzug und fing mich vor der Kapelle ab. Aus seiner Jackentasche lugte eine Krawatte; das Knotenbinden beherrschte er nicht mehr, und auch Kerttu hatte sich an das komplizierte Prozedere nicht erinnern können.
Die Schnürsenkel seiner Turnschuhe waren ebenfalls nicht zugebunden.
Ich bückte mich, machte zwei Schleifen und führte Vater in die Kapelle.
Vom Büfett im Gemeindehaus holte ich ihm ein Schinkenbrot und ein Stück Karamellkuchen. Das Brot schnitt ich in mundgerechte Happen, den Kuchen schob ich essbereit auf den Löffel, damit möglichst wenig danebenging.
Und
angesichts der mitfühlenden und wohlwollenden Blicke, in deren Feuer sie für einen Moment stand, fühlte sie sich verlegen und verlogen: die gute Tochter.
Ich drückte auf Vaters Klingel. (Vor neunundzwanzig Jahren war das auch noch meine Klingel gewesen.)
Hinter der Tür herrschte Stille.
Ich klingelte noch einmal.
Ich spähte durch den Briefschlitz, doch die Zwischentür war zu.
Ich zündete ein Streichholz an und hielt es an den Spalt über der Schwelle. Zwischen der Wohnungstür und der Zwischentür lagen unberührt die Helsingin Sanomat und die Sonntagsausgabe der Volksnachrichten.
Im Treppenhaus ging das Licht aus.
Und
sie steht im Dunkeln und möchte am liebsten in einer schalltoten Ellipse der Zeit versinken, nicht mehr hier sein. Fort sein, weit fort von diesem dunklen Treppenhaus.
Aber
ich machte das Licht wieder an und versuchte, klar zu denken.
Jetzt ist Eile angesagt, versuchte ich zu denken.
Ich klingelte beim Nachbarn; das schaffte ich.
Doch er machte nicht auf.
Ich klingelte bei sämtlichen Nachbarn auf der Etage meines Vaters; ich schaffte auch das.
Doch niemand machte auf, und
dann ist sie im Fahrstuhl.
Und nach dem Fahrstuhl kommt die Haustür und dann der Asphalt im Innenhof.
Sie sieht sich die Hämeentie entlanglaufen, fiebrig und atemlos.
Sie sieht sich hoffen, ihr käme ein Polizeiauto entgegen, in dem ein Polizist mit einem Schlüssel und einer Antwort auf die Frage säße, was jetzt zu tun ist.
Sie will zur Polizei laufen, um eine Antwort, einen Schlüssel und die Erlaubnis zu erhalten, Vaters Zuhause zu betreten, ihr Zuhause.
Sie hat die Polizei und den Schlüssel und die Antwort schon fast erreicht,
doch
da kamen mir zwei Betrunkene entgegen, in Umarmung aufeinander gestützt.
Einer von ihnen war ein alter Kindheitsfreund, und während die Hämeentie ignorant toste, bekam ich Angst, der alte Freund könnte ausgerechnet jetzt nach meinem Vater fragen.
Und das war der Grund, weshalb ich durch eine offen stehende Tür in ein Chinarestaurant lief.
Ich taumelte gegen eine Sitzecke und wurde von einer Speisekarte gestoppt, die mir der Kellner vors Gesicht hielt.
»Gutön Moogen!«
Und
schon sieht sie sich auf einer weichen Bank im Chinarestaurant sitzen und die Speisekarte studieren.
Jetzt bin ich lächerlich, denkt sie.
Jetzt muss was passieren, denkt sie.
Das ist ein Albtraum, denkt sie.
Das ist eine Szene von Woody Allen, denkt sie.
Jetzt muss ich klar denken, denkt sie,
und
nachdem ich mich bei dem irritierten Kellner entschuldigt und von der Bank geschlängelt habe und auf die Straße gerannt bin, halte ich erst wieder im Metrotunnel an. Ich kaufe eine Fahrkarte; wohin ich will, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass ich Fieber habe, hohes Fieber.
Ich weiß, dass Vater hinter zwei Türen liegt und die Arbeiterzeitung und die Helsingin Sanomat nicht vom Boden aufheben kann,
und
trotzdem bleibt sie am Fahrkartenautomaten stehen und lässt sich von den Geräuschen im Tunnel forttragen aus Raum und Zeit, weit fort.
Und als der wallende Rock einer Roma-Frau in den Rolltreppenstufen hängen bleibt, lauscht sie friedlich-verträumt den hastigen Schritten des Wachpersonals und dem Quietschen der abrupt gestoppten Rolltreppe; sieht den unruhigen, nie abreißenden Strom der gehetzten Familien, japanischen Touristen, schlurfenden Säufer, weißbemützten Rentner, verschleierten Musliminnen, Somali und Senegalesen und müden, vor Hitze rotgesichtigen finnischen Kinder.
Sie träumt sich zurück ins südkoreanische Nationalmuseum, wo hinter Glas eine große Puppe auf einem Pferd galoppierte, und erst jetzt wird ihr klar, dass die Zungen am goldenen Puppenhelm Flammen darstellen sollten, doch dann fällt ihr wieder ein, wo sie ist.
Ich muss klar denken, denkt sie und reißt sich aus ihrem Fiebertraum.
Jetzt nur noch der Weg vom Fahrkartenautomaten bis zum R-Kiosk weiter hinten im Tunnel.
Ich muss einen Stift kaufen, denkt sie und sagt diesen Gedanken laut zur Verkäuferin.
Die sieht sie erstaunt an.
Jetzt habe ich es falsch gesagt, denkt sie, doch die Verkäuferin lächelt bereits freundlich:
»Bleistift oder Kugelschreiber?«
Ich muss mich entscheiden, denkt sie gestresst.
»Vielleicht einen Bleistift«, sagt sie aufs Geratewohl.
»Haben wir leider nicht.«
Die Verkäuferin lächelt noch immer.
Sie ist eine junge Frau mit sanften Kurven und Einsprengseln eines langsam erlöschenden Savo-Dialekts.
Und
in diesem Moment würde ich gern hierbleiben, meinen Kopf ins Tal zwischen den zwei Hügeln der Verkäuferinnenbrüste drücken und über mein Schicksal klagen, weil es gerade sehr schwer ist, Mutter und Lebensgefährtin und Tochter zu sein.
Aber
noch gibt sie nicht auf, sie muss weiterkämpfen.
»Dann einen Kuli.«
»Kulis haben wir leider auch nicht.«
Sie sieht sich ratlos im Dämmerlicht der Brusthügel und des Savo-Lächelns stehen, lässt sich aber diesmal nicht aus dem Griff von Raum und Zeit fallen.
»Verdammt«, hört sie sich sagen, »es gibt doch in jedem Kiosk einen Stift!«
Und ihr Blick erhascht einen Kugelschreiber, der nichts Böses ahnend auf einem Block Karopapier schlummert.
»Da ist doch einer«, hört sie sich triumphieren.
»Der gehört aber dem Personal.«
In die einlullende Wärme der Savo-Stimme schleicht sich ein bedrohlich kühler Luftstrom.
»Egal, ich nehme ihn«, hört sie sich sagen,
und
dann muss ich die Hämeentie zurückrennen und dabei überlegen, warum der Stift eigentlich so wichtig ist.
An der Tür fällt es mir wieder ein: Ich muss den Hausmeister anrufen.
Ich muss ins Treppenhaus gehen, auf die Tafel schauen, die Nummer aufschreiben, zum Kiosktelefon laufen, den Hausmeister anrufen und ihn um einen Schlüssel für die Tür bitten, hinter der Vater liegt, lebendig oder tot.
Der Hausmeister schließt auf.
»Na dann«, sage ich.
Die Badezimmertür steht offen.
Vater liegt in Unterhose auf den Fliesen und klammert sich mit weißen Fingernägeln an den Schlauch der Waschmaschine.
Die eine Wange ist blau.
Der Hausmeister steht auf der Flurmatte.
Ich stehe schon an der Badezimmertür.
»Na dann«, sagt der Hausmeister, »ich werde hier wohl nicht mehr gebraucht.«
»Eher nicht«, sage ich, doch bevor ich zu Vater gehen darf, muss ich einen Hundertmarkschein und den Personal-Kuli vom Kiosk aus meiner Hosentasche kramen und das Aufschließen der Tür quittieren.
Der Hausmeister verschwindet. Die Wohnungstür fällt zu,
und
dann will die Zeit einfach nicht mehr vergehen.
Sie steht auf der Flurmatte und weiß nicht, was zu tun ist.
Sie gähnt und denkt an das Fieber.
Sie streicht mit der Hand übers Telefon, und erst dann schafft sie den Schritt ins Badezimmer.
Vaters Augenlider bewegen sich.
»Hallo«, sagt sie und weiß nicht, was sie mit dem Kuli machen soll, der unmotiviert von einer Hand in die andere wandert.
Es ist jetzt ein schmutziger Kuli, ein von klebrig-kaltem Schweiß besudelter Gegenstand.
Vaters Lippen bewegen sich, und nach kurzem Zögern neigt sie ihr Ohr an den zahnlosen, blau angelaufenen Mund:
»Bist ja am Ende doch noch gekommen.«
Die grüne Schirmmütze; das gelbe Flugzeug
Ich bin ein Einzelkind.
Es dauert lange, bis mir das auffällt, denn um mich herum gibt es viele Menschen.
Es gibt Mutter.
Mutter ist immer zu Hause, so lange, bis sie als Verkäuferin im Kolonialwarenladen von Irja Markkanen anfängt und ich in den Kindergarten muss.
Mutter trägt auch im Alltag eine weiße Spitzenbluse mit beigefarbenen Knöpfen.
Sie hört viel Radio und singt russische Kampflieder, denn als sie noch jung war, gehörte sie zur Band der Finnisch-Sowjetischen Gesellschaft.
Auch Sirpakka war in der Band, deshalb macht Mutter ihr weiterhin die Tür auf, dabei ist Sirpakka ständig betrunken, was sich für eine Frau nicht gehört.
Sie kommt aus Varkaus, wie Mutter, aber Sirpakka ist vor die Hunde gegangen und Mutter nicht.
Sirpakka schenkt Mutter in Papier eingewickelte Topfblumen, aber wenn Mutter in die Küchenecke geht und sie auspackt, kommt eine Flasche Koskenkorva-Wodka zum Vorschein, die längst nicht mehr voll ist.
Sirpakka trinkt auch den Rest allein, während Mutter nervös auf dem Ausziehbett sitzt, zur Uhr blinzelt und hofft, dass Sirpakka weg ist, bevor Vater aus dem Büro kommt.
Vater nennt Sirpakka Saufstiefel.
Vater hat dichte Locken und eine Wolljacke, in die meine Großmutter Elche gestrickt hat.
Er arbeitet bei der Finnisch-Sowjetischen Gesellschaft.
An den Wochenenden fährt er durchs ganze Land und führt den Menschen russische Filme vor, damit sie korrekt über die Erfolge des Sozialismus und so weiter informiert werden.
Sehr oft zu Besuch kommt Tante Ulla.
Tante Ulla trägt einen tollen grünen Mantel aus weichem Kunstpelz, und auf ihrer schwarzen Samtmütze prangen goldene Sterne.
Sie kommt am liebsten, wenn Vater nicht zu Hause ist, denn seit sie bei der letzten Parlamentswahl einen Kandidaten der Sammlungspartei gewählt hat, wegen seiner schönen braunen Augen, verstehen die beiden sich nicht mehr.
Tante Ulla ist Mutters ältere Schwester.
Auch sonst haben wir viel Besuch, und den meisten Leuten scheint es recht zu sein, wenn Vater da ist.
Und besonders oft haben wir Versammlungen.
Versammlungen sind blöd, dann wird auf unserem einzigen Tisch Protokoll geschrieben, und ich muss still herumsitzen und alleine spielen.
Bei den Versammlungen bin ich immer das einzige Kind im Raum, was nicht schön ist, aber immerhin besser, als Einzelkind zu sein, denn das ist richtig ernst und kompliziert.
Doch ob nun Mutters alte Bandmitglieder mit ihren Familien zu Besuch sind oder der Frauen-Nähclub von Vaters Radsportgruppe Blitzbrüder oder Vaters Verwandte und all deren Kinder: Ich bin und bleibe das einzige Einzelkind.
Einzelkind zu sein heißt, dass die anderen Kinder im Hof angeblich immer fürchterlich neidisch sind auf meine Sonntagsausflüge und dass ich nicht um acht aufstehen und zum Kindergottesdienst muss, weil meine Eltern und ich an so was wie Kirche nicht glauben. Ich würde alles kriegen, was ich will, und müsste nie mit jemandem teilen, und deshalb wäre klar, dass ich später höchstwahrscheinlich egoistisch werden und nur auf meinen Vorteil bedacht sein würde.
Das ist ja im Grunde unausweichlich.
Über Mutter sagen die anderen Kinder, dass sie jung und schön ist, und in dem Punkt bin ich ganz ihrer Meinung.
Aber dann heißt es sofort, dass sie nur deshalb so jung und schön aussieht, weil sie keine Lust hat, mehr Kinder zu kriegen als nur eins.
Über Vater sagen sie, dass er gut aussieht und ein anständiger Familienvater ist, der sich nichts aus Schnaps macht.
Damit bin ich sehr einverstanden. Dann wiederum heißt es aber, er könne es nicht mit echten Männern aufnehmen, wenn’s drauf ankommt, zum Beispiel bei Schlägereien mit den Vätern von der Schnapsfraktion, die nach der Samstagssauna Frau und Kinder verprügeln, weil sie im Krieg waren und Splitter im Kopf haben.
Ich frage zu Hause nach, was es mit der Kriegs- und Splittersache auf sich hat, gehe zurück auf den Hof und sage, dass Vater im Krieg in der Kanonenbrigade auf der Festungsinsel Suomenlinna gewesen und unverletzt geblieben ist, Stalin sei Dank, weil Russland lieber den Weltkrieg gewinnen wollte, als das unbedeutende Finnland zu besiegen.
Doch dann sagen sie: Entschuldige mal, Russland hat gegen Finnland nicht gewonnen, sondern verloren, und Kanonenbrigaden gibt es doch gar nicht.
Und wieder bin ich die Einzige, deren Vater nicht bei der Schlacht von Suomussalmi oder wenigstens bei der von Summa dabei war, wo die Finnen massenweise russische Gegner umgelegt haben.
Später erfährt sie, dass auch Vater Einzelkind ist.
Doch erst muss sie die schockierende Tatsache verdauen, dass Vater überhaupt mal ein Kind war.
Und noch viel unbegreiflicher ist die Tatsache, dass auch Großmutter nicht als Großmutter geboren wurde, sondern vorher eine Mutter war, die Mutter von Vater.
Und dass auch sie vor dem Großmutter- und Muttersein ein Kind war, die Tochter von jemandem.
Auf dem Klassenfoto der Volksschule im Arbeiterstadtteil Kallio sieht sie mit ihrer großen Nase und dem Spitzenkragen immerhin schon wie eine Großmutter aus, wenn auch wie eine junge und kleine.
Doch das dickliche Wesen mit den Stiefelchen, dem kahlen Kopf und dem trotzigen Gesichtsausdruck, das auf dem Sofa sitzt und vom weißen Rahmen eingefasst ist, kann unmöglich Vater sein, denn der ist schlank, tatkräftig und hat dichte Locken.
In Großmutters Fotoalbum klebt auch das Bild eines kleinen Mädchens mit Schleife im Haar und luftigem Beinkleid, von dem man nicht sagen kann, ob es ein Rock oder eine Hose ist.
Und als Großmutter erklärt, auch dieses Bild zeige Vater und kein fremdes Mädchen, schnappt sie vor Verwirrung nach Luft,
denn
noch weiß ich nicht, dass meine Großeltern vor Vaters Geburt eine Tochter hatten, die im Alter von zwei Jahren gestorben ist und an deren Stelle mein Vater während der ersten Lebensjahre Schleifen, Röcke und Kleider tragen musste.
Und
erst viel, viel später wird sie wissen, dass ihre Eltern vor ihrer Geburt einen Sohn hatten, der mit vier Tagen starb.
Ich möchte ein Junge sein.
Und mehrere Jahre ist das kein Problem.
Solange niemand zusieht, kann ich im Stehen pinkeln, auch wenn das etwas umständlich ist und spritzt.
Meine Haare sind so dünn, dass sie sowieso meist kurz geschnitten werden, und als ich auch noch pfeifen, fluchen und spucken lerne, werde ich oft für einen Jungen gehalten, jedenfalls im Sommer, wenn ich kurze Hosen tragen darf.
Mädchen verabscheue ich, aber ich kenne auch kaum welche.
Meine besten Freunde Alf, Reiska und Risto übernehmen beim Spielen freiwillig die Rolle der Mutter.
Und ich bin der Vater. Morgens gehe ich zur Arbeit und führe sowjetische Filme vor, und wenn Reiska, Risto oder Alf das Essen fertig haben, komme ich zurück nach Hause.
Wenn ich groß bin, möchte ich Vater sein.
Tante Ulla verrät mir, dass auch sie als Kind ein Junge sein wollte.
Aber dann drehen Mutter und Großmutter mir die Haare auf Lockenwickler und stecken mich in rüschenbesetzte Blümchenkleider und gestärkte Schürzen.
Vater macht einen Fernkurs zum technischen Buchhalter und möchte, dass aus mir eine Frau wird, die es mit den Männern aufnimmt, eine Bergbauingenieurin, eine Doktorin der Wirtschaftswissenschaften oder eine kaltblütige Geschäftsfrau, wie die Forstbesitzerin Hella Wuolijoki. Die hat linke Ansichten und einen BMW, den auch Vater fahren darf, bis er ihn eines Tages kauft.
Großvater findet, man soll die Kinder machen lassen.
Wenn das Kind ein Junge sein will, dann ist das Kind eben ein Junge.
Großvater war es auch, der mir die grüne Schirmmütze gekauft hat, die mit dem gelben Plastikflugzeug vorne drauf. Da bin ich mir sicher.
Ansonsten mag ich neue Kleidungsstücke nicht.
Vor Bekleidungsgeschäften habe ich richtig Angst, denn wenn ich mich in eine neue Jacke oder Skihose reinquetschen muss, weine ich sofort los.
»Jesus«, sagt Vater dann, und Mutter:
»Nun lasst uns mal nicht nervös werden.«
Aber irgendwann hören die Einkaufstouren auf. Für lange Zeit muss ich nicht mehr in ein Bekleidungsgeschäft.
Nur ab und zu ins Schuhgeschäft, doch davor habe ich weniger Angst als vor dem Bekleidungsgeschäft, dem Friseur oder dem Fotostudio. Oder vor dem Kindergarten.
Im Schuhgeschäft muss man den Fuß in ein Röntgengerät schieben, das messen kann, ob der neue Schuh auch wirklich richtig sitzt. Auf dem Röntgengerät kann ich jeden einzelnen Knochen sehen.
Neue Kleidungsstücke tauchen jetzt einfach bei uns auf.
Wenn die Pollaris zu Besuch gekommen sind, stehen nicht nur benutzte Kaffeetassen und Kuchenteller auf dem Tisch, sondern auch Blumen und ein Karton mit Strickjacken und Schürzen.
Ich weiß, dass die Schürzen und Jacken von meiner Schwippcousine Helena sind, der sie nicht mehr passen, und dass Helenas Mutter, Tante Kaarina, sie angeblich ganz aus Versehen bei uns gelassen hat.
Was außer mir niemand weiß: dass Helena der einzige Mensch auf der Welt ist, dessen Schürzen ich freiwillig anziehe.
Helenas Schürzen riechen nach Waschmittel und Bügeleisen, und erst recht niemand weiß, dass ich aus dem Bügelgeruch sogar noch etwas anderes herausschnuppern kann: Helenas Eigengeruch.
Helena ist der schönste und lockigste Mensch, den ich kenne. Und sie ist die Klügste von allen.
Sie kann zeichnen und hat Grübchen und ist witzig.
Großvater mochte Helena von allen Mädchen am liebsten, heißt es.
Bis ich geboren wurde.
Ich möchte gern Helena sein.
Doch daraus wird nichts, weil ich dunkle Haare und keine Grübchen habe.
Aber nicht einmal Helena besitzt eine grüne Schirmmütze.
So eine habe nur ich.
Eines Tages lag sie da, auf dem Esstisch zwischen dem Brotteller und der Pfanne mit der Lebersoße.
Vorn über dem Schirm prangt ein gelbes Flugzeug aus echtem Plastik.
Es ist eine Jungsmütze, eindeutig.
Und sie ist für mich, denn Vater ist sie zu klein, und Mutter würde nie im Leben eine Jungsmütze tragen.
Schon sehr lange habe ich mir eine Schirmmütze gewünscht, genauso lange wie eine Kniebundhose aus Leder, ein Tretauto, eine Papierkugelpistole, eine Pfeilpistole und eine Wasserpistole, was ich alles nicht bekommen werde.
Aber eine Schirmmütze bekomme ich.
Und die gehört nur mir.
Ich setze sie auf und mustere mich im Flurspiegel.
Das ist ein Fehler.
Denn jetzt geschieht etwas mit ihr.
Sie erkennt es daran, dass Mutter keinen Ton sagt, und auch Vater und Großmutter schweigen. Niemand sagt etwas, nicht einmal Tante Ulla.
Daraus schließt sie, dass ihre Mütze in Gefahr ist.
Und deshalb bewacht sie sie.
Gleich morgens setzt sie die Mütze auf.
Mit dem Flugzeug auf der Stirn sitzt sie in der Küchenecke auf der Arbeitsfläche und isst Brei.
Mit dem Flugzeug auf der Stirn sitzt sie in der Küchenecke auf der Fensterbank und lässt die Wurstpelle auf die Straße segeln. Bis Mutter sie zum Spielen in den Hof schickt.
Wenn sie ihren Mittagsschlaf machen muss, schläft die Mütze neben ihr auf dem Kopfkissen. Matt und zufrieden streichelt sie über den weichen grünen Stoff und die scharfkantigen Plastikflügel.
Und obwohl ich meine Mütze wirklich streng bewache, verschwindet sie.
Ich suche auf der Hutablage, unter dem Stahlrahmenbett und in den Küchenschränken, finde sie aber nicht.
Niemand hilft mir beim Suchen, und ich habe die böse Vorahnung, dass meine Mütze für immer verloren ist.
»Das war doch sowieso eine Jungsmütze«, versucht Mutter mich zu trösten.
»Auf dem Hof lachen sie über ein Mädchen mit so einer Mütze«, versucht Vater mich zu trösten.
»Die hat der Schnappi geholt, Suchen ist zwecklos.«
Das sagt Tante Ulla.
Diesen Schnappi kennt sie schon.
Der hat ihr auch den Schnuller weggenommen und ihr dafür die allererste Erinnerung ihres Lebens beschert.
Ich bin gerade zwei, doch das weiß ich selbst noch nicht.
Ich sitze im warmen Wasser der Emaillewanne.
Im alten Herd prasselt das Feuer, wir sind bei Großmutter.
Hosenbeine und Röcke gehen an mir vorbei, und auch das große Wesen mit dem weichen Fell, das sie mal Hund nennen und mal Tepsi.
Das Wesen leckt mich im Vorbeigehen ab, sein Atem riecht übel.
Sie kann das Wort Hund noch nicht kennen und weiß auch nicht, was Herd und Feuer sind. Aber sie spürt es.
Ihre Erinnerung kann nicht falsch sein.
Das warme Seifenwasser, das prasselnde Feuer, die Schritte und das Stimmengewirr verbinden sich zu einer kleinen Seligkeit.
Mein Mund ist gefüllt, ich schmecke altes Gummi, mein Schnuller ist abgekaut. Er ist knallrot, und von seinem Rand rinnt warme Spucke auf mein Kinn, weiter über meinen nackten Bauch bis hinunter ins warme Seifenwasser.
Da taucht plötzlich eine Hand auf, von oben, wie fast alles in meinem Leben noch von oben kommt.
Die Hand reißt mir den Schnuller aus dem Mund.
Die Röcke und Hosenbeine versammeln sich um mich und bilden eine Mauer, mein Schnuller wandert von einer Hand zur nächsten.
»Schnuller«, schreie ich und strecke die Arme aus, worauf ich einen anderen Schnuller kriege, hart und blau und fremd.
Die Tür des Küchenschranks geht auf, und ich sehe meinen alten Schnuller ins Dunkel fliegen.
Ich höre das Platschen im Abwassereimer.
Dann ist es still.
»Den hat der Schnappi geholt«, sagt Großmutter.
Der Schnappi ist gierig nach Dingen, die dem Menschen wichtig sind, so wichtig, dass er ohne sie nicht leben kann.
Der Schnappi hinterlässt eine unendliche Einöde aus Bedürfnissen und Ersatz.
Den harten blauen Schnuller habe ich nie angenommen; er wurde nicht richtig warm, und sein harter Rand drückte an der Nase.
Doch Vater und Mutter und Tante Ulla und Großvater und Großmutter waren zufrieden mit ihrem erzieherischen Streich: