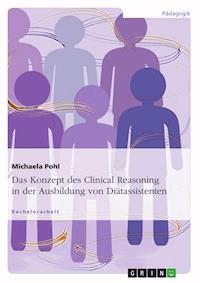
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Pädagogik - Berufsbildung, Weiterbildung, Note: 1,7, DIPLOMA Fachhochschule Nordhessen; Zentrale, Sprache: Deutsch, Abstract: Clinical Reasoning findet zusehends Verbreitung in vielen Therapieberufen. Im Bereich der Logopädie, Physiotherapie sowie Ergotherapie finden hierzu Fortbildungen statt, es wird in Ausbildung und Studium integriert sowie in Fachbüchern und -zeitschriften veröffentlicht. Für den Bereich der Diätassistenz bzw. Ernährungsberatung und -therapie gibt es derzeit überwiegend Veröffentlichungen über den Berufsverband der Diätassistenten (VDD). In dieser Arbeit wird beschreiben, wo Clinical Reasoning in der Ernährungsberatung und -therapie zur Anwendung kommen kann. Das Buch zeigt eine Beispielmöglichkeit zur Einbindung dieses Konzeptes in die derzeitige Ausbildung von Diätassistenten. Der Lehr-Lern-Prozess wird anhand des problemorientierten Lernen beschrieben. Eine Übertragung auf eine kompetenzorientierte oder modularisierte Ausbildung wird dadurch möglich. Es wird dargelegt welche Fächer eine Rolle spielen bzw. in welchen Bereichen bereits Clinical Reasoning-Inhalte vermittelt werden. Diese sollen dann in den Lernprozess um das Clinical Reasoning eingebunden, vertieft und genutzt werden. Das Konzept könnte, in Teilen modifiziert, in andere Ausbildungen übernommen werden. Eine Evaluierung des Konzeptes steht noch aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Methodik
3. Ausbildung von Diätassistenten
3.1 Differenzierung theoretischer und praktischer Unterricht, prak-tische Ausbildung
3.1.1 Theoretischer und praktischer Unterricht
3.1.2 Praktische Ausbildung
4. Tätigkeitsfelder von Diätassistenten
5. Begriffsbestimmung Diättherapie, Ernährungstherapie und Ernäh- rungsberatung
5.1 Diättherapie
5.2 Ernährungstherapie
5.3 Ernährungsberatung
5.4. Schlussfolgerung und derzeitige Problematik
6. Diättherapeutische Vorgehensweisen
6.1 Empfehlung des VDD
6.2 Nutrition Care Process
6.3 Diätologischer Prozess
6.4 Vergleich der verschiedenen diättherapeutischen Vorgehensweisen
6.5 Qualitätssichernde Standards für diättherapeutische Anforderung- en, Maßnahmen, Dokumentationen
7. Clinical Reasoning
7.1 Definition Clinical Reasoning
7.2 Wissensbereiche im Clinical Reasoning
7.3 Entscheidungsfindung im Clinical Reasoning
7.3.1 Musterkennung
7.3.2 Clinical Reasoning Prozess
7.4 Formen des Clinical Reasoning
7.5 Entwicklungsstadien im Clinical Reasoning
7.6 Individuelles Krankheitsskript
8. Anthropologische, soziale und fachliche Voraussetzungen der Schüler
8.1 Schulische Vorbildung
8.2 Alter
8.3 Geschlechterverteilung
8.4 Klassengröße
8.5 Möglicher Kenntnisstand
9. Rahmenbedingungen der Diätschulen
9.1 Räume und deren Ausstattung
9.2 Heterogenität der Lehrkräfte
9.2.1 Pädagogische und fachliche Qualifikationen
9.2.2 Anzahl hauptamtlich angestellter Lehrkräfte
9.2.3 Anzahl nebenberuflich tätiger Lehrkräfte
10. Methodik zur Einbindung des Clinical Reasoning in den theoretisch- en Unterricht
10.1 Problemorientiertes Lernen (POL)
10.1.1 Definition und Ziele
10.1.2 Die Siebensprung Methode
10.1.3 Zeitlicher Aufwand
11. Clinical Reasoning und POL im Fach Ernährungs- und Diätbera-tung
11.1 Clinical Reasoning in den Lehrplänen
11.2 Clinical Reasoning im theoretischen Unterricht
11.3 Individuelles Krankheitsskript
11.4 Einführung des Clinical Reasoning
11.5 Einführung in den Clinical Reasoning Prozess
11.5.1 Der Clinical Prozess anhand eines Fallbeispiels
11.6 Formen des Clinical Reasoning
11.6.1 Übung zu den Formen des Clinical Reasoning
11.7 Reflexion der Einbindung von Clinical Reasoning in den theore-tischen Unterricht
11.8 Clinical Reasoning in der praktischen Ausbildung Diät- und Ernäh- rungsberatung
11.8.1 Einbindung des Clinical Reasoning in die praktische Ausbildung
12. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anlagenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
Clinical Reasoning findet zunehmend Verbreitung in Diätassistentenkreisen. Im Rahmen der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der leitenden Lehrkräfte, im November 2010, hat Heike Siegmann einen ersten Vortrag zu diesem Thema gehalten. Im Rahmen des 53. Bundeskongresses des VDD im Mai 2011 sowie der aktueller Mitgliederzeitschrift Diät- und Information 5/2011 wurde das Thema erneut aufgegriffen und einer breiteren Diätassistenten[1]-Öffentlichkeit vorgestellt.
In den Forderungen an Politik und Akteure im Gesundheitssystem zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung und Weiterentwicklung des Berufs der Diätassistentin/des Diätassistenten in Deutschland[2] (VDD 2011) wird folgendes erläutert: „ …Um eine noch stärkere Fokussierung auf praxisnahe Tätigkeiten zu erfahren, muss in die DiätAss-AprV verpflichtend der Nutrition Care Process (NCP) bzw. der Diätologische Prozess als zentrales methodisches Instrument der Diät- und Ernährungstherapie sowie Ernährungsberatung aufgenommen werden. Dies gilt gleichermaßen für das Konzept des Clinical Reasoning und dessen Implikation in den beruflichen Alltag vom Diätassistenten als Beruf der Therapie und Beratung….“
Derzeit ist Clinical Reasoning kein Bestandteil der Ausbildung von Diätassistenten und wird im Rahmen von berufsspezifischen Fort- und Weiterbildungen nicht angeboten. In den angrenzenden Therapieberufen der Logopädie, Ergo- und Physiotherapie bestehen seit längerer Zeit Bestrebungen, dieses Thema sowohl in die Ausbildungen als auch in Fort- und Weiterbildungen zu etablieren (Nauerth 1998, Feiler 2003, Hand-graf/Klemme, Nauerth, 2003, Klemme/Walkenhorst 2003, Lagemann 2003, Klemme/Siegmann 2006, Beushausen/Walther 2010). Clinical Reasoning wird sowohl als separate Fortbildung, in Kombination mit einer fachspezifischen Fortbildung sowie in Bachelor- und Masterstudiengängen für die oben genannten Berufe angeboten. Je nach Träger werden auch Ärzte und andere Therapieberufe genannt (siehe Literaturverzeichnis Seite XV-XVI). Aufgeführt sind ergänzend Fortbildungen, die in der Schweiz stattfinden, wo Clinical Reasoning ebenfalls thematisiert wird.
Um nationalen und internationalen Standards zu genügen, ist es daher dringend notwendig, Clinical Reasoning in die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Diätassistenten zu integrieren. Dies ist zum derzeitigen Stand lediglich über den Bachelorstudiengang für Medizinalfachberufe (Diploma Hochschule Nordhessen) möglich.
Ziel dieser Bachelorarbeit ist es aufzuzeigen, wie Clinical Reasoning im Rahmen der aktuellen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung in den Unterricht eingebunden werden kann. Hauptaugenmerk wird dabei auf die Diättherapie gelegt, wie sie in den Punkten 5.1 und 6.1 beschrieben ist.
2. Methodik
Im Rahmen einer Literatur- und Internetrecherche wird die aktuelle Situation der Ausbildung und im Berufsalltag von Diätassistenten dargelegt. Ergänzend wird aufgeführt in wie weit Clinical Reasoning bereits Eingang in die berufliche Praxis gefunden hat. Anschließend werden einige Bereiche des Clinical Reasoning näher betrachtet und ein pädagogisches Konzept erstellt, welches darstellt, wie Clinical Reasoning in die Ausbildung integriert werden könnte. Beispielhaft soll aufgeführt werden, mit welchen pädagogischen, methodisch-didaktischen Mitteln dies möglich ist.
Die Einbindung sollte möglichst ohne zusätzliches Personal und somit kostenneutral sein. Die vorgegebenen Unterrichtsstunden der DiätAss-AprV sollen eingehalten und, bei Bedarf, lediglich verlagert werden.
Als Problem ist anzusehen, dass es bisher kaum Diätassistenten gibt, die sich mit Clinical Reasoning befasst haben. Wie in der Einleitung beschrieben, werden Fort- und Weiterbildungen für diesen Bereich bisher kaum angeboten. Daher wird es voraussichtlich schwierig sein, Clinical Reasoning in allen Schulen umzusetzen und in die praktische Ausbildung der Diät- und Ernährungsberatung, die außerhalb der ausbildenden Diätschulen[3] stattfindet (siehe Punkt 3.1.2), einzubinden.
3. Ausbildung von Diätassistenten
Die Ausbildung[4] von Diätassistenten findet an staatlich anerkannten Berufsfachschulen statt, dauert drei Jahre und endet, nach dem Bestehen der Abschlussprüfung, mit der staatlichen Anerkennung. Die Schulen sind sowohl Kliniken angeschlossen als auch über private Träger organisiert.
Innerhalb der Ausbildung sind laut DiätAss-AprV 4450 Stunden zu unterrichten. Diese teilen sich in 3050 Stunden theoretischen und praktischen Unterricht sowie 1400 Stunden praktische Ausbildung auf. Die Verteilung der Stunden auf die einzelnen Fächer ist in Anlage 1, als Auszug aus der DiätAss-AprV ersichtlich. Im Rahmen der Gesamtstundenzahl wird in Unterpunkten ergänzt, welche Inhalte vermittelt werden sollen.
Höfler/Willig (1996) haben einen Lehrplan für Theorie und Praxis für Diätschulen in Deutschland herausgegeben und die Unterpunkte aus der DiätAss-AprV mit möglichen Inhalten ergänzt. Es handelt sich um kein verbindliches Curriculum, sondern um eine Stoffsammlung. In Anlage 2 ist exemplarisch am Fach Ernährungs- und Diätberatung aufgeführt, wie dieser Lehrplan aufgeschlüsselt ist. Ein großer Teil der Diätschulen orientiert sich hieran.
Im Freistaat Bayern existieren als einzigem Bundesland verbindliche Lehrpläne für die Berufsfachschule Diätassistent/Diätassistentin (1996). In einer Stundentafel (Anlage 3) ist dargestellt, wie die jeweiligen Fächer auf die einzelnen Schuljahre aufgeteilt werden sollen. Desweiteren sind für jedes Fach Lernziele, Lerninhalte und Hinweise zum Unterricht inkl. der angesetzten Unterrichtsstunden aufgeführt. In Anlage 4 ist dies für einen Vergleich ebenfalls für das Fach Ernährungs- und Diätberatung dargestellt.
Aktualisierungen haben bei beiden Lehrplänen bisher nicht stattgefunden. Die AG Gesetz überarbeitet derzeit die Unterrichtsinhalte mit den zusätzlichen Zielen der Novellierung der DiätAss-AprV, der möglichen Umbenennung der Berufsbezeichnung und einer Akademisierung des Berufes. Im Forderungskatalog (VDD 2011) wird dies ausführlich dargestellt und begründet.
3.1 Differenzierung theoretischer und praktischer Unterricht, prak-tische Ausbildung
3.1.1 Theoretischer und praktischer Unterricht
In der DiätAss-AprV werden die abzuleistenden Unterrichtsstunden der Ausbildung in theoretischen und praktischen Unterricht sowie in die praktische Ausbildung unterteilt.
Im theoretischen Unterricht werden die Grundlagen vermittelt, im praktischen Unterricht sollen diese Grundlagen über konkrete Handlungen ausgeführt und damit vertieft werden. Zum praktischen Unterricht gehören nach Lehrpläne für die Berufsfachschule Diätassistent/Diätassistentin (1996). z. B. Übungen zur
-Datenverarbeitung, Dokumentation und Statistik,
-Diätetik, wie die Zubereitung von für bestimmte Kostformen geeigneten Speisen,
-Koch- und Küchentechnik, wie die grundsätzliche Zubereitung von Speisen und
-Diät- und Ernährungsberatung, wie die Planung und Durchführung von Einzelberatungen und Gruppenschulungen.
3.1.2 Praktische Ausbildung
In diesem Teil der Ausbildung lernen die Schüler die Umsetzung des in den Diätschulen vermittelten Unterrichtsstoffes im Diätassistenten-Alltag kennen. Diese Kenntnisse sollen über das Beobachten der Praxisanleiter sowie das eigene Tun ungesetzt und vertieft werden. Die praktische Ausbildung teilt sich nach der DiätAss-AprV in drei Bereiche auf:
-Diätetik einschließlich Organisation des Küchenbetriebes,
-Koch- und Küchentechnik einschließlich Hygiene sowie
-Diät- und Ernährungsberatung.
Die Schüler sind dabei in der Regel außerhalb des Schulbetriebes eingesetzt, z. B. in verschiedenen Krankenhausküchen, auf einer Krankenstation sowie in verschiedenen Einrichtungen, in denen diättherapeutische Maßnahmen erfolgen. Dazu gehören Krankenhäuser, Kurkliniken oder freiberuflich tätige Diätassistenten.
5. Begriffsbestimmung Diättherapie, Ernährungstherapie und Ernäh- rungsberatung
5.1 Diättherapie
Eine allgemein anerkannte Definition für diesen Begriff existiert derzeit nicht. In § 3 des DiätAssG wird als Zieldefinition für die Ausbildung „…die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, die zur eigenverantwortlichen Durchführung diättherapeutischer und ernährungsmedizinischer Maßnahmen auf ärztliche Anordnung oder im Rahmen ärztlicher Verordnung wie dem Erstellen von Diätplänen, dem Planen, Berechnen und Herstellen wissenschaftlich anerkannter Diätformen befähigen, sowie dazu, bei der Prävention und Therapie von Erkrankungen mitzuwirken und ernährungstherapeutische Beratungen und Schulungen durchzuführen.“ beschrieben.
Diätassistenten orientieren sich an dieser Beschreibung, wenn es um therapeutische Vorgehensweisen geht.
5.2 Ernährungstherapie
In der Rahmenvereinbarung zur Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung und Er-nährungsbildung in Deutschland (2009) und in den Definitionen des Institut für Ernährungstherapie und Ernährungsberatung e. V. (QUETHEB 1997, in Benecke et al. 2006) wird zwischen Ernährungsberatung und Ernährungstherapie unterschieden. Beide Beschreibungen und Definitionen sind inhaltlich ähnlich formuliert. Die im Folgenden aufgeführten Definitionen und Inhalte sind der o. g. Rahmenvereinbarung entnommen und wurden modifiziert.
Eine “…qualifizierte Ernährungstherapie richtet sich an Kranke in enger Kooperation mit dem behandelnden Arzt….Die Ernährungstherapie beinhaltet eine längerfristige Betreuung und umfasst auch die Erstellung individueller Ernährungspläne…“.
Als Ziele werden aufgeführt:
-Vermitteln von Grundsätzen einer gesundheitsfördernden, vollwertigen Ernährung, um den Gesundheitszustand zu verbessern und Rückfällen und Folgeerkrankungen vorzubeugen
-Nachhaltiges Verbessern der individuellen Ernährungsweise und des Essverhaltes orientiert an der medizinischem Notwendigkeit und den individuellen Bedürfnissen und Wünschen des Klienten
-Erhalten bzw. Verbessern der Lebensqualität
„Für die Ernährungstherapie ist grundsätzlich eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung[5] erforderlich; ggf. erfolgt sie in Absprache mit Therapeuten anderer Fachdisziplinen.“
5.3 Ernährungsberatung
Eine qualifizierte Ernährungsberatung richtet sich, nach der in Punkt 5.2 genannten Rahmenvereinbarung, an Gesunde ohne dass eine ärztliche Weisung[6] vorliegt. Als Beratungsziele werden hier genannt:
-Vermitteln von Grundsätzen einer gesundheitsfördernden, vollwertigen Ernährung um Mangel- und Fehlernährung zu vermeiden und das Risiko von ernährungsbedingten Krankheiten zu reduzieren
-Verbessern der individuellen Ernährungsweise und des Ernährungsverhaltens sowie ggf. die Lösung von Ernährungsproblemen
-Verbessern der Entscheidungsfähigkeit und Handlungskompetenz
In der Rahmenvereinbarung wird ergänzend beschrieben: „Die Ernährungsberatung kann auch dazu dienen, Fehlernährung zu erkennen und den Klienten ggf. einer Ernährungstherapie zuzuführen.“
5.4. Schlussfolgerung und derzeitige Problematik
Die zweite Beschreibung deckt sich in weiten Teilen mit den Ausbildungszielen für Diätassistenten. Aus heutiger Sicht lässt sich nicht zweifelsfrei zurückverfolgen, warum der Begriff Ernährungstherapie gewählt wurde. Die Begriffswahl könnte daran liegen, dass die GKVen neben Diätassistenten auch Ernährungswissenschaftler, Diplom Oeco-trophologen, Diplom-Ingenieure Ernährungs- und Hygienetechnik bzw. Ernährungs- und Versorgungsmanagement sowie Ärzte mit entsprechenden Zusatzqualifikationen für die Durchführung von Ernährungstherapie zulassen. Der Begriff diättherapeutische Maßnahmen ist im DiätAssG beschrieben (siehe Punkt 5.1) und dies lässt den Schluss zu, dass dieser Tätigkeitsbereich nur mit einer Ausbildung als Diätassistent ausgeführt werden kann. Bei diesen Überlegungen ist zu berücksichtigen, dass es im DiätAssG keine vorbehaltenen Tätigkeiten gibt, wie dies z. B. in § 4 des Hebammengesetzes formuliert ist.
Das BSG hat bereits im Jahr 2000 festgestellt, dass Diättherapie ein Heilmittel ist. In regelmäßigen Veröffentlichungen und Forderungskatalogen wurde in den letzten zwei Jahren verstärkt auf die Dringlichkeit der Aufnahme der Diättherapie in den Heilmittelkatalog hingewiesen (Igl 2010, Richard 2010, Lindemann/Steinkamp 2011, VDD Forderungskatalog 2011). Im Rahmen der Veröffentlichung Diätassistenten im Ernährungsteam unentbehrlich (www.VDD.de; 15.08.2011) erklärt Heise (Ernährungsmediziner und Oberarzt) “ …dass die Berufsbezeichnung ´Diätassistentin´ deren Kompetenz bei weitem nicht wiederspiegele. Es gehe um den therapeutischen Ansatz, der auch in der Berufsbezeichnung zum Ausdruck kommen sollte.“
Die diättherapeutische Behandlung ist z. Zt. eine freiwillige Leistung der GKV und ein Versicherter hat somit keinen Anspruch auf Kostenübernahme. Die meisten GKVen übernehmen auf Antrag des Versicherungsnehmers einen Teil der Kosten für in der Regel maximal fünf Beratungseinheiten.





























