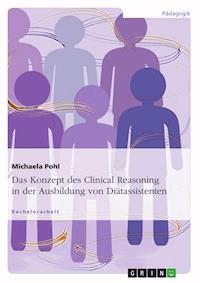Fürsorge und (Ernährungs-)Autonomie in Ernährungsberatung und -therapie aus der Perspektive der Beratenden E-Book
Michaela Pohl
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Gesundheit - Ernährungswissenschaft, Note: 1,6, Katholische Hochschule Freiburg, ehem. Katholische Fachhochschule Freiburg im Breisgau, Veranstaltung: Angewandte Ethik, Sprache: Deutsch, Abstract: Fürsorge und Autonomie bzw. Ernährungsautonomie sind Aspekte mit denen Fachkräfte wie z. B. Diätassistenten, Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler im täglichen Beratungsgeschehen konfrontiert werden. Auf der einen Seite steht die Fürsorge gegenüber den Betroffenen und auf der anderen Seite die Entscheidungen, die von den Betroffenen getroffen werden. Wie gehen Ernährungsfachkräfte mit Entscheidungen um, die sie möglicherweise nicht befürworten. Wie sehen die Beratenden die Begrifflichkeiten Fürsorge, Autonomie und Ernährungsautonomie aus ihrer eigenen Erfahrung heraus. Die Masterarbeit hat dies mit Hilfe von Interviews untersucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretischer Hintergrund
2.1. Fürsorge
2.1.1 Rechtliche Ebene
2.1.2 Christliche Ebene
2.1.3 Pflegerische, soziale Ebene
2.1.4 Gender Aspekt
2.1.5 Individuelle Ebene
2.2. Autonomie
2.2.1 Philosophische Perspektive
2.2.2 Rechtlicher Hintergrund
2.2.3 Therapeut-Patienten-Beziehung
2.3 Autonomie aus Klientensicht
2.3.1 Phasen der Krankheitsbewältigung
2.3.2 Sichtweisen zur Autonomie von Klient und Ernährungsfachkraft
2.4 Ernährungsautonomie
2.5 Ernährungsberatung und –therapie
2.5.1 Unterscheidung in Ernährungsfachkreisen
2.5.2 Unterscheidung der Krankenkassen und ernährungsbezogener Fachgesellschaften
2.5.3 Unterscheidung Beratung und Therapie
2.6 Beratungsverständnis einer Ernährungsfachkraft
2.6.1 Klientenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers
2.6.2 Ablauf von Ernährungsberatung und –therapie
2.7 Zusammenfassung
3. Formulierung der Forschungsfrage
4. Methodik
4.1 Qualitative Sozialforschung
4.1.1 Qualitative Interviews
4.1.2 Interviewleitfaden
4.1.3 Daten für statistische Zwecke
4.1.4 Postskript
4.2 Durchführung der Interviews
4.2.1 Rekrutierung der Interviewpartner
4.2.2 Zusammensetzung der Stichprobe
4.2.3 Ablauf der Interviews
4.2.4 Die Rolle des Interviewenden
4.2.5 Pretest
4.3 Datenerhebung und –aufbereitung
4.3.1 Termine und Ort der Interviews
4.3.2 Transkription
4.3.3 Datenauswertung
4.3.4 Kategorienbildung
5. Ergebnisse und Interpretation
5.1 Ergebnisse der Befragung
5.1.1 Auslegung Fürsorge
5.1.2 Beispielhafte Situationen fürsorglichen Verhaltens
5.1.3 Stellenwert Fürsorge
5.1.4 Auslegung Autonomie
5.1.5 Auslegung Ernährungsautonomie
5.1.6 Beispielhafte Situationen zum Achten von Ernährungsautonomie
5.1.7 Stellenwert Ernährungsautonomie
5.1.8 Abwägen zwischen Fürsorge und Ernährungsautonomie
5.1.9 Die Beratung beeinflussende Rahmenbedingungen
5.1.10 Gesprächsführung nach Rogers
6. Zusammenfassung der Ergebnisse
7. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anlagenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Ethik der Autonomie und Ethik der Achtsamkeit (Conradi 2013, S. 11)
Abbildung 2: Einflüsse auf die individuelle Auslegung von Fürsorge (modifiziert nach Pohl 2015, S. 7).
Abbildung 3: Patienten-Autonomie im Spannungsfeld der Sichtweisen von Patient und Ernährungsfachkraft (Pohl 2015, S. 17).
Abbildung 4: Ernährungsautonomie im Kantonsspital Winterthur (2014).
Abbildung 5: Nutrition Care Process-Modell (Buchholz et al. 2012, S. 587).
Abbildung 6: Bereiche des Clinical Reasoning (Pohl 2014, S. 51)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Gegenüberstellung von Psychotherapie und Beratung nach Sander, Zieberts (2010, S. 28) und Biermann-Ratjen et al. 1979.
Tabelle 2: Zusammensetzung der Stichprobe
Tabelle 3: Zusammenfassung Aussagen zur Auslegung von Fürsorge.
Tabelle 4: Zusammenfassung Aussagen zu Patientendaten erfassen.
Tabelle 5: Zusammenfassung der Aussagen zum fürsorglichen Verhalten.
Tabelle 6: Zusammenfassung zum Stellenwert von Fürsorge.
Tabelle 7: Zusammenfassung Aussagen zur Auslegung von Autonomie.
Tabelle 8: Zusammenfassung Aussagen zur persönlichen Auslegung von Ernährungsautonomie.
Tabelle 9: Zusammenfassung Beispiele, in denen Ernährungsautonomie geachtet wurde.
Tabelle 10: Zusammenfassung zum Stellenwert Ernährungsautonomie.
Tabelle 11: Zusammenfassung Ergebnisse zum Abwägen zwischen Fürsorge und Ernährungsautonomie.
Tabelle 12: Zusammenfassung Rahmenbedingungen, die die Beratung beeinflussen.
Tabelle 13: Zusammenfassung Aussagen zur klientenzentrierten Gesprächsführung nach Rogers.
1. Einleitung
Im Laufe der über 20jährigen Tätigkeit als Lehrkraft an einer Fachschule für Diätassistenten entstand der Eindruck, dass sich Schüler nicht immer ausreichend Gedanken um die Situation des Patienten/Klienten[1][2] machen. Es wurde häufig beobachtet, dass Schüler in dem Glauben sind, dass Klienten das umsetzen müssen, was ihnen gesagt/aufgetragen wird. Sinngemäße Aussagen von Schülern im dritten Ausbildungsjahr waren z. B.: Ein Patient könne doch froh sein, dass er überhaupt etwas zu essen bekomme. Das Essen müsse weder gut aussehen noch schmecken und dass ein Schüler die Verwendung vorgefertigten Lebensmittel und Speisen nicht unterstützen und in Beratungseinheiten entsprechend auf einen Klienten einwirken möchte. Wegen solcher und ähnlicher Aussagen entstand das subjektive Gefühl, dass angehende Diätassistenten Bedürfnisse von Klienten bzw. deren autonome Entscheidungen nicht immer erfassen und berücksichtigen.
Es wurden zusätzlich verschiedene Foren, in denen sich unterschiedliche Berufsgruppen aus dem Bereich Ernährung über ihre Tätigkeit austauschen, beobachtet. Zu den beteiligten Personen gehören u. a. Diätassistenten, Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler. In den beobachteten Foren zeigt sich in einigen Fällen ein ähnliches Bild, wie dies bei Schülern wahrgenommen wurde. Aus dieser Beobachtung heraus entstand der Eindruck, dass einige Ernährungsfachkräfte sehr rigide mit der Umsetzung von Maßnahmen für Erkrankte umgehen und mit einer missionarischen Einstellung Beratungen durchführen. An der einen oder anderen Stelle entstand sogar der Eindruck, dass der Klient mit seinen Lebensumständen vergessen wurde.
Im Rahmen von Vorlesungen an Hochschulen, an denen z. B. Diätassistenten mit Berufserfahrung ein ergänzendes Studium absolvieren, konnte ähnliches wahrgenommen werden. Auch hier gab es immer wieder Aussagen, die darauf schließen lassen, dass Diätassistenten zwar die Beratervariablen der Gesprächsführung nach Rogers kennen, aber in der Praxis sehr stark auf die Umstellung von Essgewohnheiten pochen. Ein einfühlendes Verständnis im Sinne von Rogers war nicht immer ausreichend vorhanden. Im Rahmen der Prüfungsleistung: Projekt des Masterstudiums der Angewandten Ethik im Gesundheits- und Sozialwesen wurde eine Ethikvorlesung dokumentiert (Pohl 2013, Anlagen 1-2). Für die Studierenden war es offensichtlich schwierig, den für die Abfragen zu persönlichen Werten und Werten von Klienten notwendigen Perspektivwechsel vorzunehmen. Die Abfrage zu einem netten und schwierigen Patienten hatte ergeben, dass eher aufgeschlossene, motivierte Patienten von der Studiengruppe als „nett“ wahrgenommen wurden.
Aus der Summe der Beobachtungen hat sich das Thema dieser Arbeit entwickelt. Es werden zunächst die Werte: Fürsorge, Autonomie und im Speziellen die Ernährungsautonomie näher betrachtet. Weiterhin wird erläutert, worin sich Beratung und Therapie unterscheidet und wo es möglicherweise Überschneidungen gibt. Über eine qualitative Untersuchung, sollen Erkenntnisse dahingehend gewonnen werden, ob sich die subjektiv gewonnenen Eindrücke bestätigen oder eine Einzelbeobachtung sind. Fürsorge wurde ausgewählt, weil es in Ernährungsberatung und –therapie u. a. um das so genannte Wohl von Betroffenen geht; Autonomie, im Speziellen Ernährungsautonomie, weil Klienten in Beratungs- und Therapieeinheiten Entscheidungen für sich und ihr Leben treffen, die nicht immer mit dem einher gehen, wie sich Beratende die Entscheidung möglichweise vorstellen. Daraus kann sich ein Spannungsfeld entwickeln, welches ebenfalls ein Teil der Fragestellung dieser Arbeit ist. Die Gesprächsführung nach Rogers wird im Rahmen des Beratungsverständnisses von Ernährungsfachkräften ebenfalls beschrieben, weil sich darin einige Aspekte von Autonomie und Fürsorge wiederfinden. Für Ernährungsfachkräfte gehört diese Art von Gesprächsführung zum Standard.
Da es für den Bereich der Ernährungsberatung und –therapie kaum Literatur zu Fürsorge und Autonomie gibt, wurden Aussagen aus Krankenpflege, Medizin und Sozialpädagogik eingebunden bzw. auf Ernährungsfachkräfte übertragen.
Zielgruppen für die Befragung sind verschiedene Berufsgruppen, die im Bereich Ernährungsberatung und –therapie tätig sind. Zu diesem Personenkreis gehören Diätassistenten, Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler, die die Beratenden im Titel dieser Arbeit darstellen.
Erwartet wird, dass Ernährungsberatung und –therapie aus Sicht der Befragten einen hohen Anteil an Fürsorge beinhalten und Fürsorge sowohl als ich schaue, was dir gut tut als auch als ich weiß, was für dich gut ist ausgelegt wird. Autonomie wird vermutlich von den Befragten als das Treffen von Entscheidungen zum eigenen Leben beschrieben, der Begriff Ernährungsautonomie ist wahrscheinlich eher unbekannt. Es soll ergänzend erfragt werden, in wie weit es Situationen gab, in denen die Befragten das Gefühl hatten, zwischen dem eigenen Fürsorgegedanken und den autonomen Entscheidungen von Klienten in einen (Werte)Konflikt zu geraten. Wahrscheinlich haben die Befragten unterschiedliche Situationen erlebt, in denen sie ggf. Prioritäten setzten mussten. Dass eine (ethische) Reflexion des persönlichen Handelns stattfindet, ist unwahrscheinlich.
2. Theoretischer Hintergrund
Für die spätere Auswertung der durchgeführten Interviews ist es notwendig, die abgefragten Aspekte Fürsorge und Autonomie sowie die Ernährungsautonomie näher zu betrachten. Die Begriffe Beratung und Therapie, insbesondere Ernährungsberatung und Ernährungstherapie werden, aus unterschiedlichen Perspektiven, ebenfalls erläutert.
2.1. Fürsorge
Fürsorge kann auf verschiedenen Ebenen, aus verschiedenen Sichtweisen definiert und interpretiert werden. Auf der einen Seite gibt es das staatliche Fürsorgesystem, das z. B. über die Sozialgesetzbücher Regelungen für den Fall der Arbeitslosigkeit, länger andauernder Krankheit oder bei Problemen in Familien beinhaltet. In Deutschland gibt es viele Einflüsse aus der christlich-jüdischen Tradition über die Bibel, die z. B. Nächstenliebe oder Hilfeleistung über das Gleichnis des barmherzigen Samariters (Lk 10, 25-37) beschreibt. Weitere Sichtweisen kommen aus pflegerischen und therapeutischen Berufen. Ergänzt werden diese durch individuelle Auslegungen von Fürsorge.
Simon (2012/13) zitiert Eibach 1997 wie folgt: „Das Ethos der Fürsorge hat die Einfühlung ins Geschick des einzelnen Menschen zur Grundlage, das ´Mit-Leiden`, aus dem heraus auch stellvertretende Entscheidungen für den anderen Menschen gefällt werden dürfen, weil nicht über den Menschen, sondern in Anteilnahme an seinem Geschick und zu seinem Wohl entschieden wird.“ Das Wohl des Betroffenen ist somit entscheidend und nicht das Wohl des „Entscheiders“. Zusätzlich geht es um Mit-Leiden und nicht um Mitleid gegenüber anderen.
Je nach Sichtweise des Betrachtenden ist Fürsorge eng verknüpft mit Begriffen wie Wohltun, Nichtschaden, Barmherzigkeit, Solidarität, Subsidiarität oder Liebe, die jedoch in diesem Zusammenhang nicht alle eine Rolle spielen und somit nicht weiter erläutert werden.
In den folgenden Abschnitten werden Aspekte des staatlichen Fürsorgesystems in Bezug auf Ernährungsberatung/-therapie, die christliche Sichtweise, die pflegerische, soziale Ebene sowie die individuelle Ebene näher betrachtet.
2.1.1 Rechtliche Ebene
Ernährung kann Teil der staatlichen Fürsorge sein. Diese hat sich beispielsweise aus der im 19. Jahrhundert systematisch beginnenden Erforschung der Ernährung entwickelt. Zunächst ging es um die vorherrschende Mangel- und Unterernährung und um die sozial ungleiche Verteilung der Nahrung, später um die Erhaltung der Arbeitskraft (Barlösius 2011, S. 57). In heutigen Gesetzgebungen finden sich Regelungen zur Lebensmittelproduktion und -kenn-zeichnung, wie die Lebensmittelinformationsverordnung, EG-Öko[3]-Basisverordnung u. v. m..
Die erwähnte Erhaltung der Arbeitskraft spiegelt sich heute z. B. imSGB V wider. Im Paragrafen 43 SGB V ist zur Rehabilitation geregelt, dass die Krankenkassen ergänzende Leistungen zu den in den §§ 53 und 54 SGB IX[4] aufgeführten erbringen können. Diese zusätzlichen Leistungen können ganz oder teilweise gefördert werden. Ernährungsfachkräfte[5] können demnach bei chronischen Krankheiten im Sinn des SGB V tätig werden und Beratungen bzw. Therapien durchführen, sofern eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung vorliegt.
Die GKV ist, als mitgliederfinanzierte Solidargemeinschaft, ebenfalls diesem System zuzuordnen, da rechtlich geregelt ist, was, wann und wie viel an möglichen anfallenden Kosten als Fürsorgeleistung zur Verfügung gestellt wird.
Für den Bereich der Prävention hat der GKV-Spitzenverband (2014) einen Leitfaden Prävention - Handlungsfelder und Kriterien zur Umsetzung der §§ 20 und 20a SGB V erstellt. Dieser enthält u. a. Abschnitte zu verschiedenen Ernährungsthemen und zur Ernährung am Arbeitsplatz im Rahmen von betrieblicher Gesundheitsförderung (S. 55ff, 83ff).
Klienten im Krankenhaus schließen über das BGB § 611 einen Dienstvertrag ab. Darin sind die ärztlichen, pflegerischen, heilhilfsberuflichen und medizinisch-technischen Maßnahmen sowie die Unterkunft und die Verpflegung geregelt. Zu den daraus entstehenden Pflichten gehören beispielsweise die ärztliche Dokumentation, eine gute Organisation des Betriebsablaufs, eine verantwortungsvolle Auswahl und Überwachung des medizinischen und sonstigen Personals, die Bereitstellung der erforderlichen Geräte und die Einhaltung von Hygienevorschriften (Bade 2014).Die Fürsorge gilt hier dem Klientenüber das Schaffen entsprechender Rahmenbedingungen im jeweiligen Krankenhaus. Ergänzt wird der Dienstvertrag durch den Behandlungsvertrag, wie er in Abschnitt 2.2.2 näher erläutert wird, in dem es u. a. um das Abwenden von Schaden von einem Klienten geht.
Zusammenfassend geht es bei beiden Verträgen um die sogenannte Sorgfaltspflicht, die für die Tätigkeiten in den jeweiligen Berufen gilt. Ernährungsfachkräfte, die im klinischen Bereich arbeiten, sind sowohl in den Dienst- als auch in den Behandlungsvertrag als beauftragte Personen eingebunden. Freiberuflich tätige Ernährungsfachkräfte schließen in der Regel direkt mit dem Klienten einen Behandlungsvertrag ab. Ernährungsfachkräfte, sofern sie im staatlich geförderten und geregelten Bereich arbeiten, gehören somit zum staatlichen Fürsorgesystem.
2.1.2 Christliche Ebene
Für die Interpretation von Fürsorge auf christlicher Ebene wird in der Regel das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10, 25-37) verwendet. Eine Aussage dieses Gleichnisses ist, dass im Moment der Not, unabhängig von möglichen Feindschaften, eine sofortige Hilfeleistung erfolgt, indem der in Not Geratene zunächst eine Erstversorgung erhält. Im Anschluss wird die Betreuung an eine andere Person übergeben und, im biblischen Gleichnis, durch den zuerst Helfenden finanziert. Es geht aus Sicht des Erst-Helfenden somit z. B. um das Wahrnehmen einer möglichen notwendigen Hilfeleistung, sich jemandem zuzuwenden, Verantwortung zu übernehmen, Ressourcen nutzen, kooperieren, sich entlasten, aber auch um wirtschaftlich handeln und den eigenen Weg weiter gehen (Adam 2013, Folie 18-19).
Höffe (2008, S. 356) schreibt, dass Wohlwollen „[…] zu einer allgemeinen Pflicht innerhalb des Gebotes der Nächstenliebe […]“ wird und ergänzt, dass es eine allgemeine Norm (ein Grundwert) ist, Notleidenden „[…] nach Maßgabe der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu helfen.“ In dieser Aussage ist der Bezug zum barmherzigen Samariter zu erkennen. Höffe schreibt weiter, im Sinne von Kant, dass Wohlwollen „im Vergnügen an der Glückseligkeit (dem Wohlwollen) anderer besteht.“ Höffe führt aus, dass diese Haltung missverständlich als Altruismus, im Sinne der Einstellung und Bereitschaft, andere auch ohne Gegenleistung zu fördern, benannt wird. Für Kant zeigt sich Wohlwollen bzw. Wohltätigkeit als Mitfreude und Mitleid.
Es geht im christlichen Sinne nicht darum, sich für den anderen aufzuopfern und seine eigenen Bedürfnisse zu vergessen, sondern auch um das Abgeben von Aufgaben/Leistungen an Personen, die die passenden Qualifikationen bzw. Ressourcen besitzen. Zusätzlich spielt die sogenannte Selbstsorge eine Rolle, die im folgenden Abschnitt angesprochen wird.