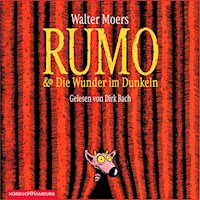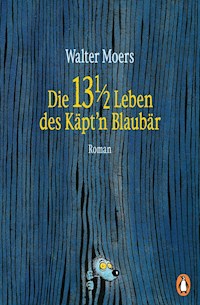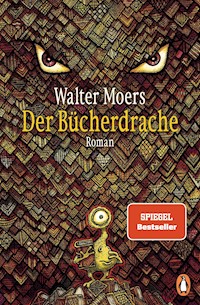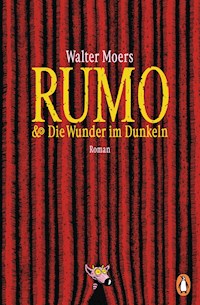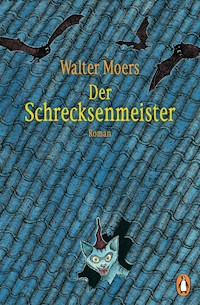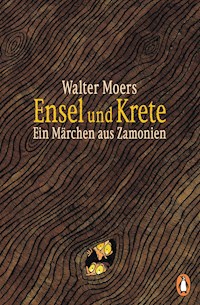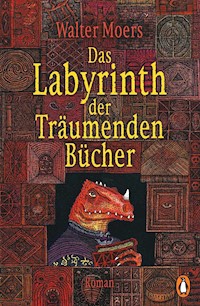
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nehmt euch in Acht: Gefährlicher können Bücher nicht sein!
Hildegunst von Mythenmetz, der größte Schriftsteller Zamoniens, suhlt sich auf der Lindwurmfeste in seinem Erfolg. Da erreicht ihn ein mysteriöses Schreiben, das ihn verlockt, dem Wohlleben Adieu zu sagen und nach Buchhaim zurückzukehren, der »Stadt der Träumenden Bücher«. Dort trifft er auf eine neuerbaute Stadt, die vor Leben rund um das Buch nur so vibriert. Und er begegnet alten Freunden, wie dem Lindwurm Ovidios und den Antiquaren Hachmed Ben Kibitzer und Inazea Anazazi, aber auch neuen Phänomenen und Wundern der Stadt.
Folgende weitere Zamonienromane sind bislang erschienen:
Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär
Ensel und Krete
Rumo & die Wunder im Dunkeln
Die Stadt der Träumenden Bücher
Der Schrecksenmeister
Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr
Weihnachten auf der Lindwurmfeste
Der Bücherdrache
Die Insel der Tausend Leuchttürme
Außerdem: Das Einhörnchen, das rückwärts leben wollte: Zwanzig zamonische Flabeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© Copyright 2011 beim Albrecht Knaus Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Lektorat: Rainer Wieland
Layout und Satz: Oliver Schmitt, Mainz
Covergestaltung: Bürosüd nach einem Entwurf von Oliver Schmitt
Covermotiv: Walter Moers
ISBN 978-3-641-05673-5V005
www.zamonien.de
www.knaus-verlag.de
Einst
Kam der Schwarze MannUnd zündet’ Buchhaim anEs brannte lichterlohDer Schwarze Mann alsoDann ging dahin die ZeitUnd mit ihr alles LeidDoch eh man sich versahWar Buchhaim wieder da
Buchhaimer Kinderlied
Eine Überraschung
ier geht die Geschichte weiter.
Sie erzählt, wie ich nach Buchhaim zurückkehrte und zum zweiten Mal hinabstieg in die Katakomben der Bücherstadt. Sie handelt von alten Freunden und neuen Feinden, von neuen Mitstreitern und alten Widersachern. Sie handelt aber vor allem, so unglaublich es klingen mag, vom Schattenkönig.
Und sie handelt von Büchern. Von Büchern der verschiedensten Art, von guten und schlechten, lebenden und toten, träumenden und wachen, wertlosen und kostbaren, harmlosen und gefährlichen. Und von solchen, bei denen man nicht ahnt, was in ihnen steckt. Bei deren Lektüre einen jederzeit eine Überraschung ereilen kann – besonders dann, wenn man am wenigsten damit rechnet.
So, wie beim Lesen dieses Buches, geneigter Leser, das du gerade in Händen hältst. Ich muss dir nämlich leider mitteilen, dass dies ein vergiftetes Buch ist. Sein Kontaktgift hat in dem Augenblick begonnen, durch deine Fingerkuppen einzudringen, als du es aufgeschlagen hast. Winzige, mikroskopisch kleine Partikel nur, für welche die Poren deiner Haut so groß wie Scheunentore sind, die ungehinderten Einlass in deinen Blutkreislauf gewähren. Und nun sind diese Todesboten bereits in deinen Arterien unterwegs, direkt zu deinem Herzen.
Horch in dich hinein! Hörst du den beschleunigten Herzschlag? Spürst du das leichte Kribbeln in deinen Fingern? Die Kälte in deinen Adern, die langsam die Arme hochsteigt? Die Beklemmung in der Brust? Die Atemnot? Nein? Noch nicht? Geduld, bald wird es beginnen. Sehr bald.
Was dieses Gift dir antut, wenn es am Herzen angelangt ist? Ehrlich gesagt: Es wird dich töten. Dein Leben beenden, hier und jetzt. Das erbarmungslose Toxin wird deine Herzklappen lähmen und damit den Fluss deines Blutes anhalten, ein für alle Mal. Der medizinische Fachausdruck dafür ist Infarkt, aber ich finde Herzkasper lustiger. Du wirst vielleicht noch theatralisch an deine Brust greifen und einen Laut der Verblüffung von dir geben, bevor du zusammenbrichst. Mehr ist dir nicht vergönnt. Und nimm es bitte nicht persönlich: Du bist nicht etwa das sorgfältig ausgewählte Opfer eines Komplotts. Nein, dieser Giftmord erfüllt keinerlei Zweck, er ist genauso sinnlos wie dein baldiger Tod. Es gibt auch kein Motiv. Du hast einfach nur zum falschen Buch gegriffen. Schicksal, Zufall, Pech – nenn es, wie du willst – du wirst jetzt sterben, das ist alles. Finde dich damit ab!
Es sei denn ...
Ja, es gibt noch eine Chance! Wenn du meinen Anweisungen folgst, ohne zu zögern. Es handelt sich nämlich um ein sehr seltenes Kontaktgift, das nur ab einer gewissen Menge tödlich wirkt. Es kommt einzig und allein darauf an, wie lange du das Buch in Händen hältst. Alles ist so präzise berechnet, derart exakt portioniert, dass dieses Gift dich lediglich dann umbringen wird, wenn du über den nächsten Absatz hinausliest! Also: Leg das Buch augenblicklich beiseite, falls du Wert darauf legst, deine Existenz fortzusetzen! Du wirst nur noch eine Weile deinen beschleunigten Herzschlag verspüren. Kalter Schweiß wird auf deine Stirn treten, das leichte Schwächegefühl wird bald vorübergehen – und dann kannst du dein erbärmliches Dasein in all seiner Ödnis so lange weiterfristen, wie das Schicksal Stunden für dich gestapelt hat. Auf Nimmerwiedersehen!
So – nun wären wir unter uns, meine tapferen Freunde! Endlich! Denn wer jetzt noch dieses Buch in Händen hält, in dessen Adern fließt Blut von meinem Blut. Ich bin es, Hildegunst von Mythenmetz, euer treuer Freund und Wegbegleiter, ich heiße euch willkommen!
Ja, es war nur ein Bluff. Das Buch ist natürlich nicht vergiftet. Wenn ich meine Leser umbringen will, dann langweile ich sie auf sechsundzwanzigtausend Seiten mit endlosen Dialogen über doppelte Buchführung zu Tode, so wie ich es mit meinem Romanzyklus Das Nattifftoffenhaus getan habe. Das finde ich subtiler.
Aber ich musste erst einmal die Spreu vom Weizen trennen. Denn dort, wo wir hingehen, können wir keinen Ballast gebrauchen. Keine zartbesaiteten Lektürememmen, die ein Buch schon bei der bloßen Erwähnung von Gefahr zitternd beiseitelegen.
Ihr ahnt es bereits, nicht wahr, meine furchtlosen Brüder und Schwestern im Geiste? Ja, es ist wahr – nach Buchhaim soll die Reise wieder gehen. Wie bitte?Die Stadt der Träumenden Bücher ist doch abgebrannt, werft ihr ein. Nun, das ist sie in der Tat. Von einer gnadenlosen Feuersbrunst wurde sie verwüstet, vor langer Zeit, und niemandem ist das schmerzlicher bewusst als mir. Denn ich war dabei. Ich sah mit eigenen Augen, wie Homunkoloss, der Schattenkönig, sich selbst entzündete, um das größte Feuer zu entfachen, das Buchhaim je erlebt hat. Ich sah ihn als lebendige Fackel in die Katakomben hinabsteigen, um einen Flammensturm zu entfesseln, der nicht nur die Häuser an der Oberfläche verbrannte, sondern sich auch tief in die Eingeweide der Stadt fraß. Ich hörte, wie die Feuerglocken gellten. Und ich sah sie mit den Sternen tanzen, die zu Funken gewordenen Träumenden Bücher. Über zweihundert Jahre ist das her.
Inzwischen ist Buchhaim wieder aufgebaut worden. In neuer Pracht, wie man hört. Mit noch reicheren antiquarischen Schätzen ausgestattet als je zuvor. Sie sollen aus den Bereichen der Katakomben stammen, deren Erschließung das Feuer erst möglich machte. Die Stadt ist nun eine pulsierende Metropole des zamonischen Buchwesens, eine magnetisch anziehende Pilgerstätte der Literatur, Verlegerei und Druckkunst, neben der das alte Buchhaim wirken würde wie ein Winkelantiquariat neben einer Staatsbibliothek. Großbuchhaim nennen es seine Bewohner heute selbstbewusst, als sei es ein vollständig anderer Ort. Welchen Büchernarren würde es nicht locken, mit eigenen Augen zu überprüfen, wie groß und prächtig die Stadt der TräumendenBücher tatsächlich aus der Asche wiederauferstanden ist?
Aber für mich gibt es noch einen anderen, einen erheblich triftigeren Grund als die bloße touristische oder bibliophile Neugierde. Und ihr, meine wissensdurstigen und unerschrockenen Freunde, wollt jetzt diesen Grund erfahren, nicht wahr? Mit gutem Recht, denn von nun an wollen wir wieder alles teilen, Freude und Leid, Gefahren und Geheimnisse, Abenteuer und Abendbrot – wir sind wieder eine verschworene Gemeinschaft. Ich verrate euch den Grund, aber ich gebe besser gleich zu, dass es kein besonders origineller Anlass war, der mich auf den Weg in das allergrößte Abenteuer meines Lebens schickte. Es war ein mysteriöser Brief. Ja, genau wie damals, bei meiner ersten Reise nach Buchhaim, war es ein handschriftliches Manuskript, das alles ins Rollen brachte.
Heimkehr zur Lindwurmfeste
Man darf mich getrost für größenwahnsinnig erklären, wenn ich behaupte, dass ich zu jener Zeit, als diese Geschichte begann, schon der größte Dichter Zamoniens war. Wie soll man einen Schriftsteller sonst nennen, dessen Bücher in Fässern in die Buchhandlungen gerollt werden? Der als jüngster zamonischer Künstler den Valtrosem-Orden erhalten hat? Dem man vor der Gralsunder Universität für Zamonische Dichtung ein Denkmal aus feuervergoldetem Gusseisen errichtet hat?
In jeder größeren zamonischen Stadt war eine Straße nach mir benannt. Es gab Buchhandlungen, die ausschließlich meine Werke führten – und die gesamte Sekundärliteratur dazu. Meine Anhänger hatten eingetragene Vereine gegründet, in denen sich die Mitglieder mit Namen von Gestalten aus meinen Büchern ansprachen. Einen Mythenmetz hinlegen war eine volksmündliche Umschreibung dafür, in einem künstlerischen Beruf eine einzigartige Karriere gemacht zu haben. Ich konnte keine belebte Straße entlanggehen, ohne einen Volksauflauf zu verursachen. Keinen Buchladen betreten, ohne bei den anwesenden Buchhändlerinnen Ohnmachtsanfälle auszulösen. Kein Buch schreiben, das nicht umgehend zum Klassiker erklärt wurde.
Kurzum: Ich war zu einem von Literaturpreisen und Publikumsgunst verhätschelten Popanz verkommen, dem jede Fähigkeit zur Selbstkritik und nahezu alle natürlichen künstlerischen Instinkte abhanden gekommen waren. Einer, der nur noch sich selbst zitierte und die eigenen Werke kopierte, ohne es zu bemerken. Wie eine schleichende Geisteskrankheit, die vom Patienten selber nicht erkannt wird, hatte mich der Erfolg ereilt und völlig verseucht. Ich war so sehr damit beschäftigt, mich in meinem Ruhm zu suhlen, ich nahm nicht einmal wahr, dass mich das Orm schon lange nicht mehr durchströmte.
Habe ich in dieser Zeit überhaupt etwas von Bedeutung geschrieben? Ich wüsste nicht, wann ich das hätte tun sollen. Die meiste Zeit verplemperte ich doch damit, in Buchhandlungen, Theatern oder auf Literaturseminaren mit selbstverliebtem Singsang aus meinen eigenen Werken vorzutragen, um mich danach am Applaus zu berauschen, herablassend mit Verehrern zu plaudern und stundenlang zu signieren. Was ich, oh meine treuen Freunde, damals für den Gipfel meiner Laufbahn hielt, markierte in Wirklichkeit ihren absoluten Tiefpunkt. Schon längst konnte ich nicht mehr anonym durch eine Stadt streifen und unbehelligt für meine Arbeit recherchieren. Überall umringten mich sogleich Scharen von Verehrern, die mich um Autogramme, künstlerische Ratschläge oder meinen Segen anflehten. Selbst auf den Landstraßen folgten mir Pilgerscharen von fanatischen Lesern, die Augenzeugen sein wollten, wenn mich das Orm überkam. Dies geschah aber erst immer seltener, dann gar nicht mehr – und ich bemerkte es nicht einmal. Denn um ehrlich zu sein, zu dieser Zeit konnte ich einen Ormrausch von einem Weinsuff kaum unterscheiden.
Es war eine Flucht vor dieser ins Monströse gewachsenen Popularität, vor meinem bizarren Erfolg und meinen verrückten Verehrern, als ich mich entschloss, nach langen Jahren der ruhelosen Wanderschaft und etlichen Abenteuern für eine Weile auf die Lindwurmfeste zurückzukehren, um mich dort ein wenig auf meinen Lorbeeren auszuruhen. Ich bezog wieder das kleine Haus, welches ich von meinem Dichtpaten Danzelot von Silbendrechsler geerbt hatte. Auch darum – sehen wir der Sache ins Gesicht, meine geliebten Freunde –, der Öffentlichkeit und meinen Artgenossen auf der Feste eine Rückkehr zu meinen Wurzeln vorzutäuschen: Auf dem Zenit seiner Karriere kehrt der verlorene Sohn heim, um unter bescheidensten Verhältnissen demütig sein titanisches Werk fortzusetzen, im beengten Häuschen seines über alles geliebten Dichtpaten.
Nichts war weiter von der Wahrheit entfernt. Niemand in ganz Zamonien hatte zu dieser Zeit weniger Bodenhaftung als ich. Und niemand lebte dekadenter und zielloser in den Tag hinein, ohne sich um seine kulturelle Aufgabe und dichterische Disziplin zu scheren. Die Lindwurmfeste war schlicht der einzige Ort, der mir perfekten Schutz vor meiner Popularität bot. Immer noch waren hier außer Lindwürmern keine anderen Daseinsformen zugelassen. Nur hier konnte ich ein Künstler unter lauter Künstlern sein. Und nur unter Lindwürmern herrschte diese perfekte Etikette, die jedem seine Privatsphäre gewährleistet. Auf der Lindwurmfeste galt die Einsamkeit als kostbares Gut. Hier war jeder Einzelne so sehr mit der eigenen literarischen Arbeit beschäftigt, dass niemand bemerkte, wie sträflich ich die meine vernachlässigte.
Die einzige Sorge, abgesehen von den üblichen hypochondrischen Anwandlungen, bereitete mir mein Körpergewicht. Der geruhsame Lebenswandel, der chronische Mangel an Bewegung und die deftige Lindwurmkost hatten sich recht bald in etlichen Pfunden auf den Hüften niedergeschlagen, was mich gelegentlich deprimierte. Aber nie so sehr, dass dies nicht mit ein paar Marmeladen-Omeletts oder einer Sumpfschweinkeule aus der Welt zu schaffen war. Ich hätte vielleicht als der fetteste und einsamste Dichter der Lindwurmfeste enden können, wenn da nicht die Lektüre eines mysteriösen Briefes gewesen wäre, die mich aus dieser Lethargie riss.
Es war an einem gewöhnlichen Sommermorgen, als mein Leben ins Rutschen kam. Wie an jedem anderen Tag saß ich beim übermäßig ausgedehnten Frühstück in der kleinen Küche meines geerbten Hauses und las wie üblich stundenlang in meiner Verehrerpost, trank dazu literweise süßen Sahnekakao, kaute schokoladenumhüllte Mokkabohnen und mampfte ein Dutzend frische Blätterteig-Hörnchen mit Aprikosenmarkfüllung. Ich langte immer mal wieder in einen der Postsäcke, den der mürrische Briefträger alle paar Tage anschleppte, holte irgendeinen Brief heraus, öffnete ihn und suchte darin ungeduldig nach den schmeichelhaftesten Stellen. Meistens war ich milde enttäuscht, weil ich mir diese Briefe immer noch etwas hymnischer vorstellen konnte, als sie es schon waren. So ersetzte ich während der Lektüre in Gedanken das eine oder andere »hervorragend« durch ein »epochal« oder ein »großartig« durch »unübertrefflich«, um den Brief anschließend an meine Brust zu drücken und dann seufzend ins Kaminfeuer zu werfen. Ich verbrannte die Verehrerpost nur schweren Herzens, aber die schiere Papiermasse hätte mich bald aus dem Haus gedrängt, wenn ich sie nicht regelmäßig entsorgte. So quoll den ganzen Morgen lang verbranntes Mythenmetzlob aus meinem Kaminschlot und reicherte die Luft um die Lindwurmfeste mit dem Parfüm meines Erfolges an. Anschließend verbrachte ich oft noch ein Stündchen damit, mich meinem neuen Steckenpferd, dem dilettantischen Spiel auf der Klavorgel1 hinzugeben. Ich gefiel mir nämlich neuerdings darin, klassische Kompositionen von Evubeth van Goldwein, Melodanus Graf Watzogam, Odion La Vivanti oder anderen Größen der zamonischen Musik mit meinen bescheidenen Fähigkeiten nachzuklimpern. Das war aber auch schon der Höhepunkt der künstlerischen Betätigungen in meinem normalen Tagesablauf.
Manchmal entscheidet ein kurzer Augenblick, oft nur von der Länge eines Wimpernschlages, über das weitere Schicksal. In meinem Fall war es der Zeitraum, den man benötigt, um einen Satz mit sieben Silben zu lesen. Mit spitzen Fingern pflückte ich wahllos einen Umschlag aus dem prallen Postsack, während ich mit der anderen Hand ein Hörnchen in den Sahnekakao tunkte. Hach, dachte ich, auch du wirst mich nicht überraschen, kleines Brieflein! Ich weiß genau, was in dir steht! Eine fiebrige Liebeserklärung an meine Lyrik oder eine unterwürfige Verbeugung vor meinem kühnen Prosastil, wetten? Eine begeisterte Eloge auf eines meiner Theaterstücke oder ein genereller Kniefall vor dem Mythenmetzschen Gesamtwerk. Ja, ja ... Einerseits ödete mich dieser endlose Strom von Zuspruch an, andererseits war ich süchtig nach ihm geworden. Vielleicht auch, weil er mir das Orm ersetzte, das mich nun so lange schon nicht mehr heimgesucht hatte.
Es gelang mir mühelos, den Umschlag mit der linken Klaue aufzureißen, den Brief hervorzuholen und zu entfalten, während ich mit der rechten das Hörnchen im Kakao ertränkte, denn das hatte ich oft geprobt. Ich hob den Schrieb vor mein blasiert dreinschauendes Gesicht und ließ den Unterkiefer weit aufklappen. Dann warf ich das Hörnchen in meinen Rachen, ohne den Ellenbogen vom Tisch zu heben. Dies geschah in der Absicht, im selben Augenblick, in dem ich die ersten schmeichelnden Zeilen des Verehrerbriefes las, in den Genuss eines Blätterteighörnchens zu kommen. So tief war ich gesunken!
»Hier«, las ich, als das Hörnchen in meinen Schlund rutschte, »fängt die Geschichte an.«
Ich muss wohl gleichzeitig mit dem Schlucken aufgehört und überrascht nach Luft geschnappt haben. Fest steht nur, dass das Hörnchen noch nicht genügend eingeweicht war und in meiner Speiseröhre stecken blieb. Diese zog sich daraufhin spasmisch zusammen, presste die Kakaosahne aus dem Teig und pumpte sie nach oben. Meine Luftröhre wurde überflutet, und ich machte Geräusche wie ein Frosch, der unter Wasser gewürgt wird. Ich zerknüllte den Brief in der einen Klaue und schlug mit der anderen sinnlos in die Luft.
Nun konnte ich weder schlucken noch atmen, daher sprang ich ruckartig auf, in der Hoffnung, dass durch die senkrechte Haltung alles wieder ins Lot kam. Das war aber nicht so – ich gurgelte lediglich mit Sahne.
»Rargll«, röchelte ich.
Das Blut schoss mir in den Kopf, und meine Augen quollen aus den Höhlen. Ich trat hastig ans offene Fenster, in der verzweifelten Hoffnung, dort besser Luft zu bekommen. Aber es gelang mir lediglich, weitere gurgelnde Geräusche von mir zu geben, während ich mich aus dem Fenster beugte. Zwei Lindwürmer, die gerade auf der Straße vorbeiflanierten, sahen zu mir herüber.
»Harrlgrn!«, machte ich, winkte panisch und glotzte sie mit hervorquellenden und rotgeäderten Augen an. Sie hielten das wohl für einen launigen Morgengruß, denn sie grüßten zurück, indem sie mein Gurgeln imitierten.
»Harrlgrn!«, riefen sie fröhlich, während sie die Augen aufrissen und mir zuwinkten. »Ein Harrlgrn auch dir, großer Meister!«
Dann lachten sie.
Seit ich ein solches Lieblingskind des Erfolges geworden war, hatten sich meine Artgenossen angewöhnt, meine Marotten nachzuäffen, um ja nicht irgendeinen zukunftsweisenden Trend zu verpassen, den ich vielleicht gerade kreierte. Die beiden gingen gurgelnd und lachend die Straße hinab, ohne mich weiter zu beachten. Der neue Mythenmetzgruß würde sicher die Runde machen.
Die Sahne lief in dünnen Rinnsalen aus meinen Nüstern. Ich wankte vom Fenster ins Zimmer zurück, stürzte dabei über den Küchenstuhl, fiel der Länge nach hin und rappelte mich röchelnd an der Tischkante wieder hoch. Ich konnte nur noch Geräusche hervorbringen, wie man sie aus verstopften Rohrleitungen oder Trompeten vernimmt. Mein tränengetrübter Blick fiel hilfesuchend auf das uralte Ölportrait meines Dichtpaten Danzelot, der verständnislos auf mich herabglotzte. Zeitlebens hatte er mich zum Verzehr von gedünstetem Gemüse angehalten und eindringlich davor gewarnt, beim Essen zu schlingen. Jetzt war ich nur Augenblicke davon entfernt, ihm ins Jenseits zu folgen – viel zu früh, wie mir schien. Meine Augen quollen noch weiter aus den Höhlen, und eine ununterdrückbare Müdigkeit vernebelte meinen Geist. Ein seltsames, widersprüchliches Gemisch aus Panik und absoluter Gleichgültigkeit überkam mich: Ich wollte leben und sterben zugleich.
Und ausgerechnet in dieser Situation, oh meine geliebten Freunde, die eigentlich kein klares Denken mehr zuließ, traf mich eine fundamentale Erkenntnis: Mein Erfolg, meine kometenhafte Karriere, mein ganzes Leben und Streben, mein bisheriges Gesamtwerk, meine Literaturpreise und Auflagenzahlen waren weniger bedeutend als ein Frühstückshörnchen. Ein billiges Gebäck aus Blätterteig entschied über Leben und Tod. Über mein Leben und meinen Tod. Eine Backmischung aus ordinärem Mehl, Zucker, Hefe und Butter.
Und das brachte mich trotz der dramatischen Umstände zum Lachen. Ihr könnt euch ausmalen, dass dies kein fröhliches und lebensbejahendes Gelächter war, sondern nur ein kurzes verbittertes »Hah!« Aber es genügte, um die fatale Situation in meiner Speiseröhre auf glückliche Weise zu wenden.
Denn durch den Lacher hüpfte das Hörnchen den Schlund hoch. Es nahm sozusagen auf dem Weg zum Magen neuen Anlauf, glitt diesmal problemlos hinab und verschwand ordnungsgemäß in meinem Verdauungstrakt. Die Sahne floss nach, die Atemwege waren wieder fast frei, ich hustete und prustete den Rest davon aus den Nüstern – und konnte Luft holen.
»Bwaaah!«, machte ich wie ein Ertrinkender, der es gerade noch an die Oberfläche geschafft hat. Sauerstoff! Die besten Dinge im Leben gibt es umsonst! Erschöpft und erleichtert zugleich ließ ich mich auf einen Küchenstuhl fallen. Ich griff mir an die Brust. Mein Herz schlug wie eine Feuerglocke. Du meine Güte! Nur um Haaresbreite war ich einem vollkommen lächerlichen Ende entgangen! Wie radikal hätte mir dieses verdammte Hörnchen beinahe meine Biographie versaut:
»Mythenmetz erstickt an einem Hörnchen!«
»Größter Dichter Zamoniens von Blätterteigspeise dahingerafft!«
»Übergewichtiger Valtrosempreisträger tot in Sahnepfütze aufgefunden!«
»Das Schwergewicht unter den zamonischen Dichtern erlag einem federleichten Gebäck.«
Ich konnte mir die Schlagzeilen genauso leicht ausmalen wie Laptantidel Latudas hämischen Großkritiker-Nachruf im Gralsunder Stadtanzeiger. Das Hörnchen hätten sie sicher noch in meinen Grabstein gemeißelt!
Erst als ich mir den Schweiß abwischen wollte, wurde mir bewusst, dass ich den Brief immer noch in der Hand hielt, die Krallen tief ins Papier gegraben. Verfluchter Wisch! Ins Feuer damit! Ich erhob mich, um ihn in den Kamin zu schleudern, aber dann hielt ich inne. Moment mal! Welcher Satz war es eigentlich gewesen, der mich derart aus der Fassung gebracht hatte? Vor lauter Aufregung hatte ich ihn schon wieder vergessen. Ich sah noch einmal hin:
Hier fängt die Geschichte an.
Ich musste mich wieder setzen. Ich kannte diesen Satz – und ihr kennt diesen Satz, meine treuen Freunde und Weggefährten! Und ihr wisst auch, welche Bedeutung er für mich, mein Leben und mein bisheriges Werk hatte. Wer hatte diesen Brief geschrieben? Nein, den durfte ich nicht einfach verbrennen, auch wenn er dazu beigetragen hatte, mich beinahe umzubringen. Ich las weiter.
Ich studierte den Brief von vorne bis hinten, Wort für Wort, zehn engbeschriebene Seiten lang. Was darin stand, abgesehen von diesem fesselnden Einleitungssatz? Nun, meine Freunde, das lässt sich mühelos mit zwei Worten beschreiben: fast nichts. Zumindest stand fast nichts Bedeutendes, Wichtiges oder Tiefsinniges auf diesen zehn Seiten.
Wohlgemerkt: Fast nichts.
Es war nämlich noch ein anderer kurzer Satz von Bedeutung darin – derjenige, welcher dem ganzen Sermon als Postskriptum angefügt war, ein Nachtrag aus vier Worten. Aber der hatte es derart in sich, dass er mein Leben komplett auf den Kopf stellen sollte.
Doch der Reihe nach: Der Brief handelte von einem Schriftsteller, der sich im horror vacui vor einem Blatt Papier befand, im Angesicht der Furcht vor dem leeren weißen Papier. Ein unbekannter Autor, gelähmt von Schreibangst. Was für ein Klischee! Wie viele Texte mit diesem Motiv kannte ich mittlerweile schon?! Zu viele, das stand fest. Aber ich hatte noch nie einen gelesen, der so wenig originell und uninspiriert mit dieser Grundidee umging, der so selbstmitleidig und weinerlich, deprimierend und trostlos war wie jener Brief. Auch trostlose Texte können künstlerische Größe erreichen, aber das hier war wie das Gewäsch eines eingebildeten Kranken, der zufällig im Wartezimmer neben einem saß und einen mit seinen nichtigen Wehwehchen behelligte. Die Ausführungen des Verfassers kreisten ausschließlich um ihn selbst und seine gesundheitlichen und seelischen Befindlichkeiten, um seine läppischen Nöte und albernen Ängste. Er beklagte sich über Dinge wie aufgerauhtes Zahnfleisch. Über einen Papierschnitt, den er sich zugezogen hatte. Über Schluckauf, Hornhaut und Völlegefühl, als seien dies unheilbare und tödliche Krankheiten. Er jammerte über Kritik an seinen Schriften, selbst wenn sie wohlmeinend war, über das schlechte Wetter und Migräne. Es stand kein einziger Satz von Wert darin. Lauter Allerweltszeug, das der schriftlichen Formulierung nicht bedurfte. Ich ächzte und stöhnte bei der Lektüre wie bei der Besteigung eines steilen Bergpfads an einem schwülen Hochsommertag mit einem Rucksack voller Pflastersteine. Noch nie hatte ich mich von Worten derart belastet, ja: belästigt gefühlt. Es war, als klammere sich der Autor an mein Bein, um von mir durch eine unfruchtbare, tote Steinwüste mitgeschleift zu werden. Worte wie ausgedorrte Kakteen, Sätze wie vertrocknete Tümpel. Dieser Schriftsteller hatte gar keine Schreibangst! Ganz im Gegenteil, er konnte die Tinte kaum halten, obwohl er eigentlich gar nichts zu sagen hatte. Kurz: Das war der schlechteste Text, den ich jemals gelesen hatte.
Und dann traf mich eine Erkenntnis wie der Tritt eines auskeilenden Pferdes: Das war ich selbst, der das geschrieben hatte! Ich schlug mir vor die Stirn. Natürlich, das waren mein Stil, meine Wortwahl, meine bandwurmlangen Schachtelsätze. So schrieb kein anderer als ich, seitdem ich den Gipfel des Erfolges erklommen hatte. Da, ein Satz mit siebzehn Kommata, mein interpunktives Markenzeichen! Hier, eine verfressene Mythenmetzsche Abschweifung zum Thema »Perfekte Kalbsschnitzel-Panierung«! Da, ein von Verbalinjurien gespickter Ausfall gegen Literaturkritiker im Allgemeinen und den Groß-Kritiker Laptantidel Latuda im Besonderen! Das war er, der unverwechselbare Gesang meiner Edelfeder. Erst in diesem Augenblick wurde mir bewusst, dass ich seit Jahren meine Texte nicht mehr las, nachdem ich sie einmal niedergeschrieben hatte. Ich gab sie oft schon in Druck, wenn die Tinte auf dem Papier noch feucht war, derart unangekränkelt war ich von jeglicher Selbstkritik. Und ich duldete auch schon lange kein Lektorat mehr, das darüber hinausging, gelungene Sätze zu unterstreichen und »Brillant!« oder »Unnachahmlich!« danebenzuschreiben.
Aber dennoch, das war doch niemals meine Handschrift! Und ich hatte noch nie einen Text solchen Inhalts verfasst, da war ich mir sicher. Irritiert las ich weiter. Ja, meine teuren Freunde, dieser Brief war garantiert nicht von mir, aber stilistisch hätte er durchaus von mir sein können, mit deutlicher Betonung all meiner Schwächen. Er enthielt sogar meine charakteristischen hypochondrischen Höhenflüge, in denen ich mir Krankheiten einbildete, wie nur ich sie erdenken konnte: Hirnhusten und Lungenmigräne, Leberfistel und Mittelohrzirrhose und so weiter. Beim Orm, das war schon sehr authentisch, bis hin zu den minutiösen Aufzeichnungen von Fieber- und Pulsfrequenzmessungen! Wenn das eine Parodie meines Stils sein sollte, dann musste ich zugeben, dass sie geradezu schmerzhaft gut gelungen war. Nur mit erheblicher Beklemmung gelang es mir, die Lektüre zu Ende zu bringen. Es ging in dieser lächerlichen Melange aus Größenwahn und Weinerlichkeit so weiter bis zum Schluss, wo der Text abrupt abbrach, als habe der Verfasser einfach die Lust verloren. Tatsächlich beendete auch ich in der letzten Zeit immer öfter in dieser saloppen Manier meine Texte.
Ächzend blickte ich vom Blatt auf. Als Leser fühlte ich mich betrogen und eines Gutteils meiner Lebenszeit beraubt. Als Parodierter vollkommen durchschaut und gedemütigt. Die Lektüre hatte vielleicht eine Viertelstunde gedauert, aber es hatte sich angefühlt wie eine Woche. Schrieb ich tatsächlich solch ein grauenhaftes, völlig ormloses Zeug? Und als ich endlich die Unterschrift unter dem Brief las, war mir zumute wie jemandem, der nach Jahren der Gefangenschaft zum ersten Mal wieder in den Spiegel sieht und sein vom Alter deformiertes Gesicht erblickt. Dort stand:
Sogar meine Unterschrift war perfekt gefälscht. Ich musste mehrmals hinsehen, um mich davon zu überzeugen, wie gut sie im Detail kopiert war. Bis in den letzten Schnörkel hinein.
Ich erschrak. Hatte ich den Brief vielleicht doch geschrieben, mit verstellter Handschrift, aber korrektem Autogramm, und an mich selbst geschickt – in geistiger Umnachtung? Hatte sich mein dichterisches Ich von mir gelöst und selbständig gemacht? War ich ein Opfer der Schizophrenie geworden, einer Psychose, ausgelöst von übermäßiger Kreativität? Welche Nebenwirkungen das Orm haben konnte, war noch nicht erforscht. Perla La Gadeon, den das Orm so oft heimgesucht hatte wie keinen anderen, war im Delirium verstorben. Auch Dölerich Hirnfidler wurde vom Irrsinn dahingerafft, lallend verendete er in seinem Elfenbeinturm. Eiderich Fischnertz soll sich angeblich mit einem Pferd unterhalten haben, kurz bevor er geistig umnachtet starb.
War das der Tribut, den ich meinem Ruhm zu zollen hatte? Und hatte ich nicht schon in meiner Jugend Symptome der Persönlichkeitsspaltung gezeigt? Ich hatte damals einen ganzen Band von Briefen An mich selbst verfasst. Aber ich war nie so weit gegangen, diese Schreiben auch tatsächlich an mich zu versenden. Herrje, meine hypochondrischen Phantasien gingen wieder mit mir durch! Ich musste mich unbedingt beruhigen. Um mich abzulenken, warf ich noch einen letzten Blick auf den Brief. Da erst sah ich das Postscriptum, welches in mikroskopisch kleiner Schrift auf den unteren Rand gesetzt war. Es lautete:
P S. Der Schattenkönig ist zurückgekehrt.
Ich starrte die Zeile an wie ein Gespenst, das mir gerade erschienen war.
P S. Der Schattenkönig ist zurückgekehrt.
Kalter Schweiß trat mir auf die Stirn, und der Brief in meiner Hand begann zu zittern. Vier Worte, zweiunddreißig winzige Zeichen auf Papier genügten, mich derart aus der Fassung zu bringen:
Der Schattenkönig ist zurückgekehrt.
War das ein gemeiner Scherz? Welcher grausame Witzbold hatte dann diesen Wisch geschickt? Einer meiner zahllosen Neider? Ein missgünstiger Kollege? Ein Kritiker? Einer der vielen verschmähten Verleger, die mich mit ihren Angeboten überhäuften? Ein verrückter Verehrer? Mit bebender Klaue langte ich nach dem Umschlag, um den Absender zu lesen. Ich nahm die zerrissene Papierhülle hoch, drehte sie um und buchstabierte wie ein Schulkind:
Da fing ich an zu schluchzen, und erst meine Tränen verschafften mir die Beruhigung, die mein aufgewühlter Geist so dringend benötigte.
1 Klavorgel, die: Primitives Tasteninstrument, das ausschließlich für die Bewohner der Lindwurmfeste hergestellt wird. Die Klaviatur der Klavorgel verfügt nur über 24 Tasten, die besonders breit und robust sind und speziell für die dreifingrige Lindwurmklaue entwickelt wurden. Wirklich differenzierte Musik lässt sich auf der Klavorgel nicht erzeugen. A. d. Ü.
Das Blutige Buch
In der Dämmerung des nächsten Morgens stahl ich mich wie ein Dieb aus der Lindwurmfeste. Niemandem begegnen, keine Erklärungen abgeben, keine Abschiedsszenen provozieren – das war unter Lindwürmern kein Akt der Feigheit, sondern ein Gebot der Höflichkeit. Wenn ich behaupte, dass ich sentimentale Szenen in der Literatur durchaus schätze, in der Wirklichkeit aber strikt ablehne, dann gilt das auch für meine Artgenossen. Vielleicht liegt es daran, dass wir Lindwürmer unsere Gefühle zum größten Teil in unserer dichterischen Arbeit ausleben können. In Gesellschaft und im persönlichen Umgang untereinander sind wir überdurchschnittlich beherrscht, kühl, höflich, ja beinahe förmlich. Ein Abschied, zumal einer für längere Zeit, gehört zu den unangenehmsten Dingen, die sich ein Lindwurm vorstellen kann. Daher bin ich sicher, dass meine Freunde und Verwandten mir nachträglich dankbar waren, ihnen die Peinigung einer Abschiedsszene erspart zu haben.
Ich spazierte unbehelligt die leere Hauptstraße hinab, die sich in einer Spirale vom Gipfel der Feste bis zu ihrem Sockel windet, auf taufeuchtem Pflaster vorbei an geschlossenen Fensterläden, hinter denen ahnungslose Lindwürmer friedlich schnarchten. Ich warf einen kurzen Brief mit hexametrischen Abschiedsversen, die ich in der Nacht verfasst hatte, in den Rinnstein und adressierte ihn damit an die ganze Gemeinde. So folgte ich einem uralten Brauch, der Verabschiedungen von der Lindwurmfeste auf poetische Weise regelt. Das Risiko, dass der Wind meine Zeilen ungelesen über die Zinnen meiner Heimstatt wehte oder ein Regenguss die Tinte verwischte, gehörte dazu. Wir mögen eine emotional verkrüppelte Rasse sein, wir sind aber nicht ohne Sinn für das Dramatische.
Es wurde schon hell, obwohl die Sonne noch nicht aufgegangen war. Wann hatte ich eigentlich zum letzten Mal einen Sonnenaufgang erlebt? Keine Ahnung! Viel zu lange bereits hatte ich das wahre Leben verschlafen! Ich fühlte mich fast wie damals, als ich zum ersten Mal nach Buchhaim gereist war: übergewichtig, übernächtigt, überdrüssig, in denkbar schlechter geistiger und körperlicher Verfassung, aber auch in beinahe kindlicher Vorfreude auf die anstehenden Ereignisse und Abenteuer. Definiert man so nicht einen Neubeginn?
Nachdem ich die Lindwurmfeste verlassen hatte, wanderte ich über die öde Steinwüste, die sie in allen Himmelsrichtungen umgibt. Ich durchquerte dichte graue Nebelbänke, die aussahen wie Regenwolken, die vom Himmel gefallen waren. Die Sonne war jetzt aufgegangen, aber sie wärmte mich nicht. Wieder und wieder musste ich den feigen Impuls bekämpfen, mich auf dem Absatz umzudrehen und in den sicheren heimatlichen Fels zurückzukehren, der aufgrund seines vulkanischen Untergrundes selbst im Winter wohlige Wärme verströmt und auf einen Lindwurm eine Anziehungskraft hat wie der warme Ofen auf die Katze.
Was zum Henker wollte ich eigentlich in Buchhaim? Diese Stadt hatte mich schon einmal fast umgebracht. Mir war es auf der Feste doch blendend ergangen. Das bisschen Übergewicht hätte ich auch mit einer Diät in den Griff bekommen. Ich war kein junger Lindwurm von siebenundsiebzig Jahren mehr, der alle existenziellen Ängste durch juvenilen Optimismus ersetzen konnte, ich war eigentlich viel zu vernünftig geworden für so ein Abenteuer. Oder sollte ich besser sagen: viel zu alt? Zwischen meinen beiden Reisen nach Buchhaim waren über zweihundert Jahre vergangen. Zwei Jahrhunderte! Der Gedanke ließ mich noch heftiger frösteln.
Gibt es eigentlich ein Wort für diese Form von Zerrissenheit, die einen ergreift, wenn man im Begriff ist, eine längere Reise anzutreten, es aber immer noch bleiben lassen könnte? Der Geist scheint sich dann in zwei Hälften zu spalten: In eine wagemutige und jugendliche Hirnhälfte, die mutig, neugierig und abenteuerlustig aus den gewohnten Verhältnissen ausbrechen will. Und in eine risikoscheue, bequeme und gereifte Hälfte, die sich am liebsten ängstlich an die gewohnte Umgebung klammern möchte. Aber kurz nachdem ich beschlossen hatte, diese gebremste Reiselust Invakanz zu nennen, verflog sie mit jedem Schritt an der frischen Luft wie ein leichter Kopfschmerz. Lag der Bannkreis der Lindwurmfeste endlich hinter mir?
Und überhaupt: Hatte ich eigentlich meine unverzichtbaren Ohrenstöpsel dabei, ohne die ich unmöglich Schlaf finden konnte? Schon gar nicht in wildfremder Umgebung voller unvertrauter Geräusche? Meine Tabletten gegen Magenübersäuerung, die mich schon ereilte, wenn ich zu viel Kaffee trank? Genug Geld? Einen Notizblock? Landkarte, Fieberthermometer, mein Adressbuch, Halspastillen? Lesemonokel, Bleistifte, Klappmesser, Kompass, den zamonischen Reisepass? Herbergsregister, Schnupftuch, Zahnbürste, Augentropfen, Rosenöl, Brandsalbe, Zahnseide, aromatisierte Schlämmkreide zur Mundhygiene? Als ich die zahlreichen Taschen meines Reisemantels und den Reisesack durchwühlte, fand ich noch Streichhölzer, drei Kerzen, Pfeife und Tabakbeutel, Migränepulver, Nadel und Faden, eine Dose Fettcreme, Natronpulver und Kohletabletten. Ah, hier: die Ohrenstöpsel! Ferner Ringdudlers Miniaturlexikon der altzamonischen Literatur, Trockentinte, eine Krallenschere, Siegellack, zwei Radiergummis, Briefmarken, Hustentropfen, Baldrianpillen, Hühneraugen-Pflaster und Mullbinde, eine Pinzette ... Herrje, wozu benötigte ich auf einer Reise nach Buchhaim denn eine Pinzette? Ach ja: In letzter Minute hatten mich Phantasien von winzigen Splittern oder Bienenstacheln heimgesucht, die man sich auf so einer Wanderung einfangen und nur mit einem Präzisionsinstrument entfernen konnte, bevor sie eine tödliche Blutvergiftung verursachten. Im Gewühle geriet mir auch ein Bündel zerknülltes Papier in die Finger – der Brief, der mich zu dieser Reise bewogen hatte.
Jetzt endlich blieb ich stehen und versuchte, meine Nerven zu beruhigen. Richtig, es gab einen Grund für diese Reise. Dieser Brief, dessen Seiten ich nun glattstrich, bevor ich ihn wieder zusammenfaltete. Kam er aus den Labyrinthen von Buchhaim? Stammte er tatsächlich aus der Ledernen Grotte – der Heimat der Buchlinge? Und wollte ich das wirklich herausfinden? Blödsinn! Nicht um alles in der Welt würde ich jemals wieder einen Fuß in diese Unterwelt setzen. Es gab Dutzende von triftigeren Gründen für meine Reise! Überdruss, Reiselust, Langeweile, Höhenkoller, Übergewicht, und außer Bequemlichkeit gab es kein einziges Argument dafür, zur Lindwurmfeste zurückzukehren. Dies war nicht die kopflose Flucht eines Jünglings ins Ungewisse, so wie damals. Beim Orm, ich war immerhin Hildegunst von Mythenmetz! Ein gestandener Schriftsteller mit solider Karriere, und ich hatte das Ziel meiner Reise schon einmal ausgiebig erkundet. Was sollte denn schon passieren?! Damals hatte ich mir unter wesentlich ungünstigeren Voraussetzungen erheblich mehr zugemutet. Das hier war doch nur ein Spaziergang, eine biographische Fußnote. Eine Forschungsreise. Kleine Recherche. Luftveränderung. Ein Spaß. Und diesmal würde ich den jugendlichen Übermut durch Erfahrung und Reife ersetzen. Auf keinen Fall blauäugig in jede ausgelegte Falle tappen, wie der Grünschnabel von vor zweihundert Jahren. Und bitteschön, was für Fallen sollten das denn sein? Niemand wusste von meinem Kommen. Und solange ich die Kapuze meines Mantels aufbehielt, konnte sich sogar der populärste Dichter Zamoniens in der Stadt der TräumendenBücher inkognito und unbehelligt herumtreiben, solange es ihm gefiel.
Diese Überlegungen beschwichtigten mich spürbar. Ich stopfte den Brief in meinen Mantel zurück, ordnete den Inhalt meiner durchwühlten Taschen und hielt plötzlich das Blutige Buch in Händen. Richtig, auch das hatte ich, einem plötzlichen Impuls gehorchend, eingepackt. Warum eigentlich? Nun, in erster Linie wollte ich es zurücktragen in die Stadt, der es eigentlich gehörte. Die grässliche Schwarte befand sich zwar nun seit zwei Jahrhunderten in meinem Besitz, aber ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass das Buch mir wirklich gehörte. Ich hatte es damals den Flammen entrissen und vor der sicheren Vernichtung gerettet. Aber machte diese Tat das Blutige Buch zu meinem Eigentum? Ich hatte nicht mehr Anspruch darauf als ein Plünderer, der während einer Katastrophe ein fremdes Haus ausraubt. Ich hatte es seither ja nicht einmal gelesen! Es war mir einfach unmöglich. Jedes Mal, wenn ich es aufzuschlagen wagte, konnte ich höchstens einen einzigen Satz daraus lesen – insgesamt waren es genau drei gewesen –, und schon hatte ich es voller Entsetzen wieder zugeklappt, um es dann jahrelang unberührt zu lassen.
Ich wollte es endlich wieder loswerden, das verwunschene Ding! Aber natürlich konnte ich es nicht einfach fortwerfen. Es war enorm kostbar und stand weit oben auf der Goldenen Liste, der Rangordnung der wertvollsten antiquarischen Bücher von Buchhaim, ja es war eines der begehrtesten antiquarischen Bücher überhaupt. Das schuf eine gewisse Verantwortung. Vielleicht gelang es mir, in der Stadt derTräumenden Bücher einen Käufer dafür zu finden. Und wenn nicht, dann würde ich es der Städtischen Bibliothek von Buchhaim spenden. Genau – das würde ich tun. Ich fügte den Gründen für meine Reise eine gute Tat hinzu. Schlagartig fühlte ich mich erleichtert. Ich steckte die schreckliche Schwarte wieder ein.
Die letzten Nebel verdampften in der Mittagssonne, deren Strahlen nun endlich mein Gesicht wärmten, und ich schritt zuversichtlicher aus. Mit dem Reisen verhält es sich auch nicht anders als mit dem Schreiben. Man muss erst mal in Gang kommen, aber wenn die ersten Stolpersteine überwunden sind, geht es meistens wie von selbst. Wer nicht reist, der bleibt zu Hause! Nachdem die Lindwurmfeste einige Zeit aus dem Sichtfeld verschwunden war, strömten Ideen für Kurzgeschichten, Gedichte, ja ganze Romane auf mich ein. Den lieben langen Tag ging das so, und immer wieder musste ich pausieren, um mir das Wichtigste in mein Notizbuch zu schreiben. Es war, als lauerten die künstlerischen Einfälle am Wegesrand zwischen der Lindwurmfeste und Buchhaim, um ausgebrannte Dichter anzuspringen und zu inspirieren. Bald deklamierte ich lauthals Verse, die ich aus dem Stegreif dichtete. Bedauernswerte zamonische Natur, die sich das anhören musste, auf sie dürfte ich den Eindruck eines entsprungenen Irrenhäuslers gemacht haben! Aber das war mir egal. Ich hatte die richtige Entscheidung getroffen, mir eröffnete sich gerade ein vollständig frischer Lebensabschnitt. Hildegunst von Mythenmetz erfand sich wieder einmal neu!
Sogar die Schuppen fielen von mir ab! Tatsächlich, mit dem Beginn meiner Wanderung setzte eine meiner periodischen Häutungsphasen ein: Mein bislang grünes Schuppenkleid verabschiedete sich, um einem von rötlicher Farbe zu weichen. Nach der gelblichen Haut meiner Kindheit, der grünlichen meiner Jugend und ersten Erwachsenenjahre, war dies eine meiner jetzigen Reife angemessene, geradezu majestätische Farbe: Rot. Die neuen Schuppen glänzten edel in der Sonne. Wenn die Häutung vollzogen war, würde ich für geraume Zeit keine Fettcreme mehr benötigen, meine neue Haut würde schimmern wie eine polierte Rüstung. Die alten Schuppen rieselten aus meiner Kleidung, zunächst nur vereinzelt, aber bald würden sie in wahren Schauern abfallen, das wusste ich aus Erfahrung. Es ist nicht unbedingt ein schöner Anblick, einem Lindwurm bei der Häutung zuzusehen, aber für ihn selbst ist das eine durchaus angenehme Erfahrung. Es juckt ein bisschen, aber auf eine wohlige Weise. Es ist, als würde man den Schorf einer geheilten Wunde abkratzen – am ganzen Leib. Ich nahm es als gutes Zeichen, als Einverständniserklärung meines Körpers zu dieser Reise. Ein schuppender Lindwurm ist ein gesunder Lindwurm! Das hatte mein Dichtpate Danzelot immer gesagt. Ich würde für die nächste Zeit eine Spur hinterlassen wie ein wandelnder nadelnder Tannenbaum.2
In einem kühlen Birkenwäldchen ließ ich mich zur Nachtruhe nieder. Es gelang mir nur mit einiger Mühe, ein kleines Lagerfeuer zu entfachen, was früher immer eine der leichtesten Übungen für mich routinierten Wanderer gewesen war. Dies war die einzige Maßnahme, die ich ergriff, um wilde Tiere abzuschrecken. Ich hatte alles Mögliche eingepackt, aber an ein Werkzeug zur Verteidigung hatte ich nicht gedacht. Die gefährlichste Waffe, die ich bei mir trug, war ein kleines Klappmesser. Wenn jetzt irgendeine Bestie aus der Dunkelheit brach, könnte ich höchstens versuchen, sie mit einer Pinzette einzuschüchtern oder ihr etwas Hustensaft anzubieten.
Wieso hatte ich eigentlich keine Angst? Wahrscheinlich war ich einfach nur viel zu müde, um mich jetzt auch noch zu fürchten. So viel gesunde Bewegung an einem einzigen Tag hatte ich schon ewig nicht mehr gehabt. Ich bettete den Kopf auf meinen Reisesack und betrachtete die tanzenden Schatten zwischen den Birkenstämmen. Mein Ruhekissen war ein wenig hart, was an dem Blutigen Buch lag, das sich darin befand, aber ich hütete mich, es herauszunehmen.
Hexen stehen immer zwischen Birken.
Dies war einer der drei rätselhaften Sätze aus dieser unseligen Schwarte, die mir immer wieder bei den unpassendsten Gelegenheiten in den Sinn kamen.
Der Schatten, den du wirfst, ist nicht dein eigener.
Das war der zweite Satz.
Wenn du die Augen schließt, kommen die Anderen.
So lautete der dritte.
Nur ganze drei Mal hatte ich das Blutige Buch aufgeschlagen, und jeder dieser drei Sätze hatte sich auf ewig in mein Gedächtnis eingebrannt. Aber seltsam, ausgerechnet hier, in dieser wildfremden, schutzlosen und sicher nicht ungefährlichen Umgebung jagten sie mir erstmals keinen wirklichen Schrecken ein. Mir war meine Notgemeinschaft mit dem Blutigen Buch immer so vorgekommen, als würde ich mit einem bösen und gefährlichen Tier zusammenleben, das mich jederzeit anfallen und zerreißen konnte.
Aber nun brachte ich es gewissermaßen in die Wildnis zurück, um es freizulassen. Deshalb machte es mir keine Angst mehr. Ich holte einen Vollkornkeks aus meinem Gepäck und vertilgte ihn andächtig. Ich wollte fortan auf meine Ernährung achten und nur so viel zu mir nehmen, wie mein Körper wirklich benötigte. Der Vorfall mit dem Blätterteighörnchen saß mir noch tief in den Knochen.
Eine frische Brise ging durch den Birkenwald, ein vielstimmiges Gewisper von gefallenem Laub erhob sich, und mein Lagerfeuer loderte noch einmal hell auf. Der Wind blätterte fahrig in den Baumkronen über mir, wie ein Kind in einem dicken Buch ohne Bilder. Ich dachte an das raschelnde Lachen des Schattenkönigs und an seine in kindlicher Freude leuchtenden Augen, als er brennend in den Tod ging. Tatsächlich war seither kein Tag verstrichen, an dem ich nicht wenigstens einmal an ihn gedacht hatte, und beim Schreiben hatte mich nicht selten das Gefühl ergriffen, dass er meine Hand lenkte.
P S. Der Schattenkönig ist zurückgekehrt.
»Unmöglich«, dachte ich schläfrig. »Wie kann jemand zurückkehren, der niemals fort war?«
Dann schlief ich ein.
Mitten in der Nacht wachte ich auf. Das Feuer war fast erloschen, die Glut errichtete nur noch einen kleinen Dom aus schwachem Licht über meinem Schlafplatz. Ich horchte. Was hatte mich geweckt?
Da war wieder das Wispern der Blätter. Aber seltsam, es schien vollkommen windstill zu sein. Beunruhigt setzte ich mich auf. Nein, das war nicht das Geraschel des Laubes. Sondern eine Stimme! Eine flüsternde Stimme, die einem Lebewesen gehörte. Mit einem Schlag war ich wirklich wach.
Ich blinzelte in die Dunkelheit und versuchte, im spärlichen Licht etwas zu erkennen. Nur quälend langsam gewöhnten sich meine Augen an die schummrigen Verhältnisse. Ich erkannte schlanke Birkenstämme, dürres Astwerk dazwischen, die Schattenrisse der Blätter – und dann etwas, das mir einen eiskalten Schauer über den ganzen Leib jagte. Zwischen zwei Birken stand eine Gestalt.
Hexen stehen immer zwischen Birken, fiel mir ein.
Nein, das war kein Baum! Das war ein lebendiges, atmendes Wesen. Lang und dürr wiegte es sich kaum merklich hin und her, wie der erhobene Leib einer Riesenschlange. Es flüsterte leise und unverständlich.
Sollte ich mich bemerkbar machen? Mit lauter, selbstbewusster Stimme? Oder mich ganz still verhalten, um keine Aufmerksamkeit zu erregen? War das ein wildes Tier oder ein intelligentes Wesen? Ein Wanderer wie ich? Ein Laubwolf? Etwas ganz anderes? War es angriffslustig oder noch verängstigter als ich selbst? Bevor ich auch nur eine dieser Fragen gebührend überdenken konnte, verstand ich plötzlich Wort für Wort, was die dünne Stimme da flüsterte:
»Getürmt aus Buch auf Buch
Verlassen und verflucht
Gesäumt von toten Fenstern
Bewohnt nur von Gespenstern.«
Ich kannte diese Verse, ich kannte sogar den Ort, von dem sie sprachen, denn ich war leibhaftig dort gewesen. Mir schossen die Tränen in die Augen, und ich wollte aufspringen und davonlaufen. Aber es war mir unmöglich, auch nur den kleinsten Körperteil zu bewegen, die Furcht lähmte alle meine Glieder. Durch den Schleier meiner Tränen sah ich undeutlich, wie sich die Gestalt aus der Baumreihe löste und langsam und geräuschlos auf mich zuglitt, als benötige sie keine Beine, um sich fortzubewegen.
»Befallen von Getier
Aus Leder und Papier
Ein Ort aus Wahn und Schall
Genannt ... Schloss Schattenhall.«
Das Gewisper war nun dicht an meinem Ohr, und der schaurige Schatten hatte mein Gesichtsfeld so vollkommen eingenommen, dass ich nur noch Schwärze wahrnahm. In dieser furchtbaren Dunkelheit wehte mich ein Geruch an, der gleichzeitig vertraut und lange vergessen war. Es roch plötzlich nach alten Büchern ..., als würde man die Tür zu einem alten Antiquariat aufreißen, als würde sich ein Sturm aus purem Bücherstaub erheben und einem der Moder von Millionen verrottender Folianten mitten ins Gesicht wehen.
So hatten nur zwei Dinge in meinem bisherigen Leben gerochen. Es war das unverkennbare Parfüm der Stadt der TräumendenBücher, der ewige Duft Buchhaims. Und es war der furchterregende Atemhauch des Schattenkönigs.
P. S. Der Schattenkönig ist zurückgekehrt.
Ich schrie vielleicht nur deshalb nicht, weil es auch nichts geändert hätte. Eine nasse und klebrige Zunge berührte mein Gesicht, tastete über meine Nüstern und Lippen – und ich erwachte.
Es dämmerte bereits, das Feuer war erloschen. Ein schneeweißes Reh stand auf dürren Beinen über mir und schleckte Kekskrümel von meinem Gesicht. Als ich mich aufrichtete, schreckte es zurück, sah mich aus großen vorwurfsvollen Augen an und verschwand mit ein paar eleganten Zickzacksprüngen zwischen den Birken. Ächzend erhob ich mich von meinem Lager und schüttelte die Tautropfen aus dem Umhang. Solche Träume sind die verdiente Quittung, wenn man sich mit dem Kopf auf dem Blutigen Buch schlafen legt, oh meine geliebten Freunde!
2Schuppenhäutige Lindwürmer – die Sorte, zu der Hildegunst von Mythenmetz gehört – häuten sich mehrmals im Leben, bis zu siebenmal, wobei das neue Schuppenkleid jedes Mal eine andere Farbe besitzt. Es gibt einen eigenen Zweig der zamonischen Literaturwissenschaft (Dermatologische Lindwurm-Etymologie), welche die literarischen Arbeiten dieser Lindwurmfestebewohner nach den verschiedenen Hautfarben in entsprechende Perioden einteilt. Folgt man dieser – nicht unumstrittenen – Kategorisierung, so beginnt hier Mythenmetz’ Purpurne Periode (siehe Exegidior Flammstrudel »Die Purpurne Reise – Mythenmetz’ dritte Häutung und ihr Einfluss auf sein biographisches Werk«). A. d. Ü.
Die neue Stadt
Erst als ich kurz darauf aus dem Birkenhain ins Freie trat, bemerkte ich, dass er an einem Abhang lag, der in eine Ebene aus Grasland hinabführte. Die klare Luft bot eine ergreifend weite Aussicht über ein grünes Meer aus spitzen Halmen, die im Wind wogten, und über das graue Ödland, das sich dahinter bis zum Horizont erstreckte. Und ganz in der Ferne, gerade noch auf der Linie, die den Morgenhimmel und die Erde trennte, sah ich bereits jenen unnatürlichen vielfarbigen Fleck, der sich aus den Häusern von Buchhaim zusammensetzt.
Ich konnte sie riechen, diese Stadt. Natürlich, das war der Geruch, der mir diese Nacht den Alptraum beschert hatte! Der beständige Steppenwind trug ihn durch die Ebene über das Grasmeer hinauf in den Birkenwald. Ich hatte sogar die Worte geträumt, mit denen ich diesen unverwechselbaren Geruch damals in meinem Buch beschrieben hatte. Als würde sich ein Sturm aus purem Bücherstaub erheben und einem der Moder von Millionen verrottender Folianten mitten ins Gesicht wehen. Gab es etwas Verlockenderes?
Die Stadt schien nicht nur zum Riechen, sondern sogar zum Greifen nahe zu sein. Aber von meiner ersten Wanderung nach Buchhaim wusste ich, dass es tatsächlich mindestens noch einen Tagesmarsch dauern würde, um dorthin zu gelangen.
Ich trank das verbliebene Wasser aus meiner Flasche in einem einzigen langen Zug. Das mag unvernünftig klingen, sollte mich aber dazu motivieren, den ganzen Tag so zügig wie möglich auszuschreiten, denn bis zum Ziel würde es nichts mehr zu trinken geben. Ich war ein paar Jährchen älter geworden – wenn ich diese Entfernung in der gleichen Zeit überbrücken wollte wie damals, dann musste ich schon für Ansporn sorgen.
Wir wollen uns die langweilige Beschreibung dieses ereignislosen Marsches schenken, meine geliebten Freunde! Lasst mich nur sagen, dass ich am Ende des Tages genauso erschöpft, zerschlagen, fußkrank, hungrig und ausgedörrt wie damals an der Stadtgrenze von Buchhaim ankam. Aber die Aussicht, dort etwas zu trinken zu bekommen, hatte besonders in den letzten Stunden meinen Schritt beschleunigt, und so war es erst später Nachmittag, als ich mein Ziel erreichte.
Schon von weitem konnte ich bestaunen, wie die Stadt gewachsen war: Sie hatte an einigen Stellen zugenommen (wie ich) und war ein wenig in die Höhe geschossen. Stunden bevor ich ihren Saum erreicht hatte, konnte ich in der Ebene ein Summen vernehmen wie von einem monströsen Bienenstock, das mit jedem Schritt lauter wurde und zunehmend vielschichtiger. Ich unterschied nun zwischen dem Hämmern und Sägen aus den Schreinereien, den Glockenschlägen, dem Gewieher von Pferden und dem rastlosen Rattern der Druckmaschinen. Und unter allem vibrierte das unverwechselbare Grundgeräusch, der Kammerton jeder größeren Stadt, der sich aus tausenden von durcheinanderplappernden Stimmen speist und wie das anhaltende Raunen eines Publikums klingt. Oder wie das Murmeln eines trägen Stromes. Ich war angekommen.
Die Anzahl der Gebäude hatte sich mindestens verdoppelt, vielleicht sogar verdreifacht, und es war auch großzügiger in die Höhe gebaut worden. Hatte es früher kaum Häuser gegeben, die höher als ein, zwei Stockwerke waren, so sah ich jetzt schon von weitem welche mit drei, vier, fünf Etagen. Schlanke hohe Silos aus Eisenblech, baumlange Schornsteine, Türme aus Stein, so etwas hatte man im alten Buchhaim nicht geduldet. Das war nicht mehr die romantische Kleinstadt mit etwas zu viel Tourismus. Das war nicht mehr das nostalgische Antiquariatsdorf meiner Erinnerung, sondern ein ganz neuer Ort, mit anderen Bewohnern, Besuchern und Schicksalen, wie es schien. Ich kam an eine Kreuzung, an der sich mein Wanderweg mit anderen traf. Von dort ging es weiter auf vielen kleinen Sträßchen, auf denen hunderte von Leuten in die Stadt strömten. Mir wurde jetzt endgültig klar, dass dies keine sentimentale Reise in die Vergangenheit war, sondern der Schritt in einen unvorhersehbaren und ungeplanten Abschnitt meines Lebens – sofern ich es tatsächlich wagte, Buchhaim zu betreten. Ich hielt unwillkürlich an.
War das wieder ein Anfall von Invakanz? Es war Unfug, sich jetzt noch einzureden, ich könne umkehren. Unmöglich! Ich war hungrig, durstig und völlig erschöpft, also musste ich zumindest einmal in die Stadt hinein, um mich zu erfrischen und auszuruhen. Eine Übernachtung zumindest war unumgänglich. Aber wieso zögerte ich denn überhaupt? Ich war doch nicht so weit marschiert, um jetzt auf dem Absatz kehrtzumachen! Blödsinn! Was ließ mich zögern? War es der Instinkt? Die Erinnerung an all das, was mir widerfahren war, nachdem ich schon einmal die magische Grenze dieser Stadt überschritten hatte? Sicherlich. Aber es war wohl hauptsächlich die Furcht vor der Gewissheit, wie unwiederbringlich die Zeit vergangen war. Wer schon einmal ein Gebäude betreten hat, das er seit seiner Kindheit oder Jugend nicht mehr gesehen hat – ein altes Geburtshaus, eine Schule oder etwas Ähnliches –, der wird das verstehen. Es ist eine schmerzhafte, melancholisch stimmende Erfahrung, die einen dem eigenen Grab näherzubringen scheint. Aber bei solchen Gelegenheiten erscheinen die Dinge meist viel kleiner, als man sie in Erinnerung hat, nicht wahr? Buchhaim hingegen, meine geliebten Freunde, konnte meinen Erinnerungen nicht nur standhalten, es war sogar viel größer geworden.
»Rein oder raus?«, fragte da eine dünne und unangenehme Stimme. Ich schreckte aus meinen Gedanken, sah mich verdattert um und bemerkte, dass ich einen der vielen Zugänge zur Stadt, eine schmale Gasse, verstopfte. Die Leute drängelten an mir vorbei, alle emsig damit beschäftigt, in die Stadt hineinzugelangen. Die Stimme gehörte einem aufdringlichen und unsympathisch aussehenden Zwerg hinter mir, der einen Bauchladen voller winziger Zwergenbücher trug und dem ich offensichtlich im Weg stand.
»Äh ...!«, sagte ich verdattert, ohne mich zu rühren.
»Nun mach mal hin, Dickwanst!«, keifte der ungehobelte Gnom. »Ja, das ist hier nicht das Provinzkaff, aus dem du stammst. Das ist Buchhaim! Hier ist Zeit Geld, und Geld regiert die Bücherwelt! Beweg deinen fetten ...«
Während er das sagte, geschahen Dinge, die wohl eher reflexbedingt als wohlüberlegt waren: Der Gnom drängelte sich rüpelhaft an mir vorbei und schickte sich an, die Stadt vor mir zu erstürmen, um sich mit seinem lächerlichen Bauchladen in Geschäfte zu stürzen, die keinen Aufschub duldeten. In meinem Gehirn war aber in Sekundenbruchteilen das Wort Dickwanst angekommen, analysiert und ein Reaktionskonzept ausgearbeitet worden, das mich dem respektlosen Kleinling unwillkürlich ein Bein stellen ließ. Der wusste natürlich nicht, dass mich niemand so nennt, ohne dafür umgehend die Quittung zu erhalten. Da bin ich völlig humorlos.
Als der Zwerg bei dem Wort fetten angekommen war, befand er sich bereits in freiem Fall. Er schlug der Länge – oder sollte ich besser sagen: Kürze – nach hin, und der putzige Inhalt seines Bauchladens, lauter Bücher, die nicht größer waren als Streichholzschachteln, ergoss sich in den Staub der Gasse.
Ich aber sagte von oben herab: »Rein oder raus? Was für eine Frage! Hinein natürlich.« Und stieg über den gedemütigten Zwerg hinweg, indem ich einfach auf ihn trat und ihn mein gesamtes Kampfgewicht spüren ließ. Ja, meine geliebten Freunde: Wenn es sein muss, trete ich auch Zwerge! Ich stolzierte in die Gasse hinein, ohne mich noch einmal umzublicken. Und bedachte nicht weiter, dass ich mir bereits mit diesem ersten Schritt über die Stadtgrenze meinen ersten unerbittlichen Feind in Buchhaim gemacht hatte.
Notizloses Notieren
Der Schwarze Mann von Buchhaim hatte nur halbe Arbeit geleistet, die aber gründlich. Das war mein etwas widersprüchliches Urteil über die Stadt, das ich bereits nach der Besichtigung der ersten Straßenzüge, welche man die Grenzgassen nennt, abgeben konnte. Jene legendäre Gestalt aus den Volksliedern und Kindermärchen, der wandelnde Riese aus flammendem Stroh und Pech, dem die Abergläubigen unter den Bewohnern die Schuld am letzten Brand immer noch gerne in die Schuhe schoben, war angeblich von Viertel zu Viertel gestapft und hatte Dach um Dach entzündet, um schließlich selber im Inferno zu verbrennen. So würde ich vielleicht selber auch einem Kind im Vorschulalter diese Katastrophe erklären, denn die Wahrheit war erheblich beängstigender als dieses grausige Märchen.
Es war nicht so, dass ich gar nichts wiedererkannte, immerhin über ein Drittel der Stadt war von den Flammen verschont worden, und selbst von den extrem feuergefährdeten uralten Häusern mit ihren strohtrockenen Reetdächern und Fachwerken hatten etliche überlebt. Der Schwarze Mann hatte weder Hirn noch Herz gehabt, wie die Legende berichtet, und dementsprechend wahllos sein Werk verrichtet: Hier eine halbe Straße niedergebrannt, dort ein ganzes Viertel verschont. Im Süden bis zur Stadtgrenze getobt, den Norden kaum angetastet. Da eine riesige Stadtbibliothek abgefackelt und direkt daneben ein winziges Winkelantiquariat stehengelassen. Wie Lavaströme Berghänge verwüsten, wie Hautkrankheiten sich sinnlos ausbreiten, so zufällig und blindwütig hatte der Schwarze Mann getobt und Angst und Schrecken gebracht, wie es im Gedicht von Perla La Gadeon hieß: Ohne Ansehen von Rang oder Wert, von Schönheit oder Zweck, einfach alles mit sich in den Flammentod gerissen, was das Unglück hatte, in seinem Weg zu stehen.
Dies konnte nur jemand nachvollziehen, der wie ich auch das alte Buchhaim gekannt hatte. Für jeden Neuling war es einfach eine aufregende Stadt voller architektonischer Widersprüche, ein kurioses Konglomerat von alten und neuen Baustilen, in dem sich frühzamonische Besiedelung, finsteres Mittelalter und moderne Einflüsse aller Art auf eine Weise mischten, wie es nirgendwo sonst derart dicht beieinander zu sehen war. Ganz abgesehen von seinen literarischen und antiquarischen Attraktionen kam Buchhaim meinem persönlichen Ideal von einer Stadt noch näher als je zuvor: Barocke Vielfalt, bis an die Grenzen der Verrücktheit verspielter Gestaltungswille, ausufernde Ornamentik, schiefe Winkel und allgegenwärtige Historie – das waren die Dinge, die mein Auge bei der Besichtigung einer Stadt entzücken konnten, und das alles war hier in einem Übermaß vorhanden. Nirgendwo sonst drängten sich Zamoniens Geschichte und seine Moderne auf so engem Raum zusammen.
Schon in den Grenzgassen, welche die ganze Stadt umgürteln, sah ich Häuser aus verschiedensten Mineralien, Metallen und anderen Baustoffen, aus roten, gelben und schwarzen Ziegeln, aus Marmorbruch, aus Bachkieseln, aus rostigem Eisen, aus Blech und glänzendem Messing, aus Sand- oder Speckstein, aus Basalt, Granit und Lavabrocken, aus Muscheln, Schiefer oder versteinerten Pilzen, selbst aus durchsichtigen Glas- und Bernsteinziegeln, aus einfachem Lehm oder geschichteten Porzellanscherben. Jedes erdenkliche Material war verarbeitet – Holz aber war ausgesprochen selten geworden. Holz als Baustoff sah ich nach wie vor an den alten Häusern, es war aber aus der modernen Buchhaimer Architektur beinahe verbannt – eine der ängstlichen Konsequenzen aus dem Flammeninferno. Aber gerade deswegen war es für mich umso erstaunlicher, wie viele der Häuser jetzt aus Büchern bestanden. Ich sah Bücher als Mauer- und Dachziegel, zu stützenden Säulen gestapelt und zu Treppen verarbeitet, für Fensterbänke vermauert und sogar als Pflastersteine eingesetzt. Bücher als Baumaterial waren allgegenwärtig im neuen Buchhaim, obwohl sie doch mindestens genauso brennbar sein mussten wie Holz. Und wie verhielt sich ein aus uralten Schwarten gebautes Haus bei Regen? Quoll das Papier dann nicht auf? Zerfielen die Pappumschläge nicht irgendwann? Oder waren diese Bücher imprägniert? Durch irgendein Verfahren gehärtet, feuerfest und wasserdicht gemacht? Nun, um dies genauer zu untersuchen, dafür fehlten mir jetzt Muße und Zeit. Der Tag war nicht mehr lang. Ich verschob die Lösung des Rätsels auf später und eilte ruhelos weiter.
Ich wollte alles auf einmal sehen, als könnte die Stadt gleich im nächsten Augenblick wieder in Flammen und Rauch aufgehen oder im Boden versinken. Gehen, Stehen, Sehen – das war immer schon mein bewährtes Motto auf Reisen, in Buchhaim galt das in höchstem Maß. Wo ich ging oder stand, gab es etwas zu bestaunen, im Großen wie im Kleinen.
Ich will euch nun ein Geheimnis anvertrauen, oh meine geliebten Brüder und Schwestern, euch eine schriftstellerische Technik offenbaren, die ich Notizloses Notieren nenne. Man könnte sie auch als Mythenmetzsche Mentalmalerei bezeichnen, wenn man es lieber etwas akademischer hat. Sie funktioniert so: Wenn ich auf Reisen in Situationen gerate, in denen mich die Ereignisse oder das Gesehene zu überwältigen drohen und der normale Dichter automatisch den Notizblock zücken würde, um möglichst viel davon schriftlich festzuhalten – immer dann enthalte ich mich ganz bewusst jeglicher Notiz oder Skizze. Dies zwingt mein Erinnerungsvermögen zu der verblüffenden Leistung, dass mein Gehirnein Mentalgemälde nach dem anderen malt. Ich habe diese Fähigkeit schon vor geraumer Zeit entdeckt, und zwar als ich daranging, mein Buch Die Stadt der Träumenden Bücher niederzuschreiben. Damals hatte ich keinerlei Notizen zur Verfügung, weil mich die Ereignisse in Buchhaim und in den Katakomben derart überrollt hatten, dass ich überhaupt keine Gelegenheit besessen hatte, irgendwelche Aufzeichnungen zu machen. Als ich aber mit dem Schreiben begann, tauchten vor meinem inneren Auge die lebendigsten und detailgenauesten Bilder und Szenen auf, als würde ich alles noch einmal durchleben.
Wer jemals ein gemaltes Panorama gesehen hat – also die Ansicht einer berühmten Stadt oder populären Landschaft, die von begabten Künstlern so akkurat wie möglich wiedergegeben wurde –, der ahnt schon, wovon ich rede. Es gibt einen Sektor in meinem Hirn, den man sich wie ein sehr kleines Museum vorstellen sollte, in dem die Gemälde der Mythenmetzschen Mentalmalerei ausgestellt werden. Es sind Ausschnitte von Landschaften und Stadtansichten von einer solchen Genauigkeit und Wirklichkeitstreue, dass sie den Meisterwerken des Florinthischen Kanalismus3 in nichts nachstehen. Ja, diese sogar durch einen entscheidenden Umstand übertreffen: nämlich, dass die beweglichen Dinge darauf nicht stillstehen wie auf einem gemalten Bild, sondern alles genauso in Bewegung ist wie in den Momenten, als sich diese Szenen in meine Netzhaut gebrannt haben. Ich sehe Passanten vorbeispazieren, Licht auf dem Wasser tanzen, Wind in den Blättern der Bäume wühlen, Rauch aufsteigen, Fahnen flattern ... Wie ist das möglich? Ich weiß es nicht, oh meine geliebten Freunde, es bleibt mir nur, es als eine Randerscheinung des Orms zu begreifen. Es ist eine Gabe, die mir manchmal selber etwas unheimlich ist. Denn gelegentlich, wenn ich mit meinem inneren Auge die Bildnisse der Mythenmetzschen Mentalmalerei betrachte, dann ist mir, als betrachtete ich nur die Oberfläche meiner Begabung, unter der vielleicht noch viel mehr, ja sogar ein dunkles Geheimnis lungern könnte. Als blickte ich in einen Zauberspiegel, der mir ein perfektes Abbild meiner Welt gibt – um darüber hinwegzutäuschen, dass sich hinter diesem Bild eine eigene geheimnisvolle Welt verbirgt.
Nun aber will ich euch in dieses imaginäre Museum geleiten, meine geliebten Freunde, zu einer exklusiven Führung durch einige der Mentalgemälde von Buchhaim, die mein fiebriges Hirn auf meinem ersten Erkundungsgang hervorbrachte. Denn zum Notieren kam ich dabei beim besten Willen nicht.
Das erste Kuriosum, das mir am neuen Buchhaim auffiel, waren die Riesenbücher. Diese monströsen Nachbildungen von antiquarischen Büchern wurden schon vor hundert Jahren an allen Zugängen aufgestellt – eine der luxuriösen Gestaltungsideen, die sich die Stadt aufgrund ihres neuen Reichtums leisten konnte, wie ich später erfuhr. Diese Buchkolosse aus Stein oder Metall, von unterschiedlichen Künstlern gestaltet und bemalt, lehnten an Hauswänden oder lagen auf dem Trottoir, um dem Besucher gleich den Eindruck zu vermitteln, dass er eine Stadt betrat, in der das gedruckte Wort und das gebundene Papier eine ganz besondere Geltung hatten.
Man mag das für protzig und prätentiös halten – mir jedenfalls hat es auf Anhieb gut gefallen, weil diese Bücher sehr schön gemacht waren und einen märchenhaften Eindruck vermittelten. Sie sahen aus wie das vergessene Eigentum eines belesenen und zerstreuten Riesen und erregten besonders die Aufmerksamkeit von Kindern. Durch sie betrat man den Ort wie ein Zauberreich, in dem andere Größenverhältnisse, ja vielleicht sogar andere Naturgesetze herrschten und Dinge möglich waren, von denen man sonst nur träumen konnte. Was konnte an einer Stadt verkehrt sein, die dem Buch eine solche Bedeutung zumaß?
Die Grenzgassen waren der erste Ring der Stadt, ein dünnes Geflecht aus schmalen Gässchen, die Buchhaim umgaben wie eine durchlässige Stadtmauer. Hier bekam man einen ersten Eindruck von der Vielfältigkeit der Architektur, aber sonst gab es hier nichts von Bedeutung, weil diese Häuser vorwiegend von Verwaltungskräften und Beamten der Stadt bewohnt waren, die hier auch ihre Büros und Amtsstuben hatten. Man fand dort weder Gaststätten noch Antiquariate – in die Grenzgassen ging man nur, wenn man einen neuen Stempel, eine Schankgenehmigung oder einen Notar benötigte.
Wenn man die Stadt mit einem Buch vergleichen würde, wären die Grenzgassen der Schutzumschlag, und die Äußere Ringstraße