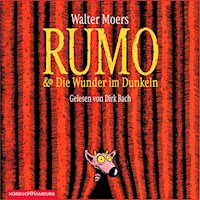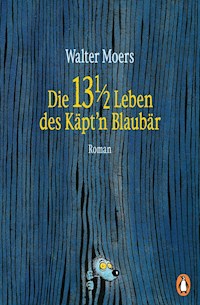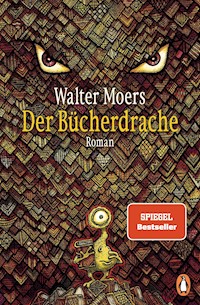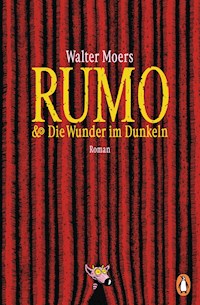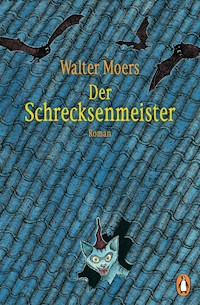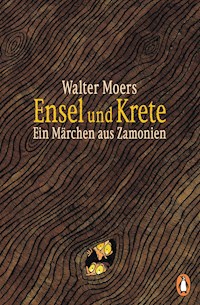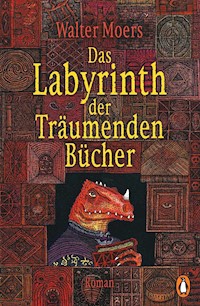14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nichts ist gefählicher als das Zauberreich der Literatur
Das geniale Manuskript eines unbekannten Autors treibt den jungen Dichter Hildegunst von Mythenmetz nach Buchhaim. Wenn er dem Geheimnis des Verfassers irgendwo auf die Spur kommen kann, dann in den labyrinthischen Katakomben dieser buchverrückten Stadt. Der Geruch von Druckerschwärze durchzieht die Straßen, Bibliothek reiht sich an Bibliothek. Und in den Katakomben stürzen sich belesene Buchlinge und Bücherjäger auf alles, was Buchstaben hat. Als Mythenmetz nach unzähligen Abenteuern den Schattenkönig von Buchhain trifft, scheint er am Ziel ... Mit fantastischem Ideenreichtum und grandiosen Illustrationen gelingt Walter Moers die »schönste und größte Liebeserklärung an das Lesen und die Literatur« (Die Welt).
Als der Pate des jungen Dichters Hildegunst von Mythenmetz stirbt, hinterlässt er seinem Schützling nur wenig mehr als ein Manuskript. Dieses aber ist so makellos, dass Mythenmetz sich gezwungen sieht, dem Geheimnis seiner Herkunft nachzugehen. Die Spur führt nach Buchhaim, der Stadt der Träumenden Bücher. Als der Held sie betritt, ist es, als würde er die Tür zu einer gigantischen Buchhandlung aufreißen. Er riecht den Anflug von Säure, der an den Duft von Zitronenbäumen erinnert, das anregende Aroma von altem Leder und das scharfe, intelligente Parfüm von Druckerschwärze. Einmal in den Klauen dieser buchverrückten Stadt, wird Mythenmetz immer tiefer hineingesogen in ihre labyrinthische Welt, in der Lesen noch eine wirkliche Gefahr ist, in der rücksichtslose Bücherjäger nach bibliophilen Schätzen gieren, Buchlinge ihren Schabernack treiben und der mysteriöse Schattenkönig herrscht.
Dies ist ein Roman, der im legendären Bücherreich Zamonien spielt.
Folgende weitere Zamonienromane sind bislang erschienen:
Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär
Ensel und Krete
Rumo & Die Wunder im Dunkeln
Der Schrecksenmeister
Das Labyrinth der Träumenden Bücher
Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr
Weihnachten auf der Lindwurmfeste
Der Bücherdrache
Die Insel der Tausend Leuchttürme
Außerdem: Das Einhörnchen, das rückwärts leben wollte: Zwanzig zamonische Flabeln
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 706
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
»Die Stadt der Träumenden Bücher« erschien erstmals 2004 beim Piper Verlag GmbH, München.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2017 beim Albrecht Knaus Verlag, 2019 beim Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Lektorat: Rainer Wieland Cover: bürosüd Colorierung Umschlag: Florian Biege Gesamtgestaltung und Satz: Oliver Schmitt, Mainz Illustrationen: Walter Moers
ISBN 978-3-641-26001-9V004
www.penguin-verlag.de
www.zamonien.de
Hildegunst von Mythenmetz
Erster Teil
Danzelots Vermächtnis
Eine Warnung
Hier fängt die Geschichte an. Sie erzählt, wie ich in den Besitz des BlutigenBuches kam und das Orm erwarb. Es ist keine Geschichte für Leute mit dünner Haut und schwachen Nerven – welchen ich auch gleich empfehlen möchte, dieses Buch wieder zurück auf den Stapel zu legen und sich in die Kinderbuch-Abteilung zu verkrümeln. Husch, husch, verschwindet, ihr Kamillenteetrinker und Heulsusen, ihr Waschlappen und Schmiegehäschen, hier handelt es sich um eine Geschichte über einen Ort, an dem das Lesen noch ein echtes Abenteuer ist! Und Abenteuer definiere ich ganz altmodisch nach dem Zamonischen Wörterbuch:»Eine waghalsige Unternehmung aus Gründen des Forschungsdrangs oder des Übermuts; mit lebensbedrohlichen Aspekten, unberechenbaren Gefahren und manchmal fatalem Ausgang.«
Ja, ich rede von einem Ort, wo einen das Lesen in den Wahnsinn treiben kann. Wo Bücher verletzen, vergiften, ja, sogar töten können. Nur wer wirklich bereit ist, für die Lektüre dieses Buches derartige Risiken in Kauf zu nehmen, wer bereit ist, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um an meiner Geschichte teilzuhaben, der sollte mir zum nächsten Absatz folgen. Allen anderen gratuliere ich zu ihrer feigen, aber gesunden Entscheidung, zurückzubleiben. Macht’s gut, ihr Memmen! Ich wünsche euch ein langes und sterbenslangweiliges Dasein und winke euch mit diesem Satz Adieu!
So. Nachdem ich meine Leserschaft gleich zu Beginn wahrscheinlich auf ein winziges Fähnlein von Tollkühnen reduziert habe, möchte ich die Übriggebliebenen herzlich willkommen heißen – seid gegrüßt, meine waghalsigen Freunde, ihr seid aus dem Holz, aus dem man Abenteurer schnitzt! Dann wollen wir auch keine Zeit mehr verlieren und unverzüglich mit der Wanderung beginnen. Denn eine Reise ist es, auf die wir uns begeben, eine antiquarische Reise nach Buchhaim, der Stadt der Träumenden Bücher. Schnürt eure Schuhe fest, es geht ein langes Stück des Weges auf felsigem, unebenem Grund, dann durch eintöniges Grasland, in dem die Halme dicht, hüfthoch und messerscharf stehen. Und schließlich auf düsteren, labyrinthischen und gefährlichen Pfaden tief hinab, hinab in die Eingeweide der Erde. Ich kann nicht vorhersehen, wie viele von uns zurückkehren werden. Ich kann euch nur empfehlen, den Mut nie sinken zu lassen – was immer auch uns widerfährt.
Und sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt!
Nach Buchhaim
Ist man im westlichen Zamonien auf der Hochebene von Dull in östlicher Richtung unterwegs, und sind die wogenden Grasmeere endlich durchschritten, erweitert sich plötzlich der Horizont auf dramatische Weise, und man kann endlos weit blicken, über eine flache Landschaft, die in der Ferne in die Süße Wüste übergeht. Im spärlich begrünten Ödland kann der Wanderer bei gutem Wetter und dünner Luft einen Fleck erkennen, der schnell immer größer wird, wenn er zügig daraufzumarschiert. Der dann kantige Formen annimmt, spitze Dächer bekommt und sich schließlich als jene legendenumrankte Stadt entpuppt, die den Namen Buchhaim trägt.
Schon von weitem kann man sie riechen. Sie riecht nach alten Büchern. Es ist, als würde man die Tür zu einem gigantischen Antiquariat aufreißen, als würde sich ein Sturm aus purem Bücherstaub erheben und einem der Moder von Millionen verrottender Folianten direkt ins Gesicht wehen. Es gibt Leute, die diesen Geruch nicht mögen, die auf dem Absatz kehrtmachen, wenn er ihnen in die Nase steigt. Zugegeben, es ist kein angenehmer Geruch, er ist hoffnungslos unmodern, er hat mit Zerfall und Auflösung zu tun, mit Vergänglichkeit und Schimmelpilzen – aber da ist auch noch etwas anderes. Ein leichter Anflug von Säure, der an den Duft von Zitronenbäumen erinnert. Das anregende Aroma von altem Leder. Das scharfe, intelligente Parfüm der Druckerschwärze. Und schließlich, über allem, der beruhigende Geruch von Holz.
Ich rede nicht von lebendem Holz, von harzigen Wäldern und frischen Fichtennadeln, ich rede von totem, entrindetem, gebleichtem, gemahlenem, gewässertem, geleimtem, gewalztem und beschnittenem Holz – kurz: von Papier. Oh ja, meine wißbegierigen Freunde, ihr riecht ihn jetzt auch, diesen Duft, der euch an vergessenes Wissen und uralte handwerkliche Traditionen erinnert. Und nun könnt ihr den Wunsch, so bald wie möglich ein antiquarisches Buch aufzuschlagen, kaum noch unterdrücken, nicht wahr? Also beschleunigen wir unseren Marsch! Mit jedem Schritt auf Buchhaim zu wird der Geruch intensiver und verlockender. Immer deutlicher können wir die spitzgiebeligen Häuser ausmachen, Hunderte, Tausende von schlanken Kaminschloten ragen aus den Dächern empor, verdunkeln mit ihrem fetten Qualm den Himmel und fügen dem Geruch der Bücher noch andere Aromen hinzu: von frischgebrühtem Kaffee, von gebackenem Brot, kräutergespicktem Fleisch, das über Holzkohle brutzelt. Unser Tempo verdoppelt sich ein weiteres Mal, und zu dem brennenden Wunsch, ein Buch aufzuschlagen, gesellt sich der nach einer heißen Tasse Zimtkakao und einem Stück ofenwarmem Sandkuchen. Schneller! Schneller!
Schließlich erreichen wir die Stadtgrenze, müde, hungrig, durstig, neugierig – und ein bißchen enttäuscht. Es gibt keine eindrucksvolle Wehrmauer, kein bewachtes Tor – etwa in Form eines riesigen Buchdeckels, der sich auf unser Klopfen knarzend öffnet – nein, es gibt nur ein paar enge Straßen, auf denen eilige Zamonier verschiedenster Daseinsformen die Stadt betreten oder verlassen. Und die meisten tun es mit einem Stapel Bücher unter dem Arm, manche ziehen ganze Karren davon hinter sich her. Ein Stadtbild wie jedes andere, wenn nicht all diese Bücher wären.
Da sind wir also, meine wagemutigen Weggefährten, an der magischen Grenze von Buchhaim – hier ist es, wo die Stadt recht unspektakulär beginnt. Sogleich werden wir ihre unsichtbare Schwelle überschreiten, sie betreten und ihre Mysterien erforschen.
Sogleich.
Doch zuvor möchte ich kurz innehalten und berichten, aus welchen Gründen ich mich überhaupt auf den Weg hierher begeben habe. Jede Reise hat ihren Anlaß, und meiner hat mit Überdruß und jugendlichem Leichtsinn zu tun, mit dem Wunsch, aus den gewohnten Verhältnissen auszubrechen und das Leben und die Welt kennenzulernen. Außerdem wollte ich ein Versprechen einlösen, das ich einem Sterbenden gegeben hatte, und nicht zuletzt war ich einem faszinierenden Geheimnis auf der Spur. Aber der Reihe nach, meine Freunde!
Auf der Lindwurmfeste
Wenn ein junger Lindwurmfestebewohner1 ins lesereife Alter eintritt, bekommt er von seinen Eltern einen sogenannten Dichtpaten zugeordnet. Das ist meist eine Person aus der Verwandtschaft oder dem engeren Freundeskreis, welche von diesem Augenblick an für die schriftstellerische Erziehung des jungen Dinosauriers verantwortlich ist. Der Dichtpate bringt dem Zögling Lesen und Schreiben bei, führt ihn an die zamonische Dichtkunst heran, gibt Lektüreempfehlungen und lehrt ihn das Schriftstellerhandwerk. Er hört ihm Gedichte ab und bereichert seinen Wortschatz – und so weiter und so fort, lauter Maßnahmen also, die für die künstlerische Entwicklung seines Patenkindes nützlich sind.
Mein Dichtpate war Danzelot von Silbendrechsler. Er war bei der Annahme der Patenschaft schon über achthundert Jahre alt, Lindwurmfeste-Urgestein, ein Onkel aus der Familie meiner Mutter. Onkel Danzelot war ein solider Verseschmied ohne höhere Ambitionen, er dichtete auf Bestellung, vorwiegend Elogen für festliche Zwecke, außerdem galt er als begnadeter Tisch- und Grabredentexter. Eigentlich war er mehr ein Leser als ein Schriftsteller, mehr Genießer von Literatur als Urheber. Er saß in unzähligen Preisgremien, organisierte Dichtwettbewerbe, war freischaffender Lektor und Geisterautor. Selbst hatte er nur ein einziges Buch verfaßt – Vom Gartengenuß –, in dem er in eindrücklicher Sprache die Fettwucherung des Blumenkohls und die philosophischen Implikationen der Kompostierung thematisierte. Danzelot liebte seinen Garten fast so sehr wie die Literatur und wurde nicht müde, mir die Parallelen zwischen gezähmter Natur und Dichtkunst aufzuzeigen. Ein selbstgepflanzter Erdbeerstrauch war für ihn gleichrangig mit einem selbstverfaßten Gedicht, die abgezählten Spargelreihen verglich er mit Reimschemata, ein Komposthaufen kam einem philosophischen Essay gleich. Ihr müßt mir erlauben, meine geduldigen Freunde, kurz aus seinem längst vergriffenen Werk zu zitieren – Danzelots Schilderung eines simplen Blauen Blumenkohls vermittelt einen wesentlich lebhafteren Eindruck von ihm selbst, als ich es mit tausend Worten vermag:
Nicht wenig verblüfft die Dressur des Blauen Blumenkohls. Da muß zur Abwechslung der Blütenstand herhalten und nicht der Blattwuchs. Der Blütendolde anerzieht der Gärtner die temporäre Fettsucht. Ihre zahllosen, zu einem kompakten Schirm zusammengedrängten Blütenknöspchen verfetten mitsamt ihren Stielen zu einer unförmlichen Masse von bläulichem Pflanzenspeck. Der Blumenkohl ist also eine vor dem aufblühen in ihrem eigenen fett verunglückte Blume, oder genauer gesagt: eine verunglückte Vielheit von Blumen, eine verkommene Rispendolde. Wie in aller Welt kann nun dieses Mastgeschöpf mit seinen zu Speck verquollenen Eierstöcken sich weiterpflanzen? Auch es kehrt nach einem Abstecher in die Unnatur wieder zur Natur zurück. Der Gärtner freilich läßt ihm keine Zeit dazu, er erntet den Kohl auf dem Gipfel seiner Verirrung, nämlich im höchsten und schmackhaftesten Stadium seiner Verfettung – dann, wenn der Pflanzendickwanst im Geschmack einer Frikadelle gleichkommt. Der Samenzüchter dagegen läßt die blaue Masse unbehelligt in ihrem Gartenwinkel sich zu ihrem besseren Selbst bekehren. Kommt er in drei Wochen nach ihr zu sehen, so findet er statt drei Pfund Pflanzenspeck einen von Bienen, Irrlichtern und Knusperkäfern umsummten, sehr lockeren Blütenbusch. Die vordem unnatürlich verdickten zartblauen Stielchen haben ihre Dicke in Länge umgesetzt, als fleischige Blütenstengel tragen sie nun an ihren »Enden eine Anzahl dünn verteilter gelber Blüten. Die wenigen unverwüstlichen unter den Knospen färben sich blau, schwellen an, blühen auf und setzen Samen an. Diese kleine tapfere Schar der Aufrechten und Naturgetreuen rettet die Blumenkohlzunft.
Ja, das ist Danzelot von Silbendrechsler, wie er leibte und lebte. Naturverbunden, sprachverliebt, immer präzise in der Beobachtung, optimistisch, ein bißchen verschroben und so langweilig wie möglich, wenn es um den Gegenstand seiner literarischen Arbeit ging: um Blumenkohl.
Ich habe nur gute Erinnerungen an ihn, bis auf die drei Monate, nachdem ihn – während einer der zahlreichen Belagerungen der Lindwurmfeste – ein steinernes Geschoß aus einer Wurfschleuder am Kopf traf und er danach der Überzeugung war, er sei ein Schrank voll ungeputzter Brillen. Damals befürchtete ich, er würde nie mehr aus dieser Wahnwelt zurückkehren, aber er erholte sich dann doch wieder von dem schweren Schlag aufs Haupt. Eine vergleichbar wundersame Genesung fand bei Danzelots letzter Grippe leider nicht statt.
Danzelots Tod
Als Danzelot mit achthundertachtundachtzig Jahren sein langes, erfülltes Dinosaurierleben aushauchte, zählte ich gerade erst siebenundsiebzig Lenze und hatte die Lindwurmfeste noch kein einziges Mal verlassen. Er starb in Folge eines eigentlich harmlosen grippalen Infektes, der sein geschwächtes Immunsystem überfordert hatte (ein Ereignis, das meine grundsätzlichen Zweifel an der Zuverlässigkeit von Immunsystemen noch vertiefte).
So saß ich an diesem unglückseligen Tag an seinem Sterbebett und notierte den folgenden Dialog, denn mein Dichtpate hatte mich dazu aufgefordert, seine letzten Worte zu protokollieren. Nicht, weil er so eitel gewesen wäre, seine Sterbeseufzer der Nachwelt erhalten zu wollen, sondern weil er glaubte, daß dies für mich eine einmalige Chance war, auf diesem speziellen Gebiet an authentisches Material zu gelangen. Er starb also in Ausführung seiner Pflicht als Dichtpate.
Danzelot: »Ich sterbe, mein Sohn.«
Ich(mit den Tränen ringend, sprachlos): »Huh …«
Danzelot: »Ich bin weit davon entfernt, das aus fatalistischen Motiven oder philosophischer Altersmilde gutzuheißen, aber ich muß mich wohl damit abfinden. Jeder kriegt nur das eine Faß, und meins ist ziemlich voll gewesen.«
(Im nachhinein freue ich mich, daß er das Bild des vollen Fasses benutzte, denn es deutet darauf hin, daß er sein Leben als reichhaltig und erfüllt ansah. Man hat viel erreicht, wenn einen sein Leben an ein volles Faß erinnert und nicht an einen leeren Eimer.)
Danzelot: »Hör zu, mein Junge: Ich habe dir nicht viel zu vermachen, jedenfalls nicht in pekuniärer Hinsicht. Das weißt du. Ich bin keiner von diesen stinkreichen Lindwurmfesteschriftstellern geworden, die ihre Honorare in Säcken im Keller stapeln. Ich werde dir meinen Garten vererben, aber ich weiß, daß du dir nicht viel aus Gemüse machst.«
(Das war richtig. Ich als junger Lindwurm konnte mit den Blumenkohlverherrlichungen und den Hymnen an den Rhabarber in Danzelots Gartenbuch herzlich wenig anfangen, und ich machte auch keinen Hehl daraus. Erst in späteren Jahren keimte Danzelots Saat, ich legte mir sogar selber einen Garten an, züchtete Blauen Blumenkohl und holte mir manche Inspiration aus der gezähmten Natur.)
Danzelot: »Ich bin also ziemlich klamm zur Zeit …«
(Der bedrückenden Situation zum Trotz konnte ich mir ein Prusten nicht verkneifen, denn die Benutzung des Wortes »klamm« in seinem Zustand hatte etwas unfreiwillig Komisches, ein Fehlgriff in die Schublade des schwarzen Humors – den Danzelot mir in einem Manuskript wohl rot angestrichen hätte. Aber mein Prusten ins Taschentuch konnte auch als tränenersticktes Schneuzen durchgehen.)
Danzelot: »… und kann dir daher in materieller Hinsicht nichts vermachen.«
(Ich winkte ab und schluchzte, diesmal vor Rührung. Er starb gerade und machte sich gleichzeitig Sorgen um meine Zukunft. Das war ergreifend.)
Danzelot: »Aber ich besitze da etwas, das wesentlich wertvoller ist als alle Schätze von Zamonien. Zumindest für einen Schriftsteller.«
(Ich sah ihn mit tränengefüllten Augen an.)
Danzelot: »Ja, man könnte sagen, daß es wahrscheinlich neben dem Orm das Wertvollste ist, in dessen Besitz ein Schriftsteller in seinem Leben kommen kann.«
(Er machte es ziemlich spannend. An seiner Stelle hätte ich mich bemüht, die nötigen Informationen in gebotener Kürze loszuwerden. Ich beugte mich vor.)
Danzelot: »Ich bin im Besitz des großartigsten Textes der gesamten zamonischen Literatur.«
(Ach herrje, dachte ich. Entweder er fängt an zu delirieren, oder er will mir seine verstaubte Bibliothek vermachen und redet von seiner Erstausgabe des Ritter Hempel, jener uralten Schwarte von Gryphius von Odenhobler, den er als Schriftsteller so vorbildlich und ich so unlesbar fand.)
Ich: »Was meinst du damit?«
Danzelot: »Vor einiger Zeit sandte mir ein junger zamonischer Dichter von außerhalb der Lindwurmfeste ein Manuskript. Mit dem üblichen verschämten Blabla, daß dies nur ein bescheidener Versuch, ein zaghafter Schritt ins Ungewisse sei und so weiter, und ob ich nicht mal sagen könnte, was ich davon hielt – und vielen Dank im voraus!
Nun, ich habe es mir zur Pflicht gemacht, all diese unverlangt eingesandten Manuskripte auch zu lesen, und ich darf mit Fug und Recht behaupten, daß mich diese Lektüre einen nicht unerheblichen Teil meines Lebens und einige Nerven gekostet hat.«
(Danzelot hustete ungesund.)
Danzelot: »Aber die Geschichte war nicht lang, nur ein paar Seiten, ich saß gerade am Frühstückstisch, hatte mir eine Tasse Kaffee eingeschenkt und die Zeitung schon ausgelesen, also nahm ich mir den Text gleich vor – jeden Tag eine gute Tat, du weißt schon, warum nicht gleich zum Frühstück, dann hatte ich es hinter mir. Ich war durch langjährige Erfahrung auf das übliche Gestammel eines mit Stil, Grammatik, Liebeskummer und Weltekel ringenden Jungschriftstellers vorbereitet, also seufzte ich und begann mit der Lektüre.«
(Danzelot seufzte herzzerreißend, und ich wußte nicht, ob es eine Imitation seines damaligen Seufzers war oder mit seinem baldigen Dahinscheiden zusammenhing.)
Danzelot: »Als ich ungefähr drei Stunden später wieder zur Tasse griff, war sie immer noch randvoll und der Kaffee eiskalt. Ich hatte für das Lesen der Geschichte aber keine drei Stunden gebraucht, sondern nicht mal fünf Minuten – ich muß die restliche Zeit regungslos dagesessen haben, den Brief in der Hand, in einer Art Schockzustand. Sein Inhalt hatte mich mit einer Wucht getroffen, zu der sonst nur das Geschoß einer Steinschleuder in der Lage gewesen wäre.«
(Unangenehme Erinnerungen an die Zeit, in der sich Danzelot für einen Schrank voll ungeputzter Brillen gehalten hatte, flammten kurz auf – und dann, ich muß es hier gestehen, dachte ich etwas Unerhörtes. Denn was mir im nächsten Augenblick durch den Kopf ging, war im exakten Wortlaut: »Hoffentlich kratzt er jetzt nicht ab, bevor er mir erzählt hat, was in diesem verdammten Brief stand.«
Nein, ich dachte nicht: »Hoffentlich stirbt er nicht« oder »Du mußt leben, Dichtpate!« oder so etwas ähnliches, sondern obenstehenden Satz, und ich schäme mich bis auf den heutigen Tag, daß darin das Wort »abkratzen« vorkam. Danzelot ergriff mein Handgelenk und umklammerte es wie ein Schraubstock, Er hob den Oberkörper und sah mich mit weit aufgerissenen Augen an.)
Danzelot: »Die letzten Worte eines Sterbenden – und er will dir etwas Sensationelles mitteilen! Merk dir diesen Kunstgriff! Da kann keiner aufhören zu lesen! Keiner!«
(Danzelot starb, und in diesem Augenblick war ihm nichts wichtiger, als mir diesen trivialen Trick für Jahrmarktsschriftsteller beizubringen – das war Dichtpatenschaft in rührendster Vollendung. Ich schluchzte ergriffen, und Danzelot lockerte seinen Griff und sank ins Kissen zurück.)
Danzelot: »Diese Geschichte war nicht lang, zehn handgeschriebene Seiten, aber ich habe nie, verstehst du, niemals in meinem ganzen Leben etwas nur annähernd so Vollkommenes gelesen.«
(Danzelot war zeitlebens ein besessener Leser gewesen, vielleicht der fleißigste der Lindwurmfeste, dementsprechend beeindruckend war diese Bemerkung für mich. Er steigerte meine Neugier ins Unermeßliche.)
Ich: »Was stand darin, Danzelot? Was?«
Danzelot: »Hör zu, mein Junge, ich habe nicht mehr die Zeit, dir die Geschichte zu erzählen. Sie liegt in der Erstausgabe des Ritter Hempel, die ich dir zusammen mit meiner gesamten Bibliothek vermachen möchte.«
(Hatte ich es doch geahnt! Meine Augen füllten sich wieder mit Tränen.)
Danzelot: »Ich weiß, daß du diese Schwarte nicht besonders magst, aber ich kann mir vorstellen, daß Odenhobler dir eines Tages ans Herz wachsen wird. Das ist eine Altersfrage. Schau bei Gelegenheit noch mal hinein.«
(Ich versprach es mit einem tapferen Nicken.)
Danzelot: »Was ich dir sagen will: Diese Geschichte war so vollkommen geschrieben, so makellos, daß sie mein Leben radikal veränderte. Ich beschloß, das Schreiben weitgehend aufzugeben, denn niemals würde ich etwas auch nur annähernd Perfektes erschaffen. Hätte ich diese Geschichte nie gelesen, dann wäre ich weiter meiner diffusen Vorstellung von Hochliteratur gefolgt, die ungefähr so in der Preisklasse von Gryphius von Odenhobler liegt. Ich hätte nie erfahren, wie vollendete Dichtung wirklich aussieht. Aber jetzt hielt ich sie in Händen. Ich resignierte, aber ich resignierte mit Freuden. Ich setzte mich nicht aus Faulheit oder Furcht oder sonstigen niederen Beweggründen zur Ruhe, sondern aus Demut vor wirklichem künstlerischen Adel. Ich beschloß, mein Leben in den Dienst der handwerklichen Aspekte des Schreibens zu stellen. Mich an die Dinge zu halten, die vermittelbar sind. Du weißt schon: Blumenkohl.«
(Danzelot machte eine lange Pause. Fast dachte ich, er sei schon verstorben, da fuhr er fort.)
Danzelot: »Und dann habe ich den größten Fehler meines Lebens gemacht: Ich habe diesem jungen Genie einen Brief geschrieben, in dem ich ihm empfahl, sich mit seinem Manuskript nach Buchhaim zu begeben, um sich dort einen Verleger zu suchen.«
(Danzelot seufzte noch einmal schwer.)
Danzelot: »Das war das Ende unserer Korrespondenz. Ich habe nie wieder von ihm gehört. Wahrscheinlich ist er meinem Ratschlag gefolgt, auf seiner Reise nach Buchhaim verunglückt oder in die Hände von Straßenräubern oder Korndämonen gefallen. Ich hätte zu ihm eilen, meine schützende Hand über ihn und sein Werk halten müssen, und was mache ich? Ich schicke ihn nach Buchhaim, in die Höhle des Löwen, eine Stadt voller Leute, die mit Literatur Geld machen, Pfennigfuchser und Aasgeier. Eine Stadt voller Verleger! Ich hätte ihn genausogut in einen Wald voller Werwölfe schicken können, mit einer Glocke um den Hals!«
(Mein Dichtpate röchelte, als gurgele er mit Blut.)
Danzelot: »Ich hoffe, ich habe all das, was ich an ihm falsch gemacht habe, an dir wiedergutgemacht, mein Junge. Ich weiß, daß du das Zeug dazu hast, einmal der größte Schriftsteller Zamoniens zu werden. Daß du das Orm erlangen wirst. Und um dahin zu kommen, wird es dir helfen, diese Geschichte zu lesen.«
(Danzelot hing noch dem alten Glauben an das Orm an, eine Art mysteriöse Kraft, die manche Dichter in Augenblicken höchster Inspiration durchströmen soll. Wir jungen und aufgeklärten Schriftsteller belächelten diesen antiquierten Hokuspokus, aber aus Respekt vor den Dichtpaten hielten wir uns mit zynischen Bemerkungen über das Orm zurück. Nicht aber, wenn wir unter uns waren. Ich kenne Hunderte von Orm-Witzen.)
Ich: »Das werde ich tun, Danzelot.«
Danzelot: »Aber laß dich nicht verschrecken! Der Schock, den du dabei erfahren wirst, wird fürchterlich sein! Jede Hoffnung wird von dir abfallen, du wirst versucht sein, deine schriftstellerische Karriere aufzugeben. Vielleicht wirst du daran denken, dich zu töten.«
(Sprach er irre? Eine derartige Wirkung konnte kein Text der Welt auf mich haben.)
Danzelot: »Du mußt diese Krise überwinden. Mach eine Reise! Wandere durch Zamonien! Erweitere deinen Horizont! Lerne die Welt kennen! Irgendwann wird der Schock sich umwandeln in Inspiration. Du wirst den Wunsch verspüren, dich an dieser Vollkommenheit zu messen. Und du wirst es eines Tages erreichen, wenn du nicht aufgibst. Du hast etwas in dir, mein Junge, über das niemand sonst auf der Blindwurmfeste verfügt.«
(Blindwurmfeste? Warum fingen seine Lider an zu flattern?)
Danzelot: »Eins noch, Junge, was du dir merken mußt: Es kommt nicht darauf an, wie eine Geschichte anfängt. Auch nicht darauf, wie sie aufhört.«
Ich: »Sondern?«
Danzelot: »Sondern auf das, was dazwischen passiert.«
(Zeitlebens hatte er keine solchen Plattheiten von sich gegeben. Verabschiedete sich nun sein Verstand?)
Ich: »Das werde ich mir merken, Danzelot.«
Danzelot: »Wieso ist es hier eigentlich so kalt?«
(Es war brüllend heiß, weil wir trotz der Sommerhitze für Danzelot ein mächtiges Kaminfeuer entfacht hatten. Er sah mich mit gebrochenem Blick an – in dem sich schon der triumphierende Sensenmann spiegelte.)
Danzelot: »So verflucht kalt … Kann mal jemand die Schranktür zumachen? Und was macht dieser schwarze Hund da in der Ecke? Warum sieht er mich so an? Wieso trägt er eine Brille? Eine ungeputzte Brille?«
(Ich blickte in die Ecke, in der sich als einziges Lebewesen eine kleine grüne Spinne in ihrem Netz unter der Decke befand. Danzelot atmete langsam und schwer und schloß die Augen für immer.)
Der Brief
Ich war in den nächsten Tagen viel zu sehr mit den Ereignissen beschäftigt, die durch Danzelots Tod verursacht wurden, um seinen letzten Worten nachzuforschen: die Beerdigung, die Ordnung seines Nachlasses, die Trauer. Als sein Dichtpatenkind hatte ich die Todes-Ode zu verfassen, ein mindestens hundertzeiliges hymnisches Gedicht, in Alexandrinern, das während der Leichenverbrennung vor allen Bewohnern der Lindwurmfeste verlesen wurde. Anschließend durfte ich seine Asche von der Spitze der Feste in alle Winde verstreuen. Danzelots Überreste wehten einen Augenblick in der Luft wie ein dünner grauer Schleier, dann lösten sie sich in feinen Nebel auf, der langsam hinabsank und sich schließlich völlig verflüchtigte.
Ich hatte sein kleines Haus mit der Bibliothek und dem Garten geerbt, daher beschloß ich, endlich das Heim meiner Eltern zu verlassen und dort einzuziehen. Der Umzug nahm ein paar Tage in Anspruch, und schließlich fing ich an, meine eigenen Bücher in die Bibliothek meines Onkels einzuordnen. Hin und wieder purzelten mir Manuskripte entgegen, die Danzelot zwischen die Bücher gesteckt hatte, vielleicht, um sie vor neugierigen Blicken zu verbergen. Es waren Notizen, rasch skizzierte Ideen, manchmal ganze Gedichte. Eins davon lautete:
Bin schwarz, aus Holz und stets verschlossen Seitdem mit Stein sie mich beschossen In mir ruh’n tausend trübe Linsen Seitdem mein Haupt ging in die Binsen Dagegen helfen keine Pillen: Ich bin ein Schrank voll ungeputzter Brillen
O je, ich hatte keine Ahnung gehabt, daß Danzelot in seiner umnachteten Phase gedichtet hatte. Ich erwog kurz, das Manuskript zu vernichten, um diesen Makel in Knittelversen aus seinem Nachlaß zu entfernen. Aber dann besann ich mich eines Besseren – als Dichter ist man der Wahrheit verpflichtet, Gutes wie Schlechtes – es gehört der lesenden Allgemeinheit. Ächzend räumte ich weiter Bücher ein, bis ich zum Buchstaben O kam – Danzelot hatte seine Bibliothek alphabetisch nach den Nachnamen der Autoren geordnet. Dort fiel mir Odenhoblers Ritter Hempel in die Hände – und Danzelots mysteriöse Andeutung auf dem Sterbebett wieder ein. Im Hempel sollte sich ein sensationelles Manuskript verbergen. Neugierig schlug ich das Buch auf.
Zwischen dem Buchdeckel und der ersten Seite lag tatsächlich ein gefalteter Brief, zehn Blätter, leicht vergilbt, stockfleckig – war es der, von dem er so geschwärmt hatte? Ich nahm ihn heraus und wog ihn einen Augenblick in der Hand. Danzelot hatte mich auf ihn neugierig gemacht und gleichzeitig davor gewarnt. Die Lektüre könne mein Leben verändern, hatte er orakelt, so wie sie seines verändert hatte. Nun – warum eigentlich nicht? Ich dürstete nach Veränderung! Ich war schließlich noch jung, gerade mal siebenundsiebzig Jahre alt.
Draußen schien die Sonne, drinnen im Haus bedrückte mich immer noch die Restpräsenz meines toten Dichtpaten. Der Tabakgeruch seiner zahllosen Pfeifen, zerknülltes Papier auf dem Schreibtisch, eine angefangene Tischrede, eine halbleere Teetasse, und von der Wand glotzte mich sein uraltes Jugendportrait an.
Er war immer noch allgegenwärtig, und schon der Gedanke, die Nacht allein in diesem Haus zu verbringen, beunruhigte mich. Also beschloß ich, hinauszugehen, mich auf eine der Mauern der Lindwurmfeste zu setzen und das Manuskript unter freiem Himmel zu lesen. Ich schmierte mir seufzend ein Brot mit Danzelots selbstgemachter Erdbeermarmelade und machte mich auf den Weg.
Ich bin sicher, daß ich diesen Tag in meinem ganzen Leben niemals vergessen werde. Die Sonne hatte ihren Zenit längst überschritten, aber es war immer noch warm, und die meisten Lindwurmfestebewohner hielten sich im Freien auf. Tische und Stühle waren auf die Straßen gestellt worden, auf den Mauern lümmelten sich sonnenhungrige Saurier, spielten Karten, lasen Bücher und trugen sich gegenseitig ihre neuesten Ergüsse vor. Lachen und Gesang überall – ein typischer Spätsommertag auf der Feste.
Es war gar nicht so einfach, eine ruhige Stelle zu finden, also streifte ich immer weiter durch die Gassen und fing schließlich schon im Gehen an, das Manuskript zu studieren.
Mein erster Gedanke dabei war, daß sich jedes Wort an der richtigen Stelle befand. Nun ist das nichts Besonderes, diesen Eindruck vermittelt eigentlich jede geschriebene Seite. Erst beim genauen Lesen bemerkt man, daß hier und da etwas nicht stimmt, Satzzeichen falsch gesetzt sind, Schreibfehler sich eingeschlichen haben, schiefe Metaphern benutzt wurden, Wörter sich inflationär häufen, und was man sonst noch beim Schreiben alles falsch machen kann. Aber diese Seite war anders – sie machte auf mich den Eindruck eines makellosen Kunstwerkes, ohne daß ich ihren Inhalt kannte. Es war wie bei einem Gemälde oder einer Skulptur, wo man ja auch auf den ersten Blick beurteilen kann, ob man es mit Kitsch oder mit einem Meisterwerk zu tun hat. Solch eine Wirkung hatte eine geschriebene Seite bei mir noch nie erzielt – ohne daß ich sie überhaupt gelesen hatte. Diese hier sah aus wie von Zeichnerhand kalligraphiert. Jeder Buchstabe behauptete sich als souveränes Kunstwerk, es war ein Ballett von Zeichen, die zu einem betörenden Reigen über die ganze Seite choreographiert waren. Es verstrich eine geraume Weile, bis ich mich von diesem einnehmenden Gesamteindruck losreißen konnte und endlich zu lesen begann.
»Hier sitzt wirklich jedes Wort an der richtigen Stelle«, dachte ich, nachdem ich die erste Seite gelesen hatte. Nein, nicht nur jedes einzelne Wort, jedes Satzzeichen, jedes Komma – selbst die Leerstellen zwischen den Worten schienen von unabänderlicher Wichtigkeit zu sein. Und der Inhalt? Der Text, soviel kann ich verraten, handelte von den Gedanken eines Schriftstellers, der sich im Zustand des horror vacui, der Angst vor dem leeren Blatt befand. Den die absolute Schreibhemmung gelähmt hatte, und der verzweifelt darüber grübelte, mit welchem Satz er seine Geschichte beginnen sollte.
Keine besonders originelle Idee, zugegeben! Wie viele Texte sind nicht schon über diese klassische, fast klischeehafte Situation des Dichterberufes verfaßt worden! Ich kenne sicher Dutzende, und ein paar davon sind von mir selbst. Meist zeugen sie nicht von der Größe des Schriftstellers, sondern von seinem Unvermögen: Ihm fällt nichts ein, also schreibt er darüber, daß ihm nichts einfällt – so als würde ein Flötist, der seine Noten vergessen hat, sinnlos auf seiner Tute herumblasen, nur weil es sein Beruf ist.
Aber dieser Text ging mit der verbrauchten Idee so brillant, so geistreich, so tiefschürfend und gleichzeitig derart erheiternd um, daß er mich binnen weniger Absätze in einen Zustand fiebriger Ausgelassenheit versetzte. Es war, als tanzte ich mit einem schönen Dinosauriermädchen, leicht berauscht von ein paar Gläsern Wein, zu himmlischer Musik. Mein Hirn schien um seine eigene Achse zu rotieren. Gedanken, funkensprühend wie Sternschnuppen, hagelten auf mich herab und verglühten zischend auf meiner Hirnrinde. Von dort aus verbreiteten sie sich kichernd in meinem Kopf, brachten mich zum Lachen, provozierten mich zu lauthalser Bestätigung oder Gegenrede – noch nie hatte mich eine Lektüre zu so lebhafter Reaktion veranlaßt.
Ich muß einen hochgradig verwirrten Eindruck gemacht haben, wie ich da so in der Gasse auf und ab stolzierte, laut deklamierend, den Brief umherschwenkend, ab und zu hysterisch auflachend oder mit den Füßen trampelnd vor Begeisterung. Aber in der Lindwurmfeste gehört schrulliges Verhalten in der Öffentlichkeit zum guten Ton, daher rief mich niemand zur Ordnung. Vielleicht probte ich ja ein Theaterstück, dessen Hauptfigur dem Wahnsinn verfallen war.
Ich las weiter. An dieser Art zu schreiben war alles richtig, derart vollkommen, daß mir die Tränen kamen – was mir ansonsten nur bei ergreifender Musik widerfährt. Das war – gigantisch, so überirdisch, so endgültig! Ich schluchzte hemmungslos und setzte meine Lektüre durch den Tränenfilm hindurch fort, bis mich plötzlich ein neuer Gedanke solchermaßen erheiterte, daß meine Tränen abrupt versiegten und ich einen Lachkrampf erlitt. Ich grölte wie ein besoffener Idiot, während ich mir mit der Faust auf den Oberschenkel hämmerte – beim Orm, war das komisch! Ich japste nach Luft, beruhigte mich kurz, biß mir auf die Lippen, preßte mir die Pranke auf den Mund – und konnte doch nicht anders, als gleich wieder loszukreischen. Wie unter Zwang mußte ich die Formulierung mehrmals laut wiederholen, immer wieder unterbrochen von hysterischen Lachanfällen. Uaaah! Das war der komischste Satz, den ich je gelesen hatte! Ein Brüller der Sonderklasse, ein Superscherz! Nun füllten sich meine Augen mit Lachtränen. Das waren keine routinierten Pointen – etwas so in gleichem Maße Geistreiches wie Witziges wäre mir im Traum nicht eingefallen. Bei allen zamonischen Musen: das war bestürzend gut.
Es dauerte eine Weile, bis die letzte große Lachwelle verebbt war und ich japsend und fiepsend meine Lektüre fortsetzen konnte, immer noch von gelegentlichem Kichern geschüttelt. Ich hatte Rotz und Wasser geheult, die Tränen liefen mir immer noch übers Gesicht. Zwei entfernte Verwandte kamen mir entgegen und lüfteten mit bitteren Mienen ihre Kopfbedeckungen, weil sie glaubten, ich sei noch in Trauer aufgelöst über den Verlust meines verblichenen Dichtpaten. In dem Moment mußte ich wieder loskreischen, und sie entfernten sich schnell unter meinem hysterischen Gelächter. Dann beruhigte ich mich endlich so weit, daß ich weiterlesen konnte.
Eine Perlenkette von Assoziationen zog sich über die nächste Seite, die mir so taufrisch, so gnadenlos originell und gleichzeitig so tiefgründig erschien, daß ich mich für die Banalität jedes einzelnen Satzes schämte, den ich bis dahin selber verfaßt hatte. Wie Sonnenstrahlen durchschossen und erhellten sie mein Gehirn, ich jauchzte und klatschte mehrmals in die Hände, gleichzeitig hätte ich am liebsten jeden Satz doppelt mit einem Rotstift unterstrichen und »Ja! Ja! Genau!« an den Rand des Briefes geschrieben. Ich weiß noch, daß ich jedes einzelne Wort eines Satzes küßte, der mir besonders gut gefiel.
Passanten gingen kopfschüttelnd an mir vorbei, während ich mit dem Brief durch die Feste tanzte und jubilierte, aber ich schenkte ihnen keine Beachtung. Simple Zeichen auf Papier waren es, die mich in schiere Ekstase versetzten. Wer auch immer diese Zeilen geschrieben hatte, er hatte unseren Beruf in einen Bereich geführt, der mir bisher verschlossen war. Ich keuchte vor Demut.
Dann kam wieder ein Absatz, und ein gänzlich neuer Ton wurde angeschlagen, hell und klar wie eine gläserne Glocke. Die Worte wurden plötzlich zu Diamanten, die Sätze zu Diademen. Dies waren unter geistigem Hochdruck konzentrierte Gedanken, mit wissenschaftlicher Präzision berechnete, gespaltene, geschliffene und polierte Worte, zusammengefügt zu Preziosen von kristallener Vollkommenheit, die an die exakten und einmaligen Strukturen von Schneeflocken erinnerten. Eine Kälte ging von diesen Sätzen aus, die mich erschauern ließ, aber es war nicht die irdische Kälte des Eises, sondern die erhabene, große, ewige Kälte des Weltraums. Das war Denken, Schreiben, Dichten in seiner reinsten Form – niemals zuvor hatte ich etwas auch nur annähernd so Makelloses gelesen.
Einen einzigen Satz will ich aus diesem Text zitieren, nämlich denjenigen, mit dem er endete. Es war gleichzeitig jener erlösende Satz, welcher dem von Schreibhemmung geplagten Dichter endlich einfiel, um seine Arbeit beginnen zu können. Ich benutze diesen Satz seither jedesmal, wenn mich selbst die Angst vor dem leeren Blatt ergriffen hat, er ist unfehlbar und seine Wirkung immer die gleiche: der Knoten platzt, und der Strom der Worte ergießt sich auf das weiße Papier. Er funktioniert wie eine Zauberformel, und ich glaube manchmal, daß er tatsächlich eine ist. Und wenn er nicht das Werk eines Zauberers ist, dann zumindest der genialste Satz, den jemals ein Dichter ersann. Der Satz lautet: »Hier fängt die Geschichte an.«
Ich ließ den Brief sinken, meine Knie wurden weich, ich sank erschöpft aufs Pflaster – ach was, bleiben wir bei der Wahrheit, meine Freunde – ich legte mich der Länge nach hin. Die Ekstase wich von mir, der Rausch löste sich auf in Trostlosigkeit. Beängstigende Kälte durchrieselte meine Adern, Furcht erfüllte mich. Ja, Danzelot hatte es prophezeit: Dieser Brief würde mich zerschmettern. Ich wollte sterben. Wie hatte ich mir je anmaßen können, Schriftsteller zu sein? Was hatten meine amateurhaften Versuche, Gedanken aufs Papier zu krakeln, mit jener Zauberkunst zu tun, deren Zeuge ich soeben geworden war? Wie könnte ich mich jemals zu solchen Höhen aufschwingen – ohne diese Flügel der reinsten Inspiration, über die der Verfasser des Briefes verfügte? Ich fing schon wieder an zu weinen, und diesmal waren es die bitteren Tränen der Verzweiflung.
Lindwurmfestebewohner mußten über mich hinwegsteigen, besorgt erkundigten sie sich nach meinem Befinden. Ich schenkte ihnen keine Beachtung. Stundenlang lag ich da, wie gelähmt, während die Nacht hereinbrach und die Sterne über mir zu funkeln begannen. Irgendwo da oben war Danzelot, mein Dichtpate, und lächelte auf mich herab.
»Danzelot!« schrie ich das Sternenzelt an. »Wo bist du? Hol mich in dein totes Reich!«
»Halt endlich die Klappe und geh nach Hause, du besoffener Sack!« rief jemand empört aus einem Fenster.
Zwei herbeigeholte Nachtwächter, die mich wahrscheinlich für einen betrunkenen jungen Poeten in der Schaffenskrise hielten (womit sie nicht so falsch lagen), hakten mich unter und führten mich, begleitet von aufmunternden Gemeinplätzen (»Das wird schon wieder!«, »Die Zeit heilt alle Wunden!«), bis nach Hause. Dort fiel ich ins Bett, wie von einer Steinschleuder niedergestreckt. Erst tief in der Nacht bemerkte ich, daß ich das Marmeladenbrot, mittlerweile völlig zermatscht, immer noch in der Pranke hielt.
Am nächsten Morgen beschloß ich, die Lindwurmfeste zu verlassen. Nachdem ich die ganze Nacht alle Alternativen zur Bewältigung meiner Krise gedanklich durchgespielt hatte – Sturz von den Zinnen der Feste, Flucht in den Alkohol, Beendigung der künstlerischen Laufbahn und Beginn eines Eremitendaseins, Blumenkohlzucht in Danzelots Garten –, entschied ich mich dafür, den Ratschlag meines Dichtpaten zu befolgen und eine längere Reise anzutreten. Ich schrieb einen tröstlichen Abschiedsbrief in Sonettform an meine Eltern und Freunde, nahm mein Erspartes und packte mir ein Reisebündel mit zwei Gläsern von Danzelots Marmelade, einem Laib Brot und einer Wasserflasche.
Ich verließ die Feste im Morgengrauen, schlich mich wie ein Dieb durch die leeren Gassen und atmete erst auf, als ich ins Freie trat. Ich wanderte viele Tage lang, mit nur wenigen Pausen, denn ich hatte ein Ziel: Ich wollte nach Buchhaim, um die Spur jenes geheimnisvollen Dichters aufzunehmen, dessen Kunst mich in solche Höhen geleitet hatte. Er sollte, so malte ich mir in meiner jugendlichen Zuversicht aus, den leeren Platz meines Dichtpaten ersetzen und mein Lehrmeister werden. Er sollte mich hinaufführen in jene Sphäre, in der solche Dichtung entstand. Ich hatte keine Ahnung, wie er aussah, ich wußte nicht, wie er hieß, nicht einmal, ob er überhaupt noch existierte, aber ich war überzeugt, daß ich ihn finden würde – oh grenzenlose Zuversicht der Jugend!
So kam ich nach Buchhaim, und hier stehe ich nun, zusammen mit euch, meine furchtlos lesenden Freunde! Und hier, an der Grenze der Stadt der Träumenden Bücher, hier fängt die Geschichte erst richtig an.
Die Stadt der Träumenden Bücher
Wenn man sich an den überwältigenden Geruch von vermoderndem Papier gewöhnt hatte, der aus den Eingeweiden von Buchhaim emporstieg, wenn die ersten allergischen Niesanfälle überstanden waren, die der überall herumwirbelnde Bücherstaub verursachte, und wenn die Augen langsam aufhörten, vom beißenden Qualm der tausend Schlote zu tränen – dann konnte man endlich anfangen, die zahllosen Wunder der Stadt zu bestaunen.
Buchhaim verfügte über fünftausend amtlich registrierte Antiquariate und schätzungsweise tausend halblegale Bücherstuben, in denen neben Büchern alkoholische Getränke, Tabak und berauschende Kräuter und Essenzen angeboten wurden, deren Genuß angeblich die Lesefreude und die Konzentration steigerten. Es gab eine kaum meßbare Zahl von fliegenden Händlern, die auf rollenden Regalen, in Bollerwagen, Umhängetaschen und Schubkarren Druckwerk in jeder denkbaren Form feilboten. In Buchhaim existierten über sechshundert Verlage, fünfundfünfzig Druckereien, ein Dutzend Papiermühlen und eine ständig wachsende Anzahl von Werkstätten, die sich mit der Herstellung von bleiernen Druckbuchstaben und Druckerschwärze beschäftigten. Da waren Läden, die Tausende von verschiedenen Lesezeichen und Exlibris anboten, Steinmetze, die sich auf Buchstützen spezialisiert hatten, Schreinereien und Möbelgeschäfte voller Lesepulte und Bücherregale. Es gab Optiker, die Lesebrillen und Handlupen fertigten, und an jeder Ecke war ein Kaffeeausschank, meist mit offenem Kamin und Dichterlesungen, rund um die Uhr.
Ich sah unzählige Stationen der Buchhaimer Feuerwehr, alle auf Hochglanz poliert, mit gewaltigen Alarmglocken über den Portalen und angespannten Pferdefuhrwerken, mit kupfernen Wassertanks auf den Anhängern. Schon fünfmal hatten verheerende Brände große Teile der Stadt und der Bücher vernichtet – Buchhaim galt als die feuergefährlichste Stadt des Kontinents. Aufgrund der heftigen Winde, die beständig durch die Straßen fegten, war es in Buchhaim je nach Jahreszeit entweder kühl, kalt oder eisig, aber niemals warm, weshalb man sich gerne drinnen aufhielt, tüchtig heizte – und natürlich viel las. Die ständig brennenden Öfen, der Funkenflug in unmittelbarer Nachbarschaft von uralten, leicht entflammbaren Büchern – das schuf einen wahrlich brenzligen Dauerzustand, in dem jederzeit eine neue Feuersbrunst ausbrechen konnte.
Ich mußte dem Impuls widerstehen, gleich in den erstbesten Buchladen zu stürmen und in den Folianten zu wühlen, denn dann wäre ich vor dem Abend nicht wieder herausgekommen – und ich mußte mir zunächst eine Unterkunft besorgen. So strich ich einstweilen mit glänzenden Augen an den Schaufenstern vorbei und versuchte mir diejenigen Läden zu merken, die über besonders verheißungsvolle Auslagen verfügten.
Und da waren sie, die Träumenden Bücher. So nannte man in dieser Stadt die antiquarischen Bestände, weil sie aus der Sicht der Händler nicht mehr richtig lebendig und noch nicht richtig tot waren, sondern sich in einem Zwischenzustand befanden, der dem Schlafen ähnelte. Ihre eigentliche Existenz hatten sie hinter sich, den Zerfall vor sich, und so dämmerten sie vor sich hin, zu Millionen und Abermillionen in all den Regalen und Kisten, in den Kellern und Katakomben von Buchhaim. Nur wenn ein Buch von suchender Hand ergriffen und aufgeschlagen, wenn es erworben und davongetragen wurde, dann konnte es zu neuem Leben erwachen. Und das war es, wovon all diese Bücher träumten.
Da: Der Tiger in der Wollsocke von Caliban Sycorax, Erstausgabe! Da: Die rasierte Zunge von Adrastea Sinopa – mit den gerühmten Illustrationen von Elihu Wippel! Da: Die Mäusehotels von Wellfleisch, der legendäre humoristische Reiseführer von Yodler van Hinnen, in tadellosem Zustand! Ein Dorf namens Schneeflock von Palisaden-Honko, die vielgepriesene Autobiographie eines dichtenden Schwerverbrechers, in den Verliesen von Eisenstadt geschrieben – mit einer Signatur aus Blut! Das Leben ist schrecklicher als der Tod – die hoffnungslosen Aphorismen und Maximen von PHT Farcevol, in Fledermauspelz gebunden! Die Ameisentrommel von Sansemina van Geisterbahner, in der legendären Spiegelschriftausgabe! Der gläserne Gast von Zodiak Glockenschrey! Hampo Henks experimenteller Roman Der Hund, der nur im Gestern bellte – lauter Bücher, von deren Lektüre ich träumte, seit Danzelot mir davon vorgeschwärmt hatte. An jeder Fensterscheibe drückte ich meine Nüstern platt, wie ein Betrunkener tastete ich mich an ihnen entlang, und ich kam nur im Schneckentempo vorwärts. Bis ich mich schließlich zusammenriß und beschloß, keine einzelnen Titel mehr wahrzunehmen und endlich Buchhaim als Ganzes auf mich wirken zu lassen. Ich hatte den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, beziehungsweise die Stadt vor lauter Büchern. Nach dem behäbigen, traumverlorenen Dichterleben auf der Lindwurmfeste, das höchstens ab und zu durch eine vorübergehende Belagerung gesteigert wurde, bescherte mir das Treiben in den Straßen von Buchhaim einen Hagelschauer von Eindrücken. Bilder, Farben, Szenen, Geräusche und Gerüche – alles war neu und aufregend. Zamonier aller Daseinsformen – und jeder hatte ein fremdes Gesicht. Auf der Feste gab es nur die immergleiche Parade von vertrauten Visagen, Verwandte, Freunde, Nachbarn, Bekannte – hier war alles unbekannt und kurios.
Tatsächlich begegnete ich auch dem ein oder anderen Bewohner der Lindwurmfeste. Dann blieben wir kurz stehen, begrüßten uns höflich, tauschten ein paar Floskeln aus, wünschten uns gegenseitig einen angenehmen Aufenthalt und verabschiedeten uns wieder. Derart reservierten Umgang pflegen wir alle auf Reisen, was unter anderem damit zu tun hat, daß man nicht in die Fremde gezogen ist, um seinesgleichen zu begegnen.
Nun aber weiter, weiter, das Unbekannte erforschen! Überall standen ausgemergelte Dichter und deklamierten lauthals aus ihren Werken, in der Hoffnung, daß irgendein Verleger oder steinreicher Mäzen vorbeischlenderte und auf sie aufmerksam wurde. Ich beobachtete, daß einige auffällig wohlgenährte Gestalten um die Straßenpoeten herumschlichen, dicke Wildschweinlinge, die aufmerksam zuhörten und sich ab und zu Notizen machten. Das waren allerdings alles andere als freigebige Gönner, sondern Literaturagenten, die hoffnungsvolle Autoren in Knebelverträge zwängten, um sie dann gnadenlos als Geisterautoren auszupressen, bis ihnen auch die letzte originelle Idee abgemolken war – davon hatte mir Danzelot erzählt.
Nattifftoffische Beamte patrouillierten wachsam in kleinen Gruppen, auf der Suche nach illegalen Verkäufern, die über keine Nattifftoffenlizenz verfügten – wo sie auftauchten, wurden hastig Bücher in Säcke gestopft und Buchkarren in Bewegung gesetzt.
Die Lebenden Zeitungen – flinkfüßige Zwerge in ihren traditionellen Papierumhängen aus Zeitungsfahnen – schrien den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Literatur durch die Gassen und ließen Passanten für geringes Entgelt die Einzelheiten auf ihren Umhängen ablesen:
Schon gehört? Muliat von Kokken hat seine Erzählung »Die Zitronenpauke« meistbietend an den Melissenverlag verhökert!
Kaum zu glauben:Das Lektorat von Ogden Ogdens Roman »Ein Pelikan im Blätterteig« verzögert sich um ein weiteres halbes Jahr!
Unerhört:Das letzte Kapitel von »Die Wahrheitstrinker« hat Fantotas Pemm aus »Holz und Wahn« von Uggli Prudel abgekupfert!
Bücherjäger hasteten von Antiquariat zu Antiquariat, um ihre Beute zu versilbern oder neue Aufträge zu erhalten. Bücherjäger! Man erkannte sie an den Grubenlampen und Quallenfackeln, an der widerstandsfähigen und martialischen Kleidung aus Leder, Rüstungsteilen und Kettenhemden, an den Werkzeugen und Waffen, die sie bei sich trugen: Beile und Säbel, Spitzhacken und Lupen, Seile, Bindfäden und Wasserflaschen. Einer stieg direkt zu meinen Füßen aus der Kanalisation, ein beeindruckendes Exemplar mit Eisenhelm und Drahtmaske. Das waren Schutzmaßnahmen nicht nur gegen den Staub oder die gefährlichen Insekten der geheimnisvollen Welt unterhalb Buchhaims. Danzelot hatte mir erzählt, daß sich die Bücherjäger unter der Erde nicht nur gegenseitig die Beute abjagten, sondern sich regelrecht bekriegten und sogar töteten. Wenn man diese rundum gepanzerte Kreatur keuchend und grunzend aus der Erde kommen sah, mochte man das gerne glauben.
Aber die meisten Passanten waren einfach nur Touristen, welche die Neugier in die Stadt der Träumenden Bücher getrieben hatte. Viele von ihnen wurden in Herden durch die Gassen getrieben, von Führern mit blechernen Flüstertüten, die ihrer Gruppe zum Beispiel zuschrieen, in welchem Haus Urian Nussek Das Tal der Leuchttürme an welchen Verleger verschachert hatte. Schnatternd und die Hälse verrenkend wie aufgeregte Gänse, folgten ihnen die Besucher und staunten über jede noch so banale Kleinigkeit.
Immer wieder verstellte mir irgendein blutschinkischer Grobian den Weg und drückte mir einen dieser Zettel in die Hand, auf denen stand, welcher Dichter sich in welcher Buchhandlung heute abend zur Holzzeit die Ehre geben und aus seinem Werk vorlesen würde. Es dauerte eine Weile, bis ich gelernt hatte, diese Form von Wegelagerei einfach zu ignorieren.
Überall wankten kleinwüchsige Daseinsformen herum, die als Bücher auf Beinen verkleidet waren und so zum Beispiel für Die Meerjungfrau in der Teetasse oder Das Käferbegräbnis Reklame liefen. Gelegentlich rempelten sie gegeneinander, weil in den Buchattrappen die Sicht beschränkt war. Dann kippten sie meistens geräuschvoll um und versuchten anschließend unter allgemeinem Gelächter, wieder auf die Beine zu kommen.
Staunend bewunderte ich die Fähigkeiten eines Straßenkünstlers, der mit zwölf dickleibigen Büchern jonglierte. Wer jemals ein Buch in die Luft geworfen und wieder aufzufangen versucht hat, der weiß, wie schwierig das ist – ich sollte allerdings hinzufügen, daß der Jongleur über vier Arme verfügte. Andere Straßenkünstler hatten sich als populäre Figuren der zamonischen Literaturgeschichte verkleidet und gaben auswendig gelernte Stellen aus den entsprechenden Werken zum besten, wenn man ihnen etwas Geld hinwarf. An einer einzigen Straßenkreuzung sah ich Hario Schunglisch aus Die Gewürfelten, Oku Okra aus Wenn die Steine weinen und die schwindsuchtgeplagte Protagonistin Zanilla Hustekuchen aus Gofid Letterkerls Meisterwerk Zanilla und der Murch.
»Ich bin nur eine Berghutze«, rief die Zanilla-Darstellerin gerade voller Dramatik, »und du, mein Geliebter, du bist ein Murch. Wir werden niemals zueinanderfinden. Laß uns gemeinsam von der Dämonenklamm springen!«
Diese wenigen Sätze genügten bereits, um mir wieder die Tränen in die Augen zu treiben. Gofid Letterkerl war ein Genie! Nur mit Mühe riß ich mich von dem Schauspiel los.
Weiter! Weiter! Auf Plakaten in den Schaufenstern, die ich aufmerksam studierte, wurde für Deklamationsabende, literarische Salons, Buchpremieren und Reimwettbewerbe geworben. Fliegende Händler rissen mich immer wieder davon los, versuchten, mir ihre abgegriffenen Schwarten aufzudrängen und verfolgten mich ganze Straßenzüge lang, lauthals aus ihrem Ramsch deklamierend.
Auf der Flucht vor einem von diesen zudringlichen Kerlen kam ich an einem schwarzgestrichenen Haus vorbei, über dessen Tür eine Holztafel annoncierte, daß es das Kabinett der Gefährlichen Bücher sei. Ein Hundling im roten Samtumhang schlich davor auf und ab und raunte den Passanten mit furchterregend gebleckten Zähnen zu: »Betreten des Kabinetts der Gefährlichen Bücher auf eigene Gefahr! Eintritt für Kinder und Greise verboten! Rechnen Sie mit dem Schlimmsten! Hier gibt es Bücher, die beißen können! Bücher, die Ihnen nach dem Leben trachten! Giftige, würgende und fliegende Bücher! Alle echt! Das ist keine Geisterbahn, das ist die Wirklichkeit, meine Herrschaften! Machen Sie Ihr Testament und küssen Sie Ihre Liebsten, bevor Sie das Kabinett der Gefährlichen Bücher betreten!«
Aus einem Nebenausgang wurden in regelmäßigen Abständen lakenbedeckte Körper auf Bahren herausgetragen, und aus den zugenagelten Fenstern des Hauses drangen gedämpfte Schreie – trotzdem strömten die Zuschauer in Scharen in das Kabinett.
»Das ist nur eine Touristenfalle«, sprach mich ein buntscheckig gekleideter Halbzwerg an. »Niemand wäre so bescheuert, echte Gefährliche Bücher der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wie wär’s mit etwas wirklich Authentischem? Interessiert an einem Orm-Rausch?«
»Was?« fragte ich irritiert zurück.
Der Zwerg öffnete sein Gewand und präsentierte mir ein Dutzend kleiner Fläschchen, die in der Innenseite steckten. Er sah sich nervös um und schloß den Umhang wieder. »Das ist das Blut von echten Dichtern, in denen das Orm kreist«, flüsterte er verschwörerisch. »Ein Tropfen davon in ein Glas Wein, und du halluzinierst ganze Romane! Nur fünf Pyras2 das Fläschchen!«
»Nein, danke!« wehrte ich ab. »Ich bin selber Dichter!«
»Ihr Lindwurmfeste-Snobs haltet euch alle für was Besonderes!« rief mir der Zwerg nach, als ich mich hastig entfernte. »Ihr dichtet auch nur mit Tinte! Und das Orm, das erlangen auch von euch nur die wenigsten!«
Herrje, ich war offensichtlich in eine der schäbigeren Ecken Buchhaims geraten. Erst jetzt bemerkte ich, daß hier auffällig viele Bücherjäger herumlungerten und mit zwielichtigen Gestalten dunkle Geschäfte tätigten. Juwelenbesetzte Bücher wurden aus Ledersäcken geholt und wechselten gegen dicke Beutel voller Pyras den Besitzer. Das mußte so etwas wie ein Schwarzer Markt sein, auf den ich da geraten war.
»An Büchern von der Goldenen Liste interessiert?« fragte mich ein von Kopf bis Fuß in dunkles Leder gekleideter Bücherjäger. Er trug das Mosaik eines Totenschädels als Maske, einen Gürtel mit einem Dutzend Messern daran und zwei Äxte in den Stiefeln. »Komm mit in die dunkle Gasse da hinten, dann zeig ich dir Bücher, von denen du bisher nicht mal geträumt hast.«
»Vielen Dank!« rief ich, während ich eilig das Weite suchte. »Kein Interesse!«
Der Bücherjäger lachte dämonisch. »Ich hab auch gar keine Bücher!« grölte er mir hinterher. »Ich wollte dir nur den Hals umdrehen und deine Hände abschneiden, um sie in Essig einzulegen und zu verkaufen! Reliquien von der Lindwurmfeste sind mächtig begehrt in Buchhaim.«
Ich beeilte mich, dieses obskure Viertel zu verlassen. Ein paar Gassen weiter war wieder alles normal, nur harmlose Touristen und Straßenkünstler, die populäre Schauspiele mit Marionetten inszenierten. Ich atmete auf. Vermutlich hatte der Bücherjäger nur einen finsteren Scherz gemacht, aber der Gedanke, daß die mumifizierten Körperteile von Lindwürmern in Buchhaim einen gewissen Marktwert besaßen, ließ mich schaudern.
Ich tauchte wieder ein in den Strom der Passanten. Eine ganze Schulklasse von niedlichen Fhernhachenzwergen trippelte schüchtern und händchenhaltend vor mir her. Mit großen leuchtenden Augen hielten sie Ausschau nach ihren Lieblingslyrikern.
»Da! Da! Hosian Rapido!« kreischten sie plötzlich und zeigten aufgeregt mit ihren kleinen Fingern auf irgend jemand, oder »Da! Da! Keilhard der Empfindsame trinkt einen Kaffee!«. Und dann wurde regelmäßig mindestens einer in ihrer Gruppe ohnmächtig.
Ich wanderte und wanderte, und ich muß gestehen, daß all die Wunder, die ich dabei erblickte, mein Erinnerungsvermögen überfordern. Es war, als ginge man in einem verschwenderisch illustrierten Buch spazieren, in dem ein künstlerischer Einfall den nächsten übertrumpfte. Wandelnde Buchstaben, die Reklame für moderne Druckerpressen liefen. Hauswände, auf die bekannte Romanfiguren gemalt waren. Denkmäler für Dichter. Antiquariate, aus denen die Schwarten förmlich auf die Straße quollen. Daseinsformen aller Art, die in den Bücherkisten wühlten und sich darum rissen. Riesige Midgard-Schlangen, die gewaltige Karren voll antiquarischem Ramsch zogen, mit grobschlächtigen Rübenzählern darin, die den Schund fuderweise in die Menge schleuderten. In dieser Stadt mußte man sich andauernd ducken, um nicht von einem Buch am Kopf getroffen zu werden. Ich fing in all dem Trubel nur Satzfetzen auf, aber jedes Gespräch schien sich in irgendeiner Form um Bücher zu drehen:
»… mit Schrecksenliteratur kannst du mich in den Werwolfwald jagen …«
» … liest heute abend zur Holzzeit in der Buchhandlung ›Goldschnitt‹ …«
»… Erstausgabe von Aurora Janus’ zweitem Roman gekauft, mit dem doppelten Druckfehler im Vorwort, für nur drei Pyras …«
»… wenn einer das Orm draufhat, dann ja wohl Dölerich Hirnfidler …«
»… typographisch eine Schande für die ganze Druckbranche …«
»… einen Fußnotenroman müßte man schreiben, nix als Fußnoten zu Fußnoten, das wär’s doch …«
Endlich blieb ich an einer Kreuzung stehen, drehte mich einmal um die eigene Achse und zählte dabei die Buchläden, die sich in den ab gehenden Straßen befanden: es waren einundsechzig. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Hier schienen Leben und Literatur identisch zu sein, alles kreiste um das gedruckte Wort. Das war meine Stadt. Das war meine neue Heimat.
Das Gasthaus des Grauens
Ich entdeckte eine kleine Pension mit dem vielversprechenden Namen Zur Goldenen Feder, was angenehm altmodisch klang und sowohl an erfolgreiches Schriftstellerhandwerk als auch an eine geruhsame Nachtruhe auf daunengefüllten Kissen denken ließ.
Hoffnungsvoll betrat ich die düstere Empfangshalle und trat über muffige Teppiche an einen hölzernen Tresen, wo ich, da niemand erschien, eine kupferne Klingel betätigte. Sie hatte einen Sprung, und ihr dissonantes Schellen erfüllte die Halle. Ich drehte mich um und versuchte, in den Schatten der abgehenden Korridore heraneilendes Personal auszumachen. Aber es kam niemand, also wandte ich mich wieder zum Tresen – und da stand plötzlich zu meinem Erschrecken der Rezeptionist, als sei er gerade aus dem Boden gewachsen. Er war ein Nebelheimer, wie ich an seiner blassen Haut erkannte. Aus Sebag Seriozas vorbildlicher Novelle Die feuchten Leute hatte ich mir die nötigen Kenntnisse über Nebelheimer angelesen – diese etwas unheimliche zamonische Daseinsform war mir in den Straßen schon mehrmals begegnet.
»Ja, bitte?« fragte er, und es klang, als würde er sein Leben aushauchen.
»Ich … suche ein Zimmer …«, antwortete ich mit bebender Stimme – und kaum fünf Minuten später bereute ich bereits bitterlich, nicht auf der Stelle Hals über Kopf geflohen zu sein. Das Zimmer – für das ich auf Drängen des Rezeptionisten im voraus bezahlt hatte – entpuppte sich nämlich als Rumpelkammer der übelsten Sorte. Mit traumwandlerischer Sicherheit hatte ich mir die wahrscheinlich übelste Absteige von ganz Buchhaim ausgesucht. Von weichen Daunen keine Spur, nur eine kratzige Decke auf einer modrigen Matratze, in der es lebendig knisterte. Den Geräuschen nach zu urteilen, versuchte im Nachbarzimmer eine Horde Yetis mit den Möbeln zu musizieren. Die Tapete löste sich schmatzend von den Wänden, irgend etwas lief fiepsend unter dem Holzfußboden herum. Unerreichbar in der hohen Zimmerecke hing kopfüber eine einäugige weiße Fledermaus und wartete anscheinend darauf, daß ich einschlief, damit sie ihr grausiges Werk beginnen konnte. Dann erst bemerkte ich, daß die Fenster keine Vorhänge hatten. Garantiert würde hier ab fünf Uhr morgens die Sonne gnadenlos hereinbrennen und ich kein Auge mehr zubekommen, denn schon beim geringsten Lichtstrahl kann ich nicht mehr schlafen. Schlafmasken lehne ich übrigens ab, seitdem ich einmal eine ausprobiert und dann am nächsten Morgen vergessen hatte, daß ich eine trug. Minutenlang befand ich mich in heller Panik, weil ich davon überzeugt war, über Nacht blind geworden zu sein. Ich bin herumgelaufen wie ein kopfloses Huhn und dabei so böse über einen Hocker gestürzt, daß ich mir das Schultergelenk auskugelte.
Aber ich hatte sowieso nicht vor, diese Nacht im Hotel zu verbringen. Ich konnte endlich mein Reisebündel ablegen und reinigte mich mit der brackigen Tunke aus der Waschschüssel oberflächlich vom Staub der Reise – das genügte für den Augenblick. Die Antiquariate von Buchhaim waren rund um die Uhr geöffnet, ich hatte Hunger, Durst und die unbändige Lust, die Nacht mit dem Stöbern nach Büchern zu verbringen. Ich wünschte der Fledermaus und den Yetis eine gute Nacht und stürzte mich wieder ins Getriebe.
Nur ein Bruchteil von Buchhaim, vielleicht gerade einmal zehn Prozent der Stadt, liegt an der Oberfläche. Die weitaus größeren Teile befinden sich unter der Erde. Wie ein monströser Ameisenbau verfügt sie über ein unterirdisches Tunnelsystem, das sich viele Kilometer nach unten erstreckt, in Form von Schächten, Schlünden, Gängen und Höhlen, die sich in einem unentwirrbaren gigantischen Knoten verschlingen.
Wie und wann dieses Höhlensystem entstanden ist, das vermag heute niemand mehr zu sagen. Manche Wissenschaftler behaupten, daß es zum Teil tatsächlich von einer prähistorischen Ameisenrasse stammt, von urzeitlichen Rieseninsekten, die es vor Jahrmillionen als Bau anlegten, um ihre gigantischen Eier darin zu verstecken. Die Antiquare der Stadt wiederum schwören darauf, daß das Tunnelsystem über Jahrtausende hinweg von vielen Generationen von Buchhändlern gegraben wurde, um Lager für antiquarische Bücher zu schaffen – was sicherlich für einige Bereiche des Labyrinths zutrifft, besonders für die, die sich dicht unter der Oberfläche befinden.
Es gibt zahllose Theorien, die diese Spekulationen mit weiteren anreichern. Ich persönlich hänge einer Mischtheorie an, nach der die ursprünglichen Tunnel tatsächlich von einer prähistorischen Insektenart gegraben und dann über die Jahrhunderte und Jahrtausende von zunehmend zivilisierteren Lebewesen ausgebaut wurden. Fest steht nur, daß diese Welt unter der Stadt existiert, daß sie bis auf den heutigen Tag noch nicht vollständig erschlossen ist und daß sie in vielen Bereichen vollgestopft ist mit Büchern, die, je tiefer man in die Katakomben hinabsteigt, immer älter und wertvoller werden.
Wenn man so durch die Gassen von Buchhaim schlenderte, erinnerte einen nichts an das Labyrinth, das sich unter dem Kopfsteinpflaster erstreckte. Ich registrierte zu meinem Entzücken, daß ich in dieser Stadt voraussichtlich nicht zu verhungern brauchte. Neben den Kaffeeausschänken und Wirtshäusern gab es viele Straßenstände, an denen preiswerte Verpflegung in allen Variationen angeboten wurde. Gebratene Würste und gefüllte Stubenküken, in Lehm gebackene Bücherwürmer, gebratene Mäuseblasen, Dampfbier, Fliegende Fladen, heiße Erdnüsse, kalte Limonade. Alle naselang stand eine Käseschmelze, wo über einem kleinen Feuer in einem gußeisernen Topf Käse zerlassen wurde, in den man gegen geringe Bezahlung ein Stück Brot tunken konnte.
Ich kaufte mir einen ordentlichen Batzen Brot, tränkte ihn mit reichlich Käse, verschlang ihn mit gierigen Bissen und trank dazu zwei Becher kalte Zitronenlimonade. Nach den Tagen der Entbehrung auf der Wanderschaft brachte diese massive Zufuhr von Nahrung und Flüssigkeit mir zwar die erhoffte Sättigung, aber auch ein ungesundes Völlegefühl, das mich eine Weile ziemlich beunruhigte. Ich befürchtete, es könne der Ausbruch einer unheilbaren Krankheit sein – bis es sich nach einem etwa einstündigen Verdauungsspaziergang in ein paar rabiaten Flatulenzen auflöste.
Was habe ich nicht alles auf diesem Spaziergang gesehen! Ich zwang mich immer noch, kein Antiquariat zu betreten, um nicht mit einem Riesenstapel Bücher bepackt ächzend durch die Gegend zu torkeln – überall lagen zu lachhaften Preisen die unglaublichsten Schätze aus: Wo der Deich kreist von Ektro Rückwasser, für fünf Pyras – handsigniert! Die Katakomben von Buchhaim, die vielgelobte Beschreibung der Zustände in den Buchhaimer Labyrinthen, von Colophonius Regenschein, dem legendären Bücherjäger – für drei Pyras! Disteln immerhin, die Lebenserinnerungen des schwermütigen Superpessimisten Humri Schiggsal, für läppische sechs Pyras!
Ich befand mich im Schriftstellerelysium, daran bestand kein Zweifel. Selbst mit der schmalen Summe, die mir Danzelot hinterlassen hatte, hätte ich mir hier im Nu eine veritable Bibliothek zusammenkaufen können, die jeden Bewohner der Lindwurmfeste neidisch machen würde. Aber zunächst ließ ich mich einfach nur treiben.
Kibitzers Antiquariat
Nachdem sich mein Staunen über das Gewimmel in den Straßen ein wenig gelegt hatte, fingen die Rempeleien der Blutschinken und die Aufdringlichkeit der fliegenden Händler allmählich an, mir auf die Nerven zu gehen. Mit fortschreitender Dunkelheit wurde es außerdem immer kühler, daher beschloß ich, endlich mit dem Stöbern in den Antiquariaten zu beginnen. Doch in welchem? Lieber einem großen mit gemischtem Angebot? Oder sollte es ein kleiner Spezialladen sein? Wenn letzteres, dann welche Spezialität? Lyrik? Kriminalromane? Rikshadämonische Gruselliteratur? Gralsunder Philosophie? Florinthischer Barock? Verlockend waren sie alle mit ihren kerzenbeleuchteten Schaufenstern voller literarischer Leckerbissen. Der Einfachheit halber entschied ich mich für den Laden, vor dem ich gerade stand. Auf der Eingangstür war ein seltsames Zeichen eingraviert: ein Kreis, der in seinem Inneren durch drei gekrümmte Linien geteilt war.
Das Geschäft war nur schummrig beleuchtet, so daß man die Titel der im Fenster ausgelegten Bücher nicht mehr entziffern konnte. Aber gerade dadurch erschien es mir am geheimnisvollsten und verlockendsten von allen Antiquariaten in dieser Straße. Hinein!
Ein dezenter Klingelton verkündete meinen Eintritt, der vertraute Muff vertrockneter Schwarten erfüllte meine Nüstern, und einen Augenblick lang glaubte ich, alleine im Laden zu sein. Meine Augen gewöhnten sich nur langsam an die Düsternis, aber dann konnte ich erkennen, daß aus den grauen Schatten der Regale eine bucklige Gestalt trat, deren enorme Glupschaugen im Dunkeln leuchteten. Ich vernahm ein dumpfes, rhythmisches Knacken.
»Kann ich Ihnen helfen?« fragte der Gnom mit dünner und brüchiger Stimme, als würde er mit einer Zunge aus Pergament sprechen. »Sie interessieren sich für die Schriften von Professor Doktor Abdul Nachtigaller?«
Ach du meine Güte! Ich war in einen Laden geraten, der auf die Schriften dieses Spinners aus den Finsterbergen spezialisiert war. Ausgerechnet! Ich war nur wenig mit Nachtigallers Werk vertraut, aber das hatte gereicht, um mir zu zeigen, daß seine wissenschaftliche Sicht der Dinge von meiner poetischen Passion weit entfernt war.
»Nur oberflächlich«, entgegnete ich kühl. Nur schnell wieder raus hier, bevor ich mir aus purer Höflichkeit eine dieser unlesbaren Schwarten andrehen ließ.
»Ohne Oberfläche gibt es keine Tiefe«, erwiderte der Gnom. »Vielleicht interessiert Sie eine sekundärwissenschaftliche Arbeit, Nachtigallers Forschungen in Zamonischer Labyrinthik betreffend? Es ist eine hochinteressante Arbeit von Doktor Oztafan Kolibril, einem der begabtesten Nachtigaller-Schüler, und ich untertreibe nicht, wenn ich behaupte, daß man daraus einiges über die Entschlüsselung von Labyrinthen erfahren kann.«
»Eigentlich interessiere ich mich nicht besonders für Labyrinthe«, gab ich zurück und trat den Rückzug an. »Ich fürchte, ich bin im falschen Laden.«
»Oh, Sie interessieren sich nicht für die Wissenschaften? Sie suchen nach Belletristik? Eskapistische Literatur für Realitätsflüchtlinge? Sie suchen Romane? Da sind Sie bei mir tatsächlich an der falschen Adresse. Hier gibt es nur Sachbücher.« Es war nichts Feindseliges oder Arrogantes in seiner Stimme, es klang wie eine höfliche Information. Ich ergriff die Türklinke.
»Entschuldigen Sie bitte!« sagte ich blöde und drückte den Türgriff. »Ich bin neu in der Stadt.«
»Sie kommen von der Lindwurmfeste?« fragte der Antiquar.
Ich hielt inne. Eines der unabänderlichen Dinge im Leben eines aufrecht gehenden Dinosauriers ist, daß jeder auf den ersten Blick seinen Geburtsort bestimmen kann. Ich hatte noch nicht herausgefunden, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil war.
»Das ist wahrscheinlich nicht zu übersehen«, antwortete ich.
»Verzeihen Sie bitte meine etwas abfällige und pauschale Bemerkung über Romane. Ich mußte mir ein paar Floskeln zulegen, um die Touristen abzuwimmeln, die hier dauernd reinplatzen und nach signierten Erstausgaben von Prinz Kaltbluth-