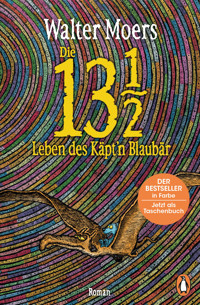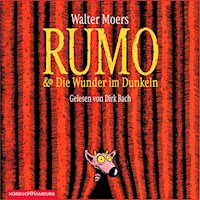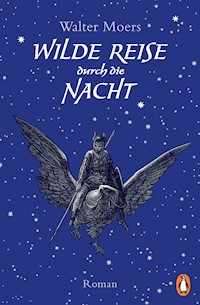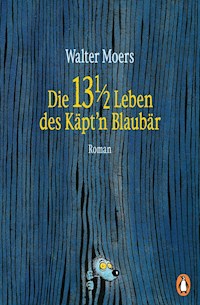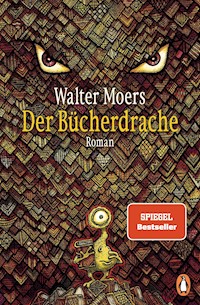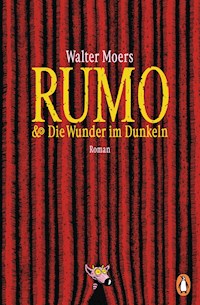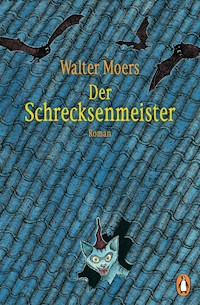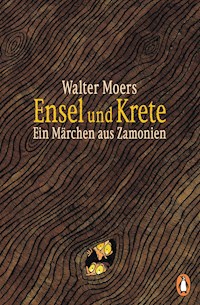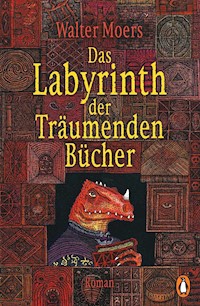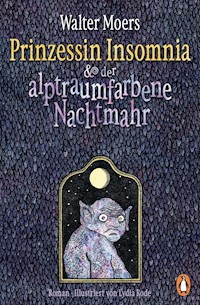
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das neue Märchen des Kultautors voller skurriler Charaktere und Komik
Prinzessin Dylia, die sich selbst »Prinzessin Insomnia« nennt, ist die schlafloseste Prinzessin von ganz Zamonien. Eines Nachts erhält sie Besuch von dem alptraumfarbenen Nachtmahr Havarius Opal: Der ebenso beängstigende wie sympathische Gnom kündigt an, sie in den Wahnsinn treiben zu wollen. Vorher nimmt er die Prinzessin aber noch mit auf eine abenteuerliche Reise durch die Welt des Denkens und Träumens, die für beide immer neue und überraschende Wendungen bereithält, bis sie schließlich zum dunklen Herz der Nacht gelangen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © Albrecht Knaus Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Lektorat: Rainer Wieland
Covergestaltung: buerosued.de nach einem Entwurf von Oliver Schmitt, Mainz, unter Verwendung einer Zeichnung von Walter Moers
Kolorierung: Lydia Rode und Oliver Schmitt
Layout und Satz: Oliver Schmitt, Mainz
Illustrationen: Lydia Rode
ISBN 978-3-641-22013-6V005
www.penguin-verlag.de
www.zamonien.de
Wenn die Minuten durch die Jahre rufenErhebt sich der ewige TräumerÜber seine irdische LastUnd reist mitten hineinIns dunkle Herz der Nacht
Anonym
Vom vielen Schlafen hat die Schlange ihre Füße verloren.
Zamonisches Sprichwort
Primus
PRINZESSIN INSOMNIA
Die Krankheit von Prinzessin Dylia war die seltenste von ganz Zamonien. Sie war noch seltener als das fiebrige Flattern, die chronische Krätze, der hysterische Husten, die paranormale Paradontose, der tonlose Tinnitus und das zantalfigorische Zittern.
Sie war so selten, dass die Ärzte dafür noch nicht einmal einen richtigen Namen hatten. Wenn zamonische Mediziner »die Krankheit« erwähnten, dann wussten sie einfach, dass es sich nur um die von Prinzessin Dylia handeln konnte und um keine andere. Eines ihrer hartnäckigen Symptome war eine Form von Schlaflosigkeit, die sich wirklich gewaschen hatte.
Wenn ihre Insomnie auftrat, vermochte die Prinzessin manchmal in fünf, sieben, neun, elf oder gar zweiundzwanzig Nächten kein Auge zu schließen. Einmal hatte sie es auf ganze vier Wochen gebracht, das war ihr persönlicher Rekord, von dem sie inbrünstig hoffte, dass sie ihn niemals brechen würde. An dem Abend, an dem die folgenden abenteuerlichen Ereignisse begannen, hatte Prinzessin Dylia bereits achtzehn Nächte hintereinander nicht geschlafen. Das war zwar noch nicht wirklich rekordverdächtig, aber selbst für ihre Verhältnisse eine ziemlich reife Leistung, wie sie nicht ohne Stolz bemerkte.
Prinzessin Dylia lebte zusammen mit ihren königlichen Eltern, ihren beiden Brüdern und dem übrigen Hofstaat in einem Schloss in der Hauptstadt des Königreiches. Das Schloss bestand aus sieben Türmen, welche die Stadt hoch überragten und die von weither sichtbar waren. Den höchsten davon bewohnte die Prinzessin wegen ihres Ruhebedürfnisses und ihrer speziellen Lebensgewohnheiten ganz alleine. In jedem Schlossturm gab es eine lange Wendeltreppe: eine mit vierhundertvierundvierzig Stufen, eine mit fünfhundertfünfundfünfzig, eine mit sechshundertsechsundsechzig – aber Dylias Turm hatte die längste Treppe mit siebenhundertsiebenundsiebzig Stufen. An deren Ende, ganz oben in der höchsten Spitze des Schlosses, befanden sich ihre geräumigen beiden Zimmer, eines zum Ankleiden und eines zum Schlafen. Hier hatte sie ihre absolute Ruhe und die beste Aussicht über das ganze Königreich.
Wie am Ende eines jeden Tages zelebrierte Dylia jetzt das gleiche langwierige Ritual, um sich zur nötigen Bettschwere zu verhelfen. Dazu betrachtete sie sich selbst zunächst im großen Spiegel des Ankleidezimmers und bemerkte dabei, wie ihr die Schlaflosigkeit von Nacht zu Nacht den Bereich um die Augen jedes Mal etwas dunkler schminkte. »Sag mal – wer bist du eigentlich?«, fragte sie ihr Spiegelbild mit einem spöttischen Lächeln. »Bist du ich oder bin ich du? Oder sind wir beide zusammen jemand ganz anderer? Hm?«
Wenn sie einmal so weit gekommen war wie heute, achtzehn Tage und Nächte in Folge ohne jeglichen Schlaf, dann kokettierte sie hin und wieder mit dem Gedanken, dass auch ihre geistige Gesundheit auf dem Spiel stehen könnte. Sie warf den Kopf in den Nacken, legte theatralisch den Handrücken an ihre kalte Stirn und fragte ihr Spiegelbild mit bebender Stimme: »Ich werde doch nicht etwa«, sie machte eine kurze dramatische Pause, »langsam wahnsinnig?«
Anschließend lachte sie kurz auf, sagte zu ihrem Spiegelbild: »Ach, geh mir doch weg!« – und ging weg. Dies war ein Teil des Rituals, das sie zur Pflege ihrer geistigen Gesundheit mittlerweile fast genauso regelmäßig praktizierte wie das Reinigen ihrer Zähne mit Zahnseide. Erst dann begann sie ihre allabendlichen Spaziergänge durch das Schloss, wobei sie meist keinen der sieben Türme mit ihren Wendeltreppen ausließ. Sie wandelte so ziellos, wie es sich für einen unruhigen Schlossgeist gehörte.
In diesem fortgeschrittenen Zustand des Schlafentzugs erschien der Prinzessin ihre eigene Existenz – und auch so ziemlich alles andere – wie ein wunschloser Tagtraum oder wie ein verrücktes Märchen ohne Ende und ohne Moral, das sie sich selber wieder und wieder erzählte. Dann stand sie buchstäblich neben sich und den Dingen und betrachtete alles aus kurzer Distanz. Nicht ohne Skepsis, aber auch nicht ohne Amüsement. Denn Prinzessin Dylia hatte gelernt, selbst ihrer extremen Schlaflosigkeit angenehme Seiten abzugewinnen. Sie las dann in sich wie in einem Buch mit rätselhaften Hieroglyphen, die sie nur zum Teil entschlüsseln konnte. Sie sah sich selbst zu wie der Hauptdarstellerin eines absurden Theaterstückes, das aus viel zu vielen und viel zu langen Akten bestand, aber dennoch seltsam fesselnd war.
Ihre eigene Stimme klang wie nie zuvor gehörter, dennoch seltsam vertrauter Gesang. Diese Art von schlafwandlerischer Selbstwahrnehmung hatte eine eigenartige, ja geradezu einzigartige Qualität, die Prinzessin Dylia niemandem vermitteln konnte, aber vielleicht gerade deshalb genüsslich auszukosten wusste. Denn sie vermochte so auf beinahe natürliche Art in Zustände zu geraten und Erkenntnisse zu gewinnen, für die andere Leute bewusstseinserweiternde Drogen nehmen, jahrelang fasten, sich selbst mit Lederriemen geißeln oder stundenlang hyperventilieren mussten.
Während sie die Treppen des Schlosses auf- und abstieg, fielen ihr exquisite und exklusive Wörter mit »ex« am Anfang zu ihren Zuständen ein: EXotisch. EXtravagant. EXaltiert. EXtraordinär. EXtrakorporal. EXtramundan. EXtragalaktisch. EXtrem. EXzentrisch. EXzitativ. EXzessiv. »Schade eigentlich«, dachte Prinzessin Dylia, »dass man ekstatisch nicht mit x schreibt.«
Keine Frage: Sie führte ein anstrengendes und entbehrungsreiches, aber auch ein außergewöhnliches und interessantes Leben. »Meine Gedanken sind meine Freunde«, dachte die Prinzessin. »Deswegen bin ich niemals allein.« Und wer konnte das schon von sich behaupten? Es galt, diesem Zustand so viel Gutes und Lehrreiches wie möglich abzugewinnen. Denn Dylia lernte gern, und wer meistens wach ist, der benutzt seinen Verstand entschieden häufiger als Leute, die ihr Leben mit Schlaf verplempern. Da wandelte sie doch lieber, wie gerade jetzt, ziellos durch die Korridore des Schlosses und dachte dabei über ihr eigenes Denken nach. Dabei stellte sie sich vor, dass das personifizierte Wissen in ihrem Kopf hauste, und zwar in Gestalt einer winzigen jadegrünen Spinne mit nur einem einzigen, melancholisch dreinblickenden Auge, die in ihren Gehirngängen einen endlosen, dünnen und vielfarbigen Faden zu einem allgegenwärtigen und immer dichter werdenden Netz der Erinnerung verknüpfte. Ein über die Maßen kunstvolles und raffiniert gesponnenes Netz war das, mit zahllosen Strängen und Querverbindungen, in dem sich letztendlich jeder gute Gedanke, jeder brauchbare Geistesblitz und jede geniale Idee verfangen mussten, um auf ewig ihr Eigentum zu sein. Ihr Gehirn war ihre ganz private Schatzkammer, gefüllt mit Kostbarkeiten, die viel wertvoller waren als all das Gold und Silber in der Schatzkammer des Königs. Und ihre Spinne war die Hüterin all dieser Schätze.
Bei ihren einsamen Wanderungen schwebte die Prinzessin manchmal wie eine Doppelgängerin neben sich her und beobachtete selbstkritisch ihre eigenen Aktivitäten. War ihr Astralleib dabei:
A. vollkommen sichtbar und undurchsichtig,
B. halbwegs sichtbar und durchsichtig oder
C. völlig unsichtbar?
Das war eine furchtbar interessante Frage, die leider niemand beantworten konnte, da zu diesem Zeitpunkt alle anderen Bewohner des königlichen Schlosses bereits zu Bett gegangen waren. Aber obwohl es sie manchmal melancholisch stimmte oder gar wütend machte, gefiel Prinzessin Dylia doch meistens, was sie sah. Sie fand nämlich, dass sie ihr Schicksal mit vorbildlicher Würde ertrug, und das machte sie ein bisschen stolz. Mit Würde, jawohl, und mit … mit … wie war noch mal der Fachbegriff dafür?
Der Begriff stammte aus dieser idiotischen Sportart, bei der sich kräftige Rübenzähler die Fäuste ins Gesicht droschen, um sich gegenseitig zum Umfallen zu bringen: Boxen. Da nannte man das … wie nannte man es noch mal? Genau: Stehvermögen. Ein seltsames Wort. Seltsame Wörter wirkten manchmal erheiternd auf sie. Prinzessin Dylia nahm sich vor, einhundert Mal hintereinander Stehvermögen zu denken, um sich zum Lachen zu bringen. »Und hey!«, dachte sie. »Rücklings im Bett liegend Stehvermögen zu beweisen – das ist doch sogar noch erheblich beeindruckender als aufrecht stehend im Boxring. Oder?«
Schon nachdem sie drei Mal »Stehvermögen« gedacht hatte, musste sie anfangen zu lachen.
Als sie an den Schlafgemächern ihrer Eltern vorbeischlich, die sich bereits in tiefem Schlummer befanden, erinnerte sich Prinzessin Dylia daran, was schon alles versucht worden war, um ihr zu ihrer königlichen Nachtruhe zu verhelfen. Allerdings! Nachdem man hatte einsehen müssen, dass weder die sieben Oberkörperärzte noch die sieben Unterkörperärzte des königlichen Hofes etwas gegen ihre Schlaflosigkeit ausrichten konnten – es halfen weder Pillen noch Pulver, weder Tränke noch Tinkturen, weder Askese noch Absinth –, da hatte der König für seine Tochter siebenhundertsiebenundsiebzig Kopfkissen maßschneidern und maßstopfen lassen, ausschließlich gefüllt mit den feinsten Flaumhärchen von frühreifen florinthischen Faultieren, die in ganz Zamonien als natürliches Schlafmittel galten. Denn dieser famose flauschige Faultierflaum verströmte ein hypnotisches Aroma, das auf dem Gebiet der Schlummerförderung als marktführend galt – noch weit vor dem Chimärischen Chloroform und dem Buchimistischen Betäubungsgas.
Aber die Prinzessin wälzte sich so schlaflos wie eh und je auf den dicken Faultierkissen herum, oder sie warf damit übermütig nach Bediensteten. Dann setzte sie seufzend ihre nächtlichen Streifzüge durch das Schloss fort, nicht ohne eine schnippische Bemerkung in Richtung ihres königlichen Vaters: »Ach, geht mir doch weg mit Eurem Faultierflaum!«
Nachdem dieser väterliche Versuch fehlgeschlagen war, ließ die Königin Mutter von den sieben Hofkerzenziehern siebentausend Duftkerzen aufstellen und entzünden, welche mit beschwichtigenden Kräutern wie Schlummerhopfen, sensillischer Senfsaat und Schnarchbaldrian kräftig aromatisiert wurden. Von deren Ausdünstungen fiel dann auch tatsächlich das halbe Schlosspersonal regelmäßig in ohnmachtähnlichen Schlaf, nicht aber die Prinzessin. Sie setzte nur Nacht für Nacht ihre somnambulen Streifzüge durch das Schloss fort, nicht ohne eine schnippische Bemerkung in Richtung ihrer königlichen Mutter. »Ach, geht mir doch weg mit Eurem Schnarchbaldrian!«
Diese Fehlschläge veranlassten nun die beiden Brüder Dylias, sich auf die Jagd nach dem legendären pechschwarzen Nachtfellbären zu begeben, von dem man in Zamonien glaubte, er bestehe aus purer Müdigkeit, die man auf Flaschen ziehen könne. Angeblich schlief er alle sieben Jahre in den Siebenbergen einen siebenmonatigen Winterschlaf. Letzteres stimmte tatsächlich, was sein Aufstöbern und Erlegen enorm erleichterte. Die Prinzen erschlugen ihn mit schweren Vorschlaghämmern im siebten Monat seines Winterschlafes und kochten aus seinem Kadaver eine deftige, nachtschwarze Suppe, von der sie ihrer Schwester anschließend sieben Liter einflößten. Aber Dylia wurde davon lediglich noch ein bisschen aufgedrehter und improvisierte drei ganze Tage und Nächte derart lautstark auf ihrer Querflöte, dass auch sonst niemand im Schloss ein Auge zubekam.
Auch andere Angehörige des Hofstaates, die nicht zur Familie gehörten, hatten fruchtlose Versuche unternommen, ihre Krankheit und ihre Schlaflosigkeit zu heilen oder wenigstens zu mildern. Höchst seriöse Wissenschaftler und höchst unseriöse Quacksalber hatten mit Baldrianschlafsäcken und Hopfenschlafmützen, viel zu warmen Heizdecken und viel zu kalten Kühlkissen experimentiert, mit halluzinogenen Hypnosependeln, meditativen Metronomen und transzendenten Traummaschinen. Nichts wollte wirken!
Der oberste Hofalchemist hatte wie immer klug taktierend im Hintergrund gewartet, bis alle gescheitert waren, um seine Lösung zu präsentieren. Er schlug eine »ganzheitliche Methode« vor. Sein Plan war, alle Künste und Wissenschaften – und ein paar esoterische Pseudowissenschaften – zu einem alchemistischen Gesamtkunstwerk zusammenzuführen, welches die Prinzessin mit vereinter Kraft in den ersehnten Schlaf wiegen würde.
Der Alchemist ließ dafür zunächst den Hofkapellmeister eine, wie er sie nannte, Morpheusische Schlummeroper komponieren. Für diese durften ausschließlich simpelste Harmonien benutzt werden, welche bereits in populären Schlafliedern Verwendung gefunden hatten. Sie wurden vom königlichen Hofchor und dem Hoforchester intoniert. Dabei kamen ein Dutzend Harfen und hundert Zupfgeigen zum Einsatz.
Die Liedtexte, welche die sieben königlichen Hofdichter dafür verfassen mussten, waren von ausgesucht nervenschonendem, harmlosem und einschläferndem Inhalt. Diese Opernmusik wurde vom obersten Hofalchemisten persönlich auf einem eigens für diesen Anlass ersonnenen und gebauten Tasteninstrument begleitet, das er, nicht besonders einfallsreich, Traumonium getauft hatte. Es handelte sich dabei aber nicht um ein Musikinstrument. Das Traumonium konnte alchemistische Duftakkorde aus beruhigenden Aromen wie Baldrian, Lavendel, Anis, Geranie, Melisse, Bergamotte, Sandelholz oder Jasmin erzeugen, und zwar vermittels ätherischer Dämpfe, die über eine Art Orgelpfeifen abgesondert wurden.
Zu dieser Musik- und Duftberieselung führten vom obersten Hofalchemisten dressierte Riesenschildkröten ein quälend langweiliges, doch hypnotisches Ballett auf: Die Kröten, deren Panzer mit Blattgold und Bernstein üppig verziert und mit brennenden Kerzen bestückt waren, krochen aufreizend langsam im Kreis herum und verteilten so ein leicht bewegtes, goldorangenes Licht über den Raum. Und tatsächlich befand sich bald die gesamte Schlossbevölkerung in friedlichem Schlummer.
Mit Ausnahme der Prinzessin natürlich. Sie konnte sich nicht daran erinnern, jemals so aufgekratzt und unternehmungslustig, so wach und lebendig gewesen zu sein wie nach dieser Inszenierung. Die kostete den obersten Hofalchemisten letztendlich nicht nur seinen Job und seine Alchemistenlizenz, sondern brachte ihm auch eine Steuernachzahlung in dreifacher Höhe seines Privatvermögens ein.
Da sah auch der Letzte ein, dass weder Chemie noch Alchemie, weder Musik noch Duftkerzen, weder Nachtfellbärensuppe noch Schlafopern etwas gegen Dylias Ruhelosigkeit ausrichten konnten.
Und so fügten sie sich alle in ihr Schicksal – am widerspruchlosesten die schlaflose Prinzessin selbst. Sie fand, man könne es ja durchaus auch mal positiv betrachten. Die Schlaflosigkeit brachte ein paar unbestreitbare Vorteile mit sich, das konnte Dylia am besten beurteilen. Zum Beispiel eine geschärfte Wahrnehmung mit allen Sinnen: Nach nur drei Tagen Schlafentzug hörte Prinzessin Dylia bereits das Gras wachsen. Nach vier Tagen konnte sie Musik riechen. Nach sechs Tagen konnte sie die Gefühle eines Pfirsichs ertasten, wenn sie über seine samtige Schale strich. Nach neun Tagen konnte sie Farben schmecken. Und nach elf Tagen schärfte sich ihr Sehvermögen auf so dramatische Weise, dass sie ihre eigenen Hände röntgen konnte. So wäre ihr ohne Schlafentzug auch niemals die Existenz von Zwielichtzwergen aufgefallen!
Secundus
DIE ZWIELICHTIGEN ZWERGE
Prinzessin Dylia konnte sich noch gut an das allererste Mal erinnern, als sie die Existenz der Zwielichtzwerge bemerkt hatte. Sie hatte wieder einmal über eine Woche kein Auge zugetan, als sie frühmorgens auf der Fensterbank ihres Schlafzimmers einige Exemplare dieser kuriosen Gattung wahrnahm. Dabei handelte es sich um zirka daumengroße Wichtel mit regenbogenfarbenen Haaren, deren Körper aus ebenso farbenfrohen, aber komplett durchsichtigen Seifenblasen zu bestehen schienen. Sie sahen so empfindlich und vergänglich aus, dass Prinzessin Dylia befürchtete, sie könnten platzen, wenn sie sie zu intensiv anstarrte. Sie hielten sich vorwiegend in der Nähe der großen Fenster auf, wo sie sich, wie die Prinzessin vermutete, von den letzten beziehungsweise den ersten einfallenden Sonnenlichtstrahlen des Tages ernährten.
Die Prinzessin sah Zwielichtzwerge nämlich nur zu diesen als »magisch« verrufenen Tagesstunden und ausschließlich in der Zeit vom Frühling bis zum Spätsommer. Die Zwielichtzwerge standen, liefen oder torkelten auf den Fensterbänken und Simsen herum, badeten in den Sonnenstrahlen, von denen sie mit offenem Mund zu trinken schienen. Aufgrund ihrer Beschaffenheit waren sie in der Lage, größere Strecken – etwa von Fenstersims zu Fenstersims – zuerst springend und dann schwebend zu bewältigen.
Prinzessin Dylia liebte es, die Zwielichtzwerge dabei zu beobachten, wie sie durch die Luft segelten, tänzerisch begabt wie Ballerinen und flugtauglich wie Pusteblumensamen. Anschließend schrieb und zeichnete sie ihre Notizen und Skizzen – anatomische Zeichnungen der Zwerge, Berechnungen der Flugbahnen und so weiter – in große Hefte, die sie streng chronologisch ordnete.
Es schien sich bei den Zwielichtzwergen um eine nicht besonders ehrgeizige Zwergenrasse zu handeln, denn viel mehr als Sonnenbaden und Lichttrinken taten sie eigentlich nicht. Erst nach einer Weile hatte Prinzessin Dylia bemerkt, dass es zwei Sorten von Zwielichtzwergen zu geben schien: Sonnenaufgangszwielichtzwerge und Sonnenuntergangszwielichtzwerge.
Die Sonnenaufgangszwielichtzwerge waren eher der nervösere, agilere Typus, sie torkelten und tanzten beim Sonnenbad herum, wobei sie zwitschernde und blubbernde Laute von sich gaben. Die Sonnenuntergangszwielichtzwerge waren eher von melancholischem, fast lethargischem Gemüt. Sie lagen und standen meist fast reglos herum und ließen nur gelegentlich ein schwermütig klingendes Glucksen vernehmen.
Aber zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, in der ganzen restlichen Zeit der Tage und Nächte außerhalb der zwielichtigen Stunden, sah sie die Zwerge nie. Die Fensterbänke blieben leer, so oft Prinzessin Dylia dort auch vorbeikam.
Sie überlegte schon seit geraumer Zeit, sich einen der Zwielichtzwerge zu fangen und ein bisschen unter der Folter zu verhören, so wie es die königlichen Folterknechte im Verlies mit Spionen und unwitzigen Hofnarren machten. Aber diesen Gedanken verwarf sie jetzt als unsittlich und unpraktikabel. So etwas gehörte sich einfach nicht. Und sie wusste ja nicht einmal, wie man Zwielichtzwerge effektiv foltert. Dafür bräuchte sie sicher sehr kleine und subtile Werkzeuge, damit die kleinen Kerlchen während des Verhörs nicht platzten.
Dylia wusste sehr gut, warum sie das befürchtete, denn als Kind hatte sie oft genug versucht, Seifenblasen zu fangen. Die waren jedes Mal zwischen ihren kleinen Fingern explodiert. Genauso gut konnte sie versuchen, einen Regenbogen am Boden festzunageln. Und diese Zwerge schienen nicht einmal über eine richtige Sprache zu verfügen, in der man sie verhören könnte. Sie zwitscherten und glucksten ja nur.
Prinzessin Dylia erwog stattdessen, eine Doktorarbeit über ihre Beobachtungen der Zwielichtzwerge zu schreiben. Aber würden die Kerlchen überhaupt genug hergeben, um eine ordentlich gegliederte, wissenschaftliche Arbeit mit vielen Fußnoten, einem Register und allem Drum und Dran zu rechtfertigen? Vor allen Dingen fürchtete sie, dass man sie aufgrund einer solchen Veröffentlichung einer ernsthaften Hirnerkrankung verdächtigen könnte. Denn es bedurfte ja mindestens sieben bis neun Tage und Nächte konsequenten Schlafentzugs, um Zwielichtzwerge überhaupt wahrnehmen zu können. Welcher mögliche Prüfer nahm das auf sich, nur um Prinzessin Dylias Zurechnungsfähigkeit zu überprüfen? Da lag es doch viel näher, sie einfach für verrückt zu erklären. Akademiker und Kopfdoktoren waren ja notorisch bekannt für ihre Denkfaulheit.
Die Prinzessin benötigte nicht viel von ihrer reizbaren Vorstellungskraft, um sich in einer – übrigens sehr eleganten und mit aparten Applikationen versehenen – Zwangsjacke stecken und von grobschlächtigen Pflegern weggeschleppt zu sehen, während sie mit überschnappender Stimme immer wieder rief: »Da! Da sind sie! Die Zwielichtzwerge! Auf der Fensterbank! Sie zwitschern! Sie glucksen! Sie schweben! Seht doch hin, ihr abgestumpften Vollidioten!« Und so weiter.
Nur kurz nachdem Prinzessin Dylia die Zwielichtzwerge gesehen hatte, schrieb sie das erste Gedicht ihres Lebens. Sie schrieb mit Buntstiften jedes Wort in einer anderen Farbe, weil es ihr sonst zu finster war:
ZwielichtisteinschönesLichtImZwielichtsiehtmannämlichnichtWieringsherumdieWeltzerbricht
NebelistauchwunderschönImNebelkannmannichtmehrseh’nWiealleDingeuntergeh’n
AmschönstenistdieDunkelheitImDunkelnsiehtmangarkeinLeidZerträumtsichblinddieEinsamkeit
Von der vierhundertvierundvierzigsten Stufe des vierten Schlossturmes trat Prinzessin Dylia nun hinaus auf einen der vielen Balkone und blickte hinab auf die schlafende Stadt. Heute würde es eine helle und klare Vollmondnacht geben.
Zu den unbestreitbaren Vorzügen des schlaflosen Nachtlebens gehörte auch, dass Dylia ausgiebige Mondlichtbäder nehmen konnte. Ein Mondlichtbad bereitet völlig andere, wesentlich subtilere Genüsse als ein Sonnenlichtbad. Es birgt zunächst den unbestreitbaren gesundheitlichen Vorteil, dass man davon weder einen Sonnenbrand noch tödliche Hautkrankheiten bekommen kann. Die Haut erhält davon auch nicht diese ordinäre Bratwurstbräune notorischer Sonnenanbeter, sondern wird auf eine vornehme Weise immer bleicher, bis sie poliertem Elfenbein oder edlem Porzellan ähnelt.
Das Gehirn schüttet, das wusste die Prinzessin, unter der Bestrahlung von vollem Mondlicht eine körpereigene Droge aus, die von zamonischen Alchemisten Insomnilin genannt wird. Durch die anhaltende Ausschüttung von Insomnilin-Molekülen kann man in einen regelrechten Rausch, die sogenannte Nocturne Melancholie, geraten, der gewöhnlichen Räuschen und Glückszuständen an Subtilität turmhoch überlegen ist. Unter der Wirkung des Insomnilins bleibt man äußerlich völlig gelassen, fast wie in Leichenstarre.
Es ist ein extrem kontrollierter, eleganter und salopper Rausch – als würde man mit Lichtgeschwindigkeit auf einem Teppich aus gesponnenen Traumfäden durch das Universum reisen, dabei aber völlig entspannt in seinem Lieblingssessel sitzen und mit abgespreiztem Finger perfekt temperierten grünen Tee aus einer hauchdünnen Tasse aus florinthischem Porzellan schlürfen. »So oder ähnlich«, dachte Prinzessin Dylia einmal anlässlich einer mittelschweren Mondlichtekstase, die man ihr äußerlich kein bisschen ansehen konnte, »muss sich der Mond auf seiner sonnenbestrahlten Seite fühlen. So erleuchtet! Und dennoch schwermütig. Schwermütig – aber trotzdem unbekümmert. Wie wohl seine Gefühle auf der dunklen Seite sein mögen?«
Bei jeder Mondlichtekstase memorierte die Prinzessin im Stillen die Namen ihrer Lieblingsmondkrater, alphabetisch und nach Farben streng geordnet, denn Ordnung musste für Dylia auch in einem Mondlichtrausch sein: Abenezra, Abul Wafa, Agatharchides, Anaxagoras, Aryabhata, Avogadro,Babakin, Belkovich, Belopolskiy, Bhabha, Bombelli, Bronk,Calippus, Cannizzaro, Capuanus, Celsius, Censorinus, Chaplygin, Chladni, Cleomedes, Crocco, Ctesibius,Daedalus, Dobrovolskiy, Drude, Dubyago,Endymion, Eötvös, Epimenides, Erro, Espin, Evdokimov, Faustini, Feoktistov, Finsen, Flammarion, Fontenelle, Fra Mauro, Frost, Fryxell,Gadomski, Gaudibert, Gemma Frisius, Glazenap, Grotrian, Guthnick,Harkhebi, Harpalus, Hatanaka, Heinsius, Hirayama, Hogg, Hommel, Hypatia,Ibn Battuta, Icarus, lnghirami, Isidorus,Jarvis, Joliot, Jomo,Kao, Karpinskiy, Kekule, Kidinnu, Kreiken, Krishna, Krusenstern,Lagalla, Lebedinskiy, Leeuwenhoek, Longomontanus,Macrobius, Mandelstam, Maskelyne, Maurolycus, Melissa, Messala, Möbius, Montanari,Nagaoka, Naonobu, Nasireddin, Necho, Nobili, Nunn,Oenopides, Oken, Onizuka, Osiris,Pannekoek, Paraskevopoulos, Perepetkin, Philolaus, Piccolomini, Pickering, Pitatus, Poczobutt, Posidonius, Protagoras,Quetelet,Raspletin, Regiomontanus, Respighi, Ricco, Rocca, Rocco,Sacrobosco, Schiaparelli, Schrödinger, Seleucus, Shi Shen, Siedentopf, Siberschlag, Simpelius, Spallanzani, Stiborius, sulpicius Gallus,Theophilus, Theophrastus, Timiryazev, Tsu Chung-Chi, Tycho,Ulugh Beigh,Vashakidze, Vendelinus, Viviani, Volterra, Voskresenskiy,Wan-Hoo, Weierstrass, Whipple, Wurzelbauer,Xenophanes, Xenophon,Yablochkov, Yamamoto, Yoshi,Zasyadko, Zeno, Zhang Yuzhe, Zupu und Zwicky.
Wenn Prinzessin Dylia bei Zwicky angekommen war, schlief sie entweder vor Erschöpfung ein oder sie fing noch mal von vorne an.
Es war die Ruhe der Finsternis, die sie an den Nächten so schätzte. Jene seltene und verhaltene Ruhe, die etwas von der Stille im Wald nach einem Gewitterregen hatte, wenn sich jede lebende Kreatur in ihren Bau oder unter ein Blatt verkroch und totstellte. Kein absoluter Stillstand, nur ein vorübergehendes Verharren des Lebens. Ein nachdenkliches Innehalten, ein allgemeiner Waffenstillstand. Das fand Prinzessin Dylia beruhigend. Es bedeutete nämlich vor allen Dingen die Abwesenheit von überflüssigen Lauten. Tagsüber gab es selbst in ruhigen Phasen dieses ewige und penetrante Dauergeräusch, welches durch das banale und größtenteils völlig überflüssige Geplauder und Geplapper der Bewohner des königlichen Palastes erzeugt wird und das in ihren Ohren klang wie das bedrohliche Summen in einem Bienenstock. All das einmal für ein paar Stunden nicht hören zu müssen, das war das Glück. Es war wie Urlaub von allem Unnötigen. Das war es, was Prinzessin Dylia an den Nächten als so heilsam empfand.
»Heilsam!«, lachte sie laut, als sie jetzt wieder ins Schloss hineinging und die Balkontür hinter sich verriegelte. Sie zog den dünnen Schal um ihren Hals wieder fester. »Ich habe eine unheilbare Krankheit und fasele von der heilsamen Abwesenheit des Unnötigen! So ein Quatsch! Nachts ist es draußen kalt, das ist alles! Ich werde mir einen verdammten Schnupfen holen, wenn ich noch länger in der Kälte herumstehe. Das ist ja wohl das Allerletzte, was ich gebrauchen kann: Krank sein und dann auch noch krank werden.«
Tertius
DIE PFAUENWÖRTER
Auf der sechshundertsechsundsechzigsten Stufe des sechsten Turmes kam es Prinzessin Dylia zu ihrer eigenen Erheiterung in den Sinn, dass sie sich in der letzten Zeit immer öfter darin gefiel, zu wandeln und nicht einfach nur ordinär zu gehen wie jeder andere Schlossbewohner. Aber sie wandelte nicht nur statt zu gehen, sie speiste statt zu essen, sie schöpfte Luft statt zu atmen. Es war schon beinahe zwanghaft geworden, dass die Prinzessin sich für fast all ihre Verrichtungen, selbst die banalsten, eine elegantere Vokabel aussuchte. Sie war nicht böse auf ihren Vater – nein, sie zürnte ihm. Sie war nicht verärgert über das schlechte Wetter wie jeder andere, sondern es dauerte sie, dass der Regen unablässig an ihr Fenster – nein, nicht klopfte, sondern pochte. Die Diener waren heute nicht einfach nur unverschämt wie immer – nein, die Domestiken waren insubordinant. Ihr Hund hyperventilierte statt zu hecheln. Der Essensgeruch zur Mittagszeit war inakzeptabel statt lediglich lästig. Und ihr Wortschatz war ultraformidabel statt nur beeindruckend.
Wie jeden Tag hatte Prinzessin Dylia beim Frühstück genau dreizehn neue Lieblingswörter aus dem Zamonischen Wörterbuch erkoren, deren wichtigste Qualität es war, dass sie ihr bislang unbekannt waren. Ihr größter Ehrgeiz galt dann der Aufgabe, an diesem Tag für jedes einzelne dieser Wörter eine sinnvolle Anwendung zu finden. Sie war ein wenig nervös, dass sie bis zum heutigen Abend noch kein einziges dieser Wörter verwendet hatte und ihr nur noch die bereits angebrochene Nacht verblieb, um ihre selbstgestellte Aufgabe zu lösen.
Prinzessin Dylia nannte diese Vokabeln ihre Pfauenwörter, weil sie so farbig und exotisch und eigentlich überflüssig waren wie jene kuriosen Vögel mit den bunten Federschwänzen in den königlichen Volieren. Genauso extrovertiert und exaltiert und exponiert und … Halt! Dylia musste aufpassen, dass ihre Vorliebe für Vokabeln mit »ex« nicht wieder mit ihr durchging! Nun, die Pfauenwörter verfügten jedenfalls über erheblich mehr Eleganz, Glamour und natürlich auch offen zur Schau getragene Eitelkeit als übliche Wörter. Es waren die Paradiesvögel unter den grauen Alltagsvokabeln.
Die dreizehn Pfauenwörter für den heutigen Tag, die sich die Prinzessin des Morgens zurechtgelegt hatte, memorierte sie nun in alphabetischer Reihenfolge:
1. Abgunst
Eine altmodische Bezeichnung für Neid; nicht zu verwechseln mit Missgunst, da gibt es angeblich einen kleinen, aber feinen Unterschied. Das war kein besonders spektakuläres oder klangvolles Pfauenwort, aber Dylia fand, es sei ein ziemlich interessanter Einstieg für den Tag. Was genau der Unterschied zwischen Missgunst und Abgunst war, das wusste Dylia aber nicht.
2. Contraindikativ
Das bedeutete »nicht empfehlenswert«. Eigentlich ein Begriff aus der Medizin, der hauptsächlich von Ärzten oder Apothekern benutzt wurde, zum Beispiel, wenn man ein gewisses Medikament besser nicht einnehmen sollte: »Bei Ihrer Form von Stuhlgang halte ich Lebertran für contraindikativ. Nehmen Sie lieber Kohletabletten!« Aber Prinzessin Dylia konnte sich auch vorstellen, dass etwa ein gebildeter Spion in einem Dialog mit einem Gegenspion Gebrauch davon machen könnte: »Ich halte es für ziemlich contraindikativ, diese Türklinke zu ergreifen, um vor mir zu fliehen, mein Bester! Denn sie ist mit einem Kontaktgift imprägniert, das sie auf erheblich schmerzhaftere und langwierigere Art töten würde als dieser florinthische Jadeglasdolch in meiner Hand.«
3. Defenestration
Das Hinausstürzen einer Person durch ein Fenster. Das war ein Wort, bei dem Prinzessin Dylia gleich ein lebendiges Bild vor Augen hatte – nicht jedes Wort konnte das von sich behaupten. Und da gab es doch in der zamonischen Geschichte diesen politischen Vorfall, bei dem ein paar Minister von ein paar anderen Ministern aus irgendwelchen Fenstern geworfen worden waren, oder? Na, egal. Es war jedenfalls ein besonders dramatisches und klangvolles Wort, und vielleicht fand die Prinzessin noch irgendeinen unfähigen Minister, den sie aus dem Fenster werfen lassen konnte. Natürlich nur aus einem Fenster im Erdgeschoss.
4. Iktsuarpoken
Das ist die manische Angewohnheit, immer wieder vor die Tür zu gehen, um nachzusehen, ob jemand zu Besuch kommt, obwohl sich garantiert niemand blicken lässt. Der Begriff stammt aus dem Sprachgebrauch der absolut kälteunempfindlichen Bewohner der Frostklippen auf der Halbinsel Würm, die ebenfalls Iktsuarpoken heißen und grundsätzlich niemals Besuch bekommen, weil es in ihren Eishöhlen so unerträglich kalt ist. Dennoch sehnen sie sich nach Gesellschaft und iktsuarpoken daher ziemlich häufig – um nicht zu sagen: andauernd. »Ja«, dachte Prinzessin Dylia mitfühlend, »manchmal kann sogar ein ganzes Volk einsam sein!«
5. Linguamundivagant
Dies sagte man, wenn jemand in sprachlichem Sinne weltläufig, also sozusagen nicht nur mit dem Finger, sondern auch mit der Zunge auf der Landkarte gut unterwegs war. Das gefiel Prinzessin Dylia, die zweiundvierzig Sprachen und Dialekte beherrschte, aber alle außer dem Zamonischen, Altzamonischen und Uraltzamonischen eigentlich nur rudimentär. Immerhin! Sie sprach zum Beispiel Hyundu, Yhollisisch, Nattifftoffisch, Gnälisch, Ullbukti, Ghola-Ghola, Wakkengolsch, Flammboyatisch, Snörö, Akkuku-Akku, Pepperiträisch, Ikktripimpi, Knoothisch und Olaniplahpla. Also durfte sie sich ja wohl auch mit Fug und Recht selber als ein wenig linguamundivagant bezeichnen, oder?
6. Mamihlapinatapaai
Dieser Zungenbrecher stammte aus dem wenig gebräuchlichen Stammesdialekt eines noch weniger bekannten Naturvolkes aus den Hutzenbergen, dessen Name sich nun wirklich niemand merken konnte. Er bedeutete: Stillschweigendes Abkommen zwischen zwei Leuten, die über eine Sache gleich oder ähnlich denken. »Komisch«, überlegte Prinzessin Dylia, »warum nennen sie es nicht einfach Liebe?« Aber Mamihlapinatapaai hatte ihr allein wegen seiner zungenbrecherischen Qualitäten so ausnehmend gut gefallen, dass es mit auf die Liste gekommen war.
7. Niemalsweh
Das ist das Fernweh nach einem Ort, an den man nie gelangen wird, weil er gar nicht oder nur in der Phantasie existiert. Entfernt verwandt mit dem Phantomschmerz. Ich hab noch einen Koffer in El Dorado war ein populärer zamonischer Niemalsweh-Schlager, der sich mit dieser seltenen und seltsamen Sehnsucht beschäftigte. Das Wort gefiel Dylia auch deswegen so ausnehmend gut, weil sie sich ziemlich viele Orte vorstellen konnte, die es nicht gab, zum Beispiel El Dorado.
8. Pisanzapra
So bezeichnete man die Zeit, die man benötigt, um eine Banane zu essen. Jedenfalls auf der winzigen Bananenplantageninsel Pisanza an der südzamonischen Küste, wo Bananen immer noch Pisanzen genannt wurden. Aber bei dem Begriff Pisanzapra ging es eigentlich weniger um den Verzehr dieser nahrhaften Frucht, sondern darum, etwas zu bezeichnen, das erstens leicht und zügig zu erledigen war und dabei zweitens auch noch Genuss bereitete. »Das war ja pisanzapra!«, sagte man zum Beispiel, wenn man gerade auf die Schnelle eine Banane gegessen hatte. Prinzessin Dylia aß sehr gerne Bananen, besonders um anschließend den Hofnarren auf der Schale ausrutschen zu sehen. »Es ist eigentlich ein sehr primitiver Scherz«, sagte sie sich gelegentlich nicht ohne Schamgefühl. »Aber er wirkt jedes Mal.« Leider hatte sich im Verlauf des Tages keine Gelegenheit gefunden, das eine oder andere pisanzapra1 zu benutzen. Ob die Nacht noch eine Möglichkeit bot?
9. Quoggonophobie
Das war die chronische Furcht, sehr kleinen Kreaturen aus Versehen etwas zuleide zu tun. Sie war verbreitet bei besonders zartbesaiteten Zeitgenossen, die befürchteten, durch rücksichts- oder achtloses Gehen auf einen Quoggozwerg (eine besonders kleinwüchsige Zwergensorte) zu treten und ihn dadurch zu verletzen oder gar zu töten. Das ist eine eigentlich ziemlich unbegründete Furcht, sagte sich die Prinzessin, weil zamonische Zwerge recht gut selbst auf sich achten können und extrem flink sind. Genauso gut könnte man Angst haben, sich auf eine Stubenfliege oder ein Wiesel zu setzen. Bei Quoggonophobie-Erkrankten, so das Wörterbuch, kann es manchmal zu ernsthaften Problemen im Sozialverhalten, zu Gehstörungen und sogar zu vollkommener Bewegungsstarre kommen.
Prinzessin Dylia überlegte jetzt, ob ihr Zurückschrecken vor der Idee, einen Zwielichtzwerg zu foltern, bereits ein Anzeichen von beginnender Quoggonophobie war, aber sie entschied, dass dies nicht der Fall sei. Es handelt sich dabei um ganz normale Sensibilität, wenn man jemand anderen nicht foltern will, sagte ihr der gesunde Prinzessinnenverstand. Im Gegenteil: Erst wenn man den dringenden Wunsch verspürte, einen Zwerg zu foltern, dann sollte man anfangen, sich Sorgen um seine geistige Gesundheit zu machen.
10. Amygdala
Dies war der zu Recht berüchtigte Teil des Gehirns, der auch Mandelstamm oder Corpus amygdaloideum genannt wurde und verantwortlich war für die Erzeugung des Angstgefühls. Ein, wie Prinzessin Dylia fand, ausgesprochen poetisches und schönes Wort für etwas, das eigentlich die übelste Gegend ihres verzweigten Hirnreiches sein sollte. So nannte man vielleicht Diamanten, Schmetterlinge oder Altenheime, aber doch keinen Ort, an dem sich Übelkeit, Panik, Depression und Apathie zusammengerottet hatten, um ihr Wirtsgebäude mit unangenehmen Emotionen zu terrorisieren. Aber gerade darum war es ja ein vorzügliches Pfauenwort.
11. Schlimazzel
Ein Schlimazzel, das war in der Mundart der fhernhachischen Kürbisbauern jemand, der Pech hat, kurz nachdem er bereits Pech hatte und unmittelbar bevor er schon wieder Pech hat. Er war also ein echter Pechvogel, dem das Unglück an den Hacken haftete. »Das ist eigentlich viel zu einfach«, dachte Prinzessin Dylia. »So brauche ich ja nur unseren Hofnarren zu nennen. Der tritt doch andauernd von einem Fettnäpfchen ins nächste. Schon aus beruflichen Gründen.« Der Hofnarr rutschte zum Beispiel mit voller Absicht auf einer Bananenschale aus, um dann mit dem Gesicht in eine Torte zu fallen – nur, um die Prinzessin aufzuheitern. Es war zwar jetzt weit und breit kein Hofnarr in Sicht, aber vielleicht würde sich noch ein anderer Unglückspilz zeigen, den sie so bezeichnen könnte.
12. Hoyotojokomeshi
Das war Dylias Lieblingspfauenwort des Tages, mit großem Abstand. Denn es bedeutete, einen Baumstamm durch einen Strohhalm zu trinken. Natürlich war das eine Metapher, nämlich dafür, etwas vollkommen Sinnloses, Unerreichbares oder physikalisch völlig Unmögliches zu versuchen, wie etwa einem Einhörnchen Salz aufs Horn zu streuen, um es zu fangen, oder einen Zwielichtzwerg zu foltern. Und eine Gelegenheit zu finden, das Wort hoyotojokomeshi sinnvoll zu benutzen, das war auch ganz schön hoyotojokomeshi – also durchaus nach Prinzessin Dylias Geschmack.
13. Zaminolonimaz
Das war ein Wort, das sich zamonische Alchemisten für ein Element ausgedacht hatten, das aus allen Elementen zugleich bestehen sollte und aus dem alle Elemente hervorgegangen waren – nicht zu verwechseln mit dem Zamomin, dem einzigen Element, das denken kann. Ein völliger Quatsch natürlich, wie so ziemlich alles, was sich zamonische Alchemisten ausgedacht hatten. Aber die Prinzessin liebte die Tatsache, dass es ein Palindrom war, ein Wort, das man von vorne nach hinten genauso lesen konnte wie von hinten nach vorne, wie Rentner oder Kajak. Prinzessin Dylia musste allerdings tadeln, dass das Wort Palindrom selbst kein Palindrom war. Man hätte es doch Mordilidrom nennen können oder so, dann wäre es auch ein Palindrom, aber wenigstens ein richtiges. Aber diese Linguisten waren für ihre Einfallslosigkeit und Denkfaulheit genauso bekannt wie die meisten anderen Akademiker. Alles musste man selber machen!
Als sich Prinzessin Dylia ihre Pfauenwörter des Tages nochmals ansah, fand sie, dass da eine ziemlich imposante Liste zusammengekommen war:
1. Abgunst
2. Contraindikativ
3. Defenestration
4. Iktsuarpoken
5. Linguamundivagant
6. Mamihlapinatapaai
7. Niemalsweh
8. Pisanzapra
9. Quoggonophobie
10. Amygdala
11. Schlimazzel
12. Hoyotojokomeshi
13. Zaminolonimaz
»Wenn der Tag nur halb so farbig wird wie diese Liste«, hatte Dylia am Morgen zufrieden gedacht, »dann wird daneben sogar ein Regenbogen blass aussehen.« Der heutige Tag war bisher zwar noch vergleichsweise farblos geblieben, aber die Prinzessin lebte ja sowieso in der Nacht erst richtig auf. Wenn andere sagten, es sei noch nicht aller Tage Abend, dann hieß es für Dylia vielmehr: Es ist noch nicht aller Nächte Morgen.
Und dann war da auch noch das Oberüberwort. Das war die geheimnisvolle Supervokabel, nach der Prinzessin Dylia schon ewig fahndete. Sie wusste, dass es sich irgendwo, vielleicht sogar in den verschlungenen Gängen ihres eigenen Gehirns befand, aber sie hatte es bis zum heutigen Tag noch nicht gefunden. Sie wusste eigentlich nur, dass es nicht unbedingt ungewöhnlich und glamourös sein musste, und es durfte auch durchaus ein ihr vertrautes Wort sein. Aber es musste eine Vokabel sein, die – mit neuer Bedeutung erfüllt – zu einem echten Zauberwort für sie werden würde.
Quartus
DIE REGENBOGENERFINDUNGEN
Auch wenn ich jetzt bereits zum x-ten Mal die dreihundertdreiunddreißig Stufen des dritten Turmes hinaufgestiegen bin«, dachte Prinzessin Dylia, »dann wird mir doch davon niemals langweilig.« Prinzessin Dylia besaß nämlich die seltene Fähigkeit, sich selbst unter den langweiligsten Bedingungen nicht nur nicht zu langweilen, sondern sogar zu amüsieren. »Bevor mir langweilig wird, würde ich mir neunundneunzig neue Namen für Langeweile ausdenken«, sagte sie trotzig zu sich selbst. Und nur um sich zu beweisen, dass sie dafür nicht einmal den Anlass einer aufkeimenden Langeweile benötigte, fing sie gleich damit an: Ennuyanz, fiel ihr als Erstes ein. Na ja, das klang zwar ganz schön, aber war doch nur ein Synonym. Ein ganz neues Wort sollte es schon sein, wie, öh … Monotonomonomononie. Das war nicht schlecht, aber nicht originell genug. Sie überlegte angestrengt. Pommlonödelfooop? Mit drei Os hinten?
Ja, Pommlonödelfooop klang wunderbar kindisch und albern, aber Langeweile war ja auch ein kindlicher und denkfauler Zustand, der darin seine klangliche Entsprechung fand. Und jetzt vielleicht ein Wort mit weniger verschiedenen Buchstaben, die dafür aber ganz oft wiederholt wurden? Wie Mömöömömöömmömöö? Oder Bllbllbllbbllbll?
Letzteres klang, als würde man trotzig einen Ton produzieren und dabei gleichzeitig mit dem Finger an den Lippen spielen. Das karikierte doch den Geist der Langeweile allerbestens. Also gebongt. Wie könnte man Langeweile noch benennen? Etwas konkreter, bildhafter vielleicht? Wie wäre es mit Eulenstrecken?
Die Eule mit ihrer Schläfrigkeit und dem monotonen Gebuhe könnte durchaus als Symbol für Langeweile durchgehen. Und eine in die Länge gestreckte Eule, das wäre doch Langeweile pur, oder? Aber wie streckte man eine Eule? Auf einer Streckbank vielleicht? Der Scharfrichter besaß eine. Sie stand in seinem Folterkeller bereit für renitente Spione und unfähige Hofnarren. Auf der könnte man …
Aah, da ging die Phantasie wieder einmal mit ihr durch! Man streckte doch keine Eulen! Genauso wenig wie man Zwielichtzwerge folterte. Was dachte sich ihre Phantasie da nur wieder aus?
Die Prinzessin entschied, mit dem Ausdenken von anderen Wörtern für Langeweile erst einmal Schluss zu machen. Und daher blieb es vorläufig bei vier Begriffen: Pommlonödelfooop, Mömöömömöömmömöö, Bllbllbllbbllbll und Eulenstrecken. Das war doch auch schon was. Vielleicht wurde sie ja wieder einmal von der Ennuyanz ereilt, dann könnte sie sich die restlichen fünfundneunzig ausdenken.
Prinzessin Dylia konnte also mit Fug und Recht von sich behaupten, dass ihr niemals langweilig war oder ennuyant zumute. »Von mir aus kann man mich in eine Zelle sperren, man könnte mir die Ohren verstopfen, mich knebeln und mir einen Sack über den Kopf stülpen. Man könnte mich derart wehrlos der zähflüssig verrinnenden Zeit ausliefern. Aber ich würde mich nicht eine einzige Minute dabei langweilen. Ich würde mir eine neue Sprache ausdenken, ein paar unlösbare Rätsel lösen oder irgendetwas in Regenbogenfarben erfinden. Meinen Geist kann man weder fesseln noch knechten!«
Und das war nicht einmal geprahlt, besonders das mit den Regenbogenfarben. Langeweile, das war für Prinzessin Dylia etwas, worunter kleine Kinder litten, die noch nicht genug Gehirnmasse entwickelt hatten. Oder Vollidioten, bei denen das mit der Gehirnmasse auch im Erwachsenenalter nicht klappte. Und sie wusste, dass Aristokraten besonders anfällig dafür waren, von quälender Langeweile heimgesucht zu werden, weil sie in Überfluss und Dekadenz lebten. Aber Prinzessin Dylia war die mit Abstand ungelangweilteste Aristokratin von ganz Zamonien.
Deshalb trainierte sie diese kostbare Begabung, die nur wenigen gegeben ist, jeden Tag mit der Ausdauer eines Hochleistungssportlers, um sie ja nicht wieder zu verlieren. Man wusste nie, wann man sie brauchen würde. Denn als Mitglied der königlichen Familie musste sie auch jederzeit damit rechnen, in eine Zelle gesperrt und einen Sack über den Kopf gestülpt zu bekommen. Palastrevolutionen und Tyrannenmorde gehörten nämlich zu den ganz normalen Berufsrisiken, wenn man in Zamonien zu einer Königsfamilie gehörte. Dabei war ihr Vater gar kein Tyrann, bewahre! Sondern ein vergleichsweise gütiger und gerechter König, der sich bei seinem Volk und seiner eigenen Familie durchaus einer gewissen Beliebtheit erfreute. Aber man konnte ja nie wissen.
Prinzessin Dylia konnte sich sogar vorstellen – sie konnte sich nämlich so ziemlich alles vorstellen, selbst diese angeblich unvorstellbar großen Zahlen aus der zamonischen Astronomie –, dass sie einmal eigenhändig eine Palastrevolution anzetteln würde. Nur so zum Spaß und um mal zu sehen, was passierte. Dann würde sie ihren Vater in ein dunkles Verlies sperren und ihm einen Sack über den Kopf stülpen lassen. Nur um sein dummes Gesicht zu sehen, wenn sie ihm den Sack selber wieder abzog und mitteilte, dass alles nur ein Scherz war. »Wie unreif und albern!«, dachte Dylia gleich wieder über ihr Gedankenspiel. »Mit einer Palastrevolution spaßt man nicht. Und man zieht seinem alten Vater keinen Sack über den Kopf. Das ist einer erwachsenen Prinzessin nicht würdig.«
Prinzessin Dylia beschloss auch dieses Mal, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein. In der Zeit, in der sie wach war, während alle anderen schliefen, hatte sie nämlich ihre eigene Erziehungsberechtigte zu sein. Und deswegen war sie strenger und unnachgiebiger mit sich selbst, als es ein autoritärer Hauslehrer, eine verknöcherte Klavierlehrerin und ein florinthischer Kampfsporttrainer gemeinsam hätten sein können.
Prinzessin Dylia wusste, dass sie die wohlerzogenste Tochter von ganz Zamonien war. Aber der Gedanke an das dumme Gesicht ihres Vaters, wenn sie ihm im Verlies den Sack wieder vom Kopf zog, gefiel ihr eine ganze Weile so vorzüglich, dass es ziemlich lange dauerte, bis sie ihn endlich verdrängt hatte.
Dies war nämlich auch eines ihrer zahlreichen Talente: Prinzessin Dylia konnte außerordentlich gut verdrängen. Zum Beispiel unangenehme Gedanken oder Zwangsvorstellungen, die ihr sinnlos die Laune verdarben – wie etwa an fette Spinnen, Palastrevolutionen oder an den Tod.
Als sie noch klein war, hatte ihr der königliche Hofvorleser einmal eine gruselige Geschichte vorgelesen von einem Dämon, der unter die Bettdecke von jungen Prinzessinnen kroch, um sie von dort aus mit seinem gespenstischen, weißen Gesicht zu erschrecken. Ihre Bettdecke aber, die sie gern bis zum Kinn hochzog, war ihre letzte Bastion gegen solche Vorstellungen aus gruseligen Geschichten.
Dass ausgerechnet unter der schützenden Bettdecke ein Dämon hocken konnte, gefiel ihr ganz und gar nicht. Also verdrängte sie diesen Gedanken mit aller Macht. Und zwar so radikal und erfolgreich, dass sie ihn völlig ausgelöscht hatte, als der königliche Vorleser ihr dieselbe Geschichte zum zweiten Mal vorlas. Also erschrak sie darüber genauso heftig wie beim ersten Mal, um die Sache dann wiederum erfolgreich zu verdrängen – und so weiter und so weiter. Sie lernte dabei nicht nur das Verdrängen, sondern auch, dass dazu mechanische Beharrlichkeit genauso gehört wie körperliche Ausdauer zum Marathonlauf.
Also verdrängte sie jeden Gedanken und jede Erinnerung, die ihr nicht gefielen. Sie verdrängte die Gedanken an ihre Krankheit und ihre Schlaflosigkeit. Außerdem vermied sie jede Sorge über Unvorhersehbares, um Raum zu schaffen für wertvolle Gedanken über die wirklich wichtigen Dinge – wie etwa gehaltvolle Bücher, unsterbliche Melodien, Pfauenwörter oder gelungene Witze des königlichen Hofnarren.
»Ich denke lieber nicht allzu viel über derart unwägbares Zeug wie das Schicksal oder die Zukunft nach«, sagte Prinzessin Dylia zu sich selbst. »Ich halte mich lieber an Sachen, die wägbar sind. Zum Beispiel, wie ich meine Pfauenwörter sinnvoll in den Tagesablauf eingebaut bekomme. Ich werde die lösbaren Probleme bewältigen, statt mir über die unlösbaren den Kopf zu zerbrechen – das ist meine Aufgabe.«
Und das war eine Kunst, die nur sehr wenige Leute so perfekt beherrschten wie Prinzessin Dylia. Diejenigen, die es gar nicht konnten, fristeten in ihren Augen ein kümmerliches und bedauernswertes Dasein in ständiger Sorge um die Zukunft oder die Gesundheit.
Das erschien Dylia ungefähr so sinnvoll, wie sich Sorgen über das Wetter oder die tektonischen Verschiebungen der Erdkruste zu machen. Deshalb hatte sie eine kreative Methode gefunden, um Dingen, die ihr Sorgen bereiten könnten, präventiv den Schrecken zu nehmen. Nämlich indem sie sie einfach anders benannte. Und zwar so radikal anders, dass sie nur noch albern, lächerlich oder völlig kryptisch klangen – statt beeindruckend, beängstigend oder deprimierend.
Bei ihr hießen Kopfschmerzen Schmopfkerzen und eine Magenverstimmung hieß Stagenvermimmung. Ihre Krankheit nannte sie eine Kreithank und Bluthochdruck Druthochbluck. Man sollte es nicht glauben, aber es kommt einem schon halb so schlimm vor, wenn man statt Depressionen nur noch Pissdrenonen hat. Und als Grämine hört sich eine Migräne eher nach einer harmlosen Topfpflanze an als nach einer chronischen Kopferkrankung.
Ihrem Vater empfahl sie, aus einer Staatskrise eine Kraatsstise zu machen und aus einer Steuererklärung eine Kleuererstärung.
Prinzessin Dylia nannte dieses selbsterdachte Verfahren ridikülisierendes Anagrammieren. Sie wollte es sogar schon einmal im ganzen Königreich als Schulfach durchsetzen, aber ihr Vater war strikt dagegen. Dabei war es ein ausgeklügeltes Buchstabenvertauschungsprogramm von verblüffender Wirksamkeit.
Es konnte jedes Schreckenswort in eine Karikatur seiner selbst verwandeln und sogar Krankheiten und Tod den bösen Stachel ziehen. Aus einem lebensbedrohlichen Herzinfarkt machte sie so im Nu einen lustigen Ferzinharkt und aus einem Schlaganfall einen absurden Flaganschall. Aus einem schmerzhaften Bandscheibenvorfall wurde ein Schandbeibenrollfav, aus Blutzucker Zutblucker und aus Brechdurchfall Frechdurchball. Es wurde nicht mehr gestorben, sondern stegorben, es drohte nicht mehr die lebenslängliche Haftstrafe, sondern nur noch die länglichlebense Strafthafe, man war nicht mehr arbeitsunfähig, sondern unbeihartsäfig.
Und jetzt gingen mit Dylia die Anagramme durch. Man kam nicht mehr auf die Intensivstation, sondern auf die Stintansivtitaon. Und was machte es da noch aus, einen Lauf kreislapskol zu erleiden und zu prekieren? Als Dotesdurunke verlor auch jede Todesurkunde ihren Schrecken, selbst wenn Zeberlirrhose oder Sindschwucht die Ursache war. Da konnte sie doch getrost ihr Mestatent machen, denn auf den Hiedfrof kam man so oder so, und zwar in einem Seichenlack. Wenn die Ärzte bei den regelmäßigen medizinischen Untersuchungen wieder mal von Blutfett und Cholesterin schwafelten, würde Dylia jetzt nur noch Flutbett und Le Chosterin hören. Und davon erhöhte sich nun nicht einmal mehr ihr Drutbluck, geschweige denn ihr Spuckerziegel.
»Man sollte sich von Wörtern, die Furcht erregen wollen, einfach nicht zu sehr beeindrucken lassen«, meinte Dylia. »Es sind und bleiben immer nur Zeichen auf Papier.« Für sie waren es alphabetische Ameisen, die man nur ein bisschen durcheinanderscheuchen musste, um ihnen jeden Sinn zu nehmen. Wenn man das begriffen hatte, war man dem Ideal einer entspannten Lebensführung schon erheblich näher gerückt.
Ihre prinzessinnenhafte Ignoranz unangenehmen Dingen gegenüber sei eine Gnade, hatte Prinzessin Dylia einmal irgendwo gehört. Nun ja, das war nicht ganz verkehrt, aber sie wusste es noch etwas besser. Für Ignoranz musste man begabt sein, um sie zur richtigen Zeit einzusetzen. Man benötigte nämlich nicht nur einen exquisiten Geschmack, um etwas Gutes zu bevorzugen, oh nein, sondern auch, um das Falsche zu verschmähen. Ignoranz war also genaugenommen eine Kunst. Die Kunst nämlich, der Realität möglichst weiträumig aus dem Weg zu gehen. Warum zum Beispiel verschlang sie reihenweise Romane und ließ Mathematikbücher in der Ecke liegen, obwohl sie eigentlich gar nichts gegen Algebra hatte? Mit dem Wahrheitsgehalt konnte das wohl nichts zu tun haben, denn da lagen die Mathebücher klar vorn. »Was kann wahrer sein als eine urmathematische Frizzerantialgleichung mit zwölf Unbekannten?«, dachte die Prinzessin.
Aber es gab Dinge auf der Welt, so entschied Dylia, die zwar nicht so wichtig waren wie die Realität und auch nicht so verlässlich wie die Logik, aber dafür waren sie attraktiver. Es gab noch viele andere Adjektive, die sie mit diesen Dingen jenseits der Realität viel eher verband als mit der sogenannten Wirklichkeit, die sie so schrecklich anstrengend und unkultiviert fand. Diese Adjektive hießen
und vor allen Dingen: . Interessant war eines ihrer Lieblingsadjektive.
Wieso fielen ihr solche Adjektive so selten zu Logarithmentafeln, binomischen Formeln und zamonischer Urmathematik ein? Und warum halfen ihr diese unzuverlässigen und unberechenbaren Dinge so gut, sie von den Symptomen ihrer Krankheit abzulenken? Eine Tabelle aus Primzahlen oder eine Steuererklärung schaffte das nämlich nicht. Warum fand sie in einem einzigen guten Witz des Hofnarren mehr Trost als in einer stundenlangen Regierungserklärung des Königs? Das musste sie unbedingt irgendwann einmal ergründen. Oder vielleicht doch besser nicht.
Wenn Prinzessin Dylia einmal so gar nichts einfallen wollte, was sie noch tun könnte, dann erfand sie völlig unpraktische Dinge in Regenbogenfarben. Das war eines ihrer Spezialgebiete geworden, seitdem sie durch die Entdeckung der Zwielichtzwerge diese leidenschaftliche Vorliebe für Regenbogenfarbenes entwickelt hatte. Wie konnte man eigentlich nur eine Lieblingsfarbe haben? Eine einzige Farbe zu favorisieren, wie beschränkt musste man dafür sein? Nein, für Dylia musste schon das ganze Spektrum des Regenbogens abgedeckt werden. Das farbenfrohe Erscheinungsbild der Zwielichtzwerge hatte irgendwie ihren Verstand beeinflusst, das wusste sie – aber was eigentlich genau passiert war, hätte sie nicht erklären können.
Hatten die kleinen verletzlichen Kerlchen außer ihrem Beschützerinstinkt auch ihre Kreativität stimuliert? Das wäre doch möglich! Kurz nachdem sie die bunt schillernden Zwerge entdeckt hatte, hatte sie jedenfalls den regenbogenfarbenen Tornado erfunden, eine Naturkatastrophe, die nichts Verheerenderes anrichten konnte als malerisch regenbogenfarbenen Staub aufzuwirbeln. Das war ihre erste Regenbogenerfindung gewesen.
Nur wenig später hatte sie ernsthaft erwogen, ein Patent für die regenbogenfarbene Schreibfeder anzumelden, welche auf mündlichen Zuruf und ohne jede Tinte in allen Farben des Regenbogens schreiben und zeichnen konnte. Dies war Prinzessin Dylias zweite Regenbogenerfindung, und von da an hatte es kein Halten mehr gegeben.
Bald darauf folgte die Konzeption der spektralspektakulären Wunderkerze, die nicht nur aus regenbogenfarbenem Wachs gezogen werden sollte, sondern nach dem Entzünden des Dochtes auch noch verschwenderisch regenbogenfarbenes Licht spendete.
Der regenbogenfarbene Spätnachmittagstee sollte im Bereich von Erfrischungsgetränken neue Maßstäbe der kulinarischen Farbgestaltung setzen, aber bis auf ein paar hübsche Entwurfszeichnungen kam nicht viel dabei heraus.
Was Prinzessin Dylia nicht davon abhielt, ihrem Oberhofgärtner ernstgemeinte Vorschläge für die Züchtung von regenbogenfarbenen Zitronen zu machen, welche eigens zur standesgemäßen Aromatisierung der erdachten Teesorte vorgesehen waren.
Als sie mit dem regenbogenfarbenen Lippenstift den Kosmetikmarkt erobern wollte, hatte sie die Pläne für regenbogenfarbenen Lidschatten und den regenbogenfarbenen Nagellack bereits im Gepäck.
Aber auch diese aparten Ideen kamen nicht über das Konzeptstadium hinaus, weshalb sich Dylia wieder auf ihr Ausgangsthema »unschädliche, aber hübsch aussehende Naturkatastrophen« besann. Da jedoch regenbogenfarbene Flutwellen auch nicht gerade zu der Sorte von Innovationen gehörten, die technisch ohne Schwierigkeiten umzusetzen waren, schien ihr Ideenvorrat für regenbogenfarbene Erfindungen schließlich erschöpft zu sein.
Ihren letzten Einfall eines regenbogenfarbenen Regenbogens mit Querstreifen statt Längsstreifen hatte sie daher gleich für sich behalten. Prinzessin Dylia wusste durchaus, wann der Bogen – beziehungsweise der Regenbogen – überspannt war.
»Aber«, dachte Dylia, »war es tatsächlich nur ein Zufall, dass mir all diese Ideen kurz nach der Entdeckung der Zwielichtzwerge in den Sinn gekommen sind?« Oder gab es da einen Zusammenhang? Es war jedenfalls kaum zu bestreiten, dass diese Erfindungen nur in ihrer Phantasie existierten, ihre Verwirklichung praktisch ausgeschlossen war und sie keinerlei praktischen Nutzen besaßen, außer auf nahezu kitschige Weise schön zu sein. »Es gibt genügend praktische Erfindungen, die uns keinerlei Trost spenden«, hatte Dylia einmal ihren Brüdern mitgeteilt. »Aber viel zu wenige trostspendende, die überhaupt keinen praktischen Nutzen haben.«
Ihr spendete nun einmal der Gedanke, ein Buch im vielfarbigen Licht einer spektralspektakulären Wunderkerze zu lesen, einen gewissen Trost – völlig egal, wie kitschig das aussehen mochte. Ah, wie sie es hasste, dieses Totschlagargument »Kitsch«, das meist von Leuten im Mund geführt wurde, die zu verbittert geworden waren, um die Schönheit einer Seifenblase überhaupt nur zu erkennen.
Um ihrerseits alle Regenbogenverächter mit Verachtung zu strafen, gab es in der Vorstellung der Prinzessin sogar einen komplett regenbogenfarbenen Planeten. Mochten ihn die Leute getrost geschmacklos oder kitschig oder sonst was finden, das war ihr doch egal! Tatsache war, dass sie diesen Planeten in all seiner Farbenpracht nicht einmal selber schön fand, sondern sogar hässlich, und zwar aus guten Gründen. Er war, ganz im Gegensatz zu all ihren übrigen Regenbogenerfindungen, nämlich alles andere als ein Vergnügen. Schon gar kein Segen. Selbst ihn als notwendiges Übel zu bezeichnen, wäre geschmeichelt gewesen. Nein, er war einfach nur eine Zumutung. Und so hieß er tatsächlich auch.
Quintus
DER KRANKE PLANET
Auf der fünfhundertfünfundfünfzigsten Stufe des fünften Turmes ereilte die Prinzessin ein leichter Schwindel, aber er war gleich wieder vorbei. Das ging nicht immer so glimpflich ab. Wenn sich die Krankheit der Prinzessin mit Schmerzen und Schwindel zeigte, dann fühlte sich das für sie so an, als sei sie von einer unbekannten Macht auf einen Berggipfel eines fremden Planeten versetzt worden. Auf den Planeten mit dem höchsten Berg des Universums, wo die Luft dünner und die Schwerkraft rabiater waren als an jedem anderen Ort. Wo blinde Kräfte brutal an ihrem Körper und an ihrem Geist zerrten und so ihre Kondition und Willenskraft auf die härteste Probe stellten. Jeder kleinste Gang wurde dann zu einer Kletterpartie, zu einer Bergbezwingung mit schwerem Gepäck. Es war ihr, als würde sie in einem Anzug aus Blei einen Gipfel besteigen, während die Atemluft immer dünner und dünner wurde.
Jeder Atemzug war dann ein Klimmzug, jeder Handgriff eine Liegestütze, jeder Schritt eine Kniebeuge. Diesen Gipfel – da gab es keinen bequemen Umweg und keine Abkürzungen – galt es jedes Mal auf neuen Routen zu erklimmen. Und erst wenn sie das wieder einmal geschafft hatte und anschließend zu Kräften kam, erst dann hatte sie es wirklich vollbracht. Und sie fühlte sich jedes Mal doppelt so lebendig wie vor der Besteigung.
Aber vor der Erlösung stand immer die Qual. Keine Besteigung war wie die andere: Mal schien es ihr schwerer, mal ein bisschen leichter zu fallen, aber immer auf überraschende Weise anders. Einmal wurde sie dabei von schlechtem Wetter überrascht, bei anderen Gelegenheiten gab es Lawinenabgänge oder Eisstürme, Meteoritenhagel oder elektrische Gewitter. Denn das Wetter auf diesem verwunschenen Planeten war genauso einfallsreich, verrückt, feindselig und unberechenbar wie ihre Krankheit: Giftnebel und horizontale Tornados, dunkle Gewitterwolken aus purem Eis, die dicht neben oder über ihr gegen die Felswände krachten, klirrend zersplitterten und in dichtem schwarzem Hagel herabregneten. Sandstürme, die aus winzigen giftigen und scharfkantigen Partikeln bestanden, aber niemals aus Sand. Eine grelle, blaue Sonne, die trotz arktischer Kälte ihre Hände und Wangen verbrannte. Immer wieder wurde sie mit langen, spitzen Eiszapfen beworfen und von Lawinen überrollt, aber noch jedes einzelne Mal hatte sie es überstanden.
Mittlerweile war ihr dieser Planet so furchtbar und sinnlos vertraut, dass Prinzessin Dylia ihm einen Namen gegeben hatte. Sie hatte den Planeten feierlich Conatio2 getauft, weil das die altzamonische Vokabel dafür war, wie sie ihn empfand: als eine Zumutung. Da half es auch nur sehr wenig, dass sie sich diesen Planeten in ihrer Lieblingskolorierung vorstellte, nämlich in allen Regenbogenfarben. Manchmal hatte sie auch noch ein paar andere Namen für ihn, die für eine Prinzessin eigentlich überhaupt nicht geeignet waren. Zum Beispiel Mastigia,3 Carnifex4 und verbero.5 Aber auf Altzamonisch konnte sie so was ja machen.
Wenn die Reise zum Planeten Conatio ging, bemerkte Prinzessin Dylia das immer zuerst an ein paar mittlerweile vertraut gewordenen akustischen Halluzinationen, an Schwindelattacken und einem seltsamen Prickeln am Gaumen. Dann schnappte sie sich – was man übrigens bei jeder gefährlichen Expedition als Erstes tun sollte – ihre stets wohlgefüllte umhängbare Wasserflasche, warf alle Pläne für die nächsten Tage über Bord und sich selbst der Länge nach auf ihr Bett, wo sie dann einfach liegenblieb, bis alles wieder vorbei war. Mehr Vorbereitung, Strategie und Taktik gab es nicht, und das war auch schon fast alles, was nötig war.
Manchmal wurde noch der königliche Vorleser herbeizitiert, der ihr aus ihren sieben Lieblingsbüchern vorlesen musste, bis das Schlimmste ausgestanden war. Viel mehr konnte man nicht tun, denn Zuhören war die einzige körperliche Leistung, die für Prinzessin Dylia in dieser Phase nicht mit allergrößter Anstrengung verbunden war.