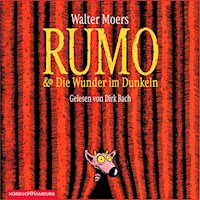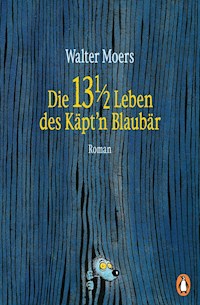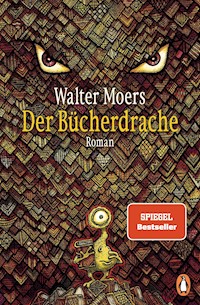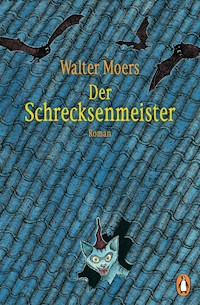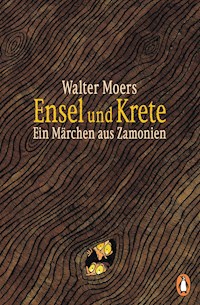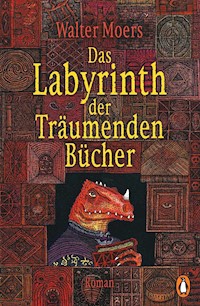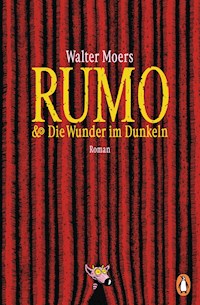
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Selbst die größten Helden haben klein angefangen
Rumo, der junge Wolpertinger aus »Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär«, macht sich selbstständig und geht seinen eignen Weg durch den gefährlichen Kontinent Zamonien. Er folgt dem Silbernen Faden, einer Geruchsspur, die nur er wittern kann und an deren Ende Rumo das Glück vermutet. Auf seiner abenteuerlichen Reise durch zwei höchst unterschiedliche Welten begegnet er Teufelszyklopen und Mondlichtschatten, den Kupfernen Kerlen und den Toten Yetis. Rumo lernt das Kämpfen, die Liebe, die Freundschaft und das Böse kennen, es verschlägt ihn in den geheimnisvollen Nurnenwald, in die legendären Untenwelt und in das Theater der Schönen Tode; er erfährt von den Unvorhandenen Winzlingen, von den Belagerungen der Lindwurmfeste, von Professor Dr. Abdul Nachtigaller und seinem Schubladenorakel – und Rumo findet endlich zu Rala, die ihm die Wunder im Dunkeln zeigt.
Dies ist ein Roman, der im legendären Bücherreich Zamonien spielt. Folgende weitere Zamonienromane sind bislang erschienen:
Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär
Ensel und Krete
Die Stadt der Träumenden Bücher
Der Schrecksenmeister
Das Labyrinth der Träumenden Bücher
Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr
Weihnachten auf der Lindwurmfeste
Der Bücherdrache
Die Insel der Tausend Leuchttürme
Außerdem: Das Einhörnchen, das rückwärts leben wollte: Zwanzig zamonische Flabeln
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1025
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Walter Moers
RUMO& Die Wunder im Dunkeln
Ein Roman in zwei Büchern Illustriert vom Autor
»Rumo & Die Wunder im Dunkeln« erschien erstmals 2003 beim Piper Verlag, München.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2017 beim Albrecht Knaus Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Rainer Wieland
Covergestaltung: bürosüd
Satz und Layout: Oliver Schmitt, Mainz
Illustrationen: Walter Moers
ISBN 978-3-641-22302-1V007
www.penguin-verlag.de
www.zamonien.de
Stellt euch einen Schrank vor!
Ja, einen großen Schrank mit vielen Schubladen, der alle Wunder und Geheimnisse Zamoniens enthält, restlos alle, alphabetisch geordnet. Einen Schrank, schwebend in absoluter Dunkelheit.
Könnt ihr euch das vorstellen?
Gut! Nun seht, wie sich eine dieser Schubladen öffnet!
Die mit dem Buchstaben R.
R wie Rumo.
Und jetzt Schaut hinein! Schaut tief hinein!
Bevor sie sich wieder schließt.
Inhaltsverzeichnis
konnte gut kämpfen.
Aber zu dem Zeitpunkt, an dem seine Geschichte beginnt, hatte er davon noch keine Ahnung, und er wußte auch nicht, daß er ein Wolpertinger war und einmal der größte Held von Zamonien werden sollte. Er hatte weder einen Namen noch die kleinste Erinnerung an seine Eltern. Er wußte nicht, woher er kam und wohin er gehen würde, sondern nur, daß der Bauernhof, auf dem er aufwuchs, sein Königreich war.
Der Herrscher des Bauernhofs
Jeder Morgen begann für Rumo damit, daß sich die ganze Bauernfamilie, eine siebenköpfige Schar von Fhernhachenzwergen, um sein Körbchen versammelte, sich an dem schlafenden Welpen entzückte und ihn mit einem süßen Fhernhachenlied weckte. Anschließend überschütteten sie ihn mit Zärtlichkeiten. Sie kraulten ihn hinter den Ohren, wiegten ihn im Arm, streichelten sein Fell und knuddelten die Wülste in seinem Nacken, was er mit wohligem Grunzen quittierte. Wohin Rumo auf seinen vier unbeholfenen Beinchen auch torkelte, sofort war er das Zentrum der Aufmerksamkeit. Man bejubelte jede seiner Aktivitäten, und man tätschelte und kraulte ihn sogar dafür, daß er über seine eigenen Pfoten stolperte. Für Rumo wurde die frischeste Milch zur Seite gestellt, die knusprigsten Würstchen in der Holzkohle gegrillt, der kühlste Platz im Schatten und der wärmste am Ofen reserviert. Wenn er sein Mittagsschläfchen hielt, ging alles auf Zehenspitzen, und wenn er gähnend daraus erwachte, stärkte man ihn mit warmem Apfelkuchen, Kakao und süßer Sahne. Immer fand sich jemand, der bereit war, mit Rumo zu spielen, zu balgen oder sich von ihm mit seiner zahnlosen Schnauze beißen zu lassen. Abends dann, wenn Rumo sich müde getobt hatte, striegelten sie sein Fell mit weichen Bürsten und sangen ihn in den Schlaf. Ja, Rumo war der heimliche Herrscher des Bauernhofes.
Es gab viele andere Tiere auf dem Hof, Milchkühe, Ackergäule und Sumpfschweine, die alle größer, stärker oder nützlicher waren als Rumo, von denen aber keines eine vergleichbare Beliebtheit genoß. Die einzige Kreatur, die Rumos Alleinherrschaft nicht respektierte, war eine schwarze Gans, die ihn mit ihrem langen Hals um die doppelte Körperlänge überragte und immer gemein zischte, wenn er in ihre Nähe kam. Also ging er ihr so weit wie möglich aus dem Weg.
Der Schmerz
Eines Morgens wurde Rumo in seinem Körbchen nicht vom süßen Gesang der Fhernhachen geweckt, sondern von einem stechenden Schmerz. Er spürte etwas Fremdartiges in seinem Maul. Das Innere seiner Schnauze war für ihn bisher ein schleimiges Feuchtgebiet, in dem die Zunge nur über runde, weiche und glatte Formen glitt – aber jetzt war da etwas Neues, etwas Beunruhigendes. Im oberen Gaumenbereich, nicht weit hinter der Oberlippe, spannte sich das Zahnfleisch: Ein spitzes, höckerförmiges Ding schien darunter zu wachsen und diesen pulsierenden Schmerz zu verursachen, der Rumo überhaupt nicht behagte. Er entschied, seine Unpäßlichkeit einer breiteren Öffentlichkeit mitzuteilen, um entsprechend bedauert und mit Zärtlichkeiten überschüttet zu werden.
Aber es war niemand in der Nähe. Er mußte sich schon zur Scheune bemühen, wo die Fhernhachen zu dieser Zeit meist damit beschäftigt waren, aus für Rumo unerfindlichen Gründen, mit Stroh um sich zu werfen. Der Weg zur Scheune war, das wußte er aus Erfahrung, mit Dornen gepflastert: Quer durch die Küche, über die Veranda mit den gefährlichen Holzsplittern, die Treppe hinab, über den matschigen Hof an der blöden Gans vorbei, um die Tränke herum, wo immer Sumpfschweinkot lag – das war eine anstrengende Strecke, die sich Rumo gewöhnlich von einem der Fhernhachenkinder tragen ließ. Wenn er sich doch bloß nicht auf allen vieren bewegen müßte und dabei immer über seine Beine stolpern würde! Wie schön wäre es, wenn er, wie die Fhernhachen, auf zwei Beinen laufen könnte.
Rumo kletterte aus dem Körbchen, stellte sich auf die Hinterbeine und richtete ächzend seinen Oberkörper auf. Er schwankte einmal nach rechts, einmal nach links und stand dann aufrecht wie ein Zaunpfahl. He! Das war leicht!
Er marschierte vorwärts wie ein ausgewachsener Fhernhache. Stolz erfüllte ihn, eine brandneue und beflügelnde Empfindung. Ohne auch nur ein einziges Mal zu straucheln, stapfte er durch die ganze Küche, stieß die angelehnte Tür auf und schaffte es sogar, die vier Stufen der Verandatreppe hinabzusteigen. Breitbeinig stakste er über den Hof. Die Morgensonne wärmte sein Fell, die Luft war kühl und erfrischend. Rumo atmete tief durch, stemmte die Vorderpfoten in die Hüfte und passierte die schwarze Gans, der er plötzlich an Körpergröße ebenbürtig war. Sie wich zurück, sah ihn verdutzt an und wollte ihm etwas Gemeines hinterherzischeln, aber vor Schreck fehlte ihr die Spucke. Rumo würdigte sie keines Blickes, er schritt einfach unbeirrt voran. Er war so groß und zufrieden wie noch nie in seinem Leben.
Der Silberne Faden
Rumo blieb stehen, um das Sonnenlicht auf seinem Fell zu genießen. Er blinzelte ins blendende Licht und machte die Augen zu, und da war sie wieder, die Welt, die sich ihm immer offenbarte, wenn er die Augen schloß. Es war die Welt der Gerüche, die vor seinem inneren Auge in Hunderten von Farben waberte und wehte: dünne Bahnen aus rotem, gelbem, grünem und blauem Licht, die wirr durcheinanderflatterten. Die grüne Bahn gehörte dem üppigen Rosmarinstrauch, der gleich neben ihm wucherte, die gelbe dem köstlichen Zitronenkuchen, der in der Küche gebacken wurde, die rote dem Rauch des schwelenden Komposthaufens. Blau war die frische Morgenbrise, die den Geruch des nahen Meeres herantrug, und da waren noch viele, viele andere Farben, auch häßliche, schmutzige, wie die braune Fahne des Kotes, in dem sich das Sumpfschwein wälzte. Aber was Rumo wirklich erstaunte, war eine Farbe, die er vorher noch nie gerochen hatte: Hoch oben über all diesen ländlichen Gerüchen wehte ein silbernes Band. Es war dünn und zart, ein Faden eigentlich nur, aber er sah es deutlich mit seinem inneren Auge.
Eine seltsame Unruhe ergriff Rumo, eine unbestimmte Sehnsucht und der bislang nie verspürte Wunsch, alles hinter sich zu lassen und alleine in die Ferne zu ziehen. Er mußte tief Luft holen, und ein Schauer überlief ihn, so mächtig und schön war das Gefühl, das sich in ihm erhob. Auf dem Grunde seines kleinen kindlichen Herzens spürte Rumo: Wenn er diesen Faden zur Richtschnur seines Weges machen und der Witterung bis zu ihrem Ursprung folgen würde, dann erwartete ihn dort das Glück.
Aber zunächst mußte er in die Scheune, um sich zu beschweren. Er öffnete die Augen wieder und marschierte weiter. Als er vor dem großen roten Vorhang stand, der das Sonnenlicht davon abhielt, das Stroh in der Scheune auszutrocknen oder gar in Brand zu setzen, hielt er inne. Ein neues, merkwürdiges Gefühl hatte ihn veranlaßt, seinen Triumphmarsch zu unterbrechen: Seine Knie waren weich geworden, und er mußte gegen den Impuls ankämpfen, sich wieder auf alle viere zu begeben. Das Blut schoß ihm in den Kopf, seine Vorderpfoten zitterten, und der Schweiß trat ihm auf die Stirn.
Rumo wußte nicht, daß der Vorhang einen neuen Abschnitt in seinem Leben markierte, daß er dabei war, sich von seinem tierischen Erbe zu lösen. Er wußte auch nicht, daß man ihn in Zukunft mit ganz anderen Augen betrachten würde, wenn er jetzt auf zwei Beinen durch den Vorhang trat, weil ein aufrecht gehender Wolpertinger mit wesentlich mehr Respekt behandelt wird als ein wilder. Aber Rumo spürte, daß sein Auftritt in der Scheune von Bedeutung war. Sein kleines Herz klopfte wild. Er war verwirrt und eingeschüchtert von der eigenen Courage: Rumo hatte Lampenfieber.
Er machte das, was auch jeder Schauspieler tut, wenn ihn diese Form von Nervosität heimsucht: Er spionierte durch den Vorhang, um zu sehen, was das Publikum treibt. Rumo steckte vorsichtig seinen Kopf durch den Spalt und sah ins Innere der Scheune.
Die einäugigen Riesen
Es war dunkel darin, und seine vom Sonnenschein geblendeten Augen benötigten einen Moment, um sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen. Zuerst erkannte er nur klobige Schatten von Holzgebälk und Strohballen, dazwischen breite Lichtstrahlen, die schräg durch die Scheunenfenster einfielen. Er blinzelte noch einmal und erkannte dann, daß die Vorgänge in der Scheune in keiner Weise seinen Erwartungen entsprachen: Die Fhernhachen waren nicht damit beschäftigt, Stroh in Säcke zu stopfen. Vielmehr waren große, gehörnte, schwarzfellige und einäugige Gestalten damit beschäftigt, die Fhernhachen in Säcke zu stopfen.
Das bekümmerte Rumo aber zunächst wenig. Er war es gewohnt, daß sich in der Welt der Großen täglich Unerklärliches ereignete. Erst vor ein paar Tagen hatte man ein Kamedar auf den Hof gebracht – was für ein Aufstand! Alle waren durcheinandergelaufen wie die Hennen beim Gewitter, und das Kamedar blökte stundenlang, als hätte es den Verstand verloren. Mittlerweile stand es Heu mampfend und angepflockt an einen Freßkoben und war zur langweiligen Alltäglichkeit geworden. Auch die Riesen jagten Rumo keine Angst ein. Auf einem fhernhachischen Bauernhof gab es Lebewesen, die sich, was Häßlichkeit anging, durchaus mit ihnen messen konnten: Der Anblick eines Ornischen Sumpfschweins zum Beispiel war nur zu ertragen, wenn man wußte, wie vorzüglich es schmeckte, wenn man es von seiner Warzenhaut befreit und am Spieß gebraten hatte. Es gab etwas in den Gesichtern der Gehörnten, was sie von der Häßlichkeit von Sumpfschweinen unterschied: die Bosheit, die in ihren Augen funkelte. Dieses Funkeln konnte Rumo nicht deuten, denn dazu fehlte ihm die Erfahrung. Er wußte nicht einmal, was Bosheit überhaupt war. Also trat er in die Scheune. Das Lampenfieber fiel von ihm ab und wich einer eiskalten Ruhe. Rumo wurde zum ersten Mal Zeuge seiner Fähigkeit, in einer angespannten Situation eine beinahe unnatürliche Gelassenheit zu bewahren. Er ging einen Schritt nach vorn und räusperte sich in der Art der Wolpertinger: Er schnaufte zweimal wichtigtuerisch durch die feuchte Nase.
Rumo mußte feststellen, daß sich dennoch niemand um ihn kümmerte. Die Riesen in der Scheune gingen unbeeindruckt ihrer Beschäftigung nach, Fhernhachen in Säcke zu stopfen, und die Fhernhachen stöhnten und wimmerten dazu. Rumo war beleidigt. Man ignorierte ihn – ihn, der auf zwei Beinen gehen konnte. Ihn, der den Schmerz in der Schnauze trug.
Und plötzlich wußte er, was zu tun war: Rumo würde sprechen. Er hatte auf Anhieb laufen gelernt, also würde ihm auch das gelingen. Zwei Sätze wollte er sagen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken:
Erstens: »Ich kann gehen!«
Zweitens: »Meine Schnauze tut weh!«
Dann würden sie ihm schon Beachtung schenken und ihn mit Zuwendung überschütten. Rumo machte den Mund auf, holte tief Luft und sprach zwei Sätze:
»Graa gra raha!«
»Raaha ragra ha gra!«
Das war nicht genau das, was ihm vorgeschwebt hatte, aber es kam aus seinem Mund, klang gut und zeigte Wirkung. Die Schwarzfelligen hörten auf, Fhernhachen in Säcke zu stopfen. Die Fhernhachen hörten auf zu jammern. Alle Augen richteten sich auf Rumo.
Seine Beine wurden plötzlich zittrig und sein Hintern bleischwer. Einen Augenblick rang er noch um das Gleichgewicht, dann kippte er nach hinten und setzte sich in den Staub. Rumo hatte eine neue Erfahrung gesammelt: den ersten großen Fehler seines Lebens gemacht zu haben. Einer der Zyklopen stapfte auf ihn zu, packte ihn bei den Ohren und steckte ihn in einen Sack.
Die Geschichte der Teufelsfelszyklopen
Teufelsfelszyklopen sind eine bösartige Zyklopengattung, die ausschließlich auf den Wandernden Teufelsfelsen beheimatet ist. Es gilt als wissenschaftlich ungenau, sie den Vertretern der zamonischen Piraterie zuzuordnen, da Piraten sich nach exakter Definition ausschließlich auf Schiffen fortbewegen und sich zumindest den Gesetzen der Navigation unterwerfen. Die Teufelsfelszyklopen aber bewegen sich auf einem Erzeugnis der Natur fort, nämlich den legendären Teufelsfelsen, einem schwimmfähigen Gemisch aus Sauerstoff und Mineralien von der Größe eines Häuserblocks, und sie unterwerfen sich überhaupt keinem Gesetz – außer dem der Natur. Sie lassen sich auf ihrem hohlen Felsen von den Gezeiten umhertreiben und verbreiten überall dort Angst und Schrecken, wo der Zufall sie hinspült.
Wenn man einen durchschnittlichen Zamonier fragte, welchem Schicksal er auf keinen Fall anheimfallen möchte, dann war die häufigste Antwort: Gefangener der Teufelsfelszyklopen zu werden. Es gab Kapitäne, die ihr eigenes Schiff versenkten, nur weil sie die Wandernden Teufelsfelsen am Horizont gesichtet hatten. Sie zogen es vor, mitsamt ihrer Mannschaft zu ertrinken, um nicht zur Beute dieser Ungeheuer zu werden. Keine Küstenregion war vor ihnen sicher. Fast jede Stadt, die sich in der Nähe des Meeres befand, wurde im Laufe der Jahrhunderte von ihnen heimgesucht.
Die Wandernden Teufelsfelsen waren ursprünglich ein Riesenbrocken Lava, den ein unterirdischer Vulkan vor vielen tausend Jahren in die Tiefsee erbrochen hatte. Dort erkaltete er und stieg dank des eingeschlossenen Sauerstoffs an die Meeresoberfläche auf. Von der Wasseroberfläche betrachtet, machten sie den Eindruck von vereinzelten steil aufragenden Felseninseln, waren aber, einem Eisberg vergleichbar, ein zusammenhängendes Gebilde, das nur seine Spitzen sehen ließ und dessen größter Teil sich unter Wasser befand. Es war nicht bekannt, wie und wann die Zyklopen diese schwimmende Insel besiedelt hatten, es mußte sich aber, nach den Berichten und Stadtchroniken über Heimsuchungen durch Vandalen zyklopischer Herkunft zu urteilen, schon vor einigen hundert Jahren zugetragen haben. Vermutlich hatte eine Sippe von ihnen den gestrandeten Felsen an der Küste Zamoniens gesichtet, ihn bestiegen und war dann von der Flut überrascht und mit ihm aufs Meer gespült worden.
Anscheinend überließen sich die Zyklopen dem Schicksal und unternahmen keinen Versuch, den Weg ihrer schwimmenden Insel zu beeinflussen. Sie waren zu wenig erfinderisch, um ihr bizarres Gefährt etwa mit Segeln, Rudern oder Ankern auszustatten, und so blieb es den Gezeiten und Meeresströmungen überlassen, zu bestimmen, an welchen unglücklichen Gestaden es landete. Ließ eine günstige Strömung die Zyklopen irgendwo auflaufen, begaben sie sich unverzüglich an Land, überfielen Städte und Dörfer und nahmen Gefangene, bis die Fluten ihre schwimmende Insel mit sich rissen.
Das war – in groben Zügen – die nicht besonders herzerwärmende Geschichte der Teufelsfelszyklopen. Und diesmal waren sie an der Küste von Fhernhachingen gestrandet.
Selbst als Rumo im Sack steckte, ahnte er nichts Böses. Er war es gewohnt, von Lebewesen, die ihm als Riesen erschienen, aus unergründlichen Motiven gepackt und herumgetragen zu werden. Der Sack war nur eine neue Variante.
Echte Sorgen bereiteten ihm seine Zahnschmerzen. Anhaltender Schmerz war etwas, das nicht in sein behagliches Weltbild paßte. Er hatte schon gelegentlich Schmerzen ertragen müssen, aber die waren nie von Dauer gewesen: Ein Sturz auf die Nase, ein Verandasplitter in der Pfote. Dieser neue Schmerz aber war nicht vorübergehend, er wuchs und wurde immer stärker. Mehr noch: An einer anderen Stelle seines Mauls begann eine ähnliche Tortur. Aber dennoch blieb Rumo still und rührte sich kaum.
Zyklopennahrung
Die Zyklopen, die auf den Teufelsfelsen zurückgeblieben waren, hatten schon seit einigen Tagen bemerkt, wie die Wellen an ihrer Behausung zerrten. Es konnte sich nur noch um wenige Stunden handeln, bis sie wieder auf hoher See trieben. Nervös beobachteten sie die Klippen der Landzunge, vor der sie im Schlick steckten. Fast alle Zyklopen waren von ihren Beutezügen zurückgekehrt, nur ein Dutzend fehlte noch.
Ein schauriger Ton, fast wie ein Schrei, drang durch den Nebel, der zwischen Meer und Festland waberte. Es war das Posaunen eines Muschelhorns, und in den Ohren der Zyklopen klang es wie Musik. Endlich: Das versprengte Dutzend kehrte zurück.
Die einäugigen Vandalen erschienen auf den Klippen und hielten triumphierend die prall gefüllten Säcke hoch, in denen, wie sie mit Genugtuung feststellten, die Beute immer noch heftig zappelte.
Beim Versuch, sich das Schlimmste vorzustellen, was ein Lebewesen einem anderen antun kann, kommt man – falls man tatsächlich die Nerven hat, diesen Gedanken zu Ende zu denken – vielleicht zu folgendem Ergebnis: jemanden bei lebendigem Leib aufzufressen. Ein Ornisches Sumpfschwein möglichst schnell und schmerzfrei zu töten, ihm seine häßliche Warzenhaut abzuziehen, es mit Rosmarin zu füllen und an einem Drehspieß zu braten, das war in Ordnung, darauf hatten sich die meisten Zamonier – Vegetarier ausgenommen – geeinigt. Dem Schwein hingegen bei lebendigem Leib das pochende Herz aus dem Leib zu schneiden und zu verschlingen: das war gar nicht in Ordnung, es gab sogar entsprechende Gesetze zu diesem Thema. Natürlich hielten sich nicht alle an diese Gesetze, Wer- und Laubwölfe zum Beispiel, und noch ein paar andere Daseinsformen der unsensibleren Sorte. Wer sich aber mit Abstand am weitesten von der allgemeinen Abmachung, keine lebendigen Wesen zu essen, entfernte, das waren die Teufelsfelszyklopen. Den Einäugigen schmeckte es nur, wenn das, was sie fraßen, sich dabei noch bewegte.
Waren sie auf hoher See, fraßen sie lebenden Fisch. Kaperten sie ein Schiff, dann fraßen sie lebendige Matrosen, Piraten, Passagiere, Kapitäne und noch die letzte Ratte, Kakerlake und Made im Laderaum. Strandeten sie an Land, verspeisten sie lebendige Zamonier. Es spielte dabei kaum eine Rolle, welcher Daseinsform die Beute angehörte, die Zyklopen waren in dieser Hinsicht nicht wählerisch – sie hätten eine Waldspinnenhexe gefressen, wenn sie dabei nur ordentlich zappelte. Die Einäugigen beurteilten die Qualität ihrer Nahrung in erster Linie nach dem Grad ihrer Lebhaftigkeit.
Sie hatten raffinierte Techniken entwickelt, ihre Opfer so aufzufressen, daß diese dabei möglichst lange am Leben blieben. Sie verschonten die lebenswichtigen Organe wie Herz, Hirn, Olgen und Bräse bis zum Schluß, aber die fraßen sie schließlich auch, einschließlich der Fußnägel, Knochen, Schuppen, Augen, Wimpern und Fühler. Besonders wichtig war es für die Zyklopen, die Organe und Innereien, die zur Hervorbringung von Lauten wichtig sind, so lange wie möglich intakt zu halten: Zunge, Kehlkopf, Lungenflügel und Stimmbänder galten als größte Leckerbissen, die man sich für die Krönung des Mahls aufhob. Ein Schrei, ein Stöhnen oder ein Wimmern war wie eine Prise Salz, wie ein Hauch von Knoblauch oder das Aroma eines Lorbeerblatts: Bei den Zyklopen aß nicht nur das Auge mit, sondern auch das Ohr.
Sie unterteilten ihre Nahrung in drei Kategorien: In die unterste, nur in Notlagen akzeptierte, fielen Wesen, die zwar lebten, aber sich kaum bewegten und keine Laute hervorbringen konnten: Miesmuscheln, Austern, Schnecken und Quallen zum Beispiel. Zur mittleren Kategorie zählten Tiere, die zwar nicht schreien, aber dafür ordentlich zappeln konnten: Fische jeder Art, Oktopusse, Hummer, Krabben und Seespinnen. In die obere Kategorie gehörten alle Wesen, die sprechen, schreien, brüllen, quieken, krähen, zwitschern, meckern oder sonstwie Geräusche hervorbringen konnten, deren Ursache Todesangst war. Ob Nattifftoffe oder Biber, Fhernhache oder Wolpertinger, Küstenzwerg, Möwe oder Schimpanse – das war den Zyklopen egal. Hauptsache, die Speise krakeelte auf ihre Art möglichst laut, während man sie fraß.
Hätten die Fhernhachen in ihren Säcken geahnt, welch appetitanregende Wirkung ihr Strampeln und Jammern auf die Zyklopen ausübte, wären sie alle so still geblieben wie Rumo, der sich immer noch fragte, wann das seltsame Spiel, das man mit ihm trieb, sein Ende finden sollte.
Die Speisekammer
Als Rumo schließlich sein muffiges Gefängnis verlassen durfte, fand er es am erstaunlichsten, daß er nicht mehr auf dem Bauernhof war. Er bemerkte zu seiner großen Verwunderung, daß der Boden unter ihm schwankte. Aber er war auch gleich wieder beruhigt, denn seine Familie war komplett versammelt, und auch die riesigen Einäugigen erkannte er wieder. Der Boden schwankte, war uneben und glitschig, und dennoch ging Rumo aufrecht. Aber er begriff nicht, warum niemand davon Kenntnis nahm und ihn dafür lobte. Nicht einmal seine eigenen Leute beachteten ihn – sie benahmen sich überhaupt sehr seltsam. Ihre sonst so freundlichen Gesichter hatten sich in Grimassen verwandelt, und einigen lief ständig Wasser aus den Augen. Rumo fragte sich, wo eigentlich sein Körbchen war. Man war doch nicht etwa ohne sein Körbchen verreist? Nein, das war unmöglich. Er hatte jetzt endgültig genug von dem Spiel, er wollte etwas Ordentliches zu essen, ein Schlaflied und ein kleines Nickerchen.
Die Fhernhachen betrachteten die Ereignisse aus einer anderen Perspektive: Sie kannten die Gerüchte von den Teufelsfelsen, manche von ihnen hatten Großeltern oder andere Verwandte gehabt, die von Zyklopen verschleppt worden waren. Sie wußten, was ihnen bevorstand, wenn nicht ein Wunder geschah.
Für die Zyklopen hingegen war die ganze Angelegenheit weder rätselhaft noch tragisch, sondern einfach erfreulich: Sie füllten gerade ihre Speisekammer. Von einem erfolgreichen Beutezug heimgekehrt, ging es wieder auf wilde See, einem herrlichen und freien Leben entgegen.
Rumo wurde zusammen mit den Fhernhachen in eine große Grotte im Zentrum der Teufelsfelsen getrieben, der für die Zyklopen der schönste Raum ihrer Insel war. Hier bewahrten sie ihre Lebensmittel auf, hier ging man morgens als erstes hin, um sich sein Frühstück zu holen, und abends als letztes, um das Nachtmahl zusammenzustellen. Manche kamen auch mitten in der Nacht, schlaftrunken, aber ganz wild auf einen kleinen ungesunden Mitternachtsimbiß.
An den Wänden der riesigen Höhle waren Ringe eingelassen, an denen die Fhernhachen befestigt wurden, mit Ketten um Hals, Arme oder Beine. In ausgehauenen Gruben im Boden stand hoch das Salzwasser, in dem sich fette Fische und Oktopusse drängelten. In Käfigen saßen wilde Tiere, Luchse, Bären und Löwen. Zahme Haustiere wie Schweine, Hühner oder Kühe liefen frei umher, zurückgehalten durch ein hohes engmaschiges Holzgatter, das die Zyklopen vor die Grotte schoben. In Steinkübeln und Tonkrügen voller Salzwasser krabbelten Hummer und Langusten über- und untereinander, oder es wurden Austern darin gehortet. Wenn es auf den Teufelsfelsen an etwas nicht mangelte, dann an lebendiger Verpflegung.
Eine schlimme Nacht
In dieser Nacht machte Rumo, wie die meisten anderen Gefangenen in der Grotte, kein Auge zu. Der schwankende Boden, die hin- und herschwappenden Wasserpfützen, das Gejammer, Heulen, Winseln, Gackern und Schreien der anwesenden Kreaturen – nie zuvor hatte Rumo solch unkomfortable Schlafbedingungen erdulden müssen. Man ließ ihn frei herumlaufen, offenbar zählte man ihn zur Kategorie der harmlosen Haustiere. Am erschütterndsten fand Rumo, daß die Fhernhachen kaum Notiz von ihm nahmen, wenn er sich zwischen sie kuscheln wollte. An die Wand gekettet, weinten sie in einem fort.
Rumo war beleidigt und lief auf der Suche nach anderweitiger Zuneigung in der Höhle umher. Aber überall herrschte eine ähnlich deprimierende Atmosphäre: Niemand wollte mit ihm spielen, jeder war mit sich selbst beschäftigt, allerorten wurde gejammert und geschluchzt.
Schließlich verzog sich Rumo in eine Felsnische von ungefähr einem Meter Durchmesser mit engem Eingang, eine dicke runde Luftblase im Lavagestein, die Schutz vor dem umherspritzenden Wasser versprach. Er rollte sich zusammen und schloß die Augen – aber dadurch empfand er den Seegang nur noch intensiver, also öffnete er die Augen wieder und blieb einfach im Dunkeln liegen, nun auch so traurig und ängstlich wie alle anderen.
Es wurde die längste und schlimmste Nacht in Rumos bisherigem Leben. Alle naselang kam ein Zyklop in die Grotte und holte sich etwas zu essen: ein Huhn, einen Hummer, ein Schwein oder einen Fhernhachen. War es ein Schwein, gab es Gequieke, war es ein Huhn, gab es Gegacker, war es ein Fhernhache, gab es Geschrei – unmöglich, unter solchen Umständen ein Auge zuzutun.
Am lautesten wurde es, als ein Zyklop ausgerechnet Appetit auf einen Löwen bekam. Rumo hatte noch nie zuvor einen Löwen gesehen, aber er spürte, daß es sich bei diesem goldmähnigen Wesen im größten Käfig um eine stolze und gefährliche Kreatur handelte. Als der hungrige Zyklop am Käfig hantierte, gab der Löwe Laute von sich, die jeden in der Grotte erschaudern ließen. Es war ein tiefes Grollen, das eher von einer Naturkatastrophe als von einem Lebewesen zu stammen schien, ein Geräusch, von dem man sich, falls man einigermaßen bei Verstand war, so weit wie möglich entfernte. Der Zyklop aber gähnte nur und betrat ohne Zögern den Käfig. Das Grollen ging nun in ein Gebrüll über, das die Wände der Grotte erbeben ließ. Der Zyklop machte eine schnelle Bewegung in Richtung des Löwen und faßte ihm ins Genick. Mit der anderen Hand wickelte er den Schwanz der Riesenkatze um sein Handgelenk, dann warf er sie sich wie einen Kohlensack über die Schulter und stapfte hinaus.
Rumo rollte sich wieder zusammen. Neben dem ständigen Lärm hielt ihn auch der Schmerz in seinem Maul vom Schlafen ab. Zwei neue Stellen, an denen sich das Zahnfleisch spannte, waren hinzugekommen, was ihm fast noch mehr angst machte als die Vorgänge in der Grotte. Die ganze Welt war von einem Tag auf den anderen feindselig geworden – sogar sein eigener Körper wandte sich gegen ihn. Er winselte noch ein bißchen, und jetzt kullerten sogar ihm ein paar Tränen aus den Augen. Erst am frühen Morgen fiel Rumo in einen kurzen unruhigen Schlaf voller wilder Albträume.
Frühstück
Als Rumo erwachte, stellte er zunächst fest, daß der Boden nicht mehr so sehr schwankte. Sein Fell war naß vom herabtropfenden Wasser. Er mußte dringend seine Blase erleichtern, was er außerhalb der Felshöhle, die er zu seinem neuen Heim erklärt hatte, erledigte. Dann nahm er einen Kontrollgang vor, um zu überprüfen, ob sich die Dinge zum Besseren gewendet hatten. Vielleicht wollte jetzt jemand mit ihm spielen.
Auf den ersten Blick sah es nicht danach aus. Es herrschte gerade Frühstückszeit, schlechtgelaunte Zyklopen stapften grunzend durch die Grotte und wählten die Zutaten für die erste Mahlzeit des Tages aus. Die meisten bevorzugten Schweine zum Frühstück, das Quieken war ohrenbetäubend. Ein Zyklop hatte sich für Oktopus entschieden. Er fischte einen gewaltigen achtarmigen Tintenfisch aus einem Becken und geriet sofort mit ihm in eine Auseinandersetzung, sehr zur Belustigung seiner Kumpane. Der Oktopus schlang seine Arme um den Körper des Einäugigen, um dessen Beine und Hals, überall sogen sich die Saugnäpfe schmatzend fest. Der Zyklop geriet ins Wanken, stolperte und stürzte zu Boden, während seine Kollegen den Kopf in den Nacken warfen und gurgelnde Geräusche von sich gaben – nun wußte Rumo, wie Zyklopen lachen. Schwerfällig erhob sich der gestürzte Riese, packte einen der Tintenfischarme und riß ihn kurzerhand ab. Der Oktopus lockerte seinen Griff, aber für Demutsgesten war es zu spät. Der Zyklop nahm drei Arme des Tintenfischs auf einmal in beide Fäuste und schleuderte ihn in der Art eines Hammerwerfers um sich herum. Dann klatschte er ihn an die Grottenwand, wo er zerplatzte wie ein Tintenfaß und seine schwarze Flüssigkeit über alle verteilte, die das Pech hatten, sich in der Nähe zu befinden. Rumo mußte sich übergeben.
Nachdem die Zyklopen endlich ihre Speisekammer verlassen hatten, begab sich Rumo auf zitternden Beinen zu einer Wasserpfütze, um seinen Mund auszuspülen. Er war so eingeschüchtert, daß er wieder dazu übergegangen war, auf allen vieren zu gehen – es erschien ihm sicherer. Das Wasser war lauwarm, salzig und schmeckte nach Fisch. Beinahe hätte sich Rumo zum zweiten Mal übergeben, da bemerkte er etwas Erfreuliches: An einer Stelle seiner Schnauze hatte der Schmerz aufgehört. Statt dessen war da jetzt ein spitzes glattes Gewächs, das sich fremd und seltsam, aber irgendwie gut anfühlte, als er es mit seiner Zunge erkundete. Die anderen Stellen schmerzten noch, aber nachdem sich die eine in etwas so Schönes verwandelt hatte, beunruhigten sie Rumo nicht mehr so sehr.
Jetzt war auch er hungrig. Er fand einen Trog mit klebrigem Brei und fraß etwas davon, zunächst widerwillig, dann immer gieriger, als er merkte, daß das hohle Gefühl in seinem Magen verschwand. Dann kroch er wieder zurück in seine winzige Höhle, um seinen ersten Zahn einer genauen Inspektion zu unterziehen. Immer wieder betastete Rumo mit seiner Zunge den neuen Besitz in seinem Maul. Er fühlte sich beschenkt.
Von überallher drangen Todesschreie in die Grotte. Die Zyklopen ließen sich Zeit mit ihrem Frühstück, und ein paar von ihnen schmausten offenbar in nächster Nähe der Speisekammer. Die Fhernhachen klammerten sich aneinander, weinten und jammerten, diesmal noch heftiger als zuvor. Rumo bemerkte, daß der Bauer, der seiner Familie als Oberhaupt vorgestanden hatte, verschwunden war. Das befremdete ihn aber nicht, denn schon auf dem Bauernhof war er manchmal für mehrere Tage fortgeblieben und dann überraschend wieder zurückgekehrt.
Rumo schnüffelte überall herum. Es fiel ihm schwer, sich an die Gerüche zu gewöhnen, die das Meer hervorbrachte und die so gänzlich anders waren als die des Bauernhofes. Dort hatte alles nach Erde, Kräutern und Leben gerochen, hier witterte er Fisch, Fäulnis und Tod. Um die Käfige mit den wilden Tieren machte er einen weiten Bogen. Unglaublich, wie groß und stark manche von ihnen werden konnten! Ein roter Gorilla. Ein zweiköpfiger Wildhund. Ein weiterer Löwe, dem ein Auge fehlte. Ein riesiger Eisbär mit blutbeflecktem Fell. Diese Tiere jagten Rumo Furcht ein, aber er zollte ihnen auch Bewunderung.
Die schwarzen Becken
Wirklich unheimlich aber waren Rumo die schwarzen Becken. Das waren acht runde Tümpel in einer Nebenhöhle der Grotte, die fast alle mit dunklem Wasser gefüllt waren. Die Färbung des Wassers kam von den Tintenfischen, die sich neben anderen Meeresbewohnern darin befanden und in ihrer Furcht immer wieder schwarze Tintenwolken absonderten. Aus dem brackigen Wasser ragten abwechselnd glitschige Fangarme, spitze Hörner, schwarze Rückenflossen und Tentakel mit leuchtenden Augen, und aus einem stieg ein klagender Singsang empor. In der Nacht hatte Rumo beobachtet, wie sich eine neugierige Ziege sehr nahe an einen der Tümpel herangewagt hatte. Plötzlich war ein gelber Arm mit dicken Saugnäpfen aus der schwarzen Brühe geschossen, hatte sich blitzschnell um den Hals des Tieres gewickelt, und noch bevor die Ziege einmal meckern konnte, war sie mit einem tiefen Gluckser verschwunden. Seitdem bewahrte Rumo zu den Tümpeln respektvollen Abstand.
Drei von den künstlichen Becken schienen Tiere zu enthalten, die sich die Zyklopen als eiserne Ration für schlechte Zeiten aufbewahrten. Selbst ihnen schien es vor diesen Geschöpfen zu grausen, sie machten einen weiten Bogen um diese Tümpel. Das Wasser in ihnen war klarer, denn sie enthielten keine Tintenfische, und Rumo sah staunend kleine, aber beeindruckende Kreaturen aus einer dunklen Welt, in der es massive Knorpelpanzer und furchteinflößende Gebisse gab. Sie hatten grimmige Gesichter mit trotzig vorgeschobenen Unterkiefern, und ihre Augen glühten und rollten wild in ihren Höhlen, als seien diese Wesen nicht ganz bei Verstand. Manche davon trugen kleine leuchtende Kugeln wie Laternen an langen Fühlern vor sich her. Rumo sah einen durchsichtigen Kugelfisch, wie aus Glas geblasen, mit einem pulsierenden roten Herz in seinem Inneren. Und ein langer dünner Seewurm wechselte unaufhörlich die Farbe, wenn er unter der Wasseroberfläche vorbeischlängelte. Rumo kam immer wieder zurück, um diese Wunder der Tiefsee zu beobachten und ihre rätselhaften Verhaltensweisen zu studieren, weil die faszinierenden Geschöpfe das einzige in der Grotte waren, das ihn wenigstens für Momente seine bedrückende Umgebung vergessen ließ.
Am geheimnisvollsten aber war das letzte Becken, das sich ein wenig abseits von den anderen am Schluß der Höhle befand. Sein Wasser hatte im Gegensatz zu den blauschwarzen Tümpeln eine dunkelgrüne Färbung, war aber genauso undurchsichtig. Rumo fiel auf, daß sich keiner der Zyklopen zu diesem Becken verirrte und auch die freilaufenden Tiere sich davon fernhielten – was wohl hauptsächlich an dem üblen Geruch lag, der davon ausging.
Rumo hätte zu gerne gewußt, welches Wesen sich unter dem öligen Wasserspiegel verbarg. Meistens ragte nur eine große graue Rückenflosse aus der dunklen Brühe, oder man sah unter der Wasseroberfläche ein lauerndes Raubfischauge rollen. Manchmal erhob sich auch ein Rücken aus der Tunke, der an einen großen Fisch oder eine fette Seekuh erinnerte.
Was Rumo besonders zu diesem Becken hinzog, waren feine Schwingungen, die er in der Nacht zuvor empfangen hatte, als er zu schlafen versuchte. Vor seinem inneren Auge hatten sie die Form von kreisförmigen roten Wellen, in deren Zentrum sich der Tümpel mit der Flosse befand. Der kleine Wolpertinger konnte diese Bilder nicht deuten, aber er empfand, daß sie ihm etwas mitteilen wollten, ja, es war fast so, als könnte er riechen, daß die geheimnisvolle versunkene Kreatur Kontakt mit ihm aufnehmen wollte. Vielleicht versuchte sie ihn anzulocken, um ihn zu fangen. Rumo hütete sich, den Signalen zu folgen, und blieb die ganze Nacht im Versteck.
Jetzt aber, wo alle wach waren und allgemeine Betriebsamkeit in der Grotte herrschte, war Rumo mutiger. Er strich eine Weile in der Nähe des Tümpels herum, aber auch nicht so nahe, um irgendeinem glitschigen Saugnapfarm die Gelegenheit zu bieten, ihn in das finstere Wasser zu zerren. Er trippelte auf allen vieren um das Becken. Das Auge unter der Oberfläche rollte hin und her und beobachtete jede von Rumos Bewegungen, und als er zweimal um den Tümpel herumgetänzelt war, erhob sich langsam die Rückenflosse aus dem Wasser. Sie sah aus wie der eiserne Zeiger einer Sonnenuhr und drehte sich Rumos drittem Rundgang folgend einmal um die eigene Achse.
So ging es eine ganze Weile: Mal versank die Flosse, mal tauchte sie wieder auf. Rumo entfernte sich vom Tümpel, kam zurück, lief wieder weg, schnüffelte in der Grotte herum – aber er behielt die ganze Zeit das Becken im Auge. Zwei, die nicht genau wußten, was sie voneinander halten sollten, belauerten sich.
Eine kleine Gruppe von Zyklopen kam in die Speisekammer, um sich einen Nachschlag zum Frühstück zu holen. Rumo versteckte sich immer in seiner Höhle, wenn die Einäugigen die Grotte aufsuchten, also lief er dorthin zurück – um festzustellen, daß sie von der schwarzen Gans besetzt war, demselben Tier, das ihm schon auf dem Bauernhof nichts als Ärger bereitet hatte.
Ein Zyklop scheuchte grölend ein paar Hühner durch die Gegend, während sich die anderen suchend umsahen. Einer erblickte Rumo und stapfte grinsend auf den kleinen Wolpertinger zu. Rumo knurrte die Gans an, um sie zu vertreiben, aber sie fauchte mit herausgestreckter Zunge gefährlich zurück. Der Zyklop blieb unentschlossen neben einer Schar kleiner Ferkel stehen.
Rumo erinnerte sich an einen erprobten Trick. Er erhob sich und stellte sich auf die Hinterbeine, bis er genauso groß war wie die Gans, und dann knurrte er noch einmal, lauter und bedrohlicher als zuvor. Er fletschte sein Zahnfleisch und zeigte der Gans seinen einzigen Zahn. Sie zischte diesmal nicht zurück, sondern watschelte tonlos aus der Höhle, damit Rumo hineinschlüpfen konnte. Verdattert stand sie da und erregte die Aufmerksamkeit des Zyklopen. Er leckte sich die Lippen, mit drei Schritten war er bei ihr und hatte sie schon beim Hals gepackt. »Qua-!« machte sie noch, und das war das letzte, was Rumo von ihr sah und hörte.
Das Auge und die Flosse
Als die Riesen mit der Gans und ein paar Ferkeln verschwunden waren und ein wenig Ruhe eingekehrt war, wagte Rumo, sein Versteck zu verlassen. Wie magnetisch angezogen, begab er sich zum übelriechenden Tümpel mit dem geheimnisvollen Auge in der Tiefe. Er schlich eine Weile in der Nähe herum, äugte immer wieder in das Becken und wartete darauf, daß sich das Wesen darin einmal ganz zeigte. Aber nichts geschah, bis auf die vertrauten Vorgänge: Die Flosse tauchte auf, die Flosse tauchte ab. Das Auge erschien unter der Oberfläche, ein paar Blasen stiegen träge hoch und zerplatzten geräuschvoll.
Schließlich traute Rumo sich noch etwas näher heran, diesmal flach auf dem Bauch. Er robbte zentimeterweise näher, bis er schließlich nur noch einen halben Meter vom Rand entfernt war. Das unbekannte Wesen war vollständig abgetaucht, weder Flosse noch Auge waren zu sehen – nur dicke grüne Blasen, die sich knallend öffneten und beleidigende Gerüche verbreiteten.
Rumo blieb tapfer liegen, schloß die Augen und witterte. Oh ja! Die roten Schwingungen waren enorm stark! Sie schienen im Takt eines mächtigen Herzens zu pulsieren, langsam, gleichmäßig und beruhigend.
Ihm entging dabei, daß sich das Wasser geräuschlos teilte und aus der dunkelgrünen Tunke ein mächtiger grauer Leib emporstieg. Er hatte den Kopf und das Gebiß eines großen Haifisches und den Körper einer abnorm aufgedunsenen Made.
»Hallo«, sprach das Wesen mit brunnentiefer Stimme.
Rumo riß die Augen auf und sprang entsetzt drei, vier Sätze zurück. Dort blieb er stehen, auf allen vieren und so gefährlich blaffend, wie es ein Wolpertingerwelpe vermochte. Das Wesen machte keinerlei Anstalten, das Becken zu verlassen oder gar Rumo anzugreifen. Links und rechts an seinem Madenleib befanden sich sieben kümmerliche Ärmchen, mit denen es in der Luft herumwedelte.
»Komm her«, brummte das Wesen, ruhig und freundlich. »Ich tu’ dir nichts.«
Rumo verstand zwar keines der Worte, aber das sanfte, sonore Murmeln flößte ihm Vertrauen ein. Er blieb dennoch auf Abstand, stellte das Blaffen ein und knurrte nur noch leise.
»Komm her«, sagte die Haifischmade. »Komm einfach her! Ich bin dein Freund.«
»Graa ra graaha«, antwortete Rumo. Er wußte zwar selbst nicht, was das zu bedeuten hatte, verspürte aber das dringende Bedürfnis, etwas zu erwidern.
»Du kannst sprechen? Das wird ja immer besser! Du bist ein Wolpertinger, weißt du das?«
Es war gleichgültig, daß Rumo nicht verstand, was die Riesenmade da sprach – entscheidend war, daß jemand versuchte, mit ihm Kontakt aufzunehmen.
»Wolpertinger«, sagte das Wesen noch einmal und deutete mit vielen Fingern auf Rumo. »Du bist ein Wolpertinger.«
»Wolpagraha«, sagte Rumo.
»Du lernst schnell«, gab die Made zurück und lachte, daß das Wasser im Becken über die Ränder schwappte. »Sag mal ›Smeik‹!« forderte sie Rumo auf.
Rumo stutzte.
»Smeik! Smeik!«
»Gra?«
»Smeik! Sag mal ›Smeik‹!«
»Smei«, sagte Rumo.
»Genau«, lachte die Haifischmade. »Smeik. Volzotan Smeik. Das ist mein Name.«
Volzotan Smeiks Geschichte
Volzotan Smeik war eine Haifischmade und als solche durchaus befähigt, das Wasser zu verlassen und an Land zu leben, aber während seines Aufenthaltes auf den Teufelsfelsen zog er es vor, den Anschein zu erwecken, er sei ein reines Geschöpf des Meeres. Smeik war nach eigener grober Schätzung mindestens fünfhundert Jahre alt und hatte im Laufe seines bisherigen Daseins schon so manche Geschichte über Teufelsfelszyklopen gehört, unter anderem jene, die besagt, daß sie zum Fressen die Landbevölkerung der Wasserfauna vorziehen.
Als die Zyklopen das Piratenschiff kaperten, auf dem sich Volzotan Smeik gerade befand, hatte er unverzüglich einen Trinkwassertank aufgesucht, sich hineingeworfen und mit viel schauspielerischer Hingabe ein stummes und körperlich schwerfälliges Meerestier markiert. Die Zyklopen waren darauf hereingefallen, hatten ihn aber nichtsdestotrotz in die Grotte verschleppt und ihn in einem der Tümpel für Notzeiten eingelagert. Während sie die Piraten innerhalb eines Monats gefressen hatten, blieb Smeik auf wundersame Weise verschont.
Dabei fühlte er sich im feuchten Element eher unwohl. Sicher, er konnte im Wasser atmen, wenn er wollte, aber das war nur das peinliche Erbe seiner schwimmenden Vorfahren, die er verachtete. Am liebsten hätte er diesen Teil seines Stammbaumes einfach verleugnet, in seiner jetzigen Lage jedoch klammerte er sich verzweifelt daran, weil seine Ahnen ihm sozusagen Tag für Tag das Leben retteten. Smeik lebte seit zweieinhalb Jahren in diesem Tümpel auf den Teufelsfelsen, und das war mit Abstand die längste Dienstzeit eines Lebewesens in der Speisekammer. Er hatte genügend Muße gehabt, die Gewohnheiten der Zyklopen zu studieren, zumindest diejenigen, die sie in der Grotte an den Tag legten. Er hatte sich auch ihre grauenhaften Gesänge anhören müssen, ihr dissonantes Getute auf den Muschelhörnern, ihr vollkommen unrhythmisches Getrommel, das nach Smeiks Rechnung etwa alle sechs Monate zu bestimmten Mondphasen begann und dann tagelang anhielt. Dadurch wußte er, wann sie ihre Feste, beziehungsweise ihre Exzesse feierten. Dieses Wissen war lebenswichtig, denn während dieser Anlässe legten die Zyklopen ein Freßverhalten an den Tag, das für jeden in der Grotte das vorzeitige Ende bedeuten konnte. Er hatte mit ansehen müssen, wie mehrere Schiffsbesatzungen, die die Zyklopen gefangen hatten, während dieser Freßräusche binnen kürzester Zeit verschwanden – der ein oder andere Gefangene war vor seinen eigenen Augen verschlungen worden. Denn auf dem Höhepunkt der Feiern war es keine Seltenheit, daß ein berauschter Zyklop in die Höhle gestürmt kam und sein schreiendes Opfer in Anwesenheit seiner entsetzten Leidensgenossen zerriß und verspeiste. Blut schien in dieser Zeit eine Wirkung auf sie zu haben, die nur mit der von hochprozentigem Alkohol zu vergleichen war.
Während dieser Exzesse versank Volzotan Smeik so tief wie möglich in seinem Tümpel und sonderte über seine Talgdrüsen ein Sekret ab, welches das Wasser tiefgrün verfärbte und in eine unappetitliche stinkende Tunke verwandelte, die selbst Zyklopen abstieß. Er haßte es, das zu tun, denn dies erinnerte ihn an eine andere unangenehme Wurzel seines Stammbaums, an deren unterem Ende die urzeitliche Schwefelmade stand, ein Geschöpf, das nur dank seines impertinenten Geruchs in einer Welt voller freßgieriger Saurier überleben konnte. Smeik konnte diesen Gestank selbst kaum ertragen, aber der Zweck heiligte in diesem Fall wirklich die Mittel.
Um in diesen Verhältnissen nicht den Verstand zu verlieren, hatte Smeik sich seine eigene Wahnwelt geschaffen. Er betrachtete seinen Aufenthalt auf den Teufelsfelsen als eine vom Schicksal auferlegte Prüfung, die ihn stählen sollte für seinen weiteren Lebensweg. Er war ein Schwert, dem eine weitere, besonders harte Legierung verpaßt wurde – dieses Bild hielt er sich gerne vor Augen, obwohl es kaum mit seiner körperlichen Erscheinung in Einklang stand. Nichts auf der ganzen Welt war grauenhafter als die anhaltende Furcht, jeden Augenblick bei lebendigem Leibe gefressen zu werden, aber es gab auch nichts, davon war er genauso überzeugt, was einen besser abhärten konnte gegen alle denkbaren Schrecken. Wenn er die Teufelsfelsen überleben würde, redete er sich immer wieder ein, dann hätte der Tod seinen Stachel verloren.
Ein anderes mächtiges Hilfsmittel im Überlebenskampf auf den Teufelsfelsen waren seine Erinnerungen. Smeik lernte erst in der Gefangenschaft die Kostbarkeit vergangener Glücksmomente zu schätzen. Er hatte sich in den Korridoren seines Gehirns eine Kammer eingerichtet, die er immer dann aufsuchte, wenn seine Hoffnung wieder einmal enttäuscht, seine Furcht am größten, seine Verzweiflung übermächtig war. Dies war die Kammer der Erinnerungen.
Wie gerahmte Ölbilder hingen dort die großen und kleinen Momente seines Lebens an den Wänden, eingefroren in der Zeit, und warteten darauf, von ihm in Bewegung gesetzt zu werden. Für jemand anderen als Smeik hätten diese Bilder keine Bedeutung gehabt: Sie zeigten einen Blick über eine trübe Bucht oder die Ansicht eines kleinen Gasthauses in der Abenddämmerung, das in einen Steilhang gebaut war. Ein Schlachtengetümmel. Ein Schachbrett mit einer besonders verzwickten Figurenkonstellation. Einen Schweinebraten, in den sich gerade ein Messer senkt.
Aber wenn Smeik vor eines dieser Bilder trat und ihm seine Aufmerksamkeit widmete, dann schien es sich zu beleben, zu öffnen und ihn förmlich hineinzusaugen. Dann erlebte er diesen kostbaren Teil seiner Erinnerungen wie zum ersten Mal – eine einsame Kunst, die er auf dem Grunde des Tümpels erlernt hatte. Das war kein Denken mehr und noch kein Träumen, es war eine Fähigkeit genau dazwischen, die er ganz unbescheiden Smeiken nannte: nicht die Kunst, sich zu erinnern, sondern die Kunst, die Erinnerung zu leben. Es waren große, dramatische Momente, aber auch kleine, intime, schlichte Erinnerungen, die Smeik je nach Bedarf aktivierte. Plagte ihn der Hunger und die Sehnsucht nach abwechslungsreicherer Speise als den Seetang und das Plankton, das die Zyklopen in sein Becken warfen, dann trat Smeik vor das Bild des kleinen Gasthauses in der Dämmerung. Er hatte dort, vor über hundert Jahren, einen der befriedigendsten kulinarischen Momente seines Lebens gehabt. Man saß im Freien auf einer Terrasse, und man hatte unverstellten Blick auf eine Bucht, die zu dieser Jahreszeit wegen der Feuerquallensaison nachts orange leuchtete. Smeik hatte als Vorspeise einen ganzen Trüffelpilz im Gänselebermantel gebacken, anschließend Gelöschte Feuerqualle auf einem Algenbett, dazu ein Venusmuschelrisotto und Ingwer-Salat in einer mit Zitronengras parfümierten Sahnesauce, und zum Nachtisch gab es fünf Jahre alten Gralsunder Blauschimmel und eine Flasche Blenheimer Rubikon. Der Wein hatte nach Pfirsichblüten geduftet. Dies war eine ziemlich profane Erinnerung, aber Smeik aktivierte dieses Bild öfter als alle anderen.
Nur ein Bild in der Kammer der Erinnerungen war ständig verhängt. Es war besonders groß und von einem schwarzen Tuch bedeckt. Smeik hastete an diesem Bild immer eilig vorbei, aber es war ihm unmöglich, es aus der Kammer zu entfernen.
Andere Erinnerungen waren in Urnen konserviert. Entlang der Wände standen zahlreiche kleine Säulen, und auf ihnen befanden sich Urnen in verschiedenen Farben. Öffnete Smeik eins dieser Gefäße, dann entfaltete sich ein Geruch: der Geruch von frischgefallenem Schnee. Das Aroma des Bücherstaubs, der beim Öffnen eines antiquarischen Buches aufsteigt. Frühlingsregen auf Großstadtpflaster. Lagerfeuer. Ein frischgezogener Weinkorken. Warmes Brot. Milchkaffee.
Jeder dieser Gerüche entzündete in Smeik eine Kettenreaktion von Erinnerungen, denen er sich stundenlang hingeben konnte, und über die er wenigstens eine Zeitlang seine Angst und Verzweiflung vergaß – bis ein Muschelhorntuten oder Gerüttel am Grottengatter ihn wieder in die Wirklichkeit zurückriß.
In diese rauhe Wirklichkeit war nun ein kleiner Wolpertingerwelpe gestolpert, der noch auf allen vieren lief, das Sprechen noch nicht gelernt hatte und sich gelegentlich übergab. Aber Smeik wußte, daß dieser Welpe den Grund verkörperte, für den er die Kammer der Erinnerungen errichtet hatte. Er verkörperte die Hoffnung, die ihn in der Tiefe seines stinkenden Tümpels nicht hatte verzweifeln lassen, er repräsentierte den letzten Wunsch, den er in dieser grausigen Welt noch hatte: den Wunsch, von den Teufelsfelsen gerettet zu werden. Dieser Wunsch, so entschied Volzotan Smeik, brauchte einen Namen, denn worauf man hoffte, das mußte man benennen können. Er überlegte nicht allzulange: Es gab ein zamonisches Kartenspiel, das er besonders schätzte. Die wichtigste Karte darin, die dem Spiel seinen Namen verlieh, wird Rumo genannt. Einen Rumo zu spielen, bedeutete einerseits, das Schicksal herauszufordern und alles – wirklich alles – zu riskieren. Andererseits versprach es die Möglichkeit eines haushohen Sieges. So kam Rumo zu seinem Namen.
Die schlafenden Wörter
»Rumo!« sagte Rumo.
»Genau!« rief Smeik. »Du Rumo – ich Smeik!«
»Du Rumo – ich Smeik!« wiederholte Rumo eifrig.
»Nein, nein«, lachte Smeik. »Du Rumo – ich Smeik!«
»Du Rumo – ich Smeik!« sagte Rumo trotzig und klopfte sich mit der Pfote vor die Brust.
Smeik brachte Rumo das Sprechen bei. Oder besser: Sprechen konnte Rumo ja schon, ihm fehlten nur die richtigen Worte, und die bekam er, indem er einfach am Tümpel saß und der Haifischmade zuhörte. Smeik hatte viel zu erzählen. Zuerst kam es Rumo so vor, als lausche er einem Tier, das wilde rachitische Laute, Gezischel und Gekrächze von sich gab, Töne, die keinen Sinn ergaben – bald aber merkte er, daß manche dieser Geräusche Bilder in ihm weckten, andere erzeugten Gefühle, Angst, Verwirrung oder Heiterkeit. Und dann waren da welche, die seinen Kopf mit geometrischen Formen und abstrakten Mustern füllten.
Der kleine Wolpertinger saugte sich voll wie ein Schwamm mit den merkwürdigen Tönen, die Smeik von sich gab. Bei gewissen Äußerungen erklang plötzlich himmlische Musik in Rumos Ohren, und er empfand ein unerklärliches Glück, das sich in seinem ganzen Körper ausbreitete. Manchmal sah er Dinge, die er gar nicht kennen konnte: eine große schwarze Stadt, in der viele Feuer brannten, Bergmassive voll glitzerndem Schnee. Ein Wüstental, flimmernd in großer Hitze. Dann wieder geriet er in eine Trance, als würde er mit weit geöffneten Augen und wild pochendem Herzen träumen. Er konnte Smeik immer noch im Tümpel schwimmen sehen, mit seinen vierzehn Armen gestikulierend, aber durch Rumos Körper floß ein Strom von Ereignissen, Gefühlen, Ahnungen. Ihm war, als würden die Wörter an tausend Stellen in seinen Kopf dringen, darin explodieren und zu Bildern werden, die sich zu wirren und zusammenhanglosen Szenen gruppierten, die rasch aufeinanderfolgten und sich gegenseitig auslöschten. Es schien, als habe ein riesenhaftes Vermögen, eine uralte Erfahrung in ihm geschlummert und sei nun kraftvoll zum Leben erwacht. Nein, Smeik brachte ihm nicht das Sprechen bei – er rüttelte in Rumo nur die Wörter aus ihrem Schlaf.
»Ja! Ja!« rief Rumo immer wieder. »Erzähl! Erzähl!«
Worte. Bilder. Gefühle. Rumo konnte nicht genug davon bekommen.
Am liebsten erzählte Smeik vom Kämpfen. Es war nicht zu übersehen, daß er selbst kein Kämpfer war, aber über die theoretischen Aspekte des Kampfes wußte er mehr als jeder andere. Er hatte alle Formen aufs gründlichste studiert, den sportlichen Wettkampf und die Schlacht auf dem Feld, das lebensgefährliche Duell mit dem Degen und den Boxkampf mit gepolsterten Fäusten, das Schnellziehen mit Kleinarmbrüsten, den archaischen Keulenkampf der Sumpfbewohner und die schrecklich blutigen Morgensternprügeleien der Blutschinken. Smeik hatte Duelle gesehen, bei denen sich pechbedeckte Kämpfer gegenseitig mit Fackeln in Brand setzten, er hatte, ausgerüstet mit einer Lupe und einem Ameisenzähler, tagelang die ungeheuer verlustreichen Schlachten zwischen verfeindeten Ameisenvölkern beobachtet. Er konnte vom Kämpfen erzählen, daß einem der Schweiß ausbrach und man die Gegner aufeinander losgehen sah und ihre Knochen krachen hörte. Manchmal saß Rumo vor dem Becken wie vor einem Boxring und schlug mit seinen kleinen geballten Pfoten Löcher in die Luft, so sehr nahmen ihn die Erzählungen Smeiks gefangen.
Smeik war Schiedsrichter bei den professionellen Fänggen-Boxkämpfen gewesen und Kriegsberater bei den Nattifftoffischen Kleinkriegen, amtlich lizenzierter Sekundant für Duelle zwischen florinthischen Adligen und Zeitnehmer bei Wolpertinger-Schachturnieren in Buchting. Sein berufliches Spektrum umfaßte unter anderem: Organisator von Hahnenkämpfen, Zahlmeister der Zamonischen Wurmlotterie (wo Ornische Würgewürmer miteinander rangen), Anfeuerer beim Midgarder Zwergenkampf und Croupier in Fort Una, der Stadt des ewigen Glücksspiels. Nein, Smeik war kein Kämpfer, er war ein Spieler. Deswegen studierte er den Kampf, beobachtete die Kämpfer, analysierte Sieg und Niederlage in jeglicher Form. Wer wußte, wie Kämpfe funktionierten, konnte darauf wetten, wie sie ausgingen. Das war Smeiks Leidenschaft, sein Lebensinhalt – diese eine Fähigkeit immer mehr zu vertiefen: zu wissen, wer gewinnt.
»Ich habe einmal zwei Skorpionhydren beim Kampf beobachtet«, begann er einmal unvermittelt, und Rumo horchte auf. Skorpionhydren, dachte der Wolpertinger, und etwas Kleines, Vielbeiniges krabbelte durch seinen Kopf.
»Skorpionhydren sind sehr kleine, aber auch sehr giftige Tiere mit sieben sehr beweglichen Schwänzen, die jeweils einen Giftstachel tragen«, fuhr Smeik fort.
Rumo schüttelte sich.
»Willst du hören, wie der Kampf verlief?«
»Erzähl!« krähte Rumo.
Die Geschichte von den beiden Skorpionhydren
»Es war in einer Wüste, und ich hatte gerade nichts zu tun, also beobachtete ich diese beiden Giftspritzen im Sand und wettete dabei mit mir selbst. Ich setzte auf die kleinere, beweglichere Skorpionhydra. Zuerst tanzten sie nur eine Weile im Sand umeinander, einen steifen, höflichen, respektvollen Tanz, wie zwei Hofschranzen, die vorgeben, sich zu amüsieren. Dann ging es plötzlich zur Sache: Die größere Hydra machte ein Täuschungsmanöver, stieß zu und tötete die kleinere mit einem Hieb. Zack! Aus. Vorbei. Danach verspeiste sie sie. Ich hatte also gegen mich selbst verloren und gleichzeitig gewonnen.«
Rumo warf seine kleine Stirn angestrengt in Falten.
»Aber das Erstaunliche daran geschah danach: Nachdem die siegreiche Hydra ihren Gegner gegessen hatte, stach sie sich den eigenen Giftstachel in den Kopf. Und starb unter furchtbaren Zuckungen.«
»Hoh …«, machte Rumo.
»Jemand hat mir das später erklärt, einer, der mächtig Ahnung von Wüstenskorpionen hatte. Er erklärte mir nämlich, daß die beiden Männchen und Weibchen waren.«
»Männchen und Weibchen?«
»Sie waren ein Paar«, beendete Smeik seine Geschichte, als sei dies eine befriedigende Moral. »Das Wunder der Liebe.«
»Das verstehe ich nicht«, sagte Rumo.
»Ich auch nicht«, seufzte Smeik und versank in seinem Tümpel.
In dieser Nacht lag Rumo lange wach und versuchte, die Worte »Männchen« und »Weibchen« mit Bedeutung zu füllen. Es gelang ihm nicht, und es machte ihm außerdem zu schaffen, daß in seinem Maul an drei verschiedenen Stellen neue Zähne vor dem Durchbruch standen. Vier andere hingegen hatten es schon geschafft, Rumo ließ gerne seine Zunge darübergleiten und erfreute sich an ihrer Glätte, den scharfen Spitzen und Kanten. Bald würde sein Maul voll sein von solchen Zähnen, so wie das des großen weißen Bären im Käfig.
Und dann schlief er doch noch ein. Er träumte, er sei ein Bär, ein Bär mit weißem Fell und silbernen Zähnen. Er befand sich auf der Jagd, er war riesengroß, stark und gefährlich. Er ging auf zwei Beinen und brüllte fürchterlich, während schwarze Schatten in Scharen vor ihm flohen. Der kleine Wolpertinger lachte im Schlaf.
Die fünf Regeln
Rumo bewegte sich mittlerweile etwas sicherer in der Grotte. Es gab fünf Regeln, die ihm Smeik eingeschärft hatte und an die er sich strikt hielt:
Regel Nummer 1: Halte dich fern von den Käfigen mit den wilden Tieren!
Regel Nummer 2: Halte dich fern von den Tümpeln mit den Tentakeln!
Regel Nummer 3: Versuche nie, über das Gatter zu klettern!
Regel Nummer 4: Verkriech dich in deiner Höhle, wenn die Zyklopen kommen!
Regel Nummer 5: Falls du es nicht in deine Höhle schaffst, beweg dich in
Anwesenheit der Zyklopen so wenig wie möglich!
Rumo genoß die größten Freiheiten von allen Gefangenen in der Grotte: Er war weder eingesperrt noch angeleint, weder trug er Ketten, noch mußte er sich im Wasser verstecken. Er bediente sich an allen Futternäpfen und Tränken – außer an denen der wilden Tiere –, er schnüffelte in allen Ecken herum, und er hatte als einziger Freilaufender in der Grotte eine Schlafstelle, die vor den Blicken der Zyklopen geschützt war. Außerdem genoß Rumo das Privileg, zu Volzotan Smeik gehen zu können, um sich etwas erzählen zu lassen, wenn ihn die Furcht zu überwältigen drohte. Besonders dann, wenn sie auf ihren Muschelhörnern und Trommeln randalierten – was in der letzten Zeit immer häufiger der Fall war –, schlich Rumo zu Smeik, um sich von dem beunruhigenden Lärm ablenken zu lassen.
»Erzähl!« kommandierte Rumo dann.
Smeik liebte es, Rumo etwas zu erzählen, denn es trug ihn genauso weit von den Teufelsfelsen fort wie den kleinen Wolpertinger.
»Möchtest du die Geschichte vom Kampf um die Lindwurmfeste hören?« fragte Smeik.
»Kampf!« rief Rumo. »Erzähl!«
Die Geschichte der Lindwurmfeste
Smeik holte so tief Luft, als habe er vor, die Geschichte in einem Atemzug zu erzählen.
»Die Geschichte der Lindwurmfeste ist die älteste Geschichte von Zamonien, vielleicht die älteste Geschichte der Welt«, begann Smeik. »Bist du bereit, die größte und älteste Geschichte Zamoniens zu hören, mein Sohn?«
Rumo nickte.
»Sie ist Milliarden von Jahren alt.« Smeik wedelte dramatisch mit seinen vierzehn Armen.
»Milarden?« Rumo staunte nicht, er ahmte nur das Wort nach.
»Ja, Milliarden! Eine Milliarde sind tausend Millionen Jahre. Und eine Million Jahre sind tausend mal tausend … aber das lernst du alles noch früh genug. Wichtig ist, daß vor Milliarden Jahren ein sehr kleines Tier im Meer entstand: das erste Lebewesen der Welt.«
»Da draußen im Wasser?«
»Ja, da draußen im Meer.«
»Was für ein Tier?«
Smeik dachte angestrengt nach. Der Kleine stellte mittlerweile erstaunliche Zwischenfragen. Was für ein Tier? Irgendwas mit A. Der Name lag ihm auf der Zunge. Amöre? Amöse? Ameise? Blödsinn! War Tier überhaupt die richtige Bezeichnung für das, was er meinte? Smeik war erschüttert. Schließlich hatte er einmal einen dreiwöchigen Kurs in Zamonischer Paläontologie belegt, an der Feierabendakademie von Sundheim. Das war … herrje, das war jetzt schon hundertfünfzig Jahre her!
»Was für ein Tier?«
Smeik konnte sich nicht erinnern. Waren die ersten Lebewesen nicht Zellen gewesen? Die sich dann spalteten und … oder galten Zellen noch nicht als Lebewesen? War es nicht so, daß erst zwei Zellen zusammenkommen mußten, um ein Lebewesen zu ergeben? Das sich dann spaltete oder so ähnlich? Er mußte unbedingt seine Kenntnisse in Paläontologie auffrischen. Und in Biologie. Und überhaupt.
»Das tut nichts zur Sache. Wichtig ist, daß das Tier sehr klein war und, äh, sich spaltete.«
»Sich spaltete?«
»Ja, sich spaltete! Was bist du, ein Papagei?«
»Ein Papagei?«
Smeik wurde bewußt, daß es schon eine Weile her war, daß er eine lange zusammenhängende Geschichte erzählt hatte. Er hatte eindeutig zu weit ausgeholt.
»Also – das Tier spaltete sich, und es wurden andere Tiere aus ihm, sie bekamen Kiefer, sie bekamen Schuppen, sie bekamen Zähne …«
»Chähne!« rief Rumo und entblößte stolz seine Zahnstummel, aber Smeik ließ sich nicht mehr unterbrechen.
» … sie wurden immer größer und dann gingen sie an Land. Das waren die Dinosaurier.« So geht’s doch auch, dachte Smeik. Kurz und schmerzlos.
»Dinosaurier?«
Rumo ging Smeik heute zum ersten Mal etwas auf die Nerven. Bisher hatten ihn seine Zwischenfragen immer belustigt und zu ausführlichen Erklärungen herausgefordert, aber heute wurde seine Geduld auf eine harte Probe gestellt. Das Trommeln hatte wieder angefangen, schon vor Tagen. Ihm war als einzigem hier bewußt, daß in der nächsten Zeit Schreckliches bevorstand. Ereignisse, die das Schicksal aller Lebewesen in der Grotte besiegeln konnten – und dieses Wissen lastete schwer auf ihm. Die Geschichte von der Lindwurmfeste sollte auch ihn selbst ein wenig ablenken, und jetzt quatschte Rumo andauernd dazwischen.
»Ja, Dinosaurier. Oder Drachen. Lindwürmer, wenn du willst. Große, mächtige Echsen. Manche waren nur groß, das waren die Pflanzenfresser. Andere waren gefährlich, das waren die Fleischfresser. Sie hatten riesige Krallen und Gebisse, ihre Haut bestand aus Schuppen und Knorpeln, und manche von ihnen wurden hundert Meter groß. Dinosaurier. Riesige Ungeheuer.«
»Oh«, machte Rumo.
Jetzt habe ich ihn, dachte Smeik. Ungeheuer. Das zieht immer.
»Gut. Die Dinosaurier, diese Ungeheuer, die gingen also an Land, überall auf der Welt. Nur an einem Ort blieben sie im Wasser. Das waren die Dinosaurier vom Loch Loch, dem großen Vulkansee von Dull, am Rande des Dämonengebirges. Im Gegensatz zu den Meeren, die sich weltweit abkühlten, blieb es im Loch Loch gleichbleibend warm, weil es unterirdisch von einem Vulkan beheizt wurde. Außerdem gab es unterhalb des Sees große Höhlen, in denen man geschützt leben konnte. Die Dinosaurier vom Loch Loch dachten sich: Warum sollen wir da draußen rumspazieren, wenn es hier drin so schön warm ist? Und sie blieben im Wasser, während die anderen Dinosaurier das Land eroberten. Dann kam die große Katastrophe!«
»Katastrophe?« Das schrecklich schwere Wort ließ Rumo Schlimmes ahnen.
»Jawohl: Riesige Meteore stürzten aus dem Weltall herab, eine gigantische Wolke aus Staub umhüllte für Millionen von Jahren ganz Zamonien, und alle Dinosaurier starben – nur nicht die im Loch Loch. Sie lebten einfach unter Wasser und in ihren Höhlen weiter, sie paarten sich quer durch alle Dinosaurierrassen und entwickelten größere Gehirne – und erst dann gingen sie an Land.«
Rumo wollte eine Zwischenfrage stellen, das Wort »paaren« betreffend, aber Smeik fuhr schnell fort:
»Tja, da standen die Dinosaurier also an Land herum und hatten keine Ahnung, was sie als nächstes machen sollten. Es war kalt und zugig, der nächste Winter fror sich gerade ins Land, und da war dieser Berg, der sich direkt neben dem Loch Loch erhob. Er war voller Löcher und Höhlen und Tunnel, im Inneren war es windgeschützt und warm, denn er war über die Jahrtausende vom Wasser nebenan aufgeheizt worden wie ein riesiger Kachelofen. Also krochen die Dinosaurier da hinein, jedenfalls die, die durch die Öffnungen paßten, also nicht größer als vier bis fünf Meter waren. Die anderen, die ganz großen, mußten draußen bleiben und erfroren. So war das nun mal.«
»Erfroren«, wisperte Rumo, und ihn fröstelte.
»Das Massiv wimmelte nur so von blinden Steinwürfchen, die sich leicht fangen ließen und nicht übel schmeckten. So überlebten die Saurier den ersten Winter. Zuerst fraßen sie die Steinwürfchen roh, dann schlug eines Tages der Blitz ins Strohlager ein und sie entdeckten das Feuer. Sie lernten grillen und kochen, ab jetzt gab es Steinwürfchen am Spieß und Steinwürfchensuppe, sie verpackten die Würfchen in Lehm und buken sie in Holzkohlenglut, bis sie ganz durch waren, innen saftig und außen … oaahmm …!«
Das Geheul von Muschelhörnern drang von ferne in die Grotte, und die Trommeln setzten wieder mit ihrem nervtötenden Gerumpel ein. Smeik räusperte sich.
»Die Saurier höhlten den Berg weiter aus und machten ihn bewohnbar. Weil es in den Wintern so kalt war und die Saurier das warme Wasser gewohnt waren, fingen sie an, Kleider zu tragen. Zuerst Umhänge aus zusammengenähten Steinwurffellen, dann klauten sie auf den Bauernhöfen in der Umgebung ein paar Schafe und sammelten Wolle, sie erfanden Spinnräder, und sie lernten, aus dem Erz des Berges Eisen zu gewinnen. Naja, kurzum: Die Dinosaurier waren offensichtlich handwerklich begabt und wurden zunehmend intelligenter und zivilisierter. Die Bewohner der umliegenden Gegenden hatten keine Ahnung von Dinosauriern, denn die waren ja längst ausgestorben, also dachten sie, es wären Drachen oder Lindwürmer, sie glaubten, sie könnten Feuer spucken und würden Jungfrauen fressen, haha! Naja, sie hatten jedenfalls einen Mordsrespekt vor ihnen und gaben dem Berg den Namen Die Lindwurmfeste.«
Rumo prägte sich den Namen ein.
»Die Lindwürmer, wie sie sich mittlerweile selbst nannten, pflegten einen distanzierten, aber freundlichen Umgang mit der umliegenden Bevölkerung. Sie räumten mit ein paar abergläubischen Vorurteilen übers Jungfrauenfressen auf, man trieb bescheidenen Handel, tauschte Waren und Lebensmittel, aber niemals ließen sie jemanden in ihren Berg. Den bauten sie immer weiter aus: Sie befestigten die Eingänge, bearbeiteten Felsen, schlugen Treppen ins Gestein