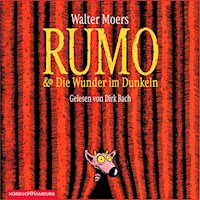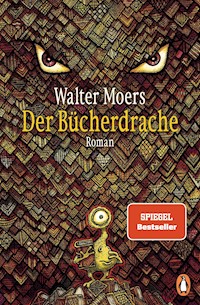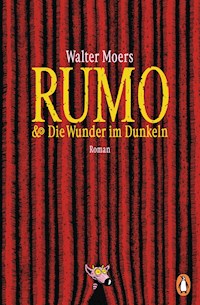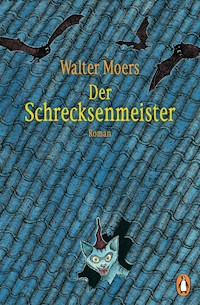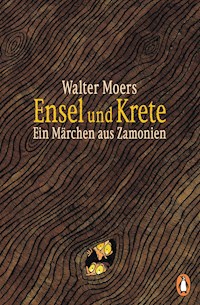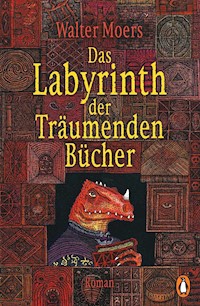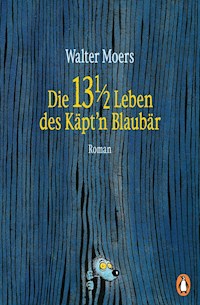
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
»Das Leben ist zu kostbar, um es dem Schicksal zu überlassen.«
»Ein Blaubär hat 27 Leben. Dreizehneinhalb werde ich in diesem Buch preisgeben…«, so beginnt der allererste Roman von Walter Moers. Man schrieb das Jahr 1999, als der berühmte Käpt´n Blaubär seine halbe Lebensgeschichte vorlegte. Darin geht es um Zwergpiraten, Klabautergeister, Waldspinnenhexen, Tratschwellen, Stollentrolle, Finsterbergmaden, eine Berghutze, einen Riesen ohne Kopf, einen Kopf ohne Riese, schlafwandelnde Yetis, einen ewigen Tornado, Rikschadämonen, einen Prinz aus einer anderen Dimension, einen Professor mit sieben Gehirnen, denkenden Sand, eine kulinarische Insel, Kanaldrachen, dramatische Lügenduelle, Nattifftoffen, viereckige Sandstürme, eklige Kakertratten, das Tal der verworfenen Ideen, Horchlöffelchen, Zeitschnecken, Olfaktillen, einen Malmstrom, tödliche Gefahren, ewige Liebe, Rettungen in allerletzter Sekunde – und vieles andere mehr.
Dies ist ein Roman, der im legendären Bücherreich Zamonien spielt. Folgende weitere Zamonienromane sind bislang erschienen:
Ensel und Krete
Rumo & die Wunder im Dunkeln
Die Stadt der Träumenden Bücher
Der Schrecksenmeister
Das Labyrinth der Träumenden Bücher
Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr
Weihnachten auf der Lindwurmfeste
Der Bücherdrache
Die Insel der Tausend Leuchttürme
Außerdem: Das Einhörnchen, das rückwärts leben wollte: Zwanzig zamonische Flabeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 740
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
»Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär« erschien erstmals 1999 in Schwarz-weiß beim Eichborn Verlag, Frankfurt am Main.
Copyright © 2013 beim Albrecht Knaus Verlag,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Käpt’n Blaubär: © WDR mediagroup licensing GmbH
Lektorat: Rainer Wieland
Cover: bürosüd
Layout und Satz: Oliver Schmitt, Mainz
Illustrationen: Walter Moers, koloriert von Florian BiegeISBN: 978-3-641-25522-0V004www.penguin-verlag.de
www.zamonien.de
Vorwort
Ein Blaubär hat siebenundzwanzig Leben. Dreizehneinhalb davon werde ich in diesem Buch preisgeben, über die anderen werde ich schweigen. Ein Bär muß seine dunklen Seiten haben, das macht ihn attraktiv und mysteriös.
Man fragt mich oft, wie es früher war. Dann antworte ich: Früher gab es von allem viel mehr. Ja, es gab Inseln, geheimnisvolle Königreiche und ganze Kontinente, die heute verschwunden sind – überspült von den Wellen, versunken im ewigen Ozean. Denn die Meere steigen immer höher, sehr langsam, aber unerbittlich, bis eines Tages unser ganzer Planet von Wasser bedeckt sein wird – nicht umsonst steht mein Haus auf einer hohen Klippe, und nicht umsonst ist es ein immer noch seetüchtiges Schiff. Von diesen Inseln und Ländern will ich erzählen, und von den Wesen und Wundern, die mit ihnen versunken sind.
Ich müßte lügen (und es ist ja hinlänglich bekannt, daß das nicht meiner Natur entspricht), wenn ich behaupten würde, meine ersten dreizehneinhalb Leben wären ereignislos verlaufen. Ich sage nur: Zwergpiraten. Klabautergeister. Waldspinnenhexen. Tratschwellen. Stollentrolle. Finsterbergmaden. Eine Berghutze. Ein Riese ohne Kopf. Ein Kopf ohne Riese. Wüstengimpel. Eine gefangene Fata Morgana. Schlafwandelnde Yetis. Ein ewiger Tornado. Rikschadämonen. Vampire mit schlechten Absichten. Ein Prinz aus einer anderen Dimension. Ein Professor mit sieben Gehirnen. Eine Süße Wüste. Barbaren ohne Umgangsformen. Hundlinge. Ein Regenwaldzwerg mit Nahkampfausbildung. Denkender Sand. Fliegende Maulwürfe. Ein Monsterschiff. Eine Ofenhölle. Eine kulinarische Insel. Unterirdische Sandmänner. Kanaldrachen. Dramatische Lügenduelle. Dimensionslöcher. Voltigorkische Baßrüttler. Randalierende Bergzwerge. Die Unsichtbaren Leute. Nattifftoffen. Viereckige Sandstürme. Venedigermännlein. Nette Midgardschlangen. Eklige Kakertratten. Das Tal der verworfenen Ideen. Witschweine. Großfüßige Berten. Rostige Berge. Horchlöffelchen. Zeitschnecken. Teufelselfchen. Alraunen. Olfaktillen. Ein Malmstrom. Draks. Fatome. Gennf. Tödliche Gefahren. Ewige Liebe. Rettungen in allerletzter Sekunde …
Aber ich will nicht vorgreifen!
Denke ich an diese Zeiten zurück, übermannt mich die Wehmut. Aber die Uhr des Lebens läßt sich nicht zurückdrehen. Das ist bedauerlich, aber gerecht.
So folgt jetzt, wie es sich gehört, der Winter auf den Herbst. Die Sonne, kalt wie der Mond, sinkt in den eisgrauen Ozean, und der Wind riecht nach Schnee. Da ist auch noch ein anderer Geruch in der Luft, der Geruch von Feuern, die in der Ferne brennen, mit einem Hauch Zimt darin – so riecht das Abenteuer! Früher bin ich diesem Geruch immer gefolgt, aber heute habe ich Wichtigeres zu tun: Meine Lebenserinnerungen müssen der Nachwelt erhalten werden. Die ersten Frostgespenster strecken ihre klammen Finger durch die Dielen meiner Kajüte und greifen nach meinen Füßen. Unsichtbare Eishexen malen Schneeblumen auf die Fenster. Nicht gerade meine bevorzugte Jahreszeit, aber genau der richtige Anlaß, eine Kanne heißen Kakao zu kochen (mit einem winzigen Schuß Rum), dreizehneinhalb gestopfte Pfeifen, dreizehneinhalb Marmeladenbrote und dreizehneinhalb gespitzte Bleistifte bereitzulegen und zu beginnen, meine ersten dreizehneinhalb Leben niederzuschreiben. Ein kühnes, kräftezehrendes Unterfangen von epischem Ausmaß, wie ich befürchte. Denn, wie schon gesagt: Damals gab es von allem viel mehr – natürlich auch mehr Abenteuer.
Eine seltsame Geburt
in Leben beginnt gewöhnlich mit der Geburt – meins nicht. Zumindest weiß ich nicht, wie ich ins Leben gekommen bin. Ich könnte – rein theoretisch – aus dem Schaum einer Welle geboren oder in einer Muschel gewachsen sein, wie eine Perle. Vielleicht bin ich auch vom Himmel gefallen, in einer Sternschnuppe.
Fest steht lediglich, daß ich als Findelkind ausgesetzt wurde, mitten im Ozean. Meine erste Erinnerung ist, daß ich in rauher See trieb, nackt und allein in einer Walnußschale, denn ich war ursprünglich sehr, sehr klein. Ich erinnere mich weiterhin an ein Geräusch. Es war ein sehr großes Geräusch. Wenn man noch so klein ist, neigt man dazu, die Dinge zu überschätzen, aber heute weiß ich, daß es tatsächlich das größte Geräusch der Welt war.
Der Malmstrom
Erzeugt wurde es vom monströsesten, gefährlichsten und lautesten Wasserwirbel der sieben Weltmeere – ich ahnte ja nicht, daß es der gefürchtete Malmstrom war, auf den ich da in meinem Schälchen zuschaukelte. Für mich war es nur ein gewaltiges Gurgeln. Wahrscheinlich dachte ich damals (wenn man das schon denken nennen konnte), daß es wohl der natürlichste Zustand war, nackt in einer Nußschale auf dem offenen Meer einem ohrenbetäubenden Tosen entgegenzutreiben.
Das Geräusch wurde mächtiger und mächtiger, die Nußschale schaukelte immer heftiger, und ich wußte natürlich auch nicht, daß ich schon längst in den Sog des Wirbels geraten war. In einer kilometerlangen Spirale tanzte mein winziges Boot, wahrscheinlich das kleinste der Welt, dem brüllenden Abgrund entgegen.
Nun muß man bedenken, daß dies so ziemlich die aussichtsloseste Situation war, in die man auf See geraten konnte. Jeder Seemann, der seinen Verstand beisammen hatte, umschiffte das Gebiet des Malmstroms großräumig. Und selbst wenn irgend jemand zu meiner Rettung angetreten wäre, hätte ihn dasselbe Schicksal ereilt. Er wäre mit auf den Grund des Meeres gezogen worden, denn kein Schiff war dem Sog des Wirbels gewachsen.
Jetzt begann sich mein Nußschälchen auch noch um sich selbst zu drehen, im Walzertakt tanzte es dem Untergang entgegen, hinab in den gurgelnden Rachen des Ozeans. Ich aber betrachtete nur die wirbelnden Sterne über mir, lauschte verzückt dem Malmstrom und ahnte nichts Böses.
Das war der Augenblick, in dem ich zum ersten Mal eines der schaurigen Lieder der Zwergpiraten hörte.
Zwergpiraten
Die Zwergpiraten waren die Herrscher des Zamonischen Ozeans. Es wußte allerdings niemand davon, weil sie so klein waren, daß keiner sie bemerkte. Keine Welle war den Zwergpiraten zu hoch, kein Sturm zu gewaltig und kein Sog zu wirbelnd, daß sie ihm nicht getrotzt hätten. Sie waren die verwegensten aller Seefahrer und suchten unablässig die Herausforderung, ihr nautisches Können auch gegen die tosendsten Naturgewalten unter Beweis zu stellen. Nur sie waren aufgrund ihrer außergewöhnlichen seemännischen Fähigkeiten in der Lage, es mit dem Malmstrom aufzunehmen.
So war es gekommen, daß sie in den Strudel geraten waren, aus reiner Verwegenheit und trotzig ihre Piratenlieder grölend. Aufmerksam die Wasseroberfläche nach den günstigsten Wellentunneln und Strömungen absuchend, hatte mich ihr Ausguck im Mast durch sein winziges Fernrohr erspäht. Ich war kurz davor, im Malmstrom zu verschwinden.
Es war eine doppelt glückliche Fügung, ausgerechnet von den Zwergpiraten gefunden zu werden, denn jeder andere von normaler Größe hätte mich vermutlich übersehen. Sie holten mich an Bord, wickelten mich in Ölzeug und banden mich mit dicken Tauen an einen Mast, was mir damals sehr seltsam vorkam, aber meiner Sicherheit diente. Währenddessen führten sie ihren heldenhaften Kampf mit den Elementen wie selbstverständlich weiter. Sie kletterten die Masten hinauf und wieder herunter wie Eichhörnchen, hißten die Segel und holten sie wieder ein, in einem Tempo, daß einem schwindelig werden konnte vom bloßen Hinsehen. Sie warfen sich wie ein Mann nach Backbord, um eine Schwankung auszubalancieren, dann wieder nach Steuerbord, zum Bug oder zum Heck. Sie pumpten das Wasser, verschwanden im Bauch des Schiffes, um mit vollen Eimern wieder herauszukommen, sprangen durch Luken und schwangen sich an Tauen hin und her. Sie waren in ständiger Bewegung, kurbelten am Steuerrad, schrien sich gegenseitig an, hängten sich gemeinsam an ein großes Segel, um es zu schnellerer Entfaltung zu bringen, holten Taue ein und vergaßen dabei keine Sekunde, ihre Piratenlieder zu singen. Ich kann mich sogar erinnern, daß einer von ihnen dabei unablässig das Deck schrubbte.
Die Gischt überschäumte das Schiff, es legte sich schräg, bäumte sich auf und tauchte sogar mehrmals unter, aber es versank nicht. Ich bekam zum ersten Mal Meerwasser zu schlucken, und ich muß gestehen: Es schmeckte nicht übel. Wir glitten durch Wellentunnel, ritten auf mächtigen Schaumbergen, wurden hoch in die Luft geworfen und tief ins Meer gedrückt. Das Piratenschiff wurde hin und her geschleudert, von riesigen Wellen geohrfeigt, geschubst und bespuckt, aber die Zwergpiraten ließen sich nicht beirren. Sie schrien das Meer an, spuckten zurück und stachen trotzig mit ihren Enterhaken nach den Wellen. Sie verteilten sich blitzschnell auf die Masten, holten die Segel ein und entrollten sie im nächsten Augenblick wieder. Sie reagierten auf jede Bewegung des Meeres, jedes Lüftchen, jede Regung des Schiffes, und wußten sogleich, was sie als nächstes zu tun hatten. Niemand erteilte Befehle, alle waren gleichberechtigt. Mit ihrer gemeinsamen Emsigkeit waren sie dem gewaltigen Ozean schließlich überlegen. Ich selbst beobachtete das Treiben voller Staunen, sicher an meinem Mast vertäut.
Wenn man so klein ist wie die Zwergpiraten (und damals auch ich), lebt man in einer anderen Zeit. Wer jemals versucht hat, eine Fliege mit der Hand zu fangen, wird erfahren haben, daß ihm dieses winzige Wesen, was Geschwindig- und Wendigkeit angeht, turmhoch überlegen ist. Aus der Sicht der Fliege bewegen wir uns wie in Zeitlupe, es ist für sie ein leichtes, um unsere Bewegungen herum zu manövrieren und uns zu entkommen. So ähnlich war es mit den Zwergpiraten. Was für ein normal großes Schiff ein rasender Sog war, erschien ihnen als tumber Wirbel. Eine Riesenwoge löste sich für uns in viele winzige Wellchen auf, die wir bequem durchschiffen konnten. Wie ein Orkan über eine Stadt fegen und dabei die größten Häuser niederreißen kann, hingegen ein kleines Spinnennetz unversehrt läßt, so konnte die monströse Strömung uns nichts anhaben. Was uns schützte, war, daß wir so klein waren.
So entkamen wir dem tödlichen Malmstrom. Wie gesagt, ich wußte damals nichts von den wirklichen Gefahren des Wirbels – das kam erst viel später. Ich registrierte nur, daß das Gurgeln immer schwächer und die Aktivitäten der Zwergpiraten weniger aufgeregt wurden. Schließlich hatte sich die Lage so weit entspannt, daß sie sich um mich versammeln, mich losbinden und bestaunen konnten.
Ich staunte zurück.
Zwergpiraten waren, wie der Name schon unterstellt, von ziemlich geringem Wuchs. Ein Zwergpirat von zehn Zentimetern Größe galt unter seinesgleichen als Hüne. Die Zwergpiraten befuhren die Meere auf winzigen Schiffen, immer auf der Suche nach etwas, das klein genug war, damit sie es kapern konnten. Was sehr selten geschah. Eigentlich nie. Um die Wahrheit zu sagen: In der ganzen Geschichte der Seefahrt wurde niemals auch nur ein einziges Schiff, nicht mal ein Ruderboot, von Zwergpiraten erfolgreich gekapert. Gelegentlich, meist aus Verzweiflung, griffen Zwergpiraten auch größere Schiffe, sogar Ozeanriesen an. In der Regel wurden ihre Bemühungen nicht einmal wahrgenommen. Die winzigen Seeräuber warfen ihre Enterhäkchen in das Holz der großen Schiffe und wurden dann so lange mitgeschleppt, bis sie endlich aufgaben. Oder sie feuerten ihre niedlichen Kanönchen ab, deren Geschosse nie das Ziel erreichten – schon nach wenigen Metern plumpsten sie wirkungslos ins Meer.
Da sie niemals Beute machten, ernährten sich die Zwergpiraten hauptsächlich von Algen oder den Fischen, mit denen sie es aufnehmen konnten, Sardellen etwa oder ganz kleinen Scampis. In Notlagen verschmähten sie auch Plankton nicht.
Anstelle von Händen besaßen die Zwergpiraten kleine Eisenhäkchen, anstelle richtiger Beine Holzbeine. Außerdem habe ich keinen von ihnen jemals ohne Augenklappe gesehen. Zuerst dachte ich, es handele sich um Blessuren, die sie sich bei ihren waghalsigen Kaperversuchen zugezogen hatten, aber später erfuhr ich, daß sie so geboren wurden, samt Schnurrbart und Hut.
Aus dem Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebungvon Prof. Dr. Abdul Nachtigaller
* * * * * * *
Zwergpiraten, die: Trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer eigentlichen Harmlosigkeit führen sich Zwergpiraten sehr gerne blutrünstig und rauhbeinig auf. Sie schwingen gerne großmäulige Reden, die bevorzugt von erfolgreichen Kaperfahrten und fetter Prise handeln. Man könnte fast sagen, sie neigen zur Prahlsucht. Wenn sich zwei Zwergpiraten begegnen (und das passiert auf einem Schiff voller Zwergpiraten ja andauernd), dann zählen sie sich gegenseitig mit großartigen Gebärden und viel Geschrei die Anzahl der Handelsschiffe vor, die sie angeblich in den Grund gebohrt haben, und protzen mit den unschuldigen Matrosen, die sie erbarmungslos kielgeholt oder über die Planke gejagt haben. Dabei trinken sie Rhumm, ein Getränk aus Algensaft und Zuckerrohr, das ihre Kaperphantasien noch befeuert und ihre Zungen schnell schwer werden läßt, obwohl es gar keinen Alkohol enthält. Zwergpiraten vertragen nicht viel.
Oft habe ich damals diesen Begegnungen beigewohnt und den grandiosen Aufschneidereien der Zwergpiraten gelauscht. Ich gebe allerdings gerne zu, daß diese Art von blümeranter Ausschmückung und üppiger Phantasie Wirkung auf mich hatte. Was ich von ihnen lernte, war, daß eine gute Notlüge oft wesentlich aufregender ist als die Wahrheit. Es ist so, als würde man der Wirklichkeit ein schöneres Kleid geben.
Jammern, Prahlen und Piratenlieder
Für einen Zwergpiraten gab es nichts Schlimmeres als die Langeweile. Sobald sich einer von ihnen auch nur ein kleines bißchen langweilte, führte er sich dermaßen gequält auf, daß es einem ans Herz ging. Er seufzte und stöhnte und drohte dem Himmel mit seiner Hakenhand, raufte sich die Haare und zerriß manchmal sogar seine Kleidung. Was alles nur noch schlimmer machte, denn dann jammerte er über die Risse in seiner Garderobe und klagte das Schicksal an, ihn mit Tragik zu überschütten. Da aber auf See die Langeweile häufiger Gast an Bord eines jeden Schiffes ist, herrschte eigentlich ständiges Gejammer und Gestöhne unter den Zwergpiraten. Wenn nicht gejammert wurde, wurde geprahlt. Wenn weder gejammert noch geprahlt wurde, grölte man Piratenlieder. In dieser Atmosphäre wuchs ich auf.
Ich wurde zum eigentlichen Lebensinhalt der Zwergpiraten. Ihr ganzes Dasein drehte sich in den fünf Jahren, die ich bei ihnen war, fast nur um mich. Es war, als hätte ich ihrem absurden Leben endlich einen Sinn gegeben. Sie bemühten sich rührend, mir alles beizubringen, was sie über das Kaperwesen und das Piratenleben wußten. Ganze Tage verbrachten sie damit, mir schauerliche Piratenlieder vorzusingen, mit Fluchen, dem Hissen von Totenkopfflaggen und dem Anfertigen von Schatzkarten. Einmal versuchten sie sogar mir zuliebe, ein Schiff zu kapern, das mindestens tausendmal größer war als ihr eigenes. An diesem Tag habe ich alles gelernt, was man über das Scheitern wissen muß.
Seemannshandwerk
Ansonsten lernte ich das Seemannshandwerk vom Ankerholen über Kalfatern bis zum Wantenspannen, nur vom Zusehen und Mithelfen.
Mit dem Deckschrubben fing es an. Es kann eine hohe Kunst sein, das Deck zu schrubben, blitzeblank, bis jede gefräßige Bakterie vom Holz ist, aber auch nicht zu glatt gebohnert, damit man noch guten Halt hat (was bei den dünnen Holzbeinchen der Zwergpiraten von besonderer Wichtigkeit war). Schmierseife mit einem leichten Anteil von Treibsand ist das ideale Scheuermittel zum Deckschrubben: die Seife für die keimfreie Reinigung und der Treibsand für die Bodenhaftung. Ich lernte das Segeln am Wind, das Segeln hart am Wind und das Rumhängen in der Flaute ohne Wind, ich lernte eine Bagstagsbrise auszunutzen, das Halsen, das Wenden auf rauher See und die nautische Vollbremsung (ein Trick, den nur die Zwergpiraten beherrschten, um auf hoher See nicht mit einem größeren Fisch zusammenzustoßen. Das fing bei ihnen ja schon beim Kabeljau an).
Knoten
Eines der wichtigsten Dinge im Leben eines Seemanns ist der Knoten. Damit ist nicht die Geschwindigkeit eines Schiffes gemeint, die man auch in Knoten mißt, nein, ich meine die mannigfachen Möglichkeiten der Verknüpfung eines Hanfseils. Ich lernte 723 verschiedene Versionen, einen Knoten zu schürzen, und die kann ich heute noch auswendig. Ich kann (natürlich) den einfachen Seemannsknoten, aber auch den doppelten Zwergpiratenschürzling, die Sturmkrawatte und den Gänsegalgen, die Klabauterfessel und sogar den doppelten Gordischen Knoten.
Ich beherrsche den gewickelten Hänfling genauso gut wie die achtschlaufige Oktopusschlinge, ich knote das Manilareep mit der Hanffaser, ich könnte mit verbundenen Augen zwei Aale so kompliziert verknoten, daß sie ihr Lebtag nicht mehr auseinander kommen. Ich wurde so etwas wie der Oberknotmeister auf dem Zwergpiratenschiff; wenn man einen Knoten benötigte, kam man zu mir. Ich könnte einen Knoten in einen Fisch machen, und, wenn es sein müßte, im absoluten Notfall, sogar einen Knoten in einen Knoten.
Wissenswertes über Wellen
Besonders wichtig auf See ist natürlich die Navigation. Die Zwergpiraten hatten kaum technische Hilfsmittel, selbst ein Kompaß war ihnen fremd. Sie steuerten nach einem System, das auf der Beobachtung von Wellenbewegungen basierte. Wenn man Wellen lange genug beobachtet, erkennt man, daß sie alle unterschiedlich sind. Man sagt zwar, eine Welle sieht wie die andere aus, aber dem ist nicht so: Jede einzelne hat eine eigene Form der Rückenkrümmung, manche gehen steil und spitz, manche rund und flach, es gibt dicke und dünne, grüne und blaue, schwarze und braune, durchsichtige und trübe, große und kleine, breite und lange, kalte und warme, salzige und süße, laute und leise, schnelle und langsame, harmlose und lebensgefährliche.
Jede Welle hat sozusagen eine eigene Statur, ein eigenes Gesicht und schließlich eine eigene Frisur in Form von Gischt auf ihrem Kopf. Und man unterscheidet sie an ihrem Gang, dem sogenannten Wellengang. Wellen südlicher Gewässer bevorzugen einen lässigen, wiegenden Gang, die der Nordmeere eher einen strammen, zügigen, wegen der Kälte und der Gefahr, zur Eisscholle zu gefrieren. Hawaiianische Wogen scheinen sich im Takt von Rumbakugeln zu bewegen, schottische in langen Reihen zu unhörbarer Dudelsackmusik zu marschieren. Wenn man Wellen ausführlich studiert, weiß man, welche Sorte sich wo gerne aufhält. Kleine grüne mit lustiger Gischt zum Beispiel in tropischen seichten Gewässern, dunkle schlammige in Küstennähe, besonders an Flußmündungen, hohe blaue auf kalter, tiefer See und so weiter.
Man kann also an ihrem Aussehen sehr genau bestimmen, wo man sich befindet, ob es Untiefen gibt oder unsichtbare Sandbänke und Korallenriffe, ob man in Landnähe ist oder auf hoher See, in einer tückischen Strömung und sogar, ob sich im Wasser Haie befinden oder nur Heringe. Sind Haie darin, zittern die Wellen leicht.
Ich lernte auch alles Nötige über die tägliche Pflege des Schiffskörpers, das Reparieren von Planken, das Entfernen von Seeschnecken vom Schiffsrumpf (und ihre Zubereitung in Algensud), das Balancieren bei hohem Seegang, das Rettungsbootlassen, das Rettungsringwerfen und Ausgucksitzen. Schon nach einem Jahr war ich ein voll ausgebildeter Seebär und mußte mich bei Sturm auch nicht mehr übergeben.
Algen
Die Zwergpiraten gaben mir reichlich zu essen, vorwiegend Algen und magere Fische. Sie kannten über 4oo Zubereitungsarten, von »Alge natur« bis zum hochkomplizierten Soufflé, und ich durfte von allem kosten. Meine heutige Abneigung gegen Algen könnte möglicherweise mit den Eßgewohnheiten der Zwergpiraten zusammenhängen.
Man kann gegen Algen sagen, was man will: Sie enthalten alle wichtigen Vitamine und Aufbaustoffe, die ein kleiner Blaubär zum Wachstum braucht, vielleicht sogar zuviel davon. Denn ich wuchs in einem Tempo heran, das nicht nur mir, sondern besonders den Zwergpiraten bald unheimlich wurde. Am Anfang war ich kleiner als meine Lebensretter gewesen, aber schon nach einem Jahr genauso groß wie sie. Im zweiten Jahr war ich schon doppelt so groß, und nach vier Jahren überragte ich sie um fünf Körperlängen.
Man kann sich vorstellen, daß dieses rapide Wachstum auf kleinwüchsige Piraten, die mit einem natürlichen Mißtrauen gegen alles Große ausgestattet sind, einen sehr unangenehmen Eindruck machte. Nach fünf Jahren an Bord war ich so groß und schwer geworden, daß ich ihr Schiff zu versenken drohte.
Wenn ich es damals auch nicht verstand, die Zwergpiraten taten das einzig Richtige, als sie mich eines Tages auf einer Insel aussetzten. Ich bin sicher, es ist ihnen nicht leichtgefallen. Sie gaben mir eine Flasche Algensaft und ein selbstgebackenes Algenbrot als Wegzehrung, dann fuhren sie jammernd und klagend in den Sonnenuntergang. Sie wußten, daß ihr Leben ohne mich um einiges langweiliger werden würde.
Allein unter Palmen
Als ich so nackt und verlassen am Strand einer einsamen Insel saß, dachte ich zum ersten Mal über meine Situation nach. Eigentlich dachte ich überhaupt zum ersten Mal nach, denn in der ewig lärmenden Atmosphäre des Zwergpiratenschiffes war ich ja nie dazu gekommen, einen klaren Gedanken zu fassen.
Ich muß gestehen, daß meine ersten Denkversuche nicht gerade von unauslotbarer Tiefe waren. Der erste Gedanke, der mir in den Sinn kam, war: Hunger. Der zweite: Durst. Also schlang ich gierig das Algenbrot herunter und trank hastig die Flasche Algensaft leer. Umgehend breitete sich in meinem Innern eine behagliche Wärme aus, als hätte jemand in mir ein kleines Lagerfeuer entfacht. Damit kam auch eine gewisse Zuversicht, die mich ermutigte, das Schicksal beim Schopf zu packen und den mächtigen Palmenwald der Insel zu erkunden. Diese frühe Erfahrung könnte wie ein Lehrsatz über meinem ganzen weiteren Leben stehen: Wie groß eine Herausforderung auch sein mag, sie ist auf jeden Fall leichter zu bewältigen, wenn man vorher eine ordentliche Mahlzeit zu sich genommen hat.
Dunkelheit
Dann kam die Nacht und mit ihr die Dunkelheit.
Dunkelheit – ich wußte ja bisher gar nicht, was das überhaupt war. Bei den Zwergpiraten war es immer hell gewesen, auch nachts. Sobald der Abend hereinbrach, wurde das Schiff auf das prächtigste beleuchtet. Ein Zwergpiratenschiff in der Nacht ist immer eine kleine Sensation. Es sieht aus wie eine schwimmende Miniaturkirmes, inklusive Geräuschkulisse. Die Zwergpiraten hatten nämlich einen fürchterlichen Bammel vor der Dunkelheit. Sie glaubten, die Nacht sei die Zeit der Klabautergeister, welche kämen, um die Seelen der Seefahrer zu verspeisen. Und diese Gespenster seien eben nur durch verschwenderische Beleuchtung und größtmögliche Lärmentfaltung zu verscheuchen. Die Zwergpiraten beleuchteten also nicht nur ihr Schiff mit Lampions, Fackeln, farbigen Lichterketten, Wunderkerzen und kleinen Feuern, sie jagten auch unablässig eine Signalrakete nach der anderen in den Himmel und veranstalteten durch Singen, Schreien und das Schlagen von Gußhämmern auf eiserne Töpfe ein solches Höllenspektakel, daß man nachts kein Auge zubekam. Geschlafen wurde am Tag. Und nie wurden wir von Klabautergeistern belästigt.
Angst
Und nun also zum ersten Mal Dunkelheit. Und mit der Finsternis kam ein neues Gefühl, das ich bisher noch nie ertragen mußte: Angst!
Ein sehr unangenehmes Gefühl, als sei die Dunkelheit in meinen Körper gedrungen und würde nun durch meine Adern fließen. Die fetten grünen Palmen, die sich eben noch so beruhigend im Wind gewiegt hatten, waren jetzt zu schwarzen, schwankenden Baumkerlen geworden, die sich mit riesigen Pranken schreckliche Botschaften zuwinkten.
Am Himmel stand eine magere Mondsichel, die ich mit Erstaunen wahrnahm, denn bei dem ewigen Lichterfest an Bord war sie mir nie aufgefallen. Der Wind rauschte durch die Farne des Palmenwaldes und verwandelte sie in eine Meute wispernder Gespenster, die sich immer dichter um mich drängten und mit dünnen Fingern nach mir tasteten. Plötzlich mußte ich an die Klabautergeister denken.
Ich versuchte, den Gedanken zu unterdrücken, aber es ging nicht. Mir fehlte der hysterische Lärm der Zwergpiraten, ihr Geschrei und vor allem ihr verschwenderisches Licht. Das Licht, das die Klabautergeister fernhielt. Ich war am absoluten Tiefpunkt meines jungen Lebens angelangt: ausgestoßen, nackt, einsam, mitten in einem finsteren, unbekannten Wald und voller Angst. Plötzlich nahm ich zwischen den Palmenstämmen sehr beunruhigende Lichter wahr. Grüne Lichtfäden, schlangengleich, zunächst ganz fern, die aber schnell immer näher kamen. Dazu ein hohes, gemeines elektrisches Summen und gelegentlich ein hohles, meckerndes Gelächter, wie von gehörnten Wesen, die in Brunnenschächten sitzen. So kündigten sich, das wußte ich von den Zwergpiraten, die Klabautergeister an.
Aus dem Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebungvon Prof. Dr. Abdul Nachtigaller
* * * * * * *
Klabautergeist, der: Der Klabautergeist gehört zu den sogenannten Allgemeingeschmähten Daseinsformen (vergleichsweise auch: > Waldspinnenhexe, die, > Stollentroll, der und > Bollogg, der), worunter diejenigen Lebewesen Zamoniens und Umgebung gezählt werden, deren vorsätzlicher Lebensinhalt es ist, unter ihren Zeitgenossen Angst und Schrecken zu verbreiten und sich auch sonst in jeder Form unsozial, harmoniestörend und frohsinnmindernd aufzuführen. Von äußerlich abstoßendem bis panikauslösendem Aussehen, erscheint der Klabautergeist meist im Rudel und unter Hervorbringung beängstigender Geräusche und grusliger Gesänge gerne möglichst wehrlosen Kreaturen, um sich an deren Unbehagen zu ergötzen.
Erste Tränen
Das war zuviel für mich. Ich spürte, wie eine heiße Flüssigkeit in meinem Kopf aufstieg. Meine Augen, mein Mund, meine Nase füllten sich damit, und ich konnte nichts anderes tun, als diesem inneren Druck nachzugeben: Ich weinte. Zum ersten Mal in meinem Leben! Dicke, salzige Tränen liefen in mein Fell, meine Nase triefte, und mein ganzer Körper schüttelte sich im Takt meines Schluchzens. Alles andere war jetzt gleichgültig.
Die Klabautergeister, die mich umringten, die Dunkelheit, die Angst – alles war zweitrangig vor diesem gewaltigen Ausbruch der Gefühle. Ich heulte und schluchzte, strampelte mit den Beinchen und schrie mir die Seele aus dem Leib. Wie zwei kleine Sturzbäche strömten die Tränen in mein Fell, bis ich aussah wie ein nasser Waschlappen. Ich gab mich ganz dem Zusammenbruch hin.
Dann kam die Ruhe. Die Tränen versiegten, die Schluchzwellen ebbten ab. Ein beruhigendes Gefühl von Wärme und Müdigkeit übermannte mich. Die Angst war verschwunden. Ich hatte sogar den Mut, aufzublicken und den Klabautergeistern ins Gesicht zu sehen. Sie schwebten im Halbkreis um mich herum, sechs oder sieben wabernde Gestalten aus gespenstischem Licht. Ihre Arme und Beine baumelten wie schlaffe Fahrradschläuche an ihnen herab. Sie starrten mich eine Weile schweigend, fast ergriffen an. Dann begannen sie zu applaudieren.
Ich will nichts beschönigen: Die Klabautergeister waren wirklich ein unangenehmer Haufen. Ihre schleimige Art der Fortbewegung, der leichte elektrische Schlag, den man bekam, wenn sie einen berührten, ihre hohen, singenden Stimmen und vor allen Dingen ihre zweifelhafte Vergnügung, sich an der Furcht hilfloser Zeitgenossen zu ergötzen, waren widerwärtig. Dazu kam noch der Geruch von fauligem Holz, den sie verströmten (er hing mit ihren Schlafgewohnheiten zusammen), und ganz besonders ihre abstoßende Art der Ernährung. Doch davon später.
Ja, die Klabautergeister waren eigentlich das Letzte, aber trotzdem ging ich mit ihnen. Was blieb mir schließlich auch anderes übrig?
Ich verstand kein Wort von dem, was sie sagten beziehungsweise sangen, aber ich begriff doch sehr schnell, daß sie mich aufforderten, mit ihnen zu kommen. Ich fand, das war angesichts meiner Lage noch das Beste, was mir passieren konnte, immerhin hätten sie auch wer weiß was mit mir anstellen können.
Sie glitten vor mir her durch den Wald, wie Wasserschlangen aus grünem Licht umflossen sie jedes Hindernis mit eleganten Bewegungen. Wenn ein Hindernis zu groß oder zu massiv war, etwa ein Felsblock oder ein umgestürzter Mammutbaum, dann flutschten sie einfach mitten durch es hindurch, als sei es nicht dichter als Nebel.
Ich hatte einige Schwierigkeiten mitzuhalten, aber die Klabautergeister machten in gewissen Abständen höfliche Pausen, in denen sie gemeinsam warteten, bis ich sie eingeholt hatte. Sie sangen in der Zwischenzeit ziemlich gräßliche Lieder, deren Melodien schon so unbehaglich klangen, daß ich froh war, den Text nicht zu verstehen.
Ein Baumfriedhof
Ich war völlig erledigt, mein Fell war voller Laub, Dornen und kleinen Ästen, als wir endlich das Ziel erreichten: eine große Lichtung mitten im Wald. Auf ihr lagen Hunderte von umgestürzten hohlen Mammutbäumen, die vor sich hin faulten. Ein Friedhof für Riesenbäume, bewohnt von Hunderten, vielleicht Tausenden von Klabautergeistern. Das sollte fürs nächste mein Zuhause sein.
s stellte sich sehr bald heraus, daß die Klabautergeister mich nicht aus reiner Gastfreundschaft aufgenommen hatten. Noch in derselben Nacht zeigten sie mir durch anschauliche Pantomimen, was sie von mir verlangten: Ich sollte für sie weinen.
Aus dem Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebung von Prof. Dr. Abdul Nachtigaller
* * * * * * *
Klabautergeister, die (Forts.): Klabautergeister entstehen durch das Zusammentreffen eines Irrlichts (Lux Dementia) mit zamonischem Friedhofsgas. Friedhofsgas ist ein unangenehm riechendes Fäulnisgas, das aus vermodernden Särgen aufsteigt, wenn die Erde darauf nicht gasversiegelnd genug beklopft wurde. Irrlichter entstehen, wenn Glühwürmchen vom Blitz getroffen werden und dann im lädierten Zustand weiterflattern. Treffen nun Irrlicht und Friedhofsgas zusammen, was aus naheliegenden Gründen vorwiegend über öffentlichen Begräbnisstätten stattfindet, verschmelzen die Gasmoleküle und Lichtatome zu jener rückgratlosen und unseligen Allianz, die gemeinhin als Klabautergeist bekannt ist.
Eigentlich klar, daß dabei nichts Erfreuliches zustande kommen kann. Wer kein Rückgrat hat, braucht auch kein Nervensystem, und wer keine Nerven hat, der hat auch keine Gefühle – und gerade deswegen interessieren den Klabautergeist die Gemütsbewegungen anderer Lebewesen so sehr. Man will eben immer das haben, was man selber nicht hat. Und wenn man einmal weiß, wie Klabautergeister entstehen, wundert man sich auch nicht darüber, daß ihr Interesse an unangenehmen Gefühlen wie Angst, Verzweiflung und Trauer so ausgeprägt ist. Ein Weinkrampf, also etwas, in dem all diese Gefühle gleichzeitig vorkommen, ist für einen Klabautergeist das Allergrößte.
Sie zeigten mir einen Platz auf einem mächtigen modernden Baumstamm, der dort wie ein umgestürzter Fabrikschornstein lag, und schoben mir ein paar Blätter unter, damit ich bequem sitzen konnte.
Unter Geistern
Die Lichtung füllte sich immer mehr mit Klabautergeistern, sie glitten zwischen den Baumstämmen umher und suchten summend ihre Sitzplätze. Es war schon unheimlich, Hunderte von ihnen einen Baumfriedhof erleuchten zu sehen. Zusammen erzeugten sie einen grünen Lichtdom, der sich gespenstisch über den Schauplatz wölbte. Es herrschte nervöses Wispern und Gekicher, bis auch der letzte Klabautergeist seinen Platz gefunden und seinen Blick auf mich gerichtet hatte. Dann wurde es still.
Ich ahnte, was von mir verlangt wurde, aber ich war irgendwie nicht in der richtigen Stimmung. Mir war durchaus unbehaglich zumute, aber nicht unbehaglich genug, um weinen zu können. Ich hatte das Gefühl, keinen Tropfen Flüssigkeit in mir zu haben, nie waren mein Mund und meine Kehle trockener gewesen. Dennoch versuchte ich, mein Bestes zu geben. Ich verzog mein Gesicht auf alle möglichen Arten, um eine Träne hervorzupressen, aber es kam nichts.
Ich versuchte es mit Schluchzen, aber heraus kam nur ein heiseres Krächzen. Die Klabautergeister wurden unruhig. Einige von ihnen fingen einen unangenehmen leisen Singsang an, und überall in der Luft knisterten kleine elektrische Entladungen. Ich schüttelte meinen Körper ein bißchen hin und her, als würde er von einem Weinkrampf erschüttert, und rieb mir die Augen, um die Tränen zum Fließen zu bringen; aber die Bewegungen wirkten hölzern und gekünstelt, und die Tränen blieben aus.
Mehrere Klabautergeister erhoben sich von ihren Plätzen, überall erklang gemeines Gezischel wie von kaputten Gasleitungen. Einige glitten von den Stämmen und schlängelten langsam auf mich zu, offenbar mit unguten Absichten. Ich versuchte es mit Selbstmitleid. Ich dachte daran, ein kleiner, nackter, ausgesetzter und sehr hungriger Blaubär zu sein, ohne Eltern, ohne Heimat, ohne Freunde. Ich dachte an die glücklichen Zeiten mit den Zwergpiraten und daran, daß diese Zeiten nun für immer vorbei waren. Mir schien, daß ich das mit Abstand bedauernswerteste, alleingelassenste, hungrigste Blaubärchen der Welt war, die absolut bemitleidenswerteste Kreatur, die jemals … und endlich flossen die Tränen!
Und wie sie flossen! Wahre Sturzbäche von Tränen, eine Überschwemmung von salzigen Fluten. Das Wasser spritzte aus meinen Augen, stieg mir in die Nase und sabberte über meine Lippen. Ich schluchzte herzzerreißend, warf mich auf den Bauch und trommelte mit meinen kleinen Fäusten auf den hohlen Baumstamm, so daß es tief in den Wald schallte. Ich strampelte mit den Füßen und raufte mir die kurzen Härchen. Ich hockte mich auf alle viere und heulte die Mondsichel an wie ein kleiner heimwehkranker Hund. Es war ein Weinkrampf der Sonderklasse, viel besser und länger als der erste.
Dann war er plötzlich vorbei. Schniefend setzte ich mich auf und wischte die letzten Tränen ab. Durch den wäßrigen Schleier vor meinen Augen sahen die Klabautergeister noch unheimlicher aus. Sie saßen völlig regungslos da und starrten mich an.
Absolute Stille.
Ich zog die Nase hoch und war auf alles gefaßt. Sollten sie mich doch fressen oder sonstwas – mir war es seltsam egal. In der letzten Baumreihe fing ein einzelner Klabautergeist zögernd an zu applaudieren. Immer noch saßen alle anderen regungslos da. Dann fiel ein zweiter in den Applaus ein, ein dritter, ein vierter, und plötzlich standen die Klabautergeister wie auf ein geheimes Kommando geschlossen auf und applaudierten, daß der Wald bebte. Sie stießen spitze Schreie des Entzückens aus und pfiffen auf ihren dünnen Geisterfingern. Manche nahmen Äste und schlugen sie im Takt gegen die hohlen Baumstämme. Es herrschte ein unglaublicher Lärm. Blumenkelche wurden in meine Richtung geworfen. Hier und da schoß ein Klabautergeist wie eine grüne Leuchtrakete hoch in die Luft. Alles in allem zeigten diese ansonsten gefühllosen Kreaturen ein erstaunliches Maß an Begeisterung. Und ich muß gestehen: Ich war davon ziemlich ergriffen.
Man kann es nicht anders sagen: Ich war buchstäblich über Nacht zum Star geworden. Ich bekam zwar kein Geld (ich wußte damals nicht mal, daß es so etwas überhaupt gibt), aber die Klabautergeister versorgten mich für meine Heulerei mit Nahrung. Nichts Besonderes, vorwiegend Nüsse und Beeren, Quellwasser und Bananen und ab und zu eine frische Kokosnuß, aber mehr brauchte ich in diesen Tagen auch nicht. Die Gespenster hatten sehr schnell begriffen, daß ich mit ihrer seltsamen Art der Ernährung nichts zu tun hatte, Neptun sei Dank. Sie ernährten sich nämlich von Angst. Ich wußte das von den Zwergpiraten: Die Klabautergeister gleiten des Nachts übers Meer, auf der Suche nach Schiffen, deren Besatzung sie mit ihrem Gesang und Geheul in Angst und Schrecken versetzen können. Haben sie das erreicht, saugen sie die Angst in sich hinein wie Milch durch einen Strohhalm.
Wenn ich diese durchsichtigen Gespenster von ihren nächtlichen Beutezügen heimkehren sah, vollgesogen mit Angst, satt und feist wie Tiefseeschwämme, dann standen mir die Haare zu Berge. Anfangs wollten sie mich noch auf ihre Schlemmertouren mitnehmen, aber sie ließen es bleiben, als sie merkten, daß ich nicht übers Wasser gehen konnte.
Trotz meiner anfänglichen Abscheu vor den Klabautergeistern: Ich muß zugeben, daß ich immer mehr Spaß an den allabendlichen Vorstellungen fand. Das Lampenfieber am Anfang, meine immer besser werdenden Schluchzarien, der tosende Applaus am Schluß – ich wurde regelrecht süchtig danach. Es fiel mir immer leichter, einfach so loszuflennen (und ich kann es auch heute noch, wenn aus dramaturgischen Gründen gelegentlich mal ein paar Tränchen notwendig sind).
Ich brauchte nur an etwas Trauriges zu denken, und schon ging es los. Ich baute dramatische Steigerungen und wirkungsvolle Schluchzpausen in mein Programm ein. Ich beherrschte die ganze Palette, vom leichten Seufzen über das verzweifelte Schluchzen bis hin zum kreischenden Tobsuchtsanfall. Ich lernte, den Rhythmus meines Schluchzens mit der Melodie meines Heulens so perfekt abzustimmen, daß kleine Symphonien daraus entstanden. Ich konnte mein Kreischen in hysterische Höhen schrauben, um es gleich darauf wieder in tiefe Jammertäler des Schniefens abstürzen zu lassen. Manchmal sabberte ich minutenlang fast tonlos vor mich hin, um das Publikum in unerträgliche Spannung zu versetzen, und dann brüllte ich auf einmal los wie ein heimatloser Seehund.
Starallüren
Die Klabautergeister waren Wachs in meinen Händen. Jeden Abend wurden die Ovationen lauter, anhaltender und begeisterter. Sie erstickten mich beinahe mit Blumen, wanden mir Kränze und überschütteten mich mit Beeren und Obst – kein Wunder, daß ich mir immer mehr in meiner Rolle gefiel. Wenn man im Rampenlicht steht und den Beifall empfängt (auch wenn es nur das fahle Licht der Klabautergeister und ihr gespenstisches Geheul ist), kann einem das schon zu Kopf steigen. Man darf nicht vergessen, daß ich noch sehr jung war – es war erst mein zweites Leben.
Bald war ich für meine Starallüren bekannt und wurde gelegentlich sogar launisch wie eine Operndiva. Wenn mein Publikum nicht frenetisch genug applaudierte, wurde ich schroff und verließ ohne Zugabe die Bühne. An manchen Abenden täuschte ich Kopfschmerzen vor, um die Vorstellungen platzen zu lassen und die Klabautergeister zu quälen. Ich wurde ein ziemliches Ekel, fast so eklig wie die Klabautergeister selbst. Tatsächlich wurde ich ihnen immer ähnlicher. Ich fing an, ihren gruseligen Singsang zu imitieren und ihre Lieder nachzusummen. Zuerst hatte ich noch darauf bestanden, allein und unter freiem Himmel zu übernachten, aber nach einiger Zeit schlief ich bei ihnen in ihren Baumhöhlen. Ich kuschelte mich zwischen die summenden Gespenster und träumte ihre gruseligen Träume. Bald roch ich wie sie nach fauligem Holz und leuchtete manchmal ein ganz kleines bißchen im Dunkeln, weil ihr Leuchtgas in meinem Fell hängenblieb. Ich machte sogar mehrere vergebliche Versuche, übers Wasser zu gehen, um sie bei ihren Beutezügen begleiten zu können. Einmal wäre ich dabei beinahe in einem Waldtümpel ertrunken.
Mir selbst fiel gar nicht auf, wie sehr ich mich darum bemühte, ein Klabautergeist zu werden. In jungen Jahren ist es ganz natürlich, so sein zu wollen wie die anderen. Das eigentlich Schlimme daran war, daß ich mich offensichtlich damit abgefunden hatte, mein restliches Leben auf der Klabauterinsel zu verbringen.
Das Spiegelbild des Grauens
Eines Abends, als ich wieder mal versuchte, übers Wasser zu gehen (ich war bei meinen Übungen zu sehr seichten Gewässern übergegangen), sah ich mich selber im Spiegelbild einer großen Pfütze. Ich ertappte mich dabei, wie ich die gummiartigen Bewegungen der Klabautergeister nachäffte und sogar in ihr scheußliches meckerndes Gelächter verfiel. Das bewegte Wasser der Pfütze gab dabei meine Gliedmaßen ähnlich wabernd wie die der Klabautergeister wieder. Ich erschrak.
Was, schoß es mir plötzlich durch den Kopf, würden wohl die Zwergpiraten von mir denken, wenn sie mich so sehen könnten? Ich schämte mich sehr. Noch heute steigt mir die Schamröte ins Gesicht, wenn ich an diesen Anblick zurückdenke.
Das war der Augenblick, in dem ich beschloß, von der Klabauterinsel zu fliehen. Wenn schlechte Dinge zur Gewohnheit werden, muß man die Verhältnisse ändern.
ines Morgens, als der Frühnebel träge über den Baumfriedhof kroch, schlich ich mich aus dem Wald. Die Klabautergeister schliefen tief und fest in ihren Baumhöhlen. In der Nacht zuvor hatten sie einen erfolgreichen Beutezug gemacht, aufgeschwemmt und summend vor Zufriedenheit waren sie zurückgekommen. Jetzt verdauten sie im Schlaf die aufgesogene Angst und schnarchten und fiepten wie vollgefressene Beutelratten. Ich warf einen letzten angewiderten Blick auf sie und machte mich auf den Weg zum Strand.
Flucht aufs Meer
In den vorherigen Tagen hatte ich kleine umgestürzte Bäumchen vom Waldrand an die Küste geschleppt und mit Lianen zusammengebunden. Als Segel für mein Floß benutzte ich ein großes fettes Palmblatt. Ein paar Kokosnüsse hatte ich ausgehöhlt, mit Wasser gefüllt, wieder versiegelt und zusammen mit den ungeöffneten, die als Nahrung dienen sollten, mit dünnen Lianen am Mast festgebunden. Das war mein ganzer Proviant.
Ich schob das Floß in die Brandung. Rasch wurde ich auf See gezogen, denn gerade begann die Ebbe. Wohin würden mich der Wind und die Wellen treiben? Auf ein Steuer hatte ich verzichtet. Man muß dem Schicksal eine Chance geben.
Ich fühlte mich großartig. Der Wind in meinem Fell und unter mir das wilde Meer, anscheinend nur dazu da, um mich dem Abenteuer entgegenzutragen. Gab es etwas Aufregenderes als eine Entdeckungsfahrt ins Unbekannte, als eine Reise über den großen, weiten Ozean?
Flaute
Drei Stunden später dümpelte mein Floß im Zentrum einer kolossalen Flaute. Konnte man sich etwas Langweiligeres vorstellen als eine Reise übers Meer? Das Meer, bah! Eine öde Salzwasserwüste, glatt und ereignislos wie ein riesiger Spiegel, auf jedem Tümpel im Klabauterwald war mehr los. Nichts geschah, nicht mal eine Möwe kam vorbeigeflogen. Ich hatte auf unbekannte Kontinente und geheimnisvolle Inseln oder zumindest auf ein Zwergpiratenschiff gehofft, aber es trieb noch nicht mal eine Flaschenpost vorbei. Erst nach geraumer Zeit kreuzte ich den Weg einer morschen Holzplanke. Es dauerte Stunden, bis sie an mir vorbeigetrieben war. Das war das aufregendste Schauspiel, das sich mir auf meiner bisherigen Reise bot. Ich knackte eine Kokosnuß und fing an, mich zu langweilen.
Je jünger man ist, desto qualvoller empfindet man die Langeweile. Sekunden dehnen sich zu Minuten, Minuten zu Stunden. Man hat das Gefühl, auf ein Folterinstrument aus Zeit gespannt zu sein und ganz langsam auseinandergezogen zu werden. Endlos plätscherten die winzigen Wellen vorbei, endlos wölbte sich der strahlendblaue Himmel. Wenn man relativ unerfahren auf See ist und den Horizont beobachtet, dann glaubt man, jeden Augenblick müsse irgend etwas Atemberaubendes an ihm zum Vorschein kommen. Aber das einzige, was dahinter auf einen wartet, ist ein neuer Horizont. Ich hätte jede Veränderung begrüßt, einen Sturm, ein Seebeben, ein gräßliches Tiefseeungeheuer. Aber wochenlang blieb es allein bei den Wellen, dem Himmel und den Horizonten.
Ich fing schon an, mich nach der ekligen Gesellschaft der Klabautergeister zurückzusehnen, als sich die Lage dramatisch änderte. Schon seit ein paar Tagen war das Meer ungewöhnlich unruhig gewesen, obwohl kaum Wind herrschte. Der stille, grüne Ozean hatte sich in eine graue, nervöse Gischt verwandelt, in der Luft lag schwerer Ruß und der Geruch von rostigem Metall. Aufgeregt hüpfte ich auf meinem Floß herum und versuchte vergeblich, die Ursache all dessen auszumachen. Dann kam ein Geräusch dazu, wie gleichmäßiger Donner, der immer näher kam. Der Himmel verdunkelte sich von Minute zu Minute. Schon hatte ich ihn, meinen ersehnten Sturm.
Das Riesenschiff
So dachte ich jedenfalls, bis das riesige Schiff aus schwarzem Eisen in der Ferne erschien.
Es hatte nicht weniger als tausend Schornsteine, die hoch oben in dem Qualm, der aus ihnen emporstieg, verschwanden. Der Himmel war völlig vom Ruß verdunkelt, und das Meer wurde tintenschwarz von den Flocken, die unablässig herabfielen wie schwarzer Schnee.
Ich dachte zuerst, das Schiff käme direkt aus der Hölle, um mich zu zermalmen, so zielstrebig wälzte es sich auf mich zu. Dann wurde ich von der Bugwelle hochgerissen und wie ein Korken aus seinem Fahrwasser geschwemmt. Jetzt konnte ich es aus sicherer Entfernung beobachten, ein finsteres Gebirge aus Eisen, das langsam vorbeizog. Die Schiffsschrauben, die es antrieben, müssen größer gewesen sein als Windmühlen.
Ich weiß nicht mehr, wie lange es dauerte, bis es ganz vorübergefahren und wieder aus meinem Sichtfeld verschwunden war, aber es zog sich wohl ungefähr einen Tag und eine Nacht hin. Ich wußte es damals noch nicht, aber das war die MOLOCH, das größte Schiff, das jemals die Meere befahren hat.
Aus dem Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebungvon Prof. Dr. Abdul Nachtigaller
* * * * * * *
Moloch, die: Mit 936589 Bruttoregistertonnen und eintausendzweihundertvierzehn Kaminschloten gilt die Moloch als das größte Schiff der Welt. Nähere Angaben über die Moloch können nicht gemacht werden, jedenfalls keine wissenschaftlich abgesicherten, da niemand, der jemals die Moloch betreten hat, wieder zurückgekehrt ist, um von ihr zu berichten. Natürlich ranken sich Tausende von Legenden um dieses Schiff, aber keine davon hat erkennbaren Anspruch auf Glaubwürdigkeit.
In der Nacht leuchteten Tausende von Bullaugen heller als die Sterne – die Fenster einer schwimmenden Riesenstadt. Das Stampfen der Maschinen war ohrenbetäubend, es klang wie eine Armee aus Eisen, die über den Ozean marschiert.
Tagsüber versuchte ich, jemanden an Deck auszumachen, aber es war so hoch, daß ich kaum etwas erkennen konnte. Ab und zu tauchten schemenhaft Gestalten an der Reling auf und warfen Abfälle ins Meer, dann machte ich jedesmal ein Mordsspektakel, winkte und jaulte, sprang auf dem Floß auf und ab und schwenkte das Palmblatt, aber meine Versuche waren genauso fruchtlos wie die Kaperversuche der Zwergpiraten.
Es war nicht ganz ungefährlich. Mehr als einmal geriet ich beinahe in den Sog der gigantischen Schiffsschrauben, Schwärme von Haien drängelten sich dicht um den Schiffsrumpf und rissen sich um die Essensabfälle, die unablässig über Bord geworfen wurden. Man hätte über ihre Rücken bis zur Bordwand spazieren können, so viele waren es manchmal.
Die Stimme im Kopf
Das erstaunlichste aber war etwas anderes. Trotz seiner monströsen Häßlichkeit ging von dem Riesenschiff eine geheimnisvolle Anziehungskraft auf mich aus. Es gab dafür keinen einsehbaren Grund, alles an dieser Maschine war abstoßend, dennoch hatte ich keinen dringlicheren Wunsch, als auf ihr die Meere zu befahren. Der Wunsch erschien in meinem Kopf in dem Augenblick, als die Moloch als kleiner Punkt am Horizont auftauchte, und er wuchs, je näher sie mir kam. Während das Schiff mein Floß passierte, wurde diese Sehnsucht geradezu übermächtig.
»Komm!«sagte eine Stimme in meinem Kopf.
»Komm auf die Moloch!«
Die Stimme hatte einen unwirklichen Klang, wie aus dem Jenseits gesprochen, von einem Wesen ohne Körper.
»Komm!«sagte sie.»Komm auf die Moloch!«
Ich wäre dieser Aufforderung damals liebend gerne nachgekommen. Heute weiß ich, daß es mein Glück war, daß zwischen mir und dem Schiff diese unüberwindbare Barriere aus Haifischen existierte, aber damals zerriß es mir beinahe mein kleines Herz, die Moloch davonziehen zu sehen.
»Komm! Komm auf die Moloch!«
Schließlich verschwand der Schiffsgigant aus meinem Gesichtskreis, während der Himmel noch lange schwarz blieb, wie bei einem sich entfernenden Gewitter.
Immer dünner klang die Stimme in meinem Kopf.
»Komm!« sagte sie nur noch ganz leise. »Komm auf die Moloch!«
Dann waren beide, das Schiff und die Stimme, verschwunden. Irgendwie stimmte mich das traurig. Damals dachte ich, ich würde es nie wiedersehen. Ich konnte ja nicht ahnen, welch entscheidende Rolle die Moloch in meinem Leben noch spielen sollte.
Der Ozean lag nun seit Tagen wieder ruhig und silbern da, nur ab und zu segelte ein Schönwetterwölkchen über den Horizont. Nachdem ich die Moloch gesehen hatte, verlor ich jeglichen Respekt vor meinem eigenen Wasserfahrzeug. Eindringlicher konnte einem der Unterschied zwischen einem Schiff und einem Floß nicht vor Augen geführt werden.
Ich erwog gerade die Möglichkeit, einfach ins Wasser zu springen und schwimmenderweise das Land zu erreichen, als ich klar und deutlich zwei Stimmen hörte:
»Naja, also auf jeden Fall – ich kann dir sagen!« sagte die eine.
»Ist nicht die Möglichkeit!« rief die andere.
Ich spähte in alle Himmelsrichtungen. Es war nichts zu sehen.
»Wenn ich’s dir doch sage!« erklang wieder die eine Stimme.
»Na, du kannst mir viel erzählen!« sagte die andere.
Ich stellte mich auf die Zehenspitzen. Nichts, gar nichts weit und breit. Außer Wellen.
»Ich hab’s dir neulich schon gesagt! Sag nicht, daß ich es dir nicht gesagt habe!«
Klopfte da der Wahnsinn an meine Tür? Schon mancher wackere Seemann hatte durch die Eintönigkeit der Ozeane den Verstand verloren. Ich sah nur Wellen. Kleine Wellen, mittlere Wellen und zwei ziemlich große Exemplare, die sich direkt auf mich zubewegten. Je näher sie kamen, desto deutlicher wurden die Stimmen.
»Du hast mir gar nichts zu sagen! Wenn hier eine das Sagen hat, dann ja wohl ich!«
Es waren die beiden Wellen, die da quasselten.
Aus dem Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebungvon Prof. Dr. Abdul Nachtigaller
* * * * * * *
Tratschwellen, die: Tratschwellen entstehen fast ausschließlich in besonders abgelegenen, ereignisarmen und mäßig beschifften Gegenden der Ozeane, meistens während anhaltender Flauten. Eine genauere wissenschaftliche Betrachtung und Herkunftsanalyse hat bisher noch nicht stattgefunden, da Tratschwellen dazu neigen, ihre Opfer um den Verstand zu bringen. Die wenigen Wissenschaftler, die es gewagt haben, Tratschwellen zu erforschen, sitzen heute in gutbewachten Gummizellen oder ruhen auf dem Grund des Meeres, in Form von Gerippen, durch die die Tropenfische schwimmen.
Normalerweise erscheinen Tratschwellen ausschließlich Schiffbrüchigen, umkreisen dann tage- oder wochenlang die Hilflosen und setzen ihnen mit ihren geschmacklosen Scherzen und zynischen Bemerkungen über die Aussichtslosigkeit der Lage so lange zu, bis die Bedauernswerten den von Wassermangel und Sonnenbestrahlung schon strapazierten Verstand vollends verlieren. Eine alte zamonische Sage ist der Ursprung für den populären Irrglauben, die Tratschwellen seien die wellengewordenen Gedanken eines gelangweilten Ozeans.
Es sind schon mehr Schiffbrüchige durch Tratschwellen umgekommen als durch Verdursten. Aber das wußte ich damals alles noch nicht. Für mich war es lediglich eine willkommene Ablenkung in der Ödnis der Flaute.
Die beiden Wellen waren nun ganz nahe herangekommen. Als sie mich sahen, auf meinem wackligen Floß, nackt und ausgebleicht von der sengenden Sonne, bekamen sie einen Lachanfall.
»Du meine Güte!« schrie die eine Welle. »Was haben wir denn da?«
»Einen Luxusdampfer!« kreischte die andere. »Mit Sonnendeck!«
Sie schwappten hin und her vor Lachen. Ich verstand nicht ganz, was sie meinten, aber ich lachte mit, um mit ihnen in Kontakt zu kommen.
Die Wellen umkreisten das Floß wie zwei Haifischflossen.
»Wahrscheinlich denkst du jetzt, du hast den Verstand verloren, nicht wahr?« fragte die eine.
»Sprechende Wellen sind das erste Anzeichen für einen Sonnenstich, wußtest du das?« die andere.
»Ja, und danach kommen singende Fische. Du solltest dir dein Schicksal erleichtern. Spring einfach ins Wasser!«
Sie schwappten hin und her und schnitten gräßliche Grimassen.
»Huuuh!« rief die eine Welle.
»Buuuh!« die andere.
»Wir sind die Wellen des Grauens!«
»Spring schon! Mach der Qual ein Ende!«
Ich dachte nicht daran zu springen. Im Gegenteil, ich war hocherfreut, daß sich endlich jemand um meine Unterhaltung bemühte. Ich setzte mich an den Rand des Floßes und betrachtete amüsiert das Schauspiel.
»Mal im Ernst, Kleiner …«, sagte eine der Wellen, nachdem sie bemerkt hatten, daß sie mit der Nummer bei mir nicht weit kamen. »Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her?«
Das war das erste Mal in meinem Leben, daß mich jemand etwas fragte. Ich hätte gerne geantwortet, aber ich wußte ja gar nicht, wie das geht.
»Was ist los, Junge?« fuhr mich die andere Welle schroff an. »Hast du deine Zunge verschluckt? Kannst du nicht sprechen?«
Ich nickte. Ich konnte zuhören, aber nicht sprechen. Weder die Zwergpiraten noch die Klabautergeister hatten darauf Wert gelegt, daß ich sprechen lernte. Mir fiel es auch gerade erst selber auf.
Die beiden sahen zunächst mich, dann sich selbst lange und tief betroffen an.
»Das ist ja furchtbar! Er kann nicht sprechen. Hast du so etwas Schreckliches schon jemals gehört?« sagte die eine.
»Das ist ja grauenvoll!« rief die andere. »Das stelle ich mir schlimmer vor als … als Verdunsten!«
Die Wellen umkreisten mich mit besorgten Gesichtern.
»Du Ärmster der Armen! Verurteilt zum ewigen Schweigen! Was für ein bedauernswertes Geschöpf!«
»Das ist wirklich das Erschütterndste, was ich in meinem bisherigen Leben gesehen habe!«
»Erschütterung ist kein würdiges Wort für meine Empfindungen angesichts eines solchen Schicksals! Tragik weht mich an!«
»Tragödie!« schrie die eine Welle.
»Klassische Tragödie!« die andere.
Sie fingen beide an, bitterlich zu weinen.
Von einer Sekunde auf die andere beruhigten sie sich wieder, steckten ihre Wellenkämme zusammen und beratschlagten sich:
»Ich habe überhaupt keine Lust, ihn zu verhöhnen.«
»Geht mir genauso. Ich bin einfach zu betroffen zum Verhöhnen. Es ist seltsam, aber … mir … mir ist irgendwie so nach helfen zumute.«
Die andere Welle schüttelte sich ein wenig. »Ja! Mir auch! Eigenartiges Gefühl, nicht wahr?«
»Ja … so fremd! Aber irgendwie … auch interessant! Wild! Neu! Nie dagewesen!«
»Wild! Neu! Nie dagewesen!« wiederholte die andere Welle begeistert.
»Nun ja – aber wie kann man ihm nur helfen? Was kann man da nur machen?«
Grübelnd zogen die Wellen ihre Kreise um mein Floß.
»Ich hab’s!« rief die eine Welle. »Wir bringen ihm das Sprechen bei!«
»Meinst du, das geht?« zweifelte die andere. »Ich finde, er sieht ein bißchen minderbemittelt aus.«
Eine der Wellen schwappte direkt zu mir hin. »Sag mal ›A‹!« befahl sie, sah mir tief in die Augen und streckte mir eine Zunge aus Meerwasser entgegen.
»A!« sagte ich.
»Siehst du!« rief sie. »Wer A sagen kann, kann in Null Komma nichts auch Binomialkoeffizient sagen!«
Sprechunterricht
In den folgenden Wochen umkreisten die Tratschwellen unermüdlich mein Floß und brachten mir das Sprechen bei. Zunächst lernte ich so einfache Wörter wie »Welle« oder »Woge«, dann schon schwierigere wie »Flutwelle« oder »Wellengang«. Ich lernte große und kleine Wörter, Tätigkeitswörter, Wiewörter, Umstandswörter, Nebenwörter, Bindewörter, Hauptwörter und Widerworte; schöne Wörter und auch solche, die man gar nicht erst sagen sollte. Ich lernte, wie man diese Wörter buchstabiert, artikuliert, dekliniert und konjugiert, substantiviert, genitiviert, akkusativiert und dativiert. Dann kamen wir zu den Sätzen. Hauptsätze, Nebensätze, Zwischensätze, Über- und Untersätze, Frage- und Halbsätze, Satzfetzen, Satzteile und ganze Satzungen.
Damit das klar ist: Die Tratschwellen brachten mir nicht das Schreiben bei, sondern nur das Sprechen. Das geschriebene Wort hat auf hoher See keine Bedeutung. Das Papier wird zu schnell naß.
Die Tratschwellen gaben sich nicht damit zufrieden, mir einfach das Sprechen beizubringen, sie wollten, daß ich es in allen Formen perfekt beherrschte.
Sie lehrten mich murmeln, quasseln und labern, tuscheln und grölen, plaudern, quatschen, parlieren, intrigieren und natürlich tratschen. Die Tratschwellen brachten mir bei, wie man eine Rede hält, wie man Selbstgespräche führt, und weihten mich in die Geheimnisse der Überredungskunst ein: wie man andere in Grund und Boden quatscht, aber auch, wie man sich selber um Kopf und Kragen quasselt. Ich lernte reden unter extrem erschwerten Bedingungen, auf einem Bein stehend, im Handstand oder mit einer Kokosnuß im Mund, während sie mich mit Wasser bespritzten.
Von der Gehässigkeit der Tratschwellen war schon längst nichts mehr zu spüren. Wahrscheinlich hatten sie noch nie eine solch verantwortungsvolle und interessante Tätigkeit gehabt. Sie gingen ganz darin auf, und ich muß sagen, daß sie wirklich gute Lehrmeister waren. Vom Quasseln verstanden sie was.
Ich wurde selbst ein Meister des gesprochenen Worts. Nach fünf Wochen war ich soweit, daß mir die Wellen nichts mehr beibringen konnten, ja, ich war ihnen fast ein bißchen über. Ich konnte jedes Wort sprechen, das es gab, in jeder gewünschten Lautstärke, vorwärts und rückwärts. »Binomialkoeffizient« war noch eins von den einfachen.
Ich konnte eine Rede schwingen, einen Toast ausbringen, einen Schwur schwören (und wieder brechen), einen Fluch ausstoßen, einen Monolog deklamieren, einen Vers schmieden, ein Kompliment schleimen, Stuß reden und Unverständliches lallen. Ich konnte frisch von der Leber reden, mich entrüsten, über jemanden herziehen, mir das Maul zerreißen, andere schlechtmachen, eine Tirade ablassen, referieren, eine Predigt halten und natürlich ab jetzt auch mein Seemannsgarn spinnen.
Nachdem ich das Sprechen gelernt hatte, konnte ich mich endlich unterhalten, natürlich zunächst nur mit den Tratschwellen. Allzu viel zu vermitteln hatte ich aufgrund meiner mangelnden Lebenserfahrung nicht. Dafür hatten die Wellen um so mehr zu erzählen. Seit Jahrhunderten, so behaupteten sie jedenfalls, durchkreuzten sie die Ozeane, dabei bekommt man natürlich einiges zu sehen. Sie berichteten von gewaltigen Hurrikanen, die Löcher ins Meer wirbelten, von riesigen Seeschlangen, die miteinander kämpften und sich mit flüssigem Feuer bespien, von roten durchsichtigen Walen, die Schiffe verschluckten, von Oktopussen, deren Tentakel kilometerlang waren und ganze Inseln umarmen konnten, von Wasserkobolden, die auf den Wellenkämmen tanzten und fliegende Fische mit bloßen Händen fingen, von brennenden Meteoren, die das Meer zum Kochen brachten, von untergehenden und von auftauchenden Kontinenten, von Unterwasservulkanen, Geisterschiffen, Schaumhexen, Meergöttern, Wellenzwergen und Seebeben. Am liebsten erzählten sie aber hinterrücks Schlechtes übereinander. Jedesmal, wenn eine der Wellen sich etwas weiter vom Floß entfernte, schnatterte die andere drauflos, von welch zweifelhaftem Charakter die andere Welle sei und daß man ihr kein Wort glauben könne, und so weiter. Das Schlimme daran war, daß ich die beiden nicht unterscheiden konnte. Sie waren nämlich Zwillingswellen. In diesem Fall stimmte ausnahmsweise das alte Vorurteil, eine Welle sähe wie die andere aus.
Ich hatte mich längst an die beiden gewöhnt. Wenn man jung ist, schließt man schnell Freundschaft und glaubt, das bliebe immer so. Aber es kam der Tag, an dem sich etwas im unbekümmerten Verhalten der Wellen änderte. Seit mehreren Stunden hatten die beiden das Floß umkreist, ohne ein einziges Wort zu sagen. Das war außergewöhnlich. Ich überlegte, ob ich irgend etwas falsch gemacht hatte. Die Wellen schwappten schließlich zum Floß und fingen an herumzudrucksen.
»Wir müssen dann mal …«, sagte die eine.
»Das Gesetz des Ozeans und so weiter«, schniefte die andere.
Dann fingen beide an zu flennen.
Nachdem sie sich wieder gefangen hatten, erklärten sie mir die Situation: Eine starke Strömung beunruhigte schon seit Tagen das Meer, und die Tratschwellen wußten, daß sie dieser Strömung folgen mußten. Wenn Wellen zu lange an einer Stelle bleiben, verdunsten sie. Deswegen sind sie dazu verurteilt, ruhelos die Ozeane zu durchkreuzen.
»Vielen Dank für alles!« sagte ich, denn ich konnte ja jetzt sprechen.
»Ach, das war doch gar nichts!« sagte die eine Welle, und ich konnte hören, daß sie mit den Tränen kämpfte.
»Zum ersten Mal weiß ich nicht, was ich sagen soll!«
Ein Name fürs Leben
»Wir haben noch was für dich«, sagte die andere Welle.
»Einen Namen!«
»Genau«, sagte die eine Welle, »wir nennen dich Blaubär.«
Das zeigte, daß es mit der Phantasie der Tratschwellen nicht sehr weit her war, aber immerhin. Einen Namen hatte ich bisher noch nicht gehabt.
Beide gaben mir eine feuchte Umarmung. Auch mir war nach Heulen zumute. Dann schwappten sie schluchzend davon.
Die Sonne ging langsam unter, und vor ihrem versinkenden Rund sah ich ihre Silhouetten Richtung Horizont entschwinden. Aber schon nach wenigen Metern rissen sie sich wieder zusammen und schnatterten los:
»Na, also ich sage dir …«
»Du hast mir gar nichts zu sagen!«
»Das hast du nicht umsonst gesagt!« Und so tratschten sie weiter; noch Stunden später, als sie längst außer Sicht waren, konnte ich von ganz weit weg ihr Geschwafel hören.
Langsam gingen meine Kokosnußvorräte zur Neige, und durch den anstrengenden Unterricht waren meine Flüssigkeitsreserven fast vollständig aufgebraucht. Zudem brannte schon seit geraumer Zeit eine gnadenlose Sonne auf meinen ungeschützten Kopf, denn ich trieb in immer südlichere Gewässer.
Ein großes Auge
Nach drei Tagen war mein Gehirn so ausgedörrt, daß ich nur noch dasaß und dumpf auf die Wasseroberfläche starrte. Wenn man Meerwasser lange genug anstarrt, kann man irgendwann die seltsamsten Dinge in seinem Schaum entdecken. Tiere, Drachen, ganze Armeen von Ungeheuern, die sich gegenseitig bekämpfen, tanzende Seegeister, springende Meerjungfrauen und seltsame graue Schatten mit Hörnern und Schwänzen. Bald hatte ich das Gefühl, auf den Grund des Meeres blicken zu können. Ich sah durchsichtige Paläste, die unter mir schwebten wie U-Boote aus Glas. Ich sah einen Kraken mit eintausend Armen. Ein Piratenschiff, vollbesetzt mit klappernden Gerippen, die schaurige Lieder sangen. Und dann sah ich das Gräßlichste von allem: eine riesige Fratze, zehnmal größer als mein Floß, mit nur einem einzigen Auge, so groß wie ein Haus, das wild in seiner Höhle rollte, bis nur noch das Weiße von ihm zu sehen war.
Darunter ein Maul, groß genug, um jedes Schiff zu verschlingen, ein mächtiger Unterkiefer, besetzt mit dünnen langen Zähnen, die kaum zu zählen waren. Gierig aufgeklappt war der Schlund, ich konnte in ihn hinabsehen wie in ein nasses Grab. Das Gesicht war von verhornten Runzeln und Schuppen übersät, von kleinen Kratern und tiefen Narben. Betäubt starrte ich weiter ins Wasser.
Aber diese Visage konnte mich nicht schrecken. Sie war ja nur ein Gespinst meines ausgedörrten Verstandes.
So dachte ich. War sie aber nicht. Es war ein Tyrannowalfisch Rex.
Aus dem Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebung von Prof. Dr. Abdul Nachtigaller
* * * * * * *
Tyrannowalfisch Rex, der: Quermäuler aus der Ordnung der Knorpelfische, mit Verwandtschaftsverhältnissen zum Mörderwal, der Riesenmuräne, dem Haifisch, dem Fleischfressenden Saurier und dem Zyklopen. Vom Wal hat er die Größe, von der Muräne die Form des Unterkiefers, vom Haifisch die Gier, alles zu verschlingen, was in seinen Rachen paßt, vom Saurier den Instinkt, alles zu jagen, was sich bewegt, und vom Zyklopen die Einäugigkeit. Man darf den Tyrannowalfisch Rex mit seinen 45 Metern Körperlänge getrost zu den größten Raubtieren der Welt zählen. Seine Haut ist mit Knorpelkörnern durchsetzt und kohlenschwarz, weswegen man ihn auch den Schwarzen Wal nennt. Der Kopf besteht aus einer einzigen großen Knochenplatte, mit der er sogar größere Handelsschiffe durch Rammen zum Versinken nötigen kann. Dankenswerterweise ist der Tyrannowalfisch beinahe ausgestorben, manche Wissenschaftler behaupten, es gebe nur noch ein einziges Exemplar, das seit vielen Jahrzehnten die zamonischen Gewässer unsicher mache. Viele Waljäger haben versucht, es zu erlegen, keinem ist es gelungen, viele davon wurden nie wiedergesehen.
Erst als der Schwarze Wal vor mir aus dem Wasser auftauchte, erwachte ich aus meinem Tagtraum. Es war, als würde eine Insel aus dem Meer geboren, hoch über mein Floß erhob sich ein Gebirge aus dunklem Walspeck, mit Tausenden von Warzen, so groß wie Felsblöcke. In Sturzbächen lief das Wasser durch die Speckfalten den Buckel des Monstrums herab und stürzte zurück ins Meer. Die Wasserfälle erzeugten Strudel rings um den Wal, einer davon erfaßte mein Floß und wirbelte es im Kreis herum.
Ein atemberaubender Gestank verbreitete sich.
Ich klammerte mich am Mast fest und versuchte, so wenig wie möglich zu atmen. Die Wirbel ließen nach, dafür blies der Wal jetzt durch sein Atemloch eine gigantische Wasserfontäne in die Luft, vielleicht hundert Meter hoch. Fasziniert beobachtete ich dieses Schauspiel, ohne daran zu denken, welche Folgen es für mich haben könnte.
Einen Moment lang schien es, als ob die Fontäne einfrieren würde. Durchsichtig wie ein geeister Wasserfall stand sie vor der Sonne. Man konnte Tausende von Fischen darin sehen, kleine wie große, ganze Kabeljauschwärme, Tümmler und auch einige Haie, ein größerer Oktopus und das abgebrochene Steuerrad eines Schiffes.
Dann stürzte die Fontäne zurück in den Ozean. Das Wasser kam mit einer Wucht auf mich nieder, als würden Lokomotiven ins Meer geworfen. Mein Floß wurde mit einem Schlag zertrümmert, immer tiefer wurde ich von den Wassermassen nach unten gepreßt. Rings um mich herum schlugen die Haie ein, die aber zum Glück selbst viel zu verdutzt waren, um nach mir zu schnappen.
Endlich ließ der Druck nach, und ich schoß wieder an die Wasseroberfläche wie ein Korken. Kaum hatte ich Luft geholt und mich einigermaßen orientiert (ich befand mich direkt vor dem Zyklopenauge des Monstrums), da öffnete es seinen Schlund, um neues Wasser hineinzulassen.
Barten