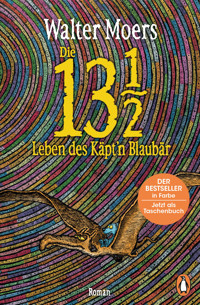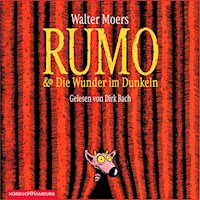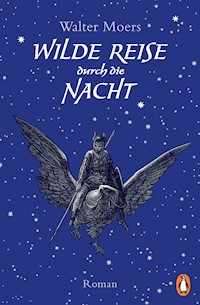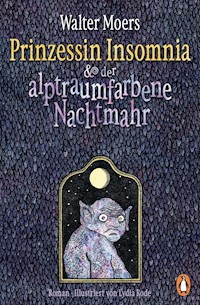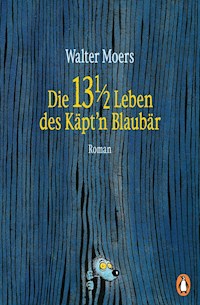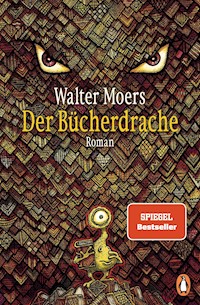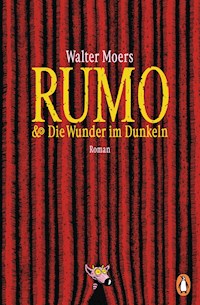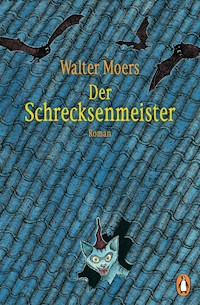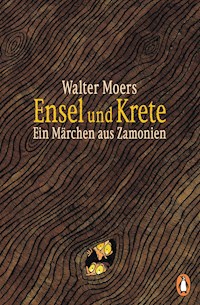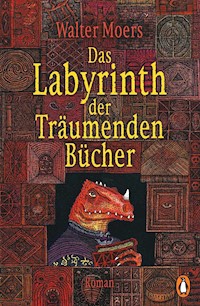16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 34,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Walter Moers in Bestform – große Erzählkunst aus Zamonien
Hildegunst von Mythenmetz hätte gewarnt sein müssen. Schon auf der Überfahrt zur Insel Eydernorn, wo er seine Bücherstauballergie kurieren will, entgeht er nur knapp dem Tod. Doch im Hotel erwartet ihn ein musikalisches Hummdudel, seine Prominenz verhilft ihm zum Rang eines Patienten erster Klasse, und hilfreiche Küstengnome bieten ihm ihre Dienste an. Neugierig erforscht er die bizarre Fauna und Flora der Insel und widmet sich den hundertelf Leuchttürmen, die in der Nacht funkeln wie tausend. Alles könnte so erholsam sein, wären da nur nicht die immer bedrohlicher werdenden Begegnungen mit der Natur Eydernorns: hungrigen Belphegatoren und aufdringlichen Strandlöpern, monströsen Frostfratten, schaurigen Wolkenspinnen und dem gefährlichsten Dämon aus der Tiefe des zamonischen Ozeans, dem sagenumwobenen Quaquappa.
Walter Moers`mit über 100 Zeichnungen illustriertes Epos über den selbstlosen Kampf einer verschworenen Gemeinschaft, die alles daransetzt, Zamonien vor der Apokalypse zu retten. Und mittendrin der Schriftsteller Hildegunst von Mythenmetz als dem gnadenlosen Schicksal ausgelieferter Held wider Willen. Wie jeder Zamonienroman erzählt auch »Die Insel der Tausend Leuchttürme« eine in sich geschlossene Geschichte, die Neueinsteigern so unterhaltsam wie mühelos den Weg in den Moers'schen Kosmos bahnt.
Folgende weitere Zamonienromane sind bislang erschienen:
Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär
Ensel und Krete
Rumo & die Wunder im Dunkeln
Die Stadt der Träumenden Bücher
Der Schrecksenmeister
Das Labyrinth der Träumenden Bücher
Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr
Weihnachten auf der Lindwurmfeste
Der Bücherdrache
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 831
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Hildegunst von Mythenmetz hätte gewarnt sein müssen. Schon auf der Überfahrt zur Insel Eydernorn, wo er seine Bücherstauballergie kurieren will, entgeht er nur knapp dem Tod. Doch im Hotel erwartet ihn ein musikalisches Hummdudel und seine Prominenz verhilft ihm zum Rang eines Patienten erster Klasse. Neugierig erforscht er die bizarre Fauna und Flora der Insel und widmet sich den hundertelf Leuchttürmen, die in der Nacht funkeln wie tausend. Alles könnte so erholsam sein, wären da nur nicht die immer bedrohlicher werdenden Begegnungen mit der Natur Eydernorns: hungrigen Belphegatoren und aufdringlichen Strandlöpern, monströsen Frostfratten und dem gefährlichsten Dämon aus der Tiefe des zamonischen Ozeans, dem sagenumwobenen Quaquappa.
Walter Moers` mit über 100 Zeichnungen illustriertes Epos über den selbstlosen Kampf einer verschworenen Gemeinschaft, die alles daransetzt, Zamonien vor der Apokalypse zu retten. Wie jeder Zamonienroman erzählt auch »Die Insel der Tausend Leuchttürme« eine in sich geschlossene Geschichte, die Neueinsteigern so unterhaltsam wie mühelos den Weg in den Moers‘schen Kosmos bahnt.
Über den Autor
Der Lindwurm Hildegunst von Mythenmetz ist der bedeutendste Großschriftsteller Zamoniens. Sein Schöpfer Walter Moers hat sich mit seinen fantastischen Romanen weit über die Grenzen des deutschen Sprachraums hinaus in die Herzen der Leser und Kritiker geschrieben. Alle seine Romane wie »Die 13 ½ Leben des Käpt'n Blaubär«, »Die Stadt der Träumenden Bücher«, »Der Schrecksenmeister«, »Prinzessin Insomnia und der alptraumfarbene Nachtmahr«, »Weihnachten auf der Lindwurmfeste« und »Der Bücherdrache« waren Bestseller.
Mit Bleistiftzeichnungen von Hildegunst von Mythenmetz
Herausgegeben, aus dem Zamonischen übertragen, mit zusätzlichen Illustrationen und einem Nachwort versehen von Walter Moers
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 beim Penguin Verlag in derPenguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Lektorat: Rainer Wieland
Covermotiv: Walter Moers
Gesamtgestaltung und Satz: Oliver Schmitt, Mainz
Illustrationen: Walter Moers
E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-19782-7V001
www.penguin-verlag.de
www.zamonien.de
Für eine Reise muss man nicht das Haus verlassen.
Die phantastischsten Reisen sind die im eigenen Kopf.
Gryphius von Odenhobler
Nicht jeder Verkannte ist ein Genie.
Amphlora Selenword
Am Fuße des Leuchtturms herrscht die Dunkelheit.
Eydernorner Sprichwort
Die Pharologie ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit Leuchttürmen. Die Eydernornische Pharotechnologie hingegen ist die von den Leuchtturmwärtern der Insel Eydernorn außerordentlich hochentwickelte Kunst zur Konstruktion und Illuminierung ihrer Leuchttürme.
Aus dempraktischen Reiseführer für Eydernorn von Pharicustos De Bong
Statt eines Vorwortes
Heute Morgen habe ich aus einer sentimentalen Laune heraus angefangen, im Briefwechsel zwischen mir und meinem alten Freund Hachmed Ben Kibitzer zu lesen. Die Lektüre versetzte mich bald in fiebrige Erregung, ich verschlang ungeduldig einen Brief nach dem anderen – fast so wie ich in meiner Jugend jeden neuen Abenteuerroman von Prinz Kaltbluth verschlungen habe. Ich vergaß darüber das Essen und das Trinken und zeitweise sogar, dass ich diese Briefe einst selber geschrieben hatte und die Hauptrolle darin spiele. Ich musste abwechselnd lachen und weinen und geriet auch sonst in so ziemlich jeden emotionalen Zustand, in den ein betagter Lindwurm wie ich noch geraten kann.
Das mag daran gelegen haben, dass ich ausgerechnet das Paket mit jenen Briefen herausgefischt habe, die meine Reise nach Eydernorn, der Insel der Tausend Leuchttürme, behandeln. Als heilsamer Kuraufenthalt geplant, den ich mit pharologischen Studien anzureichern gedachte, entwickelte er sich zu einem spektakulären Abenteuer, das aus meinen zahlreichen Wanderungen durch Zamonien aufgrund seiner außergewöhnlichen Ereignisse weit herausragt. Einzigartig an diesem Teil meines Briefverkehrs mit Hachmed Ben Kibitzer ist auch, dass er aus schicksalhaften Gründen ausschließlich Schreiben von mir, aber keine Antworten Hachmeds enthält.
Jetzt endlich, tief in der Nacht, habe ich die pausenlose Lektüre beendet. Ich versuche, mich zu beruhigen, indem ich literweise Baldriantee trinke, aber an Schlaf ist nicht zu denken. Zu lebhaft stehen mir die aufwühlenden Erinnerungen vor dem geistigen Auge. Die Bilder von all den ungeheuerlichen und schönen, furchterregenden und betörenden, schrecklichen und wunderbaren Dingen, die ich auf dieser Reise gesehen habe. Die Bilder von Nephelenia und Queekwigg und Inazea. Von Hummdudeln und Frostfratten und Wolkenspinnen. Das Bild vom Quaquappa, dem unbeschreiblichen Dämon aus der Tiefe des Zamonischen Ozeans. Und natürlich die unvergesslichen Bilder der Leuchttürme von Eydernorn, die in der Nacht gemeinsam funkeln und strahlen, als wären es tausend.
Tagebucheintrag von Hildegunst von Mythenmetz
Erster Brief
Liebster Hachmed,
du kennst ja meine hypochondrische Veranlagung, daher wird es dich kaum wundern, dass ich felsenfest davon überzeugt war, bei der Überfahrt zur Insel Eydernorn von schlimmer Seekrankheit heimgesucht zu werden. Deshalb habe ich gleich in der betörend trostlosen Hafengegend von Alt-Werfting eine Apotheke ausfindig gemacht und mir dort verschiedene Medikamente gegen dieses unberechenbare Reiseleiden besorgt sowie ein praktisches Hilfsmittel, das die diskrete Bezeichnung »Nausealer Beutel« trägt, in der freien zamonischen Seefahrt aber unverblümt »Kotztasche« genannt und von erfahrenen Matrosen hartherzig belacht wird.
Nausealer Beutel
Als ich an Bord des kleinen Dreimasters namens Quoped ging (was, wie du natürlich weißt, Altzamonisch ist und Wohin strebst du? bedeutet – ein erstaunlich tiefsinniger Name für ein gewöhnliches Fährschiff, nicht wahr?), der nur zweimal in der Woche nach Eydernorn und wieder zurück pendelt, herrschten so ziemlich alle Wetterbedingungen, die meine ärgsten Befürchtungen hinsichtlich der Überfahrt bekräftigten.
Tiefdruck von barometrischer Obszönität verursachte einen zwischen meinen Schläfen hin und her wandernden Kopfschmerz, dünner, warmer Regen sprühte mir ins Gesicht, ohne Erfrischung zu spenden, und die enorme Luftfeuchtigkeit löste einen Schweißausbruch nach dem anderen aus. Auch ohne Seekrankheit war ich schon ein körperliches Wrack, bevor ich die Planken des Schiffes überhaupt betreten hatte. Ein granitgrauer Himmel aus massiven Gewitterwolken hing so bedrohlich tief über dem Hafen, als würde er gleich krachend herunterstürzen. Das Wasser war von fast identischem Grau – und genauso aufgewühlt, wie es in meinen Innereien zuging! Gab es überhaupt eine Toilette an Bord? Oder erledigten diese raubeinigen Seebären ihre diesbezüglichen Geschäfte auf andere, unaussprechliche Weise? Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung von dieser klatschnassen schwankenden Welt!
Die Segel der Quoped waren von kreisrunden Löchern perforiert, was mich zuerst etwas befremdete, weil es aussah wie ein Sturmschaden. Aber wie man mir später erklärte, ist dies so üblich bei Schiffen, die regelmäßig in der Nähe der Insel Eydernorn kreuzen. Die Winde, die dort blasen, sind manchmal so rabiat, dass sie gewöhnliche Segel mitsamt ihren Masten zerstören würden, wenn sie nicht systematisch durchlöchert wären, um den Luftstrom teilweise hindurchfahren zu lassen.
Die Quoped
Das Gekrächz der aufgeregt umherflatternden Sturmmöwen klang einmal wie das heisere Fiepsen von Ratten, dann wieder wie höhnisches Nixengelächter und manchmal sogar nach düsteren Schrecksenprophezeiungen. Meine Nerven waren so angespannt, dass ich aus den Vogelschreien mehrmals verstörende Vokabeln wie nasses Grab, Wassersarg oder Totenschiff herauszuhören glaubte. Eine wilde Windsbraut tanzte durch den Hafen und brachte alle Sturmglocken, Anker- und Bojenketten und was sonst noch Geräusche von sich geben kann zu einem synkopischen Geklimper, das mich bestürzend an die hypnotische Begräbnismusik jener legendären Almdruiden des Hutzengebirges gemahnte, die angeblich ein Millennium alt werden können und sich aus bis heute unerfindlichen Gründen traditionell und trotz bester Gesundheit an ihrem tausendsten Geburtstag jodelnd in die Dämonenklamm stürzen.
Die wirbelnden Winde bauschten mein Reisegewand derart, dass es ausgesehen haben muss, als ob Luftgeister mit allen Kräften versuchten, mich vom Betreten des todgeweihten Fährschiffes abzuhalten. Aber dann stießen sie mich so brutal vorwärts, dass ich über eine Planke hinauf an Bord stolperte und mich dort beinahe längs hingelegt hätte. Ein zwergenhafter und übertrieben tätowierter Matrose lachte so meckernd und höhnisch wie die Sturmmöwen und knotete dabei weiter an etwas herum, das aussah wie ein Galgenstrick.1
Sehnsüchtig blickte ich zum Land zurück, und plötzlich kam mir sogar ein heruntergekommenes Küstenkaff mit dahinsiechender Fischkonservenindustrie wie Alt-Werfting ausgesprochen reizvoll vor. Ich könnte seine drei historischen Gassen mit den Kapitänshäuschen erkunden! Ich könnte den siebenhundert Jahre alten Schandpranger für Meuterer besichtigen oder den einzigartigen Piratengalgen mit Atemluftpumpe, an dem das Erhängen mehrere Wochen gedauert haben soll, bis der Tod einsetzte. Oder ich könnte mir die aktuelle Treibholzausstellung im Harpunenmuseum ansehen, einen Rundgang in der Oktopus-Konservenfabrik machen und abschließend im Gasthaus Zur Halbtoten Qualle vom berühmten Werftinger Stockfischkuchen probieren.
Dann würde ich schleunigst mit der Kutsche ins Landesinnere stiften gehen, und zwar in möglichst hoch gelegene Bezirke, fernab von jedem Salzwasser, wo es Segelschiffe nur als Miniaturmodelle in Glasflaschen oder auf alten Ölgemälden gibt. Wo Fische höchstens in Aquarien existieren. Wo Enzian und Edelweiß blühen und die Luft so dünn ist, dass man davon Nasenbluten oder Höhenkoller bekommt. Oder gleich zurück zur Lindwurmfeste! Von der ich unter anderem auch deswegen geflohen bin, weil dort in wenigen Tagen die Hamoulimepp2-Feierlichkeiten beginnen, die ich so verabscheue. Aber lieber an Hamoulimepp teilnehmen, als unter solch mörderischen Umständen in diese aufgewühlte See stechen, die voll von glitschigen Ungetümen mit Saugnäpfen, Sägezähnen und Stacheln ist – das weiß man doch!
Aber es war bereits zu spät. Die Planke wurde eingeholt, nautische Befehle wurden gebellt, und kurz darauf sah es aus, als schaukelte die Kaimauer von uns fort, obwohl es natürlich wir waren, die davonschaukelten.
Du darfst dir daher meine große Überraschung darüber ausmalen, lieber Hachmed, dass sich die Sache mit der Seekrankheit vollkommen anders gestaltete als befürchtet. Denn trotz des rabiaten Seegangs, haushoher schwarzer Wellen und einer orkanmäßigen Windstärke ereilte mich kein einziges Symptom! Kein Schwindel, kein Brechreiz, weder kalter Schweiß noch ein rebellierender Magen. Ganz im Gegenteil: Bevor ich irgendein Medikament einnehmen oder meinen Nausealen Beutel auspacken konnte, überkam mich inmitten des ganzen Geschaukels und Gebrülls völlig überraschend ein Hochgefühl. Ja, schon kurz nachdem wir den Hafen aus den Augen verloren hatten, breitete sich eine tiefe innere Ruhe und Behaglichkeit in mir aus, die schließlich sogar in regelrechte Euphorie, fast schon Ekstase überging.
Ein nasses Grab?
Ich stellte fest, dass ich ein geborener Seemann bin, eine jener gesegneten Kreaturen, die auf natürliche Weise gegen die wechselhaften Zustände gewappnet sind, die auf einer instabilen Fläche wie dem Meer herrschen. Man ist seefest, oder man ist es nicht – aber um das herauszufinden, muss man es ausprobieren! Das Rollen des Schiffes, das Schwanken des Horizonts, das Auf-und-Ab-Schwappen meiner inneren Organe machten mir wunderbarerweise nicht das Geringste aus. Ich haftete so unverrückbar auf den Planken wie eine Fliege auf einer Glasscheibe, egal, wie sehr sie sich schrägten. Ich konnte selbst bei tosendem Sturm ruhigen Auges in den brodelnden Hexenkessel des zamonischen Nordmeeres starren und verspürte dabei keinerlei Unpässlichkeit. Nicht einmal einen leichten Schwindel, während alle anderen Passagiere entweder über der Reling hingen und blökend in die spritzende Gischt kotzten oder sich kreidebleich und mit irrem Blick ans Tauwerk klammerten. Und mit »alle anderen Passagiere« meine ich wirklich alle, liebster Hachmed – auch die Besatzung! Ein hartgesottener Matrose, dem das raue Seeklima tiefe Furchen ins Gesicht geätzt hatte, hielt sich schluchzend an mir fest und betete dabei verzweifelt zu irgendeiner archaischen Meeresgottheit. Ich sah, wie der Kapitän, ein robust gebauter Seebär mit langem, graugrünem Bart und rustikaler Wollmütze, aus seiner Kabine zur Reling stürzte und einen armdicken Strahl kaum verdauter Muschelsuppe von sich gab. Nicht zu fassen: Selbst der Kapitän dieses sturmgeprüften Schiffes war unter den herrschenden Umständen seekrank!
Ob du es glaubst oder nicht, mein Freund, ein paar größenwahnsinnige Augenblicke lang erwog ich sogar, das Kommando auf dem Kahn zu übernehmen! Denn vorübergehend machte es tatsächlich den Eindruck, als sei ausgerechnet ich der Einzige an Bord, der über einen klaren Verstand, über ein stabiles Gleichgewichtsgefühl und so etwas wie Urteilsvermögen verfügte. Nein, das war beileibe kein Größenwahn, sondern eine realistische Einschätzung einer äußerst beängstigenden Situation! Mir war natürlich völlig klar, dass dies keine Lösung sein konnte, weil ich von Seefahrt und Segelhandwerk nun mal so viel verstehe wie eine Katze vom Rückenschwimmen. Aber wir befanden uns in höchster Gefahr. Ich segelte auf einem Narrenschiff mit einer Besatzung, die sich angesichts einer fast aussichtslosen Lage als etwa so brauchbar erwies wie am Abend nach der Auszahlung der Heuer, im Zustand der besinnungslosen Volltrunkenheit. Wir waren, so schien es, zwischen zwei Monsterorkane geraten, Stürme, welche die Ausdehnung von Kontinenten hatten!
Dies war eine der seltensten, gefährlichsten und unglücklichsten meteorologischen Konstellationen, in die man auf zamonischen Ozeanen überhaupt geraten kann, mein Freund! Etwas, das selbst den erfahrensten Seeleuten im Berufsalltag so gut wie nie widerfährt. Und mir passierte dies gleich beim allerersten Mal, als ich die Planken eines Schiffes betrat!
Schon eine Stunde nachdem wir abgelegt hatten, befanden wir uns in einem nahezu unpassierbaren Bereich des Meeres, in einer Todeszone, in der die wirbelnden Ränder dieser Jahrhundertstürme aufeinanderprallten wie gigantische Mühlräder, die alles zermalmten und pulverisierten, was zwischen sie geriet: Schiffe, Küstenstädte und sogar ganze Inseln. Der einzige Glücksumstand war, dass die Quoped ein ehernes Seepferd der uralten Art war, ein beinahe antiker Eisbrecher, aus massivstem Eisenholz nach Methoden gebaut, die heute fast vergessen sind. Ein moderner Segler wäre von diesen rabiaten Kräften binnen kurzem in Splitter von Zahnstochergröße zerlegt worden, aber uns fehlten erst einmal nur ein paar Segel. Krachend und schäumend stürzten die Brecher über Deck und rissen alles mit sich, was nicht festgebunden oder angenagelt war. Ein ganzer Schwarm Kristallmakrelen wurde an Bord geschwemmt, wo die glitzernden Fische verzweifelt zappelten und nach Luft schnappten, bis die nächste Woge sie wieder ins Meer spülte. Wuuusch! Mit ohrenbetäubendem Wutgebrüll zerrten die tobenden Sturmdämonen am festgezurrten Segeltuch und an meiner Kleidung, mein Umhang flatterte im Orkanwind wie ein Drachenflügel. Aber ich blieb als Einziger an Bord aufrecht an der Reling stehen und trotzte den Elementen wie eine festgeschraubte Galionsfigur. Allerdings hatte ich meine Krallen auch tief ins Holz des Handlaufs gebohrt wie eine Zecke ihren Stachel in den Wirtskörper. Ich stand wie angenagelt. Ich war seefest!
Nun, mein lieber Hachmed, du kennst ja den Grund meiner Reise nach Eydernorn: Ein befreundeter Arzt hat mir einen ausgedehnten Kuraufenthalt auf dieser vorbildlich gelüfteten Nordmeerinsel verschrieben, um meine asthmatischen Beschwerden zu behandeln, die er übrigens für psychosomatisch hält, verursacht von meinen traumatischen Erlebnissen in der stickigen Unterwelt der Labyrinthe von Buchhaim. Durch jahrelanges Verschleppen sind diese Symptome chronisch und ausgesprochen lästig geworden. Jedes Mal, wenn ich ein Antiquariat betrete und mir der zuvor so geliebte Bücherstaub in die Nase steigt, verkrampfen sich meine Bronchien, und ich bekomme eine Atemnot, die manchmal sogar in Erstickungsphantasien und nackter Todesangst gipfelt. Das kann unmöglich so weitergehen, wenn ich das Vergnügen an alten Büchern nicht verlieren will – und du weißt ja, wie wichtig sie mir sind. Auf Eydernorn wird mit wissenschaftlichen Methoden regelmäßig die sauberste und sauerstoffreichste Luft Zamoniens gemessen, gesünder als dort ist der unsichtbare und lebensnotwendige Stoff, den wir atmen, nirgends auf unserem Kontinent. Die besonders salzhaltige Seeluft dieser Insel soll darüber hinaus Spurenelemente enthalten, denen man eine daseinsverlängernde Wirkung nachsagt. Aber das sind wissenschaftlich unbestätigte Behauptungen von Alchemisten, die in den Bereich der Spekulation gehören. Dennoch ist es erwiesen, dass die Bewohner von Eydernorn im Durchschnitt etwa hundertachtzig Jahre älter werden als die übrige zamonische Bevölkerung, egal, welche Rolle dabei irgendwelche unerforschten Bestandteile der Luft spielen. Dies ist wohl der Grund dafür, dass es dort das qualifizierteste Lungensanatorium von ganz Zamonien gibt – und die höchste Kurtaxe. »Vier bis acht Wochen in diesem Klima und dabei immer tüchtig durchgeatmet, dann haben Sie anschließend praktisch zwei neue Lungenflügel«, scherzte mein Hausarzt und verschrieb mir zwei Monate Kur.
Du weißt auch, mein lieber Hachmed, dass ich keiner bin, der sich tatenlos der gesundheitlichen Rehabilitation hingibt. Sich einfach nur zu erholen, fände ich unmoralisch. Um also dieser Reise auch einen praktischen Nutzen abzugewinnen, habe ich mir unter anderem vorgenommen, während meines Aufenthaltes ausgiebig die Architektur jener legendären Bauwerke zu studieren, die diesem Eiland seinen etwas prahlerischen Beinamen verleihen: Die Insel der Tausend Leuchttürme. Es sind nämlich tatsächlich nur rund einhundert Exemplare. Einhundertundelf, um ganz genau zu sein. Aber jeder, der sie einmal bei Nacht in Aktion gesehen hat, so versichert der Praktische Reiseführer für Eydernorn von Pharicustos De Bong, wird beschwören, dass sie strahlen und funkeln wie tausend. Zu diesen beglückten Augenzeugen will ich gehören! Und ich möchte so viele ausführliche schriftliche Notizen und zeichnerische Skizzen davon machen wie irgend möglich. Also verzeih mir bitte, wenn ich diese Briefe gelegentlich mit kleinen Zeichnungen verunstalte, die hauptsächlich peinliche Dokumente meiner künstlerischen Unzulänglichkeit sein werden. Aber du weißt ja: Ein Bild sagt manchmal tatsächlich mehr als tausend Worte – auch wenn es nur den Eindruck einer Kinderzeichnung macht. Abfällige Kommentare dazu kannst du dir also schenken, denn ich weiß leider nur zu gut, wo die Grenzen meiner zeichnerischen Fähigkeiten liegen.
Danzelot von Silbendrechsler
Ich möchte auch gerne den einen oder anderen Leuchtturmwärter über seine Berufserfahrungen aushorchen, wenn diese als notorisch maulfaul verschrienen Einzelgänger das überhaupt zulassen. Dir ist bekannt, mein lieber Hachmed, dass ich kein Architekt bin und auch keine Karriere als Leuchtturmwärter anstrebe. Aber man kann als Schriftsteller aus jeder Disziplin, jeder anderen Kunst und jeder Wissenschaft Honig für das eigene Schaffen saugen, das ist meine tiefe Überzeugung. Was für die Architektur, die sowohl mit exakter Konstruktion als auch mit gestalterischer Phantasie zu tun hat, ganz besonders gilt, wenn sie denn von Könnern praktiziert wird. Dies ist leider immer seltener der Fall. Auch für den Bau von Luftschlössern kann es nicht schaden, die Gesetze der Statik studiert zu haben, mein Lieber! Und welche Bauwerke eignen sich besser zum Studium der Haltbarkeit von kreativen Konstrukten als Leuchttürme? Was ist stabiler und verlässlicher als diese extremsten aller Außenposten unserer Zivilisation? Diese Festungen der Einsamkeit gegen die Naturgewalten, die oft den schlimmsten klimatischen Anfeindungen, eisigem Sturmwind und haushohen Flutwellen standhalten müssen, manche viele Jahrhunderte und sogar Jahrtausende lang? Gibt es ein romantischeres und metaphorisch aufgeladeneres Gebäude als einen Leuchtturm? Eines, das mehr an den vielbeschworenen Elfenbeinturm des Schriftstellers erinnert? Und auf Eydernorn erwarten mich die ältesten und neuesten, die altmodischsten und fortschrittlichsten, die kostspieligsten und verrücktesten davon. Über hundert Stück, so viele auf engstem Raum wie nirgends sonst. Schon Ojahnn Golgo van Fontheweg hat diese Bollwerke der Lebensrettung in Sonetten besungen. »Kein Wunder«, wirst du sagen, »dieser notorische Schwätzer hat ja auch zu allem anderen seinen klassischen Senf dazugegeben, wie könnten da die Leuchttürme fehlen?« Ganz recht, wegen Fontheweg bin ich bestimmt nicht nach Eydernorn gereist. Viel wichtiger war mir der Rat meines Dichtpaten Danzelot von Silbendrechsler, der mir schon in meinen ganz jungen Jahren (da war ich gerade mal sechzig) dringend empfohlen hat, wenigstens einmal in meinem Leben diese kuriose Insel zu besuchen. »Du kannst dort vieles lernen, was man über die Einsamkeit und den Irrsinn des Schriftstellerberufes wissen muss«, raunte er geheimnisvoll, während er uralte handgezeichnete Seekarten der Insel vor mir ausrollte, die meine Phantasie bis heute beschäftigen. »Auch verstörende und beängstigende Dinge. Ja, genau genommen kannst du dort hauptsächlich verstörende und beängstigende Dinge lernen. Aber, mein Junge, es gibt keinen Ort auf unserem Kontinent, wo man dem Orm näher ist! Glaub mir! Eydernorns Leuchttürme sind nicht schön. Nein. Nicht im landläufigen Sinne. Nicht auf den ersten Blick. Sie offenbaren ihren besonderen Status erst über die Jahrhunderte, durch Beharrlichkeit und edlen Nutzen. Wie gute Bücher, wie noble Gedanken. Und wenn du einmal dort sein solltest, dann sieh dir auf jeden Fall auch die Sprechenden Grabmale an. Und die Stadt ohne Türen.«
Ich habe erst später gelernt, mein lieber Hachmed, dass Danzelot weder Eydernorn noch dessen Leuchttürme und Sprechenden Grabmale oder gar die Stadt ohne Türen jemals selber gesehen hat. Er war nie dort. Denn er hat ja die Lindwurmfeste nie verlassen, der alte Stubenhocker. Er wusste davon nur aus seinen Büchern. Aber das hat ihm offensichtlich gereicht, um seine Sehnsucht nach Eydernorn an mich weiterzugeben. Eine ganze Insel, die vom Orm bestrahlt wird. Mit Bauwerken, die wie gute Bücher, die wie klassische Literatur sind – an einen solchen Ort der Träume wollte ich immer hin! Und jetzt, wo ich endlich auf dem Weg war, sah es aus, als würden wir das Eiland nicht lebend erreichen. Denn die Zustände an Bord hatten sich dramatisch verschlimmert. Das Schiff schlingerte ohne Steuermann durch die turmhohen Wellen, um uns herum toste das Inferno. Niemand kümmerte sich mehr um die Navigation der Quoped, jeder war nur noch damit beschäftigt, die Kontrolle über den eigenen Körper wiederzuerlangen und sich nicht von den Brechern ins Meer spülen zu lassen. Überall herrschte das Chaos. Ein Sharkodil3 von der zweifachen Länge eines Sarges hatte sich in der Takelage verfangen und schnappte wild um sich, bis es sich befreien konnte und ins Meer zurückplumpste. Ein Blitz hatte eines der wenigen Rettungsboote in der Mitte in zwei Teile gespalten, es brannte in gespenstischen blaugrünen Flammen.
Sharkodil
Es war höchst unwahrscheinlich, dass wir überhaupt noch auf die Insel zuhielten – wo war sie denn überhaupt? Jeden Augenblick konnte eine der turmhohen Monsterwellen das Schiff so unglücklich schrägen, dass es voll Wasser lief und wir unseren Kurs in Richtung Meeresgrund ändern würden. Einer der Masten knickte ab und verschwand einfach in den Lüften, wie von einer unsichtbaren Riesenhand gepflückt. Ob du es glaubst oder nicht, mein lieber Hachmed, in diesem Moment musste ich laut und wie wahnsinnig lachen – und es war sicher viel mehr pure Verzweiflung als Humor, was mich dazu veranlasste. Ja, ich lachte dem in die Wolken hinauffliegenden Segelmast hinterher wie einem gelungenen Scherz. Denn das war alles, was mir noch blieb: das irre Gelächter des Hoffnungslosen. Und ausgerechnet dies war der Augenblick, der schicksalsträchtige Moment, in dem ich sie zum ersten Mal sah, die legendären Lichter der tausend Leuchttürme von Eydernorn. Zuerst war es nur ein einziger dünner Strahl, den ich für Sonnenlicht hielt, das durch die schwarzen Wolken bricht. Aber für einen Sonnenstrahl war er zu horizontal und zu unstet, denn er wanderte, verkürzte sich, wurde zu einem Punkt und verlängerte sich dann wieder auf der anderen Seite – das war eindeutig ein kreisender Strahl. Natürlich! Das rotierende Licht eines Leuchtturms!
Ein Leuchtturm! Land! Wir befanden uns in Küstennähe! Ich konnte anhand des Strahls nicht nur endlich wieder den Horizont bestimmen, sondern auch die Lage der Insel Eydernorn, denn wir steuerten direkt auf das Licht zu. Nur ein einziges Licht? Nein, immer mehr luminöse Erscheinungen tauchten auf, lange leuchtende Geisterfinger, die durch Nebel und Gischt tasteten und sich uns entgegenstreckten! Dazwischen pulsierten Flecken in Gelb, Blau und Grün, die vielleicht von weiter entfernten Türmen stammten. Blendend helle Säulen, die aussahen wie erstarrte Blitze, schwankten durch Gischt und Wolken hin und her. Glühende Kugeln stiegen auf wie Ballone und sanken dann langsam erlöschend wieder herab. Rote und gelbe, biegsame, fluoreszierende Tentakel schlängelten sich in Peitschenschwüngen himmelwärts. Ich hörte Explosionen, dumpfe Schläge wie Kanonendonner, manchmal das schrille Pfeifen, Heulen und Zischen eines Feuerwerks. Aber dieses Spektakel hier war auf den ersten Blick viel eher furchterregend als bezaubernd – so beängstigend wie ein Tiefseewesen von monströsen Ausmaßen, das plötzlich auftaucht, um einen mit organischen Lichtspielen und Leuchtaugen in seine Fänge zu locken. Ja, so etwas soll es durchaus in den Gewässern Zamoniens, vor allem um Eydernorn herum, geben, mein Lieber. Davon konnte nicht nur einem abergläubischen Seemann oder einem unerfahrenen Passagier angst und bange werden! Ich hatte zum Glück während meiner Reisevorbereitungen gelesen, dass die hochentwickelte »Eydernornische Pharotechnologie« über die verschiedensten und originellsten Beleuchtungstechniken verfügt, vom altmodischen Phosphorfeuer mit Brennspiegeln bis hin zur modernen alchemistischen Batterielampe mit kostspieligen Diamantlinsen. Raffinierte Ingenieurskunst, die jeden nur denkbaren optischen Hokuspokus erlaubt. Der simple Lichtstrahl ist für Eydernorner Leuchtturmwärter nur noch eine veraltete und mitleidig belächelte Methode. Manche Türme besitzen Kanonen, mit denen sie wasserdichte Feuerwerksraketen durch Regen und Sturm in die Troposphäre jagen können. Andere verschießen brennbare Flüssigkeiten in Glaskugeln, die auf ihrem Zenit platzen und in funkelndem Sternennebel zerstäuben. Wieder andere schleudern mit Katapulten Pulverkapseln in die Luft, deren Inhalt sich in einer exakt vorausberechneten Höhe selbst entzündet. Es soll Leuchtturmwärter geben, die mit dressierten Irrlichtern und Feuerkäfern arbeiten, mit Mondlichtreflektoren, mit entzündlichem Friedhofsgas oder biologischem Schrecksenfeuer. Mit kanalisierter Lava und was weiß ich sonst noch allem.
Wie das im Einzelnen und Speziellen funktioniert, mein lieber Hachmed, nun, das ist größtenteils Geheimwissen der Leuchtturmwärter, das sie seit Jahrhunderten eifersüchtig hüten und ständig verfeinern. Eydernorn ist die einzige zamonische Gemeinde, in der die Leuchtfeuerwerkerei offiziell zur eigenständigen Kunstform erklärt worden ist. Dass jährlich eine dieser Methoden der Feuerwerkerei als »die Jahresbeste« prämiert wird, wusstest du das? Mit dem Eydernorner Feuervogel, einer unter Leuchtturmwärtern sehr begehrten Trophäe. Mir war das alles aus meiner Lektüre über die Insel bereits bekannt, aber ich besaß natürlich keinerlei Begriff davon, wie beeindruckend diese Lichtspiele in Wirklichkeit aussehen und sogar noch mitten in einem Orkan ihre Wirkung entfalten! Wäre mir dieses Spektakel völlig unvorbereitet begegnet, hätte ich sicher nicht nur ein bisschen an meinem Verstand gezweifelt, sondern mich gleich von ihm verabschiedet. Tatsächlich gibt es verbürgte Geschichten von Seefahrern, die vor den Rettungslichtern panisch die Flucht ergriffen haben, weil sie diese in ihrer Unkenntnis für Ungeheuer, Höllenfeuer oder ausbrechende Vulkane hielten. Sie flohen in die entgegengesetzte Richtung, also schnurstracks ins Verderben. Stell dir mal vor, liebster Hachmed, ein Nordlicht würde mit einem Silvesterfeuerwerk ein Kind der Liebe zeugen, das dann während eines blitzdurchzuckten Finsterberggewitters zusammen mit Schwärmen von Irrlichtern im Paarungsrausch am Firmament erscheint und eine Orgie der Illumination feiert – dann hast du vielleicht eine ungefähre Vorstellung von diesem irrsinnigen Phänomen, das sich über Eydernorn abspielte, während unser Schiff noch mit den Wellen kämpfte. Man muss es gesehen haben, um es zu glauben. Es ist eines der großen Wunder unseres Kontinents, auch wenn es ein künstlich erzeugtes ist. Ein Wunder der Eydernornischen Pharotechnologie.
Und es sah sogar so aus, als würde dieser mächtige Lichtzauber das schlimme Unwetter vertreiben! Das war natürlich eine zufällige Korrelation, aber zumindest ließ der Sturm endlich ein wenig nach, und die Wellen schrumpften auf ein Maß, das wieder zielgerichtetes Navigieren zuließ. Die erstaunlichste Veränderung konnte ich aber bei der Besatzung der Quoped beobachten, die sich beim Anblick des Lichtspektakels umgehend zu erholen schien. Und zwar so schlagartig, dass ich es eigentlich nur als Wunderheilung bezeichnen kann, mein Lieber! Wer eben noch weinend auf allen vieren übers Deck gekrochen war oder sich röhrend in ein Rettungsboot übergeben hatte, kletterte jetzt artistisch in den Wanten herum und entfesselte die gerefften Segel. Der Kapitän lief wieder hocherhobenen Hauptes herum und bellte in dieser absurden Seemannssprache selbstbewusst seine präzisen nautischen Befehle, die von der Mannschaft schnurstracks umgesetzt wurden: »Fockmast brassen! Klüver kielholen! Toppgasten verklöten!« Oder so ähnlich. Fasziniert und ergriffen konnte ich dabei zusehen, was für eine mächtige, fast magische Wirkung Leuchtturmsignale auf eine Schiffsbesatzung in Seenot haben. Wie sie tiefste Verzweiflung und Entkräftung in Entschlossenheit und Lebenswillen verwandeln und aus Todgeweihten wieder hartgesottene Seebären machen. Das Meer war jedoch immer noch viel zu unruhig, um von Entwarnung oder gar Rettung zu reden, und die Anlandung war immer noch ein riskantes Abenteuer, das es zu überstehen galt. Sie sollte, anders als geplant, in Klein-Hafing stattfinden, dem kleinsten der drei Inselhäfen, der sich an der Südküste des westlichen Eydernorn befindet.
Dies hatte den Vorteil, dass man bei dem immer noch mächtigen Seegang nicht mehr die Südwestspitze des Eilands umschiffen musste, was wir normalerweise getan hätten, um in Eydergard, der Hauptstadt der Insel, anzulegen. Aber dazu hätten wir auch noch die Westlichen Wirbel und den Nebula Eterna passieren müssen, zwei unter Seeleuten gefürchtete Naturphänomene, die an dieser Küste den Schiffsverkehr behindern. Unter den gegebenen Umständen wählte unser Kapitän das kleinere Übel, das darin bestand, bei hohem Seegang in den Öresund einzufahren, eine flache Bucht mit extrem engem Eingang zwischen hohen Klippen. Die Seeleute raunen, das komme ungefähr dem Versuch gleich, mit verbundenen Augen einen Zwirn durch ein Nadelöhr zu fädeln, während man in einer Schiffschaukel steht, die von zwei betrunkenen Matrosen in Schwung gehalten wird. Nun, ich will dich nicht weiter mit den Einzelheiten dieser haarsträubenden Landung behelligen, lieber Hachmed, nur diese eine Information kann ich mir nicht verkneifen: Wir mussten dreimal auf die hohe See zurückkehren und neuen Anlauf nehmen, bis es endlich gelang, was erheblich an unser aller Nerven zerrte und zu neuen Ausbrüchen von Seekrankheit unter den Passagieren führte.
Kurz bevor ich endlich von Bord gehen konnte, trat der Kapitän der Quoped an mich heran und erklärte mir beinahe feierlich, dass er noch nie einen solchen Seegang erlebt habe, obwohl er diese Strecke seit zweihundertachtundsiebzig Jahren befahre. Kein einziges Mal. Ob ich eventuell erwöge, eine Laufbahn in der freien Seefahrt anzustreben? Denn ich sei ja offensichtlich zu diesem Zweck hergestellt worden! Eine Position als Erster Maat auf seinem Schiff könne er mir auf der Stelle anbieten – drei Wochen bezahlter Urlaub im Jahr, kostenlose Skorbutversicherung, das Essen würde ich mit ihm in der Kapitänskajüte zu mir nehmen, und ein zwölfter Teil der jährlichen Einkünfte des Fährgeschäftes sei mir garantiert. Ich dachte zuerst an einen Scherz. Dann bemerkte ich, dass ich immer noch an derselben Stelle stand wie zu dem Zeitpunkt, als das Inferno ausgebrochen war, aufrecht an der Reling, die Klauen tief ins Holz des Handlaufs gebohrt. Ich hatte mich keinen Schritt bewegt. Das erfüllte mich alten Bergsaurier nun doch mit einem gewissen Stolz. Aber ich musste das verlockende Angebot natürlich höflich ablehnen, wie du dir denken kannst, mein liebster Hachmed. Ich betrat die Insel daher im Zustand der Erleichterung, fast der Euphorie – nun, was man eben so empfindet, wenn man gerade den schlimmsten Sturmdämonen getrotzt hat, ohne die Kotztasche benutzen zu müssen.
Es herrschte inzwischen finsterste Nacht. Die Sturmfronten waren weitergezogen, ein dünner Regen wurde von den letzten Böen durch die Gassen von Klein-Hafing gepeitscht. Der Boden schwankte immer noch unter meinen Füßen, als ich an die Tür der erstbesten Pension pochte, die ich in der Hafengegend finden konnte. Ich bezog ein kleines, sauberes Zimmer, das nicht gerade von Luxus, aber von gepflegter Gastfreundschaft zeugte. Da ich immer noch ziemlich aufgekratzt von den Ereignissen war und auch das dringende Bedürfnis verspürte, sie schriftlich zu fixieren, habe ich diesen Brief an dich geschrieben, bevor ich nun endlich ins Bett falle.
Ahoi: Dein offensichtlich seefester
Zweiter Brief
Bester Hachmed,
nachdem ich mich am heutigen Morgen in Klein-Hafing nur mit Mühe und schmerzenden Gliedern vorwiegend in den Waden- und Oberschenkeln aus dem Hotelbett gewuchtet hatte, stellte ich fest, dass der Boden unter mir immer noch schwankte wie ein Schiffsdeck bei hohem Seegang. Ich erschrak und war sogleich hellwach. Ist das etwa der Preis für meine vermeintliche Seetüchtigkeit? Dass ich jetzt an einer Art Seekrankheit leide, die erst verzögert an Land auftritt? Die womöglich chronisch ist und nie wieder weggeht? Gibt es so etwas? Eine unheilbare Gleichgewichtsstörung, die einen das restliche Leben wie auf einem schlingernden Schiff verbringen lässt, egal, wie stabil der Grund unter einem tatsächlich ist? Beunruhigt raffte ich mein Reisegepäck zusammen und torkelte wie ein Besoffener die Pensionstreppe hinab, was mit diesen Beinen, die sich immer noch auf der Quoped zu befinden schienen, ein fast lebensgefährliches Unterfangen war.
Erst ein Gespräch mit dem Pensionswirt, einem uralten Küstengnom mit grünlichem Bart und einem tätowierten Tiefseefisch auf der Stirn, konnte mich ein wenig beruhigen. Beim Bezahlen der Rechnung vermochte ich unhöflicherweise meinen Blick kaum von dem Bild auf seiner Stirn zu lösen, weil es die erste Lebende Tätowierung war, die ich zu sehen bekam. Dabei handelt es sich um eine Eydernorner Spezialität der Tätowierkunst, deren Motive sich, wenn man genauer hinsieht, auf verstörende Art zu bewegen scheinen.
Dies ist keine Magie, sondern eine optische Illusion, die durch das raffinierte Übereinander mehrerer verschiedenfarbiger Tätowierschichten entsteht – eine Kunst, die angeblich nur die professionellen Epidermisperforierer dieser Insel wirklich perfekt beherrschen. Man nennt sie hier »Huijdenpieker«. Der Urfisch auf der faltenreichen Stirn des Wirtes sah also nicht aus wie ein herkömmliches Tattoo, sondern eher wie ein filigran modelliertes Halbrelief, das sich beinahe unmerklich bewegte. Faszinierend und verstörend zugleich, wie ein Ölbild im Rahmen, das plötzlich lebendig wird!
Küstengnom
Der freundliche Hotelier versicherte mir, während ich fasziniert auf sein Tattoo starrte, dass dieses Schaukeln ganz normal und durchaus üblich sei und bei manchen Passagieren sogar ein paar Tage anhalten könne, bis sich der Gleichgewichtssinn wieder auf die stabilen Verhältnisse eingestellt habe. Der Körper ist wieder an Land, aber das Hirn weilt noch auf hoher See. Er kannte sogar ein Fachwort für diesen Zustand, er nannte ihn mit großer Selbstverständlichkeit »Landschippen«. »Dat is man blouß Landschippen, mijn Jong! Ewwer dat geit nu ballich wör wech«, belehrte er mich im breitesten Inseldialekt, den ich mir selbst noch etwas mühsam ins Hochzamonische übersetzen musste: »Aber das geht bald wieder weg.« Na hoffentlich!
Erst auf den zweiten Blick wurde mir bewusst, dass ich noch nie einen so alten Küstengnom von nahem gesehen hatte. Sein Gesicht glich einer Klippenlandschaft, die in Millionen von Jahren unermüdlich von Wind, Regen und Wellen gestaltet worden war, mit zahllosen Falten und Verwerfungen, durchwachsen von Moosen und Flechten – ein Antlitz wie aus der letzten Eiszeit. Ich ertappte mich dabei, dass ich in seinem kunstvoll mit einer hübschen Spiralmuschel verknüpften Bart (eine Technik, die nur die Eydernorner Barbiere beherrschen und »Knautik« genannt wird) nach Möwennestern fahndete, vielleicht auch nach einer Flaschenpost mit einer Schatzkarte. Was mich aber am meisten faszinierte, war seine Stimme. Er sprach überhaupt nicht wie ein betagter Gnom, es lag kein altersbedingtes Krächzen oder Knarzen darin. Nein, er sprach laut und deutlich akzentuiert, mit heller, hoher Stimme, wie jemand in seiner Lebensmitte. Auch seine übrige Physis machte einen jugendlichen, drahtigen, ja beinahe athletischen Eindruck – obwohl ich ihn aufgrund seiner Gesichtszüge auf mindestens fünfhundert Lenze schätzte. Nicht das geringste Zittern der Hände, eine katzenhafte Körperbeherrschung und ein kraftvoller Händedruck zum Abschied, der mich vor Schmerz beinahe zum Jodeln veranlasste. Er bestand sogar darauf, meinen schweren Seesack bis zur Tür zu tragen, was er dann auch mit spielerischer Leichtigkeit und nur einer Hand tat, als wäre dieser ein Federkissen. Dies war das erste Mal, dass ich einem leibhaftigen Beweis für das berühmte kraftspendende und lebensverlängernde Klima von Eydernorn begegnete. Ich war so beeindruckt von der körperlichen Verfassung meines Gastwirtes, als wäre ich einem seltenen und gefährlichen Raubtier in freier Wildbahn begegnet.
Ich war also höchstwahrscheinlich nicht – wie befürchtet – unheilbar seekrank. Das war erfreulich. Dennoch muss ich den Eindruck eines nach durchzechter Nacht immer noch heftig alkoholisierten Matrosen gemacht haben, als ich mich durch den Morgennebel wankend zur nächsten Kutschenstation begab (oder besser: landschippte), um nach Eydergard zu gelangen, meinem eigentlichen Reiseziel, wie du weißt.
In der Station erwarteten mich schlechte Nachrichten.
Der Kutscher, ein mitteilsamer Froschling, der trotz feuchter Aussprache und leicht quakender Artikulierung ein glücklicherweise fast akzentfreies Hochzamonisch sprach, berichtete mir, dass die Quoped aus dem Hafen von Klein-Hafing über einen Kanal nach Eydergard geschleppt werden müsse, um dort fachgerecht repariert und wieder seetüchtig gemacht zu werden. Bis wieder ein Schiff verkehre, könne es Wochen dauern. Und da die Quoped das einzige Schiff sei, das regelmäßig zwischen Eydernorn und dem Festland verkehre, sei in absehbarer Zeit auch kein Postverkehr möglich – bis auf den mit Brieftauben, der aber ausschließlich der behördlichen Nachrichtenübermittlung und Notsituationen vorbehalten sei. Er fügte noch hinzu, dass seines Wissens alle Schiffe, auch die in den Häfen, so schwere Sturmschäden zeigten, dass selbst die tollkühnsten Seemänner keine Überfahrt wagen würden.
Und ich hatte mir vorgenommen, liebster Hachmed, dir alle zwei, drei Tage einen ausführlichen Brief über meine Leuchtturmstudien und Naturbeobachtungen zu schicken, und mich auch schon auf deine kenntnisreichen Antworten, Besserwissereien, Beleidigungen und Schachzüge gefreut. Daraus wird nun erst mal nichts. Aber ich gedenke, diese Briefe trotzdem regelmäßig zu schreiben, sie zu sammeln und dir dann, wenn der Schiffsverkehr wieder aufgenommen wird, gebündelt zuzusenden. Unsere Fernschachpartie müssen wir allerdings derweil aussetzen. Aber meine Aussichten, wenigstens einmal gegen dich und deine nicht nur zahlenmäßig überlegenen Gehirne4 ein Schachmatt zu erkämpfen, sind ja eh aussichtslos.
Die Kutschfahrt von Klein-Hafing nach Eydergard gab mir einen ersten beklemmenden Vorgeschmack von der Zivilisationsferne, die mein Leben in den nächsten Wochen bestimmen würde. Immer noch war kaum etwas richtig zu sehen, weil dichter Nebel die ganze Insel einzuhüllen schien. Ich hoffte inständig, das sei nur eine Folge des Sturmes und kein Dauerzustand. Nicht einmal den Himmel konnte ich ausmachen. Nur ab und zu waren mir durch das beschlagene Kutschenfenster Ausblicke auf eine platte, vom rabiaten Seewind abgeschmirgelte Landschaft vergönnt, wenn der Nebel einmal nicht ganz so kompakt war. Dann sah ich meistens ödes Brachland, auf dem anscheinend nur hartnäckigstes Kleingestrüpp mit kräftigen Wurzeln überlebensfähig ist. Ab und zu tauchte ein bizarres Großgewächs ohne Blätter und mit sturmverrenkten Ästen auf, das mehr Ähnlichkeit mit einer Koralle als mit einem Baum oder Strauch hatte – das war fast schon alles, was mir die karge Eydernorner Pflanzennatur auf dieser Fahrt bieten wollte.
Korallenbaum
Der freie Blick aufs Firmament wurde bis zum Schluss der holprigen Reise von zähem Nebel verhindert. Großartig, dachte ich, die nächsten Wochen werde ich unter einer beschlagenen Käseglocke vegetieren, in der nur sture Disteln, amphibische Pflanzen und Strandhafer gedeihen. Meine geplanten botanischen Exkurse würden wahrscheinlich weniger entdeckungsreich und abenteuerlich verlaufen, als ich es mir vorgestellt hatte. Gelbgraue Wanderdünen waren die einzigen landschaftlichen Besonderheiten, die ich ausmachen konnte, und ab und zu schälten sich einsame Gehöfte aus dem Dunst, auf denen, wie ich vermute, die Produktion von Ziegenkäse, Schafschererei und Inzucht betrieben werden. Dort findet man auch die bekannten Eydernorner Strandhafersilos, die im Lauf der Jahrhunderte vom Inselwind derart gebeugt worden sind, dass sie aussehen, als würden sie im nächsten Augenblick umstürzen. Ich hörte es gelegentlich im Nebel meckern und blöken und sah auch mal ein paar windzerzauste Schafe, die stoisch auf drahtigem Unkraut herumkauten und unserer Kutsche verständnislos hinterherglotzten.
Strandhafersilo
Einen Kulturschock im Sinne einer Reizüberflutung habe ich hier also offensichtlich nicht zu befürchten. Sprachmächtige Bewohner sah ich während der ganzen Fahrt überhaupt keine, wodurch sich mir schließlich abwegige Gedanken aufdrängten, wie etwa die Frage, was Tiere, die man scheren muss, eigentlich gemacht haben, als es noch keine Bauern gab? Kollerten sie als ungeschorene Wollbälle durch die Dünen? Sollte man auf Inseln nicht lieber Fischzucht betreiben statt Käse und Wolle zu produzieren? Konnte man etwa auch aus Fischen Käse gewinnen? Ich wusste so bestürzend wenig über die Insellandwirtschaft! Erst, als ich anfing, mir Produktnamen für Fischkäsesorten auszudenken (Heringscamembert, Eydernorner Sardinendeichkäse, Streichmakrele), bemerkte ich, dass meine Gedanken nur noch alberne Assoziationsketten bildeten – wie so oft auf langen Kutschfahrten oder Spaziergängen, bei denen sich mein Denken gerne heillos in sich selbst verheddert. Wenn das die allgemeine Richtung sein wird, die meine Grübeleien hier nehmen, dann sehe ich allerdings schwarz für meine literarische Produktion während des Kuraufenthaltes, mein lieber Hachmed!
Um auf andere Gedanken zu kommen, musterte ich verstohlen den einzigen weiteren Passagier in der Kutsche, einen bleichgesichtigen Hutzenhalbzwerg in einer grauen Kutte mit geräumiger Kapuze. Das war ein Fehler! Denn sobald sich unsere Blicke kreuzten, fing er umgehend an, mit unangenehm rasselnder Atmung und Fistelstimme von seinen gesundheitlichen Beschwerden zu berichten. Er erzählte auf quälend umständliche Art, dass er, verteilt über einen Zeitraum von hundertsiebzig Jahren, nun bereits zum vierzehnten Mal zur Kur auf Eydernorn weile, um eine hartnäckige Bronchienverschleimung zu behandeln. Das vertiefte natürlich meine Zweifel an der Heilbarkeit chronischer Krankheiten und deprimierte mich umgehend. Ich blickte noch angestrengter als bisher aus dem Fenster, um den mitteilungsbedürftigen Greis durch Ignorieren zum Schweigen zu bringen. Die einzige Sehenswürdigkeit während der ganzen Inselüberquerung war die Burg Eyder, auch Eyderburg genannt, ein uraltes, sechseckiges Kastell. So steht es jedenfalls in dem informativen Reiseführer von Pharicustos De Bong, den ich auf dieser Reise bei mir führe.
»Wussten Sie, dass die Eyderburg zum größten Teil aus Möwenmörtel besteht?«, krächzte der Alte, als wir die Ruine passierten.
Ich schüttelte den Kopf.
»Das ist getrockneter Seevogelkot«, erläuterte er unaufgefordert. »Er wird pulverisiert und bei Bedarf mit Küstensand und Salzwasser vermischt. So ergibt er den berühmten, sturmerprobten Eydernorner Zement, aus dem fast jedes zweite Haus der Insel gebaut ist. Sie nennen ihn hier Dünenschiet.« Die Information, dass die Hälfte aller Behausungen, in denen ich mich in den nächsten Wochen aufhalten würde, aus Vogelscheiße errichtet ist, war auch nicht unbedingt dazu angetan, meine Stimmung zu heben.
»Das, äh, wusste ich nicht«, antwortete ich kühl. »Das ist ja hochinteressant.«
Es folgte noch ein langer Sermon zur Eydernorner Inselgeschichte und zum historischen Konflikt der Inselhälften Eyder und Norn, den ich dir aber, mein lieber Hachmed, an dieser Stelle ersparen will, weil er so uninteressant ist, dass ich keine Lust habe, ihn jetzt auch noch niederzuschreiben. Lediglich die beiläufige Erwähnung der Stadt ohne Türen fand ich bemerkenswert, weil sie mir in Erinnerung rief, dass auch diese zu den Sehenswürdigkeiten gehört, die mein Dichtpate Danzelot erwähnt hat. Ich machte mir eine gedankliche Notiz: Stadt ohne Türen besichtigen. Und eine zweite: In Kutschen Blickkontakt mit Fahrgästen vermeiden. Dann glotzte ich wieder aus dem Fenster ins trostlose Ödland und stellte die Ohren auf Durchzug, bis die holprige Fahrt zu Ende war.
In Eydergard bezog ich mein Hotelzimmer, das ich schon für die vorherige Nacht postalisch gebucht hatte. Ich ziehe es nämlich vor, den gesamten Kuraufenthalt im Hotel zu verbringen, um nicht auf einer Station des Sanatoriums leben zu müssen, wo es von röchelnden Patienten, heimtückischen Bazillen, bösartigen Viren und anderen umherschweifenden mordlustigen Krankheitskeimen sicher nur so wimmelt. Ich mache also eine ambulante Kur, was bedeutet, dass ich mich nur zu den täglichen Anwendungen (Salzwassergurgeln, Algenpackungen, Schwitzbäder und so weiter) ins Sanatorium begeben muss. Die restliche Zeit kann ich mich frei auf der Insel bewegen und so den Kontakt mit Ärzten, Krankenpflegern, anderen Patienten und sonstigen potentiellen Bazillenträgern auf ein Minimum reduzieren.
Das kleine Hotel Strandlöper in der Duinenstraat 77 mitten in Eydergard ist altmodisch möbliert und offensichtlich mit ältlichen Gästen unterschiedlichster Herkunft gut belegt – ich komme mir in der Lobby mit meinen beinahe dreihundert Jahren fast schon wieder jugendlich vor. Und es ist so unnatürlich ruhig darin, dass ich beim Betreten der Eingangshalle zuerst die Befürchtung hatte, einen Hörsturz erlitten zu haben. Aber es war nur die ungewohnte Abwesenheit sämtlichen Lärms. Personal und Gäste unterhielten sich ausschließlich in murmelndem oder flüsterndem Ton. Ich sah Leute ihre Teetassen derart behutsam abstellen, dass dabei unmöglich ein Laut entstehen kann, und wenn doch, dann wird er von den dicken lärmschluckenden Teppichen mit nautischen Motiven umgehend aufgesogen. Die ziemlich kuriose Uhr der Lobby, die man anscheinend aus einem antiken Muscheltaucherhelm, einem präparierten Oktopus und einem Chronometer gefertigt hat, ist vielleicht gar nicht defekt, sondern nur nicht aufgezogen, damit kein Ticken oder gar ein Glockenschlag die allgemeine Grabesstille stören kann. Ihre Zeiger deuten daher ewig mahnend auf fünf vor zwölf. Nun ja, auch eine stillstehende Uhr sagt immerhin zweimal am Tag die richtige Zeit an. Und vielleicht genügt auf dieser Insel diese Mindestanforderung an Zeitmesser schon vollkommen, obwohl Chronometer eigentlich dafür hergestellt werden, um in der Seefahrt besonders exakt die Uhrzeit anzusagen.
Fünf vor zwölf
Nur das zarte Säuseln des Meereswindes durch die Doppelglasfenster zeugte davon, dass die Zeit wenigstens draußen noch weiterlief. Auf Zehenspitzen schlich (oder immer noch: landschippte) ich zum Tresen und nannte eingeschüchtert wispernd meinen Namen.
»Ich, äh, habe ein Zimmer reserviert«, fügte ich fast unhörbar hinzu. Dennoch war ich davon überzeugt, dass sich alle Ohren im Raum in meine Richtung spitzten. Der Rezeptionist, der gerade an seinem Schlüsselbrett hantierte, drehte sich aufreizend langsam um und blickte mich abschätzig an. Ich muss leider gestehen, mein lieber Hachmed, dass ich bis ins Mark erschrak, als ich erkannte, dass er ein Nebelheimer war!
Nebelheimer Rezeptionist
Nun, du weißt ja, dass ich seit unserem gemeinsamen Erlebnis mit Nebelheimern und ihrer Trompaunenmusik ein gespanntes, fast schon neurotisches Verhältnis zu dieser zamonischen Daseinsform habe.5 Aber ich arbeite kontinuierlich an der Bekämpfung meiner Vorurteile, mein Freund!
Denn es ist mir natürlich klar, dass man aufgrund eines einzigen unangenehmen Zwischenfalls mit ein paar missratenen Vertretern einer Bevölkerungsgruppe nicht gleich alle Nebelheimer über einen Kamm scheren darf. Daher gab ich mir wirklich alle Mühe, über meinen Schatten zu springen, mir nichts anmerken zu lassen und diesen Rezeptionisten mit größtmöglicher Unbefangenheit zu behandeln. Leider hat er einen Sprachfehler: ein enervierendes Pausieren zwischen manchen Satzteilen, unterstrichen von einem gespenstischen Hauchen, was eine zwanglose Kommunikation mit ihm nicht unbedingt erleichtert.
»In der Tat, Herr von … (unangenehme Pause, langer Blick in sein Gästebuch) … hhhhh … Mythenmetz«, entgegnete er mit so jenseitiger und körperloser Stimme, dass sich meine Nackenschuppen sträubten. »Wir haben Sie bereits … hhhhh … gestern erwartet.«
»Ich musste in Klein-Hafing übernachten«, antwortete ich im Flüsterton. »Mein Schiff geriet in einen furchtbaren Sturm und daher …«
»Ich weiß«, unterbrach er. »Dieser schreckliche Sturm. Wir werden Ihnen … hhhhh … die letzte Nacht selbstverständlich nicht berechnen. Wir haben ein sehr komfortables Zimmer für Sie bezugsfertig. Und es wird Sie wahrscheinlich erfreuen, dass es … hhhhh … eine ganze Kategorie höher liegt als der reservierte Raum. Es ist eine Suite. Aber … hhhhh … Sie bezahlen selbstverständlich denselben Preis wie für das Standardzimmer.«
»Das ist allerdings erfreulich, danke!«, antwortete ich. »Der bisherige Gast musste vorzeitig abreisen?«
»So könnte man es formulieren. Er ist … hhhhh … hhhhh … plötzlich verstorben.«
Ich zuckte nur unmerklich zusammen und versuchte, einen Gesichtsausdruck aufzusetzen, in dem sich die Betroffenheit über den Todesfall und die Freude über das bessere Zimmer auf pietätvolle Weise die Waage hielten, aber mir gelang wahrscheinlich nur eine verlogene Grimasse. Egal, denn der Nebelheimer starrte sowieso an mir vorbei ins Leere, während er mir den Schlüssel überreichte. »Zimmer … hhhhh … Einhundertdreizehn«, hauchte er. »Benötigen Sie Hilfe mit dem … hhhhh … Gepäck?«
Ich sah kurz zu dem Gepäckträger hinüber. Es war schon wieder so ein muskulöser, moosbärtiger Küstengnom, eine auf dem Festland eher seltene Daseinsform, die dafür aber offensichtlich erfolgreich auf Eydernorn Fuß gefasst hat. Auch er trug eine Lebendige Tätowierung auf der Stirn, und auch er sah so aus, als sei er mindestens fünfmal so alt wie ich, könne mich aber mit Leichtigkeit inklusive Gepäck und mit nur einer Hand aufs Zimmer tragen. Wenn jemand für sein hohes Alter einen besonders sportlichen oder belastbaren Eindruck macht, dann nennt man das »rüstig«, nicht wahr, mein guter Hachmed? Aber für den Eindruck, den dieser drahtige Greis auf mich machte, wäre ein läppisches »rüstig« nicht ausreichend gewesen. Athletisch, drahtig oder sogar beneidenswert wäre angemessener. Ein Körper, in dem die Zeit so stillzustehen schien wie in der Uhr der Empfangshalle.
Der Boden wankte immer noch unter meinen Füßen, und ich verspürte, da ich mich während des Sturmes so hartnäckig in die Reling gekrallt hatte, sogar einen ausgewachsenen Muskelkater in meinen Händen und Armen. Daher nahm ich die angebotene Dienstleistung dankbar an.
»Sie haben … hhhhh … einen Hummdudel!«, zischelte mir der Nebelheimer hinterher. Ich blieb kurz stehen und überlegte, was er damit gemeint hatte. Ich hätte einen … was? Einen Hummdudel? War das etwa eine Eydernorner Beleidigung, die mir einen Dachschaden unterstellte? Weil er meine Nebelheimerfeindlichkeit instinktiv gespürt hatte? Es klang jedenfalls wie ein Schimpfwort. Aber warum sollte er einen zahlenden Gast, den er gerade noch zuvorkommend bedient hatte, plötzlich derart kompromittieren? Vielleicht war mein Gehör von der Überfahrt ähnlich beeinträchtigt wie mein Gleichgewichtsgefühl? Hatte er eventuell »Sie haben eine Rumbuddel« gesagt – und damit die alkoholische Verpflegung auf meinem Zimmer gemeint, die im Eydernorner Hotelgewerbe ja besonders vorbildlich sein soll, wie ich dem Reiseführer entnehmen konnte. Aber der alerte Halbzwerg eilte bereits leichtfüßig eine mit faustdicken Teppichen gepolsterte Treppe hinauf, die jedes Trittgeräusch verschluckten, und der Nebelheimer widmete sich hinter seinem Tresen wieder seinen nummerierten Schlüsseln. Also ließ ich es auf sich beruhen und folgte meinem sportlichen Gepäckträger, den ich wegen seines penetranten Makrelengeruchs auch mit verbundenen Augen im Dunkeln gefunden hätte.
»De harten Smügen in de Prükken«, informierte er mich, als ich ihn nicht ohne Mühe endlich eingeholt hatte. »Dat gieft ün Smökenpriel!« Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wovon er da faselte, denn bei ihm war der Dialekt besonders ausgeprägt. Aber ich nahm an, dass es, wie bei derartigem Höflichkeitsgeplänkel mit Hotelpersonal üblich, das Wetter betraf. »Ja, ja«, antwortete ich daher. »Das glaube ich auch.«
»Ik woor Kraaken fieken in de Düjnen!«, fügte er hinzu, während er im Lauftempo vorauseilte, ohne außer Puste zu geraten. Ich musste mich nun wirklich nicht sehr anstrengen, um zu kombinieren, dass mit »Düjnen« die Eydernorner Küstenlandschaft gemeint war. Aber ich kam zum Glück nicht mehr dazu, mir auszumalen, wie er darin »Kraaken fiekte«, weil wir bei meinem Zimmer angekommen waren.
»Zemmer Hondertdertiejn!« Das verstand ich und weiß seitdem, wie ich »Hundertdreizehn« auf Eydernorner Platt aussprechen muss. Im Nu hatte er aufgeschlossen und die schwere Tür aus aufgearbeitetem Treibholz mit eingewachsenen Muscheln und Seesternen mit der breiten Schulter aufgewuchtet, ohne das Gepäck abzusetzen. Wir traten ein.
»Da boopen geit de Smükken en de Brommsdijdl«, klärte er mich auf, während er die Vorhänge öffnete und mir damit einen nebelverhangenen Ausblick über Eydergard präsentierte, also einen Blick ins Nichts.
»Sehr schön«, sagte ich.
Auf einer Kommode stehen ein paar Flaschen mit hochprozentigen alkoholischen Getränken – darunter tatsächlich auch eine waschechte Rumbuddel. Ich entspannte mich wieder ein bisschen mehr.
»En hiejr«, fügte der Diener mit düsterem Blick auf das große Bett hinzu, »is de laatse Gaast chestorven.«
Wenn er damit sagen wollte, dass auf diesem Bett, über dem ein großes Ölbild hängt, auf dem ein Segelschiff in wildbewegten Wellen von einem rotglühenden Riesentintenfisch in die Tiefe gezerrt wird, der letzte Gast gestorben ist, dann war das eigentlich mehr Service, als ich benötigte. Ich hatte den Gedanken an meinen verblichenen Zimmervorgänger erfolgreich verdrängt, aber jetzt musste ich mir zwanghaft einen röchelnden Greis vorstellen, der auf dieser Steppdecke mit eingestickten Ankern und Harpunen seinen letzten Atemzug aushauchte. Ich kann nur hoffen, dass er nicht an irgendeinem ansteckenden und resistenten Keim verschieden ist, und habe mir daher vorgenommen, die ersten Nächte lieber auf dem Sofa in der Ecke zu verbringen, damit eventuell vorhandene Bazillen in der Bettwäsche genug Zeit bekommen, ihre restliche Virulenz zu verlieren. Waren das eigentlich Schwimmhäute zwischen den Fingern meines Hotelpagen? Eine peinliche Pause entstand, in der ich klimpernd nach Trinkgeld in meiner Reisebörse suchte. Da sagte der Moosbärtige plötzlich: »Un dat is de Hummdudel!«
Ich folgte mit dem Blick seinem wie anklagend ausgestreckten Finger und bemerkte erstmals das kleine Terrarium mit Bleiverglasung, das auf der großen Wäschekommode des Zimmers steht.
Ich trat neugierig näher und gewahrte darin zu meiner Verblüffung ein lebendes Wesen. Das Terrarium ist etwa so groß wie zwei Hutschachteln und rundum verglast, aber hier und da sind kleine Luftlöcher durch das Glas gebohrt. In einer liebevoll gestalteten Miniaturküstenlandschaft aus nassem Schlick, vertrocknetem Strandhafer und Algenknäueln, einem Stückchen Treibholz, einem verrosteten kleinen Anker und sogar einer winzigen Piratenschatztruhe (wahrscheinlich mit einem winzigen Schatz darin) kauerte – ja, tatsächlich: ein lebendiges Wesen! Und zwar eine mir bislang unbekannte Kreatur, die ich auf den ersten Blick als Mischung aus Riesenschnecke, Nautilusmuschel, Seestern, Oktopus und Seeanemone beschreiben würde, während mir beim zweiten Blick noch ein paar andere Geschöpfe des Meeres einfielen.
Terrarium
Hummdudel
Speziell für dich, lieber Hachmed, versuche ich es mal etwas systematischer: Das kuriose Weichtier verfügt über ein schneckenhausähnliches Gehäuse, an dem winzige Muscheln, Meerespocken und Seesterne festgebacken sind, die ihm eine zusätzliche Panzerung verleihen. Aus der großen Öffnung quellen zahlreiche saugnapfbewehrte Rüssel sowie tentakelhafte Greifarme, die in ständiger, aber sehr langsamer Bewegung sind und mich an wabernden Seetang unter Wasser erinnern. Einmal glaubte ich in dem Ärmchengewirr ein gelbliches Auge auszumachen, das mich melancholisch und irgendwie mitleiderregend anglotzte, aber dann war es gleich wieder verschwunden. Der Unterkörper, der dem einer Raupe respektive Schnecke nicht unähnlich ist, kann sich auf seinen unzähligen winzigen und grünlichen Stummelbeinchen nur sehr gemächlich fortbewegen. Das Terrarium ist von außen mit einer kompliziert wirkenden technischen Apparatur bestückt, bestehend aus kleinen, langsam pumpenden Blasebälgen, einem gusseisernen Kessel (wie bei einer Miniaturdampfmaschine), diversen Kupferröhren, Überdruckventilen und Armaturen. Diese Maschine versorgt das Terrarium mit einem Dampf, wie ich ihn in solcher Farbe und Konsistenz noch nie gesehen habe. Er ist von leuchtendem, leicht pulsierendem Hellblau und verharrt in Form einer fingerdicken Schlange auf dem Schlickboden des Behältnisses, er wirkt beinahe so organisch wie das Hummdudel selbst. Als ich mich noch näher beugte, gewahrte ich durch die Luftlöcher einen intensiven Meeresgeruch. Und ich glaubte, ein rhythmisches Summen und Brummen (»Humm, humm, humm, hummhummhumm …«) zu hören, das vermutlich von dem kleinen Schalltrichter verstärkt wurde, der aus dem Terrarium ragte. Ich vernahm auch ein darüber gelagertes, sich ständig wiederholendes und beinahe hypnotisch klingendes Dudeln, das sich fast so anhörte, als sängen in der Ferne mehrere kindliche und schöne Stimmen zu fremdartiger Dudelsackmusik. Ich glaubte sogar, ferne Meeresbrandung zu hören, aber das war natürlich Einbildung.
»Hummdudel«, wiederholte der Zwerg. »Sächt, wie dat Wedder geit!« Er goss vermittels einer danebenstehenden kleinen Gießkanne etwas Wasser in das Terrarium.
»Es kann … das Wetter vorhersagen?«, versuchte ich aus dem Stegreif zu übersetzen. Der Zwerg nickte eifrig.
»Johoo! Singt de Hummdudel huuh – Wedder wörd guud. Singt de Hummdudel bass – Wedder wörd nass.«
Aha. Das war ja eigentlich leicht zu merken: Wenn der (die? das?) Hummdudel hoch singt, bleibt es trocken. Bei tiefen Tönen empfiehlt es sich wohl, einen Schirm mitzunehmen. Erfreut darüber, so ein putziges lebendes Barometer als Zimmergenossen zu haben (und vom Rezeptionisten offensichtlich nicht beleidigt worden zu sein – jetzt war auch das geklärt), händigte ich dem Pagen ein Trinkgeld aus, das ich als fürstlich ästimierte, er jedoch mit steinerner Miene entgegennahm.
»Queekwigg!«, rief er und klopfte sich dabei mit der Faust vor die Brust.
Es dauerte einen Augenblick, bis ich begriffen hatte, dass dies keine Dankbarkeitsbekundung war, sondern sein Name. Dann entfernte er sich unter unverständlichem Gemurmel.
Queekwigg
Ich verstaute meine Reisegarderobe in Schrank und Kommode und wusch mir am wunderbar sauberen Waschbecken Gesicht und Hände. Dann inspizierte ich die Schreibutensilien auf dem kleinen, aber für die Zeit meines Aufenthalts ausreichenden Schreibtisch: Briefpapier mit Hotel-Strandlöper-Briefkopf, Tintenfass mit wasserfester Seemannstinte (»Kapitänsqualität« – nicht verkehrt auf einer Insel, deren Post von Schiffen durch Sturm und Regen und über den Ozean transportiert wird), drei frisch gespitzte Federn, Löschpapier, Siegellack, Adressstempel und Stempelkissen, ein Federmesser, ein paar Umschläge, ein Bleistift, fünf der berühmten dreieckigen Eydernorner Briefmarken mit Motiven von hiesigen Naturerscheinungen, ein Radiergummi in Muschelform.
Dreieckige Briefmarken
Sehr ordentlich, damit kann ich immerhin ein paar Gedichte oder Kurzgeschichten verfassen. Und meine Korrespondenz an dich. Schließlich versuchte ich, mich auch geistig zu akklimatisieren, indem ich mir ein ordentliches Glas aus der wohlgefüllten Rumbuddel (achtzig Prozent) einschenkte und mich an den Tisch setzte, wo ich diesen zweiten Brief an dich schreibe. Dabei habe ich die ganze Zeit dem beruhigenden Gehumme und Gedudel des Hummdudels gelauscht, bis ich beinahe im Sitzen darüber eingeschlafen wäre.
Dein nun hoffentlich endlich vollständig auf Eydernorn angekommener
Dritter Brief
[Geschrieben im Café Strandlöper]
Die nächste spektakuläre Sehenswürdigkeit von Eydernorn nach den Leuchttürmen, folgt man dem Reiseführer, durfte ich gleich am heutigen Morgen bei meinem ersten Spaziergang bestaunen, mein lieber Hachmed! Und sie hatte wieder mit Ereignissen am Firmament zu tun, denn es waren die sogenannten »Wogenden Wolken« über der Insel, die es an fast jedem nebelfreien Tag kostenlos zu bestaunen gibt, wenn man von der saftigen Kurtaxe absieht. Der Nebel hatte sich endlich so weit verzogen, dass ich freien Blick auf den Himmel hatte.
Eines garantiere ich dir, mein bester Freund: Auch du würdest angesichts eines solchen Naturschauspiels aus dem Staunen nicht mehr herauskommen und mit deinem von Gehirnen beschwerten Kopf im Nacken herumlaufen, als ob du Nasenbluten hättest – so, wie ich es tat, als ich, immer noch leicht landschippend, aus der Tür des Hotels Strandlöper herausgetreten war. Denn derart wild bewegte und faszinierende Cumuli wie über Eydergard habe ich noch nie gesehen. Diese Wolken »wogten« tatsächlich wie aufgewühltes Meer hoch über den Dächern. Treffender kann man es nicht umschreiben. Die Fülle der Formen, der Abwechslungsreichtum von waberndem wattigem Gewölk, von gewaltigen tiefgrauen Wolkenwürmern und schraffierten Regenstreifen am Himmel war so eindrucksvoll, dass ich für lange Zeit den Blick nicht abwenden konnte. Es sah aus, als ob sich dort oben ein unsichtbarer Künstler mit gewaltigen Pinseln im Schaffensrausch austoben durfte, in kühnen Schwüngen mit Dampf und Regen malend, in allen Abstufungen von Grau und hin und wieder mit einem kühnen Strich von strahlend weißem Licht darin. Um kurz darauf alles wieder zu revidieren und neu zu überpinseln oder die Leinwand auf den Kopf zu stellen. Das war kein Wetter, das war Kunst.
Wie du weißt, habe ich schon häufig bewegte Himmel beobachtet und gelegentlich auch beschrieben: hastig ziehende Wolken vor und nach dem Sturm, blitzdurchzuckten Gewitterhimmel und sogar tobenden Orkan. Aber das hier war etwas ganz anderes. Waren das überhaupt noch Wolken? Sie zogen nicht einfach dahin, wie sie es gewöhnlich zu tun pflegen – nein, sie rotierten, sie stürzten über- und ineinander, vermengten und verdrängten sich, kreisten und verschlangen sich gegenseitig wie ein rasend gewordener Schwarm von kannibalischen Raubfischen. Ich konnte es mir auf Anhieb wirklich nicht erklären, denn die ungewöhnliche Turbulenz des Himmels schien keinerlei bekannten naturwissenschaftlichen Gesetzen zu folgen, keiner meteorologischen oder physikalischen Logik. Es herrschte kein Sturm, bei mir unten war es sogar beinahe windstill, aber dort oben sah es so aus, als bliese der Wind aus allen Richtungen gleichzeitig. Hatten diese Wolken den Verstand verloren? Oder ich?
Ein paar Einheimische lachten über mich. Völlig zu Recht, mein Lieber, denn so erkennt man auf der Insel den Neuankömmling, die Landratte vom Kontinent: daran, dass er mit zum Himmel gewandtem Blick durch die Gegend landschippt wie ein besoffener Matrose. Und gegen Hauswände und Straßenlaternen läuft, zur Erheiterung der alteingesessenen Inselbewohner und Stammgäste. Beinahe wäre ich in einen der Eydernorner Abwasserkanäle gestolpert, von denen es praktisch in jeder zweiten Straße einen gibt und die alle ins Meer fließen.
Aber das war mir völlig egal. Ich konnte den Blick einfach nicht abwenden. Ich kam mir vor wie unter Wasser, als beobachtete ich aus einem Taucherhelm heraus Riesenfische oder Seeungeheuer, die sich über mir an der Meeresoberfläche dicht an dicht drängten. Und immer wieder sah ich beängstigende Windhosen, die Tintenfischtentakeln ähnelnd aus dem bewegten Himmel nach der Insel zu greifen schienen. Dazwischen im düsteren grauen Brei der Wolken rotierten dunkle Löcher, die alles in sich hineinsogen, hypnotisch mit ihren langsamen Spiralbewegungen. Fratzen, Tiere, Untiere, Berge und Wälder sah ich für Sekunden auftauchen und wieder verschwinden, der Himmel über Eydernorn zeigte den ganzen unglaublich reichhaltigen Fundus eines Wolkentheaters an Kulissen und Requisiten. Dieses Firmament verwandelte mich in ein staunendes Kind mit der Naturauffassung eines zamonischen Ureinwohners. Kein Wunder, dass ein derart animierter Himmel in früheren Zeiten von der Inselbevölkerung als lebendiges Wesen oder als Kosmos von Göttern und Dämonen angebetet wurde.
Es gibt gegen dieses irritierende Spektakel ein probates Mittel, wie ich später aus dem Reiseführer erfuhr: den Blick einfach abzuwenden und mit gesenktem Kopf auf den Boden zu starren, so wie es die meisten Inselbewohner tun. Dieser demütige Blick ist hier so gebräuchlich, dass er einen eigenen Namen hat: Man nennt ihn den »Eydernorner Boudenkieker«. Das sieht im Straßenbild so aus, als würden die Leute kollektiv auf dem Pflaster nach verlorenem Kleingeld suchen. Daher kommt es, dass die alten Eydernorner beim Gehen nach unten, die Neuankömmlinge und Kurgäste nach oben schauen, aber so gut wie keiner geradeaus.
Mein erster Spaziergang führte mich bis zum Stadtrand, zum Sanatorium für Atemwegserkrankungen, das ich im Weiteren mit SAFÜAT abkürzen werde. Die Bewohner und Patienten nennen es auch spöttisch den »Lungenhügel«, etwas weniger gebräuchlich ist »Schloss Keuchhusten« oder »Bronchienburg«. Das SAFÜAT steht auf einer Anhöhe vulkanischen Ursprungs, einem soliden Sockel aus pechschwarzer verquollener Lava, die auf Eydernorn allgegenwärtig ist.
Sanatorium
Geologisch ist es eine ziemlich junge Insel, und die Natur hatte bisher noch nicht genügend Zeit, das frische Vulkangestein (es ist erst ein paar Millionen Jahre alt) komplett mit Erde und Pflanzen zu überdecken. Eine steile Treppe, direkt aus der wulstigen Lava geschlagen, führt hinauf zum Eingang des schmucklosen viereckigen und fünfstöckigen Gebäudes, das so einladend wirkt wie ein Krematorium – oder eine Irrenanstalt. Bereits wenn man die ersten Stufen betritt, hört man die schweren Fälle im Inneren röcheln und keuchen, denn die Fenster der mittleren Etage stehen meistens weit offen. Dort werden die Schwerkranken behandelt, und man hält es für eine genesungsfördernde Maßnahme, dass diese Patienten ununterbrochen der frischen Eydernorner Luft ausgesetzt sind, der man wunderwirkende Heilkräfte nachsagt. Mein Hausarzt hatte mich ja schon gewarnt, was die unorthodoxen Heilmethoden des SAFÜAT angeht. Auch wenn dort im Winter manchmal Temperaturen im zweistelligen Minusbereich gemessen werden, bleiben einige der Fenster stets offen, weshalb Personal und Patienten dieser Abteilungen dicke Pelzmäntel sowie Mützen und Schals aus Eydernorner Schafswolle tragen müssen.