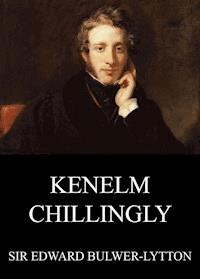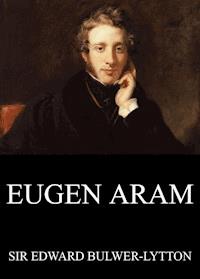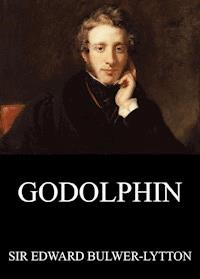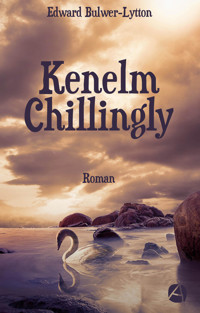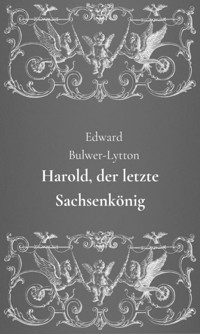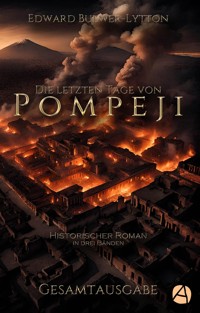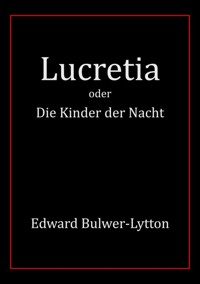Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reichel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sir Edward Bulwer-Lytton, bekannt durch seine Werke "Zanoni", "Das kommende Geschlecht" und "Die letzten Tage von Pompeji" folgt im "Lebenselixier" (1862 unter dem Titel " A strange Story" erschienen) den Lehrsätzen des altehrwürdigen, geheimnisvollen Ordens der Rosenkreuzer. Dem Orden, dem wahrscheinlich auch Bulwer-Lytton angehörte, wird nachgesagt, dass seine Mitglieder durch "vollendete Lebenskunst" und ein ganz aussergewöhnliches Maß an Wissen aus der Naturwissenschaft und Philosophie ein Mittel gefunden haben wollen, das menschliche Leben vor Krankheit, Alterung und Tod zu schützen und dass sie - durch ihre Kunst - so lange zu leben vermochten, wie das Leben ihnen Genuss und Freude bot, kurz - das Lebenselixier gefunden zu haben. In diesem Roman, der im frühen 19. Jahrhundert spielt, trifft ein Arzt auf Margrave, einen undurchsichtigen Schüler des Okkulten. Dieser wirft seinen Schatten über die gesamte Handlung, auch über Fenwicks Liebe zu Lilian Ashleigh, einer jungen Dame der Gesellschaft, hinter deren Hang zum Mystischen sich eine ausserordentliche Fähigkeit verbirgt. Bulwer- Lytton sagte dazu: "Es ist ein Roman und ist es nicht; es ist eine Wahrheit für die, die es verstehen können und eine Phantasterei für die, die es nicht können". Treffender kann man "Das Lebenselixier" nicht charakterisieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 815
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Dem Orden, dem wahrscheinlich auch Bulwer-Lytton angehörte, wird nachgesagt, dass seine Mitglieder durch "vollendete Lebenskunst" und ein ganz außergewöhnliches Maß an Wissen aus der Naturwissenschaft und Philosophie ein Mittel gefunden haben wollen, das menschliche Leben vor Krankheit, Alterung und Tod zu schützen und dass sie - durch ihre Kunst - so lange zu leben vermochten, wie das Leben ihnen Genuss und Freude bot, kurz - das Lebenselixier gefunden zu haben. In diesem Roman, der im frühen 19. Jahrhundert spielt, trifft ein Arzt auf Margrave, einen undurchsichtigen Schüler des Okkulten. Dieser wirft seinen Schatten über die gesamte Handlung, auch über Fenwicks Liebe zu Lilian Ashleigh, einer jungen Dame der Gesellschaft, hinter deren Hang zum Mystischen sich eine außerordentliche Fähigkeit verbirgt. Bulwer- Lytton sagte dazu: "Es ist ein Roman und ist es nicht; es ist eine Wahrheit für die, die es verstehen können und eine Phantasterei für die, die es nicht können". Treffender kann man "Das Lebenselixier" nicht charakterisieren.
Der Autor
Edward Bulwer-Lytton, engl. Romanschriftsteller und Politiker, ist bekannt geworden durch seine populären historischen/metaphysischen und unvergleichlichen Romane wie „Zanoni“, „Rienzi“, „Die letzten Tage von Pompeji“ und „Das kommende Geschlecht“. Ihm wird die Mitgliedschaft in der sagenumwobenen Gemeinschaft der Rosenkreuzer nachgesagt. 1852 wurde er zum Kolonialminister von Großbritannien ernannt.
Edward Bulwer-Lytton
Das Lebenselixier
Metaphysischer Roman
Übersetzt von Bernd Wollsperger
For what we do presage is not in grosse. For we be brethren of the Rosie Crosse. We have the Mason word, and second sight. Things for to come we can foretell aright...
Muses Threnodie, Henry Adamson, Edinburgh, 1638
Kapitel I
Im Jahre 18.. ließ ich mich als Arzt in einer der reichsten unserer großen englischen Städte nieder, die ich nur mit ihrem Anfangsbuchstaben L.... bezeichnen will. Ich war noch jung, hatte mir aber durch meine professionelle Tätigkeit , die mir – wie ich hoffen darf – in der Fachwelt immer noch den Ruf einer Autorität auf meinem Gebiet sichert, einen gewissen Namen erworben. Ich hatte in Edinburgh und Paris studiert und konnte mir an beiden dieser hervorragenden medizinischen Fakultäten den Beifall meiner Professoren in einem Maße erwerben, der die Ambitionen eines Studenten wohl zu der Aussicht auf zukünftige Auszeichnung berechtigte. Nachdem ich ein Mitglied des Ärztekollegiums geworden war, bereiste ich, ausgestattet mit Empfehlungsschreiben hervorragender Mediziner, die Hauptstädte Europas und trachtete danach, meine medizinischen Kenntnisse durch die verschiedenen Theorien und Behandlungsmethoden erweitern zu können. Ich hatte beschlossen, meinen Wohnsitz in London zu nehmen. Ehe ich jedoch meine Vorbereitungstour abschließen konnte, wurde mein Entschluss durch eines jener unerwarteten Ereignisse verändert, welche die Absichten des Menschen so oft vereiteln. Als ich auf dem Weg nach Norditalien durch Tirol kam, fand ich in einem kleinen, weit von ärztlicher Hilfe entfernten Gasthaus einen englischen Reisenden vor, der lebensgefährlich an einer akuten Lungenentzündung erkrankt war. Ich widmete mich ihm Tag und Nacht und hatte, eher infolge meiner sorgsamen Pflege als durch den Einsatz von Medikamenten, das Glück, seine vollständige Wiederherstellung bewirken zu können.
Der Reisende erwies sich als Julius Faber, selbst ein namhafter Arzt, der sich damit begnügt hatte, sich in seiner Geburtsstadt L... niederzulassen, jedoch einen weitverbreiteten Ruf als gründlicher und origineller Pathologe besaß, und dessen Schriften einen nicht unwichtigen Teil meiner eigenen speziellen Studien ausgemacht hatten. Er war gerade im Begriff gewesen, mit erneuerter Kraft von einem kurzen Erholungsurlaub nach Hause zurückzukehren, als er durch die erwähnte Krankheit niedergestreckt wurde. Der zufällige Patient wurde der Begründer meines beruflichen Glücks. Er fasste eine freundschaftliche Zuneigung zu mir, vielleicht um so mehr, als er ein kinderloser Junggeselle war und sein Neffe, auf den sein Reichtum übergehen sollte, nicht erkennen ließ, auch die Mühen, durch die der Reichtum erworben worden war, auf sich nehmen zu wollen. So war wohl ein Erbe für das Eine vorhanden, lange hatte er jedoch nach einem Nachfolger für das Andere gesucht und sich nun in den Kopf gesetzt, denselben in mir gefunden zu haben. So musste ich ihm zum Abschied versprechen, eine regelmäßige Korrespondenz mit ihm zu unterhalten und es dauerte nicht lange, bis er mir in einem Brief mitteilte, welchen Plan er zu meinen Gunsten geschmiedet hatte. Er würde alt, so schrieb er, die Arbeit in seiner Praxis überstieg seine Kräfte und er benötige einen Partner. Er bringe es nicht über sich, die Gesundheit seiner Patienten, die ihm wie Kinder ans Herz gewachsen seien, feil zu bieten: um so mehr, als Geld für ihn keine Bedeutung habe - der Menschheit, der er gedient und dem Ruf, den er erworben habe aber kein Nachteil aus der Wahl seines Nachfolgers erwachsen solle. Kurz, er schlug vor, ich solle sofort nach L... kommen, sein Partner werden und nach Ablauf von zwei Jahren seine Praxis ganz übernehmen, da er vorhabe, sich im Anschluss an diese Frist in den Ruhestand zu begeben.
Eine derartige Chance bietet sich einem jungen Mann, der gerade im Begriff war, sich in einem derart überbesetzten Beruf zu etablieren, nur selten; und als jemand, den weniger die Verlockungen des Geldes, als vielmehr die Aussicht auf Ruhm und Auszeichnungen anzogen, galt mir der Ruf des Arztes, der mir so großzügig die unschätzbaren Vorteile seiner langen Erfahrung bot und mich mit solcher Herzlichkeit in seine Praxis einführen wollte, als Beweis dafür, dass eine Praxis in der Hauptstadt nicht unbedingt notwendig sei, um zu nationalem Ansehen zu gelangen.
Ich begab mich also nach L.... und noch vor Ablauf der zwei Jahre meiner Teilhaberschaft rechtfertigte mein Erfolg die Wahl meines wohlwollenden Freundes und überstieg meine eigenen Erwartungen bei weitem. Ich hatte das Glück, gleich zu Beginn meiner Tätigkeit einige bemerkenswerte Heilerfolge zu erzielen und es bedeutet viel für die Karriere eines Arztes, wenn er durch einen glücklichen Wink des Schicksals das Vertrauen erringen kann, welches Patienten meist erst der langjährigen Erfahrung entgegen bringen. Zu der Leichtigkeit, in der mein Weg geebnet wurde, trugen wahrscheinlich auch einige Umstände bei, die mit meinen medizinischen Fähigkeiten nichts zu tun hatten. Meine Herkunft und mein Vermögen schützten mich vor dem Verdacht, ein medizinischer Abenteurer zu sein. Ich gehörte einer alten Familie an (einem Zweig des ehemals mächtigen Grenzclans der Fenwicks), die seit vielen Generationen ein schönes Gut in der Nähe von Windermere besaß. Als einzigem Sohn war diese Besitzung mit Eintritt meiner Volljährigkeit auf mich übergegangen und war von mir verkauft worden, um die Schulden meines Vaters, der als Antiquar und Sammler einen kostspieligen Geschmack besessen hatte, tilgen zu können. Der verbleibende Erlös sicherte mir, abgesehen vom Ertrag meiner Praxis, eine bescheidene Unabhängigkeit; und da ich gesetzlich nicht verpflichtet gewesen wäre, für die Verbindlichkeiten meines Vaters einzustehen, gewann ich durch mein Verhalten den Ruf der Uneigennützigkeit und Rechtschaffenheit, der die öffentliche Meinung in England stets für durch Fleiß oder Talent erworbene Erfolge geneigt stimmt. Vielleicht wurden mir auch berufliche Fähigkeiten, die ich besitzen mag, bereitwillig zugestanden, da ich mit großem Erfolg Studien in den an die Medizin angrenzenden Wissenschaften durchgeführt hatte. Kurz gesagt, ich befand mich in der glücklichen Lage, in der Gesellschaft eine Stellung einnehmen zu können, die meinem Ruf als Arzt behilflich war und die Stimmen der Neider, die für gewöhnlich den Erfolg verbittern oder sogar zu verhindern wissen, zum Verstummen brachte.
Dr. Faber setzte sich nach Ablauf der vereinbarten zwei Jahre zur Ruhe. Er ging ins Ausland und da er noch immer über eine rüstige Gesundheit und einen wachen, wissbegierigen Geist verfügte, unternahm er viele Reisen, während derer wir anfangs einen regelmäßigen Briefwechsel unterhielten, der jedoch im Laufe der Zeit versiegte und schließlich ganz zum Erliegen kam.
Ich konnte den größten Teil der Praxis, die mein Vorgänger in dreißig Jahren harter Arbeit aufgebaut hatte, auf mich übertragen. Mein Hauptrivale war ein gewisser Dr. Lloyd, ein gütiger, heißblütiger Mann – nicht ohne ein gewisses Genie ausgestattet, so weit von Genie gesprochen werden kann, wenn es an Urteilsvermögen fehlt; nicht ohne wissenschaftliche Kenntnisse, denen es jedoch an der notwendigen Gründlichkeit mangelte – einer jener begabten, aber oberflächlichen Männer, welche nicht fähig sind, sich dem gewählten Beruf mit dem vollen Einsatz ihres Verstandes zu widmen. Männer dieser Art verfallen für gewöhnlich einer mechanischen Routine, da sich ihre Gedanken während der Ausübung ihrer angeblichen Berufung verlockenderen Beschäftigungen zuwenden. Aus diesem Grunde sind sie im Rahmen ihrer Tätigkeit selten kühn oder erfinderisch – obwohl sie diese Eigenschaften außerhalb ihres Beruf bisweilen sogar im Übermaß zeigen. Zeigt sich jedoch im Rahmen dessen eine grundlegende Neuerung, so pflegen sie dieselbe mit einer an Starrsinn grenzenden Zähigkeit und Leidenschaft, die den ruhigen Philosophen unbekannt ist, die sich jeden Tag mit Neuigkeiten beschäftigen, diese mit der Nüchternheit geübter Augen prüfen, bei Seite legen, teilweise verändern oder sich ganz aneignen, je nachdem ob das vergleichende Experiment die Mutmaßung bestätigt oder als nicht stichhaltig zurückweisen muss.
Dr. Lloyd hatte sich als ausgebildeter Naturwissenschaftler einen Ruf erworben, lange bevor ihm der eines akzeptablen Arztes zuteil geworden war. Trotz aller Entbehrungen seiner Jugend hatte er es Schritt um Schritt zustande gebracht, eine zoologische Sammlung, nicht lebender, sondern zum Glück des Betrachters ausgestopfter und einbalsamierter Lebewesen zusammen zu tragen. Aus dem, was ich berichtet habe, kann zu Recht geschlossen werden, dass Dr. Lloyd´s frühe Karriere als Mediziner nicht gerade brillant zu nennen war; in späteren Jahren hatte er sich jedoch in den Status einer Autorität, den die Zeit einem allgemein respektierten Menschen zugesteht, den man allgemein schätzt und den zu beneiden sich niemand veranlasst sieht, eher hinein gealtert als gearbeitet.
In L... gab es zwei deutlich getrennte gesellschaftliche Kreise – den der reichen Kaufleute und Händler und den einiger weniger privilegierter Familien, die einen fernab vom geschäftigen Treiben des Handels gelegenen Teil der Stadt bewohnten, den man Abbey Hill nannte. Diese stolzen Areopagiten übten über die Frauen und Töchter der niederen Klasse, der mit Ausnahme des Abbey Hills alle Bürger ihren Wohlstand verdankten, den selben geheimnisvollen Einfluss aus, den man unter ähnlichen Verhältnissen in allen großen und kleinen Städten Englands beobachten kann.
Abbey Hill war nicht übermäßig reich; aber durch eine Konzentration seiner Ressourcen mächtig genug, in allen Arten der Gönnerschaft maßgebend zu sein. Abbey Hill hatte seine eigene Modistin, seine eigene Textilhandlung, seinen eigenen Konditor, Metzger, Bäcker und Teehändler. Die Schirmherrschaft des Abbey Hill war der eines Königshauses vergleichbar – an sich wenig lukrativ, vielmehr ein feierliches Zeugnis des allgemeinen Verdienstes. Die Läden, die Abbey Hill zu ihrem Kundenkreis zählen durften, gehörten sicher nicht zu den günstigsten, wahrscheinlich nicht einmal zu den besten, waren jedoch unbestreitbar eindrucksvoll. Die Eigentümer waren auf anständige Weise prunkvoll, die Angestellten auf hochmütige Art höflich. Es schien ganz so, als ob es sich um Staatsbedienstete handelte, die verächtlich auf diejenigen herab blickten, denen sie dienen sollten. Die Damenwelt der Low Town, (die am Fuße des Hills liegende Stadt war nach dem Vorbild einer weit zurückliegenden Feudalzeit entworfen worden), betraten diese Läden mit einer ehrfurchtsvollen Scheu und verließen sie wieder mit einer gewissen Art Stolz. Sie hatten eine Erfahrung gemacht, die der Hill anerkannte; sie hatten gekauft, was sich der Hill leisten konnte. Es bedeutet viel im Leben sich bewusst zu sein, das Rechte getan zu haben, was immer diese Überzeugung uns auch kosten mag.
Abbey Hill pflegte unter anderem auch seinen eigenen Arzt zu konsultieren. Aber diese Gewohnheit war in den späteren Jahren der Praxis meines Vorgängers etwas außer Brauch geraten. Seine Überlegenheit über alle anderen Ärzte der Stadt stand derart unbestritten fest, dass der Berg, welcher gelegentlich auch den physischen Gebrechen der einfachen Sterblichen unterworfen war - obwohl Dr. Faber den städtischen Krankenhäusern und Kliniken vorstand und auch seiner Herkunft nach ausdrücklich zuständiger Arzt der Unterstadt war - die Frage der Ehre nicht so weit betrieb, in der Sache ein Opfer an Menschenleben zu riskieren. Da die untere Stadt einen der berühmtesten Ärzte Englands besaß, entschloss sich der Abbey Hill großmütig, ihn nicht durch einen Rivalen in Bedrängnis zu bringen. Abbey Hill ließ sich gnädig von ihm den Puls fühlen.
Als mein Vorgänger in den Ruhestand ging, hatte ich in überheblicher Weise vorausgesetzt, der Hill werde fortfahren, sich seines normalen Rechts an einem eigenen Arzt zu erinnern und mir dieselbe großmütige Gunst zu Teil werden lassen, die er ihm, der mich für würdig befunden hatte seinen Ehren nachzufolgen, erwiesen hatte. Ich hatte Anlass für diese Vermessenheit, da der Hill mir bereits zugestanden hatte, eine nennenswerte Anzahl seiner Patienten behandeln zu dürfen, mir einige gnädige Dinge über das große Ansehen der Familie Fenwick gesagt und mich hin und wieder zum Dinner und viel häufiger noch zum Tee eingeladen hatte.
Doch mein Dünkel erlitt einen bemerkenswerten Rückschlag. Abbey Hill erklärte, dass die Zeit gekommen sei, das im Dornröschenschlaf liegende Privileg wieder ins Leben zu rufen, einen Doktor seiner eigenen Wahl zu berufen, einen Doktor, dem man wohl gestatten konnte, aus Gründen der Menschlichkeit oder des Gewinns die Unterstadt zu besuchen, der aber seine besondere Lehenstreue gegen Abbey Hill nachdrücklich dadurch bekundete, seine Wohnung auf dieser ehrwürdigen Anhöhe zu nehmen. Miss Brabazon, eine unverheiratete Dame ungewissen Alters, aber unzweifelhafter Abstammung, mit einem kleinen Vermögen und einer großen Nase – die sie selbst scherzhaft als Beweis ihrer Abstammung von Humphrey, Duke of Gloucester (mit dem sie, ungeachtet der Zeitrechnung, tatsächlich oft diniert haben mag) erklärte – wurde beauftragt, mich, ohne den Hill durch die Anfrage in irgendeiner Weise bloßzustellen, diplomatisch zu befragen, ob ich geneigt sei, ein am Rande des Hills gelegenes, großes, altertümliches Herrenhaus zu beziehen, das vor vielen Jahrhunderten von Äbten bewohnt worden sein soll und von der Bevölkerung immer noch „Abbots´ House“ genannt wurde. Sollte ich mich hierzu entschließen können, werde der Berg an mich denken.
„Es handelt sich allerdings um ein großes Haus für einen alleinstehenden Mann,“ sagte Miss Brabazon offen und fügte mit einem Seitenblick von alarmierender Süße hinzu, „aber sobald Dr. Fenwick die seiner Abstammung entsprechende Stellung unter uns eingenommen hat, braucht er nicht lange alleine zu leben, es sei denn, er zieht diesen Zustand vor.“
Ich antwortete mit größerer Derbheit, als der Anlass gerechtfertigt hätte, dass ich zur Zeit nicht daran denke, meine Wohnung zu verlegen und dass der Hill eben nach mir schicken solle, wenn er mich brauche.
Zwei Tage danach mietete sich Dr. Lloyd in Abbots´ House ein und kaum eine Woche später war er der erklärte medizinische Ratgeber des Hills. Die Wahl wurde durch den Richtspruch einer großen Dame entschieden, die unter dem Namen einer Mrs. Colonel Poyntz auf der heiligen Anhöhe als Alleinherrscherin gebot.
„Dr. Fenwick,“ sagte diese Dame, „ist wohl ein kluger junger Mann und Gentleman, aber bildet sich doch ein wenig zu viel darauf ein – der Berg duldet keine Anmaßung außer der eigenen. Hinzu kommt, dass es sich um einen Neuankömmling handelt: der Widerstand gegen Neuankömmlinge, überhaupt gegen alles Neue, ausgenommen Hüte und Romane, stellt eines der wichtigsten Bande dar, welche alteingesessene Gesellschaften zusammenhalten. Aus diesem Grunde hat Dr. Lloyd auf meinen Rat hin Abbots´House bezogen; die Kosten hierfür würden jedoch seine Mittel übersteigen, wenn der Hill sich nicht verpflichtet fühlte, das in seine Protektion gelegte Vertrauen zu rechtfertigen. Ich versicherte ihm, dass alle meine Freunde nach ihm schicken würden, sobald ein Krankheitsfall auftritt, und wer sich zu meinen Freunden rechnet, wird mich nicht Lügen strafen. Was der Hill tut, wird viele Nachahmer bei denen dort unten finden – damit ist die Angelegenheit geregelt!“ Und sie war geregelt.
Dr. Lloyd, in solcher Weise an der Hand genommen, dehnte den Bereich seiner Besuche bald über die Grenzen des Hills aus, der für einen Arzt nicht unbedingt gleichbedeutend mit einem Berg aus Gold war und teilte sich mit mir, wenn auch zu einem geringen Anteil, die viel einträglichere Praxis in der Low Town.
Ich hatte keinen Grund, ihm seinen Erfolg zu missgönnen und tat es auch nicht. Aber nach meiner Ansicht über Heilkunst war seine Diagnose nur oberflächlich und seine Rezeptur veraltet. Wurden wir zusammen zu einem Ärztekonzil berufen, konnten wir uns nur selten auf eine Behandlungsweise verständigen. Ohne Zweifel war er der Ansicht, ich müsse in Anbetracht seiner Jahre Respekt zeigen; aber ich hielt es mit der Auffassung, welche die Jugend für die Wahrheit und die Alten für ein Paradox halten: nämlich, dass in Bezug auf wahre Wissenschaft in Wirklichkeit die Jüngeren die Erfahreneren - mit den neuesten Errungenschaften vertraut - seien, während die Senioren stur an den Lehrsätzen festhielten, die ihnen beigebracht worden waren als die Welt noch einige Jahrzehnte jünger war.
Inzwischen breitete sich mein Ruf rasch aus, auch über meinen derzeitigen Wirkungskreis hinaus; mein Rat wurde sogar von Patienten aus der Hauptstadt eingeholt. Das Streben, das mir schon in früher Jugend meine Karriere vorgezeichnet und all meine Mühen versüßt hatte – der Ehrgeiz meinen Platz unter den großen Ärzten einzunehmen, denen die Menschheit eine dankbare, wenn auch prunklose Anerkennung zollt – sah sich vor freiem Feld und einem sicheren Ziel.
Ich weiß nicht, ob ein weit vor der dafür vorgesehenen Zeit errungener Erfolg dazu berechtigt, aber er rechtfertigte meiner Ansicht nach den Hauptzug meiner moralischen Organisation – intellektuellen Stolz.
Trotz aller Milde und Sanftheit gegenüber den meiner Obhut anvertrauten Patienten, ein notwendiges Element meines Berufes, neigte ich zu Intoleranz gegenüber Kollegen, die meinen Ansichten widersprachen – ja selbst meine Lieblingstheorien anzweifelten.
Die Grundsätze meiner medizinischen Ausbildung richteten sich streng nach den Prinzipien der induktiven Logik aus. Mein Glaubensbekenntnis war ein strenger Materialismus. Ich zeigte tiefe Verachtung für all jene, die gläubig hinnahmen, was durch Vernunft nicht erklärt werden konnte. Meine Lieblingsphrase war „gesunder Menschenverstand“. Gleichzeitig hatte ich keinerlei Vorurteile gegenüber kühnen Entdeckungen, da Entdeckungen Forschung voraussetzen, verwarf aber alle Hypothesen, die nicht durch einen praktischen Test bestätigt werden konnten.
Als Mediziner war ich Schüler von Broussai´s, auf metaphysischem Gebiet Anhänger Condillac´s gewesen. Ich glaubte mit diesem Philosophen daran, dass „wir all unser Wissen der Natur schulden; dass wir uns zu Beginn nur durch ihre Lektionen unterrichten können; und dass alle Kunst der Spekulation nur in der Fortsetzung dessen bestehe, was sie uns zu beginnen gezwungen hat.“ Da ich die Naturphilosophie streng von den Lehren der Offenbarung zu trennen wusste, kam ich nie mit den letzteren in Konflikt; aber ich behauptete steif und fest, dass kein gründlicher Denker aus ersterer die Existenz der Seele als drittes Prinzip neben Geist und Körper ableiten könne. Dass wie durch ein Wunder der Mensch wieder lebendig werden könnte, sei eine Frage des Glaubens, nicht des Verstandes. Ich überließ den Glauben der Religion und verbannte ihn aus der Philosophie. Wie konnte mit der Sicherheit, die der Logik der Philosophie genügte, definieren, was wieder lebendig werden sollte? Der Körper? Wir wissen, dass der Körper im Grab ruht, bis der Zersetzungsprozess seine Elementarteile in eine andere materielle Form gebracht hat. Der Geist? Aber der Geist war ein klares Resultat der körperlichen Organisation, wie die Musik des Cembalos das Resultat des sie erzeugenden Mechanismus des Instrumentes ist. Der Geist teilt die Hinfälligkeit des Körpers in extremem Alter, und durch Beschädigung des Gehirns kann in Mitten der vollen Kraft der Jugend der Intellekt eines Plato oder Shakespeare zerstört werden. Aber das dritte Prinzip – die Seele – dieses Etwas, das im Körper wohnen soll, wie sollte sie weiterleben können? Wo verbarg sie sich vor den Blicken des Pathologen? Mussten die Philosophen, die versuchten sie zu definieren, sie nicht mit den Eigenschaften des Geistes vermischen? Konnten man sie auf das bloße moralische Empfinden reduzieren, veränderbar durch Erziehung, Ausbildung, Verhältnisse und physische Konstitution? Aber selbst das moralische Empfinden des tugendhaftesten Menschen kann durch ein Fieber weggewischt werden. Dies waren meine Ansichten zu der Zeit, von der ich jetzt spreche – Ansichten, die sicher nicht originell oder gefällig zu nennen sind; aber ich hielt an ihnen mit einer Hartnäckigkeit fest, als handele es sich um besonders trostbringende Wahrheiten und ich sei ihr Entdecker. Ich zeigte Intoleranz gegenüber denjenigen, die dem widersprechende Lehren unterstützten – verachtete sie als irrational oder verabscheute sie als unaufrichtig. Sicher hatte ich die Laufbahn, die mein Streben vorausgesagt hatte, vollendet – war Begründer einer neuen pathologischen Schule geworden und meine Theorien in akademischen Vorlesungen zusammengefasst – hätte sogar eine, wenn auch schwache Autorität für jene Sekten abgegeben, die das Interesse des Menschen auf das Leben beschränken, das seinen Abschluss im Grab findet.
Vielleicht fand auch das, was ich intellektuellen Stolz nenne, mehr als ich zuzugeben bereit war, Nahrung in dem Selbstvertrauen, das gewöhnlich aus einem ungewöhnlich hohen Grad physischer Kraft erwächst. Ich war von der Natur mit der Statur eines Athleten gesegnet worden. Unter der abgehärteten Jugend des nördlichen Athens hatte ich mich durch frühzeitige Proben meiner Behendigkeit und Kraft ausgezeichnet. Meine geistigen Arbeiten und das gewissenhafte Verantwortungsbewusstsein, welches mit dem medizinischen Beruf einher gehen sollte, ließ mich zwar des Lebens nicht so recht froh werden, konnte jedoch meine seltene körperliche Gesundheit in keiner Weise schwächen. Ich durchmaß die Menge mit festem Schritt und dem stolz erhobenen Haupt eines der geharnischten Ritter des Altertums, der sich in seinem Gehäuse aus Eisen einem ganzen Haufen gewachsen fühlte.
Aus diesem Grunde trug der Sinn einer robusten Individualität, ebenso stark in disziplinierter Vernunft wie in animalischer Kraft und daran gewöhnt, anderen zu helfen, dazu bei, meinen Willen gebieterisch und meine Meinung arrogant zu gestalten. Diese Mängel waren mir meinem Beruf keineswegs abträglich; im Gegenteil, da sie von einem ruhigen Wesen und der Art Würde, die eine Art Amtstracht der Selbstachtung ist, begleitet wurden, dienten sie dazu, mir Respekt zu verschaffen und Vertrauen herzustellen.
Kapitel II
Ich war ungefähr sechs Jahre in L... tätig, als ich plötzlich in eine Kontroverse mit Dr. Lloyd verwickelt wurde. Gerade als die ärztlichen Erfolge dieses unglücklichen Mannes auf ihrem Zenit standen, beging er die Dummheit, sich nicht nur als begeisterten Anhänger des Mesmerismus als Heilmaßnahme zu proklamieren, sondern auch als eifrigen Gläubiger der Realität somnambulen Hellsehens als eines unschätzbaren Geschenks bestimmter privilegierter Organisationen zu erklären. Diesen Doktrinen setzte ich eifrigen Widerspruch entgegen – vielleicht mit um so größerer Heftigkeit, da Dr. Lloyd aus ihnen einen Beweis für die Existenz der Seele sowie der Unabhängigkeit des Geistes vom Körper ableitete und darauf ein Gebilde physiologischer Phantasien aufbaute, welches, wäre es nachzuweisen gewesen, jedes System der Metaphysik, das sich die anerkannte Philosophie bisher herabgelassen hatte zu diskutieren, ersetzt hätte.
Ungefähr zwei Jahre, bevor er eigentlich eher ein Schüler von Puysegur als von Mesmer wurde (Mesmer setzte wenig Vertrauen in die Gabe des Hellsehens, deren erster kühner Verfechter in der Neuzeit, wie ich glaube, Puysegur war), hatte Dr. Lloyd seine sehr viel jüngere, zärtlich geliebte Gattin verloren. Dieser Verlust, der ihn Hoffnung auf eine Welt jenseits des Grabes suchen ließ, war vielleicht die Ursache, ihn für das Phänomen, in dem er Beweise für eine rein geistige Existenz zu finden hoffte, empfänglicher zu machen. Wäre es lediglich darum gegangen, mich mit den Ansichten eines anderen Physiologen auseinander zu setzen, hätte ich mich, wie es wissenschaftlichen Kontrahenten auf der Suche nach der Wahrheit ziemt, auf einen fairen Schlagabtausch beschränkt und ich müsste mich nicht für meine ehrliche Überzeugung und Argumentation entschuldigen; aber als er mich - als viel jüngeren Mann, der das Phänomen, das er verleugne, überhaupt nicht verstehe - mit gutmütiger Herablassung zu einer seiner Séancen einlud, um seine Heilungen zu bestätigen, wurde meine Eigenliebe verletzt und es schien mir notwendig zu erklären, dass die Veranstaltung eine zu große Gewalttat gegenüber dem gesunden Menschenverstand darstelle, um überhaupt eine Untersuchung zu rechtfertigen. Aus diesem Grund schrieb ich ein Pamphlet zu dem Thema, in dem ich alle Waffen einsetzte, welche die Ironie von der Verachtung borgen kann. Dr. Lloyd antwortete; und da er kein geübter Schreiber war, schadete ihm seine Erwiderung vielleicht mehr als mein Angriff. In der Zwischenzeit hatte ich Erkundigungen über den moralischen Charakter seiner bevorzugten Hellseherinnen eingezogen. Ich glaubte genug in Erfahrung gebracht zu haben, um sie als abgefeimte Betrügerinnen, ihn selbst als ihr übertölpeltes Opfer bezeichnen zu dürfen.
Die Low Town trat, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auf meine Seite über. Der Hill schien anfangs geneigt zu sein, sich um seinen gekränkten Arzt scharen und den Streit zu einem Parteienstreit machen zu wollen, in dem er schwerlich den Kürzeren gezogen haben würde, als sich plötzlich dieselbe hochstehende Dame, die Dr. Lloyd die Gunst seiner hohen Stellung verschafft hatte, gegen ihn wandte und ihre Huld in Ungnade wandelte.
„Dr. Lloyd ist eine liebenswerte Natur,“ so die Königin des Hills „irrt aber in Bezug auf dieses Thema völlig. Überdrehte Dichter mögen einer exaltierten Eigenschaft ihren höheren Wert verdanken, aber bei einem Mediziner wird die Angelegenheit gefährlich. Zudem hat er dem Festhalten an allem Althergebrachten die Gunst des Hills zu verdanken; da er überspannte revolutionäre Theorien einführen will, verstößt er gegen die Prinzipien des Hill und übt Verrat an den Grundsätzen, die seine sozialen Fundamente ausmachen. Dr. Fenwick ist als Streiter für diese Prinzipien eingetreten und der Hill ist verpflichtet, ihn dabei zu unterstützen. Damit ist die Angelegenheit geregelt.“
Und sie war geregelt.
Von dem Augenblick an, in dem Mrs. Colonel Poyntz ihren Tagesbefehl erlassen hatte, war Dr. Lloyd vernichtet. Seine Praxis war ebenso zu Grunde gerichtet wie sein Ruf. Die Kränkung und der Ärger bewirkten einen Schlaganfall, der meinen Gegner ausschaltete und unserem Streit ein Ende bereitete. Ein obskurer Dr. Jones, der Dr. Lloyds Schüler und Protégé gewesen war, bot sich selbst als Kandidat für die Zungen und Pulse des Hills an. Der Hill gab ihm jedoch wenig Anlass zur Ermutigung. Er suspendierte aufs Neue sein Wahlrecht und rief mich einfach - ohne eine erneute Bewerbung von meiner Seite zu verlangen - so oft seine Gesundheit eines anderen Rates außer dem des von Haus zu Haus eilenden Apothekers bedurfte. Erneut wurde ich zum Dinner und noch öfter zum Tee eingeladen. Und abermals gab mir Miss Brabazon mit einem Seitenblick zu erkennen, dass es nicht ihre Schuld sei, wenn ich noch immer unverheiratet sei.
Ich hatte die Auseinandersetzung fast schon vergessen, der ich einen derartig auffälligen Triumph verdankte, als ich in einer Winternacht aus dem Schlaf geweckt wurde. Dr. Lloyd war einige Stunden vorher von einem zweiten Schlaganfall betroffen worden und hatte, als er wieder zu sich kam, das ungestüme Verlangen ausgedrückt, den Rivalen, durch den er so schweren Schaden erlitten hatte, zu konsultieren.
Eine Februarnacht, scharf und bitter kalt; am Boden eisengrauer Frost, am Himmel ein melancholischer, gespenstischer Mond. Ich musste Abbey Hill über eine finstere, steile zwischen hohen Mauern hindurch führende Gasse erklimmen. Ich betrat durch ein stattliches Tor, welches weit offen stand, den Garten, der das alte Abbots´ House umgab. Am Ende einer kurzen Zufahrt trat das dunkle und düster wirkende Gebäude aus laublosen Baumskeletten hervor; das Mondlicht ruhte hell und kalt auf den vorspringenden Giebeln und hohen Schornsteinen. Eine alte Bedienstete empfing mich an der Haustüre und führte mich, ohne ein Wort zu sprechen, durch eine lange niedrige Halle und eine trübselige Eichentreppe hinauf zu einem großen Treppenabsatz, auf dem sie einen Moment lang lauschend stehen blieb. Halle, Treppenhaus und Absatz waren angefüllt mit toten Exemplaren wilder Tiere, deren Sammlung der ganze Stolz des Naturforschers gewesen war. Nahe an dem Ort, an dem ich stand, gähnte der geöffnete Rachen einer Anaconda - der untere Teil ihres Körpers wurde, da er auf dem darunter liegenden Stockwerk ruhte, durch die Windungen der massiven Treppe verborgen. An den von einer matten Täfelung bedeckten Wänden, standen Glaskästen mit grotesken unheimlichen Mumien, welche durch das durch die Fenster scheinende Mondlicht und die Kerze in der Hand der alten Frau nur unzureichend beleuchtet wurden. Diese wandte sich mir jetzt zu, winkte mir, ihr zu folgen und führte mich durch eine finstere Passage, von deren Seiten aus mich Reihen riesiger Vögel – Ibis, Geier und der riesige Condor – mit von falschem Lebenslicht erhellten, hungrigen Augen anglotzten.
Ich betrat das Krankenzimmer und bereits mein erster Blick sagte mir, dass hier meine Kunst machtlos geworden war.
Die Kinder des schwerkranken Witwers standen rings um das Bett versammelt, das Älteste offenbar etwa vierzehn, das Jüngste vier Jahre alt; ein kleines Mädchen – das einzige weibliche Kind – hing am Hals ihres Vater, drückte sein Gesicht an seine Brust und sein Schluchzen war das einzige laute Geräusch, das im Raum hörbar war .
Als ich über die Schwelle trat, hob Dr. Lloyd den Kopf, den er über das weinende Kind gebeugt hatte und empfing mich mit einem Blick seltsamer Fröhlichkeit, den ich mir nicht erklären konnte. Als ich langsam und leise an seine Seite trat, drückte er seine Lippen auf die langen blonden Flechten, die wirr auf seine Brust niederfielen und bedeutete der Krankenschwester, die neben dem Kopfende des Bettes stand, das Kind fort zu nehmen. Dann bat er die Schwester und die Kinder mit einer Stimme, die klarer war, als ich sie von einem Mann erwartet hätte, dessen Stirn das unverkennbare Siegel des Todes trug, den Raum zu verlassen. Seiner Bitte wurde traurig Folge geleistet; nur das kleine Mädchen, in die Arme der Krankenpflegerin gebettet, fuhr fort zu schluchzen, als wolle ihm das Herz brechen.
Ich war auf keine derart ergreifende Szene vorbereitet und tief bewegt. Meine Augen folgten voller Wehmut den Kindern, die so bald Waisen werden sollten, während eines nach dem anderen in den kalten dunklen Gang, angefüllt mit den blutlosen Vertretern einer stummen rohen Natur - in grässlicher Weise vor dem Sterbezimmer eines Menschen aufgebaut - hinaustrat. Als die letzte Kindergestalt verschwunden war und die Tür sich mit einem scharfen Geräusch geschlossen hatte, wanderten meine Blicke noch unstet im Zimmer umher, bevor ich es über mich brachte, sie der zusammengebrochenen Gestalt zuzuwenden, neben der ich jetzt in der vollen Größe und Kraft stand, die den Stolz meines Geistes genährt hatte. In dem Moment, den meine wehmütige Umschau in Anspruch genommen hatte, brannte sich der Anblick dieses Ortes bis ans Ende meines Lebens unveränderlich in meine Erinnerung ein. Durch das hohe, tief herab reichende Fenster, das zur Hälfte von einem dünnen verblichenen Vorhang verhüllt wurde, strömte das Mondlicht herein, bedeckte den Boden mit dem weißen Schimmer eines Leichentuchs und verlor sich in der Dunkelheit unter dem Totenbett. Die Decke war niedrig, ein Eindruck, der sich durch die gekreuzten Stützbalken, die ich mit meiner erhobenen Hand erreichen konnte, noch verstärkte. Die hohe tropfende Kerze und das Flackern des Feuers, das sich durch das aufgehäufte Brennmaterial fraß, warfen ihre Reflexion einer übelriechenden zitternden Dunkelheit, ähnlich einer bösartigen Wolke, unmittelbar an die Decke über meinem Kopf.
Plötzlich ergriff der Sterbende mit seiner linken Hand (die rechte war bereits gelähmt) meinen Arm und zog mich näher und näher zu sich heran, bis seine Lippen beinahe mein Ohr berührten. Mit einer manchmal festen, manchmal durch Keuchen und Zischen zerrissenen Stimme sagte er:
„Ich habe Sie rufen lassen, damit Sie Ihr eigenes Werk bewundern können. Sie haben mein Leben in einem Augenblick zerstört, als es für meine Kinder am wichtigsten und für den Dienst an der Menschheit am nützlichsten war. Hätte ich noch einige Jahre länger gelebt, wären sie alt genug gewesen, um nicht den Versuchungen des Mangels ausgesetzt und nicht auf die Barmherzigkeit von Fremden angewiesen zu sein. Ihnen haben sie es zu verdanken, dass sie mittellose Waisen sein werden. Von Krankheiten heimgesuchte Mitmenschen, denen Ihr Arzneibuch nicht helfen konnte, kamen zu mir, um mich um Hilfe zu bitten und fanden sie. „Einbildung,“ sagten Sie. Aber was machte das schon aus, wenn ich die Einbildung in Richtung einer Heilung leitete? Nun haben Sie die Unglücklichen durch Ihren Spott ihrer letzten Chance beraubt. Sie werden leiden und zu Grunde gehen. Haben Sie geglaubt, ich sei im Irrtum? Sie wussten, dass mein Streben der Suche nach der Wahrheit galt. Sie haben gegen ihren Amtsbruder tödliche Arznei und eine vergiftete Sonde gebraucht. Sehen Sie mich an! Sind Sie zufrieden mit Ihrem Werk?“
Ich versuchte, meinen Arm dem Griff des sterbenden Mannes zu entwinden. Das ging jedoch nicht ohne Gewalt, die anzuwenden unmenschlich gewesen wäre. Seine Lippen näherten sich noch mehr meinem Ohr.
„Eitler Heuchler, rühmen Sie sich nicht damit, dass Ihr schriftstellerisches Talent der Wissenschaft gedient habe. Die Wissenschaft ist all denen gegenüber nachsichtig, die das Experiment als Prüfung einer Mutmaßung anbieten. Sie sind aus dem Stoff, aus dem Inquisitoren gemacht werden. Sie mutmaßen eine Entweihung der Wahrheit, wenn Ihre Dogmen in Zweifel gezogen werden. In Ihrer oberflächlichen Anmaßung haben Sie die Grenzen der Natur gezogen und sobald Ihre Vision verblasst, sagen Sie „Hier muss die Natur enden“; in der Bigotterie, die der Anmaßung das Verbrechen hinzufügt, würden Sie einen Entdecker steinigen, der Ihren Karten neue Gebiete hinzufügt und Ihre eigenmächtigen Grenzen erschüttert. Wahrlich die Vergeltung wird Sie ereilen! In den Räumen, die Ihre Wahrnehmung zu erforschen verschmäht hat, werden Sie verloren und verwirrt umherstreunen. Hah! Ich sehe Sie schon! Die flüsternden Phantome umringen Sie bereits!“
Die Stimme des Mannes verstummte abrupt; sein Blick erstarrte in glasigen Augen; seine Hand lockerte ihren Griff und er fiel auf sein Kissen zurück. Ich schlich mich aus dem Zimmer und traf auf die Krankenschwester und die alte Dienerin. Glücklicherweise waren die Kinder nicht anwesend. Aber aus einem nicht weit entfernten Zimmer hörte ich das Schluchzen des Mädchens.
Ich flüsterte der Schwester hastig zu: „Es ist alles vorüber!“, glitt unter dem Rachen der ungeheuren Anaconda vorbei und gelangte durch die dunkle Gasse zwischen den toten Wänden und die von geisterhaftem Mondlicht erhellten gespenstischen Straßen zurück in meine einsame Wohnung.
Kapitel III
Es dauerte einige Zeit, bis ich den Eindruck abschütteln konnte, den die Worte und der Blick des sterbenden Mannes auf mich gemacht hatten.
Nicht, dass mich mein Gewissen ernsthaft beunruhigt hätte. Was hatte ich schon getan? Eine Sache an den Pranger gestellt, die ich, wie die meisten vernünftigen Menschen – Ärzte oder nicht –, für eine jener Illusionen hielt, mit der die Quacksalberei Vorteile aus dem Wunder der Unwissenheit zieht. War es mir anzulasten, dass ich mich weigerte, die an Zaubermärchen erinnernden, angeblichen Kräfte mit demselben Respekt zu behandeln, wie die legitimen Errungenschaften der Wissenschaft? Hatte ich eine Ausbildung an wissenschaftlichen Akademien genossen, um mich zu einer Untersuchung herabzulassen, ob eine schlummernde Sibylle ein ihr auf den Rücken gelegtes Buch lesen oder mir in L...... sagen könnte, was im selben Augenblick ein an den Antipoden weilender Freund tue?
Und obwohl Dr. Lloyd ein ehrenwerter und ehrlicher Mann gewesen sein mochte, der aufrichtig an den Unfug geglaubt hatte, für den er von anderen die gleiche Leichtgläubigkeit forderte, kommt es nicht jeden Tag vor, dass ehrliche Menschen sich dadurch zum Gegenstand des Spotts machen, dass sie gegen den gesunden Menschenverstand verstoßen? Konnte ich voraussehen, dass eine Satire, die so sehr herausgefordert worden war, eine derartig tödliche Wunde schlagen könnte? War ich ein unmenschlicher Barbar, weil der zerstörte Gegner krankhaft empfindlich war? Deshalb machte mir mein Gewissen keine Vorwürfe und die Öffentlichkeit erwies sich nicht strenger als mein Gewissen. Die Öffentlichkeit hatte sich während der Auseinandersetzung auf meine Seite gestellt; die Öffentlichkeit wusste nichts von den Anschuldigungen, die mein Gegner auf seinem Sterbebett gegen mich erhob; die Öffentlichkeit wusste lediglich, dass ich ihm in seinen letzten Augenblicken Beistand geleistet hatte, sie sah mich der Bahre folgen, die ihn zu Grabe trug, bewunderte die Achtung, die ich ihm erwies, indem ich ihm einen einfachen Grabstein mit einer Inschrift, die seiner unbestreitbaren Menschenfreundlichkeit und Integrität Gerechtigkeit Rechnung trug, aufstellen ließ. Vor allem rühmte man den Eifer, mit dem ich eine Sammlung für seine Waisen initiierte und die Großzügigkeit, mit der ich als Erster eine Summe einzahlte, die im Vergleich zu den mir zu Verfügung stehenden Mitteln als groß bezeichnet werden konnte.
Ich beschränkte allerdings meine Unterstützung nicht auf diese Summe. Das Schluchzen des armen Mädchens klang immer noch in meinem Herzen nach. Da ihr Schmerz größer gewesen war als der ihrer Brüder, könnten ihr größere Prüfungen bevorstehen, wenn einmal die Zeit kam, ihren eigenen Weg durch die Welt zu beschreiten. Aus diesem Grunde legte ich, unter Vorsichtsmaßnahmen, die verhindern sollten, dass das Geschenk jemals bis zu meiner Hand zurück verfolgt werden konnte, eine Summe für sie an, die solange anwachsen konnte, bis sie ins heiratsfähige Alter käme und ihr als kleine Mitgift dienen konnte; sollte sie ledig bleiben, aber für ein Einkommen sorgte, das sie über die Versuchungen der Armut erhob und sie vor der Bitterkeit einer sklavischen Abhängigkeit bewahrte.
Dass Dr. Lloyd in Armut gestorben war, überraschte anfangs allgemein, da er in den letzten Jahren beachtliche Einkünfte erzielt hatte und stets ein zurückgezogenes Leben geführt hatte. Aber unmittelbar vor dem Beginn unserer Kontroverse hatte er sich dazu bewegen lassen, den Bruder seiner verstorbenen Frau, der Juniorpartner einer Londoner Bank war, durch ein Darlehen in Höhe seiner gesamten Ersparnisse zu unterstützen. Der Mann erwies sich als unredlich; er veruntreute nicht nur diese, sondern auch andere Summen, die ihm anvertraut worden waren und floh aus dem Land. Das selbe Gefühl gegen das Andenken seiner verstorbenen Gattin, das Dr. Lloyd um sein Vermögen brachte, bewog ihn auch, über die Ursache seines Verlustes Schweigen zu bewahren. Es war seinen Nachlassverwaltern vorbehalten den Verrat des Schwagers aufzudecken, den der arme Mann großzügig vor weiterer Schande bewahren wollte.
Der Bürgermeister von L...., ein reicher und von Gemeinsinn beseelter Kaufmann, kaufte das Museum, das Dr. Lloyd´s Passion für die Naturgeschichte zusammengetragen hatte, und die Summe, die aus dem Erlös des Verkaufs resultierte, reichte nicht nur aus, alle Verbindlichkeiten des Verstorbenen zu tilgen, sondern auch den Waisen eine Ausbildung zu sichern, die es zumindest den Jungen ermöglichen würde, sich einen guten Startplatz in dem Spiel zu sichern, in welchem Geschicklichkeit eine höhere Bedeutung hat als der Zufall und Fortuna sich als so wenig blind erweist, dass wir bei jeder Umdrehung des Rades beobachten können, wie Reichtum und Ehre den schlaffen Fingern der Unwissenheit und Trägheit entrissen werden, um von der entschlossenen Faust der Arbeit und des Wissens ergriffen zu werden.
Inzwischen übernahm ein auf dem Lande lebender Verwandter die Vormundschaft über die Waisen; sie verschwanden vom Schauplatz, und die Fluten des Lebens in einer kommerziell ausgerichteten Gemeinschaft brandeten bald wieder über den Platz, welchen der Verstorbene in den Gedanken seiner viel beschäftigen Mitbürger eingenommen hatte.
Eine Person in L...., und nur sie allein, schien den Hass zu teilen und geerbt zu haben, den der arme Arzt auf seinem Sterbebett über mich ausgegossen hatte. Es handelte sich um einen Gentleman namens Vigors, einen entfernten Verwandten des Verstorbenen, welcher sich während der Auseinandersetzung mit mir als einer der herausragenden Parteigänger Dr. Lloyd´s erwiesen hatte – ein Mann von geringer wissenschaftlicher Bildung aber respektablen Fähigkeiten. Er besaß den Einfluss, den die Welt tüchtigen Männern einräumt, wenn seine Fähigkeiten mit einem ernsten Charakter und einer strengen Moral verbunden sind. Seine Lieblingsbeschäftigung war es, über andere zu Gericht zu sitzen und er war einer der eifrigsten und strengsten Friedensrichter, die L... je gesehen hatte.
Kapitel IV
Ich hatte nun das Alter erreicht, in dem ein ambitionierter Mann befriedigt auf seine Erfolge in der Welt zurückblickend das heftige Verlangen einer unbefriedigten Zuneigung und die Leere eines einsamen Herzens zu spüren beginnt. Ich beschloss zu heiraten und sah mich nach einer Frau um. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich der Leidenschaft der Liebe keinen Platz in meinem Leben gegönnt. Tatsächlich hatte ich sogar in frühester Jugend mit einer Art stolzer Verachtung auf die Leidenschaft wie auf eine Krankheit herabgesehen, die aus weibischem Müßiggang entsprang und von einer überreizten Einbildungskraft genährt wurde.
Ich hoffte in meiner zukünftigen Frau eine vernünftige Gefährtin, einen liebevollen und zuverlässigen Freund zu finden. Keine Heiratspläne konnten weniger romantisch und nüchterner sein, als meine Überlegungen. Genau so wenig stellte ich Ansprüche überheblicher oder gewinnsüchtiger Natur. Ich achtete nicht auf Vermögen oder Verbindungen. Mein ganzer Ehrgeiz galt meinem Beruf, dem weder eine adlige Verwandtschaft noch eine üppige Mitgift dienen konnten. Ich achtete nicht auf außergewöhnliche Schönheit und verlangte von einer Frau auch nicht das Bildungsniveau der Vorsteherin einer höheren Mädchenschule.
Als ich die Entscheidung getroffen hatte, mir eine Gefährtin zu suchen, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es schwer sein würde eine Wahl zu treffen, die meine Vernunft billigen würde. Aber es verging Tag um Tag, Woche um Woche und obwohl es in den Familien, die ich besuchte, viele junge Damen gab, deren Eigenschaften meinen Vorstellungen mehr als entsprachen und die, wie ich mir schmeicheln darf, meine Werbung nicht zurückgewiesen hätten, fand ich doch keine darunter, deren lebenslanger Gesellschaft ich nicht die Einsamkeit, die ich inzwischen so lästig fand, vorgezogen hätte.
Eines Abends kehrte ich von der Visite einer armen Patientin zurück, die ich unentgeltlich behandelte und deren Zustand mich mehr in Anspruch nahm, als irgendein anderer meiner Fälle – denn obwohl man ihren Zustand im Hospital als hoffnungslos eingestuft hatte und sie nach Hause zurückgekehrt war, um im Kreis ihrer Familien zu sterben, war ich mir sicher, dass ich sie retten könne und ihr Zustand schien sich tatsächlich unter meiner Pflege zu verbessern.
An diesem Abend – einem fünfzehnten Mai – fand ich mich plötzlich vor den Toren des Hauses wieder, welches Dr. Lloyd bewohnt hatte. Das Haus war seit seinem Tod unbewohnt; die Miete, die der Eigentümer forderte, wurde als sehr hoch angesehen und seine Lage auf dem geheiligten Berg schreckte aus Scheu oder Stolz die reicheren Kaufleute ab. Das Gartentor stand weit offen, genau wie in der Winternacht, in der ich dem Sterbenden den letzten Besuch abstattete. Die Erinnerung an das Sterbebett kehrte lebhaft zurück und die phantastische Drohung des Sterbenden dröhnte erneut in meinen Ohren. Ein unwiderstehlicher Impuls, den ich mir nicht erklären konnte und auch heute noch nicht erklären kann – das genaue Gegenteil des Drangs, der uns veranlasst den Platz einer schmerzhaften Erinnerung schleunigst zu verlassen – veranlasste mich, durch das geöffnete Tor den vernachlässigten, mit Gras bewachsenen Weg zu betreten und das Haus, das ich bisher nur in der Finsternis einer Winternacht unter einem melancholischen Mond gesehen hatte, im Licht der untergehenden Frühlingssonne zu betrachten.
Als das zum Teil mit Efeu bewachsene Haus mit seinen dunkelroten Backsteinen in Sicht kam, bemerkte ich, dass es nicht länger unbewohnt zu sein schien. Ich sah Gestalten sich hinter den geöffneten Fenstern hin und her bewegen; ein beladener Möbelwagen stand vor der Haustüre und ein Diener in Livré überwachte das Entladen des Inventars. Offensichtlich war gerade eine Familie dabei, hier einzuziehen. Ich fühlte mich durch mein Eindringen ein wenig beschämt und wollte mich gerade rasch wieder entfernen, als ich Vigors in Begleitung einer Dame mittleren Alters in der Nähe des Gartentors bemerkte. Gleichzeitig bemerkte ich einen Pfad, der seitlich durch das Gestrüpp zu einer kleinen Gartentüre aus dem Garten führte. Ich wollte der Dame, die ich für die neue Besitzerin hielt, nicht begegnen, um nicht eine unbeholfene Entschuldigung für das widerrechtliche Betreten ihres Grundstückes anbringen zu müssen und noch weniger wollte ich mich in der eigenartigen und unwürdigen Lage, in der ich mich befand, dem verächtlichen Blick von Mr. Vigors aussetzen. Unwillkürlich schlug ich deshalb den Seitenweg ein, auf dem ich unbemerkt zu entkommen hoffte. Auf halbem Weg zwischen Haus und Gartentüre hörte plötzlich das Gestrüpp auf und ermöglichte den Blick auf einen von den unregelmäßigen Trümmern eines alten Backsteinbaus umgebenen freien Platz, der zum Teil mit Farn, Schlingpflanzen, Unkraut und wilden Blumen überwachsen war. In der Mitte des Kreise befand sich ein Springbrunnen oder vielmehr ein Brunnen, über den sich ein auf kleinen normannischen Säulen ruhendes verwittertes und baufälliges gotisches Vordach spannte. Eine große Trauerweide ließ ihre Äste über das unverkennbare Relikt der alten Abtei hängen. Ein Hauch von Altertum, Romantik und Legende lag über dem Platz, der so plötzlich zwischen dem zarten Grün des jungen Gewächses auftauchte. Aber es war nicht das verfallene Gemäuer oder das gotische Brunnendach, das meinen Lauf hemmte und mein Auge bezauberte.
Es war eine einsame Gestalt, die inmitten der traurigen Trümmer saß.
Die Gestalt war so zart, das Antlitz so jung, dass ich beim ersten Anblick vor mich hin murmelte: „Was für ein hübsches Kind.“ Aber als mein Blick länger auf ihr ruhte, erkannte ich in den nachdenklich hochgezogenen Brauen, dem süßen, ernsten Ausdruck des Gesichts und den leichten Rundungen des Umrisses der zarten Gestalt die unbeschreibliche Würde einer jungen Frau.
Auf ihrem Schoss lag ein Buch und zu ihren Füßen ein Körbchen, das halb mit Veilchen und Blüten gefüllt war, die offensichtlich von den die Trümmer überwuchernden Pflanzen abgepflückt worden waren. Hinter ihr fielen wie ein grüner Wasserfall in einem Bogen die Zweige der Weide in einer Woge aus zartem Grün, am Gipfel hell von den freundlichen Strahlen der untergehenden Sonne beschienen, in immer dunkleren Schattierungen bis auf den Rasen herab.
Sie beachtete mich nicht, schien mich nicht einmal wahrzunehmen. Ihre Augen schienen derart an einem Punkt des Horizonts, an der Scheitelinie zwischen den Baumwipfeln, der Ruine und dem endlosen Blau des Himmels festgebannt zu haften – so konzentriert, dass ich mich unwillkürlich umwandte, um der Richtung ihres Blicks folgen zu können. Es schien, als warte sie darauf, dass irgend ein vertrautes Zeichen aus den Tiefen des Alls auftauchte oder als wolle sie vor irgend einem anderen Lebewesen das erste Blinken des Abendsterns wahrnehmen.
Die Vögel hüpften aus den Zweigen der umgebenden Bäume und Sträucher so furchtlos neben ihr herum, dass einer von ihnen sogar an den Blumen in dem Körbchen zu ihren Füßen herum pickte. Es gibt ein berühmtes deutsches Gedicht mit dem Titel „Das Mädchen aus der Fremde“, das ich in meiner Jugend gelesen hatte und je nach Ansicht des Kommentators als Allegorie auf den Frühling oder die Poesie gedeutet wurde. Es schien mir, als ob das Gedicht für sie geschrieben worden wäre. In der Tat hätte ein Dichter oder Maler in ihr eine Verkörperung beider Prinzipien, jedes eine Bereicherung für die Erde erkennen können: beide bezaubern die Sinne unserer Wahrnehmung und doch rufen beide Gedanken in uns hervor, die zwar nicht unbedingt traurig zu nennen, aber doch der Trauer verwandt sind.
Ich hörte hinter mir das Geräusch von Schritten und eine Stimme, die ich als die von Mr. Vigors erkannte. Der Zauber, der mich gebannt hielt, zerbrach und ich eilte verwirrt auf die kleine Gartentüre zu, welche mich über eine kleine abwärts führende Treppe auf die Hauptstraße hinaus führte. Und wieder lag der Alltag vor mir. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite Häuser, Läden, Kirchtürme; einige Schritte weiter das geschäftige Treiben der Straßen! Wie unendlich weit und doch so kurz liegt die normale Welt vom Feenland der Romantik entfernt, das sich vor uns aus der Härte der materiellen Welt öffnet, wenn sich die Liebe an unsere Seite stiehlt, um wieder in sie zurückzusinken, sobald die Liebe lächelnd oder seufzend sich von uns verabschiedet!
Kapitel V
Noch am Abend zuvor hatte ich auf Mr. Vigors mit erhabener Gleichgültigkeit herabgesehen! Welche Wichtigkeit erlangte er nun in meinen Augen! Die Dame, mit der ich ihn gesehen hatte, war ohne Zweifel die neue Bewohnerin des Hauses, welches offensichtlich auch dem jungen Mädchen, von dem mein Herz so seltsam berührt worden war, als Heim diente. Vermutlich waren die beiden Damen Mutter und Tochter. Mr. Vigors, welcher der Freund einer, vielleicht sogar mit Beiden verwandt war, konnte sie von vornherein gegen mich einnehmen – konnte vielleicht.... – ich sprang auf und kappte den Faden der Vermutungen, denn genau vor meinen Augen, auf dem Tisch, neben den ich mich nach dem Betreten des Raumes gesetzt hatte, lag eine Einladungskarte:
Mrs. Poyntz
zu Hause,
Mittwoch, den 15. Mai
Früh morgens.
Mrs. Poyntz, Mrs. Colonel Poyntz, die Königin des Hills? Dort, in ihrem Haus, konnte ich bestimmt alles Wissenswerte über die Neuankömmlinge erfahren, die sich kaum ohne ihr Einverständnis auf ihrer Domäne hätten niederlassen können.
Hastig wechselte ich meinen Anzug und erstieg mit klopfendem Herzen den ehrfurchtgebietenden Berg.
Ich benutzte dazu nicht die Seitengasse, die direkt zum Abbots´ House führte (das alte Haus stand einsam inmitten des Grundstücks - ein wenig abseits von der geräumigen Fläche gelegen, auf der sich die Gesellschaft des Hills konzentrierte), sondern die breite Straße, die von zwei Reihen Gaslampen flankiert wurde. Die prächtigeren Läden waren noch nicht geschlossen und die Flut des Geschäftslebens ebbte nur langsam von den immer noch belebten Straßen zurück, hin zu einem freien Platz auf dem die vier Hauptstraßen der Stadt zusammenliefen und der die Grenze zur Low Town bildete. Ein großer dunkler Bogengang, in einem Winkel dieses Vierecks gelegen und im Volksmund Monk´s Gate genannt, bewachte den Eingang zum Abbey Hill. Nachdem man den Bogen passiert hatte, fühlte man sofort, dass man sich in einer Stadt der Vergangenheit befand. Der Bürgersteig war eng und uneben; die Läden klein mit hervorspringenden oberen Stockwerken, welche gelegentlich malerische arabeske Stuckverzierungen trugen. Eine kurze, aber steile und stark gebogene Steigung führt zu der alten Abbey Church, vornehm in der Mitte eines riesigen Vierecks gelegen, um das die düsteren, vornehmen Wohnungen der Areopagiten des Hills lagen. Noch vornehmer und weniger düster – mit erleuchteten Fenstern und Blumen auf dem Balkon – stand links und rechts durch eine Gartenmauer bewehrt das Herrschaftshaus der Mrs. Colonel Poyntz.
Als ich den Salon betrat, hört ich die Stimme meiner Wirtin – es war eine klare, entschlossene, metallische, glockenartige Stimme die Worte sprechen: „...wer das Abbot´s House bezogen hat? Das werde ich Ihnen sagen.“
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: