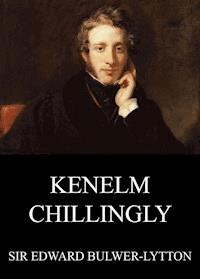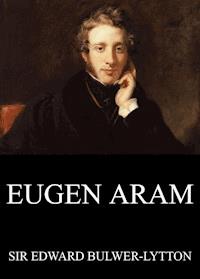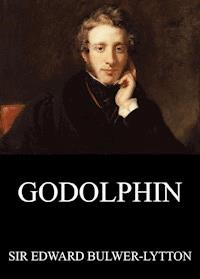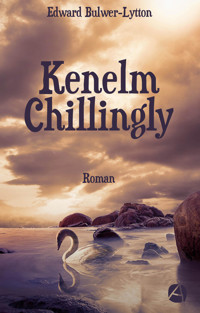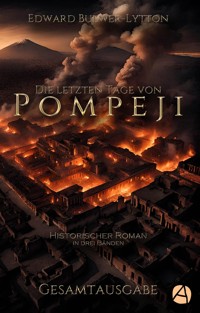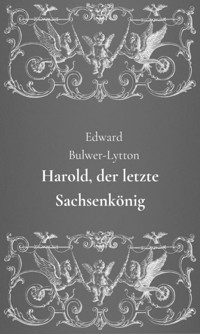
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ich widme Dir ein Werk, theuerster Freund, das fast ganz unter Deinem gastlichen Dache verfaßt wurde und wozu Deine an den für mich nöthigen Autoritäten so reiche Bibliothek die bedeutendsten Materialien lieferte. Der Gedanke, auf ein so wichtiges nationales Ereigniß, wie der normännische Einfall, einen historischen Roman zu gründen, hatte schon lange in mir geschlummert, und die Chroniken jener Zeit waren mir längst vertraut gewesen. Es liegt jedoch von jeher in meiner Gewohnheit, mich vielleicht Jahre lang mit Plan und Gegenstand eines Werkes herumzutragen, ehe ich meine Feder anrühre, indem ich mich, wie der alte Burton sagt, »otiosaque diligentia ut vitarem torporem feriandi«, mit dieser spielenden Arbeit beschäftige.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 989
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harold,
der letzte Sachsenkönig.
Historischer Roman
von
Sir Edward Bulwer Lytton, Baronet.
Aus dem Englischen
von
Eduard Mauch.
›Edith the Fair‹
Inhaltsverzeichnis
Zueignung.
Erstes Buch.
Der normännische Gast, der sächsische König und die dänische Prophetin.
Zweites Buch.
Lanfranc der Gelehrte.
Drittes Buch.
Das Haus Godwins.
Viertes Buch.
Der Heidenaltar und die sächsische Kirche.
Fünftes Buch.
Tod und Liebe.
Sechstes Buch.
Ehrgeiz.
Siebentes Buch.
Der wälsche König.
Achtes Buch.
Schicksal.
Neuntes Buch.
Die Todtenbeine.
Zehntes Buch.
Das Opfer am Altare.
Eilftes Buch.
Der normännische Politiker und der norwegische Seekönig
Zwölftes Buch.
Das Feld von Hastings.
Anmerkungen.
A.
B.
Jagdgesetze vor der Eroberung.
C.
Lanfranc, der erste anglo-normännische Erzbischof von Canterbury.
D.
Edwards des Bekenners Erwiderung gegen Magnus von Dänemark, als dieser seine Krone beanspruchte.
E.
Herolde.
F.
Die Fylgia oder der Schutzgeist.
G.
Earl Godwin’s Abstammung.
H.
Der Mangel an Vesten in England.
I.
Die Ruinen von Penmaen-mawr.
K.
Der Götze Bel.
L.
Salben, wie die Hexen sie gebrauchten.
M.
Hilda’s Beschwörungen.
N.
Harold’s Thronbesteigung.
O.
Physische Eigenthümlichkeiten der Skandinavier.
P.
Harold’s Begräbniß.
Fußnoten.
Zueignung
dem
höchst ehrenwerthen
E. T. d’Eyncourt, P. M.
Ich widme Dir ein Werk, theuerster Freund, das fast ganz unter Deinem gastlichen Dache verfaßt wurde und wozu Deine an den für mich nöthigen Autoritäten so reiche Bibliothek die bedeutendsten Materialien lieferte.
Der Gedanke, auf ein so wichtiges nationales Ereigniß, wie der normännische Einfall, einen historischen Roman zu gründen, hatte schon lange in mir geschlummert, und die Chroniken jener Zeit waren mir längst vertraut gewesen. Es liegt jedoch von jeher in meiner Gewohnheit, mich vielleicht Jahre lang mit Plan und Gegenstand eines Werkes herumzutragen, ehe ich meine Feder anrühre, indem ich mich, wie der alte Burton sagt, »otiosaque diligentia ut vitarem torporem feriandi«, mit dieser spielenden Arbeit beschäftige.
Der Hauptgrund, der mich längere Zeit von der Sache abhielt, lag darin, daß ich wußte wie die gewöhnlichen Laser mit den Charakteren, Ereignissen, und so zu sagen mit den eigentlichen Physiognomien einer Periode, welche ante Agamemnonem, d. h. vor das glänzende Zeitalter des herangereiften Ritterwesens fällt, das seine eigene Thaten, wie den glorreichen Wahnsinn der Kreuzzüge im Gedichte wie im Roman verewigte, meist gar nicht vertraut sind. Die normännische Eroberung war unser trojanischer Krieg — eine Epoche, über welche hinaus unsere Gelehrsamkeit nur selten die Fantasie sich versteigen läßt.
Wollte ich mich auf so ganz neuen Boden wagen, so blieb mir nur die Wahl zwischen zwei Dingen: entweder den Schein der Pedanterie auf mich zu laden, indem ich dem Leser Nachforschungen vor Augen führe, welche ihn zugleich mit dem Verfasser gerades Weges in die eigentlichen Memoiren jener Zeit einweihen, oder alle Ansprüche auf Genauigkeit gänzlich bei Seite zu werfen und mich damit zu begnügen, statt meine eigene Ansicht über die Verwendung der natürlichen Romantik aus der wirklichen Geschichte zu verfolgen, diese letztere in einen offenkundigen Roman zu verwandeln. Endlich entschloß ich mich, nicht ohne einige Ermuthigung von Deiner Seite, (wofür Dir Dein gebührender Antheil am Tadel werden möge!) den Versuch zu wagen und jene Behandlungsweise anzunehmen, welche zwar von Seite des Lesers größere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, dafür aber auch für seine Beurtheilung um so vollständiger erschien.
Das Zeitalter selbst zeigt sich bei gehöriger Würdigung überreich an jenen Elementen, welche das Interesse des Lesers erwecken und seine Einbildungskraft ansprechen sollten. Nicht mit Unrecht hat Sismondi gesagt, ›das eilfte Jahrhundert hat ein Recht, als ein großes Zeitalter betrachtet zu werden. Es war eine Periode schöpferischen Lebens und alles, was das Mittelalter an Edelsinn, Kraft und Heroismus erzeugte, hat in dieser Epoche seinen Anfang genommen‹1. Für uns Engländer insbesondere besteht neben dem engeren Interesse an jener Lust zu Abenteuern, Unternehmungen und Verbesserungen, wofür die normännische Ritterschaft das edelste Vorbild abgab, noch jene tiefere und rührendere Theilnahme an dem letzten Aufglimmen der alten sächsischen Monarchie, das sich in den traurigen Blättern unserer Chronisten vor unsern Augen eröffnet.
Ich habe in diesem Werke weniger eine Porträtirung bloser Sitten, welche den Geschichtsfreunden ohnehin durch die neueren Nachforschungen vertraut geworden, als eine Schilderung jener großen Charaktere versucht, die in der langen unsichern Erinnerung der Jahrhunderte so sorglos übergangen wurden; es war mir darum zu thun, die Beweggründe und die Politik der Theilnehmer an einem der merkwürdigsten europäischen Ereignisse deutlicher hervorzuheben und eine, wenn auch allgemeinere, so doch genauere Kenntniß jener Männer anzubahnen, welche in jenem Schattenreiche lebten und wirkten, das hinter der normännischen Eroberung begraben liegt.
»Spes hominum caecas, morbos, votumque, labores,
El passim toto volitantes aethere curas.«
(Hoffnungen, blinde — des Menschen, Krankheit, Gebete und Mühen
Und die beflügelten Sorgen, den ganzen Aether durchdringend.)
Auf diese Weise bin ich den leitenden historischen Ereignissen in der großen Tragödie unseres Königs Harold treu geblieben und habe — soweit die widersprechenden Zeugnisse es erlaubten — die Schilderung der Charaktere, wie die richtige chronologische Reihenfolge, ohne welche keine historische Philosophie, d. h. kein greifbares Band zwischen Ursache und Wirkung bestehen kann — so genau wie nur immer möglich eingehalten. Der erdichtete Theil meiner Erzählung beschränkt sich deßhalb, wie im »Rienzi« und »dem letzten der Barone« hauptsächlich auf das Privatleben mit all’ seinen Unfällen und Leidenschaften, von dem nur wenig bekannt ist, woran man also auch wenig fälschen kann, sofern man nur der menschlichen Natur überhaupt getreu bleibt. Die Liebesgeschichte zwischen Harold und Editha ist anders gegeben als die wohlbekannte Legende sie erzählt, welch’ letztere eine minder reine Verbindung voraussetzen läßt. Die ganze Legende über die Editha Pulchra, deren Name ohne weitere Bezeichnung als eben jenes Adjektiv, das ihre Schönheit andeutet, in dem großen Lehenbuche2 vorkommt, gründet sich jedoch, was ihre populäre Annahme betrifft, nur auf sehr schwache Autoritäten, und an einem Werke, das nicht allein zur Lektüre überhaupt bestimmt ist, sondern auch, wie ich hoffe, aus mancherlei Gründen der Jugend ohne Scheu anvertraut werden dürfte, werden die Gründe für meine Aenderungen, welche mit dem Geiste der Zeit im strengsten Einklange stehen und eine der hervortretendsten Eigenthümlichkeiten derselben beleuchten sollen — hinlänglich gerechtfertigt erscheinen.
Der öftere Gebrauch, den ich von den abergläubischen Ansichten jener Periode machte, bedarf vielleicht einer ausführlicheren Entschuldigung. Jener Aberglaube ist übrigens mit dem Zeitalter selbst dermaßen verwoben — er begegnet uns so vielfältig, sey es nun bei unsern eigenen Chronisten, oder in den Memoiren der verwandten Skandinavier — er ist mit den Gesetzen und dem ganzen Leben unserer sächsischen Vorväter so verwachsen, daß man dem Leser nur dann einen lebendigen Eindruck von dem Volke, welches unter ihm lebte, beibringen kann, wenn man ihn fast mit derselben Leichtgläubigkeit, mit welcher er ursprünglich aufgefaßt wurde, in der Erzählung anwendet. Nicht ohne Wahrheit hat ein italienischer Schriftsteller bemerkt: »wer ein unphilosophisches Zeitalter philosophisch beleuchten wollte, sollte sich erinnern, daß man, um mit Kindern vertraut zu werden, zuweilen in die Denk- und Gefühlsweise eines Kindes eingehen muß.«
Gleichwohl habe ich diese gespenstigen Helfershelfer nur sehr selten zu den gewöhnlichen poetischen Zwecken des Schreckens verwendet, und wenn sie gleichwohl jene Wirkung hervorbringen, so wird sie, wie ich fürchte, eher dazu dienen, die eigentlichen historischen Quellen unserer Theilnahme zu verstärken, als dem Werke selbst ein leitendes und populäres Charaktermerkmal mitzutheilen. Meine Absicht bei Einführung der dänischen Vala hat ebenso viel mit der Vernunft, wie mit der Fantasie zu schaffen, indem ich zeigte, welche weit verbreitete düstere Ueberbleibsel der alten Heidenwelt sich noch immer auf dem sächsischen Boden behaupteten, und gegen ihren schließlichen Stellvertreter — den mönchischen Aberglauben — ankämpften und kontrastirten. Hilda existirt nicht in der Geschichte; aber ohne die romantische Personifikation dessen, was Hilda darstellt, ließe sich die Geschichte jener Zeit nur unvollkommen verständlich machen.
In Harolds Charakter habe ich zwar die oberflächlichen Beweise seiner unterscheidenden noch jetzt unter uns erhaltenen Attribute sorgfältig erwogen und geprüft, und trotz einer nicht unnatürlichen Partheilichkeit seine Mängel — was nämlich ich dafür halte — und nicht minder den großen Irrthum seines Lebens nicht verhehlt: gleichwohl gieng mein Hauptbestreben dahin, das Ideal jenes ächt sächsischen Charakters in leichten Umrissen hervorzuheben, wie dasselbe schon damals mit seinen großen unentwickelten Vorzügen, mit seiner schon in jener frühen Zeit sich entfaltenden geduldigen Ausdauer, mit seiner Freiheits- und Gerechtigkeitsliebe, — dem männlichen Pflichtgefühle mehr als dem ritterlichen Sinne für Ehre und jenem unzerstörbaren Elemente praktischen Strebens und muthvollen Wollens, welches, standhaft in allen Gefahren und jeder Eroberung Trotz bietend, so ungeheuren Einfluß auf das Geschicke der Welt auszuüben bestimmt war — hervortrat.
Gegen den normännischen Herzog glaube ich so mild verfahren zu seyn, als es die Gerechtigkeit nur immer zuläßt, obwohl es ebenso unmöglich ist, seine Feinheit zu läugnen wie sein Genie ihm abzustreiten, und so weit der Zweck meines Werkes gestattete, hoffe ich, die großen Charakterzüge seiner Landsleute, welche weit ritterlicher waren als er selbst, richtig angegeben zu haben. Es war ein Unglück für jenen ausgezeichneten Menschenstamm, daß bei uns in England die anglonormännischen Könige als seine Repräsentanten galten, während doch der wilde intriguirende William, der eitle werthlose Rufus, der kaltblütige erbarmungslose Henry keine würdigen Typen für ihre weit edleren normännischen Vasallen abgeben können, von denen selbst der englische Chronist gesteht, daß sie »freundliche Herren« gewesen seyen, und denen die späteren Freiheiten Englands ihren Königen zum Trotz so Vieles zu verdanken haben.
Allein vorliegendes Werk schließt auf dem Schlachtfelde von Hastings — jenem edlen Kampfe für nationale Unabhängigkeit, bei welchem die Sympathien jedes ächten Landeskindes — auch wenn er sein Geschlecht bis auf die normännischen Sieger zurückführte — auf die Seite des patriotischen Harold gehören.3
Durch die Noten, die ich für das bessere Verständniß dieses Werkes für nöthig hielt, wollte ich den Leser überhaupt blos so weit in die damaligen Zustände einweihen, daß er mit dem Hauptgegenstande des Buches leichter vertraut würde, oder seine Erinnerung an die bezüglichen Einzelnheiten, welche ohnehin nicht ohne nationales Interesse sind, auffrischen könnte. Durch die Anführung von Autoritäten beabsichtige ich keineswegs für eine bloße Fiktion den eigentlichen Charakter einer Geschichte in Anspruch zu nehmen; jene Bezugnahme kommt hauptsächlich da vor, wo ich entweder das, was ich aus einer Chronik entlehnte, scharf von der bloßen Erfindung unterscheiden, oder wenn es mir nöthig schien, in Fällen, wo ich von einem populären, dem Leser vielleicht eher geläufigen Geschichtschreiber abwich, die Quelle, worauf jene Differenz sich gründete, benennen wollte.4
Kurz — mein Hauptzweck war der Art, daß ich genöthigt war, ernstere Dinge, als sonst wohl vorkommen, in meinen Roman einzumischen — ein Verfahren, das man — wie ich schwach zu hoffen wage — schon aus nationeller Sympathie zwischen Autor und Leser mit der Anklage der Langweile verschonen dürfte. Mein Zweck ist erreicht, aber auch nur dann erreicht, wenn der Leser beim Umschlagen der letzten Seite findet, daß er trotz der Zulassung erdichteter Stoffe dennoch eine klarere und genauere Ansicht von einer fernen aber heroischen Zeit, von Charakteren, welche für jeden Engländer ein wahres Familieninteresse haben sollten, gewonnen hat, als die gedrängten Berichte des bloßen Historikers ihm möglicherweise hätten gewähren können.
So, mein theurer d’Eyncourt, habe ich dem Publikum unter Deiner Adresse alle jene Erklärungen gegeben, wozu die Schriftsteller überhaupt (und ich nicht am allerwenigsten) oft nur gar zu bereitwillig sind.
Nachdem diese Aufgabe vorüber, kehren meine Gedanken in natürlichem Gange zu den Bildern zurück, womit ich Deinen Namen gleich Anfangs, als ich ihn auf die Aufschrift dieses Briefes setzte, in Verbindung brachte. Mir ist, als befände ich mich abermals unter Deinem freundlichen Dache, als begrüßte ich wieder meinen sorgsamen Wirth, während er in jenes gothische Zimmer tritt, worin ich meine ungeselligen Studien aufschlagen durfte, um mir die Ankunft majestätischer Folianten auszuposaunen und ganze Bibliotheken rings um mein unwürdiges Werk aufzuhäufen. Ich halte inne in meiner Arbeit und schaue abermals durch die Burgfenster und über jenen feudalen Graben auf die breite Landschaft, welche — wenn ich nicht irre — ihren Namen von dem stolzen Bruder des Eroberers selbst erhielt; oder wenn in jenen Winternächten die grimmigen alten Tapeten in den düstern Winkeln sich regten, höre ich wieder den sächsischen Thegn (Than), wie er sein Horn vor der Thurmpforte schallen läßt und Zutritt in die Hallen verlangt, aus denen ihn der Prälat von Bayeux so ungerechter Weise vertrieb5 — ist es da ein Wunder, daß ich in den Zeiten, welche ich geschildert, mit den Sachsen als Sachse, mit dem Normann als seines Gleichen lebte — daß ich mich nur der ehrwürdigen Sprache, wie sie am Hofe des Bekenners heimisch war, bediente, oder meine Mitgäste (wenn ich sie nämlich meiner Gegenwart würdigte) mit den letzten Neuigkeiten erschreckte, welche Harolds Spione von dem Lager zu St. Valery zurückgebracht hatten? Mit all’ jenen Folianten, welche als Riesen einer vergangenen Welt, zudringlich wie die Normannen, unbezähmbar wie die Sachsen und hochgewachsen wie die schlankesten Dänen (grausame Feinde, ich sehe sie immer noch vor mir!), täglich mehr und mehr, höher und höher — ein Ossa über den Pelion — auf Stuhl und Tisch, auf Heerd und Boden sich aufthürmten, — bei alten ausgegrabenen Gespenstern, welche an den Wänden emporkrochen, bei den rostigen Waffenrüstungen in Deinen Gallerien, den verstümmelten Statuen früherer englischer Könige (den heiligen Eduard mit eingeschlossen) in den Nischen der grauen epheuüberwucherten Mauern — sage bei Deinem Gewissen, o Du mein reumüthiger Wirth! soll ich je wieder zu dem neunzehnten Jahrhundert zurückkehren?
Doch weit über diese frischen Bilder eines einzigen Winters (wofür der Himmel Dich absolviren möge!) geht das Gedächtniß einer Freundschaft, welche schon so manchen Winter überstanden und sich gegen Stürme bewährt hat. Oft kam ich zu Dir, um mich Raths zu erholen bei Deiner Weisheit, um Theilnahme zu finden bei Deinem Herzen, und jedesmal kehrte ich mit vermehrtem Danke zurück — einem Danke, welcher vielleicht das seltenste, aber darum nicht weniger glückliche Gefühl enthält, das die Erfahrung dem Manne übrig läßt. Mag es auch seyn, daß manche Meinungsverschiedenheiten — sei es nun in öffentlichen Fragen, wodurch wir jeden Tag Freundschaften, welche durch den Austausch der Gefühle entstanden, weit außer dem Bereiche von König und Gesetz hätten stehen sollen, entfremdet sehen, oder in den mehr scholastischen Streitfragen, welche gebildete Menschen eben so lebhaft interessiren — uns zuweilen das idem velle, et idem nolle streitig machen; die vera amicitia bedarf nicht jener gewöhnlichen Bande. Der Sonnenschein scheidet darum nicht von der Welle, weil ein zufälliger Stein einen Augenblick lang die Oberfläche kräuselte.
So empfange denn in dieser Widmung eines Werkes, das mir so lange auf der Seele gelegen und aus vielen Gründen theuer geworden ist, das Unterpfand meiner Zuneigung für Dich und die Deinigen — einer Zuneigung, welche ebenso stark wie die Bande des Bluts und nicht minder dauernd als der Glaube an die Wahrheit ist.
1. März 1848.
E. B. L.
Erstes Buch.
Der normännische Gast, der sächsische König und die dänische Prophetin.
Erstes Kapitel.
Lustig war der Monat Mai im Jahr unseres Herrn 1052. Da gab es nur wenige Bursche und noch weniger Mädchen, welche den Morgen des ersten Tages dieses fröhlichen Monats verschlafen hatten, denn lange vor der Dämmerung hatte das junge Volk Wiesen und Wälder heimgesucht, um Maibäume zu fällen und Blumen zu winden. Manche schöne grüne Wiese lag damals noch jenseits des Dorfes Charing und hinter der Thorneyinsel (zwischen deren Farren- und Brombeersträuchern sich eben um jene Zeit rasch und stattlich die Halle und Abtei von Westminster erhob); mancher Wald dehnte sich dunkel im Sternenlichte an den Abhängen über den feuchten Strand mit seinen zahlreichen Kanälen oder Gräben auf beiden Seiten der großen Kenterstraße. Flöten und Hörner klangen fern und nah über die grünen Stellen, aus denen Gesang und Gelächter und das Krachen der brechenden Aeste in die Lüfte erscholl.
Wie der Morgen grau im Osten empordämmerte, beugte sich manches schelmische blühende Gesicht, um sich im Maithau zu baden. Geduldige Ochsen standen dösend an den blütheduftenden Hecken, bis die munteren Maischnitter mit ihren stattlichen Stangen aus den Wäldern kamen, während die Mädchen die Schürzen voll Blumen nachtrugen, die sie auf den Wiesen im Schlafe überrascht hatten. Auch die Stangen prangten von Blumensträußen, und jedem Ochsen wurde ein Kranz um die Hörner gehängt. Dann strömten die Prozessionen gegen Anbruch des Tags durch alle Thore in die Stadt zurück; voraus zogen Knaben mit ihren Maigaden (geschälten Weidengerten mit Schlüsselblumen umwunden) und durch die belebenden Klänge der Hörner und Flöten schallte laut aus dem wandelnden Haine ein munterer Chor, der einige alte sächsische Verse — Vorläufer des späteren Liedes: »Wir haben den Sommer heimgebracht!« — anstimmte.
Oft waren Könige und Aeltermänner in den guten alten Tagen, bevor der Mönch-König regierte, auf diese Weise in die Maien gegangen; allein jener gute Prinz konnte solche Lustbarkeiten, die nach dem Heidenthume schmeckten, nicht leiden. Dennoch war der Gesang eben so lang und die Zweige waren eben so grün, als ob König und Earl im Zuge mitgewandelt wären.
Die schönsten Matten für die Schlüsselblumen, die grünsten Wälder zu den Zweigen umringten damals an der großen Kenterstraße ein stattliches Gebäude, das einst einem üppigen Römer angehört hatte, jetzt aber entstellt und verfallen war. Bursche und Mädchen scheuten jedoch solche Orte, und als sie mitten in ihrer Lustbarkeit auf dem Heimwege an den zertrümmerten Mauern, den angenisteten Außengebäuden vorüberkamen und in deren Nähe die grauen Druidensteine (jene Denkmale eines Zeitalters, das den sächsischen wie den römischen Eroberern lange vorhergegangen) in der Dämmerung durchschimmern sahen, hatte der Gesang ein Ende; die Jüngsten bekreuzten sich und die Aelteren meinten in feierlichem Flüstern, es wäre wohl vorsichtiger, ihren fröhlichen Gesang in einen frommen Psalm zu verwandeln. In jenem alten Gebäude wohnte nämlich Hilda — finsteren berüchtigten Andenkens — Hilda, welche, wie man glaubte, allem Gesetz und Canon zum Trotz noch immer die verderblichen Künste der Wicca und Morthwyrtha (der Hexe und Todtenverehrerin) praktiziren sollte. Sobald jedoch das Völkchen jenen Bereich des Schreckens hinter sich hatte, war der Psalm vergessen und der fröhliche Chor drang abermals laut, hell und silberrein durch die Morgenlüfte.
So gelangte man gegen Sonnenaufgang nach London, und Thüren und Fenster wurden gebührendermaßen mit Blumenguirlanden umwunden, jedes Dorf in der Umgebung hatte seinen Maibaum, der das ganze Jahr über stehen blieb. Jede Arbeit ruhte an diesem glücklichen Tage; Ceorl und Theowe (Höriger und Leibeigener) hielten ihren Feiertag, um zu tanzen und sich um den Maibaum herumzutummeln, und so geschah es denn wirklich, wie das Lied es erzählt, daß Jugend, Frohsinn und Musik am ersten Mai den Sommer hereinbrachten.
Noch am andern Tage konnte man deutlich erkennen, wo die fröhlichen Banden sich herumgetrieben hatten; man konnte ihren Weg an den zerstreuten Blumen und Blättern und an den tiefen Räderspuren der Karren, welche die Maibäume heimführten, — diese waren oft mit zwanzig bis vierzig Ochsengespannen besetzt — verfolgen und von jeder Anhöhe ließen sich weit über das ganze Land die zierlichen Maibäume gewahren, womit der Rasen jedes Weilers gekrönt war — die Luft schien noch immer mit den Düften der Blumenguirlanden erfüllt.
Mit eben diesem zweiten Maitage des Jahres 1052 will ich denn meine Geschichte im Hause Hilda’s, der berüchtigten Morthwyrtha, eröffnen. Es stand auf einer sanften, grünen Anhöhe und trotz der barbarischen Verstümmlung, die es von barbarischen Händen erlitten hatte, war immer noch genug davon übrig geblieben, um gegen die gewöhnlichen Wohnungen der Sachsen einen auffallenden Kontrast zu bilden.
Noch immer waren die Ueberbleibsel römischer Kunst sehr zahlreich über England verbreitet, aber es geschah nur selten, daß sich der Sachse seine Heimath unter den Villen dieser früheren Eroberer erwählte. Unsere ersten Vorväter waren weit eher geneigt zu zerstören, als sich an Gegebenes anzupassen. Durch welchen Zufall dieses Gebäude eine Ausnahme von der allgemeinen Regel bildete, ist jetzt unmöglich zu erforschen; so viel ist gewiß, daß es seit sehr langer Zeit ganzen Geschlechtern teutonischer Gebieter zum Obdache gedient hatte.
Die Veränderungen, die mit dem Gebäude vorgegangen, waren traurig und grotesk zugleich … Was jetzt als Halle diente, war offenbar das Atrium (Vorhof) gewesen, der runde Schild mit seiner zugespitzten Buckel, der Speer, das Schwert und der kleine krumme Säx des früheren Teutonen hingen an denselben Säulen, welche früher von Blumen umwunden gewesen; in der Mitte des Flurs, wo zwischen dem hartgestampften Pflaster aus Lehm und Kalk noch Trümmer der alten Mosaik hervorglitzerten, war der Herd auf das frühere Impluvium etablirt und der Rauch stieg langsam durch die Oeffnung im Dache, welche vor alten Zeiten den Regen des Himmels eingelassen hatte.
Rings um die Halle hatte man die alten cubicula oder Schlafgemächer (klein, hoch und nur von der Thüre aus beleuchtet) für die Dienerschaft des Haushalts oder untergeordnete Gäste beibehalten, während am hintern Ende der Halle der weite Raum zwischen den Säulen, durch den man einst aus anmuthigen Zellen in das tablinum und viridarium hinausgeschaut hatte, mit wüstem Gerümpel und römischen Ziegelsteinen ausgefüllt war, so daß nur eine niedere Rundbogenthüre übrig blieb, welche noch immer in das Tablinum führte. Dieses selbst, früher das heiterste Staatszimmer des römischen Großen, war jetzt mit allerlei Plunder, Reisbündeln und Geräthschaften des Landbaus angefüllt. Zu beiden Seiten dieses entweihten Gemaches dehnte sich rechts das alte lararium (Gemach des Laren), nun aber seiner alten Götterbilder und Familienstatuen entkleidet, links das frühere gynaeceum (Frauengemach).
Das Lararium war übrigens von einem frühern sächsischen Than oder Galden offenbar schon vor Einführung des Christenthums in ein Staatszimmer verwandelt worden, denn hier und dort hatte eine grimmige Künstlerhand auf das einst mit Gegenständen aus der klassischen Mythologie und Poesie reich bemalte Glas Skizzen gesudelt, welche Hengist’s weißes Roß oder Wodans schwarzen Raben darstellen sollten; Runeninschriften liefen zum Theil verwischt erbarmungslos über die Mitte eines abgeblaßten Gebälks mit spielenden Liebesgöttern; gespenstige Wolfsköpfe, durch Zeit und Verfall, Motten und Würmer halb zerstört, hingen über einem alterthümlichen, seltsamen Stuhle und hatten dort in melancholischem Stolze seit dem Tage gehaust, da diese verwandten Thiere von ihren sächsischen Brüdern so unnatürlich vertilgt worden waren.
Alle diese Gemächer, deren Thüren sich auf die offene Gallerie, Viridarium genannt, und dann auf einen Peristyl oder längliche Colonnade öffneten, waren nur mit Ausnahme des mittleren Tablinums (dieses hatte die Thüre beibehalten) durch Fenster geschlossen; das im alten Lararium war blos durch Lattenwerk gegen den Regen geschützt, das gegen das Gynäceum dagegen mit trübem grauem Glase versehen. (Das Glas, das zur Zeit Bedas eingeführt wurde, war nämlich damals6 sowohl an Gefässen als an Fenstern in den Häusern der Wohlhabenden weit häufiger als in der viel späteren Zeit der glänzenden Plantagenets, obwohl sich dessen Gebrauch immer noch auf die Vermöglichen beschränkte.) Der alte Peristyl war von bedeutender Ausdehnung; die eine Seite hatte man in Stallungen, in Schwein- und Ochsenställe verwandelt; auf der anderen war aus rohen Eichenplanken, welche oben durch Platten zusammengehalten wurden, eine christliche Kapelle errichtet, welche ein Schilfdach bedeckte. Die Außenwand des Peristyls nebst seinen Säulen bildete eine wirre Trümmermasse, durch deren riesige Spalten ein Grashügel an den Abhängen theilweise mit Ginsterbüschen bedeckt hindurchschimmerte.
Auf diesem Hügel standen die verstümmelten Trümmer eines alten druidischen Cromlechs (Altar), in dessen Mitte man nahe an einer Begräbnißmündung mit dem Bauta- oder Grabsteine eines frühern sächsischen Häuptlings an dem einen Ende — verbrecherischer Weise einen Altar für Thor aufgestellt hatte, was sowohl aus der Gestalt als aus einem rohen halbverwischten gemeiselten Relief des Gottes mit seinem geschwungenen Hammer und einigen Runenbuchstaben hervorging. Hier sah man aufs Neue, wie der Sachse mitten in dem Tempel des Bretonen den Schrein seines triumphirenden Kriegsgottes aufgerichtet hatte.
Unter den Trümmern dieser ebengenannten Außenseite des Peristyls, welche auf den Hügel hinausging, waren erstens ein alter römischer Brunnen, der jetzt den Schweinen zur Schwemme diente, und dann ein kleiner sacellum oder Bacchustempel (wie das noch erhaltene Fries und Relief bezeugte) übrig geblieben, so daß das Auge mit einem Blick die Denkmäler von vier verschiedenen Glaubensbekenntnissen überschauen konnte — hier das druidische, mystisch und symbolisch: dort das römische, sinnlich aber menschlich; das teutonische, grausam und zerstörend, und am spätesten entstanden und alle überlebend, obwohl bis jetzt seinen sanften Einfluß über die Thaten der Menschen nur in geringem Grade ausübend — der Bau, welcher der Lehre des Friedens gewidmet war.
Durch das Peristyl zogen Leibeigene und Schweineheerden ungehindert hin und her; im Atrium sah man Männer der höhern Klasse, halb bewaffnet, einige mit Trinken, andere mit Würfeln, diese mit ungeheuren Hunden, jene mit den Falken beschäftigt, welche ernst und feierlich auf ihren Stangen dasaßen.
Das Lararium war verlassen, das Gynäceum dagegen noch immer wie in der Römerzeit das Lieblingsgemach des weiblichen Hauspersonals und trug auch noch denselben Namen7. Mit einer dort versammelten Gruppe werden wir jetzt zunächst zu thun haben.
Die Ausstattung des Zimmers deutete auf den Rang und die Wohlhabenheit des Besitzers. Damals war nämlich der häusliche Luxus des Reichen weit größer, als man in der Regel angenommen hat: der Fleiß der Frauen schmückte Wände und Geräthe mit Nadelarbeit und Vorhängen, und gleichwie ein Than durch den Verlust seiner Ländereien auch seinen Rang einbüßte, so behielten die höheren Klassen einer mehr auf Reichthum als Geburt sich gründenden Aristokratie gewöhnlich einen Theil ihrer überflüssigen Schätze bei, welche sonst in die Bazars des Orients und auf die nähern Märkte von Flandern und dem sarazenischen Spanien wanderten.
In diesem Gemache waren die Wände mit reichgestickten seidenen Vorhängen drappirt. Auf einem Schenktische standen Trinkhörner, in Silber gefaßt, und sogar einige Gefässe aus purem Gold. Ein kleiner runder Tisch in der Mitte wurde durch sonderbar geschnitzte symbolische Ungeheuer gestützt. An der einen Wand saßen auf einer langen Bank ein halb Dutzend Hausmägde, mit Spinnen beschäftigt; ferne von ihnen und nahe am Fenster sah man eine hochbetagte Frau von eigenthümlicher majestätischer Miene und Haltung. Auf einem kleinen Dreifuß vor ihr lag eine Runenhandschrift mit einem Tintenzeug von eleganter Form nebst silbernem Schreibgriffel. Zu ihren Füßen kauerte ein kaum sechzehnjähriges Mädchen, dessen schönes langes Haar, über der Stirne gescheitelt, weit über ihre Schultern herabfiel. Ihre Kleidung war eine linnene Untertunika mit langen Aermeln, welche hoch zum Hals hinaufreichte, und ohne all’ die modernen kunstreichen Zwangsanstalten durch den einfachen Gürtel die schlanken Verhältnisse und den zarten Umriß des Mädchens hervorhob. Die Farbe dieser Tracht war das reinste Weiß, nur an den Bordüren reich gestickt.
Die Schönheit der Kleinen grenzte wirklich ans Wunderbare, denn sogar in einem Lande, das durch seine schönen Frauen sprüchwörtlich geworden, hatte sie ihr bereits den Namen der »Schönen« erworben. Bei ihr vereinigten sich nämlich — bis jetzt nicht ohne gegenseitigen Wettstreit um die Herrschaft — die beiden nur selten in einem und demselben Antlitze verbundenen Reize des Edlen und des Sanften. Der Beweis dieses innern Kampfes zeigte sich in der That in dem ganzen Aeußern: der Verstand war noch nicht gereift, Seele und Herz noch nicht vereinigt, und Editha, die christliche Maid, wohnte in dem Hause Hilda’s, der heidnischen Prophetin. Die blauen Augen des Mädchens, unter dem Schatten ihrer langen Lider dunkel erscheinend, waren voll Spannung auf das strenge unruhige Gesicht geheftet, das sich mit jenem zerstreuten Blicke, welcher die Abwesenheit der Seele andeutet, über ihr eigenes Antlitz beugte. So saß Hilda, und so kauerte ihre Enkelin Editha.
»Großmutter,« sagte das Mädchen leise und nach langer Pause — der Klang ihrer Stimme erschreckte die Hausmägde dermaßen, daß jede Spindel für einen Augenblick inne hielt und sich dann mit erneuter Thätigkeit von Neuem regte — »Großmutter, was beunruhigt Dich? Denkst Du nicht an den großen Earl und seine schönen Söhne, welche jetzt ferne über die weite See verbannt sind?«
Bei den Worten des Mädchens fuhr Hilda wie aus einem Traume empor, und als Editha ihre Frage beendigt hatte, erhob sie sich langsam zu der vollen Höhe ihrer Gestalt, welche, ungebeugt von den Jahren, sogar die gewöhnliche Männergröße weit überragte, und von dem Kinde sich abwendend, fiel ihr Auge auf die schweigende Mägdereihe, welche an ihrem raschen geräuschlosen verstohlenen Werke saß.
»Hoh!« rief sie, während ihr kaltes hochmüthiges Auge in düsterm Feuer aufglimmte, »gestern haben sie den Sommer eingebracht, heute helft ihr den Winter einbringen. Webt nur gut — habt mir Acht auf Zettel und Einschlag, Skulda8 ist unter Euch, und ihre bleichen Finger führen das Weberschiff.«
Die Mägde wagten nicht die Augen aufzuschlagen, obwohl Aller Wangen bei den Worten der Gebieterin erblaßten. Die Spindeln surrten, der Faden schoß und das Schweigen war alsbald eisiger denn zuvor zurückgekehrt.
»Fragst Du,« fuhr Hilda endlich, an das Kind gerichtet, fort, als ob die Frage, die sich so lange zuvor an ihr Ohr gewendet, erst jetzt ihre Seele erreicht hätte, »fragst Du, ob ich an den Earl und seine schönen Söhne dachte? — Ja, ich hörte den Schmied, wie er Waffen auf den Ambos schwang, und wie der Hammer des Schiffebauers starke Rippen für die Meeresrosse zimmerte. Ehe noch der Schnitter seine Garben gebunden, wird Earl Godwin die Normannen in den Hallen des Mönchekönigs verscheuchen, wie der Falke die Brut im Taubenschlage verscheucht. Webt nur gut und habt mir Acht auf Zettel und Einschlag, ihr flinken Mädchen — stark sey das Gewebe, denn beißend ist der Wurm.«
»Was weben sie denn, gute Großmutter?« fragte das Mädchen mit Scheu und Verwunderung in ihren sanften milden Augen.
»Das Todtenhemd für den Großen.«
Hilda’s Lippen schloßen sich, aber ihre Augen, leuchtender als zuvor, starrten in den leeren Raum hinaus, und ihre bleiche Hand schien Buchstaben gleich Runenzeichen in die Luft zu malen, bis sie sich langsam umwandte und durch das trübe Fenster hinausschaute.
»Reicht mir Schleierhaube und Stab,« gebot sie plötzlich.
Jedes der Mädchen, heilig froh eine Arbeit zu verlassen, welche erst frisch begonnen schien und nach dem, was sie über ihren Zweck von der Herrin erfahren, bei ihnen gewiß nicht sehr beliebt war — erhob sich, um diesem Befehle zu gehorchen.
Ohne die Hände, die miteinander wetteiferten, zu beachten, nahm Hilda ihre Haube und stülpte sie theilweise auf die Stirne, worauf sie, leicht auf ihren langen Stab sich lehnend, dessen Kopf einen aus schwarzgefärbtem Holze geschnitzten Raben vorstellte, in die Halle und von da durch das entheiligte Tablinum in den mächtigen, durch den bedeckten Peristyl gebildeten Hof trat, wo sie eine Weile nachdenklich stille hielt und ihrer Enkelin rief. Das Mädchen stand bald an ihrer Seite.
»Komm mit. — Es gibt ein Gesicht das Du nur zweimal in Deinem Leben sehen sollst — heute — —«
Hilda schwieg und man sah, wie die rauhe, fast kolossale Schönheit ihres Gesichtes sich sänftigte.
»Und wann abermals, meine Großmutter?«
»Kind, lege Deine warme Hand in die meine. So! das Gesicht verdunkelt sich vor den Blicken: wann abermals — fragst Du, Editha? Ach, ich weiß es nicht.«
So sprechend ging Hilda langsam an dem Römerbrunnen und dem Heidentempel vorüber und stieg den kleinen Hügel hinan; dort auf der entgegengesetzten Seite des Gipfels, den druidischen Cromlech und den teutonischen Altar hinter sich, setzte sie sich bedächtlich auf den Rasen nieder.
Einige Maasliebchen, Primeln und Schlüsselblumen wuchsen in der Nähe; diese begann Editha zu pflücken, indem sie beim Kranzwinden ein einfaches Lied sang, das eben sowohl durch seinen Dialekt wie durch das in ihm waltende Gefühl seinen Ursprung in den Balladen der Norsa9 verrieth, deren Charakter sich durch sorglosere Fassung von der künstlicheren Poesie der Sachsen wesentlich unterschied.
Das Lied läßt sich ziemlich unvollkommen also wiedergeben:
»Lustig dort die Drossel singt
In dem lust’ gen Mai;
Drossel singt zu meinem Ohr:
Herz ist nicht dabei.
Lustig mit dem Blüthenzweig
Lächelt froh der Baum;
Mein Auge nach den Blüthen schaut:
Herz schifft in Meeresraum.
Mein Mai ist nicht der Blüthenzweig —
Nicht Vogelsang im Gras:
Mein Mai der war im Winterfrost,
Wenn Einer neben saß.«
Als sie an die letzte Strophe kam, schien ihre sanfte Stimme einen Chor von lauten Hörnern, Trompeten und gewissen anderen, der damaligen Musik eigenthümlichen Blasinstrumenten zu erwecken. Der Hügel begrenzte die Hochstraße nach London, welche sich damals zwischen weiten Forststrecken durchwand, und unter den Bäumen zur Linken hervortretend, kam eine stattliche Gesellschaft zum Vorschein.
Voraus zogen zwei Bannerträger, jeder mit einer Fahne. Auf der einen war das Kreuz und die fünf Hämmer — das Wahrzeichen Edwards, später mit dem Namen der Bekenner — abgemalt; auf der andern sah man ein einfaches breites Kreuz mit einem tiefen Rande ringsum, die Ecken in scharfe Spitzen ausgezackt.
Das erste Banner war Edithen bekannt, welche ihre Guirlande fallen ließ, um den nahenden Prachtzug zu beschauen; das letzte dagegen schien ihr noch fremd. Sie war gewöhnt, das Banner des großen Earls Godwin neben dem des Sachsenkönigs zu sehen, und darum sagte sie fast unwillig:
»Wer wagt es, theure Ahne, ein Banner als Wimpel aufzupflanzen, wo das des Earls Godwin flattern sollte?«
»Schweig,« gebot Hilda; »schweig und schaue!«
Unmittelbar hinter den Standartenträgern kamen zwei Gestalten, in Miene, Jahren und Alter wunderbar unähnlich, jede einen Falken auf der linken Faust führend. Der eine der beiden Männer ritt einen milchweißen Zelter, dessen Schabrake mit Gold und ungeschliffenen Juwelen besetzt war. Obwohl nicht eigentlich alt — denn er war kaum über die Sechzig — war ihm doch das Alter in Miene und Haltung eingegraben. Seine Gesichtsfarbe war zwar ausnehmend klar und seine Wangen von gesunder Röthe gefärbt, aber sein Gesicht zeigte lange tiefe Furchen und unter seinem Barett, das in der Form den schottischen nicht unähnlich war, wallte das lange schneeweiße Haar mit einem großen Zwickelbarte sich vermischend. Weiß schien seine Lieblingsfarbe, denn weiß war die obere Tunika, die mit einer breiten Spange oder Brosche auf die Schulter geheftet war, weiß die wollenen Beinkleider, die seine abgemagerten Glieder bedeckten, und weiß der Mantel, jedoch mit einer breiten Bordüre von Gold und Purpur besetzt. Der Schnitt seiner Kleidung war wie er einem Edlen geziemte, nur daß er für die gebrechliche, ungraziöse Gestalt des Reiters gar übel taugte.
Gleichwohl erhob sich Editha, sobald sie seiner ansichtig wurde, mit einem Ausdruck tiefer Ehrfurcht, und ging mit den Worten: »es ist unser Herr, der König!« einige Schritte den Hügel hinab, wo sie, die Arme über die Brust gekreuzt, und in ihrer jugendlichen Unschuld ganz vergessend, daß sie das Haus ohne Mantel und Schleierhaube, wie man sie für die Tracht der Jungfrau wie der Matrone außer dem Hause als unerläßlich betrachtete, zu Haus gelassen hatte — am Fuß desselben stehen blieb.
»Edler Sir und Bruder mein,« sagte die tiefere Stimme des jüngeren Reiters in der romanischen oder normännischen Sprache. »Ich habe gehört, daß das kleine Völkchen, von dem meine Nachbarn, die Bretonen, uns so Vieles erzählen, in diesem Eurem schönen Lande sehr zahlreich seyn solle, und ritte ich nicht an der Seite eines Mannes, dem kein ungetauftes und nicht absolvirtes Geschöpf sich nahen darf — bei der süßen St. Valery, ich würde sagen: dort drüben steht eines jener selben gentiles fées.«
König Edwards Auge folgte der Richtung, welche sein Begleiter mit der Hand andeutete, und seine ruhige Stirn zog sich leise zusammen, als er Editha’s jugendliche Gestalt regungslos nur wenige Schritte vor sich sah, während die warmen Mailüfte mit ihren langen goldenen Locken kosten. Er hielt seinen Zelter an und murmelte einige lateinische Worte, in denen der Ritter neben ihm ein Gebet erkannte, welchem er sein Amen mit entblöstem Haupte und in so salbungsvollem Tone beifügte, daß ihn der königliche Heilige mit schwachem Beifallslächeln und einem zärtlichen »Bene, bene, Piosissime!« belohnte.
Sofort seinen Zelter gegen den Hügel lenkend, winkte er dem Mädchen, ihm näher zu kommen. Editha gehorchte mit hochrothen Wangen und trat bis an die Straße. Die Bannerträger hielten wie der König und seine Begleiter — die Prozession hinten blieb stehen — dreißig Ritter, zwei Bischöfe, acht Aebte, alle auf feurigen Rossen und in normännischer Tracht — Knappen und Fußknechte — ein langes pomphaftes Gefolge — alle hielten an; nur einige weggelaufene Hunde sonderten sich von der übrigen Meute und wanderten mit hängendem Kopfe in die benachbarten Forste.
»Editha, mein Kind,« begann Edward noch immer normännisch-französisch, denn er sprach seinen Landesdialekt nicht sehr geläufig und das Romanische, das unter den höheren Klassen in England schon lange einheimisch gewesen, war seit seiner Thronbesteigung die ausschließliche Hofsprache geworden, und als solche wurde angenommen, daß jeder Earl-Sippe sie gleichfalls spreche — »Editha, mein Kind, Du hast hoffentlich meine Lehren nicht vergessen, Du singst die Hymnen, die ich Dir gab und versäumst doch nicht, die Reliquie um den Nacken zu tragen?«
Das Mädchen senkte das Haupt und schwieg.
»Wie kommt es denn,« fuhr der König fort, während er seiner Stimme vergeblich einen strengen Accent zu geben versuchte, »wie kommt es, o Kleine, daß Du, deren Gedanken sich bereits über diese Fleischeswelt emporgeschwungen haben und eifrig auf den Dienst unserer keuschen und gebenedeiten Maria gerichtet seyn sollten, so schleierlos und allein — ein Ziel für die Augen der Männer — am Wege stehst? Geh zu, das ist nichts.«
Dieser Vorwurf, vor so großer glänzender Gesellschaft ausgesprochen, färbte des Mädchens Wangen mit wechselnder Röthe, ihre Brust hob sich, aber mit einer Anstrengung weit über ihre Jahre, hielt sie ihre Thränen zurück und sagte in mildem Tone:
»Meine Großmutter Hilda befahl mir mit ihr zu kommen und ich kam.«
»Hilda!« rief der König, seinen Zelter mit anscheinender Bestürzung zurückhufend: »Hilda ist aber nicht bei Dir — ich sehe sie nicht.«
Indem er noch sprach, erhob sich Hilda, und ihre hohe Gestalt erschien so plötzlich auf dem Gipfel des Hügels, daß man hätte glauben können, sie wäre aus dem Boden emporgestiegen; mit leichtem raschem Schritte neben ihre Enkelin tretend, gab sie nach einer flüchtigen hochmüthigen Verbeugung zur Antwort:
»Hilda ist hier; was verlangt Edward, der König, von seiner Dienerin Hilda?«
»Nichts, nichts,« versetzte der König hastig, und ein Anflug von Furcht kam über sein stilles Antlitz, worauf er mit dem widerstrebenden Ton eines Menschen, der seinem Gewissen gegen die eigene Neigung gehorcht, also fortfuhr: »außer daß ich Dich bitten möchte, dieses Kind hinter Hausschwelle und Altar zu halten, wie es der Maid geziemt, welche unsere heilige Jungfrau ihrer Zeit für ihren Dienst erkiesen wird.«
»Nicht so, Sohn Ethelreds, Sohns von Wodan; Penda’s letzter Abkömmling muß leben, nicht um als Geist zwischen Klostermauern zu schweben, sondern um Söhne für den Krieg in ihres Vaters Schilde zu wiegen. Es gibt ja so wenige Männer wie ehedem, und so lange der Fuß des Fremden auf sächsischem Boden verweilt, sollte kein Zweig an Wodans Stamme im Blatte geknickt werden.«
»Per la resplendar. Dé,10 kühne Dame,« schrie der Ritter neben Edward, während sich düstere Gluth über seine bronzene Wange ergoß, »Du zeigst wahrlich für einen Unterthan eine zu geläufige Zunge, und für die Lippen einer christlichen Matrone schwatzest Du viel zu viel von Eurem heidnischen Wodan.«
Hilda begegnete den blitzenden Augen des Ritters mit einer Stirne, worauf hohe Verachtung nicht ohne leisen Schreck sich abmalte.
»Kind,« sagte sie, ihre Hand auf Edithens schöne Locken legend, »Das ist der Mann, den Du nur zweimal in Deinem Leben sehen sollst — blick auf, daß Du ihn Deinem Gedächtniß wohl einprägest!«
Editha hob unwillkürlich die Augen, welche, einmal auf den Ritter geheftet, wie durch einen Zauber an ihn gefesselt schienen. Sein Gewand, von so dunklem Karmoisin, daß es neben der schneeweißen Tracht des Bekenners fast schwarz aussah, war mit einem breiten goldgesticktem Saume besetzt; sein fester voller Hals, stark und kräftig wie eine Granitsäule, war ganz unbedeckt, und eine kurze Pelzjacke oder Halbmantel, der ihm über die Schultern hing, enthüllte in ihrer ganzen Breite eine Brust, welche dazu gebaut schien, das Vorrücken einer ganzen Armee aufzuhalten, während sich an seinem linken Arme, der zur Stütze für den Falken leicht gebogen war, die starken Muskeln durch den engen Aermel rund und sehnig hervorhoben. An Größe ragte er nur wenig über die jetzige Männerhöhe empor11; aber seine Haltung, seine Miene, der Adel seiner großartigen Verhältnisse stachen dermaßen ins Auge, daß er sich unermeßlich über die andern zu erheben schien.
Sein Gesicht war übrigens noch merkwürdiger als seine Gestalt; noch in der Blüthe der Jugend, schien er beim ersten Blicke jünger, beim zweiten älter als er wirklich war. Beim ersten Blicke jünger, denn sein Gesicht war ganz glatt geschoren, sogar ohne den Schnurrbart übrig zu lassen, wie ihn der sächsische Höfling, als Nachahmung der Normannen, noch immer abzulegen sich weigerte, so daß das glatte Gesicht und der bloße Hals an sich schon genügten, seinem gebietenden eindringlichen Wesen einen jugendlichen Anstrich zu verleihen. Sein kleines Barett ließ die mit kurzem, dickem, ungekräuseltem, aber rabenschwarzem, glänzendem Haar bedeckte Stirne gänzlich unbedeckt, eine Stirne, auf welcher die Zeit ihre Spuren eingegraben hatte, denn sie war in einer Falte über den Augbraunen gerunzelt, und tiefe Furchen kreuzten ihre breite, aber nicht hervortretende Oberfläche. Jene Stirnrunzel verkündete ein jähzorniges Temperament und die Gewohnheit strengen Kommando’s; jene Furchen erzählten von tiefem Nachdenken und einem intriguirenden Geiste, die eine blos Temperament und zufällige Umstände, die andere, edlere, den Charakter und die Geisteskraft verkündend. Das Gesicht war vierkantig und der Blick löwenähnlich; der Mund, klein und sogar schön im Umriß, bekam durch seine ausnehmende Festigkeit einen düstern Ausdruck, und das Kinn breit, massig und wie in Eisen gebunden — gab Zeugniß von einem hartnäckigen, erbarmungslosen, entschlossenen Willen; es war ein Kinn, wie es unter Thieren dem Tiger, unter Menschen aber dem Eroberer zukommt — ein Kinn, wie es an den Bildern eines Cäsar, Cortes oder Napoleon hervortritt.
Seine ganze Erscheinung war wohl darauf berechnet, die Bewunderung der Frauen nicht minder, wie die Scheu der Männer zu erregen. Aber keine Bewunderung mischte sich in den Schrecken, der das Mädchen ergriff, während sie den Ritter lange und gedankenvoll anstarrte: der Zauber der Schlange über den Vogel erhielt sie stumm und in eisiger Erstarrung. Nie vermochte sie dieses Gesicht zu vergessen; oft sollte es noch in ihrem späteren Leben, am hellen Tage wie in ihren Träumen, vor ihren Gedanken spuken.
»Schönes Kind,« begann der Ritter, von ihrem hartnäckigen Anstarren endlich ermüdet, während jenes Lächeln, wie es Solchen, die an das Befehlen gewöhnt sind, eigen ist, seine Stirne sänftigte und seinen Lippen die angeborene Schönheit wiedergab, »schönes Kind, laß Dir von Deiner grämlichen Ahnfrau nicht so unhöfliche Lehren, wie den Haß gegen die Ausländer, aufheften. Wie Du zur Jungfrau heranreifst, so erfahre auch, daß der normännische Ritter ein geschworener Sklave der Schönheit ist. Oeffne die Hand, mein Kind,« indem er von seinem Barett einen ungeschnittenen, in byzantinische Filigranarbeit gefaßten Juwel abnahm, »und wenn Du den Fremdling schmähen hörst, so stecke diese Kleinigkeit in die Locken und denke freundlich an William, Graf12 der Normannen.«
Indem er so sprach, ließ er den Juwel zu Boden fallen, denn Editha, welche vor ihm zurückbebte, streckte keine Hand darnach aus, und Hilda, mit welcher Edward leise gesprochen hatte, kam alsbald zur Stelle und stieß den Edelstein mit ihrem Stab unter die Hufe des königlichen Zelters.
»Sohn der Normannin Emma, welche Deine Jugend ins Exil sandte — tritt nur die Gaben Deines normännischen Verwandten mit Füßen, und wenn Du, wie man sagt, mit solcher Heiligkeit begabt bist, daß der Himmel Deiner Hand die Macht zu heilen, und Deiner Stimme die Gewalt zu fluchen verleiht, so heile Dein Land und fluche dem Fremdling!«
Bei diesen Worten hob sie den rechten Arm gegen William, und so groß war die Würde und Gewalt ihrer Leidenschaft, daß Alle ein förmliches Grauen überfiel. Den Schleier übers Gesicht ziehend, wandte sie sich sofort langsam zur Seite und erreichte den Gipfel des Hügels, wo sie aufrecht neben dem Altar der nordischen Gottheit stand, ihre Gestalt regungslos wie eine Bildsäule, ihr Angesicht unsichtbar wegen des Schleiers, mit dem sie es förmlich verhüllt hatte.
»Reitet weiter,« sprach Edward sich bekreuzigend.
»Bei den Gebeinen der heiligen Valery,« rief William nach einer Pause, worin sein scharfes schwarzes Auge den düstern Ausdruck auf dem sanften Angesicht des Königs beobachtet hatte, »es nimmt mich nur gewaltig Wunder, wie selbst so heilige Gegenwart diese barschen, nichtswürdigen Worte ohne Zorn anzuhören vermag. Beim Himmel, auch wenn die stolzeste Dame der Normandie (und dafür halte ich das Weib des stattlichsten meiner Barone, William Fitzosborne’s) also zu mir gesprochen hätte —«
»So würdest Du gethan haben wie ich, mein Bruder,« fiel Edward ein; »Du hättest unsern Herrn gebeten, ihr zu verzeihen und wärest mitleidig weiter geritten.«
Williams Lippen bebten vor Zorn, aber er drängte die Antwort, die ihm auf der Zunge schwebte, zurück, indem er seinen fürstlichen Genossen voll Zuneigung — und diese ist ja von Natur mehr zur Bewunderung als zur Verachtung geneigt, — betrachtete. So stolz und grausam auch des Herzogs Thaten waren — sein Glaube war dennoch aufrichtig, und während dies den Prinzen hauptsächlich zu dem frommen Edward hinzog, beugte sich derselbe auf der andern Seite mit jener Art unwillkürlicher, abergläubischer Huldigung vor dem Manne, der die Handlungen dem religiösen Glauben anzupassen suchte. Man wird bei heftigen stürmischen Geistern immer die Erfahrung machen, daß ein sanftes Gemüth, das stark gegen sie kontrastirt, sich auffallend in ihre Neigungen einschmeichelt. Nur dieses Princip der menschlichen Natur vermag die enthusiastische Ergebung zu erklären, wie sie die milden Leiden des Erlösers bei den wildesten Verwüstern des Nordens erweckten; ja mit der Wildheit des Kriegers stand oft gerade seine Liebe zu jenem göttlichen Ebenbilde im Verhältniß, über dessen Leiden er weinte, zu dessen Grabe er barfuß wanderte, dessen Beispiel in mitleidsvoller Versöhnlichkeit zu folgen er aber gleichwohl an sich selbst als die größte Niederträchtigkeit betrachtet hätte.
»Nun schwöre ich Dir, bei der Gebenedeiten »ich ehre und liebe Dich, Edward,« rief der Herzog mit offenerer Herzlichkeit, als man sonst an ihn gewöhnt war, »und wäre ich Dein Unterthan, dann wehe jedermänniglich, der seine Zunge rührte, um Dich mit einem Athemzuge zu verwunden. Doch wer und was ist diese nämliche Hilda? Gehört sie zu Deinem eigenen Geschlecht? — gewiß, nur königliches Blut kann so kühn in den Adern rollen!«
»William, bien aimé!« sagte der König, »es ist wahr, diese Hilda, der die Heiligen verzeihen mögen, ist von königlichem Geblüte, doch nicht von unserer eigenen Herrscherlinie. Man fürchtet,« fuhr Edward mit schüchternem Flüstern und hastigem Seitenblicke fort, »dieses unglückliche Weib sey von jeher den Gebräuchen ihrer heidnischen Vorfahren weit mehr als denen der heiligen Kirche zugethan gewesen, und es gibt Leute, welche behaupten, daß sie auf diese Weise von einem Zauberer oder gar von dem Bösen selbst Geheimnisse erlangt habe, denen der Rechtschaffene in seiner Frömmigkeit ausweichen muß. Nichts desto weniger laßt uns lieber hoffen, daß ihr Gemüth von den erlittenen Unglücksfällen etwas verwirrt ist.«
Der König seufzte und der Herzog nicht minder, aber der Seufzer des Letzteren verkündete blos dessen Ungeduld. Er warf einen wilden sengenden Blick auf die stolze Gestalt der Prophetin zurück, die man noch immer durch die Waldöffnungen gewahrte, und sagte in düsterm Tone:
»Von königlichem Geblüt; doch hat diese Wodanshexe hoffentlich keine Söhne oder Verwandte, welche auf den Thron der Sachsen Anspruch machen?«
»Sie ist eine Sippe von Godwins Weibe Githa, und das eben ist ihre gefährlichste Verwandtschaft,« gab der König zur Antwort; »denn der verbannte Earl machte, wie Du weißt, keinen Anspruch auf den Thron, sondern begnügte sich mit nichts Geringerem als mit der Regierung unsers ganzen Volkes.«
Der König fuhr dann fort, eine Skizze von Hilda’s Geschichte zu entwerfen; allein seine Erzählung war eben sowohl durch seine abergläubischen Vorurtheile, wie durch seine unvollkommene Kenntniß aller Hauptereignisse und Charaktere in seinem eigenen Königreiche dermaßen entstellt, daß wir es wagen müssen, seine Aufgabe auf uns zu nehmen, und während der königliche Zug durch Wälder und Matten weiter zieht, aus unsern besondern Geschichtsquellen in aller Kürze die Chronik von Hilda, der skandinavischen Vala, zu erzählen.
Zweites Kapitel.
Ein prächtiger Menschenstamm waren doch jene Kriegssöhne aus dem alten Norden, welche unsere Volksgeschichten, die in ihren Berichten über dieses Zeitalter so oberflächlich verfahren, unter dem gemeinsamen Namen der Dänen begreifen. Sie haben allerdings die Nationen, über welche sie hinfegten, in abermalige Barbarei zurückversenkt; aber aus dieser Barbarei haben sich durch sie die edelsten Elemente der Civilisation erhoben. Schweden, Norweger und Dänen zeigten, von Weitem gesehen, trotz aller Verschiedenheit in unwesentlicheren Punkten, bei näherer Prüfung doch einen gemeinsamen Charakter; sie besaßen dieselbe wunderbare Thatkraft, dieselbe Leidenschaft für persönliche und bürgerliche Freiheit, dieselben glänzenden Irrthümer im Durste nach Ruhm und im Punkte der Ehre, und vor Allem als Hauptursache der Civilisation dieselbe bewundernswerthe Biegsamkeit und Geschmeidigkeit in der Vermischung mit den überwundenen Völkerschaften. Gerade dieser Zug bildet ihren eigentlichen Unterschied von den halsstarrigen Celten, welche jede Vermischung zurückweisen, jede Verbesserung verachten.
»Frankes li Archeveske li Dus Rou bauptiza.«13
(Frankes, der Erzbischof, taufte Rolfganger.)
Und kaum ein Jahrhundert später waren die Abkömmlinge dieser furchtbaren Heiden, welche weder Priester noch Altar verschont hatten, die gefürchtetsten Vertheidiger der christlichen Kirche; ihre alte Sprache war bis auf wenige Ueberbleibsel in dem Städtchen Bayeux vergessen, ihre alterthümlichen Namen14, mit Ausnahme weniger der Edelsten, in französische Titel umgeschaffen, und unter den Künsten und Sitten der Franko-Normannen war ihnen fast nichts als die unbezähmbare Tapferkeit der Skandinavier als unzerstörbares Vermächtniß übrig geblieben.
Ebenso waren ihre verwandten Stämme, die sich um zu rauben und zu zerstören über Angelsachsen ergossen hatten, sobald sie von Alfred dem Großen eine dauernde Heimath erlangt hatten, vielleicht der mächtigste und nach kurzer Zeit nicht der wenigst patriotische Theil der angelsächsischen Bevölkerung geworden.«15 Zur Zeit des Anfangs unserer Erzählung hatten sich diese Nordmänner unter dem gemeinsamen Namen der Dänen in nicht weniger als fünfzehn16 englischen Grafschaften friedlich niedergelassen und auch noch jenseits der Grenzen dieser Grafschaften, welche den unterscheidenden Namen Danelagh führten, waren ihre Edlen in Dörfern und Städten vielfach vertreten. Besonders zahlreich waren sie in London, in dessen Umkreise sie ihren eigenen Begräbnißplatz hatten, während die Hauptmunicipalbehörde dieser Stadt von ihnen den Namen der Hustings17 erhielt. Ihr Einfluß in der Nationalversammlung des Witan hatte die Wahl der Könige entschieden, und so hatten sich diese einst so unruhigen Eroberer mit geringen Ausnahmen in Dialekt und Gesetzen mit dem eingebornen Stamme18 auf freundschaftlichem Wege amalgamirt. Noch bis auf den heutigen Tag besteht der Landadel, die Kaufleute und Pächter in mehr als einem Drittel von England, und gerade in den Grafschaften, welche, wie allgemein anerkannt wird, an der Spitze des Fortschritts stehen, aus den Abkömmlingen dieser alten Wikinger, die sich früher mit sächsischen Müttern vermählten. Ueberhaupt existirte zwischen den normännischen Rittern aus den Zeiten Heinrichs I. und dem sächsischen Than aus Norfolk und York nur sehr wenig Unterschied der Raçe; beide waren von mütterlicher Seite fast ausschließlich Sachsen, während sie von der väterlichen in der Regel dem skandinavischen Stamme angehörten.
So allgemein auch dieser Charakter der Schmiegsamkeit verbreitet war, so ergaben sich doch mit Nothwendigkeit einzelne Ausnahmen, und ihre Hartnäckigkeit stand in demselben Verhältniß, je nachdem sie dem alten heidnischen Glauben anhingen, oder zu aufrichtigen Christen bekehrt waren. Die norwegischen Chroniken und einzelne Stellen unserer eigenen Geschichte beweisen, wie falsch und hohl die angenommene Christlichkeit bei vielen dieser wilden Odinsverehrer war. Sie ließen sich zwar bereitwillig die äußern Zeichen der Taufe gefallen, aber das heilige Wasser vermochte nur wenig an dem innern Menschen zu ändern. Selbst Harold, Canuts Sohn, kaum siebzehn Jahre vor dem Datum unserer Erzählung, lebte und regierte als einer »der den Christenglauben abgeschworen«, weil er nicht im Stande war, von dem Erzbischof zu Canterbury, der sich der Sache seines Bruders Hardicanut angenommen hatte, die königliche Einsegnung zu erhalten.19
Die Priester waren besonders auf dem skandinavischen Continent gar oft genöthigt, bei ihren grimmigen Convertiten zu gewissen Gewohnheiten, wie z. B. schrankenloser Vielweiberei, ein Auge zuzudrücken. Zu Ehren Odins Pferdefleisch zu essen und Weiber ad libitum zu heirathen — das waren die Hauptbedingungen der Neubekehrten, und die verlegenen Mönche, gar oft mit Gewalt zur Wahl getrieben, gaben in dem Punkte der Weiber nach, um desto bestimmter auf der wichtigeren Bedingung des Pferdefleisches zu bestehen.
Mit ihrer neuen Religion, welche, auch wenn sie sie ächt empfingen, nur sehr unvollkommen von ihnen verstanden wurde, behielten sie das ganze Heer heidnischen Aberglaubens, das sich immer mit den hartnäckigsten Instinkten in der Menschenbrust zu verkitten pflegt. Noch kurz vor der Regierung des Bekenners waren die Gesetze des großen Canuts gegen Hexenkunst und Zauberei, gegen Anbetung von Steinen, Quellen, Eschen- und Ulmenrunen und die Huldigungsgesänge für die Todten offenbar mehr auf die frischen dänischen Bekehrten, als auf die Angelsachsen, die schon seit Jahrhunderten unterjocht, mit Leib und Seele an die Herrschaft der christlichen Mönche gefesselt waren.
Hilda, eine Tochter aus dem dänischen Königshause und Base Githa’s, der Nichte Canuts, welche dieser König an Godwin in zweite Ehe gegeben hatte, war ein Jahr nach Canuts Thronbesteigung mit einem trotzigen Jarl, ihrem Gemahl, nach England herübergekommen — beide dem Namen nach bekehrt, aber insgeheim noch Anhänger von Thor und Odin.
Hilda’s Gatte war in einem der Seekriege zwischen Canut und dem heiligen Olaf, König von Norwegen, auf den nördlichen Meeren gefallen. Jener Heilige selbst war, nebenbei bemerkt, ein äußerst grausamer Verfolger des ursprünglichen Landesglaubens, der sich aber dabei nicht nehmen ließ, sein heidnisches Vorrecht, die häuslichen Neigungen über die strenge Grenze, nach der sie sich auf ein einziges Weib hätten beschränken sollen, auf mehrere auszudehnen — durch die Praxis zu bewähren, wie denn auch sein natürlicher Sohn Magnus nach ihm auf dem dänischen Throne saß. Der Jarl starb, wie er sichs nie anders gewünscht hatte — als der Letzte an Bord seines Schiffes, mit der tröstenden Ueberzeugung, daß die Walkyren ihn nach Walhalla hinübertragen würden.
Hilda überlebte ihn mit einer einzigen Tochter, welche Canut an Ethelwolf, einen sächsischen Earl von großen Gütern, verheirathete, der seine Abkunft von Penda, jenem alten Könige von Mercia ableitete, der sich durchaus nicht bekehren lassen wollte, aber dabei vorsichtig bemerkte: er habe nichts dawider, wenn seine Nachbarn Christen würden, wofern sie jene Friedsamkeit und Versöhnlichkeit, welche nach der Aussage der Mönche die Elemente des Glaubens bildeten, auch wirklich ausüben wollten. Ethelwolf fiel in Hardicanuts Ungnade, vielleicht weil er mehr sächsisch als dänisch gesinnt war; der wilde König wagte jedoch nicht, ihn offen vor den Witan zu stellen, gab aber geheime Befehle, wonach er an seinem eigenen Herde und in den Armen seines Weibes, welche kurz darauf vor Schreck und Kummer starb, abgeschlachtet wurde. Auf diese Weise kam Editha, die einzige Waise dieses unglücklichen Paares, unter Hilda’s Vormundschaft.
Es war ein nothwendiger und unschätzbarer Charakterzug eben jener Geschmeidigkeit, wodurch die Dänen sich auszeichneten, daß sie auf das Land, worin sie sich niederließen, all’ die Liebe übertrugen, womit sie früher das ihrer Vorfahren umfaßt hatten. So war auch Hilda, so weit es ihre Anhänglichkeit an den Boden betraf, im Herzen fast eben so gut zur Engländerin geworden, wie wenn sie zwischen den Hügeln und Matten geboren und aufgewachsen wäre, aus denen der Rauch ihres Herdes durch das alte römische Impluvium emporstieg.
Sonst aber war sie durchaus Dänin: Dänin in Glauben und Gewohnheiten — Dänin in ihrer tiefen brütenden Einbildungskraft — in der Poesie, die ihre Seele füllte, die die Luft mit Gespenstern bevölkerte und die Blätter der Bäume mit Zauber bedeckte. Bei der strengen Einsamkeit, in der sie nach dem Tode ihres Herrn lebte, für den sie die ergebene aber heroische Liebe eines skandinavischen Weibes gehegt, hatte sich ihre Seele mit jedem Jahre, jedem Tage mehr und mehr den Traumgesichten einer unbekannten Welt zugewendet, wie sie die Gefährten des Grames und der Einsamkeit in jedem Glauben heraufzubeschwören pflegen.
Die Zauberei hatte im skandinavischen Norden verschiedene Formen und war an verschiedene Grade gebunden. Da war die alte verwitterte Hexe, wie man sie in unserem späteren Mittelalter vorzugsweise schilderte; da war das furchtbare Zauberweib oder die Wolfhexe, welche gleich den Schicksalsschwestern im Macbeth menschlicher Geburt und Attribute gänzlich entkleidet scheint — Geschöpfe, welche Nachts in die Häuser drangen und die Krieger erfaßten, um sie zu verschlingen, und die man mit dem Gerippe des Riesenwolfs, welcher Blut aus seinen gewaltigen Kinnbacken träufelte, über das Meer gleiten sah — endlich die friedlichere klassische, aber doch furchtbare Vala oder Sibylle, welche, von Häuptlingen und Nationen geehrt, die Zukunft voraussagte und den Helden ihre Thaten anzurathen pflegte. Von letzteren wird uns in den Norsa-Chroniken gar Vieles erzählt: sie waren oft von hohem Rang und Reichthum, von zahlreichem Gefolge ihrer Hausmägde und Diener begleitet — Könige führten sie auf den Ehrenplatz in der Halle, wenn Rath von ihnen verlangt wurde, und ihre Häupter waren heilig wie die der Diener der Götter.
Diese letztere Stellung in dem gräßlichen Reiche der Wiglaer (Zauberlehrer) geziemte natürlicherweise dem hohen Range und der stolzen, aber blinden und verkehrten Seele der Tochter jener Kriegerkönige. Jede Ausübung ihrer Kunst, der sie sich seit langen Jahren gewidmet hatte, im Interesse des niedrigen Schicksals pöbelhafter Leute verschmähte Odins20 Kind in hoher Verachtung: ihre Träumereien waren auf das Schicksal der Könige und ihrer Reiche gerichtet; sie wollte solche Dynastien retten, oder erheben, welche über die noch ungeborenen Geschlechter regieren sollten. In ihrer Jugend stolz und ehrgeizig — was ein gemeinsamer Fehler nordischer Frauen ist — brachte sie bei dem Eintritte in die dunklere Welt all’ jene Vorurtheile und Leidenschaften mit sich, welche sie schon in der früheren sonnebeleuchteten Hälfte ihres Lebens gekannt hatte.
Alle ihre menschlichen Neigungen concentrirten sich in ihrer Enkelin Editha, dem letzten Sprößling zweier königlichen Stämme. Ihre Nachforschungen über die Zukunft hatten sie versichert, daß Leben und Tod des schönen Kindes mit den Geschicken eines Königs verwebt seyen, und das nämliche Orakel hatte auf eine geheimnißvolle unauflösliche Verbindung ihres eigenen zertrümmerten Hauses mit dem blühenden Geschlechte Earl Godwin’s, des Gemahls ihrer Base Githa, hingedeutet, so daß sie mit der großen Familie, sowohl durch die Bande des Aberglaubens, wie durch Blutsverwandtschaft aufs Innigste verknüpft war. Godwin’s Erstgeborener Sweyn war anfänglich ihr Liebling und Augapfel gewesen; auch hatte er sich, der überhaupt in seinem Wesen weit poetischer war als seine Brüder, ihrem Einflusse bereitwillig unterworfen; allein unter all’ seinen Brüdern war — wie wir später sehen werden — Sweyn’s Laufbahn die verderblichste und ungesegnetste, und während der Rest seines Hauses die tiefe entrüstete Theilnahme ganz Englands mit ins Exil nahm, gab es nicht einen einzigen Einwohner, der Sweyn’s Name mit einem »Gott segne ihn!« begleitet hätte.
Den zweiten Sohn Harold dagegen hatte Hilda, sobald er vom Knaben zum Jüngling herangewachsen war, mit noch auffallenderer Vorliebe als früher den älteren Sweyn ausgezeichnet. Sterne und Runen versicherten sie seiner künftigen Größe, und die Talente und Vorzüge des jungen Earls hatten gleich beim Beginn seiner Laufbahn die Genauigkeit dieser Prophezeihung bestätigt. Ihre Theilnahme für Harold wurde um so tiefer, theils weil sie jedesmal, so oft sie die Zukunft über das Loos ihrer Enkelin Editha befragte, dasselbe unverändert an Harolds Schicksal geknüpft fand, theils weil alle ihre Künste noch nicht vermocht hatten, weiter als bis zu einem bestimmten Punkte in ihrer gemeinsamen Zukunft vorzudringen, so daß ihre verwirrte Seele zwischen Schrecken und Hoffnung getheilt blieb. Bis jetzt hatte sie über den kräftigen gesunden Sinn des jungen Earls noch keinerlei Einfluß erlangt, und obwohl er vor seiner Verbannung öfter denn jeder andere von Godwin’s Söhnen nach dem alten Römerhause kam, hatte er immer nur mit stolzer Ungläubigkeit zu ihren vagen Prophezeihungen gelächelt, und alle ihre Anerbieten, ihn mit unsichtbaren Kräften zu unterstützen, mit der ruhigen Antwort zurückgewiesen: »Der Tapfere bedarf keines Zaubers, um ihn zu seiner Pflicht zu ermuthigen, und der Gute verachtet alle Warnungen, die ihn vor deren Erfüllung abschrecken möchten.«
In der That, so wenig auch Hilda’s Magie böswilliger Natur war, und so sehr sie die Quelle ihrer Orakel nicht bei bösen Geistern, sondern in den Göttern ihres Glaubens aufsuchte, so war es doch auffallend, daß Alle, welche ihrem Einfluß gehorchten — nicht allein ihr Gatte und Schwiegersohn (diese Beiden hatten sich ganz von ihrem Rathe leiten lassen), sondern auch andere Häuptlinge, welche ihr Rang oder Ehrgeiz auf ihre Lehre anwies — von einem kläglichen frühzeitigen Ende heimgesucht worden waren.
Nichtsdestoweniger war die Herrschaft, die sie über die Gemüther des Volks gewonnen hatte, so groß, daß es im höchsten Grade gefährlich gewesen wäre, die Verdammungsgesetze wider Zauberei gegen sie in Anwendung zu bringen. In ihr verehrten und schützten nöthigenfalls all’ die mächtigeren dänischen Familien das Blut ihrer alten Könige und die Wittwe eines ihrer gefeierten Helden. Gastlich, freigebig und wohlthätig gegen die Armen, eine gütige Gebieterin über zahlreiche Hörigen, durfte sie gewiß seyn, daß die große Menge — so sehr sie sich auch vor ihr fürchtete — sie dennoch geschützt hätte. Beweise ihrer Kunst wären schwer herzustellen gewesen, da sich alsbald eine Masse von Gewährsmännern zu Zeugen ihrer Unschuld erhoben hätten. Auch wenn man sie einem Gottesgerichte unterworfen hätte, so wäre es ihrem Golde ein Leichtes gewesen, die Priester, durch deren Hülfe einer solchen Gefahr zu entrinnen war, zu bestechen, und mit jener weltlichen Klugheit, deren Personen von Genie auch bei ihren wildesten Excentricitäten nur selten entbehren, hatte sie sich bereits durch reiche Schenkungen an benachbarte Klöster vor der Möglichkeit täthlicher Verfolgung von Seiten der Kirche gesichert.
Kurz, Hilda war eine Frau von erhabenen Absichten und außerordentlichen Gaben, furchtbar nur als passiver Agent der Schicksalsmächte, welche sie anrief, und sonst mehr eine gewisse unklare Bewunderung und räthselhaftes Mitleid für sich beanspruchend — keine teuflische Hexe, an Bosheit und Macht das Menschenvermögen übersteigend, sondern wesentlich menschlich, auch wenn sie noch so sehr das Geheimniß eines Gottes ansprach. Wollen wir auch für den Augenblick annehmen, daß Personen von eigenthümlichem Nervenzustande und Temperament mit Hülfe sehr intensiver Einbildungskraft so tiefe Verwandtschaft mit der übersinnlichen Welt erlangen können, daß der Magnetismus und die Magie alter Zeiten sich nicht gänzlich verwerfen ließe, so war es jedenfalls kein fauler mephitischer Sumpf vom giftigen Nachtschatten überhangen, und verschlossen vor den Strahlen des Himmels, sondern ein lebendiger Strom, auf welchem der Stern zitterte und an dessen Ufern das grüne Gras wogte, den die dämonischen Schatten so schwarz und furchtbar überzogen.