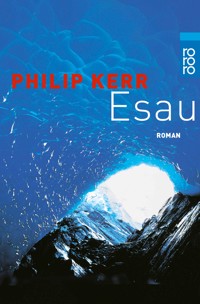9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bernie Gunther ermittelt
- Sprache: Deutsch
Buenos Aires, 1950. Privatdetektiv Bernie Gunther soll für Peróns Geheimpolizei die vermisste Fabienne von Bader ausfindig machen. Bei seiner Suche nach dem fünfzehnjährigen Mädchen stößt er in der Wüste auf ein verlassenes Lager, das seine schlimmsten Befürchtungen weckt. Immer mehr gerät Gunther unter Druck, denn nicht nur die Perónistas sind hinter dem Mädchen her. Zu welchem Schatz ist Fabienne der Schlüssel? Und welche Rolle spielt die schöne Jüdin Anna? Bald steht Gunther im Fadenkreuz der verschiedensten Mächte … «Exzellent! Kerrs Stil macht jede Seite zum Lesevergnügen.» (Publishers Weekly) «Ein glänzender, erfindungsreicher Thriller-Autor.» (Salman Rushdie)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Philip Kerr
Das letzte Experiment
Thriller
Übersetzt von Axel Merz
Über dieses Buch
Buenos Aires, 1950. Privatdetektiv Bernie Gunther soll für Peróns Geheimpolizei die vermisste Fabienne von Bader ausfindig machen. Bei seiner Suche nach dem fünfzehnjährigen Mädchen stößt er in der Wüste auf ein verlassenes Lager, das seine schlimmsten Befürchtungen weckt. Immer mehr gerät Gunther unter Druck, denn nicht nur die Perónistas sind hinter dem Mädchen her. Zu welchem Schatz ist Fabienne der Schlüssel? Und welche Rolle spielt die schöne Jüdin Anna? Bald steht Gunther im Fadenkreuz der verschiedensten Mächte …
«Exzellent! Kerrs Stil macht jede Seite zum Lesevergnügen.» (Publishers Weekly)
«Ein glänzender, erfindungsreicher Thriller-Autor.» (Salman Rushdie)
Vita
Philip Kerr wurde 1956 in Edinburgh geboren. 1989 erschien sein erster Roman «Feuer in Berlin». Aus dem Debüt entwickelte sich die Serie um den Privatdetektiv Bernhard Gunther. Für Band 6, «Die Adlon-Verschwörung», gewann Philip Kerr den weltweit höchstdotierten Krimipreis der spanischen Mediengruppe RBA und den renommierten Ellis-Peters-Award. Kerr lebte in London, wo er 2018 verstarb.
Para el desaparecido
Die Handlung dieses Romans ist frei erfunden. Namen, Personen, Firmen, Organisationen, Orte und Ereignisse sind entweder das Produkt der Phantasie des Autors oder werden zu fiktiven Zwecken benutzt. Jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen, lebenden oder verstorbenen Personen, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
Eins
Buenos Aires 1950
Wir kamen mit der SSSan Giovanni, ein passender Name angesichts der Tatsache, dass mindestens drei der Passagiere – einschließlich mir selbst – bei der SS gewesen waren. Es war ein mittelgroßes Schiff mit zwei Schornsteinen, einer gutausgestatteten Bar und einem italienischen Restaurant. Das war prima, wenn man italienisches Essen mochte, doch nach vier Wochen auf See, seit Genua ständig mit acht Knoten, hatte ich die Nase voll und war alles andere als traurig, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Entweder bin ich kein großartiger Seefahrer, oder irgendetwas anderes stimmte nicht mit mir – abgesehen davon, dass die Gesellschaft mir nicht behagte, in deren Begleitung ich mich in jenen Tagen aufhielt.
Wir fuhren den grauen Río de la Plata hinab in den Hafen von Buenos Aires, und das war für mich und meine beiden Mitreisenden eine Gelegenheit, über die stolze Geschichte unserer heldenhaften deutschen Marine nachzudenken. Irgendwo am Grund des Flusses lag das unbesiegte Wrack des Westentaschenschlachtschiffs Admiral Graf Spee, das von dem eigenen Kommandanten im Dezember 1939 versenkt worden war, um es nicht den Briten zu überlassen. Meines Wissens hatte Argentinien vom Krieg ansonsten nicht viel mitbekommen.
Wir legten im nördlichen Becken direkt am Zollgebäude an. Westlich von uns war eine moderne Stadt mit hohen Betongebäuden zu sehen, hinter den Schienen und Lagerhäusern, Viehhöfen der Stadt Buenos Aires – der Ort, an den sämtliches Vieh der argentinischen Pampa in Zügen herbeigekarrt wurde, um in Massen geschlachtet zu werden. Danach wurde das Frischfleisch tiefgefroren und in die ganze Welt verschifft. Die Fleischexporte hatten das Land reich gemacht, und Buenos Aires wurde zur drittgrößten Stadt, nach New York und Chicago, auf dem amerikanischen Kontinent.
Die drei Millionen Einwohner von Buenos Aires nannten sich porteños – Hafenvolk –, was nett, ja, romantisch klang. Meine beiden Reisebegleiter und ich nannten uns Flüchtlinge, was besser klang als Flüchtige. Doch das waren wir. Zu Recht oder Unrecht – jeden von uns erwartete in Europa die eine oder andere Art von Gerechtigkeit, und unsere vom Roten Kreuz ausgestellten Pässe nannten nicht unsere wahre Identität. Ich war genauso wenig Dr. Carlos Hausner wie Adolf Eichmann Riccardo Klement oder Herbert Kuhlmann Pedro Geller. Das war den Argentiniern egal. Hier scherte sich niemand darum, was wir während des Krieges getan hatten. Und trotzdem mussten wir an jenem kalten, feuchten Wintermorgen im Juli 1950 gewisse Formalitäten einhalten.
Ein Beamter der Passkontrolle und ein Zöllner kamen an Bord unseres Schiffes und stellten Fragen, während jeder Passagier seine Papiere vorlegte. Auch wenn es diesen beiden natürlich vollkommen egal war, wer wir waren und was wir getan hatten, so gaben sie sich große Mühe, so zu tun, als sei das Gegenteil der Fall. Der goldhäutige Passbeamte betrachtete Eichmanns lächerlichen Pass, dann Eichmann selbst, als käme er direkt aus einem Seuchengebiet. Was auch eigentlich der Wahrheit entsprach. Europa erholte sich nur langsam von einer Krankheit namens Nationalsozialismus, die Millionen Todesopfer gefordert hatte.
«Beruf?», fragte der Passbeamte.
Eichmanns Visage zuckte nervös. «Techniker», antwortete er und wischte sich mit einem Taschentuch die Stirn. Es war nicht heiß, doch Eichmann hatte, wie ich schon bemerkt hatte, ein Temperaturempfinden, das sich von dem seiner Mitmenschen unterschied.
Inzwischen hatte sich der Zollbeamte, der wie eine Zigarrenfabrik roch, zu mir gewandt. Seine Nüstern blähten sich, als könnte er das Geld riechen, das ich in meiner Tasche hatte, dann bleckte er seine großen Zähne, wahrscheinlich sollte das ein Lächeln sein. Ich hatte ungefähr dreißigtausend österreichische Schillinge in meiner Tasche, was in Österreich eine Menge Geld war, aber nicht mehr so viel, wenn man es in richtiges Geld umtauschen wollte. Ich ging nicht davon aus, dass der Zöllner das wusste. Meiner Erfahrung nach können Zöllner mehr oder weniger tun, was ihnen beliebt, nur eines nicht: großzügig oder nachsichtig reagieren, wenn sie einen höheren Betrag an ausländischer Währung sehen.
«Was ist in dieser Tasche?», fragte er.
«Kleidung. Toilettenartikel. Ein wenig Geld.»
«Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich selbst einen Blick hineinwerfe?»
«Nein», sagte ich, obwohl ich eine Menge dagegen hatte. «Überhaupt nichts.»
Ich wuchtete meine Tasche auf den langen Tisch und war im Begriff, die Schnallen zu öffnen, als ein Mann die Gangway unseres Schiffes hinaufgeeilt kam. Er rief etwas auf Spanisch und dann auf Deutsch: «Alles in Ordnung. Es tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Lassen Sie die Herren bitte durch. Es hat ein Missverständnis gegeben. Ihre Papiere sind einwandfrei. Ich habe sie schließlich selbst vorbereitet.»
Er sagte noch irgendetwas auf Spanisch über uns drei, unter anderem, dass wir bedeutende Herrschaften aus Deutschland seien, und das Verhalten der beiden Beamten änderte sich augenblicklich. Beide schlugen die Hacken zusammen. Der Passbeamte gab Eichmann seinen Pass zurück und bedachte den meistgesuchten Mann Europas mit einem gereckten Arm, begleitet von einem lauten «Heil Hitler!», das jeder auf Deck gehört haben muss.
Eichmann lief dunkelrot an und zog den Kopf ein wie eine Riesenschildkröte, als würde er am liebsten unsichtbar sein. Kuhlmann und ich lachten lauthals über Eichmanns Verlegenheit, während dieser seinen Pass an sich riss, sich abwandte und die Gangway hinunter und auf den Kai stürmte. Wir lachten immer noch, als wir neben ihm auf der Rückbank einer schwarzen amerikanischen Limousine saßen. Auf einem Schild an der Windschutzscheibe stand: VIANORD.
«Ich finde das überhaupt nicht lustig!», sagte Eichmann.
«Das denke ich mir», erwiderte ich. «Gerade das macht es ja für uns so witzig.»
«Sie hätten Ihr Gesicht sehen sollen, Riccardo», sagte Kuhlmann. «Was um alles in der Welt mag in diesen Kerl gefahren sein, dass er Sie mit dem Hitlergruß begrüßt? Ausgerechnet Sie!» Kuhlmann prustete erneut los. «Heil Hitler, du meine Güte!»
«Ich fand, dass er das ziemlich gut hingekriegt hat», warf ich ein. «Für einen Amateur.»
Unser Gastgeber, der auf dem Fahrersitz Platz genommen hatte, wandte sich nun um und schüttelte uns reihum die Hand. «Bitte entschuldigen Sie diesen Zwischenfall», sagte er zu Eichmann. «Einige dieser Beamten zeichnen sich nicht durch übermäßige Intelligenz aus. Tatsächlich haben wir sogar ein und dasselbe Wort für Schweine und öffentliche Bedienstete: chanchos. Wir nennen beide chanchos. Es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn dieser Idiot glaubt, dass Hitler immer noch der deutsche Führer ist.»
«Mein Gott, ich wünschte, es wäre so!», murmelte Eichmann und verdrehte die Augen zum Wagenhimmel. «Ich wünschte sehr, er wäre es noch.»
«Mein Name ist Horst Fuldner», stellte sich unser Gastgeber vor. «Meine Freunde in Argentinien nennen mich Carlos.»
«Wie klein doch die Welt ist», bemerkte ich. «Genauso nennen mich meine Freunde in Argentinien auch. Alle beide.»
Ein paar Leute kamen die Gangway hinunter und spähten neugierig durch das Beifahrerfenster, um einen Blick auf Eichmann zu werfen.
«Können wir von hier verschwinden?», fragte er. «Bitte.»
«Wir tun besser, was er sagt, Carlos», sagte ich. «Bevor jemand unseren Riccardo hier erkennt und David Ben Gurion alarmiert.»
«Sie würden bestimmt keine Witze darüber machen, wenn Sie in meiner Haut steckten!», schimpfte Eichmann. «Die würden alles geben, um mich in die Finger zu kriegen, und dann hat mein letztes Stündlein geschlagen!»
Fuldner ließ den Motor an, und Eichmann entspannte sich merklich, als wir langsam davonfuhren.
«Da Sie gerade davon sprechen – wir sollten vielleicht kurz darüber reden, was Sie tun, falls jemand Sie erkennt», sagte Fuldner.
«Niemand wird mich erkennen», sagte Kuhlmann. «Abgesehen davon sind es die Kanadier, die mich suchen, nicht die Juden.»
«Ist kein Unterschied», sagte Fuldner. «Ich sage es trotzdem. Nach den Spaniern und den Italienern sind die Juden die größte ethnische Gruppe im Land. Nur, dass wir sie los Russos nennen, weil die meisten von ihnen vor dem Pogrom des russischen Zaren hierher geflüchtet sind.»
«Welchem Pogrom?», fragte Eichmann.
«Wie meinen Sie das?»
«Es gab drei Pogrome», erläuterte Eichmann. «Das erste 1821, dann eins zwischen 1881 und 1884 und schließlich das dritte, das 1903 anfing. Das Kischinew-Pogrom.»
«Riccardo weiß alles über die Juden», sagte ich. «Außer, wie man sie freundlich behandelt.»
«Ich denke, das letztere Pogrom», sagte Fuldner.
«Würde passen», sagte Eichmann, ohne auf meine Bemerkung einzugehen. «Das Kischinew-Pogrom war das radikalste.»
«Da kamen die meisten Juden nach Argentinien. Allein hier in Buenos Aires lebt eine Viertelmillion. Sie wohnen in drei Bezirken, aus denen Sie sich unbedingt fernhalten sollten: Villa Crespo, Belgrano und Once. Wenn Sie vermuten, dass man Sie erkannt hat, verlieren Sie nicht den Kopf. Machen Sie keine Szene. Bewahren Sie Ruhe. Die Polizei in diesem Land ist langsam und nicht sonderlich hell. Wie der chancho auf dem Schiff vorhin. Wenn es Ärger gibt, dann wird man Sie genauso verhaften wie den Juden, der Sie erkannt haben will.»
«Dann besteht wohl keine große Aussicht auf ein Pogrom hier?», bemerkte Eichmann.
«Gütiger Himmel, nein!», antwortete Fuldner.
«Gott sei Dank», sagte Kuhlmann. «Ich habe die Nase voll von all diesem Irrsinn.»
«Wir hatten nichts mehr in dieser Art seit der sogenannten Tragischen Woche. Die Anarchisten, wissen Sie? Das war 1919.»
«Anarchisten, Bolschewiken, Juden, das ist doch alles das Gleiche!», sagte Eichmann, der für seine Verhältnisse ungewöhnlich gesprächig war.
«Während des Krieges gab es eine Verordnung von der Regierung, die jegliche jüdische Emigration nach Argentinien verbot. Doch die Dinge haben sich inzwischen wieder geändert. Die Amerikaner haben Perón unter Druck gesetzt, die argentinische Politik gegenüber den Juden aufzuweichen und ihnen zu gestatten, hierher zu kommen und sich niederzulassen. Es würde mich nicht überraschen, wenn auf Ihrem Schiff zahlreiche Juden gewesen wären.»
«Was für ein tröstlicher Gedanke», sagte Eichmann.
«Keine Sorge», beeilte sich Fuldner zu sagen. «Sie sind ziemlich sicher hier. Die porteños scheren sich einen Dreck um das, was in Europa passiert ist, und die Juden interessieren sie noch weniger. Abgesehen davon glaubt niemand auch nur die Hälfte dessen, was die englischen Zeitungen und Wochenschauen verbreiten.»
«Die Hälfte wäre schon schlimm genug», murmelte ich. Jetzt wechselten sie hoffentlich ihr Thema, denn die Unterhaltung gefiel mir gar nicht. Ich mochte Eichmann immer weniger leiden. Obwohl er in den letzten vier Wochen so gut wie kein Wort gesprochen und seine abscheulichen Ansichten für sich behalten hatte. Um eine endgültige Meinung über Carlos Fuldner zu haben, war es noch zu früh.
Nach seinem pomadisierten Hinterhaupt zu urteilen, mochte Fuldner um die vierzig sein. Sein Deutsch war fließend, doch seine Aussprache ein wenig zu weich. Um die Sprache Goethes und Schillers korrekt zu sprechen, muss man seine Stimmbänder wohl mit dem Bleistiftspitzer schärfen. Fuldner redete jedenfalls gern, das war klar. Er war weder groß noch klein, weder sah er besonders gut aus, noch war er hässlich. Er war ziemlich gewöhnlich. Ein gewöhnlich aussehender Mann in einem guten Anzug mit guten Manieren und gepflegten Händen. Ich konnte sein Gesicht noch einmal länger betrachten, als wir an einer Kreuzung hielten und er sich umdrehte, um uns Zigaretten anzubieten. Sein Mund war breit und sinnlich, seine Augen blickten träge, doch intelligent, und seine Stirn war so hoch wie ein Kirchendach. Wenn es darum gegangen wäre, die Rollen in einem Spielfilm zu besetzen, hätte er den Priester gespielt oder einen Anwalt. Oder vielleicht auch einen Hotelmanager. Er schnippte eine Dunhill aus der Packung und steckte sie an, dann begann er, ein wenig von sich selbst zu erzählen. Das war auch ganz gut. Weil es nicht mehr um Juden ging, verlor Eichmann rasch das Interesse und starrte gelangweilt aus dem Fenster. Ich hingegen bin ein Mensch, der höflich zuhört, wenn sein Erretter Geschichten über sich selbst erzählt. Deshalb hatte meine Mutter mich damals zur Sonntagsschule geschickt.
«Ich wurde hier in Buenos Aires als Kind deutscher Einwanderer geboren», begann Fuldner. «Für eine Weile gingen wir zurück nach Deutschland, nach Kassel, wo ich zur Schule ging. Nach der Schule habe ich in Hamburg gearbeitet. Ab 1932 war ich bei der SS und wurde Hauptsturmführer, bevor man mich in den SD, den Sicherheitsdienst der SS, versetzte und auf eine geheimdienstliche Mission nach Argentinien schickte. Seit dem Krieg haben ich und ein paar andere VIANORD ins Leben gerufen, ein Reisebüro mit dem Zweck, unseren alten Kameraden bei der Flucht aus Europa behilflich zu sein. Selbstverständlich wäre das alles nicht möglich ohne direkte Hilfe vom Präsidenten und seiner Frau Eva. Während Evitas Reise nach Rom zum Papst im Jahr 1947 begriff sie, dass es notwendig war, Männern wie Ihnen einen neuen Start ins Leben zu ermöglichen.»
«Dann gibt es also doch einen gewissen Antisemitismus im Land?», bemerkte ich.
Kuhlmann und Fuldner lachten, Eichmann hingegen blieb stumm.
«Es tut gut, wieder unter Deutschen zu sein», sagte Fuldner. «Humor ist keine herausragende Eigenschaft der Argentinier. Sie sind viel zu sehr auf ihre Würde bedacht, um auch mal zu lachen, vor allem über sich selbst.»
«Klingt, als wären sie Faschisten», sagte ich.
«Das ist eine andere Sache. Der Faschismus hier ist kein echter. Die Argentinier haben weder den Willen noch die Neigung, anständige Faschisten zu sein.»
«Vielleicht gefällt es mir hier am Ende ja doch ganz gut», sagte ich.
«Also wirklich!», rief Eichmann.
«Glauben Sie mir, Herr Fuldner», sagte ich. «Ich bin nicht ganz so politisch wie unser Freund hier mit der Fliege und der dicken Brille, das ist alles. Er verleugnet die Wirklichkeit immer noch. Hat mit allen möglichen Dingen zu tun. Soweit ich weiß, klammert er sich noch immer an die Vorstellung, dass das Dritte Reich tausend Jahre überdauern wird.»
«Sie meinen das ernst, nicht wahr?»
Kuhlmann kicherte.
«Müssen Sie über alles Witze machen, Hausner?» Eichmanns Tonfall war gereizt.
«Ich mache lediglich Witze über Dinge, die mir als witzig erscheinen», entgegnete ich. «Ich würde nicht im Traum daran denken, über etwas wirklich Wichtiges Witze zu machen. Nicht, wenn ich riskiere, Sie damit zu ärgern, Riccardo.»
Ich spürte Eichmanns Blicke, und als ich mich zu ihm wandte und ihn ansah, kniff er die Lippen zusammen. Für einen Moment starrte er mich feindselig an.
«Was machen Sie eigentlich hier, Herr Dr. Hausner?», fragte er.
«Das Gleiche wie Sie, Riccardo. Ich sehe zu, dass ich Land gewinne.»
«Aber warum? Warum? Sie verhalten sich nicht wie ein Nazi.»
«Ich bin von der Beefsteak-Sorte. Braun auf der Außenseite, aber innen ziemlich rot.»
Eichmann starrte aus dem Fenster, als ertrüge er meinen Anblick nicht eine Sekunde länger.
«Ich könnte ein gutes Steak vertragen», murmelte Kuhlmann.
«Dann sind Sie hier genau richtig», sagte Fuldner. «In Deutschland ist ein Steak ein Steak, aber bei uns in Argentinien ist es eine patriotische Bürgerpflicht.»
Wir fuhren immer noch durch Hafengebiet. Die meisten Namen auf den Lagerhäusern und Öltanks waren britisch oder amerikanisch: Oakley & Watling, Glasgow Wire, Wainwright Brothers, Ingham Clark, English Electric, Crompton Parkinson, Western Telegraph. Vor einem hohen offenen Lagerhaus weichten heuballengroße Berge Zeitungsdruck im Nieselregen des frühen Morgens auf. Fuldner lachte und zeigte darauf.
«Dort», sagte er beinahe triumphierend. «Das ist Perónismus in Aktion. Perón zensiert die oppositionelle Presse nicht oder verhaftet ihre Herausgeber. Er verhindert nicht einmal, dass sie ihre Zeitungen drucken. Er stellt lediglich sicher, dass die Zeitungen nicht mehr lesbar sind, wenn sie bei den Lesern ankommen. Verstehen Sie – Perón hat sämtliche großen Gewerkschaften auf seiner Seite. Das ist argentinischer Faschismus, wie er leibt und lebt.»
Zwei
Buenos Aires 1950
Buenos Aires sah aus und roch auch wie jede europäische Großstadt vor dem Krieg. Während wir durch die geschäftigen Straßen fuhren, kurbelte ich die Scheibe nach unten und atmete euphorisch in tiefen Zügen den Duft draußen ein, die Abgase, den Zigarettenrauch, den Duft nach Kaffee und teurem Parfum, gebratenem Fleisch, frischen Früchten, Blumen und Geld. Es war wie die Rückkehr zur Erde nach einer Reise ins Weltall. Deutschland mit den Lebensmittelrationierungen, den Kriegsschäden und der ganzen Schuld, den alliierten Tribunalen schien Millionen Kilometer entfernt. In Buenos Aires herrschte dichter Verkehr, weil es jede Menge Benzin gab. Die Bevölkerung hatte keine Sorgen, man war gut gekleidet und gut genährt, weil es in den Läden Kleidung und Essen gab. Buenos Aires war alles andere als Provinz. Es war beinahe wie eine Rückkehr in die belle epoque. Beinahe.
Unser Unterschlupf befand sich in der Calle Monasterio 1429 im Bezirk Florida. Fuldners Worten zufolge war Florida einer der schicksten Stadtteile von Buenos Aires, doch das hätte man nicht vermutet, wenn man unser Versteck sah. Von außen war das Haus hinter den riesigen Pinien nicht zu sehen, und von der Straße hätte man nicht vermutet, dass auf dem Grundstück überhaupt ein Haus stand. Drinnen angekommen, war dann klar, dass dort tatsächlich eines stand – und man wünschte sich augenblicklich, es wäre nie gebaut worden, so hässlich war es. Die Küche war heruntergekommen, die Deckenventilatoren waren rostig. Die Wände, ursprünglich wohl mal weiß, waren heute gelb, und das Mobiliar sah aus, als versuchte es, zur Natur zurückzukehren. Giftig, halb verrottet, von Schimmel heimgesucht.
Man führte mich zu einem Zimmer mit einer gebrochenen Fensterlade, einem verdächtig aussehenden Teppich und einem Messingbett mit einer Matratze, die so dünn war wie eine Scheibe Roggenbrot und ungefähr genauso komfortabel. Durch das schmutzige, spinnwebverhangene Fenster sah ich hinaus in einen Garten, der überwuchert war von Jasmin, Farnen und wilden Reben. Es gab einen kleinen Brunnen, der allem Anschein nach schon seit einer ganzen Weile nicht mehr funktionierte: Direkt unter dem kupfernen Wasserhahn hatte eine Katze ein Lager für ihre Jungen gebaut. Doch es war nicht alles schlecht. Wenigstens hatte ich mein eigenes Badezimmer. Die Wanne war zwar voll mit alten Büchern, was aber ja nicht bedeutete, dass ich kein Bad nehmen konnte. Ich lese gern, wenn ich in der Wanne sitze.
Ein weiterer Deutscher wohnte bereits hier. Sein Gesicht war rot und aufgedunsen, und er hatte Tränensäcke unter den Augen, die so groß waren wie die Hängematte eines Schiffskochs. Sein Haar war strohblond und struppig, er selbst dünn und hatte überall Narben, die offenbar von Schusswunden kamen. Er trug nur die übelriechenden Überreste eines Morgenmantels über einer Schulter wie eine Toga. Seine Beine waren übersät von Krampfadern, so dick wie Eidechsen. Er schien von der stoischen Sorte, die in einem Fass schlief, allerdings steckte eine Schnapsflasche in seiner Manteltasche, und das Monokel in seinem Auge verlieh ihm einen Hauch von Eleganz und Vornehmheit.
Fuldner stellte ihn uns als Fernando Eifler vor, doch ich ging davon aus, dass dies nicht sein richtiger Name war. Wir lächelten alle drei höflich und dachten das Gleiche: Wenn wir zu lange hier blieben, würden wir enden wie Fernando Eifler.
«Hätte einer der Herren vielleicht eine Zigarette?», fragte Eifler. «Meine sind wohl ausgegangen.»
Kuhlmann gab ihm eine und bot ihm zugleich Feuer an, während sich Fuldner für die erbärmliche Unterkunft entschuldigte und erklärte, dass wir nur für ein paar Tage hier bleiben würden. Eifler sei nur deswegen immer noch da, weil er jede Arbeit abgelehnt habe, die die DAIE ihm angeboten hatte, die Organisation, die uns nach Argentinien gebracht hatte. Sein Ton war nüchtern und keineswegs vorwurfsvoll, doch unser Hausgenosse regte sich gleich auf.
«Ich bin nicht um die halbe Welt gefahren, um zu arbeiten!», sagte Eifler mürrisch. «Für wen halten Sie mich? Ich bin ein deutscher Offizier und Gentleman und kein verdammter Bankangestellter! Ehrlich, Fuldner, das ist zu viel verlangt. Niemand drüben in Genua hat ein Wort davon gesagt, dass ich arbeiten muss, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen! Ich wäre niemals hergekommen, wenn ich gewusst hätte, dass Sie von mir erwarten, mir meinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen! Ich meine, es ist schlimm genug, dass ich den Familienstammsitz verlassen musste – auch ohne die zusätzliche Demütigung, mich irgendeinem Vorgesetzten unterordnen zu müssen.»
«Vielleicht hätten Sie es vorgezogen, sich von den Alliierten aufhängen zu lassen, Herr Eifler?», fragte Eichmann.
«Ein amerikanischer Galgen oder ein argentinisches Halsband», entgegnete Eifler. «Das ist kein großer Unterschied für einen Mann meiner Herkunft. Offen gestanden, ich hätte mich lieber von den Popovs erschießen lassen, als mich jeden Morgen um neun Uhr an einen Schreibtisch zu setzen und zu arbeiten. Es ist einfach unzivilisiert.» Er lächelte Kuhlmann verkniffen zu. «Danke sehr für die Zigarette. Und ach so: Willkommen in Argentinien. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, die Herrschaften.» Er verneigte sich steif, humpelte in sein Zimmer und schloss hinter sich die Tür.
Fuldner zuckte die Schultern. «Manche haben größere Schwierigkeiten, sich anzupassen, als andere. Ganz besonders Aristokraten wie Fernando Eifler.»
«Hätte ich mir denken können», rümpfte Eichmann die Nase.
«Ich lasse Sie und Herrn Geller jetzt allein, damit Sie sich einrichten können», sagte er zu Eichmann. Dann blickte er mich an. «Herr Hausner, Sie haben gleich jetzt einen Termin.»
«Ich?»
«Ja. Wir fahren zur Polizeiwache nach Moreno», sagte er. «Zur Registrierung ausländischer Personen. Sämtliche Neuankömmlinge müssen sich dort melden, um eine cedula di identitad zu erhalten. Ich darf Ihnen versichern, es ist lediglich eine Routineangelegenheit, Herr Dr. Hausner. Fotografien und Fingerabdrücke und dergleichen. Sie benötigen selbstverständlich alle diesen Ausweis, damit Sie arbeiten dürfen, doch wir müssen ein wenig vorsichtig sein, deshalb ist es besser, wenn Sie nicht alle am selben Tag auf dem Amt vorsprechen.»
Als wir zum Wagen gingen, sagte Fuldner, dass zwar tatsächlich alle Neuankömmlinge diese cedula von der örtlichen Polizeiwache benötigten – doch dass wir nicht dorthin fahren würden.
«Ich brauchte schließlich einen Vorwand», sagte er. «Ich konnte auf keinen Fall sagen, wohin wir wirklich fahren, ohne die anderen zu kränken.»
«Das wollen wir ganz bestimmt nicht, nein», sagte ich, als ich in den Wagen stieg.
«Und bitte sagen Sie nach unserer Rückkehr um Himmels willen nicht, wo wir gewesen sind. Dank Eifler gibt es bereits genug Verstimmung in diesem Haus.»
«Selbstverständlich. Es bleibt unser kleines Geheimnis.»
«Sie machen Witze», sagte Fuldner und ließ den Motor an. Wir fuhren los. «Aber ich bin derjenige, der als Letzter lacht, wenn Sie erst mal sehen, wohin wir fahren.»
«Sagen Sie mir nicht, dass man mich jetzt schon wieder deportiert.»
«Nein, nichts dergleichen. Wir haben einen Termin beim Präsidenten.»
«Juan Perón will mich sehen?»
Fuldner lachte. Ich schätze, ich muss ziemlich dumm dreingesehen haben.
«Warum die Ehre? Habe ich einen bedeutenden Preis gewonnen? Der schlaueste Nazi-Neuankömmling in Argentinien?»
«Glauben Sie es oder nicht, Perón begrüßt eine Menge deutscher Offiziere persönlich, die hier in Argentinien eintreffen. Er mag Deutschland und die Deutschen sehr.»
«Womit er zurzeit wohl ziemlich allein dasteht.»
«Er ist ein Militär, vergessen Sie das nicht.»
«Wahrscheinlich ist das der Grund, weshalb man ihn zum General gemacht hat.»
«Am liebsten trifft er deutsche Ärzte. Peróns Großvater war Arzt. Er wollte selbst Arzt werden, doch stattdessen ging er auf die nationale Militärakademie.»
«Eine Verwechslung, die einem schnell mal passiert», sagte ich. «Menschen umbringen statt Menschen heilen.»
Mein Ton war hart, als ich fortfuhr: «Ich bin mir der großen Ehre bewusst, Carlos. Aber es ist eine Weile her, dass ich mir ein Stethoskop in die Ohren geklemmt habe. Ich hoffe, er erwartet nicht von mir, dass ich ihm ein Heilmittel gegen Krebs präsentiere oder mit ihm über die neuesten Erkenntnisse der Deutschen Medizinischen Gesellschaft plaudere. Schließlich habe ich mich die letzten fünf Jahre in einem Kohlenschuppen versteckt.»
«Entspannen Sie sich», sagte Fuldner. «Sie sind nicht der erste Nazi-Arzt, den ich dem Präsidenten vorstellen muss. Und ich nehme nicht an, dass Sie der letzte sein werden. Die Tatsache, dass Sie Mediziner sind, heißt für Peròn aber, dass Sie gebildet sein müssen und ein Gentleman.»
«Wenn es die Gelegenheit erfordert, weiß ich mich wie ein Gentleman zu benehmen», sagte ich. Ich knöpfte meinen Hemdenkragen zu, straffte meine Krawatte und warf einen Blick auf meine Uhr. «Empfängt er seine Besucher immer zum Frühstück, bei gekochten Eiern?»
«Perón ist in der Regel schon um sieben Uhr in seinem Büro», sagte Fuldner. «Dort drüben. In der Casa Rosada.» Er deutete auf ein grell rosafarbenes Gebäude, das auf der anderen Seite einer mit Palmen und Statuen gesäumten Plaza stand. Es sah aus wie der Palast eines indischen Maharadschas, von dem ich einmal ein Foto in einem Magazin gesehen hatte.
«Rosa», sagte ich. «Schöne Farbe für ein Regierungsgebäude. Wer weiß, vielleicht wäre Hitler noch an der Macht, hätte er seine Reichskanzlei in einer hübscheren Farbe gestrichen anstatt in tristem Grau.»
«Es gibt einen Grund, warum das Gebäude rosa ist», sagte Fuldner.
«Erzählen Sie ihn mir bitte nicht. Es hilft mir dabei, mich zu entspannen, wenn ich mir Perón als die Sorte von Präsident vorstellen kann, die Rosa mag. Glauben Sie mir, Carlos, das ist wirklich sehr beruhigend.»
«Das erinnert mich an etwas. Sie haben einen Scherz gemacht, von wegen, Sie wären ein Roter. Stimmt das?»
«Ich war fast zwei Jahre in einem sowjetischen Gefängnis, Carlos. Was denken Sie?»
Er fuhr um das Gebäude herum zu einem Seiteneingang und zeigte dem Wachposten an der Schranke eine Sicherheitsplakette, bevor wir auf einen zentralen Innenhof kamen. Vor einer kunstvollen Marmortreppe standen zwei Grenadiere mit hohen Kopfbedeckungen und gezogenen Säbeln. Sie erinnerten mich an eine Illustration aus einem alten Kindermärchen. Ich sah hinauf zu der loggiaartigen oberen Galerie, halb in der Erwartung, dort Zorro zu entdecken, der sich zu einer Fechtstunde einfand.
Stattdessen erblickte ich eine hübsche, zierliche Blondine, die uns interessiert beobachtete. Sie trug mehr Diamanten, als um diese frühe Stunde schicklich schien, dazu eine formidable Dauerwelle.
«Das ist sie», sagte Fuldner. «Evita. Die Frau des Präsidenten.»
«Irgendwie dachte ich mir schon, dass sie nicht die Putzfrau ist.»
Wir stiegen die Treppe hinauf und gelangten in eine luxuriös eingerichtete Halle, in der mehrere Frauen umherliefen. Trotz der Tatsache, dass die Herrschaft Peróns eine Militärdiktatur war, sahen wir hier oben niemanden in Uniform. Auf eine diesbezügliche Bemerkung meinerseits erwiderte Fuldner, dass Perón nichts von Uniformen hielt und eine gewisse Ungezwungenheit vorzog, die manch einen Besucher überraschte. Ich stellte fest, dass die Frauen in der Halle alle überdurchschnittlich schön waren und Perón und ich in dieser Hinsicht offenbar denselben Geschmack hatten. Aber eine Laufbahn wie Peróns war für mich immer ausgeschlossen gewesen – allein wegen meines ausgeprägten Gerechtigkeitssinns und meines unbedingten Glaubens an die Demokratie.
Allem Anschein nach saß der Präsident nicht bereits frühmorgens um sieben hinter seinem Schreibtisch, wie Fuldner erzählt hatte. Und während wir auf ihn warteten, brachte uns eine seiner Sekretärinnen Kaffee auf einem kleinen silbernen Tablett. Wir rauchten. Die Sekretärinnen rauchten ebenfalls. Alle in Buenos Aires rauchten. Es kam mir vor, als qualmten in Buenos Aires selbst Hunde und Katzen ihre Zwanziger-Packung am Tag weg.
Schließlich vernahm ich hinter den hohen Fenstern Motorengeräusch. Ich stellte meine Kaffeetasse ab und stand auf. Ich sah, wie ein hochgewachsener Mann von einem Motorroller stieg. Es war der Präsident, da war ich mir sicher, obwohl ich das an seinem bescheidenen Transportmittel kaum hätte erkennen können, genauso wenig wie an seiner bequemen Kleidung. Ich versuchte mir vorzustellen, wie Hitler in Golfkleidung auf einem hellgrünen Motorroller die Wilhelmstraße entlangknatterte.
Der Präsident parkte seinen Roller und kam die Treppe hinauf, indem er immer zwei Stufen auf einmal nahm. Er trug derbe englische Straßenschuhe. Er mochte aussehen wie ein Golfspieler mit seinem Hut und der braunen Reißverschluss-Strickjacke, den braunen Knickerbockern und den dicken Wollsocken, doch er hatte die sportliche Statur eines Boxers. Nicht ganz eins achtzig groß, mit glatt zurückgekämmtem schwarzem Haar und einer Nase, die römischer war als das Kolosseum, erinnerte er mich an Primo Carnera, den italienischen Schwergewichtler. Sie waren auch ungefähr im gleichen Alter. Ich schätzte Perón auf Anfang fünfzig. Das schwarze Haar sah aus, als würde es jeden Tag getönt und poliert, mit demselben Zeugs, mit dem die Grenadiere ihre Stiefel wienerten.
Eine der Sekretärinnen reichte ihm ein paar Zeitungen, während eine andere die Doppeltür zu seinem Büro aufhielt. Die Einrichtung dahinter war, wie man sich das Amtszimmer eines Diktators vorstellt: Massen von Reiterbronzen, Eichenpaneele, noch nicht ganz trockene Porträts in Öl, kostspielige Läufer und korinthische Säulen. Perón bedeutete uns, dass wir auf den ledernen Armsesseln Platz nehmen durften, warf die Zeitungen auf einen Schreibtisch von gewaltiger Größe und übergab Hut und Jacke einer weiteren Sekretärin, die seine Garderobe so inbrünstig an ihren nicht kleinen Busen drückte, dass man meinen konnte, sie wünschte, sie hielte Perón selbst im Arm.
Eine Sekretärin brachte ihm eine Demitasse Kaffee, ein Glas Wasser, einen goldenen Füllfederhalter und eine goldene Zigarettenspitze mit einer brennenden Zigarette darin. Perón nahm einen Schluck Kaffee, zog an der Zigarette, nahm den Füllfederhalter zur Hand und begann, die Dokumente zu unterzeichnen, die man ihm zuvor auf den Schreibtisch gelegt hatte. Ich konnte von dort, wo ich saß, seine Unterschrift erkennen. Das geschwungene, egoistische J, der aggressive, finale Abstrich beim n von Perón. Der Handschrift nach zu urteilen, war der Mann ziemlich neurotisch, einer, der die Kontrolle nicht abgibt – die Leute sollten auf jeden Fall sofort kapieren, was er schreibt. Was man ja von Ärzten nicht gerade sagen kann, dachte ich und war ein bisschen erleichtert.
Er entschuldigte sich in fast perfektem Deutsch dafür, dass er uns hatte warten lassen, dann bot er uns Zigaretten aus einer silbernen Schatulle an. Er schüttelte uns die Hand, ich spürte den kräftigen Handteller und dachte wieder an einen Boxer. Deshalb und weil ich die geplatzten Äderchen unter seinen Wangenknochen sah sowie die Zahnplatte, die sein angenehmes Lächeln freilegte. In einem Land, in dem niemand Sinn für Humor besitzt, ist ein lächelnder Mensch ein König. Ich lächelte zurück, dankte ihm für seine Gastfreundschaft und machte ihm Komplimente für sein Deutsch – auf Spanisch.
«Nein, bitte», antwortete Perón, wieder auf Deutsch. «Ich spreche sehr gern Deutsch, und es ist eine gute Übung für mich. Als ich ein junger Kadett an der Militärakademie war, hatten wir ausschließlich deutsche Ausbilder. Das war vor dem Ersten Weltkrieg, im Jahr 1911. Wir mussten alle Deutsch lernen, weil unsere Waffen aus Deutschland kamen und die Handbücher und technischen Anleitungen auf Deutsch geschrieben waren. Wir lernten sogar den Stechschritt. Jeden Abend um sechs Uhr kommen meine Grenadiere im Stechschritt auf die Plaza de Mayo, um die Flagge vom Mast zu holen. Das müssen Sie sich unbedingt einmal mit mir zusammen ansehen.»
«Sehr gern, Herr Präsident.» Ich ließ mir von ihm Feuer geben. «Ich denke allerdings, für mich selbst ist es mit dem Stechschritt vorbei. Heutzutage schaffe ich es gerade noch, eine Treppe hochzusteigen, ohne außer Atem zu kommen.»
«Bei mir ist es genauso.» Perón grinste. «Aber ich versuche auf meine Gesundheit zu achten. Ich reite, und ich fahre gern Ski, wenn ich die Zeit dazu finde. 1939 war ich in den Alpen zum Skilaufen, in Österreich und Deutschland. Deutschland war ein wundervolles Land damals, wie eine gutgeölte Maschine, ein großer Mercedes-Benz. Alles lief glatt und vibrierte vor Kraft, und es war aufregend. Ja, es war eine bedeutsame Zeit in meinem Leben.»
«Ja, Herr Präsident.» Ich lächelte ihn strahlend an, als spräche er mir aus der Seele. Tatsache war, dass ich den Anblick von Soldaten im Stechschritt hasste. Für mich waren Soldaten im Stechschritt einer der unerfreulichsten Anblicke der Welt, etwas, das albern und furchteinflößend zugleich wirkte, sodass einem das Lachen im Hals steckenblieb. Und was das Jahr 1939 anging – so war es wohl für ziemlich viele Leute ein bedeutsames gewesen. Ganz besonders, wenn man Pole oder Franzose oder Brite oder gar Deutscher war. Wer in Europa würde 1939 je vergessen?
«Wie stehen die Dinge in Deutschland zurzeit?», fragte Perón.
«Für gewöhnliche Leute sind die Zeiten sehr hart», antwortete ich. «Doch es kommt auch darauf an, in welcher Zone man sich befindet. Am schlimmsten von allen ist die sowjetische Besatzungszone. Wo die Iwans das Sagen haben, ist es für niemanden leicht. Nicht mal für die Iwans selbst. Die meisten Menschen wollen den Krieg einfach nur hinter sich bringen und mit dem Wiederaufbau vorankommen.»
«Es ist erstaunlich, was in so kurzer Zeit erreicht wurde», sagte Perón.
«Ich meine nicht nur den Wiederaufbau unserer Städte, Herr Präsident», sagte ich. «Obwohl das selbstverständlich auch wichtig ist. Nein, ich meine vielmehr die Rekonstruktion unserer grundlegenden Institutionen und Überzeugungen. Freiheit. Gerechtigkeit. Demokratie. Ein Parlament. Eine verlässliche Polizei. Unabhängige Gerichte. Und wenn wir all das wiederhaben, gelingt es uns vielleicht sogar, ein wenig Selbstachtung zurückzugewinnen.»
Perón kniff die Augen zusammen. «Ich muss schon sagen, Sie klingen nicht wie ein Nazi», stellte er fest.
«Es ist fünf Jahre her, Herr Präsident, seit wir den Krieg verloren haben», antwortete ich. «Sinnlos, über das nachzudenken, was nicht mehr ist. Deutschland muss den Blick in die Zukunft richten.»
«Das ist es, was wir in Argentinien brauchen!», sagte Perón. «Nach vorn gerichtetes Denken! Ein wenig vom deutschen Optimismus, oder, Fuldner?»
«Absolut, Herr Präsident.»
«Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Herr Präsident», sagte ich. «Nach allem, was ich bisher gesehen habe, gibt es nichts, was die Argentinier von Deutschland lernen könnten.»
«Argentinien ist ein sehr katholisches Land, Dr. Hausner», klärte Perón mich auf. «Das tägliche Leben ist festgefahren. Wir benötigen modernes Denken. Wir brauchen Wissenschaftler. Führungskräfte. Techniker. Ärzte wie Sie.» Er legte mir die Hand auf die Schulter.
Zwei kleine Pudel trotteten herbei, sie dufteten nach Parfum, und aus den Augenwinkeln sah ich, dass die Blondine mit der Ku’damm-Frisur und den Klunkern den Raum betreten hatte. In ihrer Begleitung waren zwei Männer. Einer war mittelgroß mit blondem Haar und einem Schnurrbart. Der andere war um die vierzig, grauhaarig, mit einer Hornbrille und dicken getönten Gläsern. Er hatte einen dichten Bart und war kräftiger als sein Kollege. Er schien von der Polizei zu sein.
«Werden Sie wieder als Arzt praktizieren?», fragte Perón an mich gewandt. «Ich bin sicher, wir finden eine Möglichkeit», fügte er hinzu. «Nicht wahr, Rodolfo?»
Der blonde Mann mit dem Schnauzer trat auf uns zu. Er sah kurz zu dem Bärtigen und fragte: «Wenn die Polizei keine Einwände hat.» Sein Deutsch war so gut wie das seines Meisters.
Der Bärtige schüttelte den Kopf.
«Dann werde ich Ramon Carillo bitten, sich darum zu kümmern, falls es recht ist, Herr Präsident?», sagte Rodolfo. Er zückte ein kleines schwarzledernes Notizbüchlein aus der Sakkotasche seines phantastisch sitzenden, maßgeschneiderten Anzugs und machte sich mit einem silbernen Füllfederhalter eine Notiz.
Perón nickte. «Bitte tun Sie das», sagte er und legte mir wieder die Hand auf die Schulter.
Obwohl er ein Liebhaber des Stechschritts war, fing ich an, den Präsidenten zu mögen. Ich mochte ihn wegen seines Motorrollers und wegen seiner albernen Knickerbocker. Und wegen seiner breiten Boxerpranken und seiner dummen kleinen Köter. Außerdem hatte er mich hier willkommen geheißen, er schien unkompliziert. Und – wer weiß? – vielleicht mochte ich ihn auch deswegen, weil ich mich verzweifelt danach sehnte, jemanden zu mögen. Ich weiß es nicht. Doch Juan Perón hatte etwas an sich, und so war ich bereit, ein Risiko einzugehen. Ich entschied, ihn darüber aufzuklären, wer ich wirklich war.
Drei
Buenos Aires 1950
Ich drückte meine Zigarette in einem Aschenbecher aus, der auf dem aufgeräumten Schreibtisch des Präsidenten stand und so groß war wie eine Autofelge. Neben dem Aschenbecher lag eine lederne Schmuckschatulle von Van Cleef und Arpels – für sich genommen bereits ein großartiges Geschenk. Ich nahm an, dass den Inhalt dieser Schatulle die kleine Blondine um den Hals trug. Sie spielte mit den Hunden, während ich meinen vornehmen, kleinen Monolog hielt. Es dauerte keine Minute, bis ich auch ihre volle Aufmerksamkeit hatte. Ich wage zu behaupten, dass ich interessanter sein kann als zwei Hunde, wenn ich mir das in den Kopf setze. Abgesehen davon besitzt wahrscheinlich nicht jeder Besucher die Stirn, dem Präsidenten in seinem Büro unumwunden zu sagen, dass er einen Fehler gemacht hat.
«Herr Präsident, Señor Perón», begann ich. «Ich habe etwas auf dem Herzen. Und weil Argentinien ein katholisches Land ist, könnte man vielleicht sagen: Ich möchte beichten.» Ich lächelte, als ich bemerkte, wie alle blass wurden. «Keine Sorge. Ich will Sie nicht mit den furchtbaren Dingen langweilen, die ich im Krieg gemacht habe. Ich gebe zu, dass ich einiges nicht gern getan habe. Dennoch habe ich keine unschuldigen Frauen und Männer auf meinem Gewissen. Nein, meine Beichte ist viel gewöhnlicher. Ich bin nicht Arzt. Ich traf einmal daheim in Deutschland einen Arzt, Grün hieß er. Der Mann wollte unbedingt weg, nach Amerika, doch er hatte furchtbare Angst, dass man herausfinden würde, was er während des Krieges gemacht hatte. Deshalb beschloss er, die Dinge so zu drehen, dass man davon ausgehen musste, ich wäre er. Er informierte die Israelis und den Alliierten Kontrollrat, wo ich zu finden war. Wie dem auch sei, er hatte gute Arbeit geleistet, niemand glaubte mir jedenfalls, dass ich nicht er war, sodass mir nichts anderes übrigblieb, als zu flüchten. Irgendwann wandte ich mich an die alten Kameraden, damit sie mir halfen, hierher zu kommen. Und so hat Carlos mir geholfen. Verstehen Sie mich nicht falsch, Señor. Ich bin heilfroh, dass ich hier sein kann. Ich hatte alle Mühe, eine israelische Todesschwadron zu überzeugen, dass ich nicht Grün bin, und ich war gezwungen, zwei von ihnen tot im Schnee in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen zurückzulassen. Verstehen Sie, Señor – ich bin tatsächlich ein Flüchtiger. Ich bin lediglich nicht der Flüchtige, für den Sie mich vielleicht halten. Insbesondere bin ich kein Arzt und war es auch niemals.»
«Und wer zum Teufel sind Sie dann?» Das war Carlos Fuldner, und er klang verärgert.
«Mein wirklicher Name ist Bernhard Gunther. Ich war beim SD und habe für den Geheimdienst gearbeitet. Ich wurde von den Russen gefangengenommen und in einem Lager interniert, aus dem ich geflüchtet bin. Vor dem Krieg war ich Polizist. Kriminalbeamter bei der Berliner Polizei.»
«Sagten Sie Kriminalbeamter?» Das war der Mann mit dem Bärtchen und der dicken Brille. Der, den ich als Polizisten zu erkennen glaubte. «Was für ein Kriminalbeamter?», fragte er.
«Ich habe hauptsächlich bei der Mordkommission gearbeitet.»
«Welchen Dienstgrad hatten Sie?», wollte er wissen.
«Als der Krieg ausbrach, war ich KOK – Kriminaloberkommissar. Ein Chief Inspector quasi.»
«Dann kennen Sie zweifellos Ernst Gennat.»
«Selbstverständlich. Er war mein Mentor. Alles, was ich weiß, weiß ich von ihm.»
«Er hatte doch einen Spitznamen, nicht? Wie wurde er in den Zeitungen nochmal genannt?»
«Der Volle Ernst. Wegen seines Leibesumfangs und seiner Vorliebe für Süßes.»
«Was ist aus ihm geworden? Wissen Sie das?»
«Er war stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei von Berlin bis zu seinem Tod 1939. Er starb an einem Herzanfall.»
«Zu schade.»
«Zu viele Süßigkeiten.»
«Gunther … Gunther …», überlegte er laut. «Ja, natürlich. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich kenne Sie.»
«Tatsächlich?»
«Ich war in Berlin, vor dem Zusammenbruch der Weimarer Republik. Ich habe dort Jura studiert.»
Der Polizist in Zivil kam näher, sodass ich seinen Kaffee- und Zigarettenatem riechen konnte. Er nahm seine Brille ab. Offenbar rauchte er eine Menge. Seine Stimme klang wie ein geräucherter Hering. Entlang seines ergrauten Barts zogen sich Lachfalten, doch seine Stirn war ernst, und an seinen geröteten blauen Augen erkannte ich, dass er sich das Lachen inzwischen abgewöhnt hatte. Er sah mich durchdringend an.
«Wissen Sie, dass Sie ein Vorbild für mich waren? Ob Sie es glauben oder nicht, Ihretwegen habe ich die Idee aufgegeben, Anwalt zu werden, und bin stattdessen zur Polizei gegangen.» Er sah zu Perón hinüber. «Herr Präsident, dieser Mann ist ein berühmter Berliner Detektiv! Als ich zum ersten Mal in Berlin war, 1928, gab es dort einen berüchtigten Würger. Sein Name war Gormann. Dieser Mann hier hat ihn überführt und gestellt. Es war ein echter Cause célèbre damals.» Er sah mich wieder an. «Ich habe recht, nicht wahr? Sie sind dieser Bernhard Gunther?»
«Zu Diensten, mein Herr.»
«Sein Name stand in sämtlichen Zeitungen. Ich habe alle Ihre Fälle verfolgt, so gut mir das damals möglich war. Und ja, ganz ehrlich, Sie waren einer meiner Helden, Herr Gunther.»
Inzwischen hatte er meine Hand ergriffen und hielt sie fest. «Und jetzt sind Sie hier in Argentinien! Wie klein doch die Welt ist!»
Perón warf einen Blick auf seine goldene Armbanduhr. Ich fing an, ihn zu langweilen. Der Polizist bemerkte das ebenfalls. Ihm schien nichts zu entgehen. Der Präsident hätte uns wahrscheinlich gar nicht mehr beachtet, wäre nicht seine junge Frau zu mir getreten und hätte mich von oben bis unten gemustert.
Eva Perón war eine interessante Gestalt, wenn man Frauen mochte, die als Aktmodelle arbeiten könnten. Ich habe noch nie ein Gemälde eines alten Meisters von einer dünnen Frau gesehen, und Evitas Körper war an den richtigen Stellen zwischen Knien und Schultern interessant. Was nicht heißt, dass ich sie attraktiv fand. Dazu war sie zu kühl, zu geschäftsmäßig und zu gefasst für meinen Geschmack. Ich mag es, wen Frauen sich ein wenig verwundbar geben. Insbesondere zur Frühstückszeit. In ihrem navyblauen Kostüm sah Evita aus, als wäre sie bereit für einen Stapellauf. Jedenfalls für irgendetwas Wichtigeres, als sich mit mir zu unterhalten. Auf dem Hinterkopf trug sie ein kleines, gleichermaßen blaues samtenes Barett, während über ihrem Arm ein dicker Zobel hing. Nicht, dass irgendetwas von all dem meine Aufmerksamkeit sonderlich fesselte – meine Augen hingen hauptsächlich an den Klunkern, die sie trug. Den kleinen Kronleuchtern aus Diamanten, die an ihren Ohren baumelten, dem floralen Diamantbukett an ihrem Revers und dem atemberaubenden Golfball an ihrem Finger. Es sah aus, als hätten Van Cleef und Arpels ein exzellentes Jahr gehabt.
«Dann haben wir also einen berühmten Detektiv hier in Buenos Aires», sagte sie. «Wie faszinierend.»
«Ich weiß nicht, Señora, ob man mich wirklich berühmt nennen kann», erwiderte ich. «Berühmt ist ein Wort für Boxer oder Filmschauspieler, aber nicht für einen Detektiv. Sicher, die Polizeichefs der Weimarer Republik haben die Zeitungen in dem Glauben gelassen, dass einige von uns erfolgreicher wären als andere. Aber das war nur ein Bild, das der Öffentlichkeit vermittelt wurde, um ihr Vertrauen in unsere Fähigkeiten zu stärken.»
Evita Perón versuchte ein Lächeln, doch es wollte ihr nicht recht gelingen. Ihr Lippenstift war makellos, und ihre Zähne waren perfekt, doch ihre Augen blieben kalt. Es war eher, als würde man in eine Gletscherspalte sehen.
«Ihre Bescheidenheit ist – wie soll ich es sagen? – typisch für Ihre Landsleute», sagte sie. «Es scheint beinahe so, als wäre niemand von Ihnen jemals wichtig oder bedeutsam gewesen. Immer ist es jemand anders, dem die Verdienste gebühren, oder sollte ich lieber sagen, der die Schuld trägt. Stimmt das nicht, Herr Gunther?»
Es gab eine Menge Dinge, die ich darauf hätte antworten können. Doch wenn die Frau des Präsidenten einem eine Ohrfeige verpasst, dann ist es besser, man hält ihr die andere Wange hin.
«Es ist noch keine zehn Jahre her, da dachten die Deutschen, sie müssten die ganze Welt beherrschen. Und heute wollen sie nichts weiter, als einfach ein zurückgezogenes Leben zu führen und in Ruhe gelassen zu werden. Ist es das, was Sie wollen, Herr Gunther? Ein stilles Leben führen? In Ruhe gelassen werden?»
Es war der Polizist, der mir unerwartet zu Hilfe kam. «Bitte, Señora», sagte er. «Herr Gunther will nur bescheiden sein. Glauben Sie mir. Er war ein großer Detektiv drüben in Deutschland.»
«Wir werden sehen», entgegnete sie.
«Nehmen Sie das Kompliment an, Herr Gunther. Wenn ich mich nach all diesen Jahren an Ihren Namen erinnere, dann werden Sie mir sicherlich zustimmen, dass Bescheidenheit fehl am Platze ist.»
Ich zuckte die Schultern. «Nun ja, vielleicht», sagte ich.
«Wie dem auch sei, ich muss nun los», sagte Evita Perón. «Ich überlasse Herrn Gunther und Colonel Montalban ihrer gegenseitigen Bewunderung.»
Ich sah ihr hinterher, froh, dass sie endlich ging, zumal ihre Rückseite ziemlich ansehnlich war. Ich kannte den argentinischen Tango, doch ich hätte glatt eine kleine Melodie summen können, während ich diesem in engen Stoff gehüllten, eleganten Hinterteil nachsah. Unter anderen Umständen hätte ich möglicherweise versucht, ihm einen Klaps zu versetzen. Es gibt Männer, die sind gut auf der Gitarre, und Männer, die sind gut im Domino. Bei mir waren es Frauenhintern. Es war zwar kein ausgesprochenes Hobby, doch ich war gut darin. Ein Mann sollte in irgendetwas gut sein.
Nachdem sie gegangen war, stieg der Präsident zurück auf den Fahrersitz und nahm das Steuer in die Hand. Ich fragte mich, wie viel er ihr wohl durchgehen ließ, bevor er ihr einen Klaps versetzte. Wahrscheinlich eine ganze Menge. Es ist eine verbreitete Schwäche bei älteren Diktatoren mit viel jüngeren Frauen.
«Bitte entschuldigen Sie, Herr Gunther», sagte Perón auf Deutsch. «Meine Frau versteht nicht, dass Sie aus dem … dass Sie aus einem Gefühl heraus gesprochen haben. Sie haben gesagt, was Sie glaubten, sagen zu müssen. Und ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie sich mir anvertrauen. Vielleicht sehen wir beide etwas im anderen. Etwas Wichtiges. Anderen Menschen zu gehorchen ist eine Sache. Jeder Narr ist dazu imstande. Sich selbst zu gehorchen jedoch, sich der unnachgiebigsten und unerbittlichsten Disziplin zu unterwerfen, das ist es, was wirklich zählt. Stimmt es nicht?»
«Jawohl, Herr Präsident.»
Perón nickte. «Soso, Sie sind also kein Arzt. Dann wird es also nicht darum gehen, Ihnen dabei zu helfen, Ihre ärztliche Kunst zu praktizieren. Gibt es denn sonst etwas, das wir für Sie tun können?»
«Es gibt eine Sache, Herr Präsident», sagte ich. «Vielleicht bin ich seekrank, oder ich werde einfach nur alt. Aber in letzter Zeit habe ich mich nicht gut gefühlt. Ich müsste dringend einen Arzt aufsuchen, Señor, falls das möglich ist. Einen richtigen, meine ich. Der herausfindet, ob irgendetwas nicht stimmt mit mir oder ob ich einfach nur an Heimweh leide … obwohl mir das zugegebenermaßen selbst ein wenig unwahrscheinlich vorkommt.»
Vier
Buenos Aires 1950
Mehrere Wochen vergingen. Ich erhielt meine cedula und zog aus dem Versteck in der Calle Monasterio in ein hübsches kleines Hotel im Florida-Viertel. Das San Martin gehörte einem englischen Ehepaar, den Lloyds, die mich mit solchem Zuvorkommen behandelten, dass man nicht glaubte, unsere Heimatländer hätten je Krieg gegeneinander geführt. Häufig findet man erst nach einem Krieg heraus, wie viel man mit dem Feind gemeinsam hat. Ich für meinen Teil stellte fest, dass die Engländer ganz genauso waren wie wir Deutschen, mit einem großen Vorteil: Sie mussten nicht Deutsch sprechen.
Das San Martin hatte diesen Alte-Welt-Charme: Glaskuppeln, komfortables Mobiliar und gute Küche – wenn man Pommes frites und Steaks mochte. Es lag gleich um die Ecke des größeren, teureren Hotel Richmond, wo es ein Café gab, das mir gefiel und in dem ich regelmäßig verkehrte.
Das Richmond erinnerte an einen Club. Es gab einen langen Raum mit Holzpaneelen und Säulen und Spiegeldecken und Drucken von englischen Jagdszenen an den Wänden sowie lederne Sessel. Ein kleines Orchester spielte Tango und Mozart und – ich hätte schwören können – eine Reihe von Mozart-Tangos. Das rauchschwangere Untergeschoss wurde bevölkert von Männern, die Billard oder Domino oder – vor allem – Schach spielten. Frauen waren nicht gern gesehen im Untergeschoss des Hotel Richmond. Argentinier nahmen ihre Frauen sehr ernst. Zu ernst, um sie dabeizuhaben, wenn sie Billard oder Schach spielten.
Oder vielleicht waren die argentinischen Frauen sehr gut im Billard und im Schach.
Daheim in Berlin hatte ich während der Hundstage der Weimarer Republik regelmäßig im Romanischen Café Schach gespielt. Ein- oder zweimal traf ich dort den großen Lasker, der ebenfalls dort Stammgast gewesen war und mir ein paar Dinge über Schach erklärte. Ich war dadurch nicht zu einem besseren Spieler geworden, doch gegen Lasker zu verlieren, war aufregender, als gegen jeden anderen Spieler zu gewinnen.
Im Souterrain des Richmond entdeckte mich Colonel Montalban. Ich beendete gerade ein Spiel gegen einen kleinen, rattengesichtigen Schotten namens Melville. Ich hätte möglicherweise ein Unentschieden erzwingen können, hätte ich Philidors Geduld besessen. Andererseits hatte Philidor nie unter den Augen der Geheimpolizei Schach spielen müssen. Auch wenn es fast so weit gekommen wäre. Zu seinem Glück weilte er gerade in England, als die Französische Revolution ausbrach, und er war klug genug, nicht wieder zurückzukehren. Es gibt wichtigere Dinge zu verlieren als ein Schachspiel. Beispielsweise den Kopf. Colonel Montalban mochte nicht den kalten Blick eines Robespierre haben, doch ich spürte ihn trotzdem in meinem Rücken. Und statt mich zu fragen, wie ich meinen Überzahl-Bauern zu meinem Vorteil nutzen konnte, dachte ich darüber nach, was der Colonel wohl von mir wollte. Hernach war es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich verloren hatte. Es machte mir nichts aus, gegen den rattengesichtigen Schotten zu verlieren – ich hatte schon häufiger gegen ihn verloren. Es machte mir jedoch eine Menge aus, dass er meinte, mir einen Ratschlag erteilen zu müssen, als er mir seine schwitzige Hand reichte.
«Sie müssen immer den Turm hinter dem Bauern positionieren», sagte er in seinem lispelnden europäischen Spanisch, das ganz anders klingt als das lateinamerikanische. «Außer natürlich, wenn es ein Fehler wäre.»
Hätte Lasker mir diesen Rat gegeben, hätte ich ihm dafür gedankt. Doch er war nicht Lasker. Er war Melville, ein bärtiger Verkäufer aus Glasgow mit schlechtem Atem und einem ungesunden Interesse an jungen Mädchen.
Montalban folgte mir nach oben. «Sie spielen ganz passabel», bemerkte er.
«Ich komme ganz gut zurecht», erwiderte ich. «Das heißt, ich kam ganz gut zurecht, bis die Polizei aufgetaucht ist. Es stört mich in meiner Konzentration, verstehen Sie?»
«Tut mir leid.»
«Sie müssen sich nicht entschuldigen.»
«Wir sind nicht so in Argentinien», sagte er. «Es ist in Ordnung, die Regierung zu kritisieren.»
«Da habe ich aber auch schon ganz andere Dinge gehört. Und wenn Sie jetzt fragen von wem, beweisen Sie nur, dass ich recht hatte.»
Colonel Montalban zuckte die Schultern und zündete sich eine Zigarette an. «Es gibt Kritik, und es gibt Kritik», sagte er. «Meine Arbeit besteht darin, den subtilen Unterschied zu erkennen.»
«Man sollte meinen, dass das keine unglaublich schwere Aufgabe ist, wenn man seine oyentes hat?» Oyentes wurden hier Peróns Spione genannt – Leute, die in Bars, in Bussen oder am Telefon die Unterhaltungen anderer belauschten.
«So, Sie wissen also bereits Bescheid über unser oyentes. Ich bin beeindruckt, wirklich beeindruckt», sagte der Colonel mit hochgezogenen Augenbrauen. «Nicht, dass ich beeindruckt sein sollte, schätze ich. Nicht angesichts eines so berühmten Berliner Detektivs, wie Sie es sind.»
«Ich bin lediglich ein Exilant, Colonel. Es zahlt sich aus, den Mund zu halten und die Ohren zu spitzen.»
«Und was haben diese gespitzten Ohren gehört?»
«Die Geschichte von den zwei Flussratten beispielsweise. Eine aus Argentinien, die andere aus Uruguay. Die Ratte aus Uruguay war ausgehungert, also schwamm sie über den Río de la Plata in der Hoffnung, irgendetwas zu fressen zu finden. Auf halbem Weg kam ihr eine argentinische Ratte entgegen, die in die entgegengesetzte Richtung schwamm. Die uruguayische Ratte war überrascht und fragte, was eine gutgenährte Ratte in Uruguay zu suchen hätte, wo es doch in Argentinien offensichtlich so viel zu fressen gäbe. Und die argentinische Ratte antwortete …»
«… dass sie nur hin und wieder mal singen wollte.» Colonel Montalban lächelte müde. «Es ist ein alter Witz.»
Ich deutete auf einen leeren Tisch, doch der Colonel schüttelte den Kopf und nickte in Richtung Tür. Ich folgte ihm nach draußen auf die Straße, die zwischen elf Uhr morgens und vier Uhr nachmittags für den Autoverkehr gesperrt war, damit Fußgänger die offensiv dekorierten Schaufenster der Kaufhäuser wie Gath & Chaves bequem in Augenschein nehmen konnten – oder damit die Männer die attraktiv gekleideten Frauen beobachten konnten, die hier in Scharen herumliefen. Nach dem tristen München und dem trostlosen Wien kam Buenos Aires mir vor wie ein Pariser Laufsteg, vor dem Krieg, versteht sich.
Der Colonel hatte den Wagen abseits von der Florida geparkt, vor dem Claridge Hotel auf der Tucuman. Es fuhr ein hellgrünes Chevrolet Cabriolet mit Türen aus poliertem Holz, Weißwandreifen, roten Ledersitzen und – mitten auf der Motorhaube – einem gewaltigen Scheinwerfer für den Fall, dass er einen Parkplatzwächter verhören musste. Wenn man in diesem Wagen saß, fühlte man sich wie in einem Rennboot.
«Das also fährt die Polenta in Buenos Aires», bemerkte ich, indem ich mit der Hand über die Tür strich. Sie war so hoch und fühlte sich an wie der Tresen eines Luxus-Hotels. Ein hübsches rosafarbenes Haus für den Präsidenten, ein hellgrünes Luxus-Cabriolet für seinen Polizei- und Geheimdienstchef. Faschismus hatte noch nie so gut ausgesehen. Die Erschießungskommandos trugen wahrscheinlich Ballettröckchen.
Wir fuhren mit offenem Dach auf der Moreno nach Westen. Was für den Colonel wahrscheinlich wie ein kalter Wintertag war, war für mich angenehm frühlingshafte Luft. Die Temperaturen lagen um fünfzehn Grad Celsius, doch die meisten porteños liefen mit Hüten und Mänteln herum, als wäre es Januar in München.
«Wohin fahren wir?», fragte ich.
«Zum Polizeihauptquartier.»
«Mein Lieblingsort.»
«Entspannen Sie sich», lachte er. «Ich möchte Ihnen etwas zeigen, mehr nicht.»
«Hoffentlich die neuen Sommeruniformen. Falls ja, kann ich Ihnen vielleicht den Weg ersparen. Sie sollten rosa sein, die gleiche Farbe wie die Casa Rosada. Es könnte helfen, Polizisten in Argentinien beliebter zu machen. Schließlich fällt es schwer, einen Polizisten nicht zu mögen, wenn er in einer rosafarbenen Uniform daherkommt.»
«Reden Sie immer so viel? Was ist aus dem berühmten ‹Mund halten und Ohren auf!› geworden?»
«Nach zwölf Jahren unter den Nazis tut es gut, hin und wieder ein wenig zu plappern.»
Wir fuhren durch das Tor eines hübschen Gebäudes aus dem vergangenen Jahrhundert, das ganz und gar nicht nach einer Polizeistation aussah. Allmählich begann ich ein bisschen etwas über die argentinische Kultur zu verstehen. Argentinien war ein sehr katholisches Land. Selbst die Polizeistation sah aus, als befände sich im Innern eine Basilika, geweiht Sankt Michael, dem Schutzheiligen aller Polizisten.
Das Gebäude mochte nicht aussehen wie eine gewöhnliche Wache, doch drinnen roch es wie auf einer Wache. Alle Polizeiwachen auf der ganzen Welt riechen nach Kot und Angst.
Colonel Montalban führte mich durch ein Labyrinth marmorner Korridore. Polizeibeamte mit Aktenordnern unter dem Arm beeilten sich, uns den Weg freizumachen, während wir durch die Gänge hasteten.
«Ich fange an zu glauben, dass Sie jemand Wichtiges sind», sagte ich.
Wir blieben vor einer Tür stehen. Hier schien die Luft nochmal schlechter. Ich dachte an die Besuche des Aquariums im Berliner Zoo, früher, als ich noch ein Kind war. Oder an das Reptilienhaus. Jedenfalls irgendetwas Nasses, Schleimiges, Unangenehmes. Der Colonel nahm ein Päckchen Capstan Navy Cut hervor und bot mir eine an, bevor er uns beiden Feuer gab.
«Die nehmen den Geruch», sagte er. «Hinter dieser Tür liegt die gerichtsmedizinische Leichenschau.»
«Bringen Sie ihr Rendez-vous immer zuerst hierher?»
«Nur Sie, mein Freund.»
«Ich schätze, ich sollte Sie warnen. Ich bin von der empfindlichen Sorte. Ich mag Leichenschauhäuser nicht. Erst recht nicht, wenn Leichen darin liegen.»
«Kommen Sie, Herr Gunther. Sie waren doch bei der Mordkommission, oder nicht?»
«Das ist Jahre her, Colonel. Heute beschäftige ich mich lieber mit den Lebenden. Hat wohl mit dem Alter zu tun. Ich habe noch reichlich Gelegenheit, Zeit mit den Toten zu verbringen, wenn ich selbst tot bin.»
Der Colonel stieß die Tür auf und wartete. Es sah so aus, als hätte ich keine andere Wahl, als ihm zu folgen. Der Gestank wurde schlimmer. Nass und schleimig und definitiv tot. Wie ein toter Alligator beispielsweise. Ein Mann in weißem Kittel und hellgrünen Gummihandschuhen kam uns entgegen. Er sah ein bisschen indianisch aus, dunkelhäutig mit noch dunkleren Ringen unter den Augen, von denen eines milchig trübe war wie eine Perle. Er sah selbst aus wie eine Leiche.
Er und der Colonel sahen sich schweigend an, nickten, und dann machten sich die grünen Handschuhe ans Werk. Es dauerte keine Minute, und ich blickte hinab auf den nackten Leib eines jungen Mädchens. Das heißt, ich nahm zumindest an, dass es sich um ein Mädchen handelte. Was üblicherweise Aufschluss in dieser Hinsicht bot, fehlte nämlich vollständig. Und offenbar nicht nur die äußeren Organe, sondern auch die meisten inneren. Ich hatte schon mal tödliche Verletzungen gesehen, allerdings nur an der deutschen Westfront 1917. Nichts unterhalb des Nabels der Toten schien am rechten Platz. Der Colonel ließ mir Zeit für einen gründlichen Blick, bevor er sagte: «Ich habe mich gefragt, ob die Tote Sie vielleicht an jemanden erinnert?»
«Ich weiß nicht. Sie meinen, an eine Leiche?»
«Ihr Name war Grete Wohlauf. Sie war Deutschargentinierin. Sie wurde vor zwei Wochen im Barrio Norte gefunden. Wir denken, dass sie erwürgt wurde. Ihre Gebärmutter und die übrigen Fortpflanzungsorgane wurden entfernt, mit großer Wahrscheinlichkeit von jemandem, der weiß, was er tut. Das war kein unüberlegter Überfall und kein Mord im Affekt. Wie Sie sehen, wurde sie mit nahezu klinischer Effizienz ausgeweidet.»
Ich behielt die Zigarette im Mund, sodass der Gestank der geöffneten Leiche mir nicht in die Nase steigen konnte. Es roch eigentlich hauptsächlich nach Formaldehyd, doch wann immer ich diesen Geruch wahrnahm, kamen Erinnerungen an die vielen unangenehmen Dinge hoch, die ich in meiner Zeit bei der Berliner Kriminalpolizei erlebt und gesehen hatte. Vor allem an zwei Vorfälle erinnerte ich mich, doch ich sah keinen Grund, warum ich Colonel Montalban davon erzählen sollte.
Was auch immer der Colonel von mir wollte, ich verspürte keine Lust mitzuspielen. Nach einer Weile wandte ich mich ab.
«Und?», fragte ich.
«Ich dachte mir … Nun, ich dachte, vielleicht erinnert Sie der Anblick an etwas?»
«Nein.»
«Sie war erst fünfzehn Jahre alt.»
«Das tut mir leid.»
«Ja», sagte der Colonel. «Ich habe selbst eine Tochter. Ein wenig älter als die Tote. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ihr so etwas zustoßen würde.» Er zuckte die Schultern. «Alles. Wirklich alles», sagte er.
Ich sagte nichts. So würde er vielleicht schneller zum Punkt kommen.
Er führte mich zur Tür zurück. «Ich habe Ihnen bereits erzählt, dass ich in Berlin Jura studiert habe», sagte er. «Fichte, von Savigny. Mein Vater wollte, dass ich Anwalt werde, doch meine Mutter, eine Deutsche, wollte, dass ich Philosoph werde. Und ich? Ich wollte reisen. Nach Europa. Und nach meinem Schulabschluss erhielt ich eine Gelegenheit, in Deutschland zu studieren. Alle waren glücklich. Ich am meisten von allen. Ich liebte Berlin.»
Er öffnete die Tür, und wir traten in den Korridor hinaus.
«Ich hatte eine Wohnung auf dem Ku’damm, in der Nähe der Gedächtniskirche und dieses Clubs mit dem Türsteher, der als Teufel verkleidet war. In dem die Kellnerinnen als Engel verkleidet waren.»
«Das Himmel und Hölle», sagte ich. «Ich erinnere mich sehr gut.»
«Genau, Himmel und Hölle.» Der Colonel grinste. «Ich war ein guterzogener römisch-katholischer Knabe. Ich hatte noch nie vorher so viele nackte Frauen gesehen. Es gab eine spezielle Show, Fünfundzwanzig Szenen aus dem Leben des Marquis de Sade, und noch eine, Die nackte Französin: Ihr Leben im Spiegel der Kunst. Was für ein Ort. Was für eine Stadt. Ist wirklich nichts mehr davon übrig?»
«Ganz Berlin ist eine Ruine. Kaum mehr als eine einzige riesige Baustelle. Sie würden nichts wiedererkennen.»
«Das ist schade, sehr schade.»
Er sperrte die Tür zu einem kleinen Zimmer gegenüber der gerichtsmedizinischen Leichenschau auf. Dort standen ein billiger Tisch, ein paar billige Stühle und ein paar billige Aschenbecher. Der Colonel zog einen Vorhang auf und öffnete ein schmutziges Fenster dahinter, um ein wenig frische Luft hereinzulassen. Auf der anderen Straßenseite erblickte ich eine Kirche und Menschen, die sie betraten und nichts wussten von Spurensuche und Mord und die Weihrauch rochen und nicht Formaldehyd und Zigaretten. Ich seufzte und sah auf meine Uhr. Ich bemühte mich kaum noch, meine Ungeduld zu verbergen. Ich hatte ihn nicht gebeten, mir den Leichnam eines toten Mädchens zu zeigen. Ich war gereizt und wütend, weil ich schon ahnte, was jetzt kommen würde.
«Bitte entschuldigen Sie», sagte er. «Ich komme gleich zur Sache, Herr Gunther. Verstehen Sie, ich habe mich stets für die dunkle Seite der menschlichen Seele interessiert. Deshalb bin ich auch auf Sie aufmerksam geworden, Herr Gunther. In gewisser Weise haben Sie mich vor einem sehr langweiligen Leben bewahrt.»
Der Colonel zog einen Stuhl für mich heran, und wir setzten uns.
«Damals, 1932, hat es in Deutschland zwei spektakuläre Mordfälle gegeben.»
«Es gab ein paar mehr als nur diese beiden», sagte ich mürrisch. «Aber diese beiden Fälle waren etwas anderes. Ich erinnere mich noch sehr genau an die schaurigen Einzelheiten. Es waren Lustmorde, nicht wahr? Zwei Mädchen, auf ähnliche Weise verstümmelt, genau wie die arme Grete Wohlauf hier. Eins in Berlin und eins in München. Und Sie, Herr Gunther, waren der für die Ermittlungen zuständige Beamte. Ihr Bild war in allen Zeitungen.»
«Das stimmt. Allerdings sehe ich nicht, was das eine mit dem anderen zu tun haben soll.»
«Der Mörder wurde nie gefasst, Herr Gunther. Deshalb unterhalten wir uns in diesem Moment.»