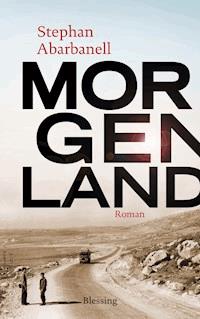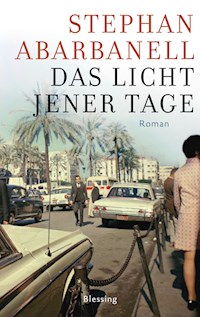
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Eine Reise in den Nahen Osten wird zur Reise in die eigene Vergangenheit
Robert Landauer, einst international geachteter Mediziner, wagt nach einem Pharmaskandal einen Neuanfang in Berlin. Als er einer ohnmächtigen jungen Frau hilft und sie nach Hause fährt, trifft er auf deren Vater, Fouad Tamimi. Es ist nicht die erste Begegnung zwischen den beiden Männern: Ihre gemeinsame Geschichte führt zurück ins Jahr 1982, in den kriegsgebeutelten Libanon; Tamimi hat Landauer damals das Leben gerettet, doch seine große Liebe Sahira verloren. Nach dem Massaker in den palästinensischen Flüchtlingslagern von Beirut fehlte von ihr jede Spur. Landauer lässt sich darauf ein, Tamimi bei der Suche nach Sahira zu helfen. Er macht sich auf den Weg in den Nahen Osten und stößt dabei nicht nur auf seine eigene Vergangenheit, sondern auch auf eine Geschichte von ungeahnten politischen Ausmaßen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Ähnliche
Das Buch
Robert Landauer, einst international geachteter Mediziner, wagt nach einem Pharmaskandal, der ihn seinen Ruf gekostet hat, einen Neuanfang in Berlin. An einem heißen Augusttag entdeckt er in einem Kleinwagen vor einem Warenhaus eine ohnmächtige, junge Frau, bringt sie nach Hause und trifft dort auf deren Vater, Fouad Tamimi.
Es ist nicht die erste Begegnung zwischen den beiden Männern: Ihre gemeinsame Geschichte führt zurück ins Jahr 1982, in den kriegsgebeutelten Libanon; Tamimi hat Landauer damals das Leben gerettet, doch seine große Liebe Sahira verloren. Nach dem Massaker in den palästinensischen Flüchtlingslagern von Beirut fehlte von ihr jede Spur. Landauer lässt sich darauf ein, Tamimi bei der Suche nach Sahira zu helfen – denn auch er hat damals seine große Liebe verloren.
Nach über dreißig Jahren reist Landauer wieder in den Nahen Osten, zuerst in den Libanon, dann nach Israel, und damit in das Land, mit dem auch ihn ein Geheimnis verbindet. Dabei stößt er nicht nur auf Tamimis sondern auch auf seine eigene Vergangenheit und auf eine Geschichte von ungeahnten politischen Ausmaßen.
Der Autor
Stephan Abarbanell, 1957 in Braunschweig geboren, wuchs in Hamburg auf. Er studierte Evangelische Theologie sowie Allgemeine Rhetorik in Hamburg, Tübingen und Berkeley und nahm an einem Creative-Writing-Kurs bei Walter Jens teil. Heute ist Abarbanell Kulturchef des rbb. Sein Romandebüt Morgenland erschien 2015 bei Blessing. Der Autor lebt mit seiner Frau, der Übersetzerin Bettina Abarbanell, in Potsdam-Babelsberg.
STEPHAN
ABARBANELL
DAS LICHT
JENER TAGE
Roman
Blessing
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Stephan Abarbanell
und Karl Blessing Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Bauer + Möhring, Berlin
Umschlagabbildung: 169 Martyrs’ Square, Beirut (5),
1970 © History and Art Collection/Alamy Stock Foto
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN 978-3-641-21801-0V001
www.blessing-verlag.de
Für
Sophie, Julius und Sebastian
Hello darkness, my old friend
I’ve come to talk with you again
Simon & Garfunkel
1
Springen
1
Beirut, August 2015
Da lag sie, die Stadt, ockerfarben, undurchdringlich, Häuser unter milchigem Dunst. Eine Promenade am Meer, gesäumt von Palmen. Auf einer Anhöhe über dem Wasser ein Riesenrad. An den fernen Hängen das Blinkern blauer Pools, Morsezeichen des erwachenden Tages. Über dem Süden der Stadt setzte das Flugzeug zur Landung an. Welcome to Rafic Hariri International Airport.
Robert Landauer löste den Gurt, hob seine Reisetasche aus dem Gepäckfach, legte das Sakko über den Arm und strich es glatt. Seine Lesebrille hatte er vor der Landung immer wieder geputzt und in den Kegel der kleinen Lampe an der Kabinendecke gehalten, bis er die prüfenden Blicke seines Sitznachbarn spürte.
Footprint Travel Guides – Lebanon & Syria, den Reiseführer, den er nach vergeblicher Suche in Berlin bei einem Onlinehändler in Sussex »gebraucht wie neu« erstanden hatte, verstaute er zusammen mit der Brille in der Reisetasche. Trotz mehrfacher Anläufe war er über das Kapitel »Before you travel« nicht hinausgekommen. Nach wenigen Absätzen waren ihm, ein Finger als Lesezeichen zwischen den Seiten, die Augen zugefallen.
Ein Flughafenbus brachte ihn zum Terminal. An andere Passagiere, meist Einheimische, gedrängt, mit einer Hand die fleckige Haltestange aus Metall umklammernd, an der anderen den Geruch abgegriffener Münzen, über ihm das Gebläse der Klimaanlage, fühlte er sich auf demütigende Weise verfrachtet. Er hatte es nicht anders gewollt.
Auf dem Gang zur Gepäckausgabe begleitete die Ankommenden eine Fotoausstellung; brennende Häuser, zerstörte Straßen, Checkpoints, ausgebrannte Panzer, MG-Nester, Frauen, die vor Schmerz und Trauer ihre Arme in die Höhe streckten: Bilder des libanesischen Bürgerkriegs. Die Fotos erst schwarz-weiß, dann in Farbe aus der Zeit nach dem Morden, als die Stadt wieder zu wachsen beginnt, ungestüm, ehrgeizig wie Rio oder Abu Dhabi, Global Money für die Zukunft, neue Straßen wie mit dem Besen gekehrt. Die diese Stadt einst zertrennende »grüne Grenze« nur noch ein Riss in der Seele derer, die nicht vergessen können.
Vor dem Flughafengebäude hielt er nach einem Taxi Ausschau, roch den Atem der fremden Stadt, schmeckte Salz auf der Zunge und spürte den Wind, der vom Meer herüberkam, sanft, schwer und heiß. Das Sakko hatte er sich über die Schultern gelegt.
Er winkte ein Taxi heran. Der Wagen hielt, der Fahrer rief ihm durch das geöffnete Fenster etwas zu. Landauer hörte, wie jemand hinter ihm lachte.
Er wandte sich um. »Gehört Ihnen«, sagte die junge Frau. Sie sprach Deutsch mit einem leichten Akzent. Landauer tippte auf den Norden Europas und fragte sich, woran sie seine Nationalität so mühelos hatte festmachen können. Natürlich – in seiner Sakkotasche steckte zusammengerollt der ungelesene Berliner Tagesspiegel.
»Ich bitte um Entschuldigung, ich habe Sie nicht gesehen, nehmen Sie es, bitte.« Für einen Moment standen beide unschlüssig nebeneinander.
Der Fahrer stieg aus und öffnete den Kofferraum. Er trug ein eng anliegendes, modisches T-Shirt, eine Ray-Ban-Wayfarer-Brille, sein Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden.
»Hamra, West-Beirut. Und Sie?«, sagte die Frau. Sie hatte kurz geschnittenes blondes Haar, Pixie-Cut, fast jungenhaft.
»Crowne Plaza Hotel«, sagte er.
»Hamra und Hamra«, sagte der Taxifahrer auf Englisch, griff mit der einen Hand Landauers Reisetasche, mit der anderen den Koffer der jungen Frau, wuchtete sie ins Auto und hielt die hintere Tür auf. »Selber Preis«, sagte er.
Die junge Frau stieg ein, Landauer ging um den Wagen herum und nahm neben ihr Platz.
Sie nannte eine Adresse, Rue Mansour Jurdak, nahe der saudischen Botschaft. Sie schien nicht das erste Mal in der Stadt zu sein.
»Diana Towers Hotel«, sagte der Fahrer. »Und Sie, Mister, Crowne Plaza? Bei geöffnetem Fenster können Sie sich heute Abend gegenseitig aus der Zeitung vorlesen.« Sein Englisch war sicher. Er legte den Gang ein und fuhr an.
Nach kurzer Zeit hatte die junge Frau ihn in ein Gespräch verwickelt, Englisch, Französisch, ein paar Brocken Arabisch, der Fahrer parierte, als sei es Teil des Geschäfts. Sie fragte nach dem Wetter, den Flüchtlingen aus dem Nachbarland, neuen Anekdoten aus der Politik und dem stumm geschalteten libanesischen Parlament, und ob es das Restaurant Soundso im Stadtteil Gemayze noch gäbe. Nicht mehr? Shit. Too bad.
What a pity, sagte der Fahrer.
Merde. Sie ließ sich nicht beirren.
Landauer sah aus dem Fenster. Taxis, Lastwagen und abgedunkelte Limousinen von Mercedes, Audi, BMW oder Lexus glitten an ihm vorbei, die Kennzeichen aus Beirut, Jounieh oder Damaskus.
»Kennen Sie Beirut? Auch den Süden, al-Dahiye, das dunkle Fenster der Stadt? Haben Sie Lust auf ein Abenteuer?«
Unvermittelt hatte sie sich ihm zugewandt. Landauer wusste nicht, was er antworten sollte.
»O.k. Versuchen wir es«, sagte sie und legte dem Fahrer die Hand auf die Schulter. Ob er bereit wäre, die Stadtautobahn zu verlassen und die Route durch den Osten der Stadt zu nehmen. In Cola könne er wieder auf die Hauptstraße. Der Fahrer schüttelte bestimmt den Kopf. Sie wandte sich wieder Robert Landauer zu.
»Hisbollah-Gebiet, die ganze Gegend hier auf der rechten Seite. Ich finde, das sollten Sie sehen. An uns haben sie kein Interesse. Es sei denn, Sie sind ein saudischer Prinz, der eine Menge Lösegeld verspricht, und auf dem Weg zu Ihrer Villa in den Bergen.«
Landauer sah im Rückspiegel den Hilfe suchenden Blick des Fahrers.
»Nicht kneifen«, sagte sie.
»Sind Sie sicher, dass dieses kleine Manöver nicht leichtsinnig ist?« Er mochte die Stimme nicht, mit der er das sagte.
»Leichtsinnig?« Sie lachte und zog eine Marlboro Light heraus. »Rauchen Sie?«
Landauer verneinte, als junger Mann gelegentlich, irgendwann habe er aufgehört, er wisse nicht mehr, wann. Sie reichte dem Fahrer eine Zigarette, er betrachtete sie, steckte sie sich hinters Ohr.
»Wenn er unser kleinesManöver tatsächlich ausführt, dann nicht wegen einer blöden Zigarette. Und nicht für tausend Dollar. Sondern weil er ein Mann ist«, sagte sie. Der Fahrer fluchte vor sich hin, schüttelte den Kopf und nahm, ohne die Geschwindigkeit zu verringern, die nächste Ausfahrt. Der Wagen begann zu rumpeln, nachdem sie abgebogen waren und nun parallel zur Stadtautobahn in Richtung Norden fuhren. Trotz der Schlaglöcher und der herumliegenden Müllreste nahm der Fahrer den Fuß kaum vom Gas, am Straßenrand glitten Werkstätten für Lastwagen, alte Mercedes-Trucks mit Wassertanks vorbei, Frauen in schwarzen Tschadors, Stände für Gemüse und Obst. Der Mittelstreifen war nur noch eine Spur aus Sand, Gestein, darauf leere Plastikkanister, alte Autoreifen. An den Laternenmasten hingen Bildnisse eines schwarz gewandeten, aus wachen Augen herabblickenden Mullahs. Fotos und handgemalte Plakate.
»Hassan Nasrallah. Ihn für ein Interview zu bekommen wäre für mich der Jackpot. Keine Chance. Jede Nacht ein anderes Bett. Einer der international meist gesuchten Männer. Dem südlichen Nachbarn würde es schon reichen, nur einen Arm oder ein Bein von ihm zu bekommen, bislang hat auch das nicht geklappt.«
Der »südliche Nachbar«. Israel. Auch seinetwegen war er hier und tastete in der Innentasche seines Sakkos nach dem Pass, den er sich für diese Reise neu hatte ausstellen lassen, ohne verräterische Stempel.
Ob sie genug gesehen hätten, wollte der Fahrer wissen. Ohne ihre Antwort abzuwarten, bog er nach Westen ab, Richtung Meer, wenig später waren sie wieder auf der Schnellstraße. Landauer spürte, wie die Anspannung wich. Der Kragen seines Hemdes war nass.
»Sie sind Journalistin?«
»Ich arbeite an einer Artikelserie über den neuen, sich gerade mal wieder selbst abschaffenden Nahen Osten. Ursprünglich eine kleine Reportage über die Ermordung Jitzchak Rabins und das trübe Jubiläum der Friedensverträge. Israel und die Rechten, Israel und die Palis. Aber wenn man in dieser Region einmal beginnt, ist es schwer, wieder ein Ende zu finden. Und einen Anfang auch. Lauter lose Fäden.«
»Rabin. Das ist zwanzig Jahre her. November 1995. Yigal Amir, am Platz der Könige. Drei Geschosse, selbst gebaute Dum-dum. Die Ärzte hatten bei Rabin keine Chance.«
»Sie sind Arzt?«
»Nicht für so etwas.«
»Aber Sie scheinen sich in der Region auszukennen.«
»Früher einmal, ja … vielleicht.«
Durch die Frontscheibe sah er auf einer Anhöhe das Riesenrad, das er vom Flugzeug aus entdeckt hatte. Verloren und stumm stand es dort, als wären die Schausteller längst weitergezogen und hätten das stählerne Gerüst von der Farbe getrockneten Bluts zurückgelassen, als Geschenk, als Mahnung, als Fluch.
»Hinter mir liegt eine Woche Kairo«, sagte die junge Frau. »Jetzt ein paar Tage Beirut. Anschließend über Istanbul nach Tel Aviv. Direkt geht nicht. Wenn in Israel tatsächlich einer den Mund aufmacht, geht es von da aus retour an den Schreibtisch. Amsterdam. Ressort Außen- und Sicherheitspolitik bei deVolkskrant. Vorne mit kleinem d, schließlich sind wir ein kleines Land und interessieren uns vielleicht auch deswegen ganz besonders für andere kleine Länder.« Sie lachte, frei und unbeschwert.
Ihr Handy klingelte, sie blickte auf das Display, ließ es wieder in die Tasche gleiten. »Mein Fotograf. Er erwartet mich im Hotel.«
Robert Landauer war froh, dass sie ihn nicht fragte, was ihn in die Stadt geführt habe. Was hätte er antworten sollen? Ein Arzt auf Abwegen? Ein Forscher ohne handfeste Hypothese? Ein Gescheiterter? Ein Verrückter. Vielleicht sogar das.
Die Frau blickte aus dem halb heruntergelassenen Fenster. Der Fahrtwind gab ihre Stirn frei. Ihre Lippen waren leicht geöffnet, sie sog die Luft tief ein.
»Riechen Sie das?«
Natriumchlorid, dachte er. In der Natur in großer Menge vorhanden, größtenteils gelöst im Meerwasser mit einem Gehalt von rund drei Prozent, insgesamt 3,6 x 1016 Tonnen. So lautete die Formel. Und mit Formeln kannte er sich aus. Zumindest hatte er das angenommen, nahezu sein ganzes Leben lang, bestätigt durch internationale Auszeichnungen, Preise und industrienahes Geld.
»Ja, das Meer«, sagte er.
»Hitze, Feuchtigkeit und Salz. Ohne den Wind wäre es hier unerträglich. Aber auf den ist in Beirut Verlass.«
Sie verließen die Stadtautobahn, bogen wenig später von der Uferpromenade rechts ab, die Straße nach Hamra stieg leicht an, der Verkehr wurde zäh. Sie standen. Hupen, Gedrängel, Polizisten auf Motorrädern, die tatenlos zusahen.
»Wassersperre«, sagte der Fahrer. »Seit gestern. Die Stadt kann nicht mehr liefern. Alle müssen Wasser kaufen, und die Tanklaster blockieren die Straßen. Wollen Sie von hier aus laufen? Geht definitiv schneller.«
Sie sahen sich an, und die junge Frau nickte. Landauer zahlte, gab großzügig Trinkgeld, und sie stiegen aus.
Die junge Frau zog ihren Koffer hinter sich her, er hatte die Reisetasche geschultert. Eine Katze hüpfte von einer Mauer und folgte ihnen. Sie kam aus der Richtung des alten, stillgelegten Leuchtturms, der zwischen den hohen Häusern Schutz zu suchen schien.
»Hier oben trennen sich unsere Wege«, sagte sie an der Einfahrt zur Rue Mansour Jurdak und wies ihm den Weg zu seinem Hotel. »Danke für den Shuttle.«
»Ich habe zu danken«, sagte er. Als er sie nach ihrem Namen fragen wollte, war sie bereits außer Sicht.
Er hatte sich von Berlin aus bei Professor Stéphane al-Soury angekündigt. Sein Kollege hatte umgehend geantwortet, er freue sich über den Besuch aus Deutschland. Sie hatten vereinbart, dass Landauer sich vom Hotel aus melden und später »zu einem leichten Abendessen«, wie al-Soury schrieb, in seinem Appartement einfinden solle. Von ihm erhoffte er sich Rat, wie er vorgehen könnte. Aber wie weit sollte, durfte er sich ihm gegenüber öffnen?
In seinen amerikanischen Jahren hatte er in Philadelphia mit dem libanesischen, um einige Jahre älteren Kollegen, der aus einer vermögenden, levantinisch-christlichen Familie stammte, zusammengearbeitet, an der Klinik der Penn University, in der medizinischen Forschung, ohne dass sie je ein privates Wort gewechselt hätten. Trotz dessen weltläufiger Freundlichkeit, die er im Stillen oft bewundert hatte, war al-Soury ihm stets unnahbar erschienen, obwohl jeder Außenstehende sie für kollegial Vertraute hätte halten können. Einmal hatte er al-Soury geholfen und dessen Karriere gerettet, als Amerika kurz nach dem Angriff auf den Irak von der Angst vor vermeintlichen Terroristen erfasst wurde und der Professor aus dem Libanon des Landes verwiesen werden sollte. Es konnte nur ein Irrtum sein. Ein Datenfehler. Über eine Kette von Kontakten bis nach ganz oben war es ihm als Mitglied des Fakultätsrates möglich, das unvermeidlich Scheinende abzuwenden. Professor al-Soury durfte im Land bleiben und weiter lehren und forschen. Er hatte sich später nie Gedanken darüber gemacht, was die amerikanischen Behörden gegen seinen Kollegen vorzubringen gehabt hatten und ob nicht auch er bei seiner beherzten Intervention ein wenig leichtsinnig gewesen war.
In Berlin war ihm sein Kollege wieder eingefallen. Auch dass er aus einer politisch aktiven Familie stammte und das Land wahrscheinlich kannte wie kaum ein anderer. Er hatte zudem gelesen, dass al-Soury in seinem Heimatland eine politische Karriere anstrebte, als Ziel einen starken, geeinten Libanon, so der Text unter dem Logo einer von einem rot umrandeten Zeder auf der Website seiner neuen Partei.
Und Sie, lieber Kollege? Was führt Sie in unser Land? Landauer würde sich erklären müssen. Er suchte eine Spur, einen Anknüpfungspunkt. Aber war al-Soury zu trauen, konnte er ein Verbündeter sein in dieser Sache? Auf welcher Seite hatte er gestanden, damals, vor über dreißig Jahren?
Und würde al-Soury ihn nicht vielleicht sogar auslachen, als den sich selbst völlig überschätzenden Ausländer betrachten, wenn er ihm den Grund für seine Reise erklärte – jemanden in dieser fremden Stadt zu suchen, den zu finden andere längst aufgegeben hatten? So viele Namenlose, Vergessene, hatten ihr Leben in diesem Land verloren, gestorben an Häuserwänden, Straßenecken, in Kiesgruben, an Straßensperren oder auf den vor Angst nass geschwitzten Matratzen ihrer Betten. So viele waren verschwunden, spurlos, wie sie. Und ausgerechnet er, ein Arzt und Forscher, der dieses Land kaum kannte, wollte sie finden!
Landauer hatte beschlossen, spontan zu entscheiden, ob er al-Soury in sein Vorhaben einweihen würde, und das Treffen mit seinem Kollegen bis auf Weiteres als eine Möglichkeit zu betrachten, den ersten Abend in einem fremden Land zumindest in vertrauter Gesellschaft zu verbringen. Dann würde er weitersehen.
Sein Zimmer lag im zehnten Stock, mit Blick über den Westen der Stadt auf das Meer. Er stellte seine Reisetasche neben das Bett. Auf dem Nachttisch lag ein Briefumschlag, darin eine Karte.
Cher Robert,
um 5 p.m. erwartet Sie mein Wagen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und hoffe, Sie sind gut angekommen und fühlen sich wie zu Hause.
Stéphane
Al-Soury war ihm zuvorgekommen. In der Hotelbar im einundzwanzigsten Stockwerk bestellte Landauer sich einen Kaffee und ein Sandwich. An jeder Seite des weitläufigen, die ganze Hotelfläche einnehmenden Raumes waren große, bodentiefe Fenster. Dahinter die wachsende Stadt. Er sah Arbeiter mit Helmen, unwirklich hohe Baukräne, die sich drehten und an langen Seilen Metallträger, Fensterfassungen und schimmernde Fassadensteine in die Höhe zogen. Die Bar ging in ein Schwimmbad über, und er beschloss, nach dem Imbiss zu trainieren, auch um die Anspannung loszuwerden. Er taxierte das Becken und hatte das heutige Soll im Handumdrehen errechnet: Seine zwanzig Bahnen in Berlin, zweimal die Woche unter Aufsicht seines Trainers Paolo, wären aufgrund der geringen Größe des Hotelbeckens zu verdoppeln, abzüglich eines Reiseerschöpfungsbonus von zehn Bahnen. Ergänzt um eine Altersermäßigung von fünf Jahren, die er sich heute selbst gewährte, schließlich war er, auch wenn man es ihm nicht ansah, achtundfünfzig. Strich drunter. »Macht fünfundzwanzig Bahnen Beirut-Maß«, sagte er leise zu sich selbst und ließ die Rechnung für Kaffee und Sandwich auf das Zimmer schreiben.
Um kurz vor fünf stand er in der Hotellobby. Er fühlte sich erfrischt und ausgeruht. Nur hatte er nicht daran gedacht, dass er seinem Kollegen al-Soury etwas hätte mitbringen sollen. Schließlich war er eingeladen.
Ein Mann im dunklen Anzug kam auf ihn zu.
»Professor Landauer?«
Gemeinsam verließen sie das Hotel. Ein schwarzer Mercedes, die Scheiben im Fond verdunkelt, erwartete sie auf dem Vorplatz. Die Wucht der Hitze überraschte ihn. In der Hamra Street vor dem Crowne Plaza stand der Verkehr. Hupen, Lärm, japanische und koreanische Motorroller, die sich an den Autos vorbeischlängelten und oft ganze Familien transportierten; vorn der Vater, hinten die Mutter, dazwischen zwei Kinder wie lebensechte Puppen. Ihm fiel ein Mädchen auf, etwa fünf Jahre alt. Er blickte ihm nach.
An der Hotelausfahrt hockte ein Bettler. Suri, sagte der Mann im dunklen Anzug und öffnete eine der hinteren Türen. Am Steuer saß ein Fahrer. Der Motor des Wagens und die Klimaanlage liefen. Sie fuhren die Auffahrt hinunter, und der Mann, der nun neben dem Fahrer saß, wies noch einmal auf den Bettler, den Syrer.
Refugees, many, many, sagte er, griff mit der Hand hinter sich an seinen Gürtel, zog eine Pistole heraus, legte sie, nachdem er den Entsicherungsschalter kontrolliert hatte, ins Handschuhfach. Er drehte sich zu Landauer um.
»Bequem? Fahrt dauert nicht viele Minuten. Ashrafieh. Wunderschön«, sagte er in einem holprigen Englisch und wandte sich wieder nach vorn.
Landauer wusste, dass sein Kollege al-Soury in einem feinen christlichen Stadtteil wohnte. Nachdem sie der Corniche am Meer entlang gefolgt waren, beschrieb diese einen Bogen, an Hafenanlagen und der Marina vorbei Richtung Osten. Der Motor schnurrte nahezu geräuschlos. Landauer roch das Leder der Sitze und entdeckte eine Vielzahl von Knöpfen und Schaltern, deren Funktion sich ihm nicht erschloss.
Die Straße, in der Stéphane al-Soury wohnte, war von Baumkronen überdacht. Vor einem mehrstöckigen Haus, das aus einer Vielzahl großzügiger Appartements zu bestehen schien und durch einen hohen Zaun vom Fußweg getrennt war, hielten sie. Der Beifahrer, die Waffe wieder im Holster, begleitete ihn zum Eingang des Grundstücks und meldete ihn über die Gegensprechanlage an. Mit einem Summen ging das Tor auf. Ein asiatisch aussehender Butler in einer weißen, uniformähnlichen Jacke öffnete Landauer, bat ihn herein und führte ihn über eine Treppe nach oben. Durch hohe, mit alten Möbeln, Statuen, großformatigen Bildern und silbernen Standleuchtern ausgestattete Räume, alle in zarten Pastelltönen, geleitete er ihn hinaus auf eine von Windlichtern erleuchtete Loggia. Über ihnen drehte sich lautlos ein großflügeliger Ventilator.
Er hatte Stéphane al-Soury einige Jahre nicht gesehen, sein Kollege war längst emeritiert, schien jedoch kaum gealtert zu sein. Den Kopf stets geneigt, dunkle, wache, funkelnde Augen, bewegliche, feingliedrige Hände. Graublauer Anzug, offenes Hemd, schwarze Slipper, Tod’s, Prada oder aufwärts.
»Wie schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Bienvenue, cher Robert.« Er reichte ihm die Hand.
Landauer hatte vergessen, dass al-Soury seinen Namen am Penn Medical Center in Philadelphia stets französisch ausgesprochen hatte. Der Butler stand mit einem silbernen Tablett regungslos neben ihnen. Al-Soury gab eine kurze Anweisung. Der Kellner verneigte sich und kam wenig später mit einer Flasche Chateau Ksara Chardonnay Cuveé du Pape zurück, einem Weißwein aus der Bekaa-Ebene, wie al-Soury beim Füllen der Gläser mit einem gewissen Stolz erklärte.
Nachdem ein paar Erinnerungen an die gemeinsame Zeit in Philadelphia ausgetauscht waren, al-Soury kurz all das Schicksalhafte – terriblement! – zur Sprache gebracht hatte, das Robert in Amerika auf so vielfältige Weise widerfahren sei, ging es zu Tisch. An dem zur Hauswand hin gelegenen Teil der Loggia war ein Buffet aufgebaut: dicke Scheiben Roastbeef mit Kräutern garniert, geröstete Kartoffeln, wahlweise gedünstete oder eingelegte Gemüse, Salat, dazu zwei unterschiedliche Dressings. Daneben auf einem hölzernen Brett eine Auswahl verschiedener Käsesorten.
Tatsächlich wollte al-Soury, kaum hatten sie zu essen begonnen, von ihm wissen, was ihn in den Libanon geführt habe. Wo doch jetzt kaum einer den Weg hierher fände, weder die Touristen noch die reichen Scheichs, für die diese ganze Hotelpracht doch gebaut worden sei, weil sie sich auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt nicht länger von den Schiiten und der Hisbollah ausrauben lassen wollten.
»Es war immer mein Wunsch, dieses Land zu bereisen«, sagte Landauer. Irgendetwas ließ ihn zögern, sich al-Soury anzuvertrauen. »Sie wissen, ich bin durch unseren Beruf viel herumgekommen, aber bestimmte Länder fehlen mir noch, obwohl sie auf meiner geistigen Weltkarte immer ganz groß verzeichnet waren. Und ich habe Zeit, ein kleines Privileg des Älterwerdens und meiner gegenwärtigen Lebensumstände.« Er wunderte sich selbst, wie leicht ihm diese Lüge über die Lippen ging. Nur der letzte Satz entsprach der Wahrheit, einer schmerzhaften Wahrheit.
Al-Soury hob die Gabel, hielt inne. »Das freut mich. Allerdings sind schon viele hierhergekommen, um sich einen Traum zu erfüllen. Und fanden sich schließlich in einem Albtraum wieder.«
Stéphane al-Soury sah Landauer durchdringend an, als wüsste er genau, dass dieser ihm etwas verheimlichte, lächelte und legte ihm die Hand auf den Arm. Er begann wieder zu essen, und binnen Kurzem steckten sie tief in Fachlichem. Er sei noch immer einigermaßen à jour, sagte al-Soury. Obwohl, dieser rasende Fortschritt in der medizinischen und pharmazeutischen Forschung, ihm werde bei der Lektüre zunehmend schwindelig, und er sei froh, da nicht mehr mithalten zu müssen. Und überhaupt, ob die ständige Lebensverlängerung der richtige Weg sei? Er habe da Zweifel. Aber vielleicht seien dies nur die Gedanken eines langsam ins Alter abtauchenden Melancholikers, es sei nur richtig, dass er selbst, Robert, es in Berlin noch einmal wissen wolle, noch gehöre er ja nicht zum alten Eisen. Und ein Mittel gegen Alzheimer würde zweifellos einen neuen, großen Markt öffnen.
»Ich bin noch immer Wissenschaftler und Arzt, kein Geschäftsmann«, sagte Landauer. »Der Wiedereinstieg in Berlin fällt mir tatsächlich nicht leicht. Oft fühle ich mich, eine kuriose Erfahrung, wo ich nun bald sechzig werde, wie der Eleve einer neuen Zeit. Verstehen Sie das?«
»Sie wollen etwas zu Ende bringen, habe ich recht? Und den Menschen auf diesem Wege endgültig die Gnade des Vergessens rauben«, sagte al-Soury schmunzelnd. »Nur zu!« Viele würden ja heute so alt, dass sie den Kasten da oben, er tippte sich an die Stirn, lange bräuchten. Vor allem die Jungen mit ihrer Aussicht auf eine halbe Ewigkeit Leben.
»Ich komme aus einer anderen Zeit, da war das Leben oft kurz. Viel zu kurz«, sagte er und strich die Serviette glatt, die auf seinem Schoß lag. Für einen Moment schienen ihn Gedanken, Bilder davonzutragen.
Der Kellner war immer wieder an den Tisch getreten und hatte ihnen Wein nachgeschenkt, zum Hauptgang einen schweren Roten, auch aus Ksara.
Sie hoben erneut die Gläser und sahen sich an. Al-Sourys Augen funkelten, als wollte er sagen, »noch heute Abend werden Sie mir Ihre Geschichte erzählen, werter Kollege«. Dann tranken sie und setzten die Gläser wieder ab.
»Willkommen im Libanon, Robért«, sagte al-Soury, winkte mit der Serviette den Butler heran, der, einer Statue gleich, neben dem Buffettisch stand und auf das lautlose Kommando hin zum Leben erwachte. »Sie können abräumen, Joachino. Und bringen sie uns Arak, den besten, den wir haben.«
2
Berlin, wenige Wochen zuvor
Vor dem Bekleidungsgeschäft am Tauentzien warteten große schwarze Wagen in der Sonne. Oberklasse, getönte Scheiben, ein Maybach, ein Porsche mit geöffnetem Verdeck. Alle im Parkverbot. Der Turm der Gedächtniskirche, nur wenige Hundert Meter entfernt, war mit einem Baugerüst eingekleidet, Landauer konnte sich nicht erinnern, die Kirche jemals ohne Gerüst gesehen zu haben. Die Sonne brannte schon jetzt, aber für die kommenden Tage hatten die Zeitungen »Sahara-Hitze« angekündigt: Berlin, sechsunddreißig Grad. Als er aus der noch kühlen, von der Zeit der Kutschen erzählenden, hohen Eingangshalle seines Wohnhauses in der Giesebrechtstraße getreten war, hatte er die ausgebleichte Baseballkappe mit der Aufschrift Philadelphia aufgesetzt. Er mochte die Hitze, verband sie Berlin doch mit Madrid, Sydney, Hongkong, Philadelphia und New York, seiner Welt. Oder der Welt, die bis vor wenigen Monaten noch seine gewesen war.
Aus dem Augenwinkel nahm er vor dem Geschäft einen kleinen Smart wahr, am Steuer eine junge Frau. Er sah ihr Profil. Sie trug einen Hidschab, dazu eine langärmelige Tunika, hatte die Augen geschlossen und den Kopf zurückgelehnt, als schlafe sie. Ein silbernes Auto mit dem Brabus-Logo. Er betrat das Geschäft durch eine Schleuse aus Wind, zögerte, nahm dann die Rolltreppe in den ersten Stock. Hätte er dem schwarz uniformierten Wachmann an der Tür sagen müssen, dass er den kleinen Wagen in der Sonne und die schlafende junge Frau im Auge behalten solle?
An der Warenausgabe legte er die Auftragsbestätigung vor. Eine zierliche, dunkelhaarige Mitarbeiterin nahm sie entgegen, hielt sie sich vor die Nase wie eine schwer zu entziffernde Wegbeschreibung und verschwand hinter einem Vorhang.
Mit dem Anzug über dem Arm tauchte sie wieder auf. »Jetzt wird er passen«, sagte sie, legte ihn auf einen Bogen Seidenpapier, strich ihn mit dünnen, langen Fingern glatt, die Nägel rot lackiert, befühlte noch einmal den Stoff, das Seidenpapier raschelte. Aleyna Demirel las er auf ihrem Namensschild. Er sah ihr zu, wie sie den Anzug zusammenlegte, stellte sich ganz plötzlich vor, er würde noch einmal, wie wenige Tage zuvor, den Laden betreten, nur diesmal Arm in Arm mit dieser Aleyna, geborgen in einem Kokon selbstverständlicher Sorglosigkeit. Die junge Frau würde geduldig vor der Kabine auf ihn warten, ihn betrachten, berühren, bis sie gemeinsam das Richtige für ihn gefunden hätten. Sie würden zusammen wieder gehen, zu ihr nach Hause, eine Wohnung in Steglitz, kleiner Balkon, die Zimmer aufgeräumt und sauber, eine Mischung aus IKEA-Katalog und Mädchenzimmer. Aleyna würde für ihn kochen, ihn bitten, den Wein aufzumachen, und durch die geöffnete Küchentür von sich und ihrem Tag erzählen, lauter himmlische, tröstende Belanglosigkeiten. Im Bett würde sie das Licht löschen, ihn sanft auf den Hals küssen und sagen, schlaf gut, Robert.
»Ihre Unterschrift, unten rechts.« Er war irritiert von dem geschäftsmäßigen Ton seiner Aleyna, suchte auf der Abholbestätigung das kleine mit Kugelschreiber gezeichnete Kreuz und unterschrieb.
»Ein schöner Name«, sagte sie. »Ich habe einen Vetter in Lindau.«
Er sah auf. »Landau, nicht Lindau. Beide Orte liegen in Bayern.«
»Landauer, klar«, sagte sie, lächelte verlegen und reichte ihm den Abholschein.
»Danke«, sagte er und ging. Den Wagen vor dem Eingang hatte er längst vergessen.
Als er auf die Straße trat, sah er eine Menschentraube. In ihrer Mitte der Wachmann des Kaufhauses. Er drängte sich an den Schaulustigen vorbei. Die Türen des Wagens waren noch immer geschlossen, ein Fahrradbote mit kurzen Hosen und tätowierten Waden hatte die Hände über die Augen gelegt und spähte durch die Seitenscheibe hinein. Er zog am Türgriff, der Wagen war nicht abgesperrt. Der Bote wandte sich um und rief: »Ist hier einer Arzt?«
Landauer blieb stehen. Er war Forscher, schon lange ohne ärztliche Praxis.
»Bitte lassen Sie mich durch«, sagte er, schritt durch die kleine Gasse aus Schaulustigen, trat neben den Fahrradboten und beugte sich in den Wagen hinein. Die Hitze darin war unerträglich.
»Benötigen Sie Hilfe?«, fragte er die junge Frau.
Sie öffnete die Lippen, formte Worte, aber er konnte nicht verstehen, was sie sagte.
»Ich werde Sie jetzt berühren«, sagte er und legte ihr die Hand an Hals, Stirn und Puls. »Können Sie mich verstehen?« Sie nickte. »Sind Sie in der Lage, die Augen zu öffnen?« Nichts geschah. »Wir werden einen Rettungswagen rufen.«
»Nein, bitte nicht«, sagte sie. Jetzt öffnete sie die Augen und sah ihn an.
»Aber Sie müssen aus dem Wagen raus.«
Der Fahrradbote reichte ihm wortlos eine ungeöffnete Flasche Mineralwasser. Als die junge Frau die Flasche sah, schüttelte sie den Kopf.
»Trauen Sie sich zu, mit meiner Hilfe auszusteigen?«
Der Schweiß rann ihm von der Stirn, er spürte, wie sein Hemd nass wurde. Die Menschen waren weitergegangen, der Wachmann hatte sich wieder dem Ladeneingang genähert, blickte aber weiterhin zu ihnen herüber, der Fahrradbote war noch da.
»Kommen Sie, helfen Sie mir«, sagte Landauer zu dem Fahrradboten, griff über die junge Frau hinweg und stieß die Fahrertür weit auf. Ein Luftzug ging durch den Wagen, die Frau atmete tief aus. Sie hatte ebenmäßige Zähne, am linken Mundwinkel Reste von Lippenstift. Sie mochte Anfang zwanzig sein.
»Ein paar Minuten nur … bitte …«, sagte sie und schloss die Augen, als wartete sie nur darauf, dass irgendeine Kraftquelle im Inneren ihres Körpers wieder zu arbeiten begann.
»Sie sollten etwas trinken«, sagte Landauer.
Das Funkgerät des Boten krächzte, er antwortete. »Ich muss weiter«, sagte er, »die Flasche lasse ich Ihnen da.« Er stieg auf sein Rad, grüßte mit dem Finger am Helm und fädelte sich in den Verkehr ein.
»Sie werden kaum alleine weiterfahren können«, sagte er.
»Delbrückstraße. Keine fünf Minuten«, sagte sie.
»Im dehydrierten Zustand sollten Sie auf keinen Fall selbst fahren. Ich könnte Sie mitnehmen.«
»Nein, nicht nötig.« Sie suchte den Zündschlüssel, der noch immer im Zündschloss steckte, fand ihn nicht, beugte sich zur Seite, suchte erneut.
»Können Sie auf den Beifahrersitz rutschen?«
Der Wagen war leicht zu bedienen, nur beim Anfahren gab Landauer zu viel Gas.
»Ein Rennwagen«, sagte er. Die junge Frau, die nun neben ihm saß, den Kopf zurückgelehnt, lächelte.
»Ein Geschenk«, sagte sie. »Vater mag es nicht, wenn ich die Öffentlichen nehme oder mit dem Fahrrad unterwegs bin.«
Hinter dem großen Kreisel, wo ein aus Beton gefertigter Cadillac im Boden steckte, bogen sie rechts in die Königsallee ein. Vorbei an Villen und dem Mahnmal, das an die Ermordung Walther Rathenaus erinnerte, fuhren sie Richtung Delbrückstraße. Immer wieder sah Robert Landauer zur Seite, um sich zu vergewissern, dass die junge Frau noch bei Bewusstsein war.
Sie bogen in die Straße ein, und sie wies auf eine große Villa, aus der Zeit des preußischen Klassizismus, nur Zaun und Lampen schienen später hinzugekommen zu sein und wollten nicht so recht zu dem erhabenen Anwesen passen. Auf Masten installierte Überwachungskameras, in der Einfahrt zwei Wagen, blendend weiß, eine große Limousine und ein SUV.
Er stellte den Motor ab und reichte ihr den Schlüssel.
»Danke«, sagte sie, jetzt wieder ein wenig bei Kräften. »Wollen Sie ein Taxi? Ibrahim kann Ihnen eines bestellen. Es tut mir leid, dass ich Sie in diese Situation gebracht habe.«
Er winkte ab, ein paar Meter zu Fuß würden ihm guttun, er würde sich später ein Taxi heranwinken. Aus dem Kofferraum nahm er den Anzug, den er dort abgelegt hatte, und gab der jungen Frau eine Visitenkarte.
Die junge Frau ging langsam die Treppen zum Eingang hinauf, die Karte in der Hand, die Tür öffnete sich, und ein kräftiger, dunkelhäutiger Mann lugte heraus, sah nach rechts und links und ließ sie hinein.
3
Es war ein ungewöhnlicher Brief, unfrankiert und ohne Absender, die Adresse in etwas zu großen Buchstaben und mit einem Füller geschrieben. Am Abend, als er aus dem Labor kam, fand er ihn im Briefkasten. In der Küche nahm er ein Messer aus dem Block und schlitzte den Umschlag auf.
In Amerika hatte er zahlreiche solcher Briefe von Unbekannten erhalten, man hatte ihm geraten, sie zu ignorieren oder gleich an seinen Anwalt weiterzuleiten. Verrückte drohen, aber sie schießen nicht. Er mochte mit Tribalon vielen Menschen geholfen, Blutwerte verbessert, Leben erleichtert und verlängert haben, aber einigen wenigen war seine Forschung zum Verhängnis geworden. So hatte es die international renommierte Fachzeitschrift Reports in Medicine formuliert. Eine Patientenorganisation hatte die Sache aufgegriffen und den Mann hinter Tribalon ins Visier genommen.
Er ging an den Kühlschrank, schenkte sich ein Glas Mineralwasser ein, trank es in wenigen Zügen aus, nahm die Karte aus dem Umschlag und setzte die Brille auf.
Professor,
Sie haben meinen Dank verdient. Ich würde mich freuen, Sie morgen gegen Abend empfangen zu dürfen.
Fouad Tamimi
Eine Visitenkarte fiel heraus. Delbrückstraße. Ach ja, die junge Frau. Er hatte ihr seine Karte gegeben. Eine Einladung also, keine Drohung. Er war erleichtert, wollte sogleich absagen, eine E-Mail-Adresse stand ebenfalls auf der Karte. Er klappte den Computer auf, alles nicht der Rede wert, er sei schließlich immer noch Arzt.
Fouad Tamimi, so hieß der Mann. Der Name machte ihn neugierig, er wollte wissen, an wen er schrieb, und war überrascht, wie viel er über ihn fand; zum einen eine arabisch-deutsche Erfolgsgeschichte, eine Hymne auf Tamimi, wichtiger Träger des Berliner Wirtschaftslebens, in den Neunzigern sogar mit einer Medaille der IHK ausgezeichnet; zum anderen Berichte über eine drohende Anklage und über fragwürdige Geschäftsmethoden, Gewaltanwendung. Schließlich die Intervention der Ausländerbeauftragten des Senats, als sich eine große Tageszeitung wieder einmal auf die Litani GmbH bezog, einseitig und mit Stereotypen durchsetzt. Der deutsche Diskurs über das Gute und das Fremde.
Er las weiter. Tamimis Firma war offenbar über die Jahre zu einem kleinen Imperium herangereift, ein Mischkonzern des Geldes, weit über Berlin hinaus bekannt, dabei immer den Kernauftrag im Fokus: Inkasso. Geld eintreiben, gegen Provision. Nicht schön, aber erlaubt. Er entdeckte einen Hinweis, den manch anderer überlesen hätte, der ihn aber aufmerken ließ. Der Name Tamimi tauchte in einem Fachaufsatz auf und war mit einer Fußnote versehen. Ein Rechtswissenschaftler hatte eine längere Abhandlung über juristische und völkerrechtliche Aspekte der wichtigsten Migrationswellen in Berlin seit 1945 geschrieben, mit dem Fokus auf die Jahre 1982 bis 1983. Fouad Tamimi, da stand er, auf Seite hundertzweiunddreißig, mit der Fußnote siebenundzwanzig versehen. Landauer scrollte weiter, bis er am Ende des Textes die Fußnote fand.
27)
Fouad Tamimi, 1982 mit der ersten arabischen Fluchtwelle (Libanon/Palästina) in die geteilte Stadt gekommen. Hoher wirtschaftlicher Eigensinn, früher und nachhaltiger Erfolg in der Selbstständigkeit. Nur schwache Rückbindung an den Glauben (Islam) und traditionelle Familienstrukturen (Clans). Zitat: »Unsere Herkunft ist nicht so wichtig wie unser Ziel. Es gibt in dieser Stadt vielleicht wenig offene Arme, aber es gibt Hände, die arbeiten wollen. Wenn man uns lässt.« 2004.
Er beschloss, die Einladung anzunehmen und auf dem Rückweg vom Labor bei Tamimi vorbeizufahren. Er öffnete den elektronischen Kalender, schrieb in die 18-Uhr-Zeile: Rettungsaktion Tamimi, Nachsorge und klappte das Gerät wieder zu.
Am nächsten Abend parkte er den Wagen im Grünwald auf Höhe der Villa. Die Sonne verschüttete ihr spätes Gold über den Baumkronen. Die Straße war ruhig, leises Vogelgezänk war zu hören, im Garten das Klackern eines Rasensprengers. Es würde erneut eine heiße Nacht werden. Das Haus musste einst von einem Großindustriellen gebaut worden sein, Jahrhundertwende. Es wirkte stimmig in seinen ausladenden Proportionen, nur durch eine Renovierung vor nicht allzu langer Zeit hatte es verloren, die Ziegel der angebauten Garage waren zu hell und glänzend, die neu angebrachten Kandelaber links und rechts des Eingangs missraten.
Ein junger Mann stand auf einer Trittleiter, polierte das Dach eines vor dem Garagentor geparkten Vans, schwarze Scheiben, an der Beifahrertür in Silber die Aufschrift »Escalade«. Landauer klingelte, hörte ein Summen, und das schmiedeeiserne Tor ging auf. In der Haustür erwartete ihn der große, dunkelhäutige Mann, den er bereits gesehen hatte, als er die junge Frau nach Hause brachte, und bat ihn wortlos herein.
In der Halle war es kühl, sie hatte eine von kleinen Fenstern durchsetzte Kuppel, Lichtbahnen zeichneten sich am Boden ab. Die Wände waren aus hellem Marmor oder geschliffenem Sandstein, bilderlos. Aber in einer großen Bodenvase ein ausladender Blumenstrauß, der seinen Duft im Raum verströmte. Zwei orientalisch anmutende Stühle standen neben dem Bogen, der den Weg zu den nach hinten gelegenen Räumen freigab. Landauer blickte durch die lange Flucht des Flures in den Garten hinaus.
»Sie also sind der Mann, der meine Tochter gerettet hat. Eigentlich hätte ich Sie aufsuchen müssen und nicht Sie mich. Aber ich wollte Sie nicht erschrecken. Ein Fremder vor Ihrer Tür, was hätten Sie denken sollen?« Fouad Tamimi musste sich von der Seite genähert haben. Er streckte die Hand aus, lachte und wies in Richtung Garten.
Tamimi war ein paar Jahre älter als er, maßgeschneiderter Anzug, kräftige Augenbrauen und ein leicht ergrauter Schnauzbart. Der Mann, der die Tür geöffnet hatte, folgte ihnen mit wenigen Schritten Abstand.
»Der einzige Schatten, der nicht kühlt«, sagte Tamimi, als er bemerkte, dass Landauer sich umwandte, berührte seinen Arm und wies auf einen der wuchtigen Sessel, die vor dem Fenster platziert waren.
Auch hier keine Bilder an den Wänden. Nur ein Wandteppich über einer Sitzgruppe, zwei rechtwinklig angeordnete, breite Sofas mit verschiedenen bunten Decken und Kissen. Es roch nach frischem Kaffee. Baklavas in unterschiedlichen Formen standen auf einem runden Beistelltisch.
»Bitte setzen Sie sich, Professor.«
Eine Frau mit weißer Schürze kam herein, auf dem silbernen Tablett nur eine Tasse, dazu Milch und Zucker.
»Mögen Sie ihn orientalisch? Süß oder ungesüßt? Oder einen deutschen Filterkaffee? Dann bekommen Sie Arabica.« Er lachte erneut.
»Arabica klingt gut«, sagte Landauer.
»In ein paar Tagen haben wir es geschafft. Ich kann nicht behaupten, dass Allah in mir den besten Partner hat, aber der Ramadan ist uns in der Familie heilig. Layla nimmt sich in diesen Tagen immer zu viel vor. Unterwegs, unterwegs. Und diese Hitze! Als hätte jemand Damaskus an die Spree verlegt. Ab jetzt wird Ibrahim sie begleiten.«
Er wies mit dem Kopf auf den kräftigen, dunkelhäutigen Mann, der im Türrahmen stand, die Hände auf Gürtelhöhe verschränkt.
»Ich möchte Ihnen danken, für die, wie sagt man …?« Tamimi schien beim Reden ein Gedanke gekommen zu sein, der ihn kurz ablenkte. »… Hilfsbereitschaft. Das meine ich. Und ein großes Herz.« Er legte eine Hand auf die Brust und neigte den Oberkörper vor.
Er habe nur das Notwendige getan, sagte Landauer. Layla sei dehydriert gewesen, daher der Schwächeanfall. Schließlich sei er Arzt.
»Und ein großer Wissenschaftler«, sagte Tamimi.
Landauer war erstaunt, wie gut Tamimi über ihn Bescheid wusste.
»Ich bin das, was wir in unserer Forschung einen Kinetiker nennen«, sagte er.
»Ich weiß«, sagte Tamimi, lächelte und wurde dann ernst. »Sie sind in der Lage, vorherzusagen, was passiert, wenn wir ein Medikament einnehmen. Und wenn es ein neues ist, wissen Sie alles darüber, bevor es die Menschen in die Hand bekommen, und können sie im Ernstfall warnen. Doch manches, was uns gesund machen sollte, macht uns krank. Auch das ist das Leben.«
»So in etwa«, sagte Landauer. Er spürte eine leichte Unruhe. War es ein Fehler gewesen, die Einladung anzunehmen?
»Kannst du kein Stern am Himmel sein, so sei eine Lampe im Haus, so sagt man bei uns, daran habe ich mich immer gehalten«, sagte Tamimi. Es schien erneut in ihm zu arbeiten, so als hätte Landauers Anwesenheit etwas in ihm ausgelöst.
Tamimi lehnte sich zurück. »Sie sehen, ich habe mich über Sie, den Retter meiner Tochter, erkundigt. Und Sie werden das Gleiche getan haben, was mich angeht. Und dennoch sind Sie gekommen. Hören Sie nicht auf das Geschwätz, das Sie über mich gelesen haben. Wer arbeitet, energisch und erfolgreich ist, löst Reaktionen aus. Ma fi shajara hazzaha l hawa, sagt man bei uns. Es gibt keinen Baum, der noch nicht von einer Brise geschüttelt wurde.«Er machte eine Pause. »Ich bin sicher, Sie verstehen das.« Seine Stimme senkte sich. »Ihnen wird nicht gefallen haben, was man in Amerika über Sie geschrieben hat. Ich habe sogar das Wort Mörder gelesen. Menschen können heute schreiben, was sie wollen, und niemand hält sie auf.«
Newsletter Nr. 12 der landesweit agierenden Patientenorganisation NEWLife, Ausgabe vom Januar 2014, erster Absatz. Können Ärzte zu Mördern werden? So lautete die Überschrift. Darunter sein Foto. Er hatte den Text immer wieder gelesen.
Tamimi hatte sich gut vorbereitet.
»Ich hoffe, Sie haben gute Anwälte.«
»Denke schon. Ich bin nur erstaunt, wie viel Zeit Rechtsstreitigkeiten brauchen. Selbst wenn man gewinnt, hat man bis dahin alles verloren.«
»Nur die Anwälte gewinnen immer«, sagte Tamimi und lachte. Dann wurde er wieder ernst.
»Sie werden den Artikel gefunden haben, in dem mein Name steht. Damals wollte dieser Wissenschaftler, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, für mich und meinen Fall Verständnis erwirken, wo doch jeder sagte, diese Flüchtlinge aus dem Libanon würden sich nie eingliedern lassen. Araber, Schlitzohren, Sozialschmarotzer. Das ist nicht wahr. Ich wollte kein Mitleid und will es heute nicht, ich will nur Gerechtigkeit. Je älter ich werde, desto mehr.«
Tamimi lehnte sich wieder zurück, hob das Kinn und schloss die Augen, atmete tief aus. Er öffnete sie wieder und rang sich ein Lächeln ab. Zugleich wieder dieser sonderbare Blick. Als ob er ihn schon einmal gesehen hätte.
»Wenn ich behilflich sein kann, lassen Sie es mich wissen. Ich habe seit einigen Wochen mehr Zeit. Mein Sohn Abdullah ist mir eine enorme Hilfe und hat mit unseren Unternehmungen große Pläne. So ist das, wir werden zwar nicht verstoßen, aber wir sollten auch nicht im Weg stehen, wenn die Zukunft anklopft.« Er hielt kurz inne. »Haben Sie Kinder?«
Die Frage kam überraschend.
»Einen Sohn, er lebt hier in Berlin.«
»Einen Sohn, was für ein Geschenk. Kinder sind die Flügel des Menschen.«
Sollte er Clara erwähnen? Er wusste, was geschehen würde, wenn er ihren Namen aussprach. Er hatte es oft genug erlebt und noch öfter zu verhindern versucht. Es war, als stünde er auf einer Rampe, die immer steiler wurde, ohne Halt, bis er ins Rutschen kam und schließlich stürzte. Meist spät am Abend, wenn er allein war. Aber sie nicht zu erwähnen hieße, so zu tun, als hätte es sie nie gegeben.
»Und eine Tochter, Clara«, sagte er. Nichts geschah.
»Layla und Abdullah. Meine Tochter haben Sie ja kennengelernt. Sie lehrt mich den Glauben. Kinder können streng sein und unerbittlich. Hätte mich als Junge einer gefragt, Sunnit oder Schiit, ich hätte es nicht beantworten können. Aber heute, es lebe der Unterschied! Es gibt nur noch dafür oder dagegen, die Zwischentöne gehen verloren, oder auch, wie sagt man hier, die Grautöne. Dabei ist Grau die eigentliche Farbe der Welt.«
Im Flur klingelte ein Handy. Tamimi erhob sich ein wenig schwerfällig.
Er sprach mit dem Anrufer Arabisch, seine Stimme klang jetzt energisch, es musste um etwas Wichtiges gehen. Zugleich bemerkte Landauer, dass er immer wieder zu ihm herüberblickte, als hätte der Anruf mit ihm oder seiner Anwesenheit zu tun.
»Manchmal hilft nur Deutlichkeit«, sagte er, nachdem er aufgelegt hatte und sich wieder näherte. »Mein Sohn Abdullah. Unsere Auffassungen vom Geschäft sind recht unterschiedlich. Manchmal frage ich mich, ob er inzwischen mehr ein Deutscher ist als einer von uns. Aber so soll es wohl sein. Er ist hier, in diesem Land geboren. Abdullah wird die Firma übernehmen. Das steht fest. Ich muss ihm einen gewissen Freiraum lassen, auch wenn es mir schwerfällt.« Er griff nach der Lehne des Sessels, als suchte er Halt.
Es war Zeit zu gehen. Robert Landauer erhob sich.
»Einen Moment noch, bitte …« Tamimi gab Ibrahim ein Zeichen. Ibrahim verließ den Raum.
Kurze Zeit später kam er zurück und nickte. Layla hatte die dunklen, glänzenden Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Nahezu lautlos war sie ins Wohnzimmer gekommen. Sie trug eine Tunika, dieses Mal in dunklem Grün.
»Vater hat mir nicht gesagt, dass Sie kommen«, sagte sie. Ihre Stimme war sanft und hell. »Aber ich möchte mich gern bei Ihnen bedanken. Ich habe Ihnen Umstände gemacht.« Sie sprach, anders als ihr Vater, ohne jeden Akzent.
Landauer winkte ab. Er sei im Aufbruch und froh, sie in guter Verfassung zu sehen.
»Layla, bring den Professor zur Tür.«
Landauer verabschiedete sich, Tamimi reichte ihm die Hand, bewegte sich aber nicht von der Stelle.
Layla ging voran. An der Haustür angekommen, wandte sie sich zu ihm um. »Ich werde vorsichtiger sein, aber Vaters Schatten brauche ich nicht. Allahs Hand wacht über uns, er schickt uns gute Menschen.«
Er trat in die Hitze hinaus. Layla blieb in der Tür stehen, bis er bei seinem Wagen angekommen war, den Motor gestartet und die Fenster heruntergelassen hatte. Sie schien auf etwas zu warten. Vom Auto aus sah er, wie sich das Tor vor der großen Doppelgarage öffnete, wenig später kam ihm ein VW Golf entgegen, älteres Baujahr, der Lack von der Sonne stumpf. Auf der Höhe seines Wagens verlangsamte er, der Fahrer, ein junger Mann, schien ihn kurz zu betrachten, beschleunigte noch einmal kurz und bog mit Schwung auf das Grundstück der Tamimis ein. Im Rückspiegel sah Landauer, wie er, ein Buch unter dem Arm, ausstieg. Er mochte um die dreißig sein und ging in Richtung Haustür, in der noch immer Layla stand. Das also war Abdullah Tamimi.
4
Victoria Leclair breitete die Arme aus, als freue sie sich über das unerwartete Wiedersehen mit einem Freund. Etwas zu herzlich, immer eine Umdrehung zu viel. Er konnte sich nicht erinnern, mit der Frau seines Kollegen und Chefs jemals mehr als zwei Sätze gewechselt zu haben. Landauer reichte ihr einen Strauß Dahlien, den sie an eine junge Frau mit gestärkter Schürze weitergab, als gelte es, den Weg umgehend für neue Gäste frei zu machen.
»Der Kongress findet draußen auf dem Vordeck statt, wie Winfried sagen würde. Bei diesem Wetter!« Sie lachte. Dann wandte sie sich ab und stieß darauf einen Freudenschrei aus. »Bernhard, wie schön!«
Mit einem Aperol Spritz in der Hand ging er durch das große Wohnzimmer. Der Duft von gegrilltem Fisch und Scampi zog herein, er hörte Stimmen, Lachen. Ein Sektkorken knallte. Auf der Fensterbank entdeckte er eine Sammlung von Buddelschiffen und den maßstabgerechten Nachbau des Viermasters Pamir. Er hätte absagen sollen. Aber es war der sechzigste Geburtstag von Winfried Leclair, und er war ihm zu Dank verpflichtet.
Eine junge Frau in einem engen, blauen Kleid, vielleicht die Gattin eines Oberarztes, stand etwas abseits auf der Terrasse und blickte zu ihm herüber. Sie schien sich zu langweilen. Als er schon fast an ihr vorbeigegangen war, hörte er ihre Stimme.
»Sie reden schon wieder nur über das Fach. Ich hoffe, Sie sind kein Mediziner! Melanie Trautmann«, sagte sie und reichte ihm die Hand.
»Robert Landauer.«
»Halt, lassen Sie mich raten.« Sie trat einen Schritt zurück und betrachtete ihn. »Ich habe Sie schon einmal gesehen. Im Fernsehen?«
»Wohl kaum«, sagte Landauer.
»Also im Radio«, sagte sie und lachte. »Nein, ich hab’s, in einer dieser Fachzeitschriften, die mein Mann überall im Wohnzimmer herumliegen lässt. Rupert hat seit drei Jahren kein Buch mehr gelesen. Immer nur diese Journals of … Lesen Sie – ich meine, Bücher, Romane?«
»Soweit es meine Zeit zulässt.«
»Das hätte von Rupert kommen können. Also nein! Manchmal lese ich ihm abends im Bett vor, und schon ist er eingeschlafen. Ich liebe Bücher, vor allem von Autoren mit unaussprechlichen Namen.«
Er wollte sie fragen, warum, ließ es dann jedoch sein. Würde ihre Antwort ihn interessieren? Er sah seine Gesprächspartnerin genauer an. Sie war auf eine vordergründige Weise hübsch, das Blond ihrer langen Haare echt. Ohne Frage war sie mit ihrem Mann hier, der sich längst unter die Gäste, Kollegen und Freunde, gemischt hatte, Rupert, der nicht las, so wie er viele Jahre nicht gelesen hatte, und den sie heute Abend so wenig zu sehen bekommen würde wie sonst auch, der jedes Gespräch, selbst eines über die Liebe, im Ton eines Fachgesprächs führte und dem sie dennoch, das aufgeschlagene Buch vor der Brust und nach stundenlangen Telefonaten mit Freundinnen, allen nächtlichen Tränen zum Trotz die Treue halten würde, auch über das Verfallsdatum ihrer Liebe hinaus.
Er hasste solche Gedankenkaskaden, die stets an einem Nullpunkt endeten. Und sich selbst hasste er dafür, dass er sich auf so einer Party nicht unterhalten konnte wie jeder andere auch.
Professor Winfried Leclair, Jubilar und Ordinarius der Pharmakologie, war inzwischen mit Unterstützung eines Kollegen auf einen Stuhl gestiegen und schlug gegen sein Glas. »Ich möchte Sie und euch alle … Victoria, bitte komm an meine Seite … vorher kann ich nicht beginnen.«
Leclairs Frau hakte Landauer unter und zog ihn mit sich, kurz vor dem fragilen Postament ihres Gatten löste sie sich wieder von ihm.
»Es war Victorias Idee, dieses Fest. Ich wollte mich verkriechen, im Labor, oder auf einen Törn gehen, hoch nach Skagen. Aber ihr wisst ja, dass wir bei unseren Frauen keine Chance haben. Also feiern wir an Land, was bleibt uns anderes übrig, und auch das Wetter spielt mit. Statt mich bei jedem Einzelnen von euch für sein Kommen zu bedanken und dabei vielleicht sentimental zu werden, bitte ich euch, alle das Glas zu heben. Herzlich willkommen. Und nun genießt den Abend. Hoffe, die Kombüse hat ordentlich gearbeitet. Das Buffet ist eröffnet.«
Beifall, Gemurmel, jemand aus den hinteren Reihen stimmte ein »Happy Birthday« an, und alle fielen mit ein, fast klang es wie ein Shanty. Leclair stieg von seinem Stuhl, schwankte bei der Landung auf dem Grün, verbeugte sich und lauschte dann erhobenen Hauptes seinem Ständchen. Als er Landauer erblickte, prostete er ihm zu.
Das war der Mann, der ihm in Berlin einen Neubeginn ermöglicht hatte. Dazu eine Privatdozentur, Forschungsgelder in respektabler Höhe, allemal genug, um eine Weile durchhalten zu können. Neurodegenerative Krankheiten waren ein Weltmarkt. Industrie, Forschung und angewandte Medizin bewegten Milliarden. Warum sollte der einstige Star Robert Landauer, bis vor Kurzem Primus inter Pares in der wissenschaftlich-medizinischen Fachwelt, nicht noch einmal einen neuen Kontinent entdecken, wie Leclair bei ihrer ersten Begegnung sofort gesagt hatte. Und er war, das immerhin war die positive Seite des Tribalon-Skandals, für seinen gegenwärtigen und damit übersichtlichen Marktwert zu bekommen gewesen.
Landauer wusste das alles, auch dass dem Samariter Leclair nicht zu trauen war, wie keinem seiner Kollegen im wissenschaftlichen Betrieb.
Professor Winfried Leclair, der darauf aus war, seinen Lehrstuhl an der Charité auszubauen, hatte das Ganze als Chance gesehen und Landauer in sein Institut eingeladen, kaum war dieser, gedemütigt und juristisch noch immer im Dickicht, in Berlin angekommen. Sie sind mein Mann. Er solle bei ihm und bei keinem anderen anheuern, so Leclair. Auch wenn er, wie er mit einem Blick über den Brillenrand hinzufügte, privat wie beruflich wohl noch immer in einer kleinen Havarie stecke. Dennoch, die Verabredung war schnell getroffen und von kristalliner Klarheit. Das Patent, das der Volkskrankheit Alzheimer den Kampf ansagen würde, sollte aus Berlin kommen, und Prof. Dr. Robert Landauer würde in der alsbald zu gründenden GmbH bei diesem groß angelegten Manöver die Forschungsentwicklung leiten. Zu ihrer beider Nutzen. Meriten und Moneten, was gebe es Schöneres, sagte Leclair und lachte. Um seinen Fall, Landauer möge den doppelten Sinn dieses Wortes nicht falsch verstehen, würden sich die Anwälte kümmern. Seine Empfehlung sei die Kanzlei Trutz, Langhoff & Partner. Und hier besonders Dr. Andreas Trutz. Heißt so, arbeitet so, hatte er erklärt. Bevor diese Sache in Amerika nicht endgültig aus dem Weg geräumt sei, könne es für Robert Landauer on the long run schwierig werden. Also los.
Ihm hatte die zupackende Art Leclairs gefallen. Er mochte den Mann mit der norddeutschen Dialektfärbung auf Anhieb. Zwar war alles an ihm irgendwie zu laut und zu groß, alles, was er sagte, auf Effekt und Wirkung aus, aber er war fachlich unangreifbar, zudem eine wichtige Stimme im Hochschulsenat. Rotary Club, Segelklub am Wannsee, die ganzen bürgerlichen Insignien und Epauletten des Erfolgs und des sicheren Standes auf der Brücke aus Geld, Anerkennung und Wissen.
Er hatte zugesagt. In der Wissenschaft gab es immer ein Danach und einen Neuanfang. Valide Falsifikation war stets der erste Schritt zur nächsten Erkenntnis. Das war sein Credo, warum sollte es nicht auch in Berlin gelten? Auch wenn er in den in einem Souterrain untergebrachten, nahezu lichtlosen Seminarräumen der Universität statt wie in Amerika zweihundert nur noch zwanzig Hörer in seinen abendlichen Vorlesungen hatte und der Prozess, der ihn rehabilitieren und Reports in Medicine viel Geld kosten sollte, noch immer nicht in Sicht war.
Landauer schreckte aus seinen Gedanken auf. Leclair hatte sich ihm von der Seite genähert und stand plötzlich neben ihm. Er schien leicht angetrunken, sein weißes Hemd spannte über dem Bauch.
»Schön, dass Sie gekommen sind, Kollege. Da muss man durch, mit Anstand, Sie werden das selber noch erleben. Und, machen Sie sich Sorgen? Wegen unseres kleinen Projektes?«
»Denke nicht.«
Leclair lachte, es klang, als klopfe man mit einem Stück Holz auf eine leere Tonne. »Das gefällt mir: Sorgen? Denke nicht. Warum halten wir es nicht alle so? Der Staat könnte sie einfach verbieten. Aber stattdessen befördert er sie. Diese ganze Rettungsaktion für den Orient wird uns hier in Berlin noch auf die Füße fallen. Sie und ich, wir kennen die Welt, wir wissen, dass sie nicht überall gleich ist. Und unser europäisches Projekt der Freiheit ist ein fragiles, kaum haben wir die Griechen wieder reanimiert, sollen wir hier für die neuen Ankömmlinge Minarette bauen. Und bei diesem Wüstenwetter hat die Notaufnahme zu Ramadan wieder ordentlich zu tun. Kippen reihenweise aus den Latschen. Wenn der Islam ein Problem hat, soll er es selber lösen. Am besten zu Hause.«
Landauer wollte etwas entgegnen, dass Leclair irrte, Humanität nicht teilbar sei, aber ihm wollte der treffende Satz, der Leclair zum Schweigen gebracht hätte, nicht einfallen.
»Noch etwas, entre nous. Ich habe Ihren Bericht gelesen, in unserem Logbuch. Wir sind in der Entwicklung unseres Produktes tatsächlich nicht so schnell, wie wir gehofft hatten. Sie und ich, wir beide wissen das. Am Ende wird das keine Rolle spielen. Aber wir könnten diese Zeit für uns nutzen, während die Chemiker weitertüfteln.« Er nahm einen Schluck, sah sich im Garten um und wandte sich wieder Landauer zu, den Kopf ein wenig gesenkt. »Vor allem Sie, lieber Kollege. Ihr Fall, ich bin sicher, Sie bekommen das hin. Nutzen Sie die Zeit, etwas für sich zu tun, Urlaub, etwas Schönes, stechen Sie einfach mal in See, während die Anwälte ackern. Wenn wir durch diese kleine Meerenge durch sind, werden Sie lange Zeit unter Volllast fahren. Da brauche ich Sie auf der Brücke. Denken Sie mal drüber nach, ich gebe Ihnen für die kommenden Wochen Prokura für die Lustbarkeiten des Lebens. Vorausgesetzt, Sie versprechen mir, danach gestärkt und gestählt wieder an Bord zu kommen.« Er lachte, legte Landauer die Hand auf die Schulter und ging auf eine Gruppe junger Oberärzte zu, die ihre Gläser hoben und mit ihm anstoßen wollten.
Das war das Letzte, was er suchte, Lustbarkeiten. Leclairs Angebot war freundlich gemeint und auch nicht uneigennützig, aber er beschloss: abgelehnt. Auch wenn die vorklinische Forschung noch immer feststeckte wie ein Pfropf auf der Flasche und an Testreihen mit Realpatienten nicht zu denken war, der Markt rief nach einem Mittel gegen Alzheimer, und die Wissenschaft war hier in der Pflicht. Er wollte vor Ort sein, hatte sich mit dem Loslassen schon immer schwergetan, seit dem Tribalon-Skandal war es nicht besser geworden. Noch nie hatte er mit sich selbst viel anzufangen gewusst, eine Auszeit kam nicht in Betracht.
Er wandelte unschlüssig durch die Menge der immer ausgelassener und lauter werdenden Gäste und hoffte, auf niemanden zu treffen, den er kannte. Aber die Gefahr war nicht allzu groß, er war erst seit einem halben Jahr in der Stadt, außer einer Handvoll Kollegen und Kolleginnen hatte er bisher niemanden kennengelernt, und es sah auch nicht so aus, als würde sich das noch ändern. Er ließ sich Fingerfood anbieten, trank zwei weitere Gläser Wein, stellte sich stumm zu Gruppen dazu, wunderte sich und war zugleich dankbar, wie wenig Notiz man von ihm nahm. Auf der Terrasse baute eine Band ihre Instrumente auf. Es war inzwischen dunkel, und Fackeln beleuchteten den Garten. Bald würde der Tanz beginnen. Die Pflichtpräsenz im Reich der Leclairschen Lustbarkeiten war abgeleistet. Ohne sich zu verabschieden, wollte er gehen.
»Ich habe alles verpasst. Die Reden, das Essen. Aber es ist schön, dich zu sehen, Robert.«
Neben ihm stand seine Kollegin Monique Kerner. Warum war er nicht auf den Gedanken gekommen, dass Leclair die Schweizer Toxikologin, die dieser wie ihn für sein Projekt angeworben hatte und über die Maßen schätzte, ebenfalls eingeladen hatte? Er wandte sich ihr zu. »Keine Reden. Nur ein Toast des Gastgebers.«
»Und du?« Sie lachte.
»Das wäre nicht angemessen gewesen. Wir sind Kollegen. Leclairs Freunde hätten aufstehen sollen oder Verwandte. Frühere Weggefährten vielleicht. Zudem ist reden nicht meine Sache …«
»Es sei denn, es geht ums Fach.«
»Das ist etwas anderes.«