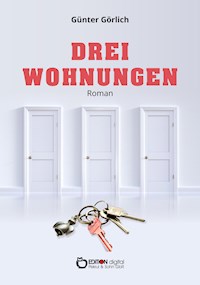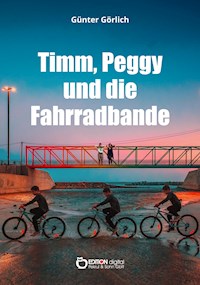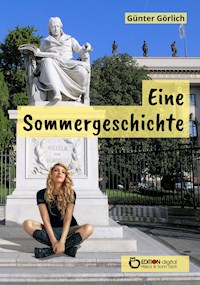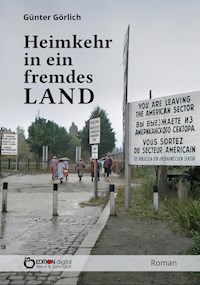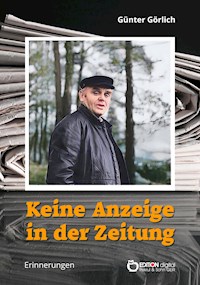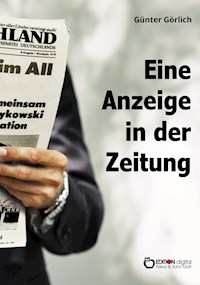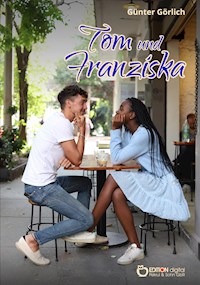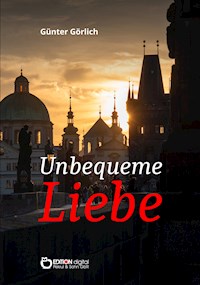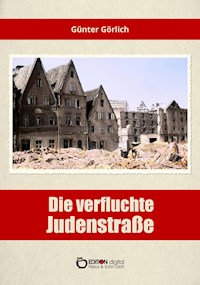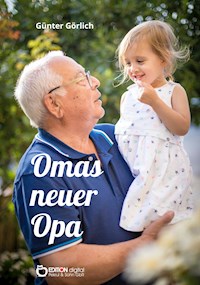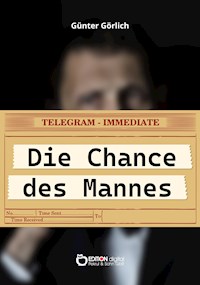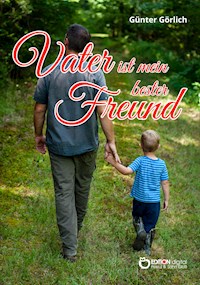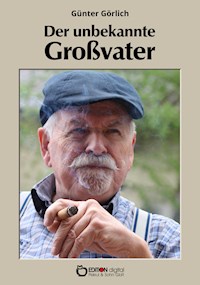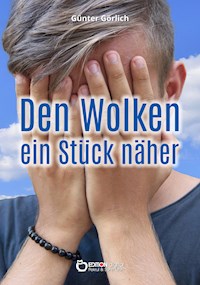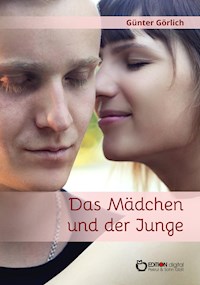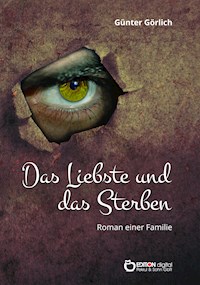
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
„Ihr wisst es, wie es kam. Es musste nicht so kommen.“ Diesen Gedanken des früheren expressionistischen Dichters und späteren ersten DDR-Kulturministers Johannes R. Becher hat Görlich diesem „Roman einer Familie“ vorangestellt. Die Familie ist die Berliner Arbeiterfamilie Wegener. Vor allem aber ist es der Roman der beiden Söhne Arthur und Willi. Die Handlung setzt im Frühjahr 1939 ein: Wie das Radio berichtet, ist die deutsche Wehrmacht im Schneegestöber in Prag einmarschiert - am 15. März 1939. Arthur und Willi arbeiten zu dieser Zeit in der gleichen Bude, in den Temler-Werken, wo Flugzeugmotoren produziert werden und die bald zu einem nationalsozialistischen Kriegsmusterbetrieb aufgebaut wird. Die Risse in der Familie zeigen sich sehr deutlich an einem Maisonntag 1939, als Vater Hermann Wegener 60 wird und ein bisschen gefeiert wird. Auch Arthur und Willi und ihre Frauen kommen zu Vaters Ehrentag – aber nicht gemeinsam. Es wird Bier getrunken und vorsichtig geredet, um nichts Falsches zu sagen. Doch es kommt trotzdem zum heftigen Streit: Vera sagte, als die kleine Monika ins Zimmer kam und sich an sie schmiegte: „Wie schön es heute die Kinder haben, Vater. Wenn du an deine Kinderzeit zurückdenkst, nicht? Ach, wie schön es unsere haben.“ Alle sahen auf Monika, auf ihr Stupsnäschen und nickten. Nur Arthur sagte: „Hoffentlich haben es die Kinder noch lange so, hoffentlich.“ Eigentlich war das keine besonders überlegte Bemerkung. Es waren nur seine Gedanken, die er aussprach, weil er manches wusste und ahnte. Er wollte auch keinen damit treffen. Willi warf den Kopf hoch, und erregt fragte er: „Was meinst du damit?“ Die Frage ließ alle aufhorchen. Arthur hätte jetzt sagen können, dass er das ganz allgemein gemeint habe. Aber als er die Wut in Willis Blick bemerkte, den vor Spannung halb offnen Mund der Vera sah, die noch immer die Hand auf dem Wuschelkopf der Monika liegen hatte, diese saubere und gesunde deutsche Familie, da sagte er: „Ich meine, man jagt uns dem Krieg entgegen.“ Er fuchtelte mit den Händen in der Luft umher und schrie: „Du bist immer der gleiche, du bist ein Hetzer.“ Schon immer habe er schweigen müssen, weil der Herr Bruder die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Im Werk müsse er Angst haben, schief angeguckt zu werden und sich mit seinen Vorgesetzten zu verfeinden. Alles setze er, der fanatische Kommunist, aufs Spiel, die ganze Familie bedrohe er. Er habe keine Kinder, werde wohl nie welche haben, deshalb könnten er und Maria so sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Günter Görlich
Das Liebste und das Sterben
Roman einer Familie
978-3-96521-685-3 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien 1963 im Verlag Neues Leben Berlin.
© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Ihr wisst es, wie es kam,
Es musste nicht so kommen.
Joh. R. Becher
Erstes Kapitel
Das Fabriktor war neu, aus Schmiedeeisen war es gefertigt. Auf beiden Flügeln hatten sie das Zeichen der Deutschen Arbeitsfront eingeschmiedet, dieses klobige Zahnrad mit dem Hakenkreuz. Die Waggonfabrik Lemke & Homann gab es aber seit sechzig Jahren. Als Hermann Wegener hier vor dreißig Jahren als Stellmacher anfing, duckten sich die rußigen Hallen schon genauso um den langen Schornstein.
Wegener zog sich die blaue Schirmmütze tief in die Stirn; der Regenwind blies ihm ins Gesicht. Das ist ein Winter in diesem Jahr! Im Januar konnte man die Joppe aufknöpfen, und jetzt, da es Frühling wird, will es noch einmal kalt werden. Im Schrebergarten stehen die fünf Obstbäume, die sind sorgfältig gekalkt. Wenn sie bloß nicht erfrieren!
Von allen Seiten strebten graue Gestalten auf das Fabriktor zu. Sie kamen aus den Hallen, ihre abgewetzten Taschen, aus denen die blauen Henkeltöpfe hervorlugten, unter den Arm geklemmt.
Hermann Wegener holte seinen Werkausweis aus der Joppentasche. Am Tor würde es wieder Gedränge geben. Jeden Tag filzte die Werkschar. Sie suchten Werkzeuge, Nägel und Schrauben. So eine Holzschraube war für die Firma Lemke & Homann eben etwas wert.
Da sah Wegener vor dem Tor seinen Enkel Martin. Er erschrak. Eilig stolperte er auf das Wachhäuschen zu. Was will Martin hier? Bei diesem Wetter?
Der Alte drängte sich in die Schlange der Wartenden und blickte unruhig zu dem Jungen hinüber.
Der Martin – wie lang und mager er geworden ist! Im letzten Jahr ist er so aufgeschossen. Warum macht er den Buckel bloß so krumm? Die schwarze Jacke hat er an, diese verfluchte Pimpfenjacke! Da muss er ja frieren. Den Buckel könnte er trotzdem gerade machen. Wie das aussieht!
Der Werkscharmann musterte den Alten misstrauisch, als wolle er ihn festhalten.
Hermann Wegener warf dem rothaarigen Burschen einen finsteren Blick zu.
„Hab nichts drin“, murmelte er.
„Halt!“, befahl der Werkscharmann und kurbelte eilig den Schlagbaum hoch. Ein schwerer Maybach rollte durch das Tor. Der Chauffeur trug eine riesige steife Tellermütze. Vor den hinteren Fenstern waren Vorhänge. Der Werkscharmann riss seinen Arm hoch und erstarrte. Der Maybach fuhr durch eine Pfütze, die blank gewichsten Stiefel waren voller Spritzer.
Der brüllt noch „Heil Hitler“. Weiß der Teufel, ist das ein Schleimer, dachte Wegener bissig.
„Was ist nun?“, knurrte er.
Der Rothaarige sagte zerstreut: „Ab – los!“
„Großvater, es ist was passiert“, sagte Martin. Seine bläulichen Lippen zitterten.
Wegener kniff die Augen zu, als blende ihn grelles Licht.
„Nu, nu, Martin.“ Er starrte in das blasse Jungengesicht mit den breiten Backenknochen. „Was ist denn, Martin? Na, sag schon!“
„Onkel Arthur haben sie abgeholt!“
Wegener presste den Henkeltopf in seiner Faust, dass der Verschluss aufsprang.
„Sie haben ihn abgeholt, so.“
Dann blickte er sich hastig um. Doch sie standen abseits am Zaun, und im stärker werdenden Regen beachtete keiner den alten Mann und den Jungen.
Wegener sah über den Kopf des Jungen hinweg. Der sagte aufgeregt: „Tante Maria hat mich gleich zu Großmutter geschickt. Ich soll rennen, hat sie gesagt. Onkel Arthur haben sie aus der Fabrik geholt, dort, wo er arbeitet, das hat einer Tante Maria heimlich erzählt. Sie hat mich gleich losgeschickt. Großvater muss es doch wissen! Großmutter hat so eine Angst, sie ist in der Küche immerzu hin und her gelaufen, immer hin und her.“ Martin schwieg.
„Hast du gehört, Großvater?“, fragte er zögernd.
„Du frierst, Martin“, sagte Hermann Wegener, „das Pimpfending ist zu dünn.“
Der Junge sah seinen Großvater verwundert an. Der fuhr sich mit der freien Hand über das Gesicht, als wolle er die Feuchtigkeit wegwischen oder die trüben Gedanken. „Du, Martin“, flüsterte er, „renn zu Großmutter, renn, so schnell du kannst. Sag Großmutter, sie soll das Päckchen wegtun. Sie weiß schon, was ich meine, sie soll es verstecken. Von dem alten Platz soll sie es tun. Sag Großmutter, ich komme heut später, ich hab noch einen Gang zu machen, ja.“
Er beugte sich zu Martin hinab. „Sag Großmutter, sie soll keine Angst haben. Und du, du behältst die Pimpfenjacke an. Wenn sie kommen, musst du ganz laut ,Heil Hitler' schreien. Mach das auch, wenn sie kommen.“
Martin schluckte. Auf seinem regenfeuchten Gesicht erschien ein zaghaftes Lächeln. „Das werd ich machen“, sagte er.
Der Alte räusperte sich verlegen. „Du, Martin, unter dem Küchentisch sind zwei Feilen. Zwischen die Tischleiste hab ich sie eingeklemmt. Sie müssen weg! Sag Großmutter, das soll sie machen. Es sind gute Feilen. Sie soll sie nicht wegwerfen. Die Stempel habe ich rausgekratzt.“
Martin nickte beklommen.
Der Strom der heimeilenden Arbeiter wurde schwächer.
Wegener hörte, wie einer am Tor sagte: „Mann, macht man kein Theater heute, gerade heute noch, wir sind doch dicke da.“
Der Werkscharmann lachte. „Möchtest wohl dabeisein, was? Prag und so – hübsche Weiber!“
Wegener zog die Augenbrauen zusammen. „Renn, Martin, na los!“
Der Junge trabte in die dunkle Straßenschlucht hinein.
Er wird schnell zu Hause sein, dachte der Alte. Was sie für Angst aussteht, die Anna. Gerade Arthur, den Ältesten! Wegener klappte den Joppenkragen hoch. Er warf noch einen Blick zum Tor. Dort lehnte der Rothaarige an der Wand des Wachhäuschens und blickte zum Verwaltungsgebäude hoch. Wegener dachte böse: Hast wohl deine Liebste dort, vielleicht unter den Tippgänsen. Bist ein strammer Bursche, so ein zackiger SS-Hengst. Wegener schritt los, er setzte mechanisch die Füße, er spürte plötzlich, dass er müde war, sehr müde.
Beim Verwaltungsgebäude hatte der Wind die klatschnasse Fahne um den Mast gelegt. Der weiße Kreis mit dem Balkenkreuz war eingewickelt. Nur das rote Tuch war zu sehen. Von der Schraubenfabrik pfiff es Feierabend herüber. Wegener schritt eiliger aus. Heute ist es spät geworden. Sonst bin ich um diese Zeit schon hinter der Unterführung an der S-Bahn. Heute ist alles anders.
Der Regen nieselte.
In Prag soll es sogar geschneit haben. Das haben sie im Radio angesagt. Die deutsche Wehrmacht ist im Schneegestöber in Prag einmarschiert. Wegener ballte die Faust in der Joppentasche. Wie sie schreien. Wie sie sich vor Freude auf die Schulter hauen. Erst Österreich, dann die Sudeten, jetzt die Tschechoslowakei, immer weiter.
In der Werkstatt gibt es auch Leute, die sich nicht genug darüber freuen können. Das war der zweite Streich, die Tschechen werden jetzt Zug in ihren Laden kriegen, das tut den faulen Ärschen gut, hat der Nieter Adamek verkündet. Der ist an diesem Tag stolz in der braunen SA-Uniform zur Arbeit gekommen. Wäre sicher gern dabeigewesen in Prag. Aber Adamek muss D-Zug-Wagen nieten und Spezialwagen für die Wehrmacht. Er ist kein schlechter Nieter, der Adamek.
Hermann Wegener verlangsamte seine Schritte. Anna wird jetzt warten. Vielleicht wartet sie nicht mehr allein. Vielleicht hocken schon welche in der Stube. Die Wohnung haben sie durchwühlt und das Päckchen gefunden, das Päckchen mit den Fotografien aus alten Zeiten, aufgenommen bei Maiaufmärschen und Versammlungen mit den alten Genossen, und dann noch die SPD-Mitgliedskarte. Warum habe ich das Zeug bloß noch herumliegen, dachte Wegener verzweifelt. Im Lager werden meine alten Knochen nicht durchhalten. Der Max Peukert, in drei Wochen war er tot. Und wie er singen konnte: „Wann wir schreiten Seit’ an Seit’“ und „Waldeslust, Waldeslust“. Mit den Kommunisten hatte er nichts zu schaffen. Die waren ihm zu radikal. Der Peukert-Max war trotzdem ins Lager gekommen, nach Oranienburg …
Hermann Wegener schüttelte sich. Niemand ging langsam, jeder wollte ins Trockene kommen.
Die Viertel am Zentralviehhof waren in den Gründerjahren hochgeschossen. Die Vorderhäuser hatten sogar Balkone und Erker mit Gipsfiguren. Die Seiten- und Hinterhäuser standen im Schatten der Fassaden, waren grau und engbrüstig, mit dunklen Fluren und ausgetretenen Stiegen. Wegeners wohnten fünfundzwanzig Jahre in einem Hinterhaus der Heidenfeldstraße.
Als Hermann Wegener merkte, dass er nur noch zwei Straßen zu gehen hatte, blieb er unschlüssig stehen. Er spürte ein beklemmendes Gefühl der Angst. Er redete sich ein: Du bist fast sechzig, Hermann, und jetzt fürchtest du dich. Es braucht doch nichts zu sein, es sind ja alles Gespenster. Doch die Angst drückte ihm das Herz ab.
Vor einer Eckkneipe blieb er stehen. Die Kneipe hieß „Zum Alten Dessauer“ und war einmal ihr Lokal gewesen, das Lokal ihrer Ortsgruppe, damals vor dreiunddreißig. Den gutmütigen, redseligen Ede, den Budiker, hatten die Braunhemden nach dem 1. Mai dreiunddreißig zusammengedroschen. Ede hatte jetzt ein Glasauge. Er stand nur noch schweigend hinter dem Schanktisch.
Wie lange bin ich hier nicht mehr gewesen, überlegte Wegener. Wie die Pest habe ich die Kneipe gemieden. Er spuckte aufs Pflaster und drückte die Klinke nach unten.
Der Schankraum war dämmrig.
„’n Abend“, sagte Wegener und schüttelte die Regentropfen von der Mütze.
„Heil Hitler!“, murmelte Ede.
Im Halbdunkel saßen zwei Männer und unterhielten sich.
Wie unter Zwang steuerte Wegener auf den runden Ecktisch zu, der für ihn so viele Erinnerungen heraufbeschwor. Der Tisch stand noch so wie damals, fest und massiv, die Holzplatte weiß gescheuert. Der Aschenbecher aus Porzellan war noch da und auch der Halter für die Streichhölzer. Aber die Bilder von früher fehlten. Andere Bilder hingen dort. Statt ihres Fotos – die ganze Gruppe hatte sich mit der Fahne fotografieren lassen – hing jetzt, genau über der Eckbank, die Aufnahme einer echten Bulldogge, die ihre Schnauze weit aufriss. Edes Kneipe war Hundezüchter-Vereinslokal geworden. Neben der Bulldogge hing Göring.
Hermann Wegener setzte sich zögernd. Ede schaltete den Rundfunkempfänger ein. Marschmusik hämmerte. Wegener hob den Kopf, öffnete die Joppe und legte die Mütze auf die Eckbank.
Ede saß am Tisch, und Wegener schien es, als wären nicht Jahre vergangen. Aber er saß heute ohne Freunde hier, und Edes Glasauge sah starr und glänzend an ihm vorbei.
„’ne Molle und ’nen Korn“, sagte Wegener.
Ede verschwand.
Er hatte ihm nicht die Hand gegeben. Wegener goss den Korn hinunter und trank das Bier in großen Schlucken, als habe er einen unlöschbaren Durst. Er starrte zum Fenster hinaus auf die dämmerdunkle Straße, die vorbeihuschenden Lichter der Radfahrer.
Jetzt haben sie Arthur abgeholt. So musste das kommen. Hat es denn Zweck, mit dem Schädel durch die Wand zu rennen? Sie marschieren eben, die Braunhemden. Sie haben Arbeit gebracht. Geld ist in den Familien, die jungen Burschen werden bei der Wehrmacht zu Menschen gemacht. Das sieht eben das Volk. Wie oft hat er Arthur prophezeit, dass es ihm Kopf und Kragen kosten wird. Der Arthur, ist er nicht jahrelang ohne Arbeit gewesen? Er hat rumgelungert, auf der schwarzen Liste stand er. Mit seiner Maria hat er sich durchhungern müssen. Wie oft sind sie froh gewesen, wenn sie am Sonntag zu ihnen kommen konnten und einen Karnickelbraten vorgesetzt bekamen. Das hatten sie von ihrem Klassenkampf. Und jetzt hat er Arbeit. Er kann ja was. Er ist ein richtiger Motorenhase. Soll er doch froh sein. Aber der alte Fischer und seine Maria, die haben ihn eingeseift. Die Maria, so eine Schwiegertochter, so ein Frauenzimmer. Ist es Arthur zu verdenken, dass er schwach wird? Die Augen, die sie hat …
Hermann Wegener hockte an dem Tisch, an dem er vor Jahren mit Max Peukert und den anderen stundenlang über die Partei und über den Sozialismus geredet hatte, und trank ganz gegen seine Gewohnheit schon die dritte Molle und den dazugehörigen Korn. In seinem Kopf brummte der Alkohol. Er blinzelte zu Ede hinüber, den er nur noch verschwommen hinter der Theke erkennen konnte. Wie ein Ölgötze steht er dort. Das Maul hat er zugeklebt. Und wie er „Heil Hitler“ kräht. Hermann spielte mit dem Bierglas, er ließ es zwischen seinen verschrammten Fingern trudeln. Er wollte noch einen Korn bestellen und noch eine Molle, doch da fiel sein Blick wieder auf die Stelle an der Wand, wo das Gruppenbild gehangen hatte und jetzt die Bulldogge heruntersah.
Er richtete sich auf. Es war ihm, als hätte ihm jemand ins Kreuz gestoßen. Die Nebel vor seinen Augen verschwanden.
„Zahlen“, sagte er. Er blickte an Ede vorbei. Der schaute über ihn hinweg. Als er zur Tür ging, ein wenig schwankend und unsicher, nickte er nur. Auch Ede nickte schweigend.
Der Märzwind und der Regen sprangen ihn an. Langsam setzte er Schritt um Schritt, während er seiner Wohnung näher kam, immer näher. Ob sie in der Küche sitzen oder im Flur stehen? Sind sie schon da und warten? Da erwachte in dem alten Wegener der Zorn, der seine Backenknochen eckig werden ließ. Hätte ihn jetzt die Anna gesehen, seine Frau, sie hätte gewusst, dass mit ihm nicht zu spaßen war.
Er läutete wie immer, drehte kurz die abgegriffene Messingklingel; aber fester als sonst presste er die Tasche unter den Arm. Sein Atem ging stoßweise, und sein altes Herz schlug heftig. Dabei war er die vier Treppen nicht schneller als sonst hinaufgestiegen.
Es blieb dunkel, und die Schritte hinter der Tür, dieser grauen Tür, vor der er jeden Tag stand, schon viele Jahre, wollten nicht kommen. Er betrachtete das Schild aus weißer Emaille, auf dem sein Name stand, und es schien ihm, als sähe er es heute zum ersten Mal. An der Ecke des Schildes war die Emaille abgeplatzt. Das verschnörkelte W war nur noch halb zu sehen. Er erinnerte sich, dass Willi einmal mit seinem Fahrrad dagegengestoßen war, Willi, der Jüngste, vor Jahren, als er noch nicht verheiratet war und zu Hause wohnte.
Die Tür öffnete sich. Er hatte keine Schritte gehört. Er trat heftig vor, als könne er es nicht mehr erwarten. Er blinzelte in die trübe Flurlampe und sah Anna vor sich, klein und ein wenig rundlich, den Lichtschein der Lampe auf ihrem weißen Haar.
„Hermann, du kommst ja so spät?“ Das war ihre besorgte, brüchige Stimme. An der Tür lehnte Martin.
„Großvater!“
Wegener blieb unbeweglich stehen. Langsam zog er die Mütze vom Kopf. Und es war wie immer, als er die Tasche seiner Frau reichte, mit den gleichen Bewegungen, wie in all den Jahren, doch heiß war ihm, und er fühlte plötzlich, dass die Hände zitterten. Sie waren nicht da, nein, sie waren nicht gekommen.
Die Frau klagte: „Ach, der Arthur! Was hat er nur angestellt!“
Er zerrte seine feuchte Joppe vom Körper. Ohne ein Wort ging er in die schmale, niedrige Küche, in der es nach gedämpftem Sauerkohl und nach Speck roch. Er schritt schwer aus. Im kleinen Küchenspind klirrten die Gewürzdosen. Er setzte sich an den Tisch auf seinen Platz der Tür gegenüber.
„Hast du alles gemacht?“, fragte er.
Anna nickte. Sie wischte mit dem Schürzenzipfel über den Tisch. Aber die helle Wachstuchdecke war sauber.
„Du musst das Zeug verbrennen. Ja, so ein Unsinn!“, sagte Anna entschieden.
Er gab keine Antwort. Er faltete die Hände. Die Angst der letzten Stunden fiel von ihm ab, doch sie zitterte nach, sie stach in der Brust und pochte in den Schläfen.
Während Anna einen Teller füllte, geschäftig und flink, blinzelte Hermann zum Fenster hinüber. Dort stand Martin und starrte nach draußen. Die Ellbogen stützte er auf das Fensterbrett, seine Augen waren groß. Hermann folgte dem Blick des Jungen. Draußen waren feuchte Dächer zu sehen, die dunkle Schlucht des engen Hofes und die kümmerliche Kastanie und über den Dächern dunstiger Rauch und die schnell dahinziehenden grauen Wolken.
Er strich sich über das borstige Haar. „Martin“, sagte er leise. Der Junge fuhr erschrocken herum, als hätte er Träumen nachgehangen. Fragend sah er den Großvater an. „Die Haare musst du mir wieder schneiden, am Sonntag.“ Martin lächelte.
Großvater Wegener wusste, dass Martin gern mit der Haarschneidemaschine auf seinem Kopf herumfuhr. Es machte ihm Spaß, alle möglichen Figuren in den dichten grauen Haarpelz zu schneiden, Kreise und Kreuze. Einmal hatte ihm der Lausebengel einen Haarkranz stehenlassen und sich halb tot gelacht. „Jetzt siehst du aus wie ein komischer Mönch, wie ein Franziskaner“, hatte er geprustet. Hermann Wegener hatte sich im Spiegel betrachtet und auch gelacht. Er und Franziskanermönch! Doch Anna war dazwischengefahren: „Du Gottloser! Wirst uns das Unglück auf den Hals hetzen. Über die Kirche spotten, so was …“ Ja, der Martin.
Jetzt starrte der Junge wieder zum Fenster hinaus, und das Lächeln war verschwunden. Hermann wusste, an wen Martin dachte. An seinen Onkel Arthur dachte er und an Maria.
„Martin!“ Wieder zuckte der Junge zusammen. „Lauf schnell nach Haus zu Tante Maria! Sie darf jetzt nicht allein sein.“
„Ja“, sagte Martin. Er warf der Großmutter einen Blick zu, als wolle er bitten, nicht böse zu sein. Bald darauf schlug die Tür.
Hermann Wegener löffelte lustlos die Kohlsuppe. Anna saß schweigend am Tisch.
„Die Feilen, Hermann“, begann sie vorsichtig, „bring keine Feilen mehr mit.“
Er hob den Blick nicht vom Teller, er dachte wieder an die Leute, die hier hätten sitzen können, um auf ihn zu warten, und er dachte an das Lager und an Peukert-Max. Mein Herz hält das nicht mehr aus, das hält’s nicht mehr aus.
„Ich werd die Feilen im Garten vergraben“, sagte er.
Der Speck, den er zwischen den Zähnen kaute, war ausgelaugt und tranig.
Durch die regenfeuchte Straße dröhnten die Trommeln. Sie zogen in Sechserreihen heran, und vorn schwankte die schwarze Fahne mit dem weißen Runenzeichen und dem hellen Messer an der Spitze. Sie sangen: „Voran der Trommelbube, er schlägt die Trommel gut; der Knab weiß nichts von Liebe, weiß nicht, wie Scheiden tut. Trum, trum, troarum, heidiridiridum!“
Die Gesichter kamen auf Martin zu. In der ersten Reihe marschierten die Großen mit den grünen Schnüren und den ernsten Mienen. Als die Fahne herankam, hob Martin den Arm, und der Blick des blonden Fähnleinführers ging über ihn hinweg. Die Reihen knallten an ihm vorbei. Die Jungen schauten geradeaus, ernst, als wollten sie immer so marschieren, immer so und singen. Martin sah ihnen nach, und das Lied gefiel ihm und die da marschierten. Die schwarzen Jacken gefielen ihm und die Schulterriemen und dieses Lied: Trum, trum, troarum, heidiridirium.
Das Lied verklang. Martins Gesicht verfinsterte sich. Er rannte weiter, den Kopf vorgebeugt, und der Regen peitschte in Böen. Onkel Arthur haben sie eingesperrt, dachte er. Sie singen auch andere Lieder. Er war einmal vom Jungvolkdienst heimgekommen und hatte gesungen: „Es zittern die morschen Knochen“. Das Beste war der Kehrreim: „Wir werden weitermarschieren, bis alles in Scherben fällt, denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt“. Er hatte laut gesungen, und es war auch was, so zu marschieren, bis alles in Scherben fällt, aus Trotz zu marschieren. Onkel Arthur hatte gerufen: „Martin, komm mal her! Was singst du da?“ – „Das haben wir heute gelernt“, hatte er erwidert. Da war Onkel Arthur im Zimmer auf und ab gelaufen, der ruhige Onkel Arthur, der graue Augen hat und fröhlich lächeln kann. „Sing das nicht mehr, Martin. Ich will’s nicht mehr hören.“ Und als Martin verwundert und ratlos gewesen war, hatte Onkel Arthur gesagt: „In Scherben soll alles fallen? Warum soll alles kaputtgehen?“ Er, Martin, hatte nicht viel begriffen. Doch er liebte Onkel Arthur und die Tante Maria. „Es ist ein rohes Lied“, hatte Tante Maria gesagt.
Martin war bei seinen Großeltern aufgewachsen. In der engen Kammer neben der Küche stand sein Bett. Erst war das ein Kinderbett, das Hermann Wegener selbst gezimmert hatte, und später ein quietschendes Sofa. Dort hatte er auch das erste Mal gebrüllt: an einem kalten Januartag im Jahre 1927. Die Mutter lag bleich, mit großen Augen und zerbissenen Lippen auf dem Sofa, und die Hebamme sprang geschäftig hin und her und meinte, der Junge sei ja ein Prachtexemplar. Die Mutter lächelte nicht. Sie weinte. Martin hatte nie seinen Vater gekannt. Als er sich schon im Leib der Mutter regte, stürzte sein Vater vom Baugerüst. Der war sofort tot. Einen Monat später hatten sie heiraten wollen, der Maurer Alfred und Helene, die Älteste der Wegeners. Lenchen riefen ihre Brüder die kleine, flinkmäulige Sortiererin aus der AEG in der Brunnenstraße. Martin liebten sie alle, der alte Hermann Wegener, die Großmutter Anna und die Brüder Arthur und Willi. Der pausbäckige Bursche krähte fröhlich in der engen, dunklen Wohnung. Und die Jahre vergingen. Lene heiratete später den Eisenbahner Diedrichkeit. Seitdem sah Martin seine Mutter selten; der Eisenbahner war nicht gern gesehen in der Familie Wegener. Der Großvater sagte zu dem Jungen: „Du gehst mir auf eine vernünftige Schule; sollst nicht so schinden wie ich.“ Aber als Martin zehn Jahre alt war, reichte das Geld, das sich Hermann vom Munde absparte, nur für die Mittelschule.
Maria und Arthur, die kinderlos waren, nahmen Martin zu sich. Schon zwei Jahre lebte er in der stillen Ausbauwohnung in Neukölln, hoch über den Dächern der Stadt, wo man vom Fenster aus die Kräne des Spreehafens sehen konnte und die Schornsteine von Klingenberg.
An diesem Märztag quälten Martin wirre Gedanken. Warum haben sie Onkel Arthur eingesperrt? Warum ist Großvater so komisch? Ja, sie sind anders als die meisten. Sie heben nicht gern die Hand. Sie tun es nur, wenn es nicht anders geht. Einmal war er mit Großvater am Brandenburger Tor, und Adolf Hitler fuhr Unter den Linden vorbei. Die Menschen schrien und winkten. Auch er wollte schreien und jubeln, und er wollte das schwarze Auto sehen, mit dem der Führer immer fährt und Deutschland groß und stark macht. Doch Großvater zog ihn zurück und starrte finster in die Rücken der schreienden Menschen. Er schwieg den ganzen Heimweg. Martin erzählte das am Abend Onkel Arthur, der sah ihn nachdenklich an und sagte dann: „Großvater hat schon recht, Martin. Später wirst du vieles besser verstehen.“ Als Martin trotzig aufblickte, meinte Onkel Arthur: „Du hast doch Großvater gern, Martin?“ – „Ja“, hatte er gesagt. Und Onkel Arthur hatte gelächelt. „Na, siehst du!“
Die S-Bahn fuhr am Bahnhof Ostkreuz vorüber. Im Abteil sagte jemand: „Schau mal, das sind aber Brummer.“ Alle sahen hinaus. Martin drückte die Nase an die Fensterscheibe. Auf der Straße rollte eine Kolonne schwerer Geschütze. Die Motoren der Zugmaschinen heulten, die Lafetten glänzten nass. Die Soldaten hatten Stahlhelme auf den Köpfen.
„Die fahren nach Prag“, sagte ein Mann.
„Dort ist doch alles vorbei“, bemerkte sein Nachbar.
„Vielleicht geht’s woandershin“, sagte der Mann lachend, „die Welt ist groß.“ Martin sah zu den beiden hin. Ihre Gesichter waren gutmütig. Wie Onkel Willi sah der eine aus.
Da überfiel ihn wieder die Angst. Er dachte an Tante Maria. Sie wird weinen. Onkel Arthur haben sie eingesperrt. Wie sie alle reden und seufzen, der Großvater, die Großmutter. „Warum macht er solche Dummheiten“, hatte Großmutter geklagt, „er bringt sich noch ins Unglück, der Junge. Gegen den Strom will er schwimmen. Es ist doch alles gut! Er soll doch zufrieden sein.“
Das alles war schwer zu verstehen.
Martin stieg die vielen Stufen hinauf. Dann rannte er los, nahm drei Stufen auf einmal. Vielleicht wird keiner mehr aufmachen? Tante Maria ist gestorben. Oder sie ist weg.
Das Treppengeländer knarrte. Der Junge klingelte und klopfte zugleich. Die Tür öffnete sich. Onkel Arthur stand vor ihm. Er presste sich an den großen Mann, und in seine Nase stieg der Geruch von Kernseife, vermischt mit dem von Motorenöl. Martins Schultern zuckten.
„Na, Martin“, sagte Onkel Arthur. „Ich bin da!“ Und es war gut. Martin hörte die Worte Tante Marias wie aus weiter Ferne. „Was klopfst du wie ein Wilder?“
„Sei ruhig, Mädchen“, sagte Onkel Arthur. „Sie kommen nicht mehr. Es war wirklich ein Irrtum.“ Doch dabei lachte er nicht.
„Bist ja ganz nass, Junge.“
Martin zog wortlos die regenfeuchte Pimpfenjacke über den Kopf.
„Geh ins Bett, Martin.“
Martin träumte schwer. Die Trommeln dröhnen laut hinter der schwarzen Fahne. Geschütze so groß wie Häuser rollen auf ihn zu. Er will schreien und kann es nicht. Er weiß nicht, was er schreien soll.
Im Zimmer war es dunkel. Nur die huschenden Lichter vom Spreehafen, die Scheinwerfer der Schwenkkräne, glitten hin und wieder am Fenster vorüber. Arthur saß am Tisch, stützte die Ellbogen auf und vergrub das Gesicht in den Händen. Als die Tür aufging, hob er den Kopf. Vom Flur fiel das Licht ein, und er sah Maria.
„Arthur, warum sitzt du hier im Dunkeln?“, fragte sie leise.
Das Licht flammte auf. Er schloss die Augen und wandte sich ab. Wieder sah er die kalte Zelle, den rissigen betonierten Keller des Verwaltungsgebäudes und die im Dunkeln zusammengepferchten Männer aus den Hallen. Er meinte wieder den Gestank nach Schmieröl, schweißnassem Drillich und verbranntem Gummi zu riechen. In drei schmutzigen Birnen hinter Drahtgittern war das Licht aufgeflammt. Der kalte Schein hatte alles noch schlimmer gemacht: die blassen Gesichter der Verhafteten traten hervor. Manche waren angstverzerrt. Dann kam alles anders. Der Gestapo-Knopf, wie er im Werk genannt wurde, ein dicker Mann, mit rundem, meist etwas träge wirkendem Gesicht, hatte zwanzig von ihnen nach Hause geschickt und darunter auch ihn, den Motorenschlosser Arthur Wegener.
Darüber hatte Arthur im dunklen Zimmer gegrübelt, ehe Maria kam. Der Gestapo-Knopf schickt mich nach Hause. Dabei muss er doch genau meine Personalakten kennen!
„Es ist manchmal gut im Dunkeln“, sagte Arthur.
Maria setzte sich an den Tisch, zupfte die Fransen der Tischdecke zurecht und rückte die Kristallschale mit den Äpfeln in die Mitte. „Iss doch. Sie sind so schön saftig.“
Arthur hielt ihre schmale Hand fest. „Ich habe gedacht, jetzt werden wir uns Jahre nicht mehr sehen – oder nie mehr.“ Er spürte das Zucken ihrer Hand. Er sah ihre weiße Stirn. Darüber sind die schwarzen Haare und darunter die grauen Augen und die leicht gebogene Nase. Er sah auch den Mund. Wenn er ihn küsst, glühen die Lippen. Er hielt ihre Hand fest und betrachtete ihr Gesicht, als sähe er es zum ersten Mal. Oder nie mehr – habe ich das gesagt? Ihr Gesicht versank im kalten Licht der grauen Zelle.
„Was hast du?“, fragte Maria besorgt.
Langsam fuhr er sich mit der Hand über die Stirn, stand auf und schüttelte sich, als friere er.
„Wir müssen Vater warnen, die Genossen.“
Er begann im Zimmer auf und ab zu gehen. Er war groß und hager, mit breiten Schultern, die ein wenig nach vorn hingen, wie das oft bei Schlossern war, die viele Jahre gebückt über dem Schraubstock arbeiteten.
„Ich werde gehen“, sagte er, „heute ist eine dunkle Nacht.“ Er sah zu Maria hinab. Ihre grauen Augen blickten kühl.
„Ich werde gehen“, sagte sie. „Für die ist es nie zu dunkel.“
Arthur nahm ihren Kopf in seine Hände. „Du hast recht, sei vorsichtig.“
„Ja“, sagte Maria, „sie müssen es wissen. Wir müssen ja auf alles gefasst sein.“
Er betrachtete sie forschend. Es war ihm, als hätte ihre Stimme gezittert. Er legte den Arm um ihre Schultern und zog sie an sich. Durch den dünnen Stoff spürte er ihren warmen Körper. Mit der freien Hand strich er ihr über das Haar.
„Ich werde doch gehen“, sagte er. „Die haben alles andere vor als hier zu lauern.“ Doch er wusste, dass es nicht stimmte, die lauerten immer.
Maria löste sich von ihm und schob ihr Haar zurecht. „Ich bin ja schnell zurück“, sagte sie. „Setz Tee auf.“
Er folgte ihr in den engen Flur, half ihr in den Mantel und zog ihr die Regenkapuze unter dem Kinn fest. Er wollte sie küssen, er tat es nicht.
Maria huschte die Treppe hinunter. Arthur beugte sich über den Lichtschacht und sah ihre weiße Hand am Geländer hinabgleiten. Im zweiten Stock klappte eine Tür. Gelächter hallte im stillen Haus. „Drei, vier: O du schöner Westerwald.“ Arthur lauschte mit starrem Gesicht. Das war beim Steuerinspektor Butgereit. Die marschieren heute im Geiste in Prag ein.
Arthur ging in die Wohnung zurück und löschte das Licht im Zimmer. Er presste das heiße Gesicht an die Fensterscheiben und spähte auf die Straße hinunter. Die Straßenecke war beleuchtet durch das trübe, kreisrunde Licht einer Gaslaterne. Dort muss Maria vorbeikommen. Er hätte hinunterschreien mögen: Maria, Mädchen, bleib hier! Der Schweiß klebte in seinen Handflächen. Er sah in Gedanken: Maria tritt aus dem Haus. Sie blickt sich um, und der Regenwind greift ihren Mantel. Sie will vorbeihuschen, leichtfüßig, wie sie es gewohnt ist. Da tritt eine dunkle Gestalt aus dem Schatten, und eine gleichgültige Stimme sagt: „Halt, bleiben Sie stehen!“ Eine Lederhandschuhhand umspannt ihren Arm. – Sie sitzt in einer Betonzelle. Es ist kalt, der Schemel ist hart, und sie haben sie geschlagen. Ihre grauen Augen starren trübe auf die grauen Wände.
Arthur umklammerte das Fensterbrett. Der Regen trommelte stärker an die Scheiben. Der gelbe Lichtkreis an der Ecke spiegelte nasses Pflaster. Arthur dachte: Wo bleibst du, Maria! Dabei waren nur Minuten vergangen. Dann sah er, wie sie im Lichtkreis auftauchte und in der dunklen Straße verschwand.
Er starrte noch lange auf den hellen Kreis. Es kam kein Schatten mehr hindurch. Niemand hat also unten gestanden und auf sie gewartet. Als er ins Zimmer zurücktrat, spürte er, dass seine Hände zitterten. Er war ärgerlich. Es ist dumm, dieses Händezittern. Der Gestapo-Knopf und seine Leute hätten dich ja leicht mürbe machen können.
Allmählich wich die Furcht. Zurück blieb das zärtliche Gefühl für Maria. Ich liebe sie sehr. Heute weiß ich wieder, wie ich sie liebe. Gesagt habe ich es ihr eigentlich noch nie. Aber sie weiß es bestimmt.
Er schob den Stuhl an das Tischchen, auf dem der Radioapparat stand, ein dunkelbrauner neuer Telefunken. Er hatte damals lange gerechnet, bis er den Apparat kaufte.
Die Skala begann zu leuchten. Aus dem Lautsprecher drang Pfeifen und Knattern. Arthur drehte am Knopf. Er kannte genau den Punkt, an dem der schwarze Strich anhalten musste. Es war fünf Minuten vor 23.00 Uhr. Arthur holte aus der Tasche einen Bleistift und legte einen Bogen Papier auf den Tisch.
Er war jetzt ruhig, und jeder, der ihn hätte sehen können, würde annehmen, dass sich der Mann am Rundfunkgerät die letzten Sportergebnisse aufschreiben wollte.
Arthur dachte an den Tag, der hinter ihm lag, an den Einmarsch der Wehrmacht in Prag dachte er und an den Gestapo-Knopf im Werk. Und er überlegte, was morgen zu tun sei, nun, da er die Genossen nicht mehr sprechen konnte. Morgen wird er wieder in der Halle stehen, im Prüfstand, dort, wo die komplizierten Motoren den letzten Schliff erhalten, wo sie noch einmal auseinandergenommen werden, nachdem sie viele Stunden auf den höchsten Touren gelaufen sind, um dann wieder sorgfältig zusammengebaut zu werden; sie sollen Kampfflugzeuge zuverlässig in die Luft tragen, ganz zuverlässig.
Im Prüfstand gibt es Leute, die werden fragen: Nun, Arthur, was ist jetzt? Sie werden sehr vorsichtig fragen, oder die Fragen werden nur in ihren Augen zu lesen sein. Man muss antworten. Und wenn es nur zwei sind, die eine Antwort wollen.
Das Knattern im Gerät verstärkte sich. Arthur nahm den Bleistift zwischen die Finger und drückte einen Strich auf das Papier. In das Knattern und Pfeifen hinein sagte eine Stimme: „Hier spricht Moskau – hier spricht Moskau!“
Maria lehnte sich erschöpft an die Wand. Die Treppenbeleuchtung erlosch, im Haus klappte eine Tür. Maria fand den Schalter sofort. In dem Haus war sie groß geworden.
Sie hätte sich genau erinnern können, dass hier auf diesem Flur im Jahre 1924 – damals war sie 14 Jahre alt und ein Mädchen mit langen, schwarzen Zöpfen – die elektrische Treppenbeleuchtung angelegt wurde; an den ersten Abenden hatte sie sich oft heimlich aus der Wohnung geschlichen und auf den schwarzen Knopf gedrückt, der die Zauberkraft besaß, das ganze Haus in helles Licht zu tauchen. Sie hatte dann atemlos auf den Augenblick gewartet, da das Licht erlosch. Jetzt dachte Maria nicht daran.
Sie steckte den Schlüssel vorsichtig ins Schloss und fand keinen Widerstand. Vater ist also nicht zu Hause.
Im Flur roch es wie immer nach Gummi und Staufferfett. Oben an der Decke hing das Rennrad ihres Bruders Fritz. Es hing schon lange dort, denn Fritz war im Frühjahr 1938 eingerückt, und erst in einem Jahr war die Dienstzeit vorbei. Er diente in Neubrandenburg bei den Panzern. Jedes Mal, wenn er auf Urlaub kam, fettete er sein Rennrad neu ein.
Als Maria noch hier wohnte, hatte Fritz bereits den Fahrradfanatismus; schon als Schuljunge hatte er sich mit Vaters Hilfe ein altes Rad zusammengebastelt. Mit verbissenem Eifer hockte er im Flur und bastelte jede Woche ein paarmal daran. Maria spottete, meinte, er solle doch lieber die Sache aufgeben, er habe kein Geschick dazu. Da warf er mit Lappen und einmal mit einer Ölkanne nach ihr.
Dabei liebte Maria den kraushaarigen Strubbelkopf, diesen Spätling in ihrer Familie. Aber sie ärgerte ihn allzugern, weil er sich über ihren Spott so leicht aufregte. Wie war er aufgebracht, wenn sie mit hoher, verstellter Stimme sang: „Brüderlein, Schwesterlein …“ Da knurrte er: „Dummes Geheule. Gibt’s nichts Anständiges? Du bist schon so ein Schwesterlein …“
Er aber hatte sie auch gern. Und ihren Arthur ebenfalls, weil der ihm einen Packen zerlesener Radsportzeitschriften und für sein Fahrrad eine nagelneue Bremse besorgt hatte.
Jetzt steckt der Krauskopf in der schwarzen Uniform.
Auf dem Küchentisch stand ein Teller mit kalt gewordenen Bratkartoffeln. Die Gabel lag noch auf dem Teller. Maria erschrak. Vater ist doch nicht so, dass er sich beim Essen stören lässt. Auf dem Schrank lag ein Zettel. „Bin bei Wilhelm.“ Maria atmete auf, aber sie spürte die quälenden Stiche in der Brust. Das Herz wollte nicht mehr so richtig. Die Schmerzen zogen bis zum Arm. Das mit dem Herzen war seit der Geburt des Kindes, des ersten und einzigen. Die Nabelschnur hatte es erdrosselt.
Maria setzte sich an den Tisch auf ihren Platz. Sie blickte auf die Uhr mit dem schwingenden Messingpendel, die weiß und verschnörkelt an der Wand hing. Es war kalt in der Küche, und Maria fror. Wie lange war Mutter schon tot? Seit über fünf Jahren lebten Vater und Fritz allein in der Wohnung. Jetzt war Vater ganz allein. Und die Wohnung blieb einsam und kalt. Sie war nicht schlecht, sie hatte große Zimmer. Der Werkzeugmacher Erich Fischer, der Arbeiter mit den goldenen Händen, hatte nie ganz schlecht bei Borsig in Tegel verdient. Und Mutter mit ihrem schwachen Herzen brauchte große Räume; sie glaubte sonst zu ersticken.
Die Wohnung barg gute Erinnerungen. Arthur hatte hier am Tisch gesessen. Neunundzwanzig war das. Er war das erste Mal mitgekommen, obwohl sie da schon lange miteinander gingen. Sie hatten sich auf einem Treffen der Sozialistischen Jugend kennengelernt. Maria war vom Kommunistischen Jugendverband hingeschickt worden. Sie trug damals einen Bubikopf. Arthur sagte später, sie habe, als sie sprach, ganz wild und so verwegen ausgesehen, dass er nicht mehr wegsehen konnte. Er habe auch nicht gehört, was sie damals redete, er habe immer nur sie gesehen.
Als er das erste Mal hier bei Fischers am Tisch saß, war er noch Sozialdemokrat. Ein paar Monate später gehörte er zu ihnen. So einfach war das nicht geschehen. Vater Fischer konnte bissig werden. Einmal war die grüne Küchenlampe, die sich tief nach unten ziehen ließ, in Scherben gegangen. Arthur war so erregt aufgesprungen, dass er mit dem Kopf gegen die Lampe stieß. Es ging um den Klassenkampf und die Regierung aus Sozialdemokraten, die nichts anderes als Kapitalistenknechte seien, wie Vater Fischer behauptet hatte. Vater Fischer hatte recht. Da war die Lampe zerschmettert. Maria hatte damals laut gelacht. Arthur war zwei Tage nicht mehr zu ihr gekommen. Er hielt es aber nur zwei Tage aus.
Die Liebe zu Arthur war genau das Gegenteil von dem, was sie sich bis dahin unter Liebe vorgestellt hatte. Unter ihren Jugendgenossen war sie als Feuerkopf bekannt, die alle Beziehungen zwischen den Geschlechtern in Frage stellte, über Romantik und Seelenschmalz spottete. „Geht mir weg mit dieser ganzen Gefühlsduselei. Liebe – ich weiß schon … wenn so ein Kerl kommt, ach, und das Ende davon?“ Ja, Maria wusste Bescheid. Sie arbeitete als Sekretärin bei einem Rechtsanwalt. Der war ein tüchtiger Anwalt, ein melancholischer Humanist und seltsamer Philosoph. Bei vielen Prozessen saß sie dabei. Sie erlebte die Besitzgier der Menschen, ihre Hemmungslosigkeit, wenn es um Geld ging, um Versorgung.
Als Arthur kam, wollte sie seine Prinzipien erproben. Bei ihren ersten Begegnungen fragte sie ihn gleich aus, ob er Bebel gelesen habe über die Frau und Engels.
Arthur hatte die Bücher zufällig gelesen. Da war Maria zufrieden. Und dann? Dann wurden die Spaziergänge unendlich lang. Jeder Abschied war schwer. Und der Herbst war schön, die Wiesen, der Müggelsee. Auch der Mond war schön …
Wie viele Jahre sind seitdem vergangen?
Maria war müde. Der Weg ist weit von Neukölln zum Zentralviehhof und jetzt zur Schönhauser Allee.
Der Tag hatte einmal kommen müssen. Da war also der Mann aufgetaucht, der sagte: „Arthur ist verhaftet!“ Das Herz wollte aussetzen. Es durfte aber nicht aussetzen. Es musste schnell gehandelt werden; nicht einmal die Asche im Ofen durfte zurückbleiben.
Maria verbrannte jetzt auch den Zettel des Vaters. Sie wollte nach Rummelsburg fahren und raustraben zur Laube Wilhelm Jakobs. Die Laube hatte einen festen Keller.
Die niedrige.Gartentür quietschte. Der Weg vom Bahnhof Rummelsburg war dunkel gewesen, mit nassen Pfützen und heiserem Hundegekläff. Nur in wenigen Lauben hatte sie Licht bemerkt. Als sie jetzt auf die Wohnlaube des alten Jakob zuging, schaute sie in die Richtung der Innenstadt. Wie eine helle Glocke spiegelte sich das Lichtermeer der Reichshauptstadt am Nachthimmel. Über Neukölln, dort, wo Arthur jetzt auf sie wartete, glühten rote Punkte. Das waren die Leuchtfeuer vom Tempelhofer Flughafen. Maria sah das Lichterspiel und dachte: Wie seltsam das ist. Hier fühle ich mich geborgen, in der Dunkelheit, auf diesem Laubengrundstück Wilhelms. Das Lichtermeer, das dort funkelt und blitzt, ist mir fremd. Zwei Berlin gibt es. Dort die von starken Scheinwerfern angestrahlte Siegessäule mit der goldenen unbarmherzigen Göttin, hier die dunklen Lauben.
Die Wohnlaube Wilhelm Jakobs unterschied sich nicht von den vielen anderen, die sich in der Kleingartenkolonie „Heimaterde“ zwischen Sträuchern und Obstbäumen versteckten. Die Fensterläden waren dicht geschlossen. Kein Lichtschein verriet, dass hier jemand wohnte.
Maria klopfte an die Fensterlade: zweimal kurz, lange Pause, dreimal kurz. Die Tür öffnete sich spaltbreit.
„Ich bin’s, Maria.“
Im Vorbau stieß sie gegen einen Eimer, der schepperte laut. Wärme schlug ihr entgegen. In dem kleinen Raum, den sie gut kannte, blakte eine Petroleumlampe und warf bizarre Schatten an die niedrige Decke. Maria blinzelte.
Der alte Wilhelm Jakob mit dem weißen Haar und dem spärlichen Spitzbart schaute sie durch seine randlose Brille prüfend an. Dann hinkte er zum kleinen Herd. Als Muni-Fahrer hatte er den letzten Krieg mitgemacht, fast vierzig war er, als es ihn an der Somme erwischte. Ein Granatsplitter wanderte noch immer in seinem Oberschenkel umher.
„Ein Schluck heißer Tee wird dir guttun“, murmelte er.
Maria erblickte auf dem grünen Sofa hinter dem Tisch ihren Vater. Schon weit über fünfzig war er und hatte noch immer sein störrisches schwarzes Haar. Mit seinem dunklen Gesicht, der Hakennase und dem festen Kinn erinnerte er an einen Bergbauern aus den Alpen. Die Stirn war hoch und gut geformt.
Hinter dieser Stirn sind kluge Gedanken. Und unnachgiebige Härte, dachte Maria. Härte gegen sich selbst. Seit ihrer frühesten Kindheit prägte der Vater ihr das ein. „Du musst hart gegen dich sein, nur so kannst du bestehen, nur so kannst du echte Aufgaben übernehmen.“
Wie oft hatte sie Vater noch spät in der Nacht über einem Buch angetroffen. Er lehnte mit der Brust an der Tischkante, die kleine, grüne Schirmlampe warf einen Lichtkreis auf den Tisch, und er las. Seine Nickelbrille glänzte. Und er war müde nach der Schicht bei Borsig. „Lesen müssen wir lernen“, sagte er. „Nur so mit dem Gefühl ist nichts.“ Und dann wies er auf die Bücher in seinem Zimmer, die alle Wände bedeckten. Sie standen sorgfältig geordnet in einfachen Holzregalen.
Und manchmal fügte er hinzu: „Bei den Sozialdemokraten haben wir wenigstens lesen gelernt. Das hat sein Gutes.“
Die Selbstzucht, die Vater besaß, war oft zu schwer für Mutter. Vater hatte einmal zu ihr, Maria, mit Besorgnis gesagt: „Bewahr du dich davor. Mutter zerbricht immer gleich die Seele. Mit allem hat sie Mitleid. Da ist der dicke Professor gestorben, na ja, er sah so gemütlich aus. Mutter weint um ihn. An Fettleibigkeit ist der gute Professor verreckt. Wer kann von uns schon fettleibig werden.“
Maria wusste, dass Vater und Mutter sich liebten. Aber es war für Mutter nicht einfach. Er hatte nie Ruhe, der Vater. Nur einmal schien es, als wäre er zur Ruhe gekommen. Das war, als Mutter starb. Es war eine unheimliche Ruhe. Wie froh war sie gewesen, als er aus seiner kummervollen Starre endlich wieder aufwachte. –
Auf dem Tisch lagen viele Bogen Papier und ein paar abgegriffene Broschüren.
„Maria, was ist los?“, fragte der Vater.
Sie streifte die Kapuze ihres Regenmantels nach hinten und setzte sich.
„Arthur haben sie heute im Werk verhaftet. Dann aber wieder freigelassen.“ Sie berichtete ruhig und sachlich. Sie wusste, dass der Vater jedes Aufgeregtsein hasste, wenn es um die illegale Arbeit ging. Ihre Kehle war trocken.
Erich Fischer schwieg, er schwieg, als habe er nicht zugehört. Dann nickte er überlegend. „Das kann mit uns was zu tun haben, sicher. Sie wollen Arthur als Lockvogel benutzen. Das ist nicht sehr neu. Aber heute haben sie in vielen Betrieben verhaftet. Prag und die Tschechoslowakei.“
Er hatte das halblaut vor sich hin gesprochen und wandte sich jetzt erst an Maria.
„Hat dich keiner begleitet bis hierher?“
Maria sagte, dass sie alles beachtet habe. Sie sei zweimal umgestiegen in der S-Bahn, habe sogar die Wagen gewechselt. Es könne ihr keiner gefolgt sein.
Fischer nickte, und Maria sah, dass der Vater plötzlich müde Augen hatte. Sie tastete nach seiner Hand.
„Du hast ganz blaue Lippen“, sagte er. „Läufst hier die halbe Nacht herum.“
Maria lächelte. „Es ist noch kühl, Vater, das ist es eben.“
Der alte Wilhelm kam an den Tisch gehumpelt und stellte eine Blechtasse mit dampfendem Tee vor Maria. „Ich hab viel Zucker reingetan. Du bist doch so ein Leckermaul. Ich weiß ja.“
Maria schlürfte den Tee. Im Ofen knisterte das Feuer.
„Wir schreiben hier ein Flugblatt“, sagte der Vater. „Hör’s dir mal an.“
Er nahm einen Bogen Papier und hielt ihn näher an die Lampe.
„Ganz oben schreiben wir: ,Tod den Nazis!‘ Und dann: Jetzt sind die Hakenkreuzfahnen in Prag. Wo werden sie morgen sein? Hitler sagt, er will Frieden. Wer glaubt daran noch? Nur Blinde können daran glauben. Unser Thälmann hat gesagt: Wer Hitler wählt, wählt den Krieg! Wer zweifelt noch, dass Thälmann recht hat? Der Krieg steht vor der Tür. Die Nazis und ihre Kapitalisten sind größenwahnsinnig. Macht Schluss! Werktätige, Arbeiter und Arbeiterinnen, unterstützt den Kampfbund gegen Naziterror! Auf zum letzten Gefecht!“
Der Vater ließ das Blatt sinken und sah Maria an.
Sie sagte zögernd: „Die Überschrift müsste anders sein. Vielleicht: Die Nazis wollen Krieg! Das ist besser. Tod den Nazis, das schreckt manchen zurück.“
Erich Fischer kaute am Bleistift. Wilhelm meinte: „Da hat sie recht.“
Fischer strich die Überschrift aus. Sie schwiegen eine Weile. Maria spürte, wie sich die Müdigkeit wie eine warme Welle über den Körper ausbreitete.
„Du legst dich auf das Sofa!“, sagte der Vater. „Du kannst jetzt nicht mehr in die Stadt zurück.“
„Und ihr?“
„Wir werden ein wenig kurbeln“, sagte Wilhelm. „Schöne Zettelchen werden wir drucken. Da werden die Bullen morgen ihren Ärger haben, in den Hintern werden sie sich beißen.“
Maria dachte: Ich will nicht müde sein. Vater muss morgen wieder nach Tegel zu Borsig. Den ganzen Tag steht er an der Werkbank. Wilhelm kann ausschlafen. Bei mir im Büro ist es nicht so schlimm.
„Ich werde kurbeln, Vater.“
„Du hast recht“, sagte der Vater. „Ich muss mich noch ein bisschen hinlegen.“
Maria und der alte Rentner Wilhelm Jakob stiegen in dieser Nacht in den kleinen Kellerraum unter der Laube und drehten abwechselnd die Kurbel des schwarzen Abziehapparates.
Der Stapel der kleinen Handzettel wuchs. Die trübe Petroleumlampe blakte. Maria kämpfte mit der Müdigkeit. Auf den Flugzetteln sprangen ihr immer wieder die manchmal etwas verwischten schwarzen Zeilen ins Auge: „Werktätige, Arbeiter und Arbeiterinnen, unterstützt den Kampfbund gegen Naziterror! Auf zum letzten Gefecht!“
Zweites Kapitel
In der lang gestreckten Werkhalle dröhnten die Maschinen. Der Einrichter Willi Wegener lehnte an dem Betonpfeiler, von dem aus er die Automatendrehbänke und auch die weiter entfernt stehenden Leute, für die er verantwortlich war, überblicken konnte. Er hatte die Hände in die Taschen seines grauen Arbeitskittels geschoben, am Hinterkopf spürte er den rauen Beton des Pfeilers.
Seine Leute arbeiteten. Die Leute, das waren der Paul Nedder aus Schlesien, vor ein paar Jahren noch Stanzer in einer Lederfabrik, dann lange arbeitslos; der Huber-Alois, früher Konditor in München, mit feinen weißen Händen, und die anderen. Jetzt waren sie Automatendreher in dem großen Flugzeugmotorenwerk in der Nähe Berlins. Man hatte sie dienstverpflichtet, und sie konnten zufrieden sein mit dem Verdienst und mit ihrem Einrichter.
Wenn Willi Wegener auch scheinbar untätig am Pfeiler lehnte – er hörte jeden falschen Ton im Gedröhn seiner zehn Maschinen, sogar jedes unvorschriftsmäßige Kreisen, wenn ein Drehmeißel stumpf wurde. Das hörte er sofort heraus, und er war stolz darauf. Auf sein Gehör konnte er sich verlassen. Wie sollte man auch sonst in der Nachtschicht fertig werden, wenn die Lampen gerade so viel Licht gaben, dass man ein paar Meter weit sehen konnte. Viele seiner Einrichterkollegen beneideten ihn. Wie er das nur mache, alles zu übersehen? Er pflegte dann lachend zu antworten, und er lachte gern, mit geraden weißen Zähnen: „Na, hör mal, Mensch, ein richtiger Dreher muss sogar riechen, wenn die Maschine nicht mehr spurt. Jawohl, riechen muss er das.“
Von seinem Platz konnte Willi Wegener aber auch zum schrägen Oberlichtfenster hinausblicken. Draußen war heute ein ungewöhnlich warmer Frühlingstag. Ende März. Willi sah die Wipfel der Kiefern, die sich im leichten Wind wiegten, und zwischen den Wipfeln die blauen Himmelsfetzen mit den eilig vorbeiwirbelnden weißen Wölkchen. Er glaubte sogar den harzigen Geruch der Kiefern zu spüren, diesen sommerwarmen Duft. Er reckte sich, und wie schon oft in den letzten zwei Jahren kam ihm der Gedanke, dass er doch in einer seltsamen Fabrik arbeite. Fast eine Sommerfrische, ein Sanatorium. Überall Wald, dichte Schonungen, dazwischen waren die stumpfgrauen Betonhallen kaum zu entdecken. Von den Buden, in denen er bis siebenunddreißig gearbeitet hatte, war wirklich nicht zu behaupten, dass sie Sanatorien ähnlich seien. Dort hielten sich kaum ein paar spärliche Grashalme zwischen den Pflastersteinen im Fabrikhof. Das Werk hier hatte man nagelneu und nach „luftstrategischen Gesichtspunkten“ angelegt. Darin bestand auch das Geheimnis der Sommerfrische.
Das Werk sollte einer aus der Luft finden? Grüne Baumwipfel konnte der zählen, nichts als grüne Baumwipfel!
Eine Melodie kam Willi in den Sinn: „Man müsste Klavier spielen können, wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frau’n.“ Den Schlager hatte am Tage zuvor der Heesters im Radio gesungen. Vera war im Zimmer umhergetanzt und hatte geseufzt. Willi hatte laut gelacht. Jetzt lächelte er auch. Glück bei den Frauen, das hatte ihm nie gefehlt. Aber ohne Klavierspielen. Dafür besitze ich eine 500er BMW, und die ist mehr wert.
Die Vera, dieses grünäugige Kätzchen, ist der beste Beweis dafür. Wenn der Eisenbahnbeamte Pohl – Reichsbahnsekretär ist er, das klingt so bedeutend, und dahinter steckt nicht viel – mir, dem Dreher Willi Wegener, seine Tochter Vera zur Frau gegeben hat, dann hat die 500er BMW nicht wenig dazu beigetragen.
Die Beamten haben so ihren Stolz. Aber der alte Pohl kann zufrieden sein. Jetzt bin ich Einrichter. Man wird schon weitersehen. Hier ist noch alles drin. Meister vielleicht …
Heute ist Sonnabend und am Mittag Arbeitsschluss, da darf man Schlager summen. Am Nachmittag wird die BMW aus dem Schuppen geschoben, und Vera wird sich auf den Sozius setzen. Sie hebt dabei so schwungvoll den Rock. Das kann sie sehr gut, und ihre Beine sind ziemlich weit nach oben hin zu sehen. Warum soll sie den Rock nicht heben? Die Vera hat Beine, lang und doch kräftig. Was sind schon die Filmbeine der Marika Rökk dagegen? Und dann wird eine Runde gedreht zum halb fertigen Häuschen am Waldrand …
Die Werkswohnung, in der man wohnt, ist nicht schlecht. Mutter Anna kann sich nicht genug freuen, wenn sie zu Besuch kommt. Aber ein bisschen dünn sind die Wände, und an der Decke zeigen sich die ersten Risse. Hat ja auch schnell gehen müssen. Die Werksiedlung haben sie einfach aus dem Wald gestampft. Ein Häuschen ist eben ein Häuschen. Für sich haust man dort. Ein Garten gehört dazu. Jetzt sind nur Baumstümpfe zu sehen. Man wird rackern müssen. Aber die Kleine, die Monika, wird aufwachsen wie im Paradies. Und eine Garage wird gebaut. Die BMW ist zur Not noch in einem kleinen Schuppen unterzubringen. Aber der Volkswagen braucht Platz. Jedenfalls wird am Nachmittag das halb fertige Häuschen besichtigt. Vera wird zum hundertsten Male im Geist die Möbel aufstellen und zum tausendsten Male sagen, dass noch so viele Möbel fehlen. Ist aber nicht leicht: Volkswagensparen, Häuschen abzahlen und dann noch Möbel.
Vera ist ein bisschen ungeduldig. Ihre Schwester, die den Lebensmittelhändler geheiratet hat, ist daran schuld. Jedes Mal wenn sie zu Besuch kommt, erzählt sie, was sie sich Neues angeschafft haben. Vera wird immer ganz weiß vor Wut. Dabei ist die Schwester nicht gerade zu beneiden um ihren Glatzkopf und Säufer. Die weiß schon, wer von den beiden das bessere Los gezogen hat. Manchmal verdreht die Schwester die feuchten Augen und möchte einen am liebsten verschlingen. So ist das: „Was dem einen sein Uhl, ist dem andern sein Nachtigall.“ Das sagt immer der Vater. Er hat überhaupt einen Haufen Sprichwörter auf Lager.
Dann wird man also nach der Baubesichtigung gemütlich nach Hause brummen; am Abend wird im „Rössel“ eine Molle getrunken, und vielleicht geht’s noch ins Kino. Aber das ist zu überlegen. Der Volkswagen will gespart sein, und das Häuschen frisst Geld, da kommt’s auf jeden Pfennig an.
Als Willi bei diesem Punkt seiner Betrachtungen angelangt war, entdeckte er den Meister Schott. Der kam auf ihn zu, hager, nach vorn gebeugt, als schleiche er ohne Kraft dahin. Schott … Willi konnte den alten Meister mit der niemals laut werdenden Stimme, den müden Augen hinter den starken Brillengläsern recht gut leiden. Es tat ihm leid, wenn den Alten der Husten schüttelte. Schott wird alt, und manchmal glaubt man, dass er die Schwindsucht habe. Wie lange kann er noch Meister sein? Willi Wegener straffte sich. Ein Meistergehalt ist besser als der Lohn eines Einrichters. Schott ist für diese Zeit zu still und zu müde. Vielleicht will er auch nicht laut sein, in dieser Zeit.
„Du sollst zu Weidauer kommen, in einer halben Stunde“, sagte Schott, er hustete und verzog gequält das Gesicht.
„Zu Weidauer?“, fragte Willi überrascht. „Was will Weidauer von mir?“
Schott zuckte die Schultern. „Er will mit dir sprechen. Du hast bei ihm einen Stein im Brett!“
„Einen Stein im Brett, ich?“
„Doch, doch“, sagte Schott. Dann schlurfte er weiter, hustete und schüttelte den Kopf, als wundere er sich über seine Schwäche.
Willi starrte ihm nach. Mechanisch tastete er nach der Zigarettenschachtel in seiner Tasche. Als er sie in der Hand hielt, fiel ihm ein, dass Rauchen in der Halle verboten war.
Was will der Weidauer von mir, der Oberingenieur Weidauer? Und das noch am Sonnabend kurz vor Feierabend. Die Maschinen müssen blitzen, kein Drehspan darf herumliegen, kein vergessener Putzlappen. Gerade Oberingenieur Weidauer ist es, der die Halle am Sonnabend wie ein Feldwebel inspiziert. Er kann fuchsteufelswild werden, wenn er die geringste Unordnung vorfindet. Nicht umsonst gilt seine Halle als die Musterhalle des „nationalsozialistischen Musterbetriebes“. Aber was sollte schon sein? An seinen Automaten klappte alles.
Den Oberingenieur bewunderte Willi im Stillen, und doch überkam ihn ein Gefühl des Widerwillens, wenn er ihn sah. Weidauer hatte eine Art zu sprechen, bei der es keinen Widerspruch geben konnte. Seine Sätze waren knapp, nüchtern, kühl war sein Blick, der alles zu durchschauen, der alles zu wissen schien, was in der großen Halle geschah, an den Maschinen, in den Konstruktionsbüros, in der Werkzeugausgabe, im Materiallager. Was er sprach, galt der Halle, der Arbeit, den technischen Vorgängen. Nichts anderes schien es für Weidauer zu geben, auch keine Menschen. Willi bewunderte ihn, weil er von der Arbeit etwas verstand, und vielleicht auch, weil er so kalt und nüchtern sein konnte. Nur nach Arbeitsschluss war das Zipfelchen eines anderen Weidauer zu erkennen. Das war, wenn er aus dem Werktor ging und in seinen Opel-Kapitän stieg, allein, ohne Hast, keinen beachtend, um dann in rascher Fahrt in Richtung Berlin davonzufahren. Willi hatte Weidauer schon ein paarmal dabei beobachtet. Er hatte sogar sein Fahrrad im Gewühl der nach Hause Fahrenden angehalten, um Weidauer zu sehen. Der saß am Steuer seines Opel-Kapitäns und trug gelbe Lederhandschuhe.
Willi warf einen Blick auf die Hallenuhr. Er zog sich den Kittel zurecht.
An der Stirnwand der Halle, etwas erhöht, klebte der „Glaskasten“. So wurde das Büro des Oberingenieurs genannt. Von hier aus hatte Weidauer einen guten Überblick über die Halle. Willi empfand stets ein merkwürdiges Gefühl, wenn er den Glaskasten betrat. Das Dröhnen und Kreischen der Halle erstarb schlagartig. Niemals konnte er sich verkneifen, noch einen Blick zurückzuwerfen. Lautlos bewegten sich die Maschinen, die Männer, lautlos schwebten die Kräne, lautlos gespenstisch rollten Elektrokarren durch die schmalen Gänge.
Der Glaskasten war nüchtern eingerichtet. Oberingenieur Weidauer saß hinter seinem Schreibtisch, sehr aufrecht, über der hohen, furchigen Stirn lag streng gescheitelt das kurz geschnittene Haar. Sein Kopf war schmal, die Nase sprang gerade vor, doch der Hals war kräftig und kurz, die Schultern breit. Wenn Weidauer durch die Halle ging, hatte er einen beweglichen Gang, der so gar nicht zu seinem kühlen Gesicht passte.
„Heil Hitler! Soll mich melden.“ Im Umgang mit Weidauer hatte sich Willi Wegener dessen knappen Tonfall angewöhnt.
Weidauer betrachtete ihn prüfend. Er hatte die Fingerspitzen seiner weißen Hände zusammengelegt. Sie zeigten genau auf Wegener. Der sah auf die gepflegten weißen Hände und dachte, sogar die Hände können einen täuschen. Er hatte diese weichen weißen Hände zupacken sehen, als die Arbeit mit dem Bohrwerk nicht klappen wollte. Eine Stunde lang hätte man vergessen können, dass der Mann, der mit geschickten, ölverschmierten Händen am Bohrwerk hantierte, der Oberingenieur Weidauer war.
„Setzen Sie sich.“ Weidauer wies auf den Stuhl. Er lehnte sich zurück. Am weißen Kittel glänzte das goldene Parteiabzeichen. Und weil genau über Weidauer das Bild des Führers hing, kam es Willi einen Augenblick vor, als verschmelze der Mann auf dem Bild mit dem Mann am Schreibtisch.
Willi hockte auf der Stuhlkante und versuchte in die Augen des Oberingenieurs zu blicken. Das gelang ihm nicht. Die Augen waren sehr hell, die Pupillen winzig klein.
„Ich erfuhr, Ihr Bruder arbeitet im Werk.“
„Jawohl, Herr Oberingenieur.“
„Er war Kommunist?“ Weidauer fuhr mit der rechten Hand behutsam über das goldene Parteiabzeichen und kniff die Augen zusammen.
Willi hatte die Empfindung, als wäre auf einmal das Dröhnen und Brausen der Werkhalle in den Glaskasten eingebrochen. Er starrte auf das runde Abzeichen an Weidauers Kittel, das ihn wie ein totes Auge ansah. Doch das Dröhnen war nur in seinen Ohren aufgeklungen. Die Stille im Raum war heiß und presste den Atem ab. Er dachte: Was hat er gefragt? Arthur Kommunist? Er hörte sich antworten, fühlte den Schweiß auf der Stirn, und seine Antwort war ein Stammeln. Er wisse nichts, niemals habe er sich darum gekümmert – vor vielen Jahren, ja, da sei mal etwas gewesen, aber er, Willi Wegener, habe sich nie darum gekümmert. Sein Motorrad habe ihn mehr interessiert. Politik sei nie seine Sache gewesen.
Er suchte nach seinem Taschentuch. Der Oberingenieur hatte sich erhoben, hinter dem Schreibtisch stand er, die Schultern waren so breit wie das Hitlerbild hinter ihm. Dann ging er mit raschen, federnden Schritten zum Fenster des Glaskastens und spähte, die Hände auf dem Rücken, in die Halle hinunter. Willi Wegener starrte auf den leeren Stuhl hinter dem Schreibtisch, genau auf das glänzende Lederkissen, das ein wenig eingebeult war. Er dachte angestrengt: Er war Kommunist? Er war Kommunist?
Weidauer setzte sich wieder und trommelte mit seinen schmalen Fingern auf die Schreibtischplatte.
„Ja“, sagte er, „er war Kommunist, Ihr Bruder.“ Er hörte auf zu trommeln.
Willi rührte sich nicht. Er kam sich vor, als säße er vor einem Hypnotiseur. Vor vielen Jahren hatte er im Wintergarten eine Vorstellung gesehen, da saß einer und blickte jemand unverwandt in die Augen, und der konnte sich nicht bewegen.
„Jawohl, Herr Oberingenieur“, antwortete er. Dann sah er zwischen den schmalen Lippen des Weidauer die Zunge auftauchen, spitz und rot. Er dachte dumpf: Was will er von mir? Hat eine Zunge wie eine Schlange. Über den Gedanken erschrak er.
In seiner Halle habe Sauberkeit zu herrschen, sprach Weidauer. Solche Schweinereien wie in anderen Hallen werde er nicht dulden. Ja, er sei sehr erstaunt gewesen, in der Direktion den Namen Wegener in einem unangenehmen Zusammenhang genannt zu hören. Den Namen Wegener gerade, wo er doch auf ihn, Willi Wegener, so große Stücke halte …
Willi presste die Handflächen fest zusammen. Er dachte an das halb fertige Häuschen, das Volkswagensparen und den Meister Schott. Und er sah wieder das goldene Abzeichen wie ein starres, kaltes Auge.
„So, Wegener“, hörte er Weidauer sagen, „Sie müssen reinen Tisch machen. Ich brauche Leute wie Sie. Nun, Sie wissen Bescheid.“
Willi Wegener erhob sich und sagte: „Jawohl, Herr Oberingenieur!“
Der Schlager summte in seinem Kopf, immer wieder, hartnäckig, als gäbe es nur ihn, diesen dummen Schlager.
„Man müsste Klavier spielen können.“ Dazwischen Weidauers Stimme: „Nun, Sie wissen Bescheid.“ Willi Wegener schob sein Fahrrad. Er hätte schon zu Hause sein können, doch er ging zu Fuß und schob sein Fahrrad. Über den Siedlungshäusern flimmerte die Sonne. Die Kinder ließen die Kreisel über die glatten Betonstraßen springen. Er bemerkte nichts davon.
Er war aus dem Glaskasten in die Halle gestolpert und wie benommen zu seiner Automatenreihe gegangen. Paul Nedder hatte ihn forschend angeschaut. „Hat dich der Alte fertiggemacht?“ Er hatte abgewinkt, gleichgültig hatte er die Automaten kontrolliert und war froh gewesen, als die Sirene heulte. Am Werktor hatte er einen vom Prüfstand abgefangen und nach Arthur gefragt und alles erfahren, im Flüsterton, dass Arthur verhaftet und wieder freigelassen worden sei und dass dies nichts zu bedeuten brauche, denn sie hätten viele verhaftet und dann wieder freigelassen. Willi hatte sich hastig verabschiedet.
Wie er nun, das Fahrrad schiebend, durch die Straßen der Werksiedlung schlich, packte ihn der Zorn auf diesen Weidauer mit dem kalten Gesicht und auf dieses Werk, das wie ein Sanatorium aussah. Doch je länger er ging und nachdachte, desto mehr verwandelte sich sein Zorn und richtete sich nun gegen den einen, der Arthur hieß und sein Bruder war.
In der Kindheit war Arthur für ihn einfach „Atze“ gewesen. Ein wenig fürchtete er den Bruder, am meisten aber bewunderte er ihn. Atze war ein verlässlicher Schutz gegen andere, Atze hatte die stille Autorität des Älteren.
Die Liebe zu technischen Dingen, die Freude am Tüfteln und Basteln, die hatte Willi von Arthur gelernt. Was war das für ein Winter im Jahre fünfundzwanzig gewesen, als sie im Keller in der Heidenfeldstraße hockten und Arthur ein altes Motorrad zusammenbaute. Willi war jeden Tag – er lernte damals in der Schwartzkopffbude – in den Keller hinabgestiegen, kaum dass er etwas gegessen hatte. Dort hockte Atze und bastelte mit ölverschmierten Händen. Willi setzte sich auf den Hauklotz und schaute zu. Bis Atze ihn dies und jenes machen ließ und in seiner knappen Art erklärte.
Arthur war damals arbeitslos. Er hatte Zeit zum Denken. Willi hörte zu und hörte doch nichts. Wenn Arthur ihn fragte: „Na, wie ist’s bei euch in der Bude. Haben sie wieder die Löhne gedrückt?“, gab er irgendeine Antwort. Er wusste nichts. Er kümmerte sich nicht darum. Er war Lehrling. Und hier das Motorrad war viel interessanter.
Arthur seufzte manchmal:
„Brüderchen, Brüderchen …“
Mein Gott, Arthur war arbeitslos, dauernd sann er über Politik nach, stritt sich mit Vater und aller Welt – was ging ihn das an. Doch nun waren sie in der gleichen Bude. Und Weidauer hatte gefragt: „Er war Kommunist?“
Es muss was gewesen sein. Wer weiß, was Arthur gesagt hat. Er hat doch nie den Mund halten können. Überall muss er nörgeln. Vollkommen verseucht ist er und verdreht. Was habe ich aber damit zu tun? Mich sollen sie aus dem Spiel lassen. Ich bin nicht der Arthur, der die Maria geheiratet hat und den alten Fischer zum Schwiegervater genommen hat, der bin ich nicht. Weidauer meint es gut mit mir, er muss sich sichern. Natürlich muss er das. Der alte Schott schleicht nur noch umher, und ich will Meister werden.
Willi schwang sich aufs Rad, ein Tourenrad der Marke „Brennabor“, und trat wütend in die Pedalen.
Am Fenster erblickte er Vera. Sie beugte sich weit hinaus. Sie hatte das grüne Kleid an, das Kleid mit dem weiten Ausschnitt, ihr weißer Hals und das blasse Gesicht leuchteten, und die langen rotbraunen Haare waren wie Flammen. Sie nickte, als sie ihn sah, und verschwand vom Fenster. Jetzt wird sie flink den Teller füllen und ein Liedchen trällern, vielleicht: „Rosemarie, Rosemarie“. Das „i“ wird sie lang ziehen, furchtbar lang.
Als Willi das Rad an die Hauswand lehnte, hatte er sich entschlossen, Vera nichts zu sagen, nichts von Weidauer und nichts über die Sache mit Arthur. Er, Willi Wegener, wollte einen schönen Sonntag haben, einen ruhigen und friedlichen. Oder hatte man sich diesen Sonntag nicht verdient?
Drittes Kapitel
Hermann Wegener lag reglos im Bett. Er schaute zur Wand hinüber, auf das Bild mit dem dicken Rahmen, dieses Stillleben, das Anna in die Ehe mitgebracht hatte, damals vor fünfunddreißig Jahren. Es glänzte in allen Farben, weil die Sonne darauf fiel. Der riesige Schinken leuchtete glutrot. Er lag in einer Schüssel aus Silber. Die aufgeschnittenen Früchte schimmerten gelb und saftig. Es waren Früchte, die Vater Wegener gar nicht kannte. Vielleicht waren sie auch nur in der Fantasie des Malers vorhanden. Warum hängt man sich eigentlich so ein Bild in die Schlafkammer? dachte Hermann. Ist es die Sehnsucht nach reichlichem Essen? In den vielen Jahren, seit denen das Bild an der Wand hängt, hat man eigentlich immer zu essen gehabt, es ist immer etwas aufzutreiben gewesen, auch in den schlechtesten Zeiten. Und jetzt? Nun, Essen ist da. Aber wie viele Jahre hat es gegeben, in denen einem das Wasser im Munde zusammenlief, wenn man auf das Bild mit dem Rollschinken blickte? Hermann versuchte zu lächeln. Was für komische Gedanken einem zufliegen, gerade heute!
Es war ein Maisonntag, und Hermann Wegener hatte seinen sechzigsten Geburtstag. Er lag wach, seit die matte Helligkeit vor dem Fenster stand. Als Anna sich zu ihm drehte, schloss er schnell die Augen. Anna stand leise auf und ging aus dem Zimmer. In der Tür tauchte der strubblige Kopf Martins auf, und durch die halbgeschlossenen Lider sah Hermann, wie Anna den Enkelsohn nach draußen drängte.
Der Martin wäre so gern reingekommen. In Annas Bett will er sich legen, und dann will er Fragen stellen. Viele Fragen: Großvater? Wie sieht der Sonderzug für den König von Rumänien aus? Sind die Türklinken richtiges Silber? Ihr baut doch den Zug, Großvater?
Großvater? Hat’s sehr weh getan, als die Franzosenkugel deine Schulter traf? Und immer, wenn Martin so fragt, nehm ich die Uhrkette vom Nachttisch. Daran ist die seltsam verzogene Kugel befestigt, die damals, in den ersten Augusttagen 1914, in einem Ardennendorf meine Schulter durchschlug. Ich erzähle, wie der Schmerz heiß durch meine Schulter riss und wie die Kugel in der Seitentasche des dicken feldgrauen Waffenrocks hängenblieb, ich erzähle, wie ich schrie und alles vergaß und wie das rote Blut floss.
Großvater? Die Franzosen sind gerannt, ja? wird Martin mit großen Augen fragen. – Ja, sie sind gerannt, aber geschossen haben sie auch.