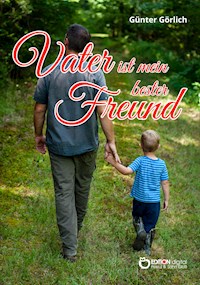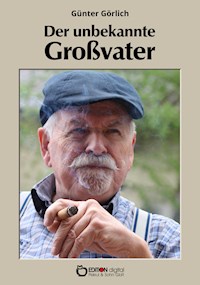8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch mit dem poetischen Titel, das wahrscheinlich zu den bekanntesten Büchern von Günter Görlich gehört, beginnt an einem dritten September. Und es beginnt mit schlechter Laune: Meine Stimmung war so mies wie das Wetter an diesem dritten September. Das Datum nenne ich so genau, weil an dem Tag die Schule anfing. Ein entscheidendes Jahr steht vor dir, hatte mein Vater mit Nachdruck gesagt. Warum sollte die achte Klasse so entscheidend sein? Vielleicht weil’s die Jugendweihe gibt und den Personalausweis? Na, ich weiß nicht. Der da schlechte Laune hat, der heißt Klaus Herper, und verantwortlich für seine schlechte Laune macht er seinen Vater – Rolf Herper, Ökonom und späterer Parteisekretär. Denn der war schuld daran, dass Klaus und seine Familie jetzt in dieser Riesenstadt hockten, was ihm nicht gefiel – ganz und gar nicht. Gemeint ist die DDR-Hauptstadt Berlin. Und hier war für Klaus alles aus seiner gewohnten Ordnung gekommen. Das fängt schon damit an, wer von den Familienmitgliedern wann aus dem Haus geht. Das ist anders als in Potsdam. Außerdem wohnen die Herpers jetzt höher als dort, viel höher – gewissermaßen direkt unter dem Himmel. Grund für den Umzug und alle damit verbundenen Änderungen, die Klaus Herper nicht gefallen, ist eine „fixe Idee“ seines Vaters, der neue Herausforderungen sucht und unbedingt seinen Arbeitsplatz in Potsdam gegen einen anderen Arbeitsplatz in Berlin tauschen will. Für Klaus bedeutet der Stadt-Wechsel auch eine neue Schule, ein alter gelbroten Ziegelbau aus dem Jahre 1910, und neue Mitschüler – seine Vormittagswelt. Gleich am Anfang gibt es dort Ärger – Ärger mit Mateja, Heinz Mateja, dem bisherigen Klassenbesten der 8b und talentierten Trompeter. Es kommt zum Kampf. Und dann hält der Neue eine ziemlich spannende Vorstellungsrede, die ihm einen Spitznamen verschafft – Lako wie lakonisch. Aber da ist auch Herr Magnus, ein toller Lehrer, wie Klaus bald feststellen kann, und Karin, in die er sich gern verlieben und mit der er gern morsen möchte, was aber beides anfangs nicht so recht funktionieren will, und da ist noch sein Freund Bully, der zu ihm hält, wenn es schwierig wird. In diesem spannenden und noch immer lesenswerten Buch, das bei seinem ersten Erscheinen 1971 für viele Diskussionen sorgte, stellt Görlich viele Fragen zum Sinn des Lebens, zur Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen, zu Freundschaft und Liebe und ob der DDR-Sozialismus so richtig ist, wie er damals war. Viele davon sind auch heute noch aktuell
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Günter Görlich
Den Wolken ein Stück näher
978-3-96521-691-4 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien erstmals 1971 in Der Kinderbuchverlag Berlin. Dem E-Book liegt die Ausgabe von 1985 zugrunde.
© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
1. Kapitel
Meine Stimmung war so mies wie das Wetter an diesem dritten September. Das Datum nenne ich so genau, weil an dem Tag die Schule anfing. Ein entscheidendes Jahr steht vor dir, hatte mein Vater mit Nachdruck gesagt.
Warum sollte die achte Klasse so entscheidend sein? Vielleicht weil’s die Jugendweihe gibt und den Personalausweis? Na, ich weiß nicht.
Ein guter Mann ist mein Vater, so im Allgemeinen hat er auch recht. Er dachte vielleicht an sich, weil er mit der achten Klasse hatte abgehen müssen von der Schule – die Zeiten waren so. – Es war eine alte Schule in Lichtenberg. Wir haben sie mal besichtigt. Vater fand sogar noch Inschriften, die er in die Wand geritzt haben wollte. Ich konnte nichts mehr entdecken, war ja alles zerkratzt.
Vater war schuld an meiner miesen Stimmung, denn ihm verdanken wir es, dass wir in dieser Riesenstadt hockten, was mir nicht gefiel – ganz und gar nicht.
Ich stand auf dem Balkon unserer neuen Wohnung, acht Stockwerke über der Straße, mit dem Fahrstuhl zu erreichen, wenn der nicht seine Mucken hatte. Das Fahrstuhlgeräusch ging meiner Mutter auf die Nerven. Gleich hinter unserer Küchenwand stand der Motor, und der hatte was zu ziehen und brummte ganz schön.
Mutter behauptete am zweiten Tag nach unserem Einzug, dem Lärm nach müsste jeden Augenblick ein Lastkraftwagen in ihre Küche hineinfahren. Das war natürlich übertrieben.
Von Norden wehte der Wind, trieb graue Wolken tief über die Stadt hinweg. Man musste staunen, wo kamen alle diese Wolken her?
Schornsteine und andere turmartige Gebäude wurden von den Wolken um die Hälfte gekürzt, sie sahen aus wie abgebrochen. Es gefiel mir, auf dem Balkon zu stehen, gewissermaßen über der Stadt. Das war wie so vieles andere neu in meinem Leben. Das sollte mir endlich bewusst werden. Vater forderte es schon eine ganze Weile von mir.
Bloß an diesem dritten September hatte ich nicht die Stimmung dazu. In einer Stunde würde ich in einer anderen Schule sein – anderes Schulgebäude, andere Lehrer, andere Schulkameraden, andere Kniffe, andere Spitznamen. Vorsichtig beugte ich mich über das Balkongeländer. Die Tiefe kam mir unheimlich vor, dabei wohnten wir schon eine Weile hier oben, direkt unter dem Himmel. Diesen Begriff hatte meine Schwester Marlies gefunden.
Ich gab mein Angstgefühl natürlich nicht zu, um nichts in der Welt. Wie käme ich, Klaus Herper, dazu, hatte ich doch die höchsten Bäume in der waldreichen Umgebung Potsdams erklettert.
Ich wurde das Gefühl nicht los, und mein Vater hatte gemerkt, dass mir beim Runtergucken nicht ganz wohl ist. Am ersten Tag – die Möbelträger räumten noch ein, und ich hatte als gutes Familienmitglied der Herpers auch mitgeholfen – war ich so einfach an das Balkongeländer rangegangen und ganz schnell zurückgezuckt. Vater sagte nur: „Man muss sich daran gewöhnen.“ Und Mutter, die gerade in Holzwolle wühlte, um ihre Tassen, Krüge und Teller zu bergen, rief ängstlich: „Passt mir bloß auf Marlies auf.“
Vater sagte: „Man muss es ihr nur erklären. Dann geht sie schon nicht ran.“
Typisch für Vater. Er ist ein großer Erklärer. Kann mich manchmal nervös machen. Ich weiß schon alles, aber er erklärt’s mir noch einmal. Mutters Warnung ist berechtigt. Wer Marlies kennt, der weiß auch, dass sie, obwohl sie kaum mit der Nase an das Balkongeländer ranreicht, gerne einen Blick über das Geländer riskieren möchte. Die fünfjährige Krabbe schiebt sich einfach eine leere Kiste ran, nicht auszudenken.
So sagte ich zu Marlies: „Mach keinen Quatsch, du. Ich kann dir sagen, da bleibt nichts mehr übrig von dir, wenn du da runtersegelst. Hast du gehört? Bist nicht auf unserer Terrasse in Potsdam, Mädchen. Dort betrug der Höhenunterschied zum Rasen zwanzig Zentimeter.“
Sie sah mich an mit ihren blauen Augen. Wer hat bloß in unserer Familie solche blauen Augen? Mutter? Ihre gehen mehr ins Grüne. Vater? Völlig unbestimmbar und dazu die Brille. Bruder Werner? Da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, wozu auch. Und jetzt war’s schwer, das nachzuholen. Werner schaukelte auf einem Wachboot vor Rügen. Bei dem Wetter. Wind von Nord, muss schwere See sein. Die werden ganz schön durchgeschüttelt auf dem Kasten. Ist ja auch egal, was Werners Augen für eine Farbe haben.
Also am dritten September stand ich auf dem Balkon und wartete auf Mutter und Marlies. Ich wollte ihnen zuwinken.
Nach unserem neuen Familienfahrplan waren die beiden die ersten, die das Haus verlassen mussten. Bis zum Sommer, draußen in Potsdam, ging’s umgekehrt lang. Erst zog Vater ab, er lief bis zu seiner Hochschule. Das wäre Medizin gegen Kreislauf- und Herzbeschwerden, sagte er und hielt lange Vorträge darüber. Die sind, ich muss das gerechterweise zugeben, für mich immer langweilig. Was ist überhaupt der Kreislauf? Und gibt es so was wie Herzbeschwerden? Ich war der zweite in Potsdam, der gehen musste, das heißt, ich schmiss mich auf mein Rad. Nur fünf Minuten Weg hatten Mutter und Marlies.
Eigentlich war in Berlin alles aus der gewohnten Ordnung gekommen.
Mutter und Marlies mussten bald auftauchen, der Fahrstuhl schwieg. Sie hatten noch die Vortreppen runterzugehen, mussten die Tür öffnen. Ein Verkehr war auf der Straße. Die Lastwagenmotoren heulten genau vor unserem Haus auf. Vor der Steigung zum S-Bahnhof mussten die Fahrer schalten. Das ging nicht anders, sie kamen von der Ecke mit Ampelregelung. Die Schalterei hatte es in sich, das Zwischengasgeben, und ich fand, das war mehr Nervensägerei als der Fahrstuhl.
Unseren Vater störte das alles nicht, auch die Flugzeuge nicht, von denen man hin und wieder annahm, sie wollten auf dem Dach landen. Vater konnte ja um keinen Preis zugeben, dass ihn etwas störte in der neuen Wohnung, denn er hatte uns in die Stadt gezwungen.
Das war, wie Mutter sagte, durch seine fixe Idee gekommen. – Ich erinnerte mich an ein Abendessen im Winter. Die Tannen in unserem Garten waren verschneit. Ich kam vom Skilaufen aus den Hügeln, müde wie ein Hund, hungrig wie ein Wolf. So bemerkte ich nicht gleich, dass irgendetwas nicht stimmte in unserer Familie. Absolutes Schweigen herrschte am Tisch. Das war nicht üblich bei uns, nur wenn was nicht im Lot war, redete keiner.
Auf einmal legte Vater sein Besteck neben den Teller. Er machte das ganz genau, so, als wäre er Oberkellner im Haus des Handwerks.
Das Haus des Handwerks war unser Lokal in Potsdam, wenn wir mal Geld übrig hatten, oder es gab etwas zu feiern, und Mutter wollte nicht in der Küche stehen.
Vater legte also sein Besteck ordentlich hin und sagte: „Ich hab es mir gut überlegt. Ich muss raus, bin bald leer. Das spüre ich.“ Ich horchte auf und fühlte, irgendetwas kam auf mich zu. Mutter erwiderte nach kurzem Schweigen: „Was treibt dich denn weg, ich verstehe dich nicht. Ich glaube, es ist eine fixe Idee von dir.“
„Ich treibe mich weg. Ich habe mich entschlossen.“
„Und wie?“ fragte Mutter.
Vater sagte nichts.
Und ich ahnte, dass Vater von seiner Hochschule weg wollte. Er hatte manchmal davon gesprochen, mehr im Scherz, und ich fasste es auch so auf. Vater scherzte ja gern, spann manchmal fantastische Pläne.
Mutters Frage verstand ich gut. Und wie?
Sie dachte an das hübsche Häuschen, in dem wir wohnten. Solange ich denken konnte, wohnten wir hier. Der Wald war nicht weit, die Havel nicht und verschiedene Seen. Und Mutter hatte ihre Arbeitsstelle in der Nähe. Seit ein paar Jahren arbeitete sie in der Poliklinik als Sekretärin. Mutter hatte Krankenschwester gelernt.
Ich sagte: „Müssen wir hier raus?“
Vater sah mich an, ganz komisch sah er mich an, so, als hätte er vergessen, dass ich am Tisch saß.
„Ja. Übrigens nicht schlecht, denn Veränderung ist immer gut.“ Mutter fragte: „Du hast Schwierigkeiten? Mit den Kollegen?“ Vater schüttelte den Kopf. „Nein, gar nicht. Ich will und muss weg, ist das so schwer zu verstehen. Von mir geht das aus. Man wird aus allen Wolken fallen.“
Mutter sagte: „So ist das also.“
„Natürlich muss alles gut vorbereitet sein. Wohnung und so weiter. Für dich muss ebenfalls überlegt werden.“
„Du hast etwas vorbereitet?“, fragte Mutter.
„Ja, nach Berlin.“
Nun schwieg Mutter. Ich sagte auch nichts.
Marlies wollte den Fernseher einschalten, der Sandmann kam. Und ich stellte hier die Frage, die mich damals im Winter so stark beschäftigte, die mich hellwach machte an jenem Abend. Ich habe nichts zu sagen in so einer Angelegenheit?
Muss man mich nicht auch fragen? Schließlich war ich fast einssiebzig groß, sah von hinten aus wie ein Mann. So ein Ortswechsel betraf schließlich auch mich.
An jenem Abend konnte ich lange nicht einschlafen. Ich dachte darüber nach, wie das ist, wenn der Vater will, und die anderen wollen eigentlich nicht.
Nun stand ich auf dem Balkon in Berlin, und es war alles so gekommen, wie es sich damals angekündigt hatte.
Die beiden Frauen traten noch nicht aus dem Haus. Wer weiß, was sie aufhielt. Ich nahm an, die Kleidung. Vielleicht war Marlies’ Rock verdreht, und Mutter stand mit ihrer Regenkapuze sowieso auf Kriegsfuß.
Vater kam auf den Balkon. In den letzten Tagen hatte ich ihn nie so richtig zu Gesicht bekommen, er war dauernd unterwegs. Es ging um seine neue Arbeitsstelle, wie ich hörte. Dies und jenes war noch zu erledigen; bürokratischer Kram, wie er meinte. Er sah abgehetzt aus. Vater hatte die Hände in die Taschen geschoben, der Schlipsknoten saß wie immer nicht richtig. Er verstand es einfach nicht, und das gab er auch zu, einen richtigen Doppelknoten hinzukriegen.
„Noch nicht zu sehen?“, fragte er.
„Nein.“
„Blödes Wetter. Und das im September.“
Ich dachte, nicht bloß das Wetter ist blöde. Mir fiel ein, dass mein Vater heute ebenfalls neu anfing in dem Werk. Was er dort arbeitete, wusste ich noch nicht, es hatte mich nicht interessiert, ganz bewusst hatte mich das nicht interessiert. Vater rauchte hastig, der schräg fallende Regen nässte sein weißes Hemd, beschlug die Brille, die er abnahm und mit dem Taschentuch reinigte.
Ohne Brille sah er recht hilflos aus, Vater war ziemlich kurzsichtig. Ich hoffe, dass ich mit meinen Augen nach Mutter komme, wie mein Bruder. Mutter braucht keine Brille.
„Kannst dir was wegholen, bloß im Hemd“, sagte ich.
„Da sind sie“, rief Vater, beugte sich über das Geländer, steckte zwei Finger zwischen die Zähne und pfiff.
Sein Pfiff übertönte den ärgsten Verkehrslärm. Ich wollte zu gerne ebenso pfeifen können. Doch es gelingt mir nicht. Kommt bloß ein klägliches Zischen raus.
Mutter sah hoch und drohte mit der Hand, denn sie sah den Vater mit seinem weißen Hemd im Regen.
Der lachte und pfiff noch einmal.
Mutter nahm Marlies an die Hand, eilte über die Straße. Und sie verschwanden im Strom der Leute, die zur S-Bahn liefen.
„Da laufen sie nun“, sagte Vater.
Was sollte ich darauf antworten. Vater erwartete sicherlich keine Antwort. Er sah zum S-Bahnhof Leninallee – ein hässlicher roter Backsteinbau, angerußt und nicht mehr sauber zu kriegen.
Ich trat ins Zimmer zurück, setzte mich an den Tisch, kaute ohne Lust meine Schrippe.
Vater kam vorbei, zerrte an seinem Schlips.
„Wasch ab, Mama freut sich.“
„Natürlich wasch ich ab.“
Vater blieb stehen, setzte sich in den Sessel mir gegenüber.
„Schlechte Laune?“
„Ja.“
„Warum?“
„Weißt es doch.“
Vater fingerte eine Zigarette aus der Schachtel, knüllte die Packung zusammen, warf sie in den Papierkorb, der an seinem Schreibtisch stand. Die Schachtel fiel daneben.
Ich stand nicht auf, um sie aufzuheben. Vater tat’s. Eigentlich hätte ich aufspringen müssen.
„Ich fange heute ebenfalls neu an“, sagte Vater.
„Du wolltest ja“, erwiderte ich.
Vater rauchte.
„Wir müssen uns mal Zeit nehmen“, sagte er, „und uns richtig aussprechen.“
Ich spülte die Schrippe mit Kakao nach. Das Zeug war heute zu süß. Ich hatte zu viel Zucker reingetan.
Vater stand auf, drückte die halb aufgerauchte Zigarette im Aschenbecher aus. Er ging an den Schreibtisch, legte sorgsam Schriftstücke in seine Tasche.
„Bist du aufgeregt?“, fragte ich.
Vater drehte sich mir zu.
„Warum?“
„Weil du neu bist in deinem Werk.“
„Du bist aufgeregt, ja?“, fragte er.
„Keine Lust hab ich“, sagte ich, „das weißt du ja.“
„Ich habe Lampenfieber“, sagte Vater, „bleibt nicht aus. Aber ich habe große Lust, ganz große.“
Was für ein Wunder! Er hat Lust, ganz große. Wie sollte er auch nicht, denn es war sein Wunsch.
Vater zog sich an, holte seinen Schirmknirps aus dem Schrank und wühlte rücksichtslos. Mutter würde sich freuen! Und sie hätte wieder Gelegenheit, über Liederlichkeit und so weiter zu reden. Vater kam ins Zimmer zurück.
Er beugte sich zu mir, umfasste mich und lächelte.
„Mach’s gut, Alter, toi, toi, toi für die neue Schule.“
Ich roch das herbe Kölnischwasser, das Vater reichlich und gern benutzte. Ich mochte diesen Geruch.
Die Tür klappte, der Fahrstuhlmotor wollte durch die Küchenwand, ich war allein. Noch eine Viertelstunde hatte ich Zeit, laut Plan, aufgestellt vom Vater. Drei Aufgaben waren zu erfüllen, Abwaschen, Gashahn abdrehen, Fenster schließen.
Ich sprang auf. Was sollte ich herumsitzen.
Ich wusch ab, schloss die Fenster und den Gashahn, nahm meine Tasche, zog den Anorak über.
Hin musste ich doch. Drei Querstraßen weiter sollte ich mich bei Herrn Magnus melden, dem Klassenleiter der 8b. Das wusste ich, und dass die Schule ein uralter Kasten war, wusste ich auch. Was sonst sein würde, dort in einer Stunde und in den nächsten Tagen und Wochen – im ganzen nächsten Jahr –, das wusste ich nicht. Ich lief die Treppe hinunter, denn ich wollte nicht im Fahrstuhl steckenbleiben. In der vergangenen Woche war jemand fast eine Stunde eingeschlossen gewesen.
2. Kapitel
Drei Straßen weiter stand meine Schule. Gleich am dritten Tag nach unserem Umzug war ich dort gewesen. Wie erschrak ich über den gelbroten Ziegelbau mit dem schiefergedeckten Turm, auf dem eine verrostete Fahnenstange mit einer schiefen Krone an der Spitze steckte. Ich kletterte über den Zaun und stand auf dem Hof, der durch kahle Mauern von drei Seiten eingefasst wurde. Drei Kastanienbäume waren das einzige Grüne auf dem Hof. Aus einem Fenster rief mir ein Mann in einem blauen Schlosseranzug zu, wahrscheinlich der Hausmeister, warum ich über den Zaun steige, das Tor sei doch nicht verschlossen. Im Übrigen solle ich mich vom Hof scheren, es wäre schon genug geklaut worden. Ich verschwand durch das Tor. Die Kette am Schloss diente wahrscheinlich zur Täuschung Nichteingeweihter. Beim Rausgehen entdeckte ich über dem Eingang die Jahreszahl 1910.
Ich war restlos bedient und für diesen Tag nicht mehr zu gebrauchen; ich musste diese Bude aus dem Jahre 1910 mit meiner bisherigen Schule in Potsdam vergleichen. Die war fünfzig Jahre später gebaut worden, lag auf einer kleinen Anhöhe, hatte eine Fensterfront, die fast nur aus Glas bestand. Nun begriff ich erst, was unser Direktor in Potsdam und andere Leute meinten, wenn sie von unserer modernen Schule schwärmten und uns zur Dankbarkeit aufforderten.
Jetzt wusste ich, dass sie recht hatten. Sie kannten eben andere Schulen, solche wie die hier an der Ringbahn in Berlin.
Ich kannte sie nun auch.
Es hatte aufgehört zu regnen, als ich drei Straßen weiter einbog am dritten September. Von unseren neuen Wohnblocks war nichts mehr zu sehen. Ich stand in einer alten Großstadtstraße. Die Luft konnte einem wegbleiben, so eng quetschten sich die Häuser aneinander.
Das Tor stand heute weit offen, die Kette war nicht vorgelegt. Der Hausmeister hob sie bestimmt bis zu den nächsten Ferien auf.
Ich war nicht unter den Ersten. Man redete und lachte. Das übliche. So fand ich mich zurecht, das kannte ich. Erlebnisse aus zwei Monaten gab es zu erzählen. Jeder machte das auf seine Art. Manche hauten ganz schön auf den Putz, um die scharten sich die Massen. Da lachte man mit und versuchte, auch was anzubringen. Und einer in so einem Kreis war immer der große Conferencier. Das kannte ich alles. Gab’s bei uns in Potsdam auch. In den vergangenen Jahren war mir das nie so aufgefallen, da traf ich schon auf dem Weg zur Schule Kumpel, denen man alles erzählte, und die erzählten auch, jeder wollte die Ferienzeit loswerden.
Hier war ich Beobachter, hier kannte mich keiner, es nahm keiner Notiz von mir. Warum auch? Ich stellte mir vor, ich wäre ein Geheimdienstmann – ein plötzlicher Einfall. Geheimdienst hin, Geheimdienst her, ich hatte in dem Durcheinander auf dem Hof einen Herrn Magnus zu finden.
So fragte ich eine Lehrerin nach Herrn Magnus. Es war aber keine Lehrerin, sondern eine Mutter, die ihren Sohn zur Schule brachte. Sie kannte jedoch Herrn Magnus und lächelte, als sie mir Auskunft gab: „Dort an der Kastanie, das ist Herr Magnus.“ Und er war hier der große Conferencier. Das war zu merken, er redete und lachte, und ich sah nur sein Gesicht. Ein paar Schritte von der Kastanie entfernt blieb ich stehen.
Das waren nun ab heute meine Klassenkameraden. Sie werden meine Vormittagswelt für die nächste Zeit sein. Und Herr Magnus wird die Elternversammlungen leiten, Mutter wird sich an ihn wenden, wenn sie über mich etwas hören will.
Nach den sieben Jahren Schule, die hinter mir lagen, würde ich zum ersten Male einen Mann als Klassenlehrer haben. Frau Dosch führte uns bis zur vierten Klasse, ohne sie konnten wir uns damals die Schule nicht vorstellen. Uns fehlte etwas, wenn Frau Dosch nicht da war. Sie war die Unfehlbare, die Gerechte, die Sanitäterin, wenn mal jemand ein Loch im Kopf hatte, die Ersatzmutter. Das gab’s nun nicht mehr.
Ich sah mir Herrn Magnus aus einer gewissen Entfernung an. Er aber hatte mich entdeckt; der Kreis teilte sich, Herr Magnus trat heraus, ein großer, kräftiger Herr Magnus.
Von den anderen sah ich nur Gesichter, vielleicht diese und jene Einzelheit. Ein Mädchen trug einen knallroten Pullover, ein Junge hatte die Arme verschränkt und sah aus wie ein Ringer.
„Du bist der Klaus Herper?“, fragte Herr Magnus.
„Ja. Guten Tag, Herr Magnus.“
Er gab mir die Hand, drückte kräftig zu.
„Du bist ein richtiger Hüne“, sagte Herr Magnus und musterte mich genau, „gut im Sport?“
„Ja. Eigentlich ja.“
„Ekliges Wetter heute. Da sieht es hier nicht gerade hübsch aus“, meinte Herr Magnus.
„Das finde ich auch“, sagte ich.
„Du wirst dich daran gewöhnen. Unser Hinterhof hat Vorteile. Sieh mal, hier fallen einem die Kastanienbäume ganz besonders auf. Und wenn die im Mai ihre Kerzen aufstecken!“
Er hatte einen Arm um meine Schulter gelegt, und wir gingen ein Stück, der Schwarm folgte uns, spürte ich.
Dann stellten wir uns auf zum Morgenappell. Herr Magnus schob mich in die erste Reihe, ich war der Größte in dieser Truppe. Kicherte nicht jemand? Ich hätte sonst was dafür gegeben, die ganze Eingewöhnung hinter mir zu haben.
Herr Magnus sagte: „Nun wollen wir mal die Ferienstimmung vergessen. Klar, Leute?“ Dann begann das übliche, überall im Lande fing so das Schuljahr an. Die Klassen hatten ihre Plätze auf dem Hof, es dauerte eine Weile, bis im Allgemeinen die Ferienstimmung nachließ.
Jetzt erst bemerkte ich, dass neben mir einer stand, der dauernd an einer Trompete herumputzte. Herr Magnus sagte zu ihm: „Also ruhig Blut. Gehe aus dir heraus. Zeige, was du kannst.“ „Die Luft ist ganz schön feucht heute“, sagte der Junge. Er war fast so groß wie ich, putzte seine Trompete und sah mich von der Seite an. Es war nicht abschätzend, das kann man nicht sagen, doch ein bisschen gespannte Neugier lag in seinem Blick. In der Art: He, was bist du für einer! Immerhin hatte ich ihn, was die Körperlänge betraf, übertroffen. Da musste man genau mustern, das war zu verstehen. Ich sah mir den Trompetenputzer auch an. Ich hätte wetten können, dass die Mädchen schön hinter dem her waren. Wie weit das den Schwarzhaarigen interessierte, war eine andere Frage.
Vom Appell, der nun folgte, blieb mir nur der Trompetenmensch in Erinnerung. Der ging zum Fahnenmast, lief lässig, hielt sein Instrument ein Stück von sich ab, sorgfältig bemüht, dass der Trompete nichts passierte. Dann stellte er sich hin und blies ein Signal. Ich war auf Übliches eingestellt, man kennt ja mancherlei Märsche und Lieder. Doch nichts von dem. Ich verstehe nicht viel von Musik, das ist nicht meine starke Seite, zum Leidwesen meiner Mutter, die jedoch auch nicht allzu viel davon versteht. Aber der da vorn blies ganz großartig Trompete und so mühelos. Das war ein Signal. Es war still auf dem Schulhof. Die hohen Hausmauern verstärkten den Klang. Das ging unter die Haut, man hatte es schwer, sich dagegen zu wehren. Ich dachte an Louis Armstrong, ich hatte mal seinen Lebensbericht gelesen. Schade, man müsste mehr davon wissen.
Das Kofferradio allein ist kein Ersatz. Es ist zwar bequem, über die Skala zu flitzen, da mal was aufzuschnappen, dort mal hängenzubleiben. Manchmal erwischt man ein schönes Lied, man versteht zwar nicht, was in der fremden Sprache gesungen wird – doch es packt einen. Und dann ist es wieder vorbei, Millimeter weiter meldet sich Radio Warschau oder Radio Luxemburg oder Radio Bremen oder Berliner Welle.
Der Junge vorn blies noch immer. Ich sah zu Herrn Magnus hin. Der lächelte, seine Augenbrauen zog er manchmal zusammen. Er kannte bestimmt – ich nahm es an – jeden Ton in diesem Trompetensignal, bemerkte die kleinste Unsauberkeit.
Der Trompeter stand schon wieder neben mir, und die Stille hielt noch an. Das war günstig für den Direktor, der eine Ansprache halten wollte. Herr Magnus stieß den Musiker in die Seite und zwinkerte ihm zu. Der putzte an seinem Instrument herum, mehr nur so, denn es regnete nicht mehr. Zerrissene Wolken fegten über den Himmel, sprangen über die Ränder der hohen Hinterfronten der Häuser und verschwanden im Nu.
Der Direktor redete. So ähnlich wurde wohl in diesem Augenblick im ganzen Lande geredet. Auch in Potsdam im Hof unserer Schule auf der Anhöhe. Unsere Klasse stand stets so, dass ich auf den Wald sehen konnte, der nicht weit entfernt begann.
Da stieß mich mein Nachbar an.
„Halt mal!“, sagte er.
Ich hatte die Trompete in der Hand, fühlte das kühle, leicht beschlagene Metall.
Der Junge holte ein Taschentuch heraus und säuberte sich sehr gründlich die Nase.
„Gib her!“, befahl er.
Ich gab ihm die Trompete zurück.
Wir standen und hörten uns die Rede des Direktors an. Dann kamen Mitteilungen irgendwelcher Art, die mich nicht interessierten, weil ich mir nichts darunter vorstellen konnte, weil ich eben neu war.
„Wo bist du her?“, fragte mein Nachbar.
„Potsdam.“
„Kennst du einen Heinze?“
„Nein. Warum?“
„Wohnt in Potsdam. Mein Freund vom letzten Sommer.“
„Na, so klein ist Potsdam nicht“, sagte ich.
„Bist du gern weg von Potsdam?“
„Nein.“
„Verstehe ich nicht. Müsstest doch froh sein.“
„Warum?“
„Berlin ist ganz was anderes.“
„Quatsch. Was soll anders sein. In so einer Bruchbude von Schule war ich nicht.“
Er sah mich an.
„Magnus ist schwer in Ordnung.“
„So?“
„Glaubst du nicht, was?“
„Muss ich selber sehen“, sagte ich.
„Muss dir genügen, wenn ich dir sage, dass er schwer in Ordnung ist.“
Ich lachte. Das kam mir komisch vor, das war mir noch nie passiert.
„Lach nicht so blöd. Bei uns herrscht Ordnung. Verstanden!“ Da interessierte mich der Trompetenbläser nicht mehr. So ein Fatzke. Was wollte der eigentlich? Ich sah einfach geradeaus. Er stieß mich an.
„Halt mal“, sagte er und hielt mir wieder die Trompete hin. Ich dachte, der ist verrückt. So muss ich ihn angesehen haben. „Na los“, sagte er.
„Steck dir deine Tüte ins Hemd.“
Das hatte er nicht erwartet.
Er sagte: „Das Grinsen vergeht dir noch, du.“
Ich erwiderte: „Lass mich in Ruhe. Sonst vergeht dir manches andere.“
Als wir auf den Eingang mit der Jahreszahl 1910 zugingen, kam Herr Magnus an meine Seite.
„Ich unterrichte in Staatsbürgerkunde, Geschichte, Deutsch. Wie stehst du in diesen Fächern?“, fragte Herr Magnus.
„Geschichte Eins. Die anderen beiden Fächer Zwei.“
Herr Magnus nickte sichtlich zufrieden und fragte dann: „Wie hat dir das Trompetensignal gefallen?“
Zögernd antwortete ich: „War gut, ja.“
„Ja, unser Heinz“, sagte Herr Magnus, „ist begabt. Er ist der Beste in der Klasse. Halte dich an ihn.“
„Was war das für ein Signal?“, fragte ich – die Ratschläge des Herrn Magnus gefielen mir nicht.
„Das kannst du natürlich nicht wissen“, sagte Herr Magnus lebhaft, „es kommt aus der Zeit der Französischen Revolution. Es reißt mit, habe ich recht? Dahinter ist eine Idee zu spüren, ein revolutionärer Gedanke. Der Mateja bringt es gut. Er hat’s begriffen, der Junge, und das spürt man, nicht wahr?“
Ich wusste nicht, ob’s der Mateja begriffen hatte, es war mir egal. Ich wusste jetzt, dass dieses Trompeten-As und auch sonst der Beste mir das Leben sauer machen würde. Mit dem mich anzulegen, gleich am Anfang meines neuen Schuldaseins, war gerade nicht das Klügste, was ich tun konnte. Aber sollte ich mir dumm kommen lassen? Das war ich nicht gewohnt. Bei uns in Potsdam, in meiner alten Klasse, gab’s so etwas nicht. Es wird nicht zu Kreuz gekrochen. Nitschewo, wie mein Vater sagt, wenn er eine Absage ernst meint. Und ich meinte es ebenfalls todernst, was den Mateja betraf.
Wir waren indessen in das alte Schulgebäude eingetreten. Mann, war das ein Treppengeländer, verschnörkelt und aus Gusseisen, die Gänge endlos lang und schmal, die Türen hoch, die Türdrücker geschnitzt, die reine Holzverschwendung. Ich blickte argwöhnisch in die Runde.
Herr Magnus sagte: „Eine alte Schule, mein Lieber.“
Der Mateja tauchte an der anderen Seite von Herrn Magnus auf, und der umfasste die Schultern des Trompeters.
Bestimmt hatte der Mateja beim Lehrer Magnus einen Stein im Brett. Und mir, ich will es ehrlich gestehen, gefiel das gar nicht. Wo blieben dabei die anderen?
Ich war gegen diese Art, die Gunst zu verteilen, und empfand Misstrauen dagegen. So hielt ich einen kleinen Abstand zwischen mir und dem Lehrer Magnus. Vor dem Lehrerzimmer blieb er stehen und sagte zu mir, indem er mich zu sich heranzog: „Weißt du, bei uns haben wir die Sitte, dass sich jeder Neue kurz vorstellt. Wie gesagt, kurz, trotzdem so, dass man weiß, wer du bist und wo du herkommst. Es wird dir nicht schwerfallen, nehme ich an.“
Und zum Mateja sagte er: „Du kümmerst dich ein bisschen um ihn.“
Die Tür des Lehrerzimmers schloss sich hinter Herrn Magnus. Der Mateja sah mich an, wütend und spöttisch oder wer weiß wie. „Soll mich also um dich kümmern“, sagte er.
Ich sah ihn an, was sollte ich schon sagen, mir kam alles ein bisschen blöd vor. So ging ich einfach den Gang weiter und suchte an den Türen die Nummer 8b. Der Mateja blieb an meiner Seite.
„Lass es nicht darauf ankommen“, sagte er, „ich warne dich. Wir brauchen keinen Querulanten bei uns.“
Ich hatte die 8b entdeckt, sah jetzt ein paar Jungen und Mädchen, die ich wiedererkannte, und merkte, wie mich manche neugierig musterten – nicht nur mich, den Mateja und mich zusammen.
Ich begriff, es war eine Kraftprobe im Gange. Man hatte das mit der Trompete auf dem Schulhof gesehen, und ich wusste, wie rasch sich aufkommende Spannung herumsprach. Wir standen vor der Klassenraumtür. Es herrschte ziemlicher Lärm im Gang, viele liefen vorbei, drängten sich fast vorbei, denn der Mateja und ich, wir rührten uns nicht vom Fleck, wir standen wie zwei Felsen in der Brandung und maßen uns mit Blicken. Der Mateja schien aufgeregt zu sein, er war ganz bleich, die Trompete hielt er vor der Brust, als müsste er sie vor mir schützen.
Ich hatte seine kostbare Trompete als Tüte bezeichnet. Das konnte er bestimmt nicht vergessen. Und das verstand ich. Doch jetzt gab’s kein Bedauern. Ich konnte doch nicht zum Mateja sagen, dass ich sein Trompetenblasen bewundere, nun ging’s hart auf hart.
Aber ich fühlte keinen rechten Zorn. Warum auch? Prügeleien haben mir nie recht gelegen.
Ich besaß drei Judogürtel. Das wusste der Mateja nicht. Und ich musste ihm das sagen – Fairness.
Ich sagte laut: „Ich bin im Judo ausgebildet.“
Denn auf dem Gang herrschte ein gewaltiger Lärm, der Mateja hätte es sonst nicht gehört. Es hatte den Vorteil, dass es andere, die rumstanden und Spannemann machten, ebenfalls hörten.
Bloß ahnte ich sofort, dass mein lakonischer Zuruf als Angeberei aufgefasst werden konnte; ich hätte hinzufügen sollen, dass ich mich verpflichtet fühlte, das zu sagen, damit ich bei eventuellen Folgen meines Handelns auf meine Warnung verweisen konnte. Das hatte uns unser Judolehrer eingepaukt. Es war nun zu spät, ich ging auf die Tür zu und wollte mein zukünftiges Klassenzimmer betreten. Schließlich war ich neugierig darauf.
Da baute sich der Mateja mir in den Weg. Wir standen uns, wie es heißt, auf Nahdistanz gegenüber.
„Judo kannst du also“, sagte höhnisch der Mateja.
„Kann ich“, sagte ich. Langsam spürte ich, wie in mir die Wut hochkam. Meine schlimmste Wut ist die kalte Wut. Ich glaube, ich spreche in diesem Zustand schrecklich langsam, ich spüre dann, wie meine Nasenspitze kühl wird.
Und dieser Zustand kam. Grund hatte ich genug. Der Mateja wollte, dass ich mich bedingungslos unterwerfe.
Ich trat einen Schritt vor, schob die Schulter vor und dadurch den überraschten Mateja einfach zur Seite.
Der knallte eine Faust an mein Kinn. Nun war das Überraschtsein meinerseits, das heißt, ich ruckte sogar ein Stück zurück, der Schlag zeigte Wirkung.
Und der Mateja sagte: „Ich kann boxen.“
Ich hatte den kurzen Haken zu verdauen, er hatte gut gesessen. Das konnte ich auch im Zustand der kalten Wut anerkennen.
Es lachten welche, und sofort bildete sich ein Kreis um uns. Ich ging den Mateja von der Seite an, das hatte er nicht erwartet, ich handelte exakt, wie auf der Übungsmatte: riss ihm einen Arm nach oben und dann nach vorn und ließ ihn über mein vorgestrecktes Bein stolpern. Und da ich ihm den Halt nahm, als ich seinen Arm losließ, stürzte er.
Das alles ging sehr schnell. Judo ist eine Sache der Schnelligkeit. Ich sah seinem Sturz zu und wusste genau, wie er fallen würde. Mit Staunen sah ich, wie er noch im Fallen versuchte, seine Trompete vor Schaden zu bewahren. Das gelang ihm nicht ganz, sie fiel ihm aus der Hand, glitt über den Steinboden, schrammte an der Wand ein Stück entlang, bis sie liegenblieb.
Der Mateja raffte sich auf, hatte keinen Blick für mich, nur für die Trompete, die er aufhob.
Jemand rief halblaut: „Magnus kommt.“
Die Kampfszene löste sich auf, ich wurde in das Klassenzimmer geschoben, auf das ich neugierig gewesen war und das ich mir mit einem Judogriff hatte freikämpfen müssen. Mein Kinn tat mir weh. Ich wagte nicht, es zu betasten, das hätte als Schwäche ausgelegt werden können.
Ziemlich rasch hatten alle die Plätze eingenommen, auch der Mateja; vorher schloss er seine Trompete in einen Schrank ein, setzte sich ohne Hast, sah mich nicht an. Ich stand an der Seite. Der Raum war sehr hell gestrichen. Man wollte damit mehr Licht schaffen, die schmalen Fenster ließen nicht übermäßig viel rein. Draußen lagen der Schulhof und die kahlen Hinterfronten der angrenzenden Häuser.
Herr Magnus betrat die Klasse, alle erhoben sich, man sprang nicht auf, doch man erhob sich rasch.
Herr Magnus sagte: „Setzt euch. Wir haben uns ja schon begrüßt, meine ich.“
Und er lachte dabei ein bisschen, wandte sich mir zu und wies auf eine leere Bank in der Fensterreihe. Es war die einzige leere Bank, und auf der saß ich nun allein.
„Es tut mir leid“, sagte Herr Magnus, „doch geht es nicht anders.“
Mir war das ganz recht. Ich war ja der Neue. Und es hatte dramatisch angefangen, und ich wusste nicht, wie es in der nächsten Pause weitergehen würde.
Da saß ich auf meinem Platz, die Bank erschien mir enger und unbequemer als die in meiner Schule in Potsdam. Oder machte das die Ferienzeit, die dazwischen lag?
Ich konnte auf den Mateja blicken, das heißt auf seinen Hinterkopf. Ich starrte auf den Hinterkopf und hätte gern gewusst, was sich in diesem Kopf jetzt abspielte. Wurde der Plan schon gesponnen, mich zurechtzustauchen?
Herr Magnus begann mit seiner Stunde, erwähnte, dass er in Abänderung des Stundenplanes in der ersten Stunde Staatsbürgerkunde gebe und dafür Geschichte in der letzten. Er meinte, man müsse sich nach zwei Monaten wilden Lebens zunächst wieder besinnen, sich orientieren, die Welt wieder im Zusammenhang sehen. Wir wüssten schon. Der Herr Magnus machte das amüsant, fand ich, ruhig und mit ein bisschen Spaß dabei und Augenzwinkern. Ich hoffte, dass er meine Vorstellerei vergessen hätte.
Immerhin hatte ich mich ja schon vorgestellt, mit meinem Widerstand gegen ihren Mateja und dem Judogriff. Bloß davon wusste Herr Magnus nichts.
Er blieb auf einmal vor meiner Bank stehen. Ich sah auf seinen grauen, etwas altmodischen Anzug, der tadellos saß, auf die etwas breite Krawatte, die nicht mehr der neuesten Schlipsmode entsprach, und in sein dunkles wettergebräuntes Gesicht.
„Nun zu dir. Wir sind neugierig.“
Herr Magnus ging langsam an seinen Tisch, setzte sich, zog umständlich ein Taschentuch heraus und wischte sich Schweiß von der Stirn.
Es war aber nicht heiß, ein kühler Tag und der Raum nicht geheizt.
Herr Magnus saß am Lehrertisch, sah irgendwie abwesend vor sich hin. Ich hatte mich rausgezwängt aus meiner Bank, wusste jedoch nicht, ob ich anfangen sollte. Ein paar Sekunden lang herrschte eine unheimliche Stille.
Dann sah Herr Magnus mich an, mir war’s, als schien er von weit her zu kommen.
„Na, fange an“, sagte er. Und er stand auf, zog sein Jackett zurecht und stellte sich ans Fenster.
Ich war dran. Doch mir fiel nicht mehr ein, was ich mir vor einer Minute zurechtgelegt hatte. War gerissen, der Film. Sie wurden unruhig um mich herum, konnte mir denken, wie sie feixten. Herr Magnus rührte sich nicht. Ich spürte Hitze aufsteigen. Jetzt wünschte ich mir die kalte Wut her. In der kalten Wut kann ich alles sagen, langsam, aber unheimlich scharf.
Es kam die Rettung. Und die hieß Mateja. Der drehte sich langsam um, ganz langsam, und sah mich voller Verachtung an, schien zu sagen: Du bist vielleicht eine Flasche. Mit mir sich anlegen. Und jetzt steht er da wie der Urmensch.
Da war bei mir der Bann gebrochen, ich stützte mich mit beiden Fäusten auf das Pult, sah den Mateja an.
„Komm aus Potsdam. Ist’s nötig, zu erklären, wo’s liegt? Will mal annehmen, weiß jeder hier. Bin in eine verdammt moderne Schule gegangen. Neueste Erkenntnisse berücksichtigt beim Bau. Klassearchitekt. Hat mal bei uns einen Vortrag gehalten. Na ja, soll genug sein davon. War in einer Klasse, die war schwer in Ordnung. Ziemlich ausgeglichenes Niveau. Ist immer gut für die Gesamtstimmung, meine ich. Kann keiner auf einsamer Spitze thronen und so. Ich hab zu den Guten gehört. Bin nicht immer gleichmäßig gewesen. Interessen schwankten, Selbsteinschätzung ist nicht so einfach. Bei uns wurde Wert darauf gelegt, auf die Selbsteinschätzung, meine ich. Will ehrlich sein, bin ungern von Potsdam weggegangen. Hätt sonst was gegeben, hätt ich dort bleiben können. Nehme an, ist für jedermann verständlich. Mein Vater hat was Neues hier angenommen. Da ist nichts zu machen. Nun bin ich hier. Alles neu und manches seltsam, wenn nicht komisch. Na, ich denke, werd mich schon an die Richtung gewöhnen.“
Ich zwängte mich mühsam in die Bank, hatte dabei dreißig Zuschauer, die störten mich jetzt nicht die Bohne. Ich sah immer noch den Mateja an, ganz ernst sah ich ihn an. Der sollte sich seine Gedanken machen, der sollte merken, dass ich eine ziemlich harte Nuss sein konnte. Die Ansprache war an seine Adresse gerichtet. Zunächst blieb’s still. Ich konnte mit der Wirkung zufrieden sein, zunächst – bloß keine voreiligen Triumphe.
Herr Magnus löste sich vom Fensterbrett, ging an seinen Tisch, schlug ein Buch auf, blickte hoch und sagte: „Danke, etwas lakonisch zwar, das ist wohl deine Art? Immerhin, es war aufschlussreich. Beginnen wir mit der Arbeit.“
Meine Antrittsrede in der Klasse 8b verschaffte mir meinen Spitznamen – Lako nannten sie mich.
Die nächsten Pausen und die Zeit nach Schulschluss verliefen ohne besondere Ereignisse.
Ich kannte an diesem ersten Tag aus der neuen Klasse nur den Mateja. Den riefen sie Matje. Ich hörte noch den Namen Bully, ohne rauszukriegen, wer damit gemeint war.
Lako lag in der Tradition der hiesigen Spitznamen.
Wir hatten an diesem dritten September zwei Stunden Mathematik bei einer Frau Schröder.
Die sprach so leise, dass es mäuschenstill blieb in diesen Stunden. Frau Schröder war so klein und zart, dass ihr anscheinend jeder die leise Stimme zubilligte. Sie schrieb korrekte Zahlen und Buchstaben an die Tafel. Der Vorteil der aufmerksamen Stille bei Frau Schröder war, dass man sehr gut mitdenken konnte, in Mathematik unbestreitbar ein riesiger Vorteil.
Ich musste zugeben, für mich natürlich nur, dass in Potsdam die Mathematikstunden nicht ganz so verlaufen waren.
Oder hatte Herr Magnus über seine Stunden hinaus seine Hände im Spiel? Dann könnte man fast Angst bekommen.
Der Gedanke kam mir, weil Herr Magnus nach der ersten Stunde beim Rausgehen zu mir gesagt hatte: „Wir werden uns schon kennenlernen. Der Kurs wird von mir bestimmt, denn ich bin der Klassenlehrer.“
Und das war er, der Herr Magnus.
3. Kapitel
Der Regen hatte wider Erwarten mehrere Tage angehalten. Es war noch immer das gleiche trübe, miese Wetter, mit dem ewigen Zug dicker, tief hängender Wolken von Norden her.
Man gewöhnte sich an das Wetter, stumpfte ab. Und genauso gewöhnte ich mich an mein Dasein in der 8b, an meine Bank in der Fensterreihe mit dem Blick auf kahle Hausmauern.
Ich kam pünktlich, grüßte, arbeitete im Unterricht mit, ohne sonderliche Anstrengungen, und im Übrigen lief das Leben, oder der Kurs, wie Herr Magnus gesagt hatte, normal.
Man hatte sich auch an mich gewöhnt, und doch lag über der ganzen Klasse so etwas wie Abwarten. Ich bekam nicht heraus, wie die Mehrheit meiner Klassenkameraden über mich dachte, wie sie mich beurteilten. Man äußerte sich nicht.
Herr Magnus, das musste ich zugeben, wenn auch widerwillig, gefiel mir in seiner Art, den Unterricht zu geben, immer mehr. Er forderte uns. Und ich begann zum Beispiel aufmerksamer die Zeitung zu lesen.
Herr Magnus lehrte uns, die politische Seite der Zeitung zweimal zu lesen. Zunächst von den Fakten her und dann im Zusammenhang. Wenn zum Beispiel eine Notiz über Vietnam in der Zeitung stand: Kämpfe in der Nähe von Saigon, die FNL drangen in Vororte der Stadt ein, das amerikanische Hauptquartier lag unter Granatwerferbeschuss; und in einer Spalte daneben, dass in den Vereinigten Staaten, im Staat Mississippi, amerikanische Neger, die für ihre Bürgerrechte demonstrierten, von der Polizei auseinandergejagt wurden und dass es dabei mehrere Schwerverletzte gegeben habe, so brachte uns Herr Magnus dazu, ganze Geschichten zu erzählen, Überlegungen anzustellen. Es könnte doch sein, dass in Saigon ein amerikanischer Neger in der Uniform der US-Armee auf die angreifenden Freiheitskämpfer schieße und sie töte und dass zur gleichen Zeit der Bruder dieses Negersoldaten im Staate Mississippi von der Polizei schwer verletzt würde. Diese Diskussion ergab eine Stunde, und wenn nötig, noch eine zweite dazu. Was sind Bürgerrechte? Welche Rolle ist dem amerikanischen Neger in US-Uniform in Vietnam zugedacht, welche seinem Bruder im Staate Mississippi, für den die Hautfarbe eine Art Uniform ist. Wie zeigt sich in allem die Klassenfrage.
So kam es bei Herrn Magnus stets zu einer lebhaften Stunde, in der durchaus nicht alles glatt verlief. Im Gegenteil, Herr Magnus legte es darauf an, uns aus der Reserve zu locken. Zum Beispiel konnte er Bully fragen: „Nun, Robert, was sagt Radio Freies Europa dazu?“
Bully saß in meiner Querreihe, war gewissermaßen mein Nachbar, mit dem Gang als Graben zwischen uns, und ich konnte ihn gut beobachten. Bully war nicht, wie man annehmen könnte, bullig, er war kaum mittelgroß, das Gesicht voller Sommersprossen. Bully hatte seinen Namen weg, weil er fanatischer Anhänger des Eishockeysportes war, und man traf ihn, wie man sagte, in den Wintermonaten entweder auf dem Eis oder vor dem Fernsehapparat. Das Wort „bully“, die berühmte Sache vor dem feindlichen Tor, führte er andauernd im Mund.
Jeder wusste, und auch Herr Magnus, dass Bully sein mittelgroßes Kofferradio, wie andere einen Kamm, ständig mit sich herumschleppte. Er wollte verbunden sein mit der weiten Welt, meinte er, und Musik aus der ganzen Welt hören. Deshalb war seine Schultasche fast so groß wie ein Koffer, ein Fach diente allein zur Aufbewahrung seines Kofferradios. Das war natürlich in der Schule verboten. Bully hatte durch seine Hartnäckigkeit im Laufe der Zeit eine Art Kompromiss erzwungen, deshalb Herr Magnus an Bully: „Nun, Robert, was sagt Radio Freies Europa dazu?“ Als ich diese Frage hörte, hielt ich fast den Atem an. Doch kein Lachen kam, kein Gemurmel. Nichts dergleichen geschah. Man war solche Fragen von Herrn Magnus gewohnt, auch Bully. Auf diese Frage antwortete er: „Ich habe schon lange nicht mehr Radio Freies Europa gehört.“
Herr Magnus fragte: „Warum?“
„Ich hab eine Sendung gehört über eine Schule hier bei uns in Berlin. War so ’ne Art Brief. Da haben sie gesagt, der Schreiber will unerkannt bleiben, sonst geht’s ihm dreckig hier. Das war vielleicht ein Brief. Einer hat sich was ausgesponnen, ausgewachsener Schwindel.“
Herr Magnus fragte weiter: „Und die Musik?“
„Musik machen sie ganz gute. Kann man nicht anders sagen.“ Herr Magnus lächelte und sagte: „Darüber unterhalten wir uns noch einmal.“
Und das geschah zwei Tage später im Musikunterricht, von allen, auch von Bully, nicht erwartet.
Herr Magnus hatte seine Hände überall im Spiel.
Ja, Herr Magnus stieg ungeheuer in meinen Augen. Die anderen Lehrer hatte ich noch nicht berochen, wie man so sagt. Es gab Unterschiede, das war klar. Die hatte es auch bei uns in Potsdam gegeben. Nur hier hatte man den Eindruck, Herr Magnus war in den Stunden aller Lehrer dabei. Das wussten alle in der Klasse. Herrn Magnus blieb nichts verborgen; es kam vor, dass er in einer Pause auftauchte und eine Frage klärte, eine Disziplinlosigkeit, die in Biologie bei der sehr jungen Lehrerin Mertens vorgekommen war, so ganz nebenbei, aber wirksam.
Und er sagte freimütig: „Denkt nicht, Fräulein Mertens ist zu mir gekommen. Ich habe mich bei ihr erkundigt, das ist meine Pflicht, nicht wahr? Und ich kenne meine Pappenheimer …“ Nur bei Frau Schröder, der kleinen, zarten Frau mit der leisen Stimme, unserer Mathematiklehrerin, brauchte er seine Hände nicht im Spiel zu haben, darin hatte ich mich getäuscht. Sie wirkte durch ihr Können.
Mathematik als Genuss. Das kannte ich noch nicht. War nie überragend in Mathe gewesen und wollte es auch nicht werden. In Berlin begann der große Umschwung. Und das geschah durch die kleine Frau Schröder. Wer mich aber in der Klasse 8b nicht glücklich werden ließ, war der Mateja. Zwischen uns stand eine Rechnung offen.
Wir gingen aneinander vorbei, als sähen wir uns nicht, manchmal sahen wir uns an, dann tasteten wir uns ab, ich dachte an den Kinnhaken und er an den Judogriff. Der Mateja war mir gegenüber sehr im Vorteil. Er hatte seine Stellung in der Klasse, er war es, der mich zur Seite schob, der mich nicht aus meiner Bank herauskommen ließ. Er besaß Autorität und stand in fast allen Fächern sehr gut da, sein Wissen und seine Leistungen konnte ich ihm nicht absprechen.
Es gab noch etwas anderes. Und das machte mir sehr zu schaffen. Am Anfang hatte ich gedacht: So ein Streber, der Mateja. So ein Schleimer. Der weiß schon, warum er so schön Trompete bläst für seinen Magnus. Den musst du noch ein paarmal über das vorgestreckte Bein stolpern lassen oder mit einem kleinen Hüftschwung aufs Kreuz legen.
So hatte ich in den ersten Tagen gedacht, wenn ich von meinem Platz aus auf den Hinterkopf des Mateja starrte. Das war aber zu einfach gedacht. War der Mateja ein Streber? Er war bedingungslos für Magnus und hätte sich für den Lehrer in Stücke reißen lassen. Auf jede Kritik, auf jede leise spöttische Bemerkung, die Herrn Magnus galt, und war sie noch so harmlos, reagierte der Mateja, wehrte ab, oft böse und scharf.
Das war keine Streberei. Ein Mateja hatte das nicht nötig. Warum nur hielt er so bedingungslos zu Herrn Magnus? Diese Frage begann mich mehr und mehr zu beschäftigen. Ich fing an, Herrn Magnus und den Mateja genauer zu beobachten.
In diesen Regentagen ging ich von der Schule sofort nach Hause. Ich hatte keine Lust, mich bei solchem Wetter in der neuen Gegend umzusehen. Schon der Blick auf die nassen Dächer, die Straßen, den schmutzigen S-Bahnhof stimmte mich unlustig. Ich setzte mich in mein Zimmer – ich war der erste, der nach Hause kam –, erledigte mein Arbeitspensum, las oder hörte Radio. Von meinem Zimmerfenster hatte ich den Ausblick auf die Hinterfront einer alten Straße. Kein besonders schöner Anblick, verglich ich ihn mit dem Blick aus meiner Kammer in Potsdam. Die war nur halb so groß wie mein Zimmer hier, an den schrägen Wänden stieß man sich fast den Gehirnskasten ein, aber ein Kirschbaum reckte seine Zweige an das Fenster. Auf dem Baum hockten allerlei Vögel zu den verschiedenen Jahreszeiten. Und in der Kirschenzeit war ich der Hüter unserer Kirschen – mit dem Luftgewehr. Mancher Sperling musste daran glauben. In Potsdam war eben alles anders. Auch wenn es so regnete wie in diesen Tagen, war es anders dort. Es kann schön sein, den Regen hören, das weiß nicht jeder. Und der Geruch, den ein feuchter Garten zum Fenster reinbringt, den wusste ich zu schätzen.
In meinem neuen Zimmer stieß man sich keine Beule an den Kopf, hier hatte ich viel Platz. Meine drei Judogürtel hingen so an der Wand, dass sie nicht zu übersehen waren, wenn jemand kam. Bloß zum Fenster durfte ich nicht raussehen, dann packte mich das heulende Elend.
Ich hatte keinen Blick – oder noch nicht – für die Stadtlandschaft, die mir mein Vater in den schönsten Farben schilderte. Mein Vater liebt die große Stadt, er war hier groß geworden. Und was er mir erzählte, am Fenster stehend, über die gewaltige Ausdehnung der Stadt, über die eigenartige Silhouette und wer weiß was noch, glitt von mir ab, dafür hatte ich keine Antenne. Er konnte das nicht begreifen.
In diesen Regentagen bekamen wir unseren Vater kaum zu Gesicht. Und wenn, dann war es spät, und er ging bald in sein Zimmer; das Licht brannte bis spät in die Nacht hinein.
Ich dachte mit Bitterkeit an sein Versprechen, dass wir beide uns ausquatschen sollten. Das hatte er vergessen oder verschoben. Ich fand es richtig, dass er viel auf seiner neuen Arbeitsstelle zu tun hatte, das wollte er so. Nur hätte ich ihm mehr Gelassenheit zugetraut. Für Mutter war es nicht gerade das Angenehmste, wenn er in seinem Zimmer verschwand. Mutter schien am schnellsten mit der Umstellung fertig geworden zu sein. Sie schmiss unseren Laden wie immer, wie es eben sein musste. Dabei hatte sich für sie allerhand geändert.
Das Schlafzimmer zum Beispiel gab’s nicht mehr. Vater schlief in seinem Zimmer, das an und für sich als Wohnzimmer gedacht war; der Fernsehkasten hatte dort seinen Platz. Mutter teilte ihr Zimmer mit der Marlies. Wir hatten hier nur drei Zimmer, in Potsdam dagegen fünf.
Formal war mein Bruder bei mir einquartiert; er hatte sich auf drei Jahre verpflichtet, ein Jahr war herum, und es sah aus, als würde mein Bruder später bei der christlichen Seefahrt anheuern.
Ich sagte zu meiner Mutter, als der Fernseher ein paar Abende hintereinander blockiert blieb: „Wie lange soll das so gehen?“ „Papa hat im Augenblick viel auf dem Buckel. Warten wir.“ „Der Kasten könnte zu mir rein.“ „So geht’s auch nicht.“
„Wann ist das Warten zu Ende?“
Mutter sah mich an. „Du musst mal versuchen, Vater zu verstehen.“
„Will aber nicht. Papa muss auch an uns denken.“
„Hör auf“, sagte Mutter.
Ich hörte auf, verstand sie aber nicht.
Sie kam später in mein Zimmer und sagte: „Die neue Arbeit macht ihm zu schaffen.“
Und wieder wunderte ich mich.
„Er hat’s doch so gewollt“, sagte ich.
„Das schon, und trotzdem ist es anders. Ich weiß das jetzt“, erwiderte Mutter nachdenklich.
Was anders war, sagte sie mir nicht. Ich hatte keine Lust, danach zu fragen, meine eigenen Probleme genügten mir, denn ich fand mich selbst nicht in meiner neuen Welt zurecht.
Es sah so aus, als würde das nie geschehen. Das machte mich niedergeschlagen und traurig. Ich konnte mich nicht erinnern, so eine Stimmung erlebt zu haben. Ich wehrte mich dagegen, doch es war nichts zu machen – bis der Regen aufhörte. Der Spätsommer zeigte sich in seiner ganzen Freundlichkeit.
Ich entdeckte plötzlich, dass die Morgensonne in mein Zimmer schien. Die hochkommende Sonnenscheibe ließ mich zum ersten Mal meine neue Umgebung anders sehen, auf einem hellen rötlichen Hintergrund sah ich die Stadt. Und ich vergaß meine Traurigkeit auf dem Weg zur Schule.
Der Mateja drückte mich zurück in meine alte Stimmung. „Mal herhören, Leute“, rief er.
Und sie hörten hin, alle, es wurde richtig still.
Ich war gerade reingekommen, als mich das „Mal herhören, Leute“ überraschte. Sollte ich deshalb zur Salzsäule erstarren?