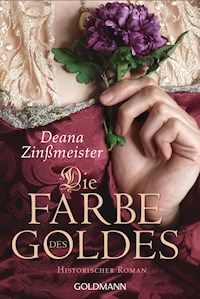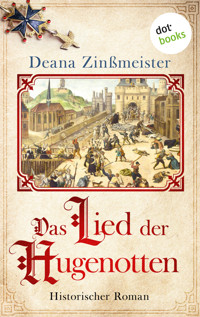
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Hugenotten-Saga
- Sprache: Deutsch
Wie überlebt man, wenn man von Feinden umgeben ist? Der historische Roman »Das Lied der Hugenotten« von Deana Zinßmeister als eBook bei dotbooks. Paris, 1572. Die Geschwister Pierre und Magali müssen mitansehen, wie in der Bartholomäusnacht ihre Mutter ermordet und ihr Zuhause zerstört wird. Dem Vater gelingt es, mit den beiden Kindern zu fliehen und auf dem Land ein neues Leben anzufangen – aber dafür müssen sie ihren Glauben verleugnen und sich als Katholiken ausgeben. Jahre später können Pierre und Magali sich nicht mehr an die Schrecken jener Nacht erinnern – und auch nicht daran, dass sie einst Hugenotten waren. Doch dann erfährt Pierre durch einen Zufall von der Vergangenheit seiner Familie und ist entsetzt vom Verrat seines Vaters am Glauben. Nichts kann ihn von dem Wunsch abbringen, nach Paris zu seinen hugenottischen Wurzeln zurückzukehren, auch nicht die inständigen Bitten seiner Schwester Magali – bis ein fürchterliches Unglück geschieht ... »Deana Zinßmeister schreibt historische Romane, wie man sie sich wünscht!« Iny Lorentz Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der facettenreiche historische Roman »Das Lied der Hugenotten« von Deana Zinßmeister ist der erste Band ihrer Hugenotten-Saga, die Fans von Kate Mosse und Sabine Ebert begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Paris, 1572. Die Geschwister Pierre und Magali müssen mitansehen, wie in der Bartholomäusnacht ihre Mutter ermordet und ihr Zuhause zerstört wird. Dem Vater gelingt es, mit den beiden Kindern zu fliehen und auf dem Land ein neues Leben anzufangen – aber dafür müssen sie ihren Glauben verleugnen und sich als Katholiken ausgeben. Jahre später können Pierre und Magali sich nicht mehr an die Schrecken jener Nacht erinnern – und auch nicht daran, dass sie einst Hugenotten waren. Doch dann erfährt Pierre durch einen Zufall von der Vergangenheit seiner Familie und ist entsetzt vom Verrat seines Vaters am Glauben. Nichts kann ihn von dem Wunsch abbringen, nach Paris zu seinen hugenottischen Wurzeln zurückzukehren, auch nicht die inständigen Bitten seiner Schwester Magali – bis ein fürchterliches Unglück geschieht ...
»Deana Zinßmeister schreibt historische Romane, wie man sie sich wünscht!« Iny Lorentz
Über die Autorin:
Deana Zinßmeister widmet sich seit einigen Jahren ganz dem Schreiben historischer Romane. Bei ihren Recherchen wird sie von führenden Fachleuten unterstützt, und für ihren Bestseller »Das Hexenmal« ist sie sogar den Fluchtweg ihrer Protagonisten selbst abgewandert. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern im Saarland.
Deana Zinßmeister veröffentlichte bei dotbooks bereits die Australienromane »Fliegen wie ein Vogel« und »Der Duft der Erinnerung«, die Pesttrilogie mit den Romanen »Das Pestzeichen«, »Der Pestreiter« und »Das Pestdorf« sowie die Hexentrilogie mit den Romanen »Das Hexenmal«, »Der Hexenturm« und »Der Hexenschwur« und die Hugenotten-Saga mit den Bänden »Das Lied der Hugenotten« und »Der Turm der Ketzerin«.
Die Website der Autorin: www.deana-zinssmeister.de
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2024
Copyright © der Originalausgabe 2017 by Deana Zinßmeister und Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/blue pencil und eines Gemäldes von Francois Dubois »Das Massaker in der Bartholomäusnacht«
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98952-226-8
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Deana Zinßmeister
Das Lied der Hugenotten
Historischer Roman
dotbooks.
Dieses Buch widme ich meinen Eltern,
die selbst eine dramatische Flucht
hinter sich gebracht haben.
Aber auch den Menschen,
die in der Bartholomäusnacht den Tod fanden
– einerlei, ob Hugenotte oder Katholik.
Die Zahl der toten Leiber
man ganz unmöglich kennt.
So viele Männer wie Weiber
ohn’ Aufenthalt und End’
färben in diesen Tagen
des Schreckens das Wasser rot,
um die Kunde zu tragen
bis nach Rouen ohne Boot.
Neues Lied wider die Hugenotten,
erschienen kurz nach der Bartholomäusnacht,
unbekannter Verfasser
Personenregister
Die mit einem * versehenen Personenhaben tatsächlich gelebt.
Paris
Jacon Desgranges, Glashüttenbetreiber
Catherine Desgranges, seine Frau
Pierre Desgranges, sein Sohn
Magali Desgranges, seine Tochter
André, Hilfskraft bei Jacon Desgranges
Romain, Glasmacher bei Jacon Desgranges
Richard, Romains Sohn
Anne, Richards Frau, Romains Schwiegertochter
Jean, Romains Neffe
Charles Marty, Jacon Desgranges' Freund; Küchenchef im
Louvre
Cécile, Küchenmagd bei Marty
Frédéric Dubois, ein Tuchhändler
Philippe Rohan, ein hugenottischer Prediger
Karl IX.* (1550-1574)
König von Frankreich, Bruder von Marguerite de Valois
Katharina von Medici* (1519-1589)
Mutter von Karl IX. und Marguerite de Valois
Heinrich von Navarra* (1553-1610)
auch: Heinrich IV., Hugenottenkönig von Navarra
(historischer Staat zwischen Frankreich und Spanien)
Marguerite de Valois* (1553-1615)
Ehefrau von Heinrich von Navarra, Kosename: Margot
Heinrich III.* (1551-1589)
Herzog von Anjou, Sohn von Katharina von Medici; Bruder
von Karl IX. und Marguerite de Valois
Elisabeth von Österreich* (1554-1592)
Ehefrau von Heinrich III.
Henri I. de Lorraine, Duc de Guise (1550-1588)
französischer Adliger, mitverantwortlich für Colignys Tod
Elisabeth L* (1533-1603)
Königin von England
Papst Gregor XIII.* (1502-1585)
Gaspard de Coligny* (1519-1572)
Admiral und Hugenottenführer, Vertrauter von Karl IX.
Charles de Téligny* (1535-1572)
Soldat, Diplomat und Colignys Schwiegersohn
Philippe Duplessis-Mornay* (1549-1623)
reformierter Theologe und Colignys Vertrauter
Eric, Colignys treuer Diener
Albert Lafontaine, Colignys Leibarzt
Ambroise Paré* (ca. 1510-1590)
Wundarzt von König Karl IX.
Charles de Louviers, Seigneur de Maurevert* (1505-1583)
Totschläger im Dienst Karls IX.
Jacques Nompar de Caumont La Force* (1558-1652)
hugenottischer Gouverneur
François de La Nue* (1531-5191)
ein Hugenottenführer
Monsieur Fontenay* (Vorname und Lebensdaten nicht überliefert)
ein Hugenottenführer
Spire Niquet* (Lebensdaten nicht überliefert)
ein Buchbinder
Madame de Popincourt* (Lebensdaten nicht überliefert)
Ehefrau des königlichen Federwarenhändlers
Vernou-sur-Brenne
Olivier, Neffe von Claire Bercy
Colette, Nichte von Claire Bercy
Claire Bercy, Schwester der verstorbenen Mutter von
Olivier und Colette
Antoine Bercy, Claires Ehemann
Fleur, die gute Seele im Haus Desgranges
Prolog
Sie wusste, dass es mitten in der Nacht war, denn kein Sonnenstrahl fiel durch die Spalten der Fensterläden. Nur das schwache Licht des Mondes und die fast heruntergebrannten Kerzen erhellten ihre Kammer. Auch war es still im Haus. Alle schliefen. Ihr kleiner Sohn Pierre schlummerte eingekuschelt in ihren Armen. Das Holzschwert, das sein Vater ihm geschnitzt hatte, hielt er fest in der Hand. »Ich brauche das, damit ich dich und Magali beschützen kann«, hatte er gesagt, als sie ihn aufforderte, es auf dem kleinen Tisch abzulegen.
Zärtlich drückte sie einen Kuss auf Pierres Stirn. Als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte sie beobachten, dass er träumte. Immer wieder zuckten seine Lider, oder er verzog seinen kleinen Mund zu einem Lächeln. Plötzlich hörte sie eine leise Melodie. Ungläubig legte sie ihr Ohr nah an seine Lippen. Fürwahr, er summte im Schlaf eines der Lieder, die sie ihm vor wenigen Stunden vorgesungen hatte. Du bist ein aufrechter Hugenotte, dachte sie und legte den Kopf zurück aufs Kissen dicht an Pierres Stirn.
Doch dann schreckte sie hoch. Jacon war noch nicht zurück von seiner Fahrt in den Louvre. Er hätte sicherlich schon nach ihnen gesehen, wenn er zuhause wäre, überlegte sie. Allerdings hatte sein junger Begleiter André bei seiner Rückkehr prophezeit, dass Jacon und sein Freund Charles Marty sicherlich die Zeit vergessen würden, da der Koch ihren Mann nicht nur zu einem opulenten Essen, sondern auch zu einem guten Rotwein eingeladen hatte. Wahrscheinlich hat mein armer Gatte nun einen Rausch, den er ausschlafen muss, kicherte sie leise.
Beruhigt kuschelte sie sich zurück an ihren kleinen Sohn. Selbst in der Nacht kühlte die Luft sich nicht ab. Nur zu gern hätte sie den Laden geöffnet, um Luft hereinzulassen, aber Pierre drückte sich eng an sie. Starr blieb sie liegen. Ihre beiden Körper waren mit einem feinen Schweißfilm überzogen. Sie zog die dünne Bettdecke zurück und versuchte zu schlafen, doch da hörte sie ihre neugeborene Tochter in der Wiege. Nun musste sie doch aufstehen. Vorsichtig löste sie sich von Pierre, damit er nicht wach wurde. Es war nicht gut, dass sie so kurz nach der Niederkunft das Bett verließ. Schon spürte sie einen Stich im Unterleib. Schmerzgebeugt schleppte sie sich die wenigen Schritte zur Wiege.
Magali war unruhig. Sicher hat sie Hunger, dachte Catherine. Ihre Tochter war erst wenige Stunden alt. Ihr Mann Jacon wusste noch nicht, dass sie während seiner Abwesenheit entbunden hatte. Alles war sehr schnell gegangen und unkompliziert gewesen. Die Hebamme war in dem Augenblick gekommen, als die Fruchtblase platzte. Von da an hatte eine Wehe die nächste abgelöst. Innerhalb einer Stunde war ihre kleine Magali geboren.
Catherine nahm ihre Tochter aus der Wiege hoch und legte sich mit ihr im Arm zurück ins Bett. Allein diese kleine Anstrengung trieb ihr den Schweiß aus den Poren. Der Schmerz wurde stärker, aber sie war glücklich und streichelte dem Mädchen lächelnd über die Stirn. »Magali, meine Kleine! Ich kann es kaum erwarten, dich deinem Vater zu zeigen«, flüsterte sie.
Tränen brannten in ihren Augen. Lieber Gott, lass mir dieses Kind! Ihre Angst war riesengroß, dass sie das Mädchen ebenso verlieren könnte wie seine beiden Brüder.
Ihr kleiner Philippe war zwei Jahre nach Pierre zur Welt gekommen. Alles schien normal zu sein. Die Wehen, die Dauer der Geburt – alles war wie bei Pierre gewesen. Auch die Hebamme hatte nichts Ungewöhnliches festgestellt. Doch es war ihr nicht vergönnt gewesen, ihren Zweitgeborenen kennenzulernen. Sie hatte diesen heftigen Ruck in sich gespürt und sofort gewusst, dass etwas nicht stimmte. Urplötzlich, kurz vor der Geburt, kamen diese furchtbaren Schmerzen, die sich mit jeder Wehe steigerten, da Philippe einfach nicht aus ihr herauskommen wollte. Manchmal im Traum spürte sie noch heute die Hände, die sie fast zerquetscht hatten, um den Jungen herauszupressen. Als er endlich geboren war, sah sie am Blick der Hebamme, dass er nicht lebte. Die Nabelschnur hatte sich mehrmals um seinen Hals gewickelt und ihm die Luft abgedrückt. Er war im Mutterleib erstickt.
Man hatte Jacon hereingerufen, der traurig seinen Sohn betrachtete. Ihr jedoch wollte man das Kind nicht zeigen, weil sich viele Menschen vor dem Anblick eines Toten fürchten – selbst vor einem Neugeborenen. Aber nicht sie! Sie hatte geschrien, getobt, geweint und gefleht, bis sie ihr den Kleinen in den Arm legten. Seine Haut war noch warm und weich gewesen. Im Gegensatz zu seinem großen Bruder Pierre, der mehr ihr glich, hatte man in Philippes Gesichtszügen bereits die Ähnlichkeit mit seinem Vater erkennen können. Dichte, dunkle Haare hatten sein Köpfchen umrahmt. Obwohl der Erstickungstod Philippes kleines Gesicht bläulich verfärbt hatte, konnte man sehen, welch hübscher Junge er war.
»Wir müssen ihn rasch taufen, damit seine kleine Seele in den Himmel aufsteigen kann«, hatte die Hebamme hastig gemurmelt und Gott den Vater angerufen. Gemeinsam hatten sie das Vaterunser gebetet. Dann wurde ihr kleiner Sohn mit Wasser dreimal im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Nach dieser Nottaufe küsste sie Philippe ein letztes Mal die Stirn und legte ihn seinem Vater in den Arm, der ihn beerdigen ließ.
Die Erinnerung schmerzte bis heute. Sie war damals todunglücklich gewesen, und selbst ihr kleiner Pierre hatte sie nicht trösten können. Erst als sie spürte, dass neues Leben in ihr wuchs, söhnte sie sich mit ihrem Schicksal aus. Vier Monate nach Philippes Geburt war sie erneut schwanger, und ihre Freude darüber war übermächtig. Die Geburt des kleinen Jean verlief ohne Probleme, fast ohne Schmerzen und sehr schnell. Dieses Kind schien anders zu sein als seine beiden Brüder. Ihr drittgeborener Sohn glich weder ihr noch ihrem Mann Jacon. Aber sie erinnerte sich, dass ihre Großmutter väterlicherseits wie Jean feuerrote Haare gehabt hatte. Nicht nur sein Aussehen war anders, auch sein Wesen. Er war ein ungewöhnlich stilles Kind, das nur selten weinte.
Doch so ruhig, wie er auf diese Welt gekommen war, so leise ging er wieder fort. Jean war sieben Monate alt, als sie ihn eines Morgens tot in seinem Bettchen fand. Er lag friedlich da, ganz so, als ob er schlief. Sie wollte nicht glauben, dass er tot war. Doch Gott hatte ihnen auch ihren kleinen Jean genommen. Damals haderte sie mit ihrem Glauben. Warum, Gott, nimmst du mir auch dieses Kind?, hatte sie geschrien.
Nach Jeans Beerdigung wollte sie niemanden sehen. Weder ihren Mann noch ihren kleinen Pierre.
Heute, fast zwei Jahre später, zerriss es ihr das Herz, dass sie damals ihren Erstgeborenen vernachlässigt hatte. Ich habe mich an Pierre versündigt, da ich es ihn spüren ließ, dass er leben durfte und Philippe und Jean nicht, dachte sie. Zum Glück hatten ihre Brüder und Schwestern im Glauben sie auf den rechten Weg zurückgebracht. Auch Jacon hatte Mitgefühl mit seiner Frau und sie nicht verdammt und verstoßen.
Dank seiner Güte und seines Verständnisses fand sie zurück zu Gott, zu ihrem Glauben und in das Hier und Jetzt.
Sie streichelte glücklich über den kleinen Körper neben sich. Gott hatte Größe bewiesen und ihnen ein weiteres Kind geschenkt. Sie glaubte fest, dass ihr Mädchen gesund war und bei ihnen bleiben durfte. Zufrieden legte sie sich ihre Tochter an die Brust und schloss die Augen. Sie war mit Reichtum und Glück gesegnet, denn ihr war vergeben worden, dachte sie.
Pierre regte sich neben ihr. »Maman«, hörte sie ihn sagen. »Maman, ist es schon morgen?«, fragte er verschlafen.
»Nein, es ist noch mitten in der Nacht. Du kannst beruhigt weiterschlafen«, antwortete sie und wischte ihm sanft den Schweiß aus dem Gesicht.
»Ist Papa wieder da?«, wollte ihr Sohn wissen und gähnte herzhaft, wobei er sein Holzschwert in die Höhe reckte.
»Nein, aber wenn du das nächste Mal wach wirst, ist Papa sicher wieder zurück aus Paris. Du kannst dein Schwert nun zur Seite legen. Alles ist ruhig. Wir sind sicher«, versuchte sie ihn zu überzeugen, doch er antwortete:
»Ich muss euch beschützen. Papa hat mir den Auftrag erteilt.«
Seufzend gab sie auf. Jacon muss seinen Sohn von dieser Pflicht entbinden, dachte sie.
Magali wimmerte.
»Was hat meine Schwester?«, hörte sie Pierre fragen. Schon hob er den Kopf und schaute zu ihr.
»Sie hat Hunger, aber sie ist noch so klein und muss erst noch lernen, wie man trinkt«, erklärte sie ihm.
»Morgen werde ich es ihr beibringen«, versprach er und legte sich zurück aufs Kissen. »Dann zeige ich ihr auch, wie man mit einem Schwert kämpft«, murmelte er und schlief ein.
Catherine schossen vor Glück die Tränen in die Augen. »Ja, mein lieber Sohn. Das wirst du alles deiner kleinen Schwester beibringen«, flüsterte sie glückselig.
Sie war erschöpft und zugleich hellwach. Wäre doch nur Jacon hier, dachte sie.
Magali schlief ein, und Catherine legte sie neben sich.
Da hörte sie lautes Poltern an der Haustür. Jacon, dachte sie freudig. Doch dann hörte sie Andrés laute Stimme und das Gebrüll fremder Männer. Männerstimmen, die durcheinanderriefen. Ein eiskalter Schauer lief über ihren Körper.
Plötzlich ließ ein schriller Schrei Catherine zusammenzucken.
Erster Teil
Kapitel 1
August 1572 – zwei Tage vor der Bartholomäusnacht
Jacon Desgranges trat ans Fenster und hielt den Weinkelch ins Sonnenlicht. Mit angehaltenem Atem betrachtete er das tiefrote Glas, in dem sich das Licht brach. Er schloss ein Auge, um mit verschärftem Blick Fehler entdecken zu können. Vorsichtig drehte er den dünnen Stiel des Weinglases zwischen Daumen und Zeigefinger und strich mit dem Zeigefinger der anderen Hand über die beiden goldenen Lettern, die mit feinem Pinsel aufgetragen und eingebrannt worden waren. H und M – die Anfangsbuchstaben der Brautleute.
»Dieses Glas scheint ebenso makellos zu sein wie das vorherige«, murmelte er und atmete laut aus. Erleichtert entspannte er seine Gesichtszüge. »Sehr gute Arbeit, Romain«, lobte er den Glasmacher, dessen Miene sich ebenfalls aufhellte.
»Wie sieht es mit den restlichen Gläsern aus?«, fragte Jacon und legte das Weinglas vorsichtig in dem Kasten ab, der mit einem Strohpolster und einem Seidentuch ausgekleidet war. Dann sah er den Mann erwartungsvoll an.
»Wir liegen gut in der Zeit, Monsieur. Bevor Ihr gekommen seid, haben die Männer die Muster in die Perlen geritzt.«
Jacons Blick wanderte zurück zu dem Kelch, den er zufrieden betrachtete. »In solch einer Notlage zeichnet es sich aus, dass wir die besten Glasmacher der Umgebung beschäftigen. Sie behalten einen kühlen Kopf und konzentrieren sich auf ihr Handwerk.«
Romain nickte. »Hoffen wir, dass im Schloss kein erneutes Malheur geschieht und Gläser zu Bruch gehen. Ich möchte nicht in der Haut derjenigen stecken, die die Weingläser beim Abräumen fallen gelassen haben.«
»Da hast du wohl recht. Obwohl wir die neuen Gläser sehr gut bezahlt bekommen, verspüre ich kein Verlangen, weitere Doppelschichten von meinen Arbeitern zu fordern«, erklärte Jacon.
Und der Glasmacher stimmte seufzend zu: »Die letzten Tage haben sie fast ununterbrochen am Schmelzofen gestanden und gearbeitet. Die Arbeiter sind müde und erschöpft«, erklärte er und fuhr sich mit der flachen Hand über das stoppelkurze Haar.
»Wie machen sich die beiden neuen Gesellen?«, wollte Jacon wissen.
»Sie haben sich sehr gut eingefügt und lernen ständig dazu.«
»Keinerlei Probleme, weil sie katholischen Glaubens sind?«
Romain schüttelte den Kopf. »Nein, nichts Gravierendes. Natürlich gibt es die üblichen Sticheleien. Einmal sind es unsere Brüder, einmal die Katholischen, die über den Glauben der jeweils anderen lästern. Aber nachdem ich ein Machtwort gesprochen habe, sind sie friedlich. Ich denke, Ihr müsst Euch nicht sorgen.«
»Das hört man gerne. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann, Romain«, lobte er den Alten und klopfte ihm wohlgesonnen auf die Schulter.
»Ihr könnt Euch glücklich schätzen, dass man Eurer Werkstatt den Auftrag für die Gläser der Hochzeitsgesellschaft gegeben hat, Monsieur Desgranges. Wie es heißt, war auch das Brautpaar sehr angetan von der Schönheit Eurer filigranen Arbeit«, erwiderte Romain.
Jacon nickte. »Das ist wohl wahr. Dieser besondere Auftrag sichert uns einen guten Leumund in höheren Kreisen. Allerdings muss ich gestehen, dass ich recht verwundert war, dass man für die Gläser der Hochzeitstafel keinen katholischen Betrieb beauftragt hat.«
»Ihr seid zu bescheiden, Monsieur. Jedes Kind weiß, dass wir Hugenotten für außerordentliche Glasarbeiten bekannt sind – und diese Glasbläserei im Besonderen. Der Hof will nur das Beste. Zudem zeigt Ihr mit der Anstellung von zwei weiteren katholischen Gesellen, dass Ihr aufgeschlossen seid und keine Vorurteile habt«, erklärte der Glasmacher energisch.
Jacon hob den Blick und sah, wie der alte Mann nachdenklich wurde.
»Was überlegst du, Romain?«
»Die Vermählung zwischen Heinrich von Navarra und der Schwester des Königs wird hoffentlich dafür sorgen, dass endlich dauerhafter Frieden zwischen uns und den Katholiken herrscht. Seit mehr als zwanzig Jahren gibt es diesen Hass und das ganze Leid zwischen den beiden Religionen. Ich möchte keinen weiteren Glaubenskrieg erleben. Meine Enkelkinder sollen Seite an Seite und unbekümmert mit den katholischen Franzosen leben können. Es heißt, dass die Königsmutter den König gedrängt habe, die Heirat zwischen seiner Schwester und unserem Heinrich einzufädeln.«
Jacon hob seine Schulter und ließ sie wieder sinken. »Als Karl IX. mit zehn Jahren den Thron bestieg, war es unvermeidlich, dass seine Mutter für ihn Entscheidungen treffen musste. Doch anscheinend ist er als zweiundzwanzigjähriger Mann noch immer nicht erwachsen genug, sein Land allein zu regieren. Katharina von Medici soll weiterhin erheblichen Einfluss auf ihren Sohn haben – was im Fall dieser Heirat sicherlich eine weise Entscheidung war. Sie sucht schon seit geraumer Zeit die Einigung mit uns Hugenotten. Sie ist keine katholische Fanatikerin.«
»Da Heinrich von Navarra beide Glaubensrichtungen kennt, setze ich meine Hoffnung in ihn, dass wir dieses Mal in Frieden nebeneinander leben können. Allerdings ist die Gefahr groß, dass er erneut wankelmütig werden und den katholischen Glauben seiner Frau annehmen wird. Schließlich hat er bereits dreimal die Konfession gewechselt«, gab der Glasmacher zu bedenken.
»Dreimal?«, fragte Jacon zweifelnd. »Ich war der Ansicht, dass er viermal konvertierte.«
»Heinrich wurde katholisch getauft«, erklärte Romain. »Kurz darauf konvertierten seine Eltern zum Calvinismus.« Er hob den Daumen in die Höhe. »Obwohl sein Vater, Antoine de Bourbon, Führer der Protestanten war, wurde er rückfällig, als ihn der französische König zum Generalleutnant ernannte. Er nahm erneut den katholischen Glauben an, und auch sein Sohn Heinrich konvertierte.« Roman nahm den Zeigefinger dazu. »Doch als der Vater vor fast zehn Jahren starb, drängte die Mutter ihren Sohn zurück zum Calvinismus, und Heinrich wechselte abermals den Glauben«, beendete der Alte seine Erklärung und hielt dabei drei Finger in die Luft.
Jacon überlegte. »Stimmt, es waren nur drei Wechsel.«
»Am Abend der Hochzeit von Heinrich und Marguerite haben wir im Wirtshaus auf das frisch getraute Ehepaar getrunken und uns darüber unterhalten. Ich hoffe inständig, dass Heinrich kein Katholik wird, allerdings kann ich mir vorstellen, dass seine Schwiegermutter darauf drängen könnte.«
»Nein, nein! Heinrich ist durch und durch Hugenotte und wird es bleiben«, versicherte Jacon. »Du weißt, Romain, dass Heinrich seinem Vater gehorchen musste. Seine Mutter hingegen blieb bis zu ihrem Tod Protestantin. Sehr tragisch, dass Jeanne von Navarra die Vermählung ihres Sohnes nicht mehr miterleben konnte«, erklärte er leise seufzend.
Romain nickte. »Ist es nicht seltsam, dass sie nur wenige Tage vor dem ursprünglichen Hochzeitstermin im Mai verstorben ist? Ihr wisst, dass man munkelt, Katharina von Medici habe sie vergiftet?«
»Unsinn! Diese bösen Zungen sollen schweigen! Welchen Grund sollte es dafür geben? Niemand weiß Genaues, da bietet es sich natürlich an zu spekulieren. Nach ihrem Tod hatte ich sogar vermutet, dass man wegen des Trauerfalls die Hochzeit auf das nächste Jahr verschieben würde, doch das wäre sicherlich nur schwerlich durchzusetzen gewesen. Alle Vorbereitungen waren getroffen und die Gäste eingeladen, manche sogar schon angereist.« Jacon sah seinen Glasmacher verschmitzt an. »Der milde Mai wäre den Mesdames und Mesdemoiselles sicher lieber gewesen als dieser heiße August. Ich konnte die Schweißperlen auf den geschminkten Gesichtern der Versammelten sehen, als ich die Gläser in den Louvre brachte. Die Lakaien haben bestimmt schwere Arme bekommen, als sie den eng eingeschnürten Frauen mit riesigen Wedeln aus Straußenfedern unentwegt Luft zufächeln mussten.« Immer noch grinsend schloss er die Holzkiste mit dem neu angefertigten Weinglas. »Lass uns zu den Arbeitern gehen. Ich will ihnen für ihre Bemühungen persönlich danken.«
Der Glasbläser nickte und nahm den schwarzen Kasten entgegen. »Ich vergaß, mich nach Eurer Gemahlin zu erkundigen«, sagte er zerknirscht und blieb auf halbem Weg zur Tür stehen.
»Danke der Nachfrage, Romain. Die Hitze macht auch meiner Catherine zu schaffen. Sie kann sich ob ihrer Leibesfülle kaum noch bewegen. Zum Glück ist die Hebamme der Ansicht, dass das Kind in den nächsten Tagen zur Welt kommen wird.«
»Dann wünsche ich Eurer Frau, dass sie bald niederkommt«, sagte der Alte und öffnete seinem Patron die Tür.
Kapitel 2
Jacon Desgranges’ Glashütte lag an einem Waldstück, eine Stunde Fußmarsch von Paris entfernt. Im Laufe der Jahre hatte er bescheidenen Wohlstand erlangt, der ihm gewisse Annehmlichkeiten erlaubte. So hatte er sich vor zwei Jahren eine Stadtwohnung am Rand der Innenstadt von Paris leisten können, in der er mit seiner Frau Catherine und dem fünfjährigen Sohn Pierre lebte. Dank der Mitgift seiner Frau war es Jacon möglich gewesen, die geforderte Pacht an den Grundherrn eines großen Waldgebiets zu zahlen. Dadurch konnte er sich das Brennmaterial für die Glashütte auf viele Jahre sichern, während andere Betriebe weiterziehen mussten, wenn ihr Geld nur für kleine Abholzflächen reichte. Ich werde es sicher nicht erleben, dass das Holz zur Neige geht und die Glashütte schließen muss, hatte Jacon damals gedacht, als er die mächtigen Stämme der Bäume betrachtete. Das war nun einige Jahre her, und bis jetzt war nicht einmal ein Viertel des Holzbestands aufgebraucht.
Der Glasfertigungsbetrieb der Desgranges war einer der größten im Umland und ernährte achtzehn Familien. Es war ein anspruchsvolles Handwerk, das im Schichtdienst rund um die Uhr arbeitete. Jeder Werkplatz bestand aus einem Meister, zwei Handwerkern und einem Anfänger. Es gab einen Schmelzer, der die geheimen Glasrezepte und die Rohstoffe kannte, die man für das Gelingen der Schmelze benötigte. Ein Strecker war der Fachmann für die Herstellung von Flachglas, das für Fensterscheiben genutzt wurde. Und ein Hafenbauer baute den Ofen, für dessen Beheizung ein Schürer zuständig war. Zudem benötigte eine Glashütte einen Pottaschensieder, der Holz zu Asche brannte, die zur Glasschmelze gebraucht wurde. Ein Glasmüller zerkleinerte das Quarzgestein, und Holzfäller schlugen das Holz, brachten es zum Ofen, zerhackten es und lagerten es zur Trocknung. Laut Glasmachervorschrift war die Produktionsdauer von Ostern bis zum Martinstag im November befristet, sodass in den Wintermonaten Reparaturen an den Öfen vorgenommen und Brennmaterial fürs nächste Jahr geschlagen werden konnte.
Jacon hatte ein Gespür dafür, geeignete Arbeiter zu finden, auf die er sich verlassen konnte, sodass er nicht mehr selbst am Schmelzofen stehen musste. Seit geraumer Zeit kümmerte er sich ausschließlich um das Geschäftliche, den Verkauf seiner Glaswaren oder die Anbahnung neuer Aufträge. Trotzdem war es ihm als Hüttenherr wichtig, den Kontakt zu seinen Arbeitern zu halten. Mehrmals im Monat kam er zu der Glashütte, um die Arbeiten zu kontrollieren, aber auch um sich ihre Sorgen, Nöte und Beschwerden anzuhören. Jacon hatte keine Scheu, seine Männer zu rügen, wenn ihm etwas missfiel. Aber genauso lobte er sie für besondere Leistungen.
Die Wohnung des Glasmachers Romain befand sich in einem Gebäude, in dem auch die Unterkünfte der Glasmachergesellen lagen. Die anderen Arbeiter wohnten mit ihren Familien in einfachen kleinen Katen, die abseits der Glashütte, um das zentrale Gebäude des Hüttenbetriebs, platziert waren. In einem aus Holz gezimmerten Langschuppen befanden sich drei Öfen mit unterschiedlichen Funktionen. Im ersten Ofen, dem Frittofen, wurden die Rohstoffe zusammengeschmolzen. Der Klumpen, der dabei entstand, wurde anschließend im Werkofen geschmolzen und zu Gebrauchsgegenständen verarbeitet, die dann im Kühlofen gekühlt wurden. Alle drei Öfen waren aus mit gebrannter Schamotte versetzten Lehmziegeln gemauert. Der Frittofen war mit drei Metern Breite und drei Metern Höhe der größte. In seine untere halbrunde Öffnung wurde das Brennmaterial eingeführt. Aus den oberen Öffnungen entnahm man das flüssige Glas. Bei diesen Arbeitsvorgängen entstand Rauch, der durch das für eine Glashütte typische Rauchdach abzog. Der Hüttenboden aus festgestampftem Lehm sorgte für Kühle und war zudem feuerfest.
Jacon Desgranges und Romain betraten das Werksgebäude. Die sommerliche Augusthitze war schon unerträglich, doch die Hitze, die im Innern der Hütte herrschte, traf die Männer wie ein Keulenschlag. Die Luft war verdichtet von Rauch, Feuer und Wasserdampf. Kaum standen die beiden in der Hütte, brach ihnen der Schweiß aus, sodass ihnen in Sekundenschnelle die Kleider am Körper klebten. Jacons Gesicht lief dunkelrot an, als ob ihn Fieber plagte. Durch den dichten Rauch brannten und tränten seine Augen. Er blinzelte und wischte mit dem Ärmel die Tränen fort.
Romain stellte die Kiste mit dem Weinkelch im Regal für fertige Glaswaren ab und griff nach zwei Bechern, die er mit Bier aus einem Krug füllte. »Trinkt, Monsieur! Ihr seid diese Hitze nicht mehr gewohnt«, sagte er mit lauter Stimme, da er gegen den Lärm angehen musste.
Jacon griff gierig nach dem Becher und leerte ihn in einem Zug. Da bei der Glasherstellung hohe Temperaturen herrschten und zudem die Arbeit sehr anstrengend war, mussten alle Arbeiter ausreichend trinken. Deshalb waren die Hüttenherren vertraglich verpflichtet, genügend Flüssigkeit bereitzustellen. Zahlreiche Krüge mit kühlem Bier standen verteilt um jeden Arbeitsplatz. Ein Lehrjunge war ausschließlich damit beschäftigt, sie immer wieder aufzufüllen und den Schaffenden zu reichen.
Romain zog aus dem Hosenbund ein Tuch hervor. »Diese Hitze ist auch nichts mehr für mich alten Mann«, knurrte er verhalten und wischte sich mit dem Lappen über das gerötete Gesicht. Jacon nickte verständnisvoll und winkte den Lehrjungen herbei, der ihnen hastig nachschenkte.
Nach dem zweiten Becher fühlte Jacon sich erfrischt und trat dichter an einen der Schmelzöfen, den Hafen, heran. Fasziniert sah er den Glasmachern auf der hölzernen Arbeitsbühne zu, auf der sie während ihrer Arbeit standen. Nachdem die Glasmasse zwei Tage und Nächte hindurch geschmolzen worden war, tauchte der Einbläser nun die Glasmacherpfeife ins Glasbad. Er drehte die Eisenhälfte des über ein Meter langen Rohrs und entnahm flüssiges Glas, das er durch Blasen ins hölzerne Ende der Pfeife zur Kugel formte. Seine Wangen blähten sich dabei derart auf, dass es so aussah, als könnten sie Jeden Augenblick platzen. Als der Einbläser mit seiner Arbeit zufrieden war, reichte er die Pfeife weiter an den Meister, der das Glas mit Glastropfen und Glasfäden, die er aus den Glasbatzen zog, verzierte. Dann brachte der Einträger das fertig geformte Glas in den Kühlofen, wo es bei geringerer Temperatur auskühlten musste.
Jacon betrat das Holzpodest, damit seine Arbeiter ihn bemerkten. Wie auf Kommando sahen alle Männer zu ihm auf, grüßten mit einem knappen Nicken und widmeten sich dann sofort wieder ihrer Arbeit. Jacon bemerkte aus dem Augenwinkel eine Bewegung und schaute zum Kühlofen, wo der Glasmeister ihn zu sich winkte. Er ging zu ihm hinüber, als dieser gerade mit dem Zwackeisen, das einer langen Pinzette mit breitem Bügel glich, ein rotes Weinglas aus dem Ofen zog und es in die Höhe hielt.
»Très magnifique! Sehr schön!«, schrie Jacon, da gerade neues Holz in den Ofen gehievt wurde und man sein eigenes Wort nicht verstehen konnte. Er klopfte dem Glasmeister wohlwollend auf die Schulter.
»Morgen sind die letzten Gläser fertig«, versprach der brüllend, und Jacon wiederholte das Schulterklopfen. Er ging soeben zurück zu Romain, der die Glasware aus dem Regal in Kisten mit Stroh verpackte, als sich die Tür des Hüttengebäudes öffnete und ein junger Mann eintrat. Sofort schweifte sein Blick suchend umher und blieb an Jacon hängen. Mit eiligen Schritten kam er auf ihn zu.
»Was machst du hier?«, fragte Jacon den Sohn seines Freundes Claude Dupont.
»Mein Vater schickt mich. Ihr sollt schnellstmöglich zu ihm kommen.«
Jacons Augenbrauen zogen sich zusammen, sodass eine tiefe Spalte zwischen ihnen entstand. »Was hat das zu bedeuten?«, fragte er verunsichert.
»Das kann ich Euch nicht sagen. Vater sagte nur, dass es dringend wäre«, erklärte der Sechzehnjährige.
Jacon wandte sich Romain zu. »Ich muss zurück nach Paris. Sorg dafür, dass die restlichen Gläser morgen, am Bartholomäustag, ausgeliefert werden können«, rief er und eilte mit dem Jungen nach draußen.
»Claude, du musst einen dringlichen Grund haben, mich so eilen zu lassen«, keuchte Jacon, als sein Freund ihm die Tür öffnete. Trotz der Hitze hatte er sein Pferd angetrieben, sodass der Wallach des Jungen kaum nachkam. Im Hof hatte er dem Burschen die Zügel zugeworfen und war, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinaufgehastet.
Nun stand er schwitzend, staubig und durstig vor seinem Kameraden aus Kindertagen, dessen angespannte Miene nicht Gutes verriet. Dupont gab Jacon ein Zeichen, leise zu sein. Dann ließ er ihn eintreten und führte ihn in sein Arbeitszimmer.
»Was ist los?«, fragte Jacon erregt, kaum dass die Zimmertür hinter ihm ins Schloss gefallen war. Er betrachtete die zahlreichen Papierbögen, die ausgebreitet auf dem Boden lagen und über die er steigen musste, um zu dem Krug zu gelangen, der auf dem Schreibtisch stand. Er goss sich Wein in einen Becher und fragte zwischen zwei Schlucken: »Hast du Schwierigkeiten mit dem Bauvorhaben im Louvre, Claude?« Da sein Freund als Baumeister die Verantwortung für den Umbau des königlichen Stadtschlosses trug, lag diese Vermutung nahe.
»Nein, im Louvre läuft alles bestens ...« Dupont stockte, und Jacon blickte über den Becherrand zu ihm hin. »Man hat heute auf Admiral de Coligny ein Attentat verübt«, erklärte er leise.
»Was?«, rief Jacon und fragte im nächsten Atemzug: »Ist er schwer verletzt?«
Claude schüttelte den Kopf. »Es heißt, dass Gaspard de Coligny Glück im Unglück gehabt hatte. Der Admiral habe sich angeblich in dem Augenblick seinem Pagen zugewandt, als der Attentäter den Schuss abfeuerte. Diese Bewegung soll Coligny das Leben gerettet haben, denn die Kugel durchschlug nicht seine Brust, sondern den rechten Unterarm und riss ihm einen Finger der linken Hand ab. Er wird beide Verletzungen überleben.«
»Wer wagt es, den Berater des Königs anzugreifen?«, fragte Jacon fassungslos.
Das Mienenspiel des Baumeisters verhieß nichts Gutes. »Das Haus, aus dem der Schuss abgefeuert wurde, gehört der Familie de Guise.«
Nun weiteten sich Jacons Augen vor Entsetzen. »Wie können sie es wagen!«, rief er ungläubig.
»Die Familie de Guise ist katholischer als der Papst und war schon einmal für einen Krieg verantwortlich. Erinnere dich an das Blutbad von Wassy vor etwas mehr als zehn Jahren. Damals wurden zahlreiche Hugenotten regelrecht abgeschlachtet, weil der Herzog de Guise nicht akzeptieren wollte, dass die Königsmutter den Hugenotten erlaubte, öffentlich Gottesdienste abzuhalten. Als de Guise in Wassy Zeuge eines solchen wurde, wollte er ihn verbieten ...«
»... und der Streit artete zu einem Gemetzel aus«, vervollständigte Jacon den Satz. »Jedes Kind weiß, dass damals der erste Hugenottenkrieg ausbrach.«
»Gerade deshalb verstehe ich nicht, dass die Familie de Guise einem Attentäter Einlass gewährt«, schimpfte Claude und lehnte sich gegen den Schreibtisch.
»Wie – glaubst du, sie wussten, was der Attentäter in ihrem Haus beabsichtigte?«, fragte Jacon erstaunt. »Und woher willst du wissen, dass es keiner von ihnen war?«
Dupont schaute Jacon erstaunt an. »Die Familie de Guise gehört zum französischen Hochadel. Als Anführer der Ultrakatholiken machen sie sich die Finger nicht selbst schmutzig. Jedoch würden sie ohne Hemmungen einen anderen beauftragen. Ihnen ist jedes Mittel recht, um Unfrieden zu stiften.«
»Die Hochzeit zwischen unserem Hugenottenkönig und der Schwester des Königs liegt erst fünf Tage zurück und sollte die beiden Glaubensrichtungen versöhnen! Und nun so etwas!«, rief Jacon schockiert und ließ sich auf einem Schemel nieder. »Weiß man, wie der König reagiert hat? Schließlich hat er für Colignys Sicherheit in diesen Tagen garantiert.«
Claude Dupont holte tief Luft und ließ sie geräuschvoll entweichen. »Ich war nicht dabei, als man ihm die Nachricht überbrachte, aber ich hörte, dass Karl IX. gerade Tennis mit Herzog Henri de Guise, dem Oberhaupt der Familie, gespielt habe. Der König soll über die Nachricht so erschüttert gewesen sein, dass er seinen Schläger zu Boden warf.« Er sah Jacon zweifelnd an.
Der runzelte die Stirn. Doch plötzlich weiteten sich seine Augen, und er flüsterte: »Du fragst dich, ob Karl erschüttert war, weil dieses Attentat passiert... oder weil es misslungen ist?«
Claude nickte verhalten.
»Wie ist die Stimmung in Paris? Hast du Zeichen sehen können, die uns beunruhigen müssten?«, fragte Jacon erregt.
»Wie du dir vorstellen kannst, verbreitet sich die Nachricht über das Attentat rasend schnell. Welche Folgen das Verbrechen nach sich ziehen wird ... wer weiß das zu sagen?«
»Ich hoffe, dass Karl IX. seinen Admiral aufsucht. Schließlich schätzt er Coligny und hat ihn immer wieder zu Rate gezogen. Der Admiral ist dem König wie ein väterlicher Freund, und zudem ein Kriegsheld, der von vielen bewundert wird.«
»Ach, mein Kopf ist leer, und ich kann nicht mehr nachdenken«, stöhnte Claude. »Ich bete und hoffe, dass dieses Attentat keine Folgen haben wird. Weder für uns Hugenotten noch für die Katholiken. Coligny lebt, und das ist die Hauptsache. Vielleicht habe ich dich umsonst in Angst versetzt«, sagte er und sah seinen Freund zerknirscht an.
»Mach dir darüber keine Gedanken. Ich wäre heute sowieso zurückgekommen. Die Arbeiter in der Glashütte kommen gut voran. Die Gläser werden rechtzeitig fertig sein, sodass ich sie morgen im Schloss abliefern kann. Jetzt gehe ich nach Hause.«
»Wie geht es deiner Frau?«
»Catherine wird in den nächsten Tagen niederkommen.«
»Dann grüße sie von mir. Ich wünsche euch ein gesundes Kind«, sagte Dupont zum Abschied und brachte Jacon zur Tür.
Jacon stieg in seinem Haus die Treppe in den ersten Stock hinauf, als er eine leise Melodie hörte. Sogleich entspannten sich seine Gesichtszüge, und er nahm die restlichen Stufen mit einem Lächeln. Auf dem kleinen Flur vor dem Schlafgemach blieb er stehen. Da die Tür halb offenstand, konnte er das Ehebett sehen.
Seine Frau lehnte mit dem Rücken gegen das Kopfende, während ihr kleiner Sohn neben ihr saß und ihrem Lied lauschte. Catherine wiederholte leise singend den Psalm 23, den der Pfarrer im Gottesdienst letzten Sonntag vorgetragen hatte: »Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grünen Auen und führet mich zum frischen Wasser...«
Jacon blieb ruhig stehen, da er Frau und Sohn nicht stören wollte. Catherine hielt die Lumpenpuppe in Händen, die sie für das ungeborene Kind genäht hatte. Sie hoffte, dass es ein Mädchen werden würde. Dann hätten wir ein Pärchen, hatte sie zu ihrem Mann mit leuchtenden Augen gesagt.
Catherine und Jacon hatten sich vor einigen Jahren auf dem Place de Grève am nördlichen Seineufer kennengelernt, als ein plötzlicher Wolkenbruch, der über der Stadt niederging, dazu führte, dass beide unter demselben Baum Schutz vor dem Regen suchten. Rasch waren sie bis auf die Haut durchnässt gewesen, und Catherines Zähne hatten vor Kälte aufeinandergeschlagen. Jacon erinnerte sich noch gut daran, wie sie verlegen versucht hatte, die Strähnen ihres hellen Haars, die sich unter der eierschalenfarbenen Haube hervorgestohlen hatten, zurückzustecken. »Darf ich Euch meinen Mantel anbieten?«, hatte er höflich gefragt.
Während sich ihre Wangen rosa verfärbten, hatte sie schüchtern genickt. Nie im Leben hätte Jacon damals gedacht, dass Catherine seine Frau werden würde. Sie hatte ihm auf Anhieb gefallen, doch da sie einige Jahre jünger als er war und zudem aus gutem Haus stammte, sah er kaum eine Chance, sie zu erobern. Nun waren sie schon sechs Jahre verheiratet und wurden erneut Eltern. Jacon seufzte leise. In welch einer barbarischen Zeit wird dieses Kind zur Welt kommen, dachte er und fuhr sich erschöpft mit beiden Händen durchs verschwitzte Haar.
Er wischte die düsteren Gedanken beiseite und betrachtete das fein geschnittene Gesicht seiner Frau. Wie blass sie ist, dachte er. Die Haut wirkte durchscheinend, und unter ihren Lidern lagen dunkle Schatten. Seit Wochen durfte sie ihr Bett nicht verlassen, da sie sonst sich und das ungeborene Kind gefährden würde. Diese Schwangerschaft raubt ihr mehr Kraft als die drei anderen, dachte Jacon. Nach dem Verlust ihres letzten Sohns war Catherine lange Zeit tieftraurig gewesen. Sie hatte sich an nichts mehr erfreuen können. Selbst der kleine Pierre hatte es nicht geschafft, sie zum Lachen zu bringen.
Der Arzt hatte erklärt, dass ein weiteres Kind ihr helfen würde, den Verlust der beiden verstorbenen Kinder zu verkraften. Jacon hatte aber zunächst lange Zeit den Beischlaf vermieden, aus Angst, Catherine könnte schwanger werden. Er war ein tiefgläubiger Mann, der niemals einer anderen Frau nachgeschaut hätte. Seine Religion verbot die körperliche Liebe des Vergnügens wegen, sodass ein Freudenmädchen nicht in Frage kam. Aber Herrgott – sollte er sich sein Verlangen aus den Rippen schwitzen? Doch seit Catherine wusste, dass sie erneut ein Kind bekommen würde, war sie gelöst und entspannt. Selbst das wochenlange Liegen nahm sie geduldig und ohne Jammern hin.
Nach Meinung der Hebamme könnte die Niederkunft in den nächsten Tagen erfolgen. Ist das Kind erst geboren, wird Catherine sicherlich wieder zu Kräften kommen, dachte Jacon.
Er hoffte, dass seine Frau noch nicht von dem Attentat gehört hatte. Er konnte das, was ihm sein Freund Claude erzählt hatte, noch immer nicht fassen.
Gaspard de Coligny ist ein Held, dem es vor wenigen Jahren gelungen ist, im Süden von Frankreich unseren Glauben zu festigen. Nicht auszudenken, wenn das Attentat geglückt wäre. Wann hat dieser unglaubliche Hass zwischen uns Hugenotten und den französischen Katholiken begonnen?, fragte sich Jacon nicht zum ersten Mal. Französische Protestanten glauben doch an denselben Gott wie Katholiken.
Doch schon seit vielen Jahren tobte in Frankreich ein Religionskrieg zwischen diesen beiden Glaubensgruppen, deren Wut aufeinander immer wieder aufs Neue entfacht wurde. Womöglich hat es mit dem Gemetzel vor zehn Jahren zu tun, überlegte Jacon. Dieses Blutbad, das katholische Söldner angerichtet hatten, als sie einen hugenottischen Gottesdienst überfielen, war abscheulich genug, um einen Krieg zu entfachen, überlegte er. Oder war das Massaker in Nîmes fünf Jahre zuvor Auslöser gewesen? Zugegeben: Dass Hugenotten hunderte katholische Kleriker und Mönche niedergemetzelt hatten, war ebenfalls ein scheußliches Verbrechen, das nicht zu entschuldigen war.
Das Lachen seines Sohnes lenkte Jacon von seinen trüben Gedanken ab. Er fühlte sich mit einem Mal erschöpft. Müde fuhr er sich abermals mit beiden Händen über das Gesicht, da hörte er die Stimme seiner Frau, die ihn rief.
»Du bist zurück, mein Lieber«, stellte Catherine mit zarter Stimme fest und sah ihm lächelnd entgegen.
»Papa!«, rief Pierre und warf sich ihm lachend vom Bett aus in die Arme.
»Nicht so stürmisch!«, mahnte Jacon und fing seinen Sohn auf, der die Wange an seinen Hals schmiegte.
Catherine betrachtete ihren Mann und fragte: »Du schaust besorgt aus. Ist alles in Ordnung?«
Jacon wandte ihr seinen Blick zu, und sein Gesichtsausdruck entspannte sich. Er ließ seinen Sohn zu Boden gleiten und bat ihn: »Geh zur Köchin, mon petit, und sag ihr, dass ich zurück bin und einen Mordshunger habe.« Dabei verdrehte er die Augen und zeigte auf seinen Bauch, sodass Pierre erneut laut lachte.
»Ich bin nicht dein Kleiner, sondern bald ein großer Bruder«, rügte er seinen Vater, der zustimmend nickte.
»Das ist wohl wahr. Jetzt geh, ich komme gleich nach«, sagte Jacon und setzte sich zu seiner Frau aufs Bett. »Ich habe dir beim Singen zugehört und wollte nicht stören«, erklärte er zärtlich und küsste ihre Fingerkuppen.
»Du störst nie, mon chéri«, erwiderte sie und strahlte ihn an. »Schau, die Puppe ist fast fertig. Ich muss nur noch deine Glasperlen als Augen festnähen und die Naht im Rücken schließen. Wie war die Reise? Läuft in der Glashütte alles nach Plan?«
Jacon lachte leise auf und streichelte ihre Finger. »So viele Fragen, ma chérie!«
»Ich habe dich seit gestern nicht gesehen und will wissen, was du erlebt hast. Seit ich ans Bett gefesselt bin, dürstet es mich zu erfahren, was in der Welt vor sich geht.«
»Das werde ich dir verraten, wenn du dich weiter ausgeruht hast. Derweil wasche ich mir den Straßenstaub vom Körper. Ich werde später wieder zu dir kommen«, versprach er.
Catherine lächelte und führte seine Hand zu ihren Lippen, um die Innenfläche zu küssen. Kaum hatte sie die Augen geschlossen, war sie eingeschlafen.
Jacon ließ seinen Blick über ihr helles, leicht gewelltes Haar schweifen, das einen schwachen Duft nach Lavendel verströmte. Ihre langen Wimpern warfen Schatten auf ihre farblose Wange, die er sanft berührte. Ich darf dir nicht sagen, was mir Claude erzählt hat, denn es würde dich unnötig aufregen, dachte er und beschloss, dass er seiner Frau nur das Schöne von der Welt berichten würde.
Kapitel 3
Zur selben Zeit in einem kleinen Ort in Frankreich
Der fünfjährige Olivier schob die Tür einen Spalt auf und lugte in den Raum. Die Fenster waren mit dünnen Decken zugehängt, die das Sonnenlicht nur gedämpft hereinließen. Kerzen auf einem Schränkchen beschienen schwach den Strohsack, der als Matratze für das Bett an der gegenüberliegenden Wand diente.
Olivier drückte die Tür weiter auf. Schon schlug ihm der Gestank von Fäulnis und geronnenem Blut entgegen. Angewidert drehte er den Kopf zur Seite und schnappte gierig nach frischer Luft. Dann wagte er erneut, den Blick in die Kammer zu richten und tapfer zur Bettstatt hinüberzuschauen.
Die Frau, die dort lag, war ihm fremd geworden, obwohl sie seine Mutter war. In den Wochen ihrer Krankheit, die die Nachbarn Schwindsucht nannten, hatte sie sich verändert. Sie war hager geworden. Die Wangenknochen stachen spitz aus ihrem blassen Gesicht hervor, und ihre Augen verschwanden beinahe in den Höhlen, die dunkelblau umrahmt waren. Ihre einst liebevollen Gesichtszüge wirkten verzerrt und hart. Falten waren wie mit einem Messer um Augen und Mund eingekerbt. Das hohe Fieber, das die Mutter seit Wochen plagte, hatte ihre Lippen rissig und spröde werden lassen. Bei jeder Bewegung platzten sie blutend auf. Sie stöhnte leise vor Schmerzen.
Wie Olivier sich erinnerte, war die Haut seines verstorbenen Vaters fleckig und mit Pocken übersät gewesen, während die Haut seiner Mutter jetzt glatt wirkte und die Farbe von Schnee bekommen hatte.
Er schaute verängstigt zu seiner Mutter, die mit jedem Keuchen und Röcheln dem Leben einen weiteren Atemzug abzuringen versuchte. Dünner Blutschweiß lief über ihre Stirn und über ihren Hals und versickerte im Stoff des Leinenhemds. Ein Hustenanfall ließ ihren Körper sich aufbäumen und das Gesicht rot anlaufen. Panisch riss sie die Augen auf und sog gierig Luft in ihre Lunge.
Olivier wollte ihr helfen und wusste nicht, wie. Seine Beine schlotterten vor Furcht und weigerten sich, ihn zu ihr zu tragen. Als der Hustenkrampf abebbte, legte sich die Mutter ermattet zurück und schloss die Augen.
Er wollte sich gerade davonschleichen, als er ihre kraftlose Stimme hörte: »Komm zu mir, mein Sohn!«
Erschrocken blickte er zu der Matratze. Er hatte nicht geahnt, dass die Mutter ihn bemerkt hatte. Noch zögerte er, doch dann fasste er Mut und schob das Türblatt ganz auf. Er trat langsam ein und ging ans Fußende des Lagers. Ein süßlicher Geruch hing über der Mutter, der sich Olivier auf die Zunge legte. Angewidert schluckte er und hoffte so, den schlechten Geschmack loszuwerden. Dann versuchte er, die Luft anzuhalten, um nicht den kranken Mief einzuatmen. Aber kaum hatte er die Wangen aufgebläht, japste er nach Luft.
»Mein armes Kind«, flüsterte die Mutter und streckte die Hand nach ihm aus. Da schüttelte sie erneut ein Hustenkrampf. Dieses Mal spuckte sie Blut, das zwischen ihren Fingern hervorrann. »Reich mir den Becher mit Wasser«, wisperte sie und wischte sich über den Mund. Blutklümpchen klebten an ihrem Handrücken.
Olivier schaute sie mit großen Augen und entsetztem Blick an. Er ekelte sich vor der Kranken, und gleichzeitig hatte er Angst, seine Mutter zu verlieren. »Musst du sterben, wie Vater?«, wimmerte er.
Hastig drehte sie den Kopf zur Wand. Als sie den Blick wieder auf ihn richtete, konnte er Tränen sehen. »Der liebe Gott ist gnädig, mein Sohn, und wird mich schon bald von meinen Qualen erlösen. Du musst keine Furcht haben, da meine Schwester, deine Tante Claire, und ihr Mann sich um euch kümmern werden.«
Olivier schüttelte entsetzt den Kopf. »Ich kenne sie nicht und habe sie noch nie gesehen«, schluchzte er. Tante und Onkel waren Fremde, zu denen er nicht wollte. »Du musst bei uns bleiben«, weinte er und blickte sich hilfesuchend in der Kammer um. Aber da war niemand, der ihn beschützen würde.
»Du darfst nicht verzagen, mein Kind, sondern du musst stark sein und auf deine kleine Schwester achten. Colette braucht dich!«, erklärte die Mutter und legte sich kraftlos zurück.
Olivier schlang die Arme um seinen dünnen Körper, um das Zittern zu unterdrücken. Die Worte hallten in seinem Kopf nach. Er war noch keine sechs Jahre alt! Wie sollte er seine Schwester beschützen?
»Du bist stark, Olivier, und du schaffst das«, flüsterte seine Mutter, die anscheinend seine Gedanken erraten hatte.
»Was soll ich Colette sagen? Sie ist noch so klein und wird nicht verstehen, warum wir nicht mehr in unserem Zuhause bleiben dürfen«, jammerte Olivier. »Bleib bei uns, Mutter«, flehte er.
»Ich kann nicht, mein Kind. Gott ruft mich, und ich muss ihm gehorchen. Zeichne ein Bild von mir, das du später Colette zeigen kannst, damit sie weiß, wie ihre Mutter aussah.«
»Ich brauche dich auch!«, schluchzte er weinend.
»Trag das Bild an deinem Herzen, dann bin ich dir nahe. Und nun verewige mich«, forderte die Sterbende ihn auf.
Olivier blickte überrascht zu seiner Mutter und wischte sich die Tränen fort. »Ich kann dich nicht zeichnen. Ich bin noch ein Kind«, erwiderte er.
Doch seine Mutter lächelte zuversichtlich. »Gott hat dich mit einem unglaublichen Talent gesegnet. Nutze es, mein Sohn, und zweifle nicht an dir.«
»Ich habe kein Papier«, flüsterte er zaghaft. Die zittrige Hand der Mutter wies zu der Truhe, die an der Wand hinter der Tür stand. »Unter der Wäsche habe ich zwei Bögen und einen kleinen Kohlestift aufbewahrt«, verriet sie mit schwacher Stimme und musste erneut husten. Erschrocken schaute er zu ihr auf, doch sie versuchte ihn mit einem Lächeln zu ermuntern. Mit einem Handzeichen gab sie ihm zu verstehen, dass er zu dem Holzkasten gehen sollte.
Olivier gehorchte und öffnete den Deckel. Er nahm die wenigen Leinentücher und Kleidungsstücke heraus und legte sie beiseite. Auf dem Boden der Kiste fand er zwei Bogen gelbliches Papier und einen abgebrochenen Kohlestift.
»Das gehört dir, mein Sohn«, flüsterte die Mutter. »Ich bete zu Gott, dass dir deine Begabung eines Tages ein besseres Leben ermöglichen wird«, sagte sie mit vom Fieber glänzenden Augen. »Und nun zeichne ein Bild von mir!«
Jeanne versuchte, ihren Sohn zuversichtlich anzublicken. Der Gedanke, ihre beiden Kinder alleinlassen zu müssen, presste ihr das Herz zusammen. Sie wusste, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte, und hatte bereits mit dem Pastor geredet. Der Geistliche hatte ihr versprechen müssen, die Kinder nach ihrem Tod zu ihrer Schwester zu bringen. Claire und ihr Mann Antoine wohnten eine halbe Tagesreise entfernt, weshalb Jeanne nicht selbst hinfahren konnte. Seit geraumer Zeit hatten die beiden Schwestern keinen Kontakt miteinander gepflegt, und deshalb wusste Claire nicht, dass Jeanne todkrank war.
Lieber Gott, bitte sorge dafür, dass meine Schwester und ihr Mann gut zu meinen Kindern sind, betete Jeanne stumm. Plötzlich schoss ihr ein Gedanke durch den Kopf, der sie panisch werden ließ. Was, wenn Claire ebenfalls krank ist oder wenn sie inzwischen selbst eine Horde Kinder zu versorgen hat und für meine beiden keinen Platz hat? Die Angst ließ Jeanne unruhig werden. Hektisch sog sie die Luft ein, sodass sich ihr Brustkorb in schneller Folge hob und senkte. Als sich wieder ein Hustenanfall löste, versuchte sie den Reiz zu unterdrücken, da ihr Sohn sie furchtsam anblickte. »Es ist alles gut«, japste sie und verzog die blutenden Lippen zu einem leichten Lächeln.
Ihre Gedanken schweiften zurück zu ihrer Schwester. Bei ihrem letzten Treffen waren Claire und ihr Mann kerngesund und kinderlos gewesen. Warum sollte das jetzt anders sein? Ihre Schwester war einige Jahre jünger als sie und erfreute sich gewiss bester Gesundheit, dachte Jeanne zuversichtlich. Selbst wenn Claire mittlerweile Kinder hat, so ist bestimmt noch Platz für meine beiden, überlegte sie und griff neben sich unter die Matratze. Als ihre Finger das Leinensäckchen ertasteten, beruhigten sich ihre Nerven und ihr Herzschlag. Dies wird sie überzeugen, Olivier und Colette bei sich aufzunehmen, war sich Jeanne sicher und schloss erleichtert die Augen. Im Laufe der letzten Jahre hatte sie jede Münze, die sie erübrigen konnte, gespart, um in schlechten Zeiten eine Reserve zu haben. Jetzt würde ihre Schwester das Geld erhalten, damit sie sich um Olivier und Colette kümmerte. »Ja, die Münzen werden sie überzeugen«, murmelte Jeanne kaum hörbar. Und sollten meine Schwester und mein Schwager nicht in der Lage sein, meine beiden Kleinen aufzunehmen, wird der Herr Pastor sicherlich ein Erbarmen mit meinen Kindern haben, hoffte sie in Gedanken und wischte sich den blutigen Fieberschweiß von der Stirn.
Jeanne betrachtete liebevoll ihren Sohn, der versuchte, ihr Gesicht auf Papier zu bannen. Er zog angestrengt die Augenbrauen zusammen und leckte sich immer wieder über die Lippen. Da seine Finger vom Kohlestift verfärbt waren, verschmierte er den Bogen Papier. Aufgeregt versuchte er den Fleck mit seinem Ärmel wegzuwischen. Jeanne lächelte schwach über Oliviers verbissenes Gesicht, als er sich wieder seiner Aufgabe widmete.
Erst vor wenigen Monaten hatte sie beobachtet, wie ihr Sohn mit einem Stück Holzkohle eine Krähe auf den Boden gezeichnet hatte. Diese war ihm so detailgetreu gelungen, dass die Zeichnung den Eindruck vermittelte, als würde der Vogel jeden Augenblick davonfliegen. Zwar war sie damals über Oliviers Begabung verwundert gewesen, doch da ihr Leben mit harter Arbeit ausgefüllt war, hatte sie keine Zeit gehabt, sich weitere Gedanken darüber zu machen. Jeanne und ihr Mann waren einfache Leute, die tagtäglich um ihr Überleben kämpfen mussten. Zeichnen und andere Künste waren für Reiche und gebildete Menschen reserviert. Doch dann ertappte sie ihren Sohn, wie er die Tiere des Waldes zeichnete. Es war am Bach gewesen, wo Jeanne Wäsche wusch, als sie sah, wie ihr Sohn auf Findlingen eine Taube, einen Hasen und einen Fuchs zeichnete. Auch auf diesen Bildern wirkten die Tiere wie lebendig.
Seitdem grübelte Jeanne, woher der Junge dieses seltene Talent geerbt haben konnte. Da weder in der Familie ihres Mannes noch in ihrer eigenen jemand diese Fähigkeit hatte, kam sie zu dem Schluss, dass Gott Olivier dieses Talent geschenkt haben musste.
Er hat sicherlich Großes mit meinem Sohn vor, denn warum sonst war er so gütig und hat ihm diese Gabe mitgegeben?, dachte Jeanne zum wiederholten Mal und schloss mit diesem beruhigenden Gedanken die Augen.
Kapitel 4
Paris – 23. August 1572, der Tag vor der Bartholomäusnacht
Es war später Nachmittag, als Jacon die Treppe zum Schlafgemach seiner Frau hinaufstieg. Da er in das königliche Schloss fahren musste und erst spät zurückkehren würde, wollte er sich vergewissern, dass es Catherine gutging. Auf der letzten Stufe der Holztreppe blieb er stehen und wischte sich mit dem Ärmel über das schweißnasse Gesicht. Schon seit Tagen lag eine drückende Hitze über Paris, die Jung und Alt zu schaffen machte. Um die Schwüle auszusperren, blieben die Fensterläden aller Räume geschlossen. Weil so aber auch keine frische Luft hereinkam, war das Haus stickig, und man konnte kaum durchatmen.
Jacon drückte die Klinke herunter und schob die Tür auf. Kerzen, die im Zimmer verteilt waren, spendeten sanftes Licht. Seine Frau schlief tief und fest. Zuerst wollte er sich umdrehen und wieder gehen, doch dann trat er leise an ihr Bett heran und setzte sich auf die Kante nieder. Wie schön sie ist, dachte er und betrachtete ihr ebenmäßiges Gesicht. Sonnenlicht fiel durch die Ritzen der Läden und zeichnete einen hellen Strahl über ihre Augenpartie. Ihre langen Wimpern warfen feine Schatten auf ihre rosigen Wangen. Catherine hatte ihr helles, gewelltes Haar zu einem Zopf geflochten, der seitlich auf dem Kissen lag.
»Wie schön du bist«, murmelte Jacon und nahm vorsichtig die Hand seiner Frau in seine, um einen Kuss daraufzuhauchen.
»Ich sehe sicherlich fürchterlich aus!«, flüsterte Catherine und blinzelte ihn schlaftrunken an.
»Du bist so schön wie immer, chérie«, versicherte ihr Jacon und beugte sich über sie, um ihr einen Kuss zu geben. »Verzeih, dass ich dich geweckt habe«, sagte er zerknirscht und setzte sich zurück. »Aber ich muss in den Louvre und wollte vorher nachsehen, ob du etwas benötigst.«
»Hast du die restlichen Weingläser bekommen?«, fragte Catherine und griff nach seiner Hand.
Jacon nickte und schwärmte: »Auch diese Gläser sind perfekt geworden. Nicht der kleinste Makel ist zu erkennen. Stell dir vor, ma chérie, wenn das Licht in einem bestimmten Winkel den Weinkelch trifft, hat es den Anschein, als ob das rote Glas durchsichtig sei«, erklärte er und schaute seine Frau begeistert an. »Ich träume von dem Tag, an dem die Alchemisten herausfinden, wie man buntes Glas herstellen kann, das nicht opacus ist.«
Catherine zog verwundert eine Augenbraue in die Höhe. Jacon lachte. »Entschuldige, ma trésor, das ist die geheime Sprache der Glashersteller«, flüsterte er. »Opacus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet: trüb oder verschwommen oder dunkel.«
Catherine sah ihn anerkennend an. »Hoffen wir, dass diese Weinkelche nicht wieder zu Bruch gehen.«
»Der Herr im Himmel möge das verhüten«, rief Jacon und hob wie flehend seine freie Hand in die Höhe. »Damit nicht wieder solch ein Malheur passiert, hat Romain die Gläser in die doppelte Menge von zerkleinertem Stroh verpackt. Außerdem werde ich persönlich jede einzelne Kiste in den Louvre tragen, damit keiner der Lakaien sie fallen lassen kann.«
»Dann achte sorgsam auf deine Tritte«, kicherte Catherine.
Jacon erwiderte ihr Lachen. Sein Blick streichelte ihr Gesicht. Immer wieder aufs Neue war er dankbar, dass Catherine ihn als Ehemann gewählt hatte. Als er ihr liebevoll über die Wange strich, neigte sie den Kopf seiner Hand entgegen und flüsterte: »Je t’aime, mon amour«
»Ich liebe dich auch, meine Schöne!«, verriet er und gab ihr einen sanften Kuss. »Spürst du schon Anzeichen, ob unser Kind das Licht der Welt erblicken will?«
Catherine nickte. »Die Hebamme glaubt, dass es bald so weit sein müsste. Sie kommt später noch einmal vorbei, um nach mir zu sehen.«
Jacons Blick fiel auf die Lumpenpuppe, die neben dem Bett auf dem kleinen Tisch lag.
»Ich sehe, die Puppe hat jetzt Kleider an«, sagte er und nahm das Spielzeug hoch. »Bist du immer noch der Ansicht, dass wir eine Tochter bekommen?«
Catherine nickte. »Ja, ich spüre, dass es ein Mädchen wird.«
Jacon wusste, dass sich seine Frau eine Tochter wünschte. Nach dem Verlust ihrer beiden Söhne hoffte sie, dass ein Mädchen ein robustes Kind würde.
»Hast du schon einen Namen für unsere Tochter?«, fragte Jacon zärtlich.
»Ich möchte sie Magali nennen – nach meiner Mutter«, verriet Catherine ihm leise. Er sah Tränen in ihren rehbraunen Augen schimmern, was ihm das Herz zerriss.
»Magali«, wiederholte er leise. »Es gibt keinen schöneren Namen für unsere Tochter«, sagte er und erhob sich.
»Geh noch nicht, Liebster. Erzähl mir von der königlichen Hochzeit, die ich leider verpasst habe.«
»Ach, Catherine, ich habe keine Zeit für Geplänkel. Ich muss die Ware ausliefern«, sagte Jacon lachend und wollte gehen, doch seine Frau hielt ihn an der Hand fest.
»Ich liege den lieben langen Tag allein in diesem Zimmer und komme um vor Langeweile. Dann grüble ich, und Grübeln verursacht Kopfschmerzen. Aber wenn du mir erzählst, wie die Feierlichkeiten waren, dann kann ich von der Hochzeit träumen«, erklärte sie, und dabei leuchteten ihre Augen.
»Du sollst dich doch schonen, damit es dir und dem Ungeborenen gutgeht. Schon bald wirst du erlöst sein und wieder am öffentlichen Leben teilhaben können«, versprach er und wollte sanft seinen Finger aus ihrem Griff lösen, doch sie hielt seine Hand fest umschlossen. Er seufzte und setzte sich wieder zu ihr auf das Bett. Als er den triumphierenden Blick seiner Frau sah, drohte er ihr mit dem Zeigefinger. »Du bist eine Schlange, meine Liebe, denn du weißt sehr genau, wie du mich beschwatzen kannst.«
Sie küsste seine Handinnenfläche und forderte ungeduldig:
»Erzähl mir, was die Menschen über diese Vermählung sagen, wie die Gäste angezogen waren – ach, einfach alles!«
Jacon schmunzelte und bat: »Dann lass mich kurz nachdenken.« Er rieb sich über die Stirn und überlegte. »Der weite Platz vor der Kirche Notre-Dame war mit Menschen überfüllt«, begann er zu erzählen. »Arme und Reiche, adlige und einfache Leute standen nebeneinander und warteten ungeduldig darauf, dass es endlich losging. Die Luft schien erfüllt von Neugierde und Vorfreude, dass der König von Navarra die Schwester des französischen Königs heiraten würde. Alle waren herausgeputzt und in ihre schönsten Gewänder gehüllt. Immer dichter drängte sich die Menge auf dem Vorplatz der Kathedrale, sodass die Schweizer Wache sie mit quer gehaltenen Hellebarden zurückdrängen musste. Doch die verwegenen Gesellen ließen sich von den imposanten Gestalten der Wache nicht einschüchtern und versuchten, sie zu überlisten. Während einer die Männer ablenkte, krochen andere unter den Lanzen hindurch. Ich hätte es nicht gewagt, mich an den Schäften der Spieße vorbeizuschleichen. Zumal es kräftige Männer waren, die durch ihre bunten Wämser breiter als normal wirkten. Ihre Ärmel waren keulenförmig aufgeplustert, und angeblich sollen sie Pranken wie Bären haben«, grinste Jacon. Dann konzentrierte er sich und fuhr fort: »Fast alle Häuser in Paris waren mit Blumen und Fähnchen geschmückt; besonders die Gebäude um den Platz der Kathedrale. Dort hingen aus weit geöffneten Fenstern Teppiche und Stoffbanner. Um das Hauptportal der Notre-Dame hatte die Innung der Zimmerleute ein großes Gerüst gebaut, das mit weißen Tüchern zugehängt worden war, weil hier die Brautleute vor allen Menschen getraut werden sollten. Hier nahmen auch die Edelleute Platz. Ihren Rang konnte man an den Farben ihrer Kleidung erkennen. Die bunten Gewänder strahlten mit dem Blau des Himmels um die Wette. Stell dir vor, Catherine, die edlen, hochwohlgeborenen Damen und Herren haben sich wie das gewöhnliche Volk vorgedrängelt, weil jeder den besten Platz auf dem Gerüst ergattern wollte.« Jacon schmunzelte, als er fortfuhr: »Es soll deshalb sogar Streit unter ihnen ausgebrochen sein, den die Offiziere der französischen Garde schlichten mussten.«
Auch Catherine musste lachen, als sie das hörte.
»Es heißt, dass sich die Juweliere, Haarmacher und Gewandschneider an der Hochzeitsfeier eine goldene Nase verdient haben, da manche Damen gar kostbarer gekleidet waren als die Braut selbst«, spottete Jacon.
»Wie sah Margot aus?«, fragte Catherine mit leuchtenden Augen.
»Ich achte auf so etwas nicht«, versuchte Jacon die Neugierde seiner Frau zu bremsen. Doch er wusste, dass sie enttäuscht sein würde, wenn er sich nicht an mehr erinnerte. Also überlegte er angestrengt. »In Margots hochgesteckten Haaren war eine Krone befestigt, wie sie nur Königinnen tragen, besetzt mit Diamanten und bunten Edelsteinen. Trotz der Hitze war sie in einen weißen Hermelinmantel gehüllt, über dem ein blauer Umhang lag, der mit Juwelen bestickt war. Das Kleid selbst konnte man nicht sehen, aber ich glaube, dass silbriger Stoff unter dem Mantel hervorspitzte.«
Jacon sah, wie Catherine versuchte, sich die Kleidung der Braut vorzustellen. Schließlich wollte sie wissen: »Wer könnte so unverschämt gewesen sein, sich ebenso aufwendig zu kleiden wie die Braut?«
»Ich weiß es nur vom Hörensagen, ma chérie, aber Elisabeth von Österreich soll in eine sehr wertvolle Robe gehüllt gewesen sein, die das Brautkleid in den Schatten gestellt haben muss.«
»Oh, wie unangenehm für die Braut«, entfuhr es Catherine, und sie hielt sich entrüstet die Hand an die Lippen.
Jacon zuckte mit den Schultern. »Da Elisabeth von Österreich unsere Sprache nicht versteht, konnte sie sich mit niemandem unterhalten. Sie soll während der Trauung stumm wie ein Ausstellungsstück dagesessen haben. Aber das ist wahrscheinlich nur das dümmliche Geschwätz von irgendwelchen Weibern. Allerdings ist bekannt, dass Elisabeth wenig Freude in ihrer Ehe hat, denn ihr Mann Karl IX. soll sie auf Schritt und Tritt betrügen«, erklärte Jacon und sah seine Frau fragend an. »Kann ich nun in den Louvre fahren?«